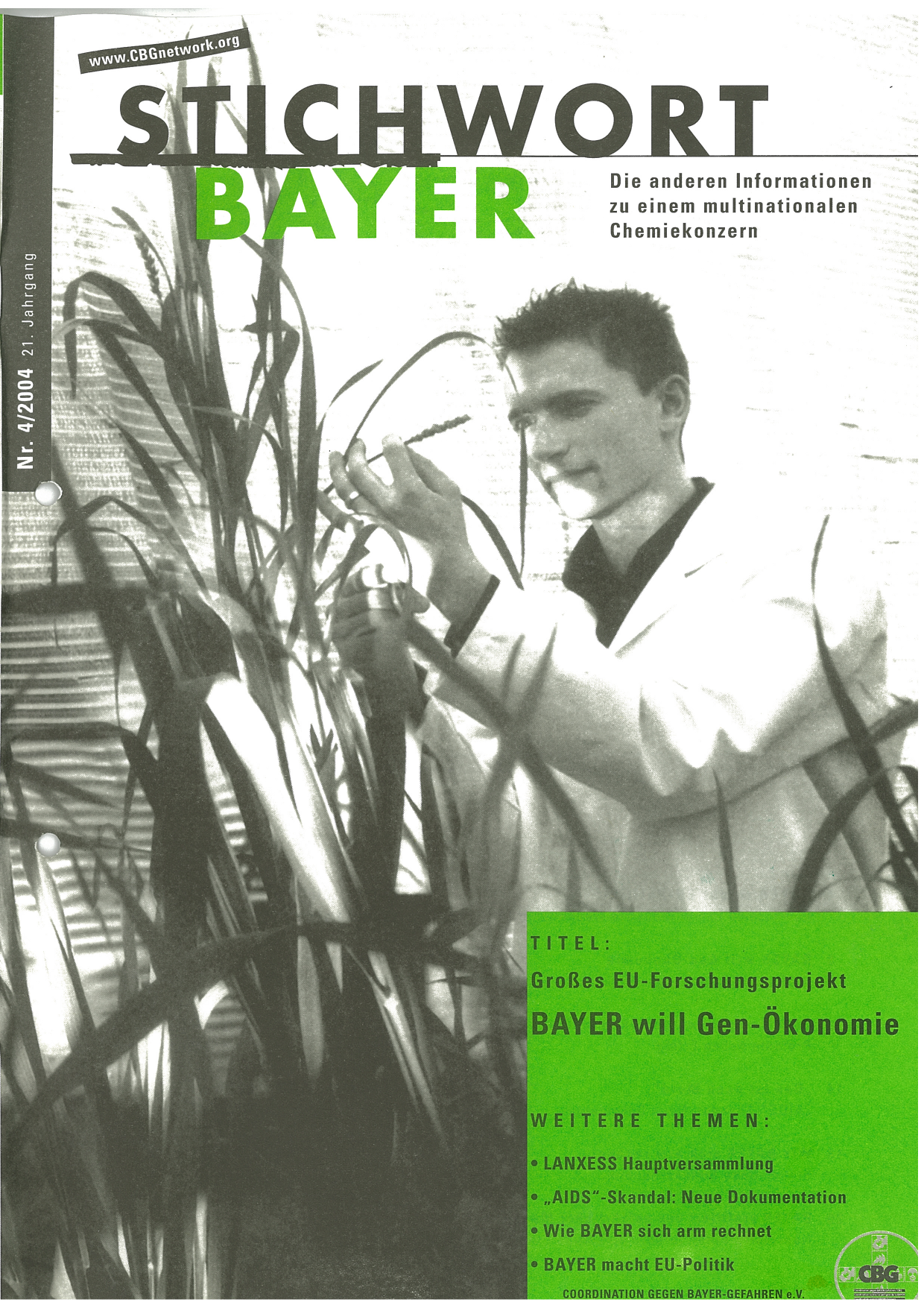20. Oktober 2004
„Verquickung von öffentlichem Dienst und wirtschaftlichen Interessen“
Offener Brief an Prof. Winnacker, Präsident DFG und Aufsichtsrat der Bayer AG
Sehr geehrter Herr Professor Winnacker,
in den vergangenen Wochen haben Sie, gemeinsam mit Kollegen und als Sprecher einer „Allianz der großen Wissenschaftsorganisationen“ (1) Front gemacht gegen die vom Deutschen Bundestag vorgeschlagene Novelle des Gentechnikgesetzes. Deshalb möchten wir uns heute an Sie wenden.
Wir schreiben dabei in einer Person an den Präsidenten der größten deutschen Wissenschafts -Förderorganisation, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das Gründungsmitglied des Europäischen Forschungs-Rates (2) und an das Mitglied des Aufsichtsrates der Bayer AG (3) und der KWS, sowie den Leiter des molekularbiologischen Laboratoriums der Universität München und den Mitbegründer und Vorsitzenden des Aufsichtsrates des deutsch-amerikanischen Gentechnologie-Unternehmens Medigene. (4)
Die Verknüpfungen dieser und weiterer Ämter und Interessen ist einer der Gründe dieses Schreibens. Für wen sprechen Sie? Für d i e deutsche Wissenschaft und deren Förderungsorganisationen? Für die interessierten Wissenschaftler, die im Bereich der Gentechnologie arbeiten, forschen und patentieren? Oder für transnationale Unternehmen, die in die Entwicklung agrar-chemischer und –gentechnischer Produkte investieren und solche auf den Markt bringen wollen?
Als Bürger, deren Steuergelder die Forschungen finanzieren, die von Institutionen wie der DFG kontrolliert werden (5), halten wir die Verquickung von öffentlichem Dienst und wirtschaftlichen Interessen in dieser Auseinandersetzung für beunruhigend. Beunruhigt sind wir aber auch in Bezug auf die öffentliche Vertretung der wissenschaftlichen Gemeinde, deren Glaubwürdigkeit durch solche Verquickungen Schaden nehmen kann.
Ihr Mitstreiter und Kollege im Aufsichtsrat der Bayer AG, Hans-Olaf Henkel, gehört als Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, der 80 Forschungsinstitute mit einem Jahresetat von nahezu 1 Milliarde Euro angehören (6), ebenfalls zu den Spitzenfunktionären der deutschen Wissenschaft. Er hat sich unlängst so ausgedrückt: „Grüne Ideologen versündigen sich an den Zukunftschancen unserer Jugend“ und verwies dabei auf die „Abschaffung der Kernkraft, nutzlose Windräder, eine kontraproduktive Ökosteuer und ein absurdes Dosenpfand“. Dann fügte er hinzu: „Zurzeit bereiten die Grünen den größten Schlag gegen die Zukunftsfähigkeit unseres Landes vor, indem sie die Gentechnik verbieten wollen“ (7). Von Ihnen lesen wir:
„Die Gegner haben es viel leichter, sie können ein Feld mit gentechnisch verändertem Mais besetzen oder zerstören. Wir dagegen verfassen eine Denkschrift.“(8) Wir halten dies nicht für den geeigneten Ton und die Grundlage einer respektvollen und ernsthaften Diskussion.
Sie schreiben, das neue Gentechnikgesetz bedeute „das Ende der grünen Gentechnik“ und gefährde „die Zukunft eines der wichtigsten Innovationszweige in Deutschland“. Insbesondere die gesamtschuldnerische und verschuldensunabhängige Haftung für Schäden, die aus der Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen (GVO), auch durch wissenschaftliche Freisetzungsversuche entstehen können, sowie die Offenlegung der Standorte werde in der Praxis zu einem Ende von wissenschaftlichen Freisetzungsversuchen führen und die Konkurrenzfähigkeit deutscher Forschung beeinträchtigen.
Dem wäre zunächst ganz praktisch entgegen zu halten, dass wissenschaftliche Freisetzungsversuche von gesamtschuldnerischer Haftung de facto nicht betroffen sind. Durch Freisetzungsversuche verursachte Verunreinigungen benachbarter Felder werden vielmehr, anders als beim Anbau kommerziell verfügbarer GVO, präzise zuzuordnen sein. Darüber hinaus haftet, wie Sie wissen und wie im Gentechnikgesetz ausdrücklich betont, für die Folgen öffentlicher Forschung ohnehin die öffentliche Hand. Geeignete und durchaus übliche Vorsorge sowie größtmögliche Sorgfalt bei Planung und Durchführung von Freisetzungsversuchen kann schließlich das Haftungsrisiko minimieren.
Von diesen Details abgesehen, fragen wir Sie: Wofür sollte nach Auffassung der wissenschaftlichen Organisationen und der führenden Agro-Gentechnik-Unternehmen in Deutschland (Bayer und KWS) die Wissenschaft denn haften? Und wer sollte Ihrer Meinung nach da haften, wo Sie nicht willens oder in der der Lage sind, den Schaden zu regulieren? Wenn Landwirte aufgrund gentechnischer Einkreuzungen ihre Produkte gar nicht oder nicht ohne Kennzeichnung als GVO verkaufen können, entsteht ihnen ein Schaden; ebenso, wenn sie zur Vermeidung solcher Verunreinigungen zusätzlichen Aufwand treiben müssen.
Auch der Gesellschaft kann Schaden entstehen, wenn Versprechungen über die Segnungen einer Technologie, in die Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln investiert werden, sich nicht einstellen, oder aber wenn die von interessierten und verantwortlichen Wissenschaftlern vorhergesagten Risiken und Folgen sich als unvollständig oder unzutreffend erweisen. Auch in diesem Zusammenhang stellt sich uns die Frage nach einer „Haftung“ der Verantwortlichen, nach der Unabhängigkeit und Redlichkeit der Wissenschaftler und nach der Risikoverantwortung der Wirtschaft.
Sie scheinen zu bedauern, dass die Gesetze der Europäischen Gemeinschaft eine besondere Risiko-Prüfung und Kennzeichnung für GVO vorschreiben und deren Verwendung im ökologischen Landbau sogar kategorisch untersagen. Wir bedauern, dass diese Gesetze die Freisetzung von GVO in die Umwelt und ihren Einsatz in der Landwirtschaft nicht schärfer regulieren. Gleichwohl muss aus unserer Sicht eine Diskussion über die Umsetzung der Gentechnik-Richtlinien und -Verordnungen der Union in Deutschland auf Basis der real existierenden europäischen Rechtsgrundlage geführt werden. Diese schreibt u.a. die Kennzeichnung von GVO und die öffentliche Registrierung von Freisetzungen zwingend vor. Sie erklärt die Wahlfreiheit der Verbraucher wie der Landwirte zu ihrem Ziel und stellt die Regulierung der zivilrechtlichen Haftungsbestimmungen mangels europäischer Zuständigkeit den Mitgliedsstaaten anheim.
Diese Rechtslage ist ein Kompromiss nach 20jähriger Debatte und trägt zumindest bedingt der Tatsache Rechnung, dass eine große Mehrheit in Deutschland und der Europäischen Union den Einsatz von GVO in Landwirtschaft und Lebensmitteln ablehnt. Wer demokratische Willensbildung, Technikfolgenabschätzung und Kontrolle nicht grundsätzlich missachtet, muss aus unserer Sicht mit diesem Kompromiss leben. Wir möchten Sie deshalb fragen, ob auch die von Ihnen repräsentierten Institutionen bereit sind, sich in diesem europäischen Rechtsrahmen zu bewegen, oder ob Sie in Wirklichkeit daran arbeiten, ihn zu untergraben.
Landwirtschafts-, Verbraucher- und Umweltorganisationen wie die unseren gehörten bisher nicht zu Ihren bevorzugten Gesprächspartnern. Vielleicht ist es an der Zeit, die Diskussion, die wir mit unseren Fragen an Sie anregen möchten, etwas zivilisierter und differenzierter zu führen. Dazu möchten wir Sie bei dieser Gelegenheit einladen: Lassen Sie uns in Berlin, wo gegenwärtig die parlamentarische Auseinandersetzung um das Gentechnikgesetz stattfindet, die von Ihnen und von uns aufgeworfenen Fragen öffentlich debattieren: Vorsorge, Koexistenz und Haftung; aber auch Glaubwürdigkeit und Interessenskonflikte der Wissenschaft und Forschung; und nicht zuletzt die Frage, welcher Innovationen die Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion in Deutschland und Europa, aber auch weltweit, tatsächlich bedarf.
Ihrer Antwort sehen wir mit Spannung entgegen und verbleiben mit freundlichen Grüßen
Benedikt Haerlin (Zukunftsstiftung Landwirtschaft) im Auftrag der unterzeichnenden Organisationen: Arbeitgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Bioland, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Bund ökologischer Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), Demeter, Foodwatch, Gen-ethisches Netzwerk (GeN), Naturschutzbund Deutschland (NABU), Naturland, Ökologischer Ärztebund (ÖÄB), Zukunftsstiftung Landwirtschaft
1 Der Alliang gehören an: Deutsche Forschungsgemeinschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, Hochschulrektorenkonferenz, Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Wissenschaftsrat. Ihre gemeinsame Erklärung „Das Ende der Grünen Gentechnik“ steht im internet unter: http:www.mpg.de/bilderBerichteDokumente/dokumentation/pressemitteilungen/2004/pressemitteilung20040917/index.html
Eine detaillierte Stellungnahme der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Gentechnikrecht steht unter:
http:www.dfg.de/aktuelles_presse/reden_stellungnahmen/2004/download/gentechnikrecht_0604.pdf
Weitere Stellungnahmen wissenschaftlicher Organisationen mit gleicher Stossrichtung wurden veröffentlicht von der Akademie der Naturforscher Leopoldina: http:idw-online.de/public/zeige_pm.html?pmid=76855 Sowie von der Union der Deutschen Akademien:
www.akademienunion.de/pdf/memorandum_ JUXHQH_JHQWHFKQLN_offener_brief.pdf
2 Das von Prof. Winnacker geleitete European Research Council soll künftig nach einem eigenen Vorschlag europaweite Forschungsförderungsmittel von mindestens 2 Milliarden Euro jährlich vergeben.
http:www.dfg.de/en/news/press_releases/2004/press_release_2004_33.html
http:www.ercexpertgroup.org/documents/ercexpertgroup_final_report.pdf
3 Der Aufsichtsrat der Bayer AG findet sich im internet unter http:www.bayer.de/geschaeftsbericht_2003/konzern/aufsichtsrat.php
Der Aufsichtsrat der Kleinwanzlebener Saat AG unter http:www.kws.de/ca/gg/xej/
Die Managementstruktur von Medigene unter http:www.medigene.de/deutsch/management.php
4 Eine Übersicht der vita und Mitgliedschaften von Prof. Winnacker findet sich im internet unter
http:www.dfg.de/en/dfg_profile/structure/statutory_bodies/executive_board/members_executive_board/ernst_ludwig_winnacker.html
5 Die DFG erhält nach eigenen Angaben im Jahre 2005 1,364 Milliarden Euro aus Mitteln des Bundes und der Länder. http:www.dfg.de/aktuelles_presse/pressemitteilungen/2004/presse_2004_34.html
6 Eine Mittelübersicht der Leibniz Gesellschaft findet sich im internet unter http:www.wgl.de/extern/organisation/zahlen.htm
7Das vollständige Interview mit Herrn Henkel im Focus-Online mit dem Titel „Die Schlampe lieben lernen“ findet sich unter http:focus.msn.de/hps/fol/newsausgabe/newsausgabe.htm?id=7333
8 Das Zitat findet sich in einem Portrait der Financial Times Deutschland vom 11.10.2004
http://ftd.de/tm/rd/1097302798147.html?nv=rs