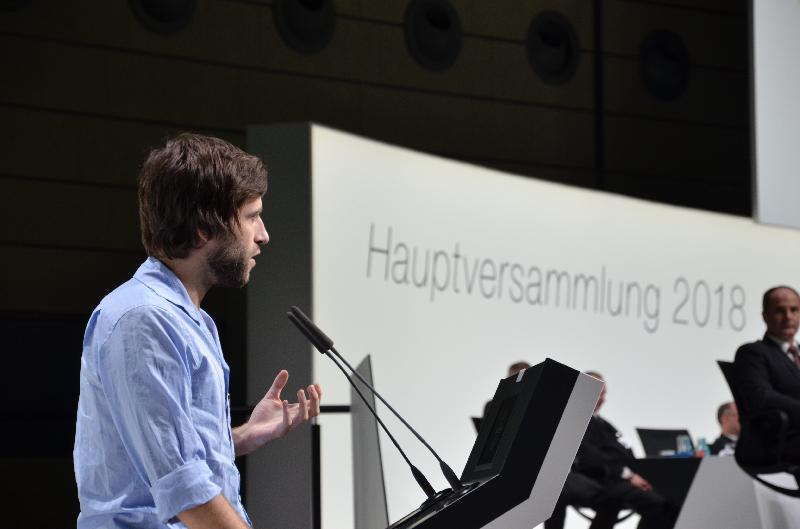Beiträge verschlagwortet als “Dhünnaue”
„DER SPIEGEL“, Ausgabe 13/92, S. 80 bis 85
Bitterfeld am Rhein
Leverkusen erlebt einen beispiellosen Chemieskandal. Bei Menschen, die auf einer Giftmüllkippe leben, häufen sich Krebserkrankungen.
Von 1968 bis 1987 hatte Bernward Prinz an der Gemeinschaftshauptschule im Leverkusener Stadtteil Wiesdorf unterrichtet. Als Werkkunstlehrer musste Prinz häufig in die Abstellräume im Keller, und da, erinnert sich der Pädagoge, „stank es schon mal“. Vor zwei Jahren, Prinz war als Konrektor an eine Kölner Schule gewechselt, spürte der 49jährige Schluckbeschwerden. Der sechste Arzt, den Prinz aufsuchte, stellte eine deprimierende Diagnose: „Tonsillen-Karzinom“, ein Krebs der Mandeln. Fünf schwere Operationen hat der Pädagoge seither durchlitten, nun erwartet er seine Zwangspensionierung.
Edwald Möller war Hausmeister an der Wiesdorfer Schule. Im Keller des Gebäudes trocknete er in seinen 20 Dienstjahren nach Rhein-Hochwassern „Pfützen mit Farben, so schillernd wie ein Regenbogen“. Hin und wieder fand der Pedell „bunte Ausblühungen hinter abbröckelndem Putz“. Im Jahr 1989, lange nach seiner Pensionierung, klagte der damals 70jährige über Schlaflosigkeit und Schweißausbrüche. Ärzte teilten dem Kranken mit, er leide an „chronisch-lymphatischer Leukämie“, einem Blutkrebs.
Der Ort, an dem Möller und Prinz jeweils 20 Jahre lang wirkten, lässt sich unwirtlicher kaum denken: Eine Aschenbahnlänge trennt die 1960 errichtete Schule an der Wiesdorfer Adolfsstraße vom dröhnenden Lärm der Autobahn Al im Norden. Im Westen schmiegen sich die Schulgebäude und ein benachbarter Kindergarten eng an den Autobahnzubringer Westring. Von Süden her grüßen die qualmenden Schlote des Chemieweltkonzerns Bayer (165000 Beschäftigte, über 40 Milliarden Mark Jahressumsatz).
An Abgase und Autolärm hatten sich die Anrainer der sogenannten Dhünnaue in Leverkusen wohl oder übel gewöhnen müssen. Einen Schock aber löste bei vielen die Mitteilung aus, dass sie gleichsam auf einer gigantischen Müllkippe hocken: einer Deponie von 68 Hektar, auf der die Bayer AG zwischen den zwanziger Jahren und 1963 Schutt, Produktionsrückstände und andere giftigen Chemiemüll abgeladen hatte.
Wie in einem „Fortsetzungsdrama ohne Ende“, sagt Marianne Hurten, Grünen-Abgeordnete im Düsseldorfer Landtag. Die Grünen-Politikerin, zugleich Betriebsrätin der Bayer-Werke, vergleicht die Dhünnaue mit der meistverseuchten Chemieregion im deutschen Osten: „Die Bitterfelder haben ihren Silbersee“, sagt sie, „in der Farbenstadt Leverkusen war alles etwas bunter - eben eine Farbkloake“.
Bereits im Mai 1989 hatte die „Beratende Ingenieursgesellschaft Dr.-Ing. Björnsen“ in einem Gutachten für die Stadt Leverkusen gefordert, die Dhünnaue südlich der Al „unverzüglich“ zu sichern und zu versiegeln: „Geeignete Maßnahmen“ seien von Nöten, um „die Kontaktmöglichkeit Mensch-Boden zu unterbinden“.
Auf dem bislang untersuchten Areal dürfe „keine landwirtschaftliche und gärtnerische Nutzung des Bodens“ mehr erfolgen. Die Altlast solle „nicht mehr als Lebensraum für Pflanzen und Tiere genutzt werden“.
Was die Bayer AG einst - im Einvernehmen mit der von ihr finanziell weitgehend abhängigen Stadt Leverkusen - alles in die Dhünnaue gekippt hat, ist heute nur noch zu erahnen. Bislang wurden lediglich Proben aus dem 25 Hektar umfassenden Gebiet südlich der Al und westlich der Schule Adolfsstraße entnommen. Allein hier hat der Chemiekonzern rund drei Millionen Tonnen Müll abgeladen.
Womöglich, warnte bereits der Düsseldorfer FDP-Landtagsabgeordnete Hans-Joachim Kühl nach Gesprächen mit Bayer-Beschäftigten, sei das „Gefährdungspotential“ der Dhünnaue-Deponie größer als die Bedrohung durch die Gifte „in der Erde von Bitterfeld“. Diese Befürchtung hätten ihm Mitarbeiter der Umweltschutzabteilung von Bayer anvertraut.
Die vom Ingenieurbüro Björnsen ausgewerteten Boden- und Wasserproben stützen das Szenario von einem Bitterfeld am Rhein: „Im Oberboden“ der Deponie fanden sich „auffällig hohe Konzentrationen“ von Schwermetallen und giftigen organischen Verbindungen wie Chlorbenzole, Chlortoluole und polychlorierte Biphenyle.
Der „eigentliche Deponiekörper“ ist sogar „mit einem erweiterten Spektrum an Schadstoffen und in deutlich höheren Konzentrationen belastet“; die giftigen Schwermetalle Chrom und Blei finden sich in schier unglaublichen Konzentrationen (22 beziehungsweise 34 Gramm je Kilogramm - g/kg), für Chlorbenzole wurden Werte bis zu 45 g/kg gemessen.
Das Grundwasser ist im gesamten Untersuchungsbereich durch deponiebürtige Stoffe deutlich belastet; „Kratzproben von Kellerfußböden in den Häusern der Siedlung Rheinallee belegen, dass die Deponie ihr Gift gleichsam ausschwitzt - nachgewiesen wurden Blei (21 g/kg), Chrom (20 g/ kg) und eine ganze Palette giftiger organischer Verbindungen.
Die Luft nahe dem Boden “außerhalb bebauter Flächen„ weist “relative Konzentrationen„ von Schadstoffen wie Benzol auf; im Laub von Pflanzen wurden “erhöhte Gehalte„ an Schwermetallen wie Blei, Chrom, Arsen und Cadmium entdeckt. “Mehr als 20„ der 57 in den Proben nachgewiesenen “Stoffe bzw. Stoffgruppen„ gelten als “kanzerogenverdächtig„ oder sind sogar “nachgewiesenermaßen krebserregend„.
Vollends zum Skandal wird der Fall Dhünnaue durch den Umstand, dass, allen Warnungen zum Trotz, noch immer 106 Familien auf der Giftmüllkippe zwischen Rhein und Al leben - in Häusern, die zwischen 1952 und 1953 errichtet wurden.
Und: Nach wie vor unterrichten Lehrer ihre Schüler an der Gemeinschaftshauptschule Adolfsstraße, tummeln sich Pennäler auf dem Schulhof, bringen Eltern ihre Kinder in den benachbarten Kindergarten. Den Betroffenen, so beschwichtigte noch vor vier Wochen der SPD-Landtagsabgeordnete Ludgerus Hovest, sei durch das “Verbreiten von Horrorgemälden„ nicht geholfen.
Nötig, so der SPD-Politiker, sei vielmehr die “Analyse des Problems, das Aufzeigen von Lösungen und deren Umsetzung„. Die “Altlast Dhünnaue„, bestätigte SPD-Umweltminister Klaus Matthiesen die Sicht des Genossen Hovest, sei “ein hochkomplexer und schwieriger Fall, zu dem es bundesweit bisher kaum eine Parallele gibt„.
Ruchbar wurde der Umweltskandal 1987, als für einen Teil der Dhünnaue zu Planungszwecken eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgenommen wurde. Damals waren, unter anderem in Kellerräumen der Schule, alarmierende Konzentrationen von Giften wie Xylol entdeckt worden.
Was seither geschah, liest sich wie eine Chronik des Versagens: Die Stadt reagierte auf die Xylol-Funde von 1987 lediglich mit ein paar Empfehlungen -die Gartennutzung müsse eingeschränkt werden, Kinder dürften nicht mehr auf den Wiesen der Dhünnaue spielen, unbefestigte Wege und Freiflächen wurden mit einem “Begehungsverbot„ (Ordnungsstrafe: 200 Mark) belegt.
Im Februar 1988 bekannte sich Bayer zu seinen Altlasten und gelobte, sich an der Sanierung der Deponie zu beteiligen. Einen Monat später verlangten Leverkusener Ärzte, die Bewohner der Deponie aus medizinischen Gründen umgehend umzusiedeln. Juni desselben Jahres begann der medizinische Gutachter Hans Joachim Einbrodt mit der Untersuchung von 828 Betroffenen. Im Februar 1989 wurden Kinder aus der Adolfsstraße erneut überprüft.
Ergebnis: 25 Prozent der Probanden von 1988 wiesen “auffällige Befunde„ des Blutbildes auf. Bei 16 Prozent der untersuchten Schüler fanden sich Veränderungen am Blutbild. Eine “akute„ Gefährdung der Betroffenen vermochte der Gutachter zwar nicht zu erkennen, er riet gleichwohl dazu, die Schule zu schließen. Denn über eine mögliche “chronische Gefährdung der Probanden„, so Einbrodt, könne er keine Aussagen machen.
Im Februar 1990 mahnte schließlich auch das Gesundheitsamt die Politiker, “die Einrichtung Schule und Kindergarten aus Vorsorgegründen„ zu verlegen - doch wieder geschah nichts.
Den meisten Lehrern und Schülern der Adolfsstraße dämmerte erst später, in welchem Maße ihre Gesundheit womöglich durch die Giftmülldeponie bedroht wird. Letztes Jahr, so erinnert sich Barbara Ulbricht, Lehrerin der Schule Adolfsstraße, sei ein kranker Kollege von der Schulaufsicht angerufen worden: Er möge sich doch, wurde dem Pädagogen mitgeteilt, “mal vom Amtsarzt untersuchen lassen„.
Im Dezember letzten Jahres schließlich erfuhren die Lehrkräfte, dass es an ihrer Schule in den letzten 15 Jahren insgesamt 15 Krebserkrankungen gegeben habe, darunter fünf mit tödlichem Ausgang - weit mehr, als statistisch zu erwarten gewesen wäre. Und jetzt erst, so bestätigte die Staatsanwaltschaft Köln, wird “in Sachen Schule Adolfsstraße„ wegen des Verdachts der Gesundheits- und Körperverletzung ermittelt.
“Patentrezepte„, beschwichtigt nun die Stadt Leverkusen die verbitterten Bewohner und Anrainer der Giftdeponie am Rhein, habe es “für die Dhünnaue leider nicht gegeben„. Immerhin, lobten die Kommunalverwalter ihr eigenes Engagement, seien von den 259 Familien der Siedlung Rheinallee “heute 156 versorgt„ mit neuem Wohnraum; Ende dieses Monats “sollen es 189 sein„. Bis zum Oktober, verspricht die Stadt, werde “das Kapitel „neue Wohnungen“ abgeschlossen„ sein.
Ein anderes Kapitel des Skandals ist noch nicht einmal angegangen worden: Zwei Tage vor Weihnachten 1989 hatte die Firma Bayer, festtäglich gestimmt, versprochen, das Gelände mit ihrer Müll-Altlast mittels einer Spundwand abzusichern - geschätzte Kosten: 150 Millionen Mark.
Doch bis zum heutigen Tag ist nicht eine einzige Stahlplanke von der versprochenen Spundwand eingerammt worden. Dabei warnen Experten, dass Deponiegifte schon bei mittlerem Rheinwasserstand mit dem Grundwasser ins Landesinnere geschwemmt und bei ablaufendem Rheinwasser in den Strom gesogen werden.
Insgesamt zehn Verträge sind bislang zwischen der Bayer AG und der Stadt Leverkusen abgeschlossen worden. Dieser von der Stadt so genannte “partnerschaftliche„ Weg wurde eingeschlagen, weil es, wie Minister Matthiesen erläutert, “wegen der Unklarheit der Rechtslage nicht erfolgversprechend erschien„, gegen den Konzern mit “Ordnungsverfügungen vorzugehen„.
Zu den Betroffenen, die unter dem Hickhack leiden, zählen auch die Bewohner eines Altenheimes am Rande der Deponie. “Über den Fortbestand des Altenwohnheims„, so die Stadt, werde “in nächster Zeit in Abstimmung zwischen allen Beteiligten" eine Entscheidung gefällt.
Vor den Alten sind die Haustiere evakuiert worden: Der Verein für Deutsche Schäferhunde e.V., der das Gebiet der Deponie lange Zeit als Klub- und Übungsgelände nutzte, hat das giftbelastete Areal bereits verlassen.
Gartenkunst am Giftmüll
Am 16. April 2005 öffnete die Leverkusener Landesgartenschau (LAGA) ihre Pforten und lockte die BesucherInnen mit dem Slogan „Neuland entdecken“ auf das Gelände. Für die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) und andere Gruppen war das kein Grund zum Feiern, sondern zum Protestieren. Was nach Ansicht von Konzern und Stadt den krönenden Abschluss der Abdichtungsarbeiten an BAYERs Giftmüll-Deponie bildete, erschien den KritikerInnen nämlich als plumper Versuch, Gras über eine nach ökologischen Kriterien unzureichende Bau-Maßnahme wachsen zu lassen.
Ein buntes Völkchen hatte sich am Eröffnungstag der LAGA vor dem Haupteingang versammelt, um auf die unter der Grasnarbe tickende chemische Zeitbombe hinzuweisen: CBGler, Antifas in weißer Schutzkleidung, DKPler mit Gasmaske, die BUND-JUGEND, AnhängerInnen des Leverkusener Wahlbündnisses LAUF, MLPDler und Unabhängige. Der Polizei wurde es schon bald zu bunt. Sie wollte die COORDINATION mit ihrem Transparent „Neuland entdecken - Giftmüll verstecken“ außer Sichtweite der BesucherInnen auf die gegenüberliegende Straßenseite verbannen, wovon die OrdnungshüterInnen erst zähe Verhandlungen abbrachten. Der Theatergruppe der BUND-JUGEND wiesen sie einen Platz zwischen Nebeneingang und Parkplatz zu. Diese Maßnahme hatte allerdings einen unerwünschten Nebeneffekt. Nicht wenige Gartenschaulustige hielten die pantomimische Darbietung über die Stadt, den BAYER-Müll und den Tod nämlich für einen Teil des offiziellen Rahmenprogramms.
Aber da hatten sie BAYER und Leverkusen zuviel Kritikoffenheit zugetraut. Sie verfolgten mit der LAGA ganz andere Pläne. „Die Leute sollen Frieden mit dem Gelände schließen“, diese Intention verfolgt die Schau laut ihrem Geschäftsführer Hans-Max Deutschle. Leverkusens SPD-Oberbürgermeister Ernst Küchler sah in Blumen, Bäumen und Beeten sogar ein Zeichen dafür, dass BAYERs Hometown keine reine Industriestadt mehr sei und beim Strukturwandel auf einem gutem Weg. Der damals noch amtierende NRW-Ministerpräsident Peer Steinbrück stimmte ihm in seiner Eröffnungsrede zu und lobte, mit der LAGA sei „auf einer der größten Altlasten Europas im wahrsten Sinne des Wortes attraktives Neuland‚ entstanden“. Bärbel Höhn machte im Spätherbst ihrer Zeit als Landesumweltministerin sogar ein neues „Naherholungsgebiet“ aus.
Allzu nah durfte mensch ihm jedoch nicht kommen, dann entpuppten sich die Grünflächen nämlich als potemkinische Dörfer. Auf sehr unsicherem Grund entfaltete sich die Blumenpracht. Die LandschaftsgärtnerInnen konnten keine Bäume mit tiefem Wurzelwerk einpflanzen, weil dieses bis in den Giftmüll gereicht hätte. Teilweise mussten sie bis zu acht Meter hohe Erdschichten aufschütten, um den Blumen festen, guten Mutterboden unter ihren Lebensadern zu gewähren - Natur mit beschränkter Haftung. Hochbauten gestattete die LAGA-Direktion ebenfalls nicht, und Außengastronomie nur in Leichtbauweise. Es sollten auf keinen Fall schwere Fundamente auf die Altlast drücken und so eventuell die schlafenden Chemie-Geister wecken oder den unter der Erde verlegten Versorgungsleitungen der BAYER-Anlagen in die Quere kommen.
Oberirdisch setzt das nur wenig einladende Panorama aus Überlandleitungen und Produktionsstätten des Konzerns dem „Naherholungsgebiet“ enge Grenzen. Auf dem Areal selber stören seltsame Apparaturen, nur unzureichend mit „Kunst“ verkleidet, den Gartenkunst-Genuss. Sechs Brunnen haben auf der LAGA die Aufgabe, den Pegelstand des Wassers zu kontrollieren, bei Erreichen einer bestimmten Marke könnte der Rhein sonst die Produktionsabfälle unterspülen und die Gifte ausschwemmen. Große Messstationen ermitteln überdies permanent, ob sich die Belastung des Grundwassers noch in den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen hält.
Eine Jahrhundert-Aufgabe: „Wie sich das Gelände innerhalb der nächsten 100 Jahre verhalten werde, sei allerdings nicht gänzlich vorherzusehen“, räumt der LAGA-Landschaftsarchitekt Rüdiger Brosk denn auch ein. Die Waz eröffnet ebenfalls wenig schöne Aussichten: „Setzungspegel und Grundwasserkontrollen wird es hier auf ewig geben“. Zwischen Chrom, Chlor & Co. stimmt die Chemie nämlich immer noch - sie reagiert munter miteinander drauflos. Darüber hinaus bilden sich durch Abbauprozesse neue giftige Gase. Dementsprechend sieht das Sickerwasser der Altlast aus. 750 Kubikmeter muss BAYER stündlich abpumpen und im Klärwerk reinigen.
Um ein „Work in Progress“ handelt es sich bei der Dhünnaue also, weil Konzern und Stadt das Areal nicht sanierten, sich stattdessen für eine bloße Absicherung der Altlast entschieden. Den Unterschied erläuterte Klaus Stief vom Umweltbundesamt 1988 auf einem Umweltschutz-Forum in Köln. „Unter Sanierungsmaßnahmen versteht man Maßnahmen, die zu einer Beseitigung des Gefährdungspotenzials der Altlast führen. Unter Sicherungsmaßnahmen werden Maßnahmen verstanden, welche die Gefährdung der Umwelt vermindern oder auch zeitlich befristet unterbinden, die allerdings das Gefährdungspotenzial nicht beseitigen. Man erreicht einen Zeitgewinn. Irgendwann, in der Regel innerhalb von Jahrzehnten, werden die Sicherungsmaßnahmen unwirksam werden. Man wird sie wiederholen müssen“, führte er in seinem Vortrag aus. Aber das verdrängen die Verantwortlichen laut Stief nur allzu gern. „Obwohl durch die Wahl des Wortes Sicherungsmaßnahmen‘ im Gegensatz zu dem Wort Sanierungsmaßnahmen‚ jedermann die zeitlich befristete Wirksamkeit und die ständige Unterhaltungs- und Reparaturbedürftigkeit der Maßnahmen klar werden soll, neigt man in der Praxis wohl immer dazu zu hoffen, dass man das Altlastenproblem vom Halse‘ hat, wenn sie gesichert ist. Das wird sich in der Regel irgendwann einmal als verhängnisvoller Irrtum herausstellen“, stellt der Diplom-Ingenieur fest.
Da hat der Experte die LAGA-Lage richtig erfasst. Im Katalog zur Ausstellung, die sich auf der Gartenschau der Geschichte der Dhünnaue und ihrer Abdichtung widmet, heißt es lapidar: „Aufwändige Technik löst das Altlast-Problem“. Eine Sanierung war nach BAYERs Ansicht nicht möglich. „Aufgrund der früher üblichen ungeordneten Ablagerung der überwiegend festen und im geringen Maße auch pastösen und flüssigen Abfälle sind die Belastungen sehr ungleichmäßig verteilt. Eine gezielte Sanierung einzelner Teilbereiche kommt deshalb nicht in Frage“, schreiben die AusstellungsmacherInnen. Eine glatte Lüge, wie ein Blick auf die Schweizer Deponie Kölligen beweist. 350.000 Tonnen Gefahrgut lagerten dort ein - und Giftmüll-Trennung betrieben die „Entsorger“ ebenso wenig wie in Leverkusen. Trotzdem entschieden sich die Verantwortlichen für eine Komplett-Sanierung mit Auskofferung des verseuchten Areals - und mussten es auch. Die Gesetze des Landes untersagen nämlich Baumaßnahmen, die den Giftaustritt nicht stoppen und als „Langzeit-Provisorien“ eine jahrhundertelange Überwachung erfordern. So kann sich die Schweiz freuen, schon im Jahr 2025 keine gefährlichen Zeitbomben mehr im Boden ticken zu haben.
In der Bundesrepublik sträubten sich BAYER & Co. stets aus Kostengründen gegen eine solche ökologisch sinnvolle Lösung. Einer genaueren Überprüfung halten ihre Argumente indes nicht stand. Sicherungsmaßnahmen erfordern zwar am Anfang keinen so hohen finanziellen Aufwand wie Sanierungsmaßnahmen, rechnet man aber die bei „Langzeit-Provisorien“ anfallenden Betriebs- und Reparaturkosten hinzu, so halten sich die Ausgaben in einem vergleichbaren Rahmen. Allein für die Reinigung des Sickerwassers muss BAYER jährlich einen Millionen-Betrag aufbringen. Was bei der Dhünnaue noch so alles an Ausgaben anfallen könnte, weiß niemand genau, denn Langzeituntersuchungen über die Beständigkeit des verbauten Materials existieren nicht, und viele Entwicklungen sind nicht vorhersehbar. So musste die Stadt Hamburg 1994 unvermittelt bei der bloß gesicherten Altlast auf dem Gelände der ehemaligen Waffenfabrik STOLZENBURG „nachbessern“, weil das nahe gelegene Wasserwerk die Trinkwasser-Gewinnung drosselte und der Grundwasser-Spiegel sich in der Folge gefährlich nah an die giftigen Produktionsrückstände heranschob.
Über diese ganze Problematik findet sich im Katalog zu der LAGA-Ausstellung „Die Dhünnaue gestern und heute“, die „eine offene Chronik über Fortschritt und Verantwortung“ sein will, nichts. Es fängt schon schlecht an. Der Konzern hat angeblich nicht nur nach dem Motto „Nach mir die Sintflut“ sorglos seine Abfälle am Rhein entsorgt, er wollte der Stadt damit auch einen wirksamen Hochwasserschutz bieten. Dass die „gute Tat“ vielleicht doch nicht so gut für Leverkusen war, stellte sich laut Text erst Ende der achtziger Jahre heraus. „Ende 1987 steht fest: Eine Gefährdung der Bewohner in der Wiesdorfer Dhünnaue kann nicht ausgeschlossen werden“. Aber selbst dann ist alles nur halb so schlimm, denn die Wissenschaft hat festgestellt: „Insgesamt kann eine akute Gefährdung der Bevölkerung mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden“. Der Herr Professor Einbrodt von der Universität Aachen war so nett. Vorher hat es nach Aussage von BAYER nur einige Klagen wegen Geruchsbelästigung gegeben und „unerwartete Schwierigkeiten“ im Zuge der geplanten Wohnbebauung über der Deponie. Eine Baugrund-Untersuchung meldete nämlich Zweifel daran an, ob der Beton dem chemischen Untergrund standhalten würde und sagte zudem eine Absenkung der Häuser voraus. Sie sollte Recht behalten. Später ergaben Messungen eine hohe Chrom-Belastung von Kellern. Die Stadt Leverkusen quartierte die Mietparteien um und schloss eine Schule. Nach Darstellung der AusstellungsmacherInnen geschah das alles nur „vorsorglich“. Die ungewöhnlich hohe Krebsrate im Umfeld der Schule - laut SPIEGEL fünf Tote, 15 Erkrankungen - verschwiegen sie.
Nicht nur diese Fälle hätten genug Grund für Entschädigungsklage geboten. Die Erleichterung darüber, dass „die Stadt Leverkusen und die BAYER AG juristischen Streit vermieden haben und sich in allen Fragen auf partnerschaftliche Lösungen verständigten“, ist den Konzern-AutorInnen deshalb deutlich anzumerken. Sie vermelden in Sachen Dhünnaue „Mission erfüllt“ und meinen so „eine Voraussetzung für die nachhaltige Entwicklung der Stadt“ geschaffen zu haben. Das Einzige, was sich auf dem Areal jedoch nachhaltig entwickelt, ist die Last der Altlast für die nachfolgenden Generationen.
Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates,
sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
mein Name ist Ulla Krajewski, und ich spreche für die CBG e.V.
Vor einem Jahr habe ich zum Thema Dhünnaue gesprochen, denn damals wurde noch geplant, die A1 abzureißen und 8spurig neu zu bauen, indem die Brückenpfeiler in Europas größte Giftmülldeponie getrieben werden, ein Unterfangen mit unkalkulierbaren Risiken. Heute ist der erste Spatenstich schon Geschichte, allerdings ist die öffentliche Diskussion zu diesem einmaligen Risikounternehmen nicht verstummt, sondern der dlf hat sogar der Dhünnaue und dem Autobahnneubau eine Reportage gewidmet. Darum habe ich dieses Thema erneut gewählt.
Im letzten Jahr waren Ihre Antworten auf meine ernstgemeinten Fragen ausweichend und teilweise unverschämt, als wüsste ich noch nicht einmal, dass Covestro nicht mehr zum Bayer-Konzern gehört. Ich verstehe, dass meine Fragen Ihnen unangenehm waren, und dennoch bitte ich Sie, heute im Rahmen Ihrer gesetzlichen Pflichten Auskunft zu geben, auch im Respekt vor den Aktionärinnen und Aktionären, die bis jetzt ausgehalten haben, um sich ein möglichst detailliertes Bild von der Geschäftstätigkeit und ihren Auswirkungen zu machen.
Leider muss ich mich äußerst kurz fassen. Die Dhünnaue ist mit vielen gravierenden Problemen behaftet. Es lagern dort fast 1 Mio. Tonnen hochtoxischer Produktionsückstände aus 50 Jahren, deren konkrete Zusammensetzung niemand kennt. Diese Stoffe sind z. T. hochreaktiv, so dass sich die chemische Zusammensetzung dieser Deponie stetig und unvorhersehbar verändert. „Et hätt noch immer jot jejange“ , würde der Kölner sagen. Wenigstens wurde die Deponie provisorisch gesichert, d. h. an den Seiten und an der Oberfläche abgedichtet, allerdings nicht im Untergrund, so dass stündlich 750 qm giftiges Sickerwasser abgepumpt und gereinigt werden müssen.
Durch die Autobahnbaustelle hat sich diese Situation noch wesentlich verschärft: Die Oberflächenabdichtung wird am Ort der Arbeiten entfernt und durch ein Leichtbauzelt ersetzt.
Ich frage Sie: Was gedenken Sie im Falle einer Explosion zu tun, wenn dieses Zelt hinweggefegt wird? – Sie werden ganz richtig bemerken, dass dieser Teil der Dhünnaue nicht mehr in Ihren Haftungsbereich fällt, sondern von Straßen.NRW, also der öffentlichen Hand. Das mag fast unglaublich klingen, ist jedoch wahr. Aber es wären ja dann in dem Falle, den wir alle nicht erleben wollen, möglichst viele Menschenleben zu retten und möglichst weiterer Schaden von der Umwelt in diesem äußerst dicht besiedelten Gebiet abzuwenden. Gibt es denn irgendwelche Notfallpläne oder Vorkehrungen, die Straßen.NRW bekanntgegeben wurden? Oder soll es so laufen wie z. B. 2008 im USamerikanischen Institute, wo Sie von den Behörden händeringend um Informationen angegangen wurden, Sie jedoch nur abgewiegelt und abgestritten haben?!
Meine 2. Frage betrifft den Thema Klimawandel, der ja mittlerweile unübersehbar begonnen hat und leider nicht mehr zu stoppen, sondern im günstigsten Falle nur noch zu bremsen wäre: Die Konstruktion des permanenten Abpumpens und Reinigens des giftigen Sickerwassers funktioniert ja nur, wenn der Rheinspiegel einigermaßen stabil bleibt, d. h. der Rheinwasserpegel nicht zu schnell abfällt, was allerdings im letzten Sommer vermutlich geschehen ist, oder keine Jahrhundertflut passiert, worauf wir uns für die Zukunft jedoch leider fast sicher einstellen müssen. Was gedenkt Bayer angesichts dieser Gefahren für Anwohner und Umwelt zu tun? Gibt es hier Forschung, und gibt es eine Abteilung, die neue Lösungen entwickelt? Wenn ja, wie viele Mitarbeitende werden mit diesen Zukunftsfragen betraut?
Meine 3. Frage betrifft den Verkehr am Standort Leverkusen, aber auch an den anderen Standorten in NRW: Tut Bayer etwas zur Verminderung der mit der Produktion zusammenhängenden Verkehrsströme, wird hier investiert, geforscht oder entwickelt? Nicht nur Pendler klagen, dass die Infrastruktur mit dem unaufhörlich steigenden Verkehrsaufkommen hoffnungslos überfordert ist, nicht nur Anwohnerinnen klagen über die schlechte Luftqualität und drohende Fahrverbote, auch viele Stimmen aus der Wirtschaft befürchten, dass der Verkehr der neue Flaschenhals unserer Wirtschaftsentwicklung werden könnte.
Die Redezeit ist um.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Falls auch Sie als Aktionäre mit der Geschäftspolitik des Konzerns in Sachen Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Menschenrechte nicht einverstanden sind, dann stimmen Sie bei allen Abstimmungen mit „nein“. Falls Sie diese Versammlung vorzeitig verlassen, haben Sie das Recht, Ihre Stimmrechte zu übertragen. Dazu können Sie Ihren Stimmkartenblock an uns kritische AktionärInnen hier vorne links von Ihnen aus gesehen abgeben.