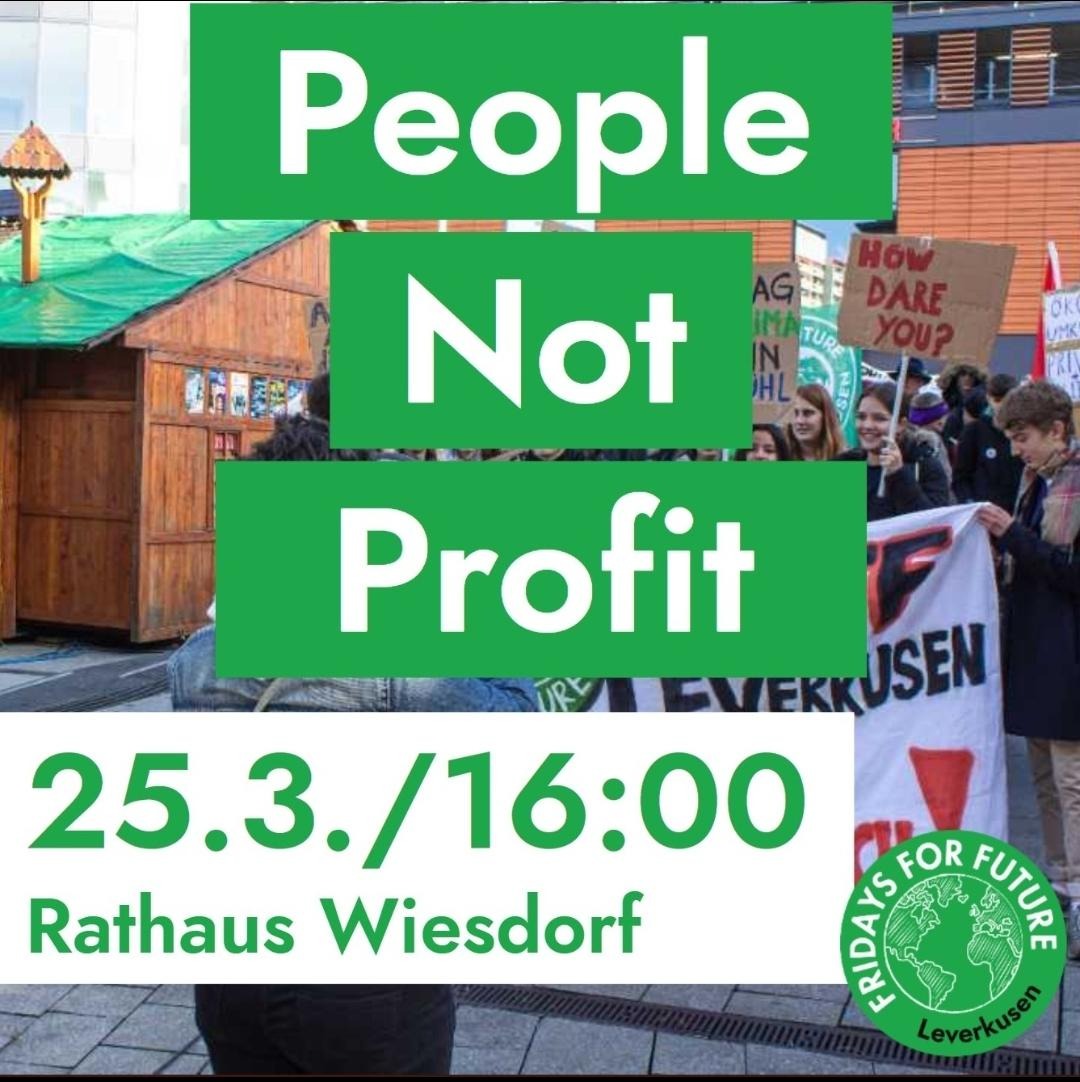wissenschaftlich-humanitäres komitee (whk)
Mehringdamm 61
10961 Berlin
www.whk.de
Pressemitteilung vom 2. März 2005
Pharma-Gigant BAYER: AIDS-Leichen im Keller
Konzern will „AIDS bekämpfen“ und wirbt mit Homopaar „for a better Life“/ whk: Unternehmen trägt Mitschuld an tausendfachem AIDS-Tod
Mit einem Schwulenpaar wirbt der BAYER-Konzern derzeit in halbseitigen Tageszeitungsinseraten für seine Diagnosemethode zur Resistenzbestimmung bei HIV. Hierzu erklärt das wissenschaftlich-humanitäre komitee (whk):
Offenbar hocherfreut über profitverheißende Meldungen zu medikamentenresistenten HIV-Virenstämmen schaltet der weltweit agierende BAYER-Konzern derzeit - unter anderem in der Tageszeitung Die Welt vom 1. März - halbseitige Werbeanzeigen mit einem aneinandergeschmiegten Männerpaar. Unter dem Slogan „Diagnostik verbessern - AIDS bekämpfen“ verspricht der Konzern dabei unter anderem „Science for a better life“.
Vollständig heißt es im Anzeigetext: „AIDS ist weiterhin weltweit auf dem Vormarsch. Alle sechs Sekunden infiziert sich ein Mensch mit HIV. Alle zehn Sekunden stirbt ein Mensch an AIDS. Weltweit gibt es bereits 42 Millionen infizierte Menschen. HIV ist ein tückisches Virus, da es immer neue Formen annimmt und deshalb schnell gegen Medikamente resistent wird. Daher hat BAYER Health Care eine neue Diagnostik entwickelt - eine Methode zur HIV-Resistenzbestimmung. Ein wichtiger Schritt, um Patienten gezielter und individueller helfen zu können.“
Für das whk sind diese Äußerungen blanker Hohn. Es ist allgemein bekannt, daß sich BAYER aus der Erforschung wirksamer Medikamente gegen HIV und AIDS weitgehend zurückgezogen hat. Wenn der Konzern nun schwulen Männern, die in den westlichen Industriestaaten nach wie vor am meisten von AIDS betroffen sind, ausgerechnet die Methode der Resistenzbestimmung nun als wichtigen Schritt gezielter und individueller „Hilfe“ verkaufen will, ist das mehr als zynisch.
Vor dem Hintergrund des von BAYER-Medikamenten verursachten weltweiten AIDS-Skandals bekommt die Anzeige sogar den Charakter einer regelrechten Desinformationskampagne. Es sei daran erinnert, daß mit HIV- und Hepatitis-C-Viren verseuchte Medikamente der hundertprozentigen BAYER-Tochter CUTTER seit Beginn der 80er Jahre Tausende von Menschen mit der Bluter-Krankheit das Leben gekostet haben. Anstatt seine verseuchten Medikamente im Sondermüll zu entsorgen, hatte das BAYER-Unternehmen sie seinerzeit massenweise zur Medikation nach Asien, Südamerika und Europa verhökert. In einzelne asiatische Länder wurde AIDS nachweislich erst durch BAYER-Medikamente eingeschleppt, die Krankheit war dort vorher nicht aufgetreten. Während sich damals Firmenmanager in Japan bei den AIDS-Opfern und deren Angehörigen entschuldigen mußten, warten die meisten von BAYER verursachten AIDS-Opfer bis heute vergeblich auf Entschädigung.
Es ist längst erwiesen, daß BAYER um die Gefährlichkeit seiner verseuchten Produkte wußte und die hochinfektiösen Medikament aus reiner Profitgier an ahnungslose Abnehmer verkaufte. Entsprechende Dokumente waren am 27. September 2004 unter anderem in der WDR-Sendung „Tödlicher Ausverkauf“ zu sehen. Auch das in Deutschland ansässige konzernkritische Netzwerk „Coordination gegen BAYER-Gefahren“ (CBG) und die New York Times haben bereits mehrfach über Hintergründe berichtet. Das whk erinnert daran, daß BAYER-Produkte zahlreiche Bluter auch in Deutschland und Frankreich mit HIV infizierten. In Frankreich war es deswegen Mitte der 80er Jahre sogar zu einer Regierungskrise gekommen. Gesundheitsminister Laurent Fabius mußte seinerzeit zurücktreten, zwei Beamte des Gesundheitsamtes wanderten sogar in den Knast. In Deutschland hat sich BAYER bislang weder bei seinen Opfern entschuldigt, noch sind BAYER-Manager je juristisch zur Rechenschaft gezogen worden.
Das Sündenregister von BAYER ist bekanntlich viel länger. Weil BAYER immer wieder die Gefährlichkeit seiner nicht nur von Pharma-Produkten wie dem Cholesterin-Senker Lipobay verschwieg, war der Global Player in den Jahren 2001 und 2004 bereits zwei Mal auf Liste der „zehn übelsten Unternehmen“ des von dem US-Bürgerrechtler Ralph Nader herausgegebenen Magazins Multinational Monitor BAYER gelandet. Demnach hatte der Chemie-Riese das US-Gesundheitsprogramm „MedicAid“, das die Arzneiversorgung von sozial Schwachen organisiert, durch fingierte Rechnungen um Millionen-Summen betrogen. Nach Angaben der CBG verzögerte die US-Gesundheitsbehörde im Jahr 2003 wegen möglicher Gesundheitsgefährdungen die Zulassung der Potenzpille Levitra, die BAYER in den USA zusammen mit dem ebenfalls im Bereich AIDS und HIV aktiven Unternehmen GlaxoSmithKline vermartet. Und Entschädigungsklagen jüdischer KZ-Opfer, die durch BAYER-Präparate in Birkenau und Auschwitz unfruchtbar gemacht worden waren, hat das Unternehmen immer wieder abgeschmettert.
In dem vor zwei Jahren erschienenen „Schwarzbuch der Markenfirmen“ bescheinigen dessen Verfasser dem Konzern unumwunden, BAYER bleibe „unangefochten“ an der Spitze der „bösen Konzerne“ und dies „nicht nur weil BAYER in allen Geschäftsfeldern - Chemie, Pharmazie, Agrobusiness und Rohstoffgewinnung - eine destruktive Phantasie an den Tag legt, was die Mißachtung ethischer Prinzipien betrifft“, sondern auch, „weil BAYERs Kommunikationspolitik offenbar im 19. Jahrhundert stecken geblieben ist. Da wird vertuscht, daß einem die Haare zu Berge stehen.“ (www.markenfirmen.com)
Das whk fordert nunmehr die kommerzielle Szenepresse dringend auf, ihren letzten Rest an Glaubwürdigkeit nicht durch die Annahme potentieller Anzeigenaufträge des BAYER-Konzerns mutwillig zu verspielen. Die verlogene und im Kern homophobe BAYER-Werbung gehört nicht in die Blätter schwuler Emanzipation. Ärzte und medizinisches Personal sollten prüfen, ob sie bei der Diagnose und Behandlung von HIV-Infizierten auf gleichartige Produkte anderer Firmen zurückgreifen können.
Das whk ruft die Szene zu Protesten gegen die Werbekampagne auf.
Rückfragen: 0162/6673642 (Dirk Ruder)