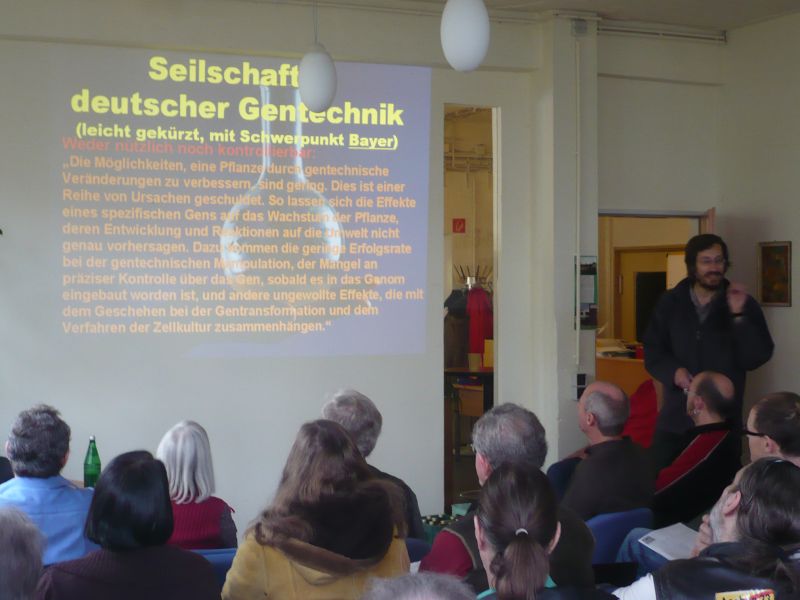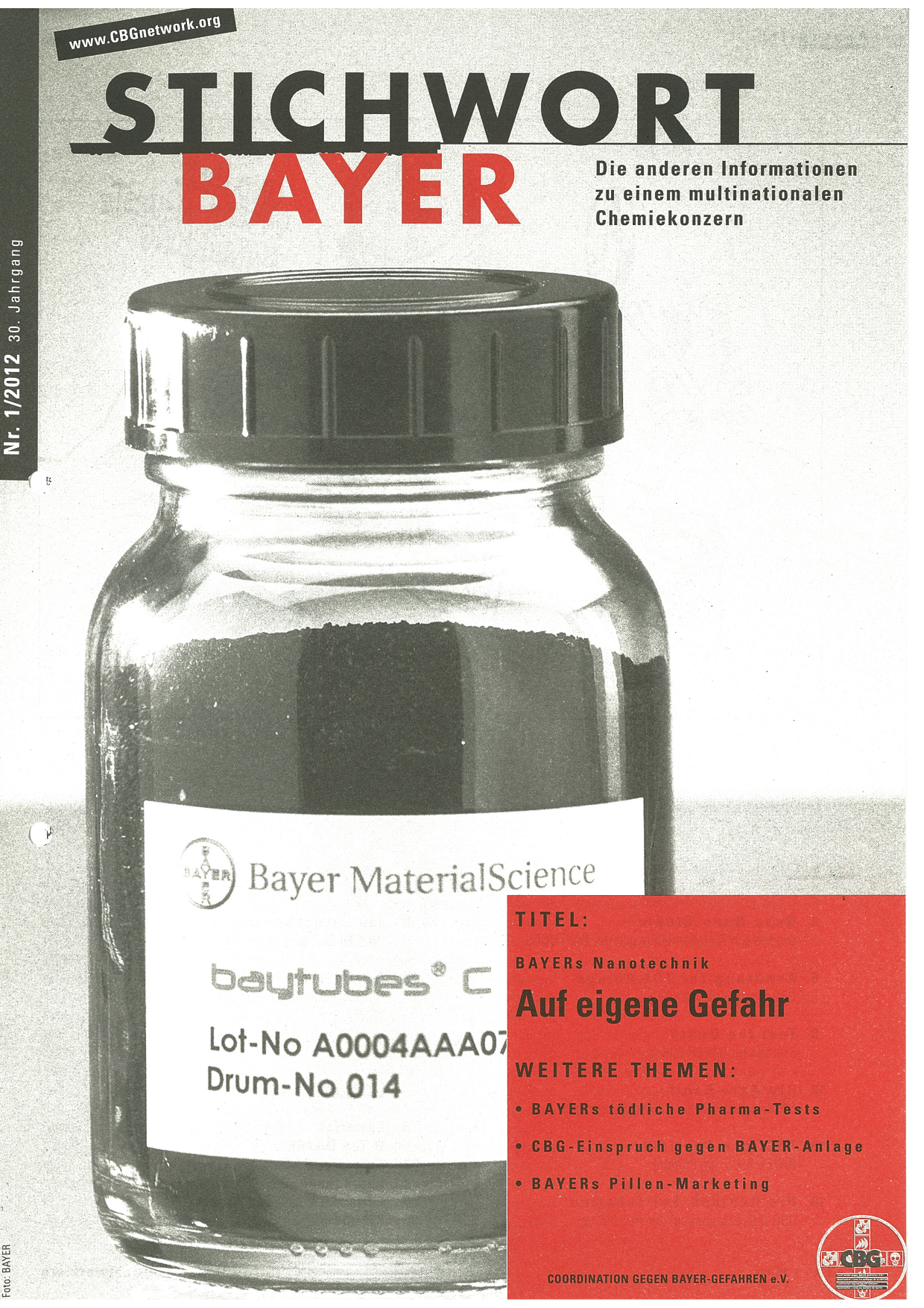138 BAYER-ProbandInnen sterben
Test the Death
Von 2007 bis 2010 starben in Indien 138 Menschen bei der Klinischen Erprobung von BAYER-Arzneien. Insgesamt kamen bei den Tests von Big Pharma in dem Zeitraum 1.600 ProbandInnen ums Leben. Während die Öffentlichkeit sich alarmiert zeigt, bestreiten die Pillen-Multis in den meisten Fällen den direkten Zusammenhang zwischen Medikament und Tod.
Im letzten Jahr hatte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) das Thema „Medikamenten-Tests in der Dritten Welt“ auf die Tagesordnung der BAYER-Hauptversammlung gesetzt. Sie kritisierte die zunehmende Verlagerung von Arznei-Erprobungen in Staaten, die als „Standortvorteil“ ein unerschöpfliches Reservoir an ProbandInnen, unschlagbare Preise, schnelle Verfahren und eine mangelhafte Aufsicht bieten. Die CBG sah durch diese Bedingungen das Leben der VersuchsteilnehmerInnen gefährdet. Aber der damalige Vorstandsvorsitzende Werner Wenning wiegelte ab. Nicht ein einziges Pharmazeutikum habe je einer Person Schaden zugefügt, antwortete er der Coordination, der Konzern halte sich stets an die Auflagen der Behörden und führe im Übrigen „eigenständige Qualitätskontrollen“ durch.
An dieser Aussage bestanden angesichts der vielen Zwischenfälle bei anderen Arznei-Tests schon damals viele Zweifel. Endgültig als Lüge erwiesen hat sie sich im Mai 2011. In diesem Monat gab das indische Gesundheitsministerium die Zahl der Personen bekannt, die von 2007 bis 2010 während der Erprobung von BAYER-Produkten starben. 138 Menschen überlebten die Prozedur nicht. Insgesamt fanden bei den Pillen-Prüfungen von Big Pharma 1.600 Menschen den Tod. BAYER & Co. meldeten diese Zahlen selber den Aufsichtsbehörden, allerdings ohne damit ein generelles Schuld-Eingeständnis zu verbinden. Ihrer Ansicht nach haben zumeist nicht die Medikamente, sondern Vorerkrankungen wie Krebs zum Ableben der ProbandInnen geführt. Die amtlichen Stellen machen ebenfalls nicht die Pharmazeutika im Allgemeinen verantwortlich. Von den 668 Sterbefällen im Jahr 2010 schreiben sie 22 der direkten Einwirkung der getesteten Substanzen zu; bei einer nicht weiter bezifferten Menge gibt es zumindest Indizien für einen Zusammenhang.
Aber nicht nur deshalb dürfte die wirkliche Zahl der Pharma-Opfer höher sein. Wenn Tests nicht ausdrücklich Krebskranke oder Menschen mit Herz/Kreislauf-Problemen erfordern, schließen die Unternehmen Personen mit Vorbelastungen gezielt aus. Alle TeilnehmerInnen müssen sich vor Beginn der Experimente einem peniblen Gesundheitscheck unterziehen, weil unerkannte oder verschwiegene Krankheiten einen negativen Einfluss auf das Ergebnis haben können. So stehen die Konzerne dann auch eher in Verdacht, zu gesunde als zu kranke ProbandInnen zu verpflichten. Darüber hinaus besteht in Indien keine Pflicht, die Klinischen Prüfungen registrieren zu lassen, was die Aufsicht erschwert - und den Verdacht auf mehr Tote nährt.
Lebensgefährliches XARELTO
Von den für 2010 zweifelsfrei geklärten 22 Todesfällen gehen die meisten auf ein einziges BAYER-Erzeugnis zurück: XARELTO. Vier InderInnen kamen durch die Arznei mit dem Wirkstoff Rivaroxaban um, die der Konzern als Mittel gegen Thrombosen testete. Bloß 5.250 Dollar zahlte der Konzern den Hinterbliebenen jeweils als Entschädigung und lag damit noch über den Beträgen von SANOFI, PFIZER & Co. Diese Summen sowie die Tatsache, dass die Familien der von 2007 bis 2009 Gestorbenen noch überhaupt kein Geld erhalten haben, veranlasste einen Leser der Publikation moneylife zu dem bitteren Kommentar: „Life is very cheap in India“. Andere sprechen von einem neuen Kolonialismus.
Der Zulassungsprozess für XARELTO gestaltet sich wegen der vielen Risiken und Nebenwirkungen seit längerem schwierig. In Europa dürfen MedizinerInnen das Therapeutikum bislang nur zur Thrombose-Vorbeugung nach schweren orthopädischen Operationen einsetzen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA tat sich aufgrund von Meldungen über Gefäß-Verschlüsse, Blutungen, Herz/Kreislaufstörungen und Leberschäden sowie der ungeklärten Langzeitwirkung sogar bei dieser eingeschränkten Indikation lange Zeit schwer. BAYER aber hat noch Größeres mit dem Pharmazeutikum vor. Das Unternehmen will es als Mittel zur Schlaganfall-Prophylaxe vermarkten, obwohl XARELTO dafür selbst nach eigener Aussage „kein konsistent positives Nutzen-Risiko-Profil“ aufweist. Der Multi erhofft sich Milliarden-Erlöse von der Substanz und der Finanzmarkt ebenfalls - in den gegenwärtigen Kurs der Aktie ist das Blockbuster-Potenzial des Produkts schon eingepreist. Deshalb reagiert sie auch äußerst empfindlich auf jede Negativ-Meldung zu XARELTO. Die letzte gab es im Anfang September 2011: Zeitungen berichteten von hochrangigen FDA-MitarbeiterInnen, die angesichts unerklärter Herzinfarkt- und Blutungsrisiken von einer Genehmigung abrieten. Aber ein paar Wochen später war die Börsen-Welt wieder in Ordnung. Das 12-köpfige BeraterInnen-Gremium der Behörde hatte sich bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung doch noch zu einer positiven Empfehlung durchgerungen. Die Vorkommnisse in Indien, über welche die CBG die FDA in Kenntnis setzte, führten auch nicht zu einem Umdenken. Der Behörde waren derartige Zwischenfälle bekannt: „Die Ärzte-Information führt Tod als mögliche Nebenwirkung auf, die während der Klinischen Tests mit XARELTO auftrat“. Bei Zulassungen gelte es immer, zwischen Wirksamkeit und Sicherheit eines Medikamentes abzuwägen, antwortete sie der Coordination.
Verstoß gegen Ethik-Regeln
Kritik am bisherigen Vorgehen der FDA in Sachen „XARELTO“ hat die US-Initiative PUBLIC CITIZEN geübt. Sie hat gravierende Mängel bei den Klinischen Prüfungen festgestellt. Bei Vergleichstests mit Warfarin haben die ProbandInnen, welche die Konkurrenz-Substanz bekamen, nicht die optimale Dosis erhalten, moniert die Organisation. „Es ist besonders besorgniserregend, dass es die schlechtesten Warfarin-Therapien bei den ausländischen Firmen gab“, so PUBLIC CITIZEN. Und am besorgniserregendsten war es bei den indischen Test-Unternehmen. Sie versorgten nur 36 Prozent ihrer PatientInnen angemessen mit Warfarin und setzten sie so einer erhöhten Gefahr aus, einen Schlaganfall zu erleiden. Auch haben die ÄrztInnen den TeilnehmerInnen, obwohl Warfarin seine Wirksamkeit erst nach einiger Zeit entfaltet, kein zusätzliches Mittel zur Blutverflüssigung verordnet. Zudem ereigneten sich unmittelbar nach dem Absetzen von XARELTO viele Zwischenfälle, für die BAYER die Erklärung schuldig blieb. Darüber hinaus rügt die Gruppe die Darreichungsform. Die ProbandInnen mussten die ganze Dosis auf einmal einnehmen, was mit höheren Risiken verbunden ist als eine Spreizung. Einzig marketing-technische Erwägungen vermutet PUBLIC CITIZEN hinter dieser Wahl. In einem Brief an die FDA haben die GesundheitsaktivistInnen diese Verstöße gegen medizinische und ethische Standards aufgelistet und die Behörde aufgefordert, die Arznei einstweilen nicht als Mittel zur Schlaganfall-Prophylaxe zuzulassen. Aber es half alles nichts. Am 4. November 2011 gab die Behörde grünes Licht für XARELTO.
MIRENA & Co.
BAYERs Pillen-Abteilung erprobt auf dem Subkontinent jedoch nicht nur XARELTO. „Sie lässt dort bereits sechs neue Medikamente testen. Das bringt deutliche Ersparnisse und ein schnelleres Entwicklungstempo“, berichtete das Handelsblatt vor vier Jahren und resümierte: „Auch als Ressource wird Indien für die Pharma-Sparte interessant“. Inzwischen ist der Staat als Ressource noch interessanter geworden. Momentan laufen Test-Reihen mit der Krebs-Arznei NEXAVAR, dem Augen-Präparat VEGF und dem Bluter-Medikament KOGENATE. Gerade abgeschlossen hat BAYER Versuche mit dem Potenzmittel LEVITRA, dem Diabetikum GLUCOBAY, der Hormon-Spirale MIRENA und den Röntgen-Kontrastmitteln GADOVIST und ULTRAVIST. Und neue ProbandInnen sucht der Konzern für weitere Erprobungen von XARELTO, GLUCOBAY, GADOVIST, KOGENATE, NEXAVAR und VEGF sowie von dem Antibiotikum AVELOX und dem von der BUKO PHARMA-KAMPAGNE als irrational eingestuften Bluthochdruck-Präparat XIRTAM.
Größtenteils handelt es sich dabei um altbekannte Pharmazeutika, für die der Leverkusener Multi bloß neue Verwendungsmöglichkeiten sucht. Ähnlich verhält es sich bei der Konkurrenz. Die wachsende Anzahl von Klinischen Tests rund um den Globus - das US-amerikanische „National Institute of Health“ hat gegenwärtig über 115.000 registriert - entspricht keinesfalls dem wachsenden Erfindungsreichtum von BAYER & Co. Das macht die wachsende Anzahl von Opfern zu einem noch größeren Skandal.
Eine Milliarden-Industrie
Die indische Test-Branche setzte 2010 nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO eine Milliarde Dollar um; rund 2.000 Arznei-Experimente fanden statt. Nachdem das Land 2005 dem Drängen von Big Pharma nach einer Verschärfung des Patentrechts nachgegeben hatte, boomte dieser Wirtschaftszweig kontinuierlich. Die „Contract Reseach Organisations“ (CROs), welche die Versuche zumeist für BAYER & Co. durchführen, haben nichts anderes im Sinn, als ihren Auftraggebern möglichst schnell möglichst gute Resultate zu liefern. Den Anforderungen an eine gute klinische Praxis genügen von den ca. 150 in Indien operierenden CROs gerade einmal 201. Ein Bericht des „National Institute of Medical Statistics“ kritisiert vor allem das Fehlen oder die mangelhafte Arbeit von Ethik-Kommissionen. Die eigentlich vorgeschriebene „informierte Einwilligung“ der ProbandInnen besteht in einem Land mit einer so hohen Analphabetismus-Rate ebenfalls oft nur auf dem Papier. Doch selbst, wenn die TeilnehmerInnen wissen, was sie tun, lässt die Armut ihnen nicht selten keine andere Wahl, als so waghalsige Unternehmungen zu riskieren. Anders als an ihren Stammsitzen geht den Konzernen deshalb der Nachschub nie aus - und sie nutzen dieses Reservoir zu einem Schnäppchen-Preis. Auswärtige Kontrollen haben sie auch nicht zu befürchten. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMEA reist zu gerade mal 40 Inspektionen pro Jahr in fernere Gefilde. Ihr US-amerikanisches Pendant überprüft in diesem Zeitraum nicht einmal ein Prozent der ausländischen Arzneitest-Firmen. Die FDA will ihr Pensum allerdings erhöhen. Der Test-Export bereitet ihr zunehmend Unbehagen, da eine Vielzahl der Versuche nicht den US-Standards entspricht und die gelieferten Datensätze mit den Ergebnissen oft unvollständig und nur schwer zu analysieren sind.
Allzuviel verändern dürfte das in Indien und anderswo allerdings nicht. Trotz solch günstiger Aussichten hadern die Firmen in jüngster Zeit jedoch mit dem Subkontinent. Den Pillen-Riesen geht es dort nicht schnell genug. Während die USA einen Klinischen Test innerhalb eines Monats genehmigen, müssten sie in dem südostasiatischen Staat 12 bis 16 Wochen auf grünes Licht warten, klagen die Hersteller. „Das ist ein großer Zeitverlust, denn die Patent-Uhr für dein Produkt tickt bereits“, so die Vertreterin eines Arznei-Riesen. Auch die Weigerung der Behörden, die für die ProbandInnen besonders gefährlichen Ersterprobungen der Phase I zu gestatten, wenn die entsprechenden Medikamente nicht für den Heimatmarkt vorgesehen sind, passt den Konzernen nicht. Darüber wächst die Kritik an den Versuchen, was bereits zu einer strengeren Reglementierung geführt hat. Darum zieht die Karawane weiter. Im Moment bietet ihr China die meisten Standort-Vorteile. 64 gerade abgeschlossene, noch laufende oder geplante BAYER-Studien im Reich der Mitte verzeichnet das „National Institute of Health“ gegenwärtig - Tendenz steigend.
Der Offene Brief
Die CBG hat die erschreckenden Nachrichten aus Indien zum Anlass genommen, um vom Leverkusener Multi Aufklärung zu fordern. In einem Offenen Brief an den Vorstandsvorsitzenden Marijn Dekkers verlangte die Coordination detaillierte Informationen über die untersuchten Pharmazeutika, die Häufigkeit von Sterbefällen und sonstigen schwerwiegenden Gegenanzeigen und die geleisteten oder nicht geleisteten Entschädigungszahlungen. Darüber hinaus wollte sie wissen, wie das Unternehmen Todesopfer bei Arznei-Prüfungen in Zukunft verhindern will. Die bisherigen Reaktionen BAYERs gleichen denjenigen auf der Hauptversammlung von 2010. Der Multi beteuert, stets nach Recht und Gesetz gehandelt zu haben. Aber anders als vor anderthalb Jahren bekennt er sich jetzt eindeutig zur „Deklaration von Helsinki“, mit welcher der Weltärztebund 1964 weltweit verbindliche ethische Standards für die pharmazeutische Wissenschaft formulierte. Nach ihr haben die ProbandInnen nach Ablauf der Versuche etwa einen Anspruch darauf, die Arzneien weiter zu erhalten - wie das ganze Land. Als bloßes Labor dürfen die Konzerne es der Deklaration zufolge nicht missbrauchen. In ihrer ursprünglichen Fassung lehnte diese sogar die Verwendung von Placebos strikt ab, weil das bedeutet, kranken Menschen ohne ihr Wissen dringend benötigte Medizin vorzuenthalten. Aber die Pharma-Riesen intervenierten und erreichten eine Revision. Es blieb nicht die einzige: Die heute gültige Fassung weicht beträchtlich von der ursprünglichen ab. Wie nicht nur die Toten von Indien zeigen, gelingt es dem Leverkusener Multi trotzdem nicht, ihren Ansprüchen gerecht zu werden. „In der medizinischen Forschung am Menschen muss das Wohlergehen der einzelnen Versuchsperson Vorrang vor allen anderen Interessen haben“ - dieses Gebot gilt für BAYER nicht. Von Jan Pehrke
Anmerkung
1 J. S. Srivastava; Need for ethical oversight of clinical trials in India; in: Current Science, Vol 99, No. 11