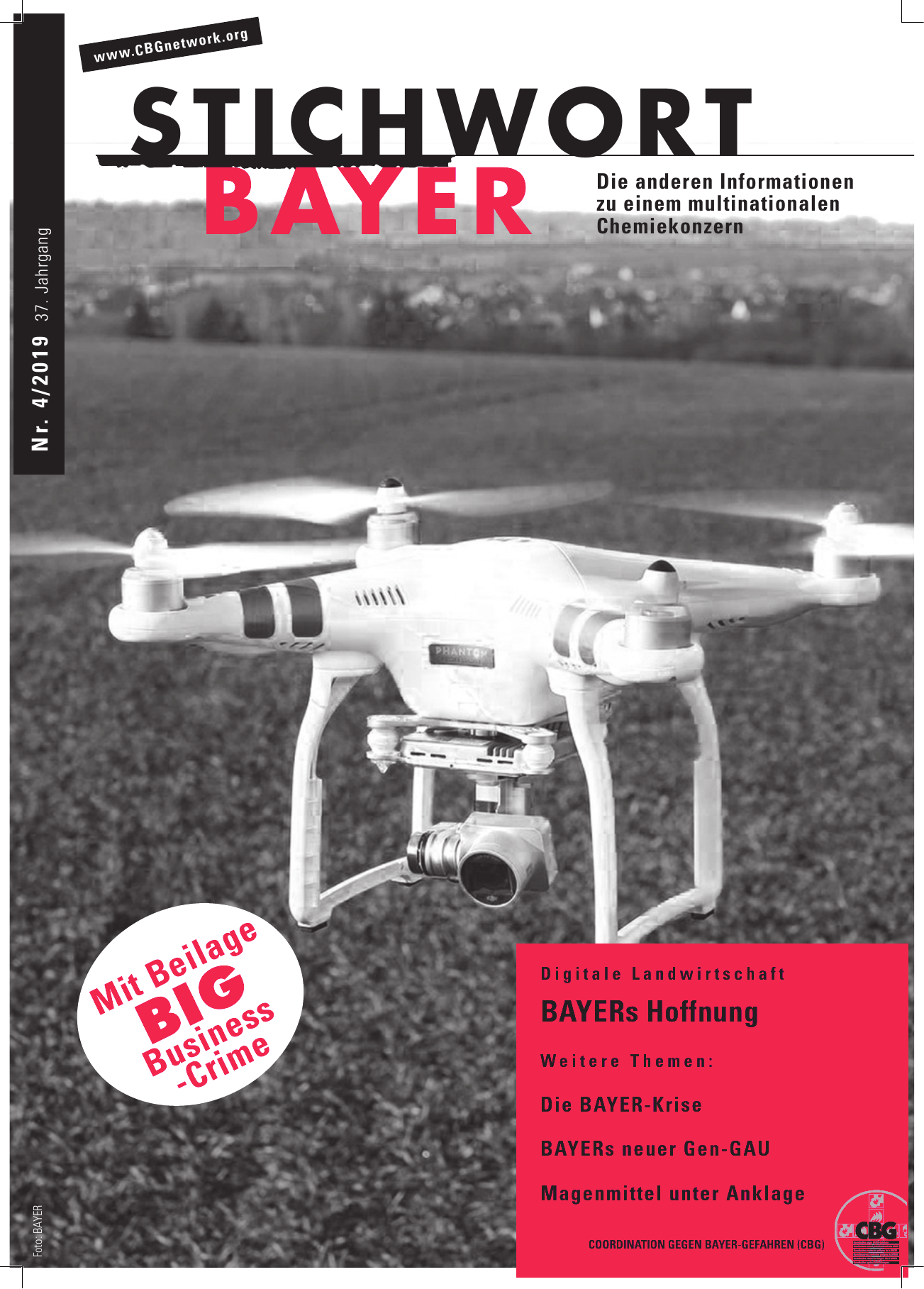Das APPLE der Äcker
Drohnen, Sensoren und Satelliten-Bilder liefern den Bauern und Bäuerinnen Daten über das Wetter, die Bodenbeschaffenheit, Pflanzenkrankheiten und Schadinsekten und verhelfen ihnen auf diese Weise zu einem ökonomischeren und ökologischeren Einsatz von Düngemitteln, Saatgut und Pestiziden – so promotet BAYER die digitale Landwirtschaft. Tatsächlich aber haben Science-Fiction-Autor*innen die schöne neue Welt auf den Äckern in ihren Horror-Szenarien weit realistischer beschrieben. Die Informationen, die der Leverkusener Multi zusammenträgt, um den Landwirt*innen „ein tieferes Verständnis über ihre Felder“ zu vermitteln, machen ihn nämlich zu einem veritablen Big Brother. Damit nicht genug, kann die „Zukunftstechnologie“ noch mit so manch anderen Risiken und Nebenwirkungen aufwarten.
Von Jan Pehrke
„Wir sind heute in der Lage, den Landwirten Daten und Wissen über jede Pflanze und jeden Quadratzentimeter Boden zur Verfügung zu stellen“, mit diesen Worten pries BAYERs Vorstandsvorsitzender Werner Baumann auf der Hauptversammlung des Konzerns im April 2019 den Segen der digitalen Landwirtschaft. Die Übernahme von MONSANTO hat den Leverkusener Multi zum Marktführer in diesem Bereich gemacht. Und dass der US-Konzern mit seiner „Climate Corporation“ hier nach Baumanns Worten „ganz vorne“ war, spielte eine nicht unwesentliche Rolle für die Kauf-Entscheidung. Aber bereits vorher hatte der Global Player dem Thema viel Gewicht zugemessen. „Wir sind absolut davon überzeugt, dass die digitale Landwirtschaft den Ackerbau revolutionieren wird“, erklärte Sparten-Leiter Tobias Menne im Jahr 2017.
Das Unternehmen glaubt, mit seinem Ackerbau 4.0 namens „FieldView“ eine neue Zukunftstechnologie im Portfolio zu haben, welche die (Kurs-)Phantasie der Investor*innen beflügeln kann, und legt sich entsprechend ins Zeug. Unter Titeln wie „Der vernetzte Acker“ oder „Das intelligente Feld“ produziert er Science Fiction. „Neben Satelliten und Drohnen sammeln auch Sensoren auf den hochmodernen Traktoren und Ernte-Maschinen wichtige Erkenntnisse über die Bodenbeschaffenheit und die Pflanzen-Gesundheit. Sie fließen in digitale Programme ein, mit denen BAYER weltweit Landwirte bei einer effizienteren und nachhaltigen Landwirtschaft unterstützen will“, fabuliert das Unternehmen. Auch Informationen über das Wetter fließen dem Konzern zufolge in entsprechende Algorithmen ein.
Konkret erhebt der „ackerbauliche Erkennungsdienst“ (Die Zeit) etwa Daten über die Menge an Biomasse und Nitrat, die im Boden steckt, das Aufkommen von Schadinsekten sowie über den Chlorophyll-Gehalt der Pflanzen, der ein Indikator für deren Gesundheit ist. Dies ermöglicht dem Global Player zufolge passgenaue Lösungen. So stellt er beispielsweise ökologisch korrekte „See and spray“-Pestizide, die den Gewächsen bei Bedarf Einzel-Behandlungen angedeihen lassen und nicht mehr großflächig ausgebracht werden müssen, in Aussicht.
Viele Probleme
In der Praxis stellt sich dies alles jedoch als nicht so ganz einfach dar. Schon die Erhebung korrekter Daten erweist sich oftmals als Problem. Das geht aus der Studie „Vom Mythos der klima-smarten Landwirtschaft“ hervor, welche die Agrar-Wissenschaftlerin Andrea Beste und die Tierärztin Anita Idel im Auftrag des grünen Europa-Parlamentariers Martin Häusling erstellt haben. So kommen beispielsweise allein in Europa 16 verschiedene Methoden zur Bestimmung des Phosphor-Gehalts im Boden zur Anwendung – und einen genauen Aufschluss über die vorhandene Gesamtmenge gibt keine davon. Noch größere Schwierigkeiten bereitet der Humus. Wie viel der Acker davon birgt, vermögen die bisherigen Verfahren nicht zu ermitteln – „von der Qualität der Humus-Substanzen ganz zu schweigen“, schreiben die Autorinnen. Auch die Chlorophyll-Messung sagt ihrer Ansicht nach nur wenig darüber aus, ob eine Ackerfrucht wirklich genug Nährstoffe bekommt. Sie bezieht sich nämlich – und auch das nur indirekt – auf den Stickstoff. Um Robustheit oder Gesundheit der Pflanze zu messen, wären nach Ansicht der beiden weitaus kompliziertere Messungen nötig. „Wenn aber die Daten unzulänglich sind, dann kann sich die Software der Präzisionstechnik gar nicht genau auf die Boden-Verhältnisse einstellen“, resümiert Beste in einem Interview mit Die Zeit.
Zudem steht dem Fluss dieser unzulänglichen Daten noch so einiges entgegen, denn die Analyse-Instrumente in den Labors sind oftmals nicht mit den Boden-untersuchungsgeräten kompatibel. Auch sonst erweisen sich fehlende Schnittstellen und andere Verbindungsprobleme oftmals als große Hindernisse bei der Datenverarbeitung. Prof. Dr. Cornelia Weltzien, die Leiterin der Abteilung „Technik im Präzisionspflanzenbau“ am Potsdamer Leibniz-Institut, führt das als einen der Gründe für die Schwierigkeiten an, welche die „Zukunftstechnologie“ dabei hat, in der Gegenwart anzukommen.
Ein Feldversuch der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, die von 2008 bis 2017 verschiedene Anwendungen des „precision farmings“ auf einem Gut nahe der Ostsee-Küste testete, zeigte weitere auf. „Am Ende stand eine gewisse Ernüchterung“, so der Agrar-Ingenieur Christoph Lubkowitz. Gut geklappt hatte nach seiner Einschätzung eigentlich nur die digital gesteuerte Ausbringung von Saatgut und Kalk sowie der Einsatz von automatischen Lenksystemen bei Treckern, Mähdreschern und Co. Aber im Bereich der Sensor- und Scan-Technik haperte es ebenso wie bei der Auswertung der Ernte-Ergebnisse. Auch die Erstellung von Ertragskarten zum Aufspüren ergiebiger und weniger ergiebiger Ackerflächen-Abschnitte funktionierte nicht so recht.
Dieser Befund entspricht den Erfahrungen, die Thomas Kiesel mit der digitalen Landwirtschaft bisher machte. Der Bauer hadert etwa mit der Sensor-Technik und nennt in dem Interview, das er dem Ideenwerk BW.de gab, als Beispiel die Anwendung von Fungiziden bei Getreide-Rost. „Der hat eine sehr kurze Inkubationszeit. Man muss also reagieren, wenn die allerersten Pusteln auf den Blättern auftauchen. Ein Sensor, der der Spritze sagt, wo sie wie viel spritzen soll, würde den Befall zu spät erkennen. Als Landwirt erkenne ich die kritischen Stellen sofort – nämlich da, wo morgens der Tau länger liegen bleibt“, erläutert Kiesel. Und an Ertragssteigerungen durch Bits & Bytes glaubt er ebenso wenig wie an ein ökologischeres Wirtschaften qua „precision farming“. Positiv bewertet der Landwirt hingegen die GPS-gesteuerten Lenk-Systeme für Mähdrescher und Schlepper, weil diese die Maschinen in der Spur halten und so helfen, Benzin und Zeit zu sparen. Insgesamt fällt sein Fazit allerdings mehr als durchwachsen aus: „Digitale Technik kann uns an vielen Stellen die Arbeit erleichtern. Aber unser Wissen und unsere Erfahrung kann sie nicht ansatzweise ersetzen.“
Auch Bruno Melcher, der in Brasilien eine 15.000-Hektar-Farm betreibt und großflächige Betriebe in Russland mitverwaltet, mag nicht an das ertragssteigernde Potenzial der Landwirtschaft 4.0 glauben: „Wir haben jetzt zwar viele daten-gestützte und technische Produkte, aber 90 Prozent aller Ernte-Verluste sind dem Wetter geschuldet.“ Sogar aus der Industrie selber erhält er Zustimmung, beispielsweise vom Vorstandsvorsitzenden des Saatgut-Unternehmens KWS SAAT, Hagen Duenbostel. „Es könne schon sein, dass eines Tages infolge der Digitalisierung einmal mehr Maiskörner am Kolben hingen als in unseren Tagen“, gibt die FAZ die Worte des KWS-Bosses wieder: „Aber derzeit, so seine ernüchternde Zwischenbilanz, werde noch kein Gramm mehr durch die Digital-Technik geerntet.“ Überdies schrecken die Landwirt*innen Duenbostel zufolge vor der Bildschirmarbeit zurück: „Die Farmer wollen nicht mit der Kaffee-Tasse im Büro sitzen und mit dem Smartphone den Traktor steuern.“ Und sie trauen den Ratschlägen von BAYER & Co. nicht, wie die KWS-Finanzchefin Eva Kienle meint: „Die Landwirte wollen Unabhängigkeit. Sie möchten nicht den Eindruck haben, ihnen wird ein Produkt empfohlen, nur weil der Anbieter etwas daran verdient.“
In der Tat handelt es sich bei den Daten-Autobahnen zumeist um Einbahnstraßen. Vor zwei Jahren brachte dies der damalige MONSANTO-Forschungschef Robert Fraley deutlich zum Ausdruck, als er im Zuge des BAYSANTO-Deals von den digitalen Synergie-Effekten schwärmte, die nach der Zusammenführung der beiden unterschiedlichen Produkt-Portfolios entständen. „In ein paar Jahren wollen wir den Farmern ein- oder zweimal am Tag ein Satelliten-Bild von ihrem Feld schicken, um das Wachstum der Pflanzen zu verfolgen und eine frühe Warnung aussprechen, wenn es irgendwo ein Problem mit Dünger, Wasser, Krankheiten oder Insekten gibt. Und dann können sie mit BAYER-Produkten eine Lösung finden“, verkündete er. Mit BAYER-Produkten. Ausschließlich um die geht es auch beim SEED ADVISOR: Das „Optimierungstool“ weiß für jeden Standort immer den geeignetsten Hybrid-Mais des Konzerns auszuwählen.
Plattform-Kapitalismus
BAYERs IT-Spezialist*innen haben den SEED ADVISOR so programmiert, dass die ganze Masse von Daten, die er ermittelt, genau auf ein Nadelöhr zulaufen: die Mais-Arten des Agro-Riesen. Marita Wiggerthale von OXFAM sieht dadurch die Landwirt*innen in eine Abhängigkeit gedrängt. „Sie erhalten damit nicht die Auswahl der besten Saatgut-Sorten allgemein, sondern nur eine Auswahl von BAYERs Saatgut“, konstatiert sie und gibt zu bedenken: „Je größer die Daten-Menge, über die ein Agrarchemie-Konzern verfügt, desto zielgerichteter die Lock-Angebote und Schein-Informationen auf den Bildschirmen der Bauern.“ Nach Angaben des Unternehmenssprechers Utz Klages plant die Aktien-Gesellschaft, hier Abhilfe zu schaffen und das „Angebot auf Saatgut-Sorten anderer Anbieter auszuweiten“. Das aber erscheint wenig glaubhaft. „Seit Jahren versprechen Konzerne der Netzwerk-Ökonomie, Produkte anderer Anbieter kompatibel zu machen, ohne dieses Versprechen zu erfüllen“, hält Reinhild Benning von GERMAN WATCH fest.
Der Leverkusener Multi hat sich in dieser Netzwerk-Ökonomie durch MONSANTOs „Climate Corporation“ bestens positioniert und nach eigenem Bekunden die „Führerschaft in digitalen Tools“ für die Landwirtschaft übernommen. Ein rasanter Aufstieg, denn die „Climate Corporation“ begann im Jahr 2006 als kleines Start-up von zwei ehemaligen GOOGLE-Beschäftigten, die Fahrrad-Verleihen und anderen klima-abhängigen Betrieben Wettervorhersagen anbieten wollten.
Nun kommen Anwendungen wie „FieldView“ bereits auf einer Acker-Fläche von 24 Millionen Hektar zum Einsatz; für das Jahr 2019 erwartet der Global Player eine Steigerung auf 36,4 Millionen Hektar. Das „APPLE der Landwirtschaft“ wollte MONSANTO mit diesem Produkt werden, und nach Meinung einiger Beobachter*innen gelang dem Unternehmen dies – zu BAYERs nunmehriger Freude – auch. So beschreibt die US-amerikanische Journalistin Angela Huffman die Plattform als eine Kombination von WINDOWS und „App Store“. Und wie APPLEs digitaler Shop zeigt sich „FieldView“ offen für zahlende Gäste; nur die direkte Konkurrenz muss draußen bleiben. Fast 80 Partner hat BAYER schon gewonnen. Dazu zählen unter anderem der Landmaschinen-Hersteller AGCO, der Bodenkarten-Anbieter VERIS, der digitale Getreide-Marktplatz FARMLEAD und HARVEST PROFIT INC., das „field-by-field profitability analysis“ anbietet. Sie alle zahlen für den Zugang und führen einen Teil ihrer Umsätze an den Agro-Riesen ab. Zudem kann der Konzern ihre Daten abgreifen.
Damit nicht genug, bietet sich ihm durch dieses Instrument die Möglichkeit, die Rolle eines Türwächters einzunehmen und so darüber zu bestimmen, wer reindarf in die Welt der digitalen Landwirtschaft und wer nicht. Ganz offen spricht die Aktien-Gesellschaft davon, eine solche Filter-Funktion ausüben zu wollen. Einige befürchten überdies, BAYER trage sich mit der Absicht, über die Plattform die traditionellen Vertriebswege für Pestizide und andere Betriebsmittel zu umgehen und selber als Anbieter aufzutreten, um sich einen größeren Anteil an der Wertschöpfungskette zu sichern.
Daten, Daten, Daten …
Die Basis der Plattform-Ökonomie bilden die Daten. Sie sind das eigentliche Kapital. Der Leverkusener Multi besitzt nach der Integration der „Climate Corporation“ jede Menge davon und zeigt sich weiter unersättlich. „Wie bei jedem digitalisierten Geschäftsmodell braucht man eine bestimmte Menge an Daten, um die Algorithmen treffsicherer zu machen. Wir sind deswegen gerade dabei, unsere Produkte zu verbessern und noch mehr Daten zu sammeln, damit wir den Landwirten gute Handlungsempfehlungen geben können“, erklärt BAYERs Agro-Chef Liam Condon. Dabei reichte der Bestand schon in der MONSANTO-Ära zeitweilig dafür aus, so viel Speicherplatz in der AMAZON-Cloud in Beschlag zu nehmen wie kein anderes Unternehmen.
Dementsprechend fürchten sich viele Bauern und Bäuerinnen davor, ihre Höfe von der Industrie bis zur letzten Ackerkrume nach dem durchleuchten zu lassen, was BAYERs Mike Stern „die neue Währung in der Landwirtschaft“ nennt. Thomas Kiesel sieht vor allem in der Vernetzung aller im Betrieb eingesetzen Systeme eine Gefahr: „Dann hätten nämlich die Hersteller von Landtechnik und anderen Betriebsmitteln direkten Zugriff auf unsere Produktionsdaten – und wir wären gläserne Landwirte.“ Bei einer Umfrage, initiiert von verschiedenen Landwirtschaftsorganisationen kurz vor dem MONSANTO-Deal, äußerten 91,7 Prozent der befragten Landwirt*innen, Angst vor einem Big Brother BAYER zu haben, der die Kontrolle über die Daten ihrer Farmen besitze. Deshalb versucht der Global Player nach Kräften, die Gemüter zu beruhigen. „Wir wollen keine Daten-Krake der Landwirtschaft werden“, beteuert etwa Tobias Menne. Aber überzeugend klingt das nicht.
Der Politik ist die Sammelwut auch nicht entgangen. Die russische Monopol-Behörde FAS hatte nicht zuletzt wegen dieser ernstliche Bedenken gegen BAYERs MONSANTO-Übernahme. „Sie haben so große Datenmengen, dass von unserem landwirtschaftlichen Sektor nach einem Zusammenschluss nicht mehr viel übrig sein wird“, fürchtete FAS-Chef Igor Artemjev. Deshalb musste der Leverkusener Multi garantieren, den Zugang zu dieser Technologie nicht zu reglementieren und auch russische Betriebe daran teilhaben zu lassen. Die Bundesregierung hat ebenfalls Handlungsbedarf erkannt – jedenfalls theoretisch. „Klare Leitplanken und Regulierung“ braucht es in diesem Bereich, verkündete Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang des Jahres auf der Grünen Woche in Berlin, ohne dem allerdings Taten folgen zu lassen.
Mit dem Einstieg in die Plattform-Ökonomie will der Konzern sein ganzes Geschäftsmodell verändern. „Durch die Digitalisierung werden wir künftig das Gesamtprodukt ‚das saubere Feld’ anstelle einzelner Artikel anbieten können“, sagt Cropscience-Chef Liam Condon. Wobei „sauber“ für BAYER ein relativer Begriff ist. Eine „ertragsrelevante Ausdehnung – nicht das Vorhandensein – von Pflanzen-Krankheiten durch unsere Technologien“ plant der Konzern künftig auszuschließen, schränkt das „Digital Farming Team“ ein.
Condon zufolge geht es jetzt nicht mehr darum, „so viel Liter Chemie zu verkaufen wie möglich“. Wenn nur die Hälfte des Feldes gespritzt werde, werde man zwar nur halb soviel Absatz machen, gibt die Nachrichtenagentur Reuters seine Worte wieder: „Aber das Wissen, dass man nur diesen Teil des Feldes spritzen muss – das können Sie verkaufen.“ Weniger kann also mehr sein.
Einen Namen hat das Kind bei BAYER auch schon: „Outcome based pricing“. Da gibt der Algorithmus, in den Zahlen zum Pestizid-Einsatz und andere Parameter einfließen, einen bestimmten Ernte-Ertrag vor. Bei einem Unterschreiten muss der Agro-Riese dann zahlen; bei einem Überschreiten erhält er Geld von den Landwirt*innen. Für Fungizide erprobt der Leverkusener Multi ein solches Modell gerade. Ein konkretes Datum zur Praxis-Einführung nennt er aber wohlweislich noch nicht. Bei einigen komplexen Variablen hakt es noch, bekundet der Konzern.
Fazit
An Baustellen fehlt es auch sonst nicht bei der „digitalen Landwirtschaft“. Vieles in dem Bereich ist noch Zukunftsmusik, und nicht weniges davon wird es für immer bleiben. Das Versprechen, den Kartoffel-Käfer und seine Kolleg*innen schon im Anmarsch per Drohne aufzuspüren und dann gezielt mittels eines gezielten Pestizid-Einsatzes zu stellen, dürfte etwa darunterfallen. Besser sieht es für die automatisierten Landmaschinen aus. Diese nutzen die Landwirt*innen jetzt schon relativ häufig. Zu einer entsprechend harten Konkurrenz für BAYER & Co. wachsen deshalb die großen Anbieter wie JOHN DEERE und CLAAS heran, denn auch diese haben sehr viel Agrar-Wissen in Nullen und Einsen parat. JOHN DEERE versuchte in der Vergangenheit sogar schon einmal, MONSANTOs Digital-Sparte zu kaufen, was nur die Intervention der US-amerikanischen Wettbewerbsbehörde verhinderte. Und dann ist das alles nicht zuletzt eine Preis-Frage. Die Landwirtschaft 4.0 kostet nämlich so einiges, und Kleinbauern und -bäuerinnen können die erforderlichen Summen in den meisten Fällen gar nicht aufbringen.
Aber die digitale Landwirtschaft steht auch vor einer grundsätzlichen Herausforderung: Was nützt ein Logarithmus, der immer die besten Bedingungen ausspuckt, was das Wetter, die Bodenbeschaffenheit und das Schadinsekten-Aufkommen angeht, wenn diese besten Bedingungen in Zeiten des Klimawandels immer schlechter werden? Was dadurch an zusätzlichem Pestizid- und Düngemittel-Bedarf entsteht, kann das „precision farming“ nie und nimmer wettmachen. Noch dazu ist die „Zukunftstechnologie“ eher Teil des Problems als der Lösung, stellt sie doch die vorerst letzte „Errungenschaft“ der agro-industriellen Landwirtschaft dar, die nicht eben wenig zur Erderwärmung beiträgt. Die gesamte Entwicklung wirft also viele Fragen auf, und momentan hapert es noch am einfachsten. So hat das „intelligente Feld“ vielerorts gar kein Netz, weil der Kabel-Ausbau in den ländlichen Regionen stockt. ⎜