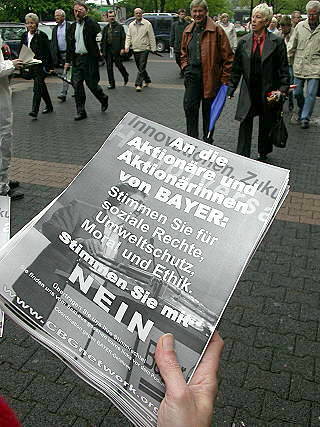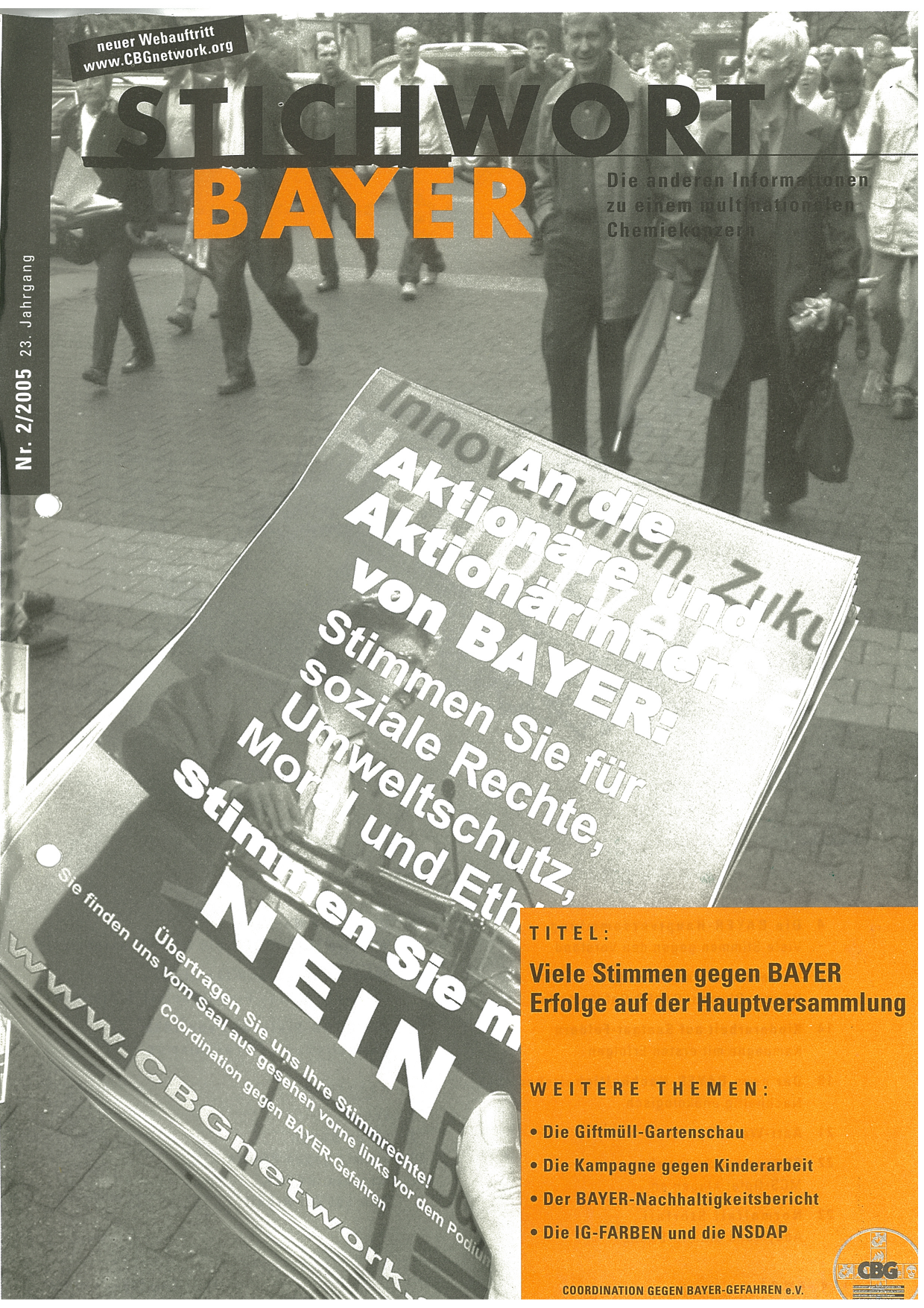AKTION & KRITIK
GREENPEACE-Aktion in Antwerpen
BAYER produziert in Antwerpen den Weichmacher Bispenol A, der durch seine hormon-ähnliche Wirkung den menschlichen Organismus schädigen kann. Wäre das EU-Chemikaliengesetz REACH schon in Kraft, das den Chemie-Konzernen die Pflicht auferlegen will, Tausende niemals auf ihre gesundheitsschädliche Wirkung hin untersuchte Stoffe zu überprüfen, hätte der Multi die Substanz womöglich schon längst aus dem Verkehr ziehen müssen. Darum hat GREENPEACE mit einer spektakulären Aktion bei BAYER/Antwerpen auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, REACH ohne die Änderungswünsche der Industrie zu verabschieden. Die AktivistInnen erklommen die Türme einiger Anlagen und brachten darauf weithin sichtbare Transparente mit den Aufschriften „BAYER ohne Gift“ und „Produziert sicherere Substanzen“ an. „Unternehmen wie BAYER und BASF sollten sich klar für ein Ersetzen problematischer Stoffe aussprechen“, forderte der GREENPEACE-Chemieexperte Fawaz Al Bitar und verwies auf Konzerne wie SONY, IKEA und H&M, die gefährliche Chemikalien in ihren Produkten schon substituiert haben.
Aus für Gentech-Hühnerfutter
GREENPEACE hat in Australien Hühner-Züchter aufgefordert, auf gentechnisch produzierte Soja- und Rapssorten made by BAYER und MONSANTO zu verzichten und hatte Erfolg: Die größten Züchter-Gesellschaften erklärten, künftig kein Gen-Futter mehr zu verwenden.
Proteste gegen Genraps
Im japanischen Tokio haben GREENPEACE, LandwirtInnen-Organisationen, UmweltschützerInnen und VerbraucherInnen-Initiativen vor der kanadischen Botschaft gegen die Genraps-Ausfuhren des Landes protestiert. Sie schichteten einen Flaschenberg mit Rapsöl auf, um der Botschaft plastisch die Folgen eines möglichen Boykotts vor Augen zu führen. „Stoppen Sie die Kontamination Japans mit Gentech-Pflanzen“ forderte die Koalition die DiplomatInnen auf. 80 Prozent des in Japan eingeführten Rapses stammen aus Kanada, bei 80 Prozent davon handelt es sich um von BAYER oder von MONSANTO gentechnisch veränderte Sorten. Schon bei der Anlandung in den Häfen verbreiten sich die Raps-Samen in der Umwelt. Ein japanisches Forschungsinstitut hat noch 30 Kilometer von den Verladestationen entfernt Spuren des Genrapses nachgewiesen.
Proteste bei BAYER CROPSCIENCE
Vom 11. bis zum 15. April 2005 fand in Lyon die Gentech-Konferenz „BioVision“ statt, zu deren Hauptsponsoren BAYER CROPSCIENCE zählte. Zudem gehörten Konzern-VertreterInnen zu den TeilnehmerInnen der Gesprächsrunden. Das nahmen französische Gentech-GegnerInnen zum Anlass, der Lyoner CROPSCIENCE-Niederlassung einen Besuch abzustatten. Sie luden - organischen - Müll vor dem Eingangstor ab, um gegen die Risikotechnologie im Allgemeinen und Freisetzungsversuche mit Genpflanzen im Besonderen zu protestieren.
PAN gegen LINDAN
Seit BAYER die US-Firma GUSTAFSON erwarb, befindet sich das nicht nur durch den Holzgifte-Skandal mit seinen unzähligen Opfern berühmt-berüchtige Pestizid LINDAN wieder im Sortiment des Konzerns. Die USA gehören zu den wenigen Staaten, die seinen Gebrauch noch nicht komplett untersagt haben, obwohl sich Rückstände des Ultragifts in 62 Prozent aller menschlichen Körper nachweisen lassen. Die US-amerikanische Sektion des PESTIZID-AKTIONS-NETZWERKS (PAN) hat deshalb einen „call in day“ inititiiert, um BAYER zu einem Verkaufsstopp zu bewegen. 200 Menschen beteiligten sich an der Aktion und sprachen beim Konzern telefonisch in Sachen „LINDAN“ vor. Zudem startete PAN eine Brief-Kampagne. Auch die COORDINATION wandte sich an BAYER und sprach das Thema zudem in der Hauptversammlung des Konzerns an.
Neue „Corporate Crime“-Website
Die Asien-Sektion des PESTIZID-AKTIONS-NETZWERKS (PAN) baut eine homepage zu Konzernverbrechen der Agro-Multis BAYER, MONSANTO und SYNGENTA auf. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hat der „Corporate Crime“-Site auf Anfrage viele Informationen zur Verfügung gestellt.
Frauen-Demo gegen Chemiegefahren
Die chemie-kritische Initiative WOMEN IN EUROPE FOR A COMMON FUTURE hat in Berlin unter dem Motto „Frauen werden giftig“ eine Demonstration mit 100 TeilnehmerInnen durchgeführt. Auf der Protestveranstaltung ließ sich auch Bundesumweltminister Jürgen Trittin sehen, um „seine Unterstützung zu zeigen“.
BAYER-Tag auf der LAGA
Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, hatte „Premiumsponsor BAYER“ zum Sonntagsausflug auf die Landesgartenschau (LAGA) geladen. Und dies zu Premiumbedingungen: MitarbeiterInnen, deren Angehörige und Freunde durften zum Firmenrabatt das fast schattenlose Leverkusener Deponiegelände bei 30 Grad Celsius besichtigen. Der große Andrang machte die Sache noch schweißtreibender, auch für die Aktiven der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG). Diese informierten die BAYER-Gemeinde über die ungeschminkte Geschichte der ehemaligen Giftmüllhalde; über all das, was die von BAYER gestaltete Ausstellung auf der LAGA verschweigt oder beschönigt wie die Krankheits- und Todesfälle und die Restrisiken der Altlast. So endete also der Sonntagsausflug für so manche/n BesucherIn nachdenklich.
Imkerbund schreibt BAYER
Im Rahmen der Landesgartenschau präsentiert BAYER auch die Aktvitäten von HobbyimkerInnen. Der Konzern verweist dabei zwar auf Bedrohungen für die Bienenbestände, über den Bienentod durch das hauseigene Pestizid GAUCHO verliert er jedoch kein Wort. Der bundesdeutsche Erwerbsimkerbund kritisierte dieses Vorgehen und erwirkte eine Änderung der Darstellung.
CBG für Friedenspreis vorgeschlagen
Die Stiftung „AnStifter“ hat die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) gemeinsam mit 22 weiteren Gruppen für den „Stuttgarter Friedenspreis“ nominiert. Der Vorschlag kam von baden-württembergischen ImkerInnen, die das Engagement der CBG gegen das bienengefährliche BAYER-Pestizid GAUCHO als preiswürdig erachteten.
Spanische ImkerInnen protestieren
In Madrid haben 3.000 spanische ImkerInnen gegen das Sterben ihrer Bienenvölker durch das BAYER-Pestizid GAUCHO mit dem Wirkstoff Imidacloprid protestiert und ein Verbot gefordert.
Alternativer ImkerInnenbund gegründet
Im April 2005 hat sich in Königswinter der ALLGEMEINE DEUTSCHE IMKERBUND konstituiert. Hauptgrund für die Neugründung stellte die Verärgerung der BienenzüchterInnen über die lasche Reaktion des Berufsimkerbundes auf das Bienensterben durch das BAYER-Pestizid GAUCHO dar. Nicht zuletzt weil der Verband Spenden vom Leverkusener Multi erhält, sucht er in Sachen „GAUCHO“ nämlich immer einvernehmliche Lösungen mit dem Agro-Multi.
Beschäftigte demonstrieren
Den MitarbeiterInnen von BAYERs abgespaltener, nun unter dem Namen LANXESS firmierender Chemie-Sparte am Standort Uerdingen drohen Entgelt-Einbußen von bis zu 800 Euro, weil das Unternehmen übertarifliche Leistungen und sonstige beim Leverkusener Multi übliche Zulagen nicht länger gewährt. Im Durchschnitt kürzt die Geschäftsleitung die Bezüge um 179 Euro. Deshalb ging die Belegschaft am 19.1.05 auf die Straße; 2.500 Beschäftigte nahmen an der Demonstration teil. Jetzt hat die Firmenleitung zumindest einen Abbau der Übertarife in Stufen zugesagt, LANXESS will die Zahlungen mit künftigen Entgelt-Erhöhungen verrechnen.
LANXESS bekommt Besuch
In Addyston, dem US-amerikanischen Standort von BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS im Bundesstaat Ohio, gehören Störfalle zum Normalfall. Seit der Leverkusener Multi das Werk 1996 von MONSANTO übernahm, ereigneten sich dort 66 Unfälle. Erst im Herbst 2004 trat zweimal in kurzen Abständen das Krebs erregende Gas Acrylnitril aus. Im März reiste ein Vertreter der Initiative OHIO CITIZEN ACTION in die Bundesrepublik, um dem LANXESS-Vorstand einen Protestbrief zu überreichen.
Protest gegen „AIDS“-Anzeige
Mit großflächigen Zeitungsannoncen, auf denen ein Schwulenpaar abgebildet ist, wirbt der BAYER-Konzern derzeit für Diagnostika zur Bestimmung des HI-Virus und setzt sich damit als ein Unternehmen in Szene, das sich bei der Behandlung von „AIDS“ besonders engagiert. Diese Selbsteinschätzung verweist das WISSENSCHAFTLICH-HUMANITÄRE KOMMITEE (whk) ins Reich der Illusionen. „Für das whk sind diese Äußerungen blanker Hohn. Es ist allgemein bekannt, dass sich BAYER aus der Erforschung wirksamer Medikamente gegen HIV und AIDS weitgehend zurückgezogen hat. Wenn der Konzern nun schwulen Männern, die in den westlichen Industrieländern nach wie vor am meisten von AIDS betroffen sind, ausgerechnet die Methode der Resistenzbestimmung nun als wichtigen Schritt gezielter und individueller Hilfe‚ verkaufen will, ist das mehr als zynisch. Vor dem Hintergrund des von BAYER-Medikamenten verursachten weltweiten AIDS-Skandals bekommt die Anzeige sogar den Charakter einer regelrechten Desinformationskampagne“, kritisierte die Initiative und rief zu Protesten auf.
Resolution gegen die Order 81
Die im Irak neu eingeführte Order 81 (SWB 1/05) sichert BAYER und anderen Agro-Multis den industriellen Zugriff auf die Landwirtschaft des Landes. Darum wandten sich Träger des Alternativen Nobelpreises und andere TeilnehmerInnen der Konferenz „Die Alternative - Ausblicke auf eine andere Globalisierung“ gegen das Gesetz. „Die Order 81‘ wurde vom US-Beauftragten für den Wiederaufbau des Irak, Paul Bremer, erlassen. Sie hat zum Ziel, dass die irakischen Bäuerinnen und Bauern zukünftig daran gehindert werden, ihre uralten Saaten und Kulturpflanzen anzubauen. Die Bäuerinnen und Bauern werden dazu gezwungen, nur noch industriell entwickeltes, gentechnisch manipuliertes und von Unternehmen patentiertes Saatgut zu verwenden. Wir fordern von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika wie von der Regierung des Irak, die Order 81' zurückzunehmen“, heißt es in der unter anderem von Vandana Shiva, Hans Peter Duerr und Johan Galtung unterschriebenen Erklärung.
Chemie-Kritik im TV
Das spanische Fernsehen zeigte einen Bericht über die Risiken der Chemie-Produktion bei BAYER & Co., zu dem auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) Informationen geliefert hatte. Der Journalist bedankte sich bei der CBG und gab zugleich einen Eindruck davon, wie schwierig es ist, in den Medien Kritik an den Konzernen zu üben. „Es war keine leichte Sache, diesen Film zu machen. Der Druck war so groß, dass wir am Ende vieles weglassen mussten, um den Rest zu schützen. Eines, was wir weglassen mussten, waren konkrete Bemerkungen zu konkreten Produkten. Deswegen musste die BAYGON-Sequenz (BAYER-Pestizid, Anm. Ticker) weg. Aber immerhin ist DIAZINON (dito) geblieben“, schrieb er.
KAPITAL & ARBEIT
Mehr Arbeit, weniger Lohn
BAYERs für Bau und Unterhalt von Anlagen zuständige Gesellschaft BAYER TECHNOLOGY SERVICES kündigte die Vernichtung von 255 Arbeitsplätzen an. Mit diesem Erpressungspotenzial ging das Unternehmen in die Verhandlungen mit dem Betriebsrat und erreichte gegen die Zusicherung, „nur“ 155 Stellen zu streichen, die Zustimmung zu einer 40-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich. Eine Öffnungsklausel im Tarifvertrag machte eine solche Lösung möglich. Der für eine alternative Gewerkschaftsgruppe im Betriebsrat sitzende Klaus Hebert-Okon kritisierte das Ergebnis der Einigung von Vorstand und IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE). Er befürchtet durch solche einseitigen Maßnahmen wahlweise eine den Zusammenhalt der BAYER-WerkerInnen schwächende neue Unübersichtlichkeit bei den Arbeitsbedingungen oder aber den Startschuss zu einer alle betreffenden größeren Lohnkürzungsoffensive.
Schlechtes Betriebsklima
Selbst führende ManagerInnen bewerten das Betriebsklima bei BAYER negativ. Bei einer Umfrage unter Leitenden Angestellten von 20 Chemie-Konzernen belegte der Leverkusener Agro-Multi mit einer Durchschnittsnote von 3,59 nur den 18. Platz.
126 Entlassungen in Lyon
BAYER CROPSCIENCE hat am französischen Standort Lyon 126 Beschäftigte entlassen.
BAYER schließt TDI-Anlage
BAYER hat im US-amerikanischen New Martinsville eine Anlage zur Produktion des Kunststoffs Tolylendiisocyanat (TDI) geschlossen und damit 30 Arbeitsplätze vernichtet. Im Zuge der Abwicklung drosselt der Multi auch die Herstellung von TDI-Beiprodukten am Standort. Von ehemals acht TDI-Fertigungsstätten bleiben jetzt nur noch die in Baytown, Dormagen und Brunsbüttel übrig. Ob sie alle überleben, wenn der Multi im Jahr 2009 sein neues Werk im chinesischen Shanghai in Betrieb nimmt, dürfte fraglich sein.
Arbeitsplatzvernichtung bei LANXESS
BAYER entschied sich Ende 2003, die Chemie- und Teile der Kunststoff-Sparte abzuspalten und unter dem Firmen-Namen LANXESS am 31. Januar 2005 an die Börse zu bringen. Seither reißen die Meldungen über Rationalisierungsmaßnahmen, Lohn-Kürzungen, und Arbeitsplatzvernichtung nicht ab. Im Juni beschloss die Geschäftsführung die Streichung von 960 Stellen in der Bundesrepublik. 500 Stellen fallen in der Leverkusener Feinchemie-Produktion weg. LANXESS plant überdies eine Veräußerung dieses Geschäftszweigs, der vor allem unter mangelnder Nachfrage von BAYERs verkleinerter Pharma-Sparte leidet - das wäre dann die Abspaltung der Abspaltung. 300 Jobs streicht der Konzern im Bereich Styrol-Harze und ABS-Kunststoffe am Standort Dormagen und 150 Jobs beim Beschäftigten-Pool. Darüber hinaus führt die Chemie-Firma die 35-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich ein. Zunächst stand sogar die Schließung von einem der beiden Feinchemie-Standorte im Raum - aber das war nur Teil „der sehr geschickten Taktik von Vorstandschef Axel Heitmann“, wie die Süddeutsche Zeitung schrieb. „Den Wettbewerb zwischen Dormagen und Tarragona heizte er immer wieder mit der Ankündigung an, nur einer von beiden könne überleben. In einer solchen Gemengelage sind Mitarbeiter bereit, Zugeständnisse zu machen, wenn es der Sicherung von Arbeitsplätzen dient“, so die Zeitung weiter. Die Börse honorierte die Poker-Qualitäten Heitmanns. Kurz nach Bekanntwerden der Rationalisierungsmaßnahmen stieg der Kurs der LANXESS-Aktie um bis zu fünf Prozent. Er dürfte in Zukunft noch mehr steigen, denn Heitmann kündigte weitere Arbeitsplatzvernichtungen an.
LANXESS ohne Papier-Chemie?
Die BAYER-Abspaltung LANXESS kündigte an, einen Partner für das Geschäft mit Papier-Chemikalien zu suchen. Auch einen Verkauf der Sparte hält der Vorstandschef Axel Heitmann für möglich. Den 350 MitarbeiterInnen an den Standorten Leverkusen und Bushy Park stehen also ungewisse Zeiten bevor. Bei anderen den Profit-Erwartungen nicht entsprechenden Betriebsteilen will das Unternehmen Heitmann zufolge ähnlich vorgehen.
Bei LANXESS geht die Angst um
Wie es um das Betriebsklima bei der permanent neue Arbeitsplatzvernichtungen bekannt gebenden BAYER-Abspaltung LANXESS bestellt ist, hat der Stern dokumentiert. Das Magazin zitiert einen Beschäftigten: „Es heißt, bei LANXESS sind die Betriebsteile, die keine oder geringe Rendite machen. Ja bin ich denn auch ein scheiß-unrentabler Mitarbeiter?“. Von Zukunftsangst gequält, schildert er den JournalistInnen seinen Gemütszustand: „Ich habe manchmal das Gefühl, ich fahre im Blindflug auf eine Straßenkreuzung zu und weiß nicht, ob es da weitergeht“.
LANXESS ohne Standort-Vereinbarung?
Finanz-AnalystInnen werten die von der BAYER-Abspaltung LANXESS übernommene „Standort-Sicherungsvereinbarung“, die bis 2007 betriebsbedingte Kündigungen ausschließt, als Bremse für den Börsenkurs. Deshalb stellt Unternehmenschef Axel Heitmann sie jetzt zur Disposition und will Unterredungen mit dem Betriebsrat führen. Die unerwartet schlechte Geschäftslage lasse ihm keine andere Wahl, bekundete Heitmann. Sollten die Gewerkschaften sich nicht gesprächsbereit zeigen, müsse LANXESS noch mehr Standorte als geplant schließen, drohte er. Eine einseitige Kündigung des Standort-Vertrages schloss der Vorstandsvorsitzende allerdings aus.
Sanierung auf Kosten von LANXESS
Wie von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) vorausgesagt, vergeht kaum ein Monat ohne Hiobsbotschaft von LANXESS. Nach Standortschließungen und massiver Arbeitsplatz-Vernichtung stellt die BAYER-Abspaltung nun auch noch die „Standort-Sicherungsvereinbarung“ in Frage (s. o.). Es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass der Pharma-Riese sich auf Kosten von LANXESS saniert hat. „Die Abspaltung des Chemie-Konzerns LANXESS von BAYER ist eine rundherum gelungene Veranstaltung - für BAYER“, schreibt die Faz. Der Pharma-Riese habe dem neu gegründeten Unternehmen Milliarden-Schulden aufgebürdet, profitable Chemie-Geschäfte wie WOLFF WALSRODE vorenthalten und es damit in eine schwierige ökonomische Lage gebracht, kommentierte die Zeitung.
Illegale Beschäftigung bei BAYER
Der Leverkusener Multi hat im Antwerpener Werk illegal ChinesInnen beschäftigt und sie auch noch zu chinesischen Konditionen (ca. 1 Euro Stundenlohn) bezahlt. Der Konzern beabsichtigte, sie für die Arbeit in der voraussichtlich 2009 fertiggestellten Kunststoff-Anlage in Shanghai zu schulen. Die hautnahe Konfrontation mit der chinesischen BAYER-Zukunft hat zudem bei den belgischen Beschäftigten Ängste vor Arbeitsplatzvernichtungen in Antwerpen entstehen lassen.
Hunderte in MitarbeiterInnen-Pools
Der „Standortsicherungsvertrag“ schließt bis 2007 betriebsbedingte Kündigungen aus. Deshalb parkt BAYER immer mehr MitarbeiterInnen in den so genannten Beschäftigten-Pools, wo sie dann auf Einsätze als SpringerInnen warten. Hunderte Belegschaftsangehörige, vor allem wegrationalisierte LaborantInnen und ChemikantInnen, befinden sich derzeit in dem „Zwischenlager“. Nach Ansicht der BASIS BETRIEBSRÄTE, einer oppositionellen Gewerkschaftsgruppe im Leverkusener BAYER-Werk, soll die perspektivlose Pool-Zeit die MitarbeiterInnen so mürbe machen, dass sie der Auflösung ihrer Verträge gegen Zahlung einer Abfindung zustimmen.
BAYER reduziert Übertarif
Das schlechte Beispiel der BAYER-Abspaltung LANXESS macht Schule (siehe AKTION & KRITIK). Wie das nunmehr selbstständige Chemie-Unternehmen reduziert nun auch der Leverkusener Multi die übertariflichen Zahlungen, indem er sie mit künftigen Entgelt-Erhöhungen verrechnen will.
BAYER-Betriebsrat gegen Grüne
Die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) hat schon vor langer Zeit ihren „sozialen Frieden“ mit dem Kapital gemacht. Angesichts von mehr als fünf Millionen Arbeitslosen zwingt sie das zu abenteuerlichen Volten. Da BAYER & Co. als unantastbar gelten, haben sie die Umweltpolitik der Grünen als Grund der Misere ausgemacht. „Die Grünen tun mit ihren ständigen Bedenken alles, um die deutsche Wirtschaft kaputt zu machen“, hetzte BAYERs Gesamtbetriebsratschef Erhard Gipperich und trat offen für eine Große Koalition in Nordrhein-Westfalen ein. Er brachte die „Initiative Pro Industriepolitik“ mit auf den Weg, der Betriebsräte von BAYER, TELEKOM, THYSSEN, FORD angehören. 1,2 bis 1,5 Millionen Beschäftigte repräsentiert sie nach Gipperichs Worten. Erste Tat der KollegInnen der Bosse: Sie schrieben einen Offenen Brief an den damaligen NRW-Ministerpräsident Peer Steinbrück, in dem sie eine Neujustierung des Verhältnisses zwischen Ökonomie und Ökologie forderten. Aber selbst Mitglieder der Initiative distanzierten sich von Gipperichs markigen Worten. Und andere Gewerkschaftler reagierten empört über den Wahlkampf des BAYER-Betriebsratlers: „Ein ziemlich dreistes Stück“.
Schneider für weniger Gewerkschaftsmacht
BAYERs Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Schneider tritt dafür ein, die paritätische Mitbestimmung abzuschaffen und fordert eine Reduzierung der Gewerkschaftsmandate. „Mitbestimmung ist kein Exportschlager. Es muss sich etwas ändern“, so Schneider.
Das Baden-Badener Netzwerk
Die seit 1954 stattfindenden „Baden-Badener Unternehmensgespräche“ sind eine wichtige Kaderschmiede der bundesdeutschen Wirtschaft. Alljährlich schickt die Deutschland AG ihren Manager-Nachwuchs auf die drei Wochen dauernden Lehrgänge. Viele der TeilnehmerInnen wie etwa Jürgen Schrempp oder Klaus Kleinfeld haben später Spitzenpositionen übernommen. BAYER-Chef Werner Wenning ist selbstverständlich auch ein Baden-Badener, er war 1991 beim 87. Unternehmergespräch mit von der Partie. Sein Amtsvorgänger Manfred Schneider holte sich beim 77. den „letzten Karriereschliff“, wie die Welt schreibt.
Verschärfte Eingangskontrollen
Die Pressefreiheit endet bei BAYER spätestens vor dem Werkstor. Die heiligen Hallen der Produktion bleiben JournalistInnen in der Regel verschlossen - der Konzern wird schon wissen, warum. Im letzten Jahr bemühten sich ReporterInnen aber doch einmal, in Leverkusen einen Blick hinter die Kulissen zu erhaschen, was das Unternehmen als den Versuch wertete, „in Industrie- und Chemieanlagen einzudringen“. Der Multi zog sofort Konsequenzen und machte sich an die „Optimierung der Zugangsregelung“. Ein Betreten des Geländes ist jetzt nur noch mit einem Ausweis möglich, dessen Gültigkeit ein Lesegerät prüft. Zudem schloss BAYER einige Eingangstore.
Krankenkassen-Beiträge für BAYER gesenkt
Der 1. Juli 2005 hat das Ende der paritätischen Krankenversicherung besiegelt. Seither zahlen BAYER & Co. prozentual weniger als die Beschäftigten. Während ihr Beitragssatz um 0,45 Prozent sinkt, steigt er für die Belegschaftsangehörigen um ebendiesen Anteil. Nach der Rechnung des Regierungsberaters Bert Rürup entlastet das die Unternehmen über die nächsten zwei Jahren um bis zu zehn Milliarden Euro.
Beschäftigte denken, BAYER kassiert
Die Verbesserungsvorschläge von Belegschaftsangehörigen rechnen sich für BAYER weit mehr als für die Kreativen selber. Die Umsetzung von 15.000 MitarbeiterInnen-Ideen brachte dem Leverkusener Multi im Jahr 2004 einen Rationalisierungsgewinn von über 9,6 Millionen Euro ein, der sich 2005ff fortschreiben dürfte. Den ErfinderInnen zahlte er für den Zugriff auf ihr geistiges Eigentum aber insgesamt nur 3,5 Millionen Euro an Prämien.
BAYER zahlt Bonus
Vor der 1997 geschlossenen „Standortsicherungsvereinbarung“ zahlte BAYER der Belegschaft noch einen jährlichen Bonus von 85 Prozent eines durchschnittlichen Monatseinkommens. Mittlerweils beträgt er lediglich 35 Prozent des Monatsentgelts. Das ergab für die 23.000 bundesdeutschen Tarif-Beschäftigten im Jahr 2005 eine Prämie in Höhe von 39 Millionen Euro.
ERSTE & DRITTE WELT
„Entwicklungshelfer“ BAYER
In Guatemala tritt der Leverkusener Agro-Multi als Entwicklungshelfer auf. Gemeinsam mit der bundesdeutschen „Gesellschaft für technische Zusammenarbeit“ (GTZ) lehrt er LandwirtInnen in der Region Las Verapaces „Nachhaltige Entwicklung“ à la BAYER: Die Bauern und Bäuerinnen sollen auf Brandrodungen verzichten und ihre Erträge lieber mit Saatgut und Pestiziden made in Leverkusen steigern.
Malaria-Initiative in der Kritik
Im Jahr 1998 startete die Weltgesundheitsorganisation WHO die Malaria-Initiative „Roll back Malaria“. In dessen Rahmen unterstützten die Weltbank und die Bill-Gates-Stiftung BAYER bei der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Malaria-Mittels, dessen Wirkstoff Artemisone ForscherInnen der „Hongkong University of Science and Technology“ entdeckten. Im April 2005 zog das medizinische Fachjournal The Lancet eine ernüchternde Zwischenbilanz des WHO-Programmes. Nach Meinung der WissenschaftlerInnen ist „Roll back Malaria“ weit hinter den selbstgesteckten Zielen zurückgeblieben, 60 Prozent der Erkrankten sofort eine medizinische Versorgung zu ermöglichen und so die Zahl der Malaria-Toten bis zum Jahr 2010 um die Hälfte zu senken. Jean-Marie Kindermans von ÄRZTE OHNE GRENZEN unterstützte den Vorstoß von The Lancet und kritisierte BAYER & Co. dafür, nicht genügend Artemisone-haltige Präparate zur Verfügung zu stellen. Für das Vorzeige-Projekt des Leverkusener Multis sieht es also schlecht aus.
IG FARBEN & HEUTE
Prinz Bernhard bei IG FARBEN
Der im Dezember 2004 verstorbene Prinz Bernard, der 1911 in Jena zur Welt kam, arbeitete in Amsterdam als Jurist bei dem von BAYER mitgegründetem Mörderkonzern IG FARBEN. Der Prinz war auch Mitglied der NSDAP und der SS.
IG-Gründung prosperiert
Die 1935 auf Initiative der IG FARBEN ins Leben gerufene „Gesellschaft für Konsumforschung“ (GfK) mit Sitz in Nürnberg weitet ihren Einfluss immer weiter aus. Mittlerweile gehören 120 Firmen zu ihrem Imperium, das sich über mehr als 60 Länder erstreckt. Damit gehört die GfK zu den weltgrößten Marktforschungsunternehmen. Die Idee zur Gründung der Gesellschaft hatte seinerzeit der im IG-Vorstand für BAYER zuständige Rudolf Wilhelm Mann. Der Arzneimittelverbrauch der „Volksgemeinschaft“ zählte deshalb zu den ersten Untersuchungsgegenständen der KonsumforscherInnen. Später widmeten sie sich vorzugsweise den Märkten derjenigen Länder, denen die Eroberungsgelüste der Nazis galten. So verfasste der spätere Bundeskanzler Ludwig Erhard eine „Südosteuropa-Untersuchung“ für die GfK, die auch heute noch gut in den ost- und südosteuropäischen Staaten vertreten ist.
POLITIK & EINFLUSS
Der Genosse der BAYER-Bosse
Die Bundesregierung unternimmt verstärkte Anstrengungen, um die Marktposition der bundesdeutschen Industrie in Südamerika vor allem gegen die wachsende chinesische Konkurrenz zu verteidigen. So führte die „Lateinamerika-Initiative der deutschen Wirtschaft“ im Mai 2005 gemeinsam mit VertreterInnen der Bundesregierung im kolumbianischen Cartagena die 9. Lateinamerika-Konferenz der deutschen Wirtschaft durch. Im Juli richtet der BDI mit Unterstützung aus dem Wirtschaftsministerium in Brasilien die deutsch-brasilianischen Wirtschaftstage aus, an der auch die „Agrobusiness-Initiative“ von BAYER & Co. teilnimmt. Es folgen weitere Aktivitäten, als deren Höhepunkt die für Ende des Jahres geplante Südamerika-Reise des Bundeskanzlers geplant ist - Flugbegleitung aus dem Hause BAYER dürfte obligatorisch sein.
Standort-Werbung durch WM
Im Herbst 2004 trafen sich Manager von BAYER und anderen Konzernen mit Bundeskanzler Schröder, um zu bereden, wie man die Fußballweltmeisterschaft als Werbung für die Unternehmen nutzen könnte. So entstand die Idee zum „1. FC Deutschland 06“. Der Sportbeauftragte des Leverkusener Multis, Meinolf Sprink, hat dabei gar keine Gewissensbisse. „Es ist richtig, Deutschland im Zuge der WM als Industriestandort zu präsentieren“, so Sprink. Noch dazu, wenn es so billig ist: der „1. FC Deutschland 06“-Vereinsbeitrag beträgt für BAYER und die anderen Sponsoren der Kampagne „Deutschland - Land der Ideen“ nur 100.000 Euro.
Wenning kritisiert Gentechnik-Politik
BAYER-Chef Werner Wenning hat die Haltung der Bundesregierung in Sachen „grüne Gentechnik“ scharf angegriffen. „Wir fürchten, dass die Pflanzen-Biotechnologie in Deutschland wegen der Haftungsregelungen nicht stattfindet“, sagte er. In einem anderen Interview sprach der Große Vorsitzende von einer „Forschungsblockade“ und „einem fundamentalen Konservatismus, der dem Standort Deutschland schadet“.
Garthoff kritisiert Gentechnik-Politik
BAYER CROPSCIENCE-Vorstandsmitglied Bernward Garthoff hat das Gentechnik-Gesetz kritisiert, über das der Vermittlungsausschuss verhandelt. Wegen der strengen Haftungsregelungen macht es seiner Meinung nach den Anbau von Gentech-Pflanzen in der Bundesrepublik unmöglich. „Wir verpassen die Chance, das Potenzial für eine Schlüsseltechnologie weiterzuentwickeln“, warnt er und stimmt den Standort-Blues an.
Gentech-Gesetz verändert
Die Kritik von BAYER & Co. am Gentechnik-Gesetz zeigt Wirkung. Die rot-grüne Bundesregierung hat bereits Veränderungen an dem Paragrafenwerk vorgenommen und damit den CDU-Ministerpräsidenten im Bundesrat die Zustimmung leichter gemacht. Für die Risiken und Nebenwirkungen steuerfinanzierter Freisetzungsversuche haftet jetzt nicht mehr die Industrie, sondern der/die SteuerzahlerIn. Zudem stehen die Informationen über die genaue Lage der Gentech-Äcker niemand mehr offen, der nicht erfolgreich ein „berechtigtes Interesse“ nachweisen kann. „Die Bundesregierung reduziert damit die Transparenz und mindert den Verbraucherschutz“, kritisiert der Präsident des NATURSCHUTZBUNDES DEUTSCHLAND (NABU), Olaf Tschimpke.
Gen-LobbyistInnen bei Künast & Co.
Nach Recherchen des Verbandes FRIENDS OF THE EARTH haben hohe BeamtInnen vom „Bundesamt für Verbraucherschutz“ und von der „Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft“, welche die Bundesrepublik auch bei der EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit vertreten, intensive Beziehungen zur Biotech-Industrie. Einige waren sich nicht einmal dafür zu schade, in den „Pro-Gentech“-Werbevideos von BAYER & Co. aufzutreten. Über ihre Entscheidungen bei der Zulassung von Freisetzungsversuchen und Gen-Pflanzen dürfte deshalb kaum Unklarheit bestehen.
Zuwachs im Verbindungsbüro
Im Oktober 2003 eröffnete der Leverkusener Multi seine Berliner Repräsentanz am Pariser Platz in unmittelbarer Nähe zum Regierungsviertel. Sinn und Zwecks des „Verbindungsbüros“ definiert BAYER-Chef Werner Wenning so: „Wir bei BAYER verstehen uns als Bestandteil der Gesellschaft und sehen es daher als unsere Pflicht, uns in die gesetzgeberischen Entscheidungsprozesse einzubringen“. Diese „Pflichterfüllung“ macht soviel Arbeit, dass der Agro-Riese das Personal aufstocken musste. Britta von Scharpen verstärkt jetzt das Team und lässt Böses ahnen. Die Dame soll sich nämlich vor allem um Fragen der Forschungs- und Sozialpolitik kümmern.
Synergieeffekt „Winnacker“
Ernst-Ludwig Winnacker ist so etwas wie das Drehkreuz der bundesdeutschen Gentechnik-Politik. Der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft gehört dem BAYER-Aufsichtsrat an, hat eigene Biotech-Firmen gegründet, berät Bundeskanzler Schröder in Sachen „Klone & Co.“ und schaltet und waltet im Genomforschungsnetzwerk. Für Unternehmen, bei denen er einen Aufsichtsratsposten inne hat, machte er im „Bundesministerium für Bildung und Forschung“ (BMBF) Millionen locker, wie das Buch „Die Gesundheitsmafia“ enthüllte. Für BAYERs Projekt „Entwicklung von biologischen Markern“ floss ein BMBF-Betrag in Höhe von 1,97 Millionen Euro.
BAYER kooperiert mit Umweltamt
BAYER hat gemeinsam mit dem nordrhein-westfälischen Landesumweltamt einen „Tag der Umwelt“ veranstaltet, der im Uerdinger Werk und auf dem Laborschiff „Max Prüss“ stattfand. Zur Feier des Tages waren auch 44 TeilnehmerInnen von BAYERs image-trächtig gemeinsam mit der UN initiiertem UmweltbotschaftlerInnen-Programm anwesend. Ihnen gaukelte der Konzern erfolgreich vor, der Rhein wäre ein reiner Fluss. „Sie haben es geschafft, dass der Rhein wieder sauberes Wasser führt. Wir möchten in Deutschland lernen, um unsere eigenen Probleme lösen zu können“, zeigte sich die in Singapur lebende Dorothy Cloaro begeistert. Der 1999 erschienene letzte Gewässergütebericht des Landes Nordrhein-Westfalen kam da zu ganz anderen Ergebnissen. Besonders in der Nähe der BAYER-Werke ließ die Wasser-Qualität zu wünschen übrig. So hatten die BAYER-Werke Dormagen und Wuppertal an den im Rhein nachgewiesenen Pestizid-Rückständen einen Anteil von 5-10 Prozent. Allein das Produkt DIURON fand sich in 73 Prozent aller Wasserproben. Ebenfalls ganz vorne mit dabei: Wirkstoffe der Ackergifte RAPIR, HEDOMAT, ECONAL und GOLTIX.
SPD-Bundestagsabgeordnete bei BAYER
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Andrea Wicklein besuchte BAYERs Biotech-Forschungszentrum im nahe Potsdam gelegenen Hermannswerder. Sie ließ sich durch die schöne neue Genwelt führen, die Folien, Papier, Klebstoff, Mayonnaise, Puddingpulver, Reis und Kartoffelstärke im Reagenzglas produziert und zeigte sich beeindruckt. „Faszinierend“, so ihr fachfrauliches Urteil. Die wackere Sozialdemokratin würde sogar kraftvoll in ein Gentech-Brötchen beißen: „Ich würde das essen, garantiert!“
Reul referiert bei BAYER
Im November 2004 besuchte der Industrieausschuss der Düsseldorfer „Industrie- und Handelskammer“ die BAYER-Niederlassung in Monheim. Auf der Tagesordnung stand eine Diskussion über die Zukunft der Gentechnologie in Nordrhein-Westfalen und ein Vortrag des für die CDU im Europaparlament sitzenden Herbert Reul. Der Politiker gehört dem Straßburger Forschungsausschuss an und sprach über die „Aktuelle Forschungsförderung in Europa“.
„Oberaufseher“ Schneider
Als „Oberaufseher“ der bundesdeutschen Wirtschaft bezeichnet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung BAYERs Aufsichtsratsvorsitzenden Manfred Schneider. „Niemand weiß mehr über das Innenleben deutscher Konzerne“, so die Zeitung. Schneider ist Aufsichtsratsvorsitzender bei BAYER und LINDE und hat einen Sitz in den Kontroll-Gremien von ALLIANZ, DAIMLER CHRYSLER, METRO, RWE und TUI. Damit bleibt er knapp unter der vom Aktiengesetz noch als tolerierbar erachteten Ämterhäufung. Über Unternehmen mit einem Börsenwert von 129 Milliarden Euro, einem Umsatz von 375 Milliarden und 1.1 Millionen Angestellten wacht Mister Aufsichtsrat und arbeitet dabei mit allen Großkopferten der Deutschland AG von Josef Ackermann bis zu Jürgen Schrempp zusammen.
Erleichterte Pillen-Zulassungen in der EU
Nach dem geplanten EU-Arzneimittelrecht soll die Zulassung einer Arznei in einem Mitgliedsstaat reichen, um sie auch in den anderen Ländern der Union auf den Markt bringen zu können. Dank der starken Lobbyarbeit von BAYER & Co. fallen dann zusätzliche nationale Untersuchungen z. B. über die Wechselwirkungen eines Medikamentes mit anderen Pillen und Studien mit AllergikerInnen oder Angehörigen anderer Risikogruppen über die Verträglichkeit eines Präparates weg. Aber die neue Regelung schränkt durch die erleichterten Genehmigungsverfahren nicht nur die Arzneimittelsicherheit ein - die Krankenkassen befürchten zudem eine Schwemme neuer, teurer und nur bedingt nützlicher Pharmazeutika.
Freundschaftsdienste von Florenz
In dem Europa-Parlamentarier Karl-Heinz Florenz (CDU) hat der Leverkusener Agro-Multi einen ganz treuen politischen Außendienstmitarbeiter. Nicht nur in Sachen „Chemikaliengesetz“ erweist sich der BAYER-Dauergast als treuer Sachwalter von Konzern-Interessen, auch in der Pharma-Politik erwirbt er sich Verdienste. Der Vorsitzende des EU-Parlamentsausschusses für Umwelt und Gesundheit hat an neuen Leitlinien mitgearbeitet, die den EU-Ländern Nachprüfungen anderswo bereits zugelassener Medikamente erschwert, was den Produkten von BAYER & Co. einen besseren Marktzugang sichert (s. o.).
Abgeordnete schreiben BAYTRIL-Brief
BAYER lässt nichts unversucht, das drohende Verbot des vor allem auf Hühnerfarmen verwendeten Antibiotikums BAYTRIL zu verhindern (siehe auch RECHT & UNBILLIG). Der Konzern engagierte den Lobbyisten Wayne Valis, um mit BeamtInnen aus dem Weißen Haus und mit FDA-Offiziellen über eine Aufhebung des geplanten BAYTRIL-Bannes zu verhandeln. Zusätzlich heuerte die Industrie-Vereinigung „Animal Health Institute“ für jährlich 75.000 Dollar den Ex-Senator Robert W. Kasten Jr. an, der seine alte Kontakte in den Dienst der BAYER-Sache stellen sollte. Als das alles nichts nutzte, tat sich der Multi im Kongress um und brachte den Republikaner Charles W. Pickering Jr. hinter sich. Unterstützt vom Lobbyisten Christopher Myrick setzte er mit 26 Kongress-Mitgliedern einen Brief an den FDA-Zuständigen Lester M. Crawford auf, in dem die PolitikerInnen die Veterinär-Antibiotika „als absolut notwendig zum Schutz der Gesundheit der Tiere“ bezeichneten, obwohl immer mehr BAYTRIL-resistente Bakterien in den Nahrungskreislauf gelangen und im menschlichen Organismus schwer behandelbare Infektionen auslösen. Die Gesundheitsbehörde reagierte schroff und teilte Pickering mit, sein Versuch, Crawford umzustimmen, stelle einen Bruch der US-Gesetze dar. „Als eine unfaire und unangebrachte Einmischung des Kongresses in ein juristisches Verfahren“ bezeichnete der Ex-FDAler Stanley Brand das Schreiben der Abgeordneten. Sein früherer Kollege Donald Kennedy sagte der Washington Post: „Ich habe während eines solchen quasi-juristischen Entscheidungsprozesses niemals solche Briefe erhalten und sollte sie auch nicht erhalten haben. Es ist schlicht ungehörig“.
PROPAGANDA & MEDIEN
Grünflächen zu Werbeflächen
Der Leverkusener Multi nutzte die über seiner ehemaligen Giftmüll-Deponie Dhünnaue errichtete Landesgartenschau ausgiebig als Werbeplattform. So veranstaltete der Konzern einen „Tag der Männergesundheit“, um für sein hinter den Umsatzerwartungen zurückbleibendes Potenzmittel LEVITRA Reklame zu machen. Zudem ließ er seine Werksfeuerwehr für ein sensationslüsternes Publikum den Ernstfall proben und gab HobbygärtnerInnen Pflegetipps inklusive Pestizidberatung. Parallel dazu stellte BAYER CROPSCIENCE im Rahmen der „Gärten des Lebens“ den so genannten Pflanzenschutzgarten vor. Angesichts von jährlich drei Millionen Pestizid-Vergiftungen wäre „Garten des Todes“ sicher ein angemessenere Bezeichnung. BAYER HEALTH CARE richtete dazu den „Gesundheitsgarten“ her - nur vor der Einrichtung eines „Gentech-Gartens“ schreckte BAYER wg. Akzeptanzproblemen zurück. Dafür bewarb der Konzern eine Veranstaltung der rheinischen WanderimkerInnen, die unter dem Motto „Gesunde Bienen für gesunden Honig“ stand, obwohl das BAYER-Pestizid GAUCHO wegen seiner bienentötenden Wirkung BienenzüchterInnen auf der ganzen Welt gegen den Agro-Riesen aufbringt.
Habemus BAYER
BAYER sponsort den Katholizismus und stellt dem im August in Köln stattfindenden Weltjugendtag Sachleistungen im Gesamtwert von ca. 400.000 Euro zur Verfügung. Der Multi erwartet einen Pilgerstrom von ca. 80.000 Menschen in Richtung BayArena. An diesem denkbar profanen Ort wollen die Gläubigen unter anderem Messfeiern abhalten. Bei dem zu erwartenden TV-Rummel und der damit einhergehenden medialen Präsenz des BAYER-Logos hat der Konzern seinen Kollektenbeitrag sicherlich gut angelegt.
Chinesische Ballon-Meisterschaft mit BAYER
Der Leverkusener Chemie-Multi nutzt alle Mittel und Wege, um den Namen BAYER im Boom-Land China bekannt zu machen. So nahm der Luftsport-Club BAYER an den „Internationalen Chinesischen Ballon-Meisterschaften“ teil und fuhr das übergroß auf dem Luft-Fahrzeug prankende BAYER-Kreuz 1.000 Kilometer durch das Reich der Mitte spazieren.
BAYER schult ApothekerInnen
Die Gesundheits„reform“ gestattet MedizinerInnen nur noch in Ausnahmefällen, rezeptfreie Arzneien zu verordnen. Aber BAYER hatte vorgesorgt und seine Werbeanstrengungen auf andere Zielgruppen verlagert. „Wir haben bereits vor fast 10 Jahren die strategische Entscheidung getroffen, uns in der Kommunikation auf den Endverbraucher und den Apotheker zu konzentrieren“, sagt Wolf-Ullrich Scherhag, der beim Konzern die Abteilung „Gesundheitspolitik“ leitet. Das Unternehmen nahm die jüngsten Entwicklungen aber zum Anlass, sich noch stärker auf die PharmazeutInnen zu konzentrieren. So kümmert sich der Pharma-Riese mit der „BayUni“ verstärkt um die konzern-konforme Fortbildung der ApothekerInnen. In Zusammenarbeit mit der „European Business School“ unterrichtet er sie in den Fächern „Kunden-Kommunikation“, „Handelsmarketing“ und natürlich besonders „Produkt-Präsentation“.
BAYER umwirbt Frauen als Kundinnen
Der Leverkusener Multi hat gemeinsam mit dem Kuratorium „Frau und gesunde Lebensführung“ eine Werbe-Offensive gestartet, um Frauen verstärkt als Kundinnen für rezeptfreie Medikamente zu gewinnen. In 2.000 Apotheken hat er Broschüren zum Thema „Frauengesundheit“ platziert. Zudem will der Konzern mit einer Umfrage die wachsende Bedeutung der Selbstmedikation statistisch belegen. „Frauentypische Bereiche, in denen die eigenverantwortliche Behandlung mittels Selbstmedikation möglich ist, sind beispielsweise Regelschmerzen, Vaginalpilz-Infektionen, Verdauungsbeschwerden und Migräne-Kopfschmerzen“, gibt die Pharma-Rundschau BAYER-Informationen wieder und vergisst nur, die dazugehörigen Produkte wie ASPIRIN, AKTREN, CANESTAN und RENNIES zu erwähnen.
BAYER betreibt Museumspädagogik
Sehr museal kommt das in Wuppertal ansässige Naturkunde-Museum Fuhlrott nicht daher. Es gibt sich „mit freundlicher Unterstützung von BAYER“ sehr gegenwartsbezogen und praxisorientiert. Der Konzern hat in dem Bau nämlich Labors eingerichtet, wo Molekular-BiologInnen des Unternehmens SchülerInnen unter anderem in DNA-Analysen unterweisen. Über die Motive dieses Engagements lässt der Leverkusener Agro-Multi kaum Zweifel aufkommen. „Wir tun das auch, um mit dem Interesse an Naturwissenschaften auch Arbeitskräfte für die Zukunft zu gewinnen“, sagt der BAYER HEALTH CARE-Leiter Bernd von der Linden.
Schulen erhalten 11.000 Euro
Schulen im Umfeld des Bitterfelder BAYER-Werkes haben vom Leverkusener Agro-Multi und anderen im Verband der Chemischen Industrie (VCI) organisierten Unternehmen insgesamt 11.000 Euro für die Anschaffung von Chemie-Lehrmitteln erhalten. Aber der Scheck kam nicht allein. „Zusätzlich legte der Chemie-Konzern eine Experimentieranleitung zur Herstellung von ASPIRIN mit bei“, schrieb die Mitteldeutsche Zeitung und gab so gründlicher Aufschluss über BAYERs Motive.
TIERE & ARZNEIEN
Immer noch BAYTRIL-Resistenzen
Im Jahr 2000 forderte die US-Gesundheitsbehörde FDA die Unternehmen BAYER und ABBOTT auf, ihre in der Massentierhaltung verwendeten Antibiotika vom Markt zurückzuziehen, weil immer mehr Bakterien gegen die Mittel Resistenzen ausbilden und - in die Nahrungskette gelangt - schwer behandelbare Krankheiten verursachen. So löst die Campylobacter-Bakterie nach Angaben eines medizinischen Instituts jährlich 2,4 Millionen Infektionen aus. Während ABBOTT sich der Entscheidung der FDA fügte, akzeptierte BAYER sie nicht. Trotzdem verzichten einige große Hühnerfarmen seitdem auf BAYTRIL. Aber die Wirkung der Tierarznei hält noch an. Selbst ein Jahr nach Absetzen des Mittels fanden ForscherInnen noch BAYTRIL-resistente Krankheitskeime in dem untersuchten Fleisch. In 33 Prozent der Proben des Hühnerzüchters TYSON wiesen sie Campylobacter-Bakterien nach, 96 Prozent davon waren gegen BAYTRIL immun. Hühner eines anderen Anbieters waren zu 19 Prozent von dem Erreger befallen, 43 Prozent davon resistent gegen das BAYER-Antibiotikum.
DRUGS & PILLS
Blind durch LEVITRA
BAYERs Potenzpille LEVITRA hat zahlreiche Nebenwirkungen. Als solche zählt eine von BAYER selbst in Auftrag gegebene Studie Kopfschmerzen, Gesichtsrötungen, Nasenschleimhaut-Entzündungen, Grippe-Symptome und Verdauungsbeschwerden auf (Ticker 1/03). Jetzt hat die US-Gesundheitsbehörde FDA auch eine Meldung über einen Fall von Blindheit nach Einnahme des Präparates gegen „erektile Dysfunktion“ bekommen. VIAGRA hat sogar schon 38 Menschen die Sehkraft geraubt.
FDA: Keine Infarkte durch ALEVE
Nach einer im Herbst 2004 vom US-amerikanischen „National Institute of Aging“ (NIA) veröffentlichten Studie steigerte BAYERs Schmerzmittel ALEVE mit dem Wirkstoff Naproxen für die ProbandInnen das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, um 50 Prozent. Die Verantwortlichen stoppten den Test sofort und informierten die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (siehe SWB 1/05). Diese überprüfte die ALEVE-Wirkung anhand von Daten, die BAYER bereitstellte, und stufte das Medikament im Gegensatz zum NIA als sicher ein.
Nr. 3 bei rezeptfreien Pillen
Im letzten Jahr übernahm BAYER die ROCHE-Sparte mit rezeptfreien Medikamenten und gehört seither weltweit zu den drei größten Anbietern in diesem Segment. Besonders auf dem Vitamin-Sektor hat der Pharma-Riese zugelegt. Neu zum Sortiment gehören die Multivitamine BEROCCA, SANATOGEN, SUPRADYN und die Spezial-Vitamine CAL-D-VITA, ELEVIT und REDOXON. Der Leverkusener Chemie-Multi vermarktet diese Mittel gern in armen Ländern als Stärkungsmittel, was regelmäßig Proteste von Initiativen wie der BUKO PHARMAKAMPAGNE hervorruft. „Multivitamin-Präparate oder Tonika zur Prophylaxe von Mangelerscheinungen anzupreisen, ist vor dem Hintergrund chronischer Mangelernährung zynisch und spricht nicht für das Verantwortungsbewusstsein der betroffenen Firmen“, kritisiert die Gruppe.
Bald noch mehr rezeptfreie Pillen?
Mit dem Erwerb der ROCHE-Sparte ist BAYER zum weltweit drittgrößten Anbieter von rezeptfreien Medikamenten aufgestiegen. Von Vitamintabletten über Magenpillen bis zu Haarwuchsmitteln wie PRIORIN und Kosmetika reicht nun das Sortiment. Da der Markt in diesem Segment wächst, allein im ersten Quartal 2005 um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr, plant der Konzern weitere Zukäufe. Vor allem nach Husten- und Erkältungsarzneien hält er Ausschau.
Konzentration auf dem Pillen-Markt
Seit der Gesundheits„reform“ erstatten die Krankenkassen vom Arzt verordnete rezeptfreie Medikamente nicht mehr. In der Folge brach der Markt ein. BAYER und andere große Hersteller waren allerdings die Krisengewinnler. Sie konnten sich dank großer Etats rechtzeitig auf den Wandel einstellen und ihre Werbemaßnahmen auf Apotheken und VerbraucherInnen umstellen (siehe auch PROPAGANDA & MEDIEN). Während kleinere Hersteller Einbußen von 20 Prozent hinnehmen mussten und in ihrer Existenz bedroht sind, reduzierte sich der Umsatz von BAYER & Co. im Geschäftsjahr 2004 nur um fünf Prozent - und dank der Erkältungswelle zum Jahreswechsel macht Big Pharma inzwischen schon wieder ein kräftiges Plus.
Neues Blasen-Medikament
BAYER bringt mit EMSELEX (Wirkstoff: Darifenacin) ein neues Medikament für PatientInnen mit überaktiver Blase heraus. Die Lizenz zur Vermarktung des Präparats hat der Pharma-Riese von NOVARTIS erworben.
BAYER die Nr.18
In der Liste der weltweit größten Pharma-Unternehmen nimmt BAYER den Rang 18 ein.
BAYER gesundet an Grippewelle
Der Umsatz von BAYERs Gesundheitssparte stieg im ersten Quartal 2005 um rund fünf Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Die Grippewelle erhöhte den Absatz von Erkältungspräparaten dermaßen, dass der Konzern sogar die starken Verluste durch den Ablauf des exklusive und entsprechend lukrative Vermarktung garantierenden Patents für das Antibiotikum CIPROBAY ausgleichen konnte.
CIPROBAY zum Inhalieren
Im Jahr 2003 lief der eine Monopol-Stellung garantierende Patentschutz für BAYERs Antibiotikum CIPROBAY aus. Die drohenden Einnahme-Verluste fing der Chemie-Multi zum Teil durch eine Umstellung der Darreichungsform oder eine geringfügige, neue Anwendungsgebiete erschließende Veränderung der Rezeptur ab. Die US-Gesundheitsbehörde FDA spielte das Recycling-Spiel jeweils mit und verlängerte das Patent bereits dreimal. Anfang 2005 kündigte der Leverkusener Multi nun wieder eine Schein-Innovation an. Er will gemeinsam mit dem US-Unternehmen NEKTAR eine CIPROBAY-Variante zum Inhalieren für Mukoviszidose-PatientInnen mit chronischer Lungenentzündung entwickeln.
GENE & KLONE
Gefährlicher Genraps
Jüngst veröffentlichte die britische Regierung die letzten Ergebnisse einer Studie über Risiken und Nebenwirkungen von Gen-Pflanzen. Die ForscherInnen legten Felder mit Herbizid-resistentem Gentech-Winterraps von BAYER und solche mit konventionellen Sorten an, zogen sie unter Pestizid-Einsatz auf und studierten die Umweltauswirkungen. Der Vergleich ging zu ungunsten des Rapses made in Leverkusen aus. Die Ackergifte auf den Genfeldern vernichteten Pflanzen, die Vögeln und Insekten als Nahrung dienen, und schränkten so die Biodiversität ein. Darüber hinaus kam es zu einem vermehrten Unkraut-Wuchs, der wiederum mehr Pestizide nötig machte. Der Agro-Multi zog die Konsequenzen. Er wollte auf einen Anbau des Winterrapses innerhalb der Europäischen Gemeinschaft verzichten und ihn lediglich noch in die EU-Region importieren. Brüssel jedoch akzeptierte eine entsprechende Änderung des Zulassungsantrages nicht. Eine endgültige Entscheidung fällt im Jahr 2006.
Gen-Pflanzen: Umsatzanteil 5 %
Im Geschäftsjahr 2004 betrug der Jahresumsatz von BAYER CROPSCIENCE 5,9 Milliarden Euro. Das Geschäft mit der Gentechnik hatte daran einen Anteil von fünf Prozent. Ca. 300 Millionen Euro spülte es in die Kassen.
Gentech-Boom in Brasilien
Brasiliens Präsident Lula da Silva hat im Jahr 2003 grünes Licht für die „Grüne Gentechnik“ gegeben. BAYER nahm die Einladung dankend an und pflanzt in dem südamerikanischen Land nun genmanipulierte Baumwoll-, Raps- und Reissorten an.
BIOGENIUS in Monheim
BAYERs „Start-Up-Initiative“ hat sich zum Ziel gesetzt, junge Biotech-Unternehmen zu unterstützen, um später von ihren Entwicklungen zu profitieren. Zu solchen Förderkandidaten zählt BIOGENIUS, das sich jetzt im Monheimer Chemie„park“ angesiedelt hat. Die Firma testet Haushaltsinsektizide gemäß der Biozid-Richtlinie der EU, übernimmt aber auch die Entwicklung von Mücken-Sprays und anderen Haushaltsgiften bis zur Marktreife, was beim Leverkusener Pestizid-Multi Outsourcing-Fantasien nähren könnte.
Kooperation mit ICON
BAYER CROPSCIENCE hat eine Zusammenarbeit mit ICON GENETICS vereinbart. Das Biotech-Unternehmen mit Firmensitzen in Halle und München will für den Agro-Multi pflanzliche Proteine finden, die in der Medikamenten-Produktion einsetzbar sind.
3. Testphase für Hautkrebs-Mittel
Der gemeinsam von BAYER und ONYX gentechnisch entwickelte Wirkstoff Sorafenib hat als Präparat zur Behandlung von Hautkrebs die Phase III der Erprobung erreicht. Gemeinsam mit den Chemotherapeutika Carboplatin und Paclitaxel soll BAY 43-9006 das Wachstum von Melanomen hemmen. Parallel dazu testen WissenschaftlerInnen die Substanz als Mittel gegen Nieren- und Leberkrebs.
BAYER sucht das Infarkt-Gen
BAYER, der „Herz-Kreislauf-Verbund Nordrhein-Westfalen“ und WissenschaftlerInnen der Universität Münster wollen die DNA von Herzinfarkt-PatientInnen mit der von gesunden Menschen vergleichen und so Aufschluss über eine etwaige genetische Veranlagung für Kreislauferkrankungen gewinnen. Ein absurdes Vorhaben, da die medizinische Fachwelt übereinstimmend eine ungesunde Lebensweise als Hauptrisikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall ausgemacht hat. Davon hat auch der Institutsdirektor Professor Gerd Assmann gehört. Diesen Zusammenhang hält er aber für genügend erforscht, ihn interessiert die Suche nach dem Herzinfarkt-Gen. „Was uns in den nächsten Jahre umtreiben wird, ist der Versuch, die genetische Disposition besser zu verstehen“, so der Arzt
SAATGUT & LANDWIRTSCHAFT
Neuer Raps von BAYER
BAYER CROPSCIENCE hat eine Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen CARGILL vereinbart. Die Konzerne wollen gemeinsam eine neue Rapssorte herstellen und vermarkten. BAYER stellt das Hybrid-Saatgut für eine Rapsart mit weniger gesättigten Fettsäuren her, CARGILL macht daraus Öl und verkauft es der Lebensmittel-Industrie. Darüber hinaus einigten sich die Geschäftspartner darauf, künftig gemeinsam Forschungsanstrengungen in Sachen Rapsöl zu unternehmen.
WASSER, BODEN & LUFT
Weitere Chrom-Untersuchungen
Das Grundwasser in der Umgebung des im südafrikanischen Durban gelegenen BAYER-Werks ist stark durch Krebs erregende Chrom-Verbindungen belastet (siehe auch SWB 4/04). Später fanden WissenschaftlerInnen das durch den Julia-Roberts-Film „Erin Brockovich“ berühmt-berüchtigte Chrom 6 auch in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern. Die Initiative SOUTH DURBAN ENVIRONMENTAL ALLIANCE forderte daraufhin flächendeckende Untersuchungen der DurbanerInnen, die im Umkreis der mittlerweile zu LANXESS gehörenden Niederlassung leben. Die Stadtverwaltung gab sie auch in Auftrag und will die Kosten dem Chemie-Unternehmen in Rechnung stellen.
In der unmittelbaren Nachbarschaft des Werkes geht die Angst um. „Wir leben auf Abruf. So sehe ich es. Wir wissen eben nicht, ob wir betroffen sind“, sagte Anil Ramlukan der südafrikanischen Sonntagszeitung The Times. Und Babs Govender erzählte dem Reporter: „Wir sind besorgt. Wir wissen nicht, ob das Chrom in unser Trinkwasser gelangt ist“. Der Konzern hingegen beschwichtigt. Wenn Personen nicht unmittelbar mit dem verseuchten Wasser in Verbindung gekommen sind, besteht keine Gesundheitsgefahr, so ein Sprecher. Zudem versucht die Firmenleitung sich der Verantwortung zu entziehen, indem sie auf angebliche Chrom-Belastungen weit vor der Zeit von BAYER/LANXESS verweist.
Marode Abwasser-Kanäle
Die Abwasser-Kanäle auf dem Gelände des BAYER-Chemie„parks“ Leverkusen entsprachen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Der Konzern musste 7,5 Millionen Euro in die Sanierung investieren.
Weniger Quecksilber in der EU?
Die EU plant, der Industrie Auflagen zur Reduzierung ihrer Quecksilber-Emissionen zu machen. BAYER leitet jährlich 33 Kilogramm des Schwermetalls, das massive Schädigungen des Nervensystems hervorrufen kann, in die Gewässer ein.
Noch mehr Giftmüll in Dormagen
BAYER betreibt die Abfall-Entsorgung mittlerweile als Geschäft und nimmt auch Fremdaufträge für die Deponien in Krefeld und Rheinfeld bei Dormagen an. So hat der Leverkusener Multi im Auftrag des „Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbands Nordrhein-Westfalen“ (AVV) im Februar 2005 ca. 30.000 Tonnen belasteter Böden und Schlacken nach Rheinberg gebracht und die AnwohnerInnen wohlweislich schon vorher vor Geruchsbelästigungen beim Einlagern gewarnt.
BAYER wirbelt Staub auf
Durch die neue EU-Richtlinie gerieten die durch Feinstäube ausgelösten Gesundheitsschädigungen in das Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit. In der Diskussion über die Ursachen für die Besorgnis erregenden Werte spielten BAYER & Co. jedoch kaum eine Rolle, die Emissionen wurden hauptsächlich dem Autoverkehr angelastet. Dabei bliesen die BAYER-Werke allein im Jahr 2000 ca. 1.900 Tonnen Feinstäube in die Luft.
PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE
Nr. 2 bei Pestiziden
BAYER war im Geschäftsjahr 2004 mit einem Umsatz von 7,30 Milliarden Dollar der weltweit zweigrößte Pestizidanbieter. Der Branchenführer SYNGENTA nahm 7,46 Milliarden ein.
GAUCHO vergiftet afrikanische Bienen
Eine Insekten-Plage führte in verschiedenen afrikanischen Ländern zu einem Großeinsatz von BAYERs berühmt-berüchtigtem Ackergift GAUCHO. In der Folge setzte ein massives Bienensterben ein. Besonders marokkanische ImkerInnen erlitten herbe Verluste. GAUCHO „hat Millionen Bienen getötet und die überlebenden so geschädigt, dass sie keinen Honig mehr produzieren“, klagt ein Bienenzüchter. UmweltschützerInnen befürchten auch eine Schädigung des Grundwassers durch das schwer abbaubare Insektizid, das in Frankreich wegen seiner „Nebenwirkungen“ nur noch für ganz bestimmte Anwendungen zugelassen ist.
Bienensterben in Zypern
In Zypern leiden BienenzüchterInnen unter einer Dezimierung ihrer Bestände durch das BAYER-Pestizid GAUCHO. Der EUROPÄISCHE IMKERBUND hat zur Beratung der ImkerInnen eine Delegation auf die Insel entsandt.
Noch mehr GAUCHO
Im Jahr 2006 läuft der Patentschutz für den bienentötenden GAUCHO-Wirkstoff Imidacloprid aus. Um drohende Umsatzrückgänge bei dem weltweit meistverkauftesten Insektizid auszugleichen, hat BAYER CROPSCIENCE mit dem israelischen Konzern MAKHTESHIM und dem dänischen Unternehmen CHEMINOVA, die beide GAUCHO-Nachahmerprodukte herstellen wollen, Verträge über Lieferungen der Wirksubstanz abgeschlossen. CROPSCIENCE-Chef Friedrich Berschauer rechnet aber trotz Endes der lukrativen Exklusivvermarktung von Imidacloprid weiter mit guten GAUCHO-Geschäften. „Patentfreie Kopien haben im Pflanzenschutz nicht so viel Bedeutung wie bei Arzneimitteln“, so Berschauer
Neues Anti-Pilzmittel
Der Fungizid-Markt boomt. Deshalb bringt BAYER in diesem Jahr das neue Anti-Pilzmittel PROSARO mit dem Wirkstoff Prothioconazole heraus.
BAYER berät LandwirtInnen
BAYER CROPSCIENCE will künftig mit der Einbecker HOFKONTOR AG bei der Beratung von LandwirtInnen in Sachen „Pestizid-Einsatz“ kooperieren. „Wir bieten dem Landwirt nicht nur Pflanzenschutzmittel an, sondern eine individuelle Beratung für diese Produkte, die individuell auf die Struktur seines Betriebes zugeschnitten sind“, erläutert BAYER CROPSCIENCE-Marketingleiter Ulrich Triebel. Besonders durch die verstärkte Tendenz zu Agrar-Großbetrieben und den damit verbundenen Rationalisierungsoffensiven sieht er die Chancen für „Gift nach Maß“ steigen. Da BAYERs Partner zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe berät, dürfte der Deal dem Konzern auch eine lukrative Monopolstellung im Segment „Pestizide“ bei den HOFKONTOR-KundInnen bescheren.
Holzgifte und kein Ende
BAYERs Tochter-Firma DESOWAG hat bis Mitte der 80er Jahre „Holzschutzmittel“ wie XYLADECOR produziert, die Gesundheitsschädigungen bei 200.000 Menschen verursachten. Erst als Giftopfer den Leverkusener Multi und andere Hersteller im so genannten Holzgifte-Prozess - dem größten Umwelt-Strafverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik - verklagten, trennte das Unternehmen sich von der DESOWAG. Aber immer noch erhält die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) Briefe von Holzgifte-Geschädigten oder deren Anwälten mit Bitten um Unterstützung.
PLASTE & ELASTE
Nr. 48 bei Autozulieferern
In der Rangliste der 100 weltgrößten Autoindustrie-Zulieferer nimmt BAYER MATERIAL SCIENCE die Position 48 ein. 25 Prozent ihres Umsatzes bestreitet die Teilgesellschaft des Konzerns mit VW & Co. Sie beliefert die Autobauer hauptsächlich mit Kunststoff-Produkten und Lacken.
Bisphenol A in Baby-Trinkflaschen
Viele Baby-Trinkflaschen bestehen aus dem auch von BAYER hergestellten Kunststoff Polycarbonat, der wiederum den Weichmacher Bisphenol A enthält. Bisphenol A gleicht in Aufbau und Wirkungsweise menschlichen Hormonen, was zu Fehlreaktionen des menschlichen Organismus führen kann. Die Nachricht, dass WissenschaftlerInnen im Inhalt von Baby-Trinkflaschen Spuren des Weichmachers nachgewiesen haben, alarmierte deshalb die Öffentlichkeit. Einige Hersteller stiegen daraufhin sofort auf ein anderes Material zur Produktion der Flaschen um.
Krebs durch Bisphenol A
Nach neuen Untersuchungen kann das in BAYER-Kunststoffen wie MAKROLON enthaltene Bisphenol A Prostatakrebs verursachen.
NANO & Co.
Kontaktlinsen von BAYER
Die Firma PLASMA-CHEM hat Kontaktlinsen entwickelt, die sechs Monate lang im Auge bleiben können. Die mikroskopisch kleine Werkstoffe verarbeitende Nanotechnik hat ihre Silicium-Oberflächen für Sauerstoff durchlässig gemacht, was Verschmutzungen verhindern soll. Für die Herstellung und Vermarktung der Linsen hat PLASMA-CHEM gemeinsam mit BAYER das Unternehmen LENSWISTA gegründet. UmweltschützerInnen warnen vor der Nanotechnologie, weil bei der Fertigung der winzigen Substanzen ebenso winzige Stäube entstehen, die alle Filter-Anlagen passierend in die Luft vordringen und über die Atemwege auch leicht in den menschlichen Organismus gelangen und Gesundheitsschäden verursachen können.
PRODUKTION & SICHERHEIT
Lösemittel schädigen die Ohren
Im Jahr 2000 hatten ForscherInnen der Universität Toronto entdeckt, dass werdende Mütter, die während der ersten drei Monate ihrer Schwangerschaft an ihrem Arbeitsplatz mit organischen Lösemitteln wie Aceton, Phenol oder Trichlorethylen in Kontakt gekommen waren, überdurchschnittlich oft taube Kinder gebären (Ticker 1/00). Neuere arbeitsmedizinische Untersuchungen bestätigen jetzt die Gefährlichkeit von Lösemitteln für die Ohren. Toluol und Styrol, die bei BAYER in der Pestizid- und Kunststoff-Produktion Verwendungen finden, sowie Trichlorethylen und Ethylbenzol stehen den Studien zufolge im Zusammenhang mit Hörschädigungen. Ein besonderes Risiko tragen Beschäftigte, die am Arbeitsplatz nicht nur den Chemikalien, sondern zusätzlich noch Lärm ausgesetzt sind, was beim Leverkusener Multi oft der Fall sein dürfte. So weist der Konzern im „Sustainable Development“-Bericht für das Jahr 2000 die Zahl von 130 „anerkannten“ Berufskrankheiten aus und nennt als Auslöser neben Asbest vor allem Lärmexpositionen. Die Berliner Arbeitsmedizinerin Gisela Fox forderte nach Veröffentlichung der Forschungsarbeit: „Dem potenziellen Risiko chemisch induzierten Hörverlustes muss generell mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden“ und tritt unter anderem für Forschungsprojekte zur Bestimmung angemessener Grenzwerte ein.
STANDORTE & PRODUKTION
BAYER zahlt Gewerbesteuer
Wider Erwarten zahlt BAYER nun doch Gewerbesteuer an die Stadt Leverkusen. Aber nicht die im Geschäftsjahr 2004 rasant gestiegenen Umsätze und Gewinne veranlassten die Multi dazu, sondern eine Betriebsprüfung durch das Finanzamt. Die BeamtInnen entdeckten in den Büchern nämlich so manchen nicht ganz legalen Steuertrick und zwangen den Konzern damit zur Nachzahlung eines zweistelligen Millionen-Betrages.
LINDE liefert Industriegase
BAYER-Aufsichtsratschef Manfred Schneider sitzt auch dem LINDE-Kontrollgremium vor. Das scheint den Geschäftsbeziehungen gut getan zu haben. Der Agro-Riese gab LINDE nämlich den Zuschlag, den Konzern langfristig mit den Industriegasen Wasserstoff und Kohlenmonoxid zu beliefern, die der Leverkusener Multi zur Fertigung von Lack, Klebstoffrohstoffen und Vorprodukten des Kunststoffs Polyurethan benötigt. LINDE baut zur Produktion der Gase auf dem Gelände des Dormagener Chemie„parks“ für 60 Millionen Euro eine Anlage, die im Herbst 2005 ihren Betrieb aufnehmen soll.
LANXESS hält BIS-Anteile
Auch nach dem Rückkauf der Wandelanleihe (siehe IMPERIUM & WELTMARKT) gibt es noch Beziehungen zwischen dem Leverkusener Multi und seiner Chemie-Abspaltung LANXESS. So hält das neugründete Unternehmen an den bundesdeuschen Standorten Anteile an BAYERs Chemie„park“-Betreibergesellschaft BAYER INDUSTRY SERVICES (BIS), in Dormagen etwa belaufen sie sich auf 40 Prozent.
Produktionsverlagerung nach China
BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS demontiert in Houston eine Anlage zur Herstellung der Chemikalie Hydrazinhydrat und in Leverkusen eine zur Hydrazinhydrat-Weiterverarbeitung, um sie in China wiederaufzubauen. Wieviele Arbeitsplätze der Konzern so an den alten Standorten vernichtet, gab er nicht bekannt.
IMPERIUM & WELTMARKT
LANXESS: BAYER lässt los
Im Juni 2005 hat BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS die vom Konzern zur Verfügung gestellte Wandelanleihe in Höhe von 200 Millionen Euro zurückerworben. Das Bankhaus MORGAN STANLEY verkaufte sie in Form von Aktien an institutionelle Anleger weiter und stockte damit das Grundkapital des neuen Unternehmens beträchtlich auf, das sich durch diese Transaktion finanziell von BAYER abgekoppelt hat.
Kooperation mit HOFKONTOR
BAYER CROPSCIENCE will künftig mit der Einbecker HOFKONTOR AG bei der Beratung von LandwirtInnen in Sachen „Pestizid-Einsatz“ kooperieren (siehe auch PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE).
BAYER kauft ZEPTOSENS
BAYER TECHNOLOGY SERVICES hat von NOVARTIS das Schweizer Unternehmen ZEPTOSENS erworben, das Analyse-Verfahren für die Biotechnologie entwickelt.
BAYER baut für WACKER
Der österreichische Chemie-Konzern WACKER gab BAYER TECHNOLOGY SERVICES (BTS) den 10 Millionen Euro schweren Auftrag, in Shanghai eine Trocknungsanlage für Pulver aus Polymer-Kunststoff zu bauen.
BAYER liefert Chloranlage
BAYER TECHNOLOGY SERVICES (BTS) baut für ein chinesisches Unternehmen eine Chlortrocknungsanlage in der Volksrepublik. „Chlor ist für die chemische Industrie so wichtig wie Strom für Rechner“, sagt BTS-Sprecher Arnold Rajathurai. Für UmweltschützerInnen hingegen ist die hoch giftige, nur schwer abbaubare Substanz eine der gefährlichsten Chemikalien überhaupt.
BAYER liefert Chloranlage
BAYER TECHNOLOGY SERVICES (BTS) baut für das Unternehmen BORSODCHEM in Ungarn eine Chlortrocknungsanlage.
BAYER baut in Kasachstan mit
BAYER TECHNOLOGY SERVICES (BTS) beteiligt sich in Kastachstan am Bau einer Bioethanol-Anlage.
Rapsöl-Kooperation mit CARGILL
BAYER CROPSCIENCE hat eine Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen CARGILL vereinbart. Die Konzerne wollen gemeinsam eine neue Rapssorte herstellen und vermarkten (siehe auch GENE & KLONE).
CIPROBAY-Kooperation mit NEKTAR
BAYER will Ciprofloxacin, den Wirkstoff des Antibiotikums CIPROBAY, künftig auch zum Inhalieren anbieten und beauftragte das US-Unternehmen NEKTAR mit der Herstellung des Trockenpulvers und des Inhalationssystems.
Zusammenarbeit mit TEIJIN
BAYER verstärkt die Zusammenarbeit mit dem japanischen Unternehmen TEIIJIN Ltd, mit dem der Konzern im Jahr 2004 bereits das Joint Venture TEIJIN-BAYER POLYTEC Ltd. gegründet hat. Die beiden Unternehmen vereinbarten, sich gegenseitig mit Polycarbonaten zu beliefern. TEIJIN erhält MAKROLON und der Leverkusener Multi im Gegenzug dafür PANLITE.
BAYER wächst in China
Der Leverkusener Multi erwartet Profitsteigerungen in China. Besonders durch die prosperierende Auto-, Bau- und Elektronikindustrie rechnet BAYERs China-Chef Jürgen Dahmer mit Zuwächsen. Auch im Gesundheits- und Agrarsektor erhöhen sich Dahmer zufolge die Marktchancen für Konzern-Produkte. Bislang erwirtschaftete der Global Player mit seinen 17 Niederlassungen in China, Taiwan und Hongkong einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro. Davon entfi