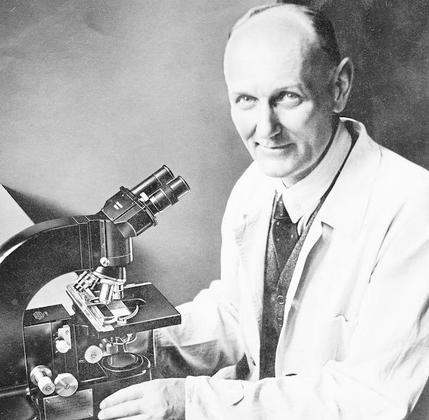Aktion & Kritik
Schuldig in 26 Fällen
Das BAYER-Tribunal
Rekord eingestellt: Wie schon im vergangenen Jahr boten auch 2017 wieder 26 Gegen-RednerInnen dem BAYER-Management Paroli und dominierten so die Hauptversammlung. Und nicht nur gegen die geplante MONSANTO-Übernahme trugen sie gewichtige Argumente vor. Von gefährlichen Infrastruktur-Projekten wie der Kohlenmonoxid-Pipeline und den Risiken und Nebenwirkungen von Pestiziden über die Geschäftspolitik des Konzerns in Ländern der sogenannten Dritten Welt bis hin zu gesundheitsschädlichen Chemikalien und Medikamenten reichte ihr Themen-Spektrum.
Von Jan Pehrke
In früheren Zeiten zelebrierten die BAYER-Hauptversammlungen geschlossen das Hochamt für den Profit. Ab 1983 änderte sich dies allerdings. Von da an brachte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) ketzerische Töne in die AktionärInnen-Treffen ein. Und seit geraumer Zeit fallen mehr und mehr vom Glauben ab und entweihen so die heiligen Hallen weiter: Die Zahl der vor die Mikrofone tretenden Konzern-KritikerInnen übersteigt diejenige der Konzern-LaudatorInnen verlässlich um ein Vielfaches. Wovon aber die CBG nach der letzten HV selbst kaum zu träumen wagte, wiederholte sich 2017: Wieder meldeten sich 26 Gegen-RednerInnen zu Wort.
Viele von ihnen widmeten sich der von BAYER geplanten Übernahme von MONSANTO. Aber auch andere Risiken und Nebenwirkungen des agro-industriellen Komplexes standen auf der Tagesordnung wie z. B. die Gefahren, die von Pestiziden ausgehen. Die Brasilianerin Verena Glass, die für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in São Paulo arbeitet und sich in einer Initiative gegen Agro-Chemikalien engagiert, berichtete vom verheerenden Ausmaß des Gift-Einsatzes in ihrem Land. Nirgendwo auf der Welt bringen die LandwirtInnen so viele Pestizide aus wie in Brasilien. In einigen Regierungsbezirken sind es rund 400 Liter pro EinwohnerIn. Mit entsprechenden Folgen: In den Teilen des Staates mit einer intensiv betriebenen Landwirtschaft übertreffen die Krebsraten diejenigen der Gebiete ohne endlose Mais- und Soja-Felder um ein Vielfaches.
Doppelte Standards
Einen nicht geringen Anteil an den vielen Krankheitsfällen haben ganz bestimmte Ackergifte. Vielfach handelt es sich dabei nämlich um solche, die wegen ihrer Gefährlichkeit in der Europäischen Union gar nicht mehr zugelassen sind oder es nie waren, wie Carbendazim, Cyclanilide, Disulfoton, Ethiprole, Ethoxysulfuron, Ioxynil, Thiadiazuron oder Thiodicarb. Christian Russau vom DACHVERBAND DER KRITISCHEN AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE brachte dies der Hauptversammlung zu Gehör. Als Beispiel nannte er den Wirkstoff Thiodicarb: Während die EU die Substanz gar nicht erst zuließ und die USA sie aus dem Verkehr zogen, vertreibt der Leverkusener Multi Thiodicarb in Brasilien ohne Rücksicht auf Verluste unter dem Namen LARVIN. Ein klarer Fall von doppelten Standards also, was BAYER jedoch abstreitet. Von Russau schon vor der HV um eine Stellungnahme zum Sachverhalt gebeten, fand der Konzern eine originelle Erklärung für „die feinen Unterschiede“, die er beim Verkauf seiner Produkte macht. Der Agro-Riese begründete sie mit den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort, „was die lokal angebauten Kulturen, Böden, Vegetationszonen, Anbau- und Klimabedingungen sowie das Auftreten von Schadinsekten, Unkräutern und Pflanzen-Krankheiten angeht“. Da Kaffee, Reis und Zuckerrohr in Europa kaum heimisch wären, wären es die dafür benötigten Agro-Chemikalien auch nicht, weshalb der Global Player für sie in Brüssel – „auch aus wirtschaftlichen Gründen“ – keine Zulassung beantragt habe. „Tja, so kann man das auch formulieren. Wenn man will. Statt ‚verboten’ sagen Sie einfach, BAYER habe für diese Mittel keine Zulassung in europäischen Ländern beantragt“, resümierte Russau.
Auch in Indien befleißigt sich die Aktien-Gesellschaft doppelter Standards, wie Sarah Schneider von MISEREOR mit Verweis auf Vorort-Recherchen des EUROPEAN CENTER FOR CONSTITUTIONAL AND HUMAN RIGHTS (ECCHR) monierte. So vermarktet der Leverkusener Multi das Ackergift NATIVO (Wirkstoffe: Trifloxystrobin und Tebuconazole) dort ohne den Warnhinweis an Schwangere, dass es werdendes Leben schädigen kann, während sich ein entsprechender Vermerk in Europa auf jeder Packung findet. Weil BAYER damit gegen internationale Handelsrichtlinien und das bundesdeutsche Pflanzenschutz-Gesetz verstößt, hatte das ECCHR bei der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen – allerdings erfolglos – eine Klage eingereicht. Und auch die indischen Behörden ermitteln in der Sache, teilte Schneider mit.
Zudem vernachlässigt es der Konzern dem ECCHR zufolge, die LandwirtInnen im Umgang mit den Mitteln zu schulen und sie über Sicherheitsvorkehrungen wie etwa das Tragen von Schutzkleidung zu informieren. Darum reiste im April 2017 eine Gruppe von FAO-ExpertInnen nach Neu Delhi und konfrontierte BAYER mit unangenehmen Fragen. „Gibt es bereits Empfehlungen vom Gremium?“ und „Wurden bereits Maßnahmen getroffen, um die möglichen Verletzungen des internationalen Kodex und der indischen Gesetzgebung zu beheben und in Zukunft zu vermeiden?“, wollte Schneider deshalb von Werner Baumann wissen.
Der Vorstandsvorsitzende beließ es allerdings bei vagen Auskünften. Es „wurde die Intensivierung von Schutzmaßnahmen diskutiert“ beispielsweise durch „die Zurverfügungstellung persönlicher Schutzkleidung“, teilte er mit und darüber gesprochen, „wie Kleinbauern in Indien noch besser in der effizienten und sicheren Anwendung von Pflanzenschutzmitteln trainiert werden können.“ Den LandwirtInnen wichtige Informationen über die Risiken und Nebenwirkungen von NATIVO vorenthalten zu haben, stritt er Schneider gegenüber schlicht ab: „In Bezug auf unsere Produkte folgen wir dem internationalen Verhaltenskodex der Welternährungsorganisation FAO.“
Eine besonders gefährliche Eigenschaft von Pestiziden wie NATIVO besteht darin, hormon-ähnlich zu wirken. Sie sind deshalb imstande, den menschlichen Organismus gehörig durcheinanderzuwirbeln und Krebs, Diabetes, Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit sowie andere Gesundheitsstörungen auszulösen. Wie diese sogenannten endokrinen Disruptoren das genau machen, legte der Kinderarzt Gottfried Arnold dar. „Stellen Sie sich einen werdenden Jungen in einem Schwangerschaftsalter von ca. acht Wochen vor: Er ist wenige Gramm schwer und ca. drei Zentimeter lang. Jetzt schon beginnen seine eigenen winzigen Hoden die Menge von männlichem Geschlechtshormon zu bilden (...) Bringen die östrogen-artig wirkenden Fremdhormone in dieser frühen Phase dieses System aus dem Gleichgewicht, kann es einerseits zu Fehlbildungen der Geschlechtsorgane wie z. B. Hodenhochstand oder Fehlmündung der Harnröhre kommen. Andererseits kann sich statt eines männlichen ein weibliches Gehirn entwickeln mit der Folge der Störung der sexuellen Identität.“
Auf einer von der EU erstellten und nicht einmal vollständigen Liste mit Pestiziden, welche diese hormonellen Effekte haben, befinden sich elf von BAYER, rechnete Susanne Smolka vom PESTIZID AKTIONS-NETZWERK (PAN) der Vorstandsregie vor: „Das sind 34 Prozent!“ Und damit nicht genug, stellt der Konzern auch noch andere Produkte wie etwa die Industrie-Chemikalie Bisphenol A her, die unter die Kategorie „Pseudo-Hormone“ fallen. Bereits seit 2009 schickt sich die Europäische Union an, für diese Stoffe strengere Regelungen zu treffen bzw. sie ganz aus dem Verkehr zu ziehen, aber da ist der Leverkusener Multi vor, wie die PAN-Mitarbeiterin berichtete. „Wir wissen, dass sich die BAYER AG aktiv dafür eingesetzt hat, dass die Umsetzung dieser demokratisch vereinbarten Regelungen über Jahre von der EU-Kommission verschleppt wurden“, so Smolka.
Das stellte BAYER-Chef Baumann jedoch in Abrede: „Unternehmen und Verbände haben nie einen Zweifel daran gelassen, dass eine Regulierung sogenannter endokriner Disruptoren selbstverständlich notwendig ist.“ Lediglich über den Weg dahin, „zu praktikablen Regulierungskriterien zu gelangen, die es erlauben, die wirklich relevanten Substanzen auch sicher zu identifizieren“, bestände nicht immer Einigkeit zwischen Industrie, Politik und zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, behauptete er.
Bienensterben
Großen Raum nahm auf der Hauptversammlung wieder ein weiterer bitterer Effekt vieler Pestizide ein: Ihre bienenschädliche Wirkung. Gleich vier ImkerInnen hatten den Weg nach Bonn gefunden, um die verhängnisvollen Folgen der BAYER-Produkte PONCHO (Wirkstoff: Clothianidin) und GAUCHO (Wirkstoff: Imidacloprid) zu beschreiben. Diese Ackergifte aus der Gruppe der Neonicotinoide können nämlich eine ganze Kettenreaktion in Gang setzen. Heike Holzum führte dies den AktionärInnen vor Augen. Die Bienenzüchterin machte ihnen deutlich, wie immens wichtig die Bienen für die Bestäubung der Nutzpflanzen und somit für die Ernten sind. Mit ihnen steht also auch die Zukunft der Nahrungsmittel-Versorgung auf dem Spiel. Die EU hat PONCHO & Co. nicht zuletzt deshalb mit einem vorläufigen Verkaufsbann belegt. Dagegen klagt der Leverkusener Multi allerdings, hält er doch seine Mittel für unschuldig am Bienensterben. Zum Beweis verweist der Konzern dabei unter anderem auf eine neue Studie mit dem Saatgutbehandlungsmittel PONCHO. An deren Seriösität meldete Holzum allerdings massive Zweifel an. Auch ihre Kollegin Annette Seehaus-Arnold, die Vorsitzende des ImkerInnen-Kreisverbandes Rhön-Grabfeld, kritisierte die Untersuchung, die in Mecklenburg-Vorpommern stattfand. Ihrer Ansicht nach produziert bereits das Studien-Design entlastende Resultate. So waren etwa auch die Bienen aus der Kontrollgruppe Ackergiften ausgesetzt, was einen seriösen Vergleich massiv erschwert. Trotz dieser günstigen Bedingungen konnten die ForscherInnen die Pestizid-Effekte allerdings nicht ganz negieren. So maßen sie einen Clothianidin-Rückstand im Nektar von 3,5 Mikrogramm/kg. Das alles hielt den BAYER-Manager Dr. Richard Schmuck jedoch nicht davon ab, Entwarnung zu geben: „Die Ergebnisse zeigen, dass die früher behördlich zugelassene Behandlung von Raps-Saatgut mit Clothianidin Honigbienenvölkern und den getesteten Wildbienen-Arten keinen Schaden zufügt.“ Schleierhaft blieb Seehaus-Arnold eine solche Schlussfolgerung.
Markus Bärmann versuchte indessen, BAYER schon aus einem Eigeninteresse heraus zu einer Umkehr in Sachen „Neonicotinoide“ zu bewegen. Bienenwachs ist nämlich ein wichtiger Grundstoff für die pharmazeutische Industrie, und eine Verunreinigung kann doch eigentlich nicht im Interesse des Produzenten liegen, meinte der Imker. Christoph Koch vom „Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbund“ legte derweil den Zusammenhang zwischen der durch eine Milbe übertragenen Bienenkrankheit Varroatose, welche der Konzern immer für die Dezimierung der Bestände verantwortlich macht, und der Ausbringung von PONCHO & Co. dar. Durch deren Einwirkung sinkt nämlich die Brutnest-Temperatur, was die Vermehrung des Parasiten beflügelt. „Seit die Neonics verwendet werden, gehen unsere Bienen an der Varroa kaputt“, hielt er fest.
Aber der Imker, der schon zum neunten Mal bei einer BAYER-Hauptversammlung sprach, erweiterte diesmal die Perspektive. Koch kritisierte nicht nur das ganze Konzept der durchindustrialisierten Landwirtschaft, wobei er überraschenderweise sogar Unterstützung von Seiten der „Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft“ in Anspruch nehmen konnte, sondern griff auch das dahinterstehende Prinzip an: „Meine Damen und Herren Aktionäre, bei meinen Reden ging es immer nur um die Bienen. Das, was BAYER mit uns Menschen macht, weil es bei den Aktien immer nur ums Geld geht, sogar um sehr viel Geld, das ist das wirklich Schreckliche! Die Honigbienen sind nur der Anfang.“
Werner Baumann jedoch leugnete bereits den reinen Tatbestand des Bienensterbens. Er hatte stattdessen sogar eine wundersame Vermehrung der Bestände um 60 Prozent ausgemacht. Und auf die Pestizide aus seinem Hause ließ er auch nichts kommen: „Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass Neonicotinoide keine Gefahr für die Bienengesundheit darstellen, wenn sie ordnungsgemäß angewendet werden.“
CO & Co.
Aber nicht nur mit Pestiziden bedroht BAYER Mensch, Tier und Umwelt, und nicht nur bei den Agro-Chemikalien leugnet der Konzern diesen Tatbestand. Gottfried Arnold, der in seiner Rede neben dem Gefahren-Potenzial von Ackergiften unter anderem auch dasjenige der Kohlenmonoxid-Leitung des Unternehmens thematisierte, musste diese Erfahrung machen. Nachdrücklich warnte der Kinderarzt vor der Inbetriebnahme des zwischen den Standorten Dormagen und Krefeld verlaufenden Röhrensystems. „Wissen die Aktionäre, welches Hochrisiko-Projekt Sie betreiben mit einer Giftgas-Pipeline, die eine so schlechte Leck-Erkennung hat, dass Hunderte oder Tausende verletzt oder getötet sein könnten, bevor der erste Alarm in der BAYER-Sicherheitszentrale ausgelöst werden kann?“, fragte er.
Dieter Donner, der Presse-Koordinator der Stopp-BAYER-CO-Pipeline-Initiativen, appellierte ebenfalls eindringlich an den Vorstand, von dem Projekt abzulassen: „Bei dem Giftgas CO, das schon mit der Menge eines Weinglases – das sind 100 Milliliter – eingeatmet einen erwachsenen Menschen ohnmächtig und bewegungsunfähig macht und letztlich tötet, sind Transporte unverantwortlich.“ Donner plädierte deshalb dafür, den „ehernen Grundsatz der Chemie“ zu befolgen und die Substanz vor Ort zu produzieren. Auch nach der Weigerung des Bundesverfassungsgerichts, die Verfassungsgemäßheit des Gesetzes, das den Weg für die Pipeline freimachte, zu überprüfen, sieht er keine Zukunft für das Vorhaben. Seiner Meinung nach wird die Entscheidung der Karlsruher RichterInnen, den Fall wieder dem Oberverwaltungsgericht Münster zu übergeben, das Verfahren noch weiter verzögern. Zudem hat Donner zufolge „noch immer das Urteil aus dem Jahr 2011, in dem das Projekt als rechtswidrig (...) beurteilt wurde“, Bestand. Mit Verweis auf den damals von den RichterInnen nicht akzeptierten Antrag, die zahlreichen die Sicherheit zusätzlich gefährdenden Abweichungen vom genehmigten Plan, die sich im Zuge der Arbeiten ergaben, nachträglich abzusegnen, bezeichnete er die Kohlenmonoxid-Leitung als „Schwarzbau“.
Der BAYER-Chef tat jedoch so, als ob er mit alldem nichts mehr zu tun habe. Weil der Leverkusener Multi im Begriff ist, sich von seiner Kunststoff-Sparte zu trennen, gliederte er die Fragen nach der Sicherheit der Kohlenmonoxid-Leitung gleich mit aus. Obwohl der Konzern aktuell noch 44,8 Prozent der Anteile an dem Geschäft mit Plaste & Elaste hält, betonte Werner Baumann, „dass die CO-Pipeline ein Projekt des rechtlich unabhängigen Unternehmens COVESTRO ist, so dass wir uns dazu nicht im Detail äußern können“. Ganz entrückt erschien ihm das Röhren-Werk schon. Auskünfte dazu musste er angeblich bei der BAYER-Tochter einholen. Was er dort zur Gefährlichkeit des Vorhabens vernahm, beruhigte ihn aber völlig. „Insofern sehen wir das von ihnen angedeutete Risiko nicht“, beschied der Ober-BAYER Gottfried Arnold scheinheilig.
Ein anderes umstrittenes Infrastruktur-Projekt setzte Michael Aggelidis von der Partei „Die Linke“ auf die Agenda der Hauptversammlung. Der Bonner Rechtsanwalt sprach über den Plan, die Autobahn A1 in Leverkusen auf bis zu 12 Spuren zu erweitern und eine neue Rheinbrücke zu errichten, was es nötig macht, BAYERs erst zur Landesgartenschau 2005 einigermaßen abgedichtetes Giftgrab „Dhünnaue“ wieder zu öffnen. Als hochgefährlich empfand es der Jurist, die Totenruhe von Quecksilber, Arsen, Chrom, Blei & Co. zu stören – und unnötig noch dazu. Es gibt ihm zufolge nämlich die Alternative, den Verkehr statt über eine Mega-Brücke unterirdisch durch einen Tunnel zu führen und so die Deponie unangetastet zu lassen.
Vom BAYER-Chef erbat Aggelidis die Information, wie er die Altlasten denn zu entsorgen gedenke und wer im Falle des Falles die Haftung für Kontaminationen übernimmt. Der Angesprochene fühlte sich aber wieder mal nicht zuständig. „Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW, ist hier Bauherr. Daher müssen Fragen zu eventuellen Haftungen dorthin und nicht an BAYER gerichtet werden. Auch zu Fragen der Abfall-Entsorgung sowie Teil-Abtragung von Abfällen sind die zuständigen Behörden in diesem Fall die richtigen Ansprechpartner.“ Ansonsten versicherte Werner Baumann, Straßen.NRW bei den Neubau-Planungen nach Kräften zu unterstützen. In der Diskussion um „Tunnel oder Stelze“ schien er sich zunächst nicht positionieren zu wollen. „Entgegen Ihrer Annahme haben wir selber keine favorisierte Variante“, teilte er dem kritischen Aktionär mit, um dann jedoch zu einem „aber“ anzuheben: „Aber wir haben immer darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit des Gefahrgut-Transportes gewährleistet sein muss“. Und das sieht der Global Player eben bei einem Tunnel nicht gewährleistet. Obwohl ein Gutachten für ein solches Unterfangen unlängst praktikable Vorschläge machte, mochte das Unternehmen die Ergebnisse nicht akzeptieren. „Für uns ist wichtig, dass der Gefahrgut-Verkehr über eine Autobahn-Trasse möglich ist“, erklärte ein Sprecher von BAYERs Tochter-Firma CURRENTA im März 2017.
Bittere Pillen
Gewohnt umfangreich fiel bei der Hauptversammlung auch wieder die Schadensbilanz von BAYERs Pharma-Sparte aus. Den ersten Eintrag nahm der Internist Dr. Jan Salzmann aus Aachen vor. Er widmete sich in seiner Rede dem Gerinnungshemmer XARELTO und schilderte die Probleme, die dieses Medikament in der Praxis bereitet. Weil Blutungen zu den häufigsten Nebenwirkungen der Arznei gehören und es dafür kein Gegenmittel gibt, zögern die Krankenhäuser Operationen von XARELTO-PatientInnen oftmals aus Angst vor Komplikationen hinaus, obwohl die Eingriffe eigentlich dringlich wären, informierte der Mediziner. Schon an den Zulassungsstudien erhob er Zweifel, hatte der Leverkusener Multi die ProbandInnen doch handverlesen und nur Personen unter 70 Jahre mit gesunden Nieren ausgesucht, um positivere Resultate zu erreichen. „Post-faktisch“ nannte Salzmann daher, was der Global Player gerne unter „Science for a better Life“ subsummiert. Und der Mediziner wusste auch, warum der Konzern zu solchen lebensgefährlichen Tricks greift: aus reiner Profit-Gier.
Es war dann eine Betroffene selbst, die die Schadensbilanz fortschrieb. Dr. Beate Kirk schilderte ihre Erfahrungen mit dem levonorgestrel-haltigen Verhütungsmittel MIRENA. „Mein Fazit: Für meine Psyche war die Verwendung der Hormonspirale eine Katastrophe. Wie viele andere Frauen litt ich unter der Hormonspirale an heftigen Depressionen, weder Antidepressiva noch Gesprächstherapie halfen. Erst nach dem Entfernen der Hormonspirale ging es ständig aufwärts“, so Kirk. Den verkaufsfördernden Verweis auf die lediglich lokale Wirkung der MIRENA muss BAYER mittlerweile in Anführungszeichen setzen, merkte die Apothekerin an. Auch räumt der Konzern ihr zufolge inzwischen selber ein, dass sich das Levonorgestrel im Blutkreislauf nachweisen lässt. Allerdings ist diese Kunde noch längst nicht bis zu allen FrauenärztInnen vorgedrungen, und Beate Kirk ahnte auch schon, weshalb: „Ich persönlich frage mich, welche Informationen die Pharma-Referenten des Arzneimittel-Herstellers den Mitarbeitern der gynäkologischen Praxen vermitteln.“
Natürliche nur „sachliche, wissenschaftliche Informationen“, vermeldete Werner Baumann. Ansonsten ging er bei der Konfrontation mit einer Pharma-Geschädigten wieder nach dem alten Muster vor. Er drückte ob der erschütternden Krankengeschichte sein Mitgefühl aus, blieb in der Sache aber hart. „Wir bedauern es sehr, dass Sie persönlich eine Beeinträchtigung ihrer Gesundheit erlitten haben, die Sie in Zusammenhang mit der Verwendung unseres Produktes bringen. Das Nutzen/Risiko-Profil von MIRENA ist allerdings positiv“, so der Ober-BAYER. Nur leider musste der Manager einräumen, dass die Aufsichtsbehörden sich dieses Profil derzeit genauer anschauen – und zwar gerade im Hinblick auf die von Beate Kirk so leidvoll erfahrene Nebenwirkung „Depression“.
Thomas Gabel buchte dann den nächsten Posten in die Schadensbilanz ein. Er sprach für die Betroffenen des AIDS-Skandals der 1980er Jahre. Damals hatten BAYER & Co. Blutprodukte auf den Markt gebracht und sich aus Profit-Gründen gespart, die Präparate Virus-Inaktivierungsverfahren zu unterziehen. In der Folge infizierten sich Gabel und Zehntausende Bluter sowie andere auf Blutkonserven angewiesene PatientInnen mit AIDS und/oder Hepatitis-C. „Wie wurden in der BAYER AG die Verantwortlichen für die HIV-Infektionen zur Rechenschaft gezogen?“, wollte der Bluter deshalb vom Vorstand wissen. Er zählt zu den nur noch 550 Überlebenden in der Bundesrepublik. Oftmals können sie nicht mehr voll oder gar nicht mehr arbeiten und sind deshalb auf das – magere – Zubrot der Stiftung „Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen“ angewiesen. An der Gründung dieser Einrichtung im Jahr 1995 hatten sich BAYER und andere Unternehmen beteiligt. Aber die Kranken lebten länger, als die Konzerne einkalkuliert hatten, und so versuchten sie in der Folge permanent, ihren Anteil am Etat zu drücken. Auch in diesem Frühjahr liefen wieder Verhandlungen mit der Bundesregierung, die sich schwierig gestalteten. Darum fragte Gabel: „Warum gibt es von Seiten der BAYER AG noch immer keine konkrete Zusage für Zustiftungen in den nächsten Jahren?“
„Wir sind mit dem Gesundheitsministerium in konstruktiven Gesprächen über die weitere Beteiligung der Pharma-Industrie an der Sicherung der Zukunft der Stiftung“, antwortete ihm Werner Baumann – wider besseren Wissens. Zu diesem Zeitpunkt war nämlich der Ausstieg der Konzerne aus dem Hilfsfonds längst beschlossene Sache. Ohnehin sah er in dem Mitwirken an dem Unterstützungswerk nur einen Akt der Barmherzigkeit, aber längst kein Schuldeingeständnis: „BAYER bestreitet (...) ein Fehlverhalten bei der Herstellung und Vermarktung dieser Produkte.“
Dies sollte Baumann auch bei dem Präparat tun, welches das Pharma-Kapitel im „Schwarzbuch BAYER“ schloss: DUOGYNON. Dieser hormonelle Schwangerschaftstest der heute zu BAYER gehörenden Firma SCHERING hat ab den 1950er Jahren zu tausenden Totgeburten geführt. Darüber hinaus kamen bis zum Vermarktungsstopp Anfang der 1980er Jahre unzählige Kinder mit schweren Missbildungen zur Welt. Gleich zwei Frauen berichteten in Bonn von diesem schweren Einschnitt in ihrem Leben. Valerie Williams war dazu extra aus England angereist. Sie hat nie wie andere Mütter mit Freude erleben dürfen, „wie die Kinder älter werden, wie sie Freundschaften schließen und Erfahrungen machten“, erzählte sie und nannte den Umgang mit dem Medikament „vorsätzlichen Kindesmord“. Margret-Rose Pyta war Zeugin eines solchen: Ihre beiden Kinder starben in jungen Jahren. „Zwei Kinder, die hätten leben können. Sie wurden ums Leben gebracht, weil mir mein Frauenarzt DUOGYNON gegeben hat“, klagte sie an und wendete sich an den Vorstandsvorsitzenden: „Ich möchte, dass Sie Verantwortung übernehmen!“ Das mochte der Angesprochene jedoch nicht: „Wir schließen DUOGYNON als Ursache für embryonale Missbildungen aus“, hatte Baumann schon in seiner Reaktion auf die Rede Gottfried Arnolds klargestellt.
Eigentlich sollte sich der BAYER-Chef an diesem Tag noch mehr über den Schwangerschaftstest anhören müssen. Auf der RednerInnen-Liste stand nämlich ursprünglich der Name von Petra Marek. Da die Ratzeburgerin auf einen Rollstuhl angewiesen ist und eine so lange Veranstaltung nur unter großen Anstrengungen durchsteht, hat die Coordination im Vorfeld Kontakt mit den BAYER-Verantwortlichen aufgenommen und von ihnen auch die Zusicherung erhalten, die Medikamenten-Geschädigte frühzeitig ans RednerInnen-Pult zu rufen. Dies ist jedoch nicht geschehen, und irgendwann am späten Nachmittag zwangen ihre angeschwollenen Beine Petra Marek, unverrichteter Dinge wieder die Heimreise anzutreten. Offenbar wollte der Konzern sich und seinen AktionärInnen den Anblick eines Menschen ersparen, den DUOGYNON in den Rollstuhl brachte. In der Absicht, einen versöhnlichen Abschluss der Hauptversammlung zu inszenieren, ließ BAYER lieber Joachim Kregel von der „Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger“ den Endpunkt setzen. Dieser aber konnte die 26 kritischen AktionärInnen, die vor ihm geredet und die Folgen der unerbittlichen Profit-Gier so eindringlich beschrieben hatten, nicht so einfach vergessen machen.