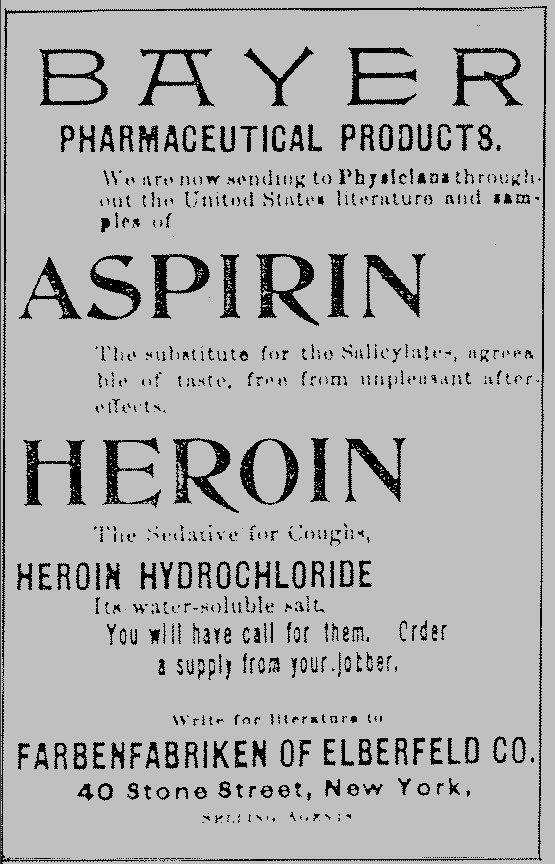Pressemitteilung vom 29. September 2004
Video Wie BAYER AIDS nach Asien importierte
Im WDR Fernsehen läuft heute der Film „Tödlicher Ausverkauf - Wie AIDS nach Asien kam“ von Egmont R. Koch. Darin wird aufgezeigt, wie eine Tochterfirma des BAYER-Konzerns Blutkonserven nach Asien exportierte, obwohl diese mit HIV belastet waren und in den USA nicht mehr verkauft werden durften.
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren kämpft seit den 80er Jahren für eine Entschädigung der Betroffenen und eine Bestrafung der verantwortlichen Manager. Im Folgenden dokumentieren wir Teile des Sende-Manuskripts.
„Tödlicher Ausverkauf“
San Francisco/Kalifornien war 1985 Schauplatz eines Medikamenten- Skandals, der selbst Contergan weit in den Schatten stellt. Erst heute, zwei Jahrzehnte später, legen geheime Firmenunterlagen das ganze Ausmaß offen; erst jetzt haben die Überlebenden eine Chance, gegen die Verantwortlichen vorzugehen.
Cutter Laboratories, eine hundertprozentige Tochterfirma des Pharmakonzerns Bayer AG, betrieb damals in ganz Amerika Blutspende-Stationen, um aus dem so gewonnenen Blutplasma Medikamente herzustellen. Als sich AIDS auszubreiten begann, gelangte das tödliche Virus sehr schnell auch in diese Medikamente.
Ein Montagmorgen, Anfang Mai 1985. Rushhour auf der Bay-Bridge. Ein Exportmanager von Cutter auf dem Weg zu seinemBüro. Er steht unter Druck. Seit Monaten schon. Seine Vorgesetzten verlangen, dass er die mit AIDS verseuchten Medikamente nach Asien verkauft.
Hongkong. Während der Tag in San Francisco gerade begonnen hat, neigt er sich in Asien bereits dem Ende zu. Im Stadtteil Wanchai hat Cutters Vertriebsfirma ihr Büro, im Caltex-House. Zu nächtlicher Stunde telefoniert Abteilungsleiter Raymond Ho mit dem Cutter-Headquarter. Er verlangt, dass die Patienten in Hongkong sofort das neue AIDS-sichere Produkt erhalten. Doch er wird abgewimmelt. Wieder einmal. Der Chinese ist empört, dass er nun schon seit Monaten Cutters „Koate“ in Hongkong verkaufen muss, obwohl dies fast sicher mit HIV-Viren verseucht ist.
In San Francisco diktiert der Exportmanager sofort nach dem Telefonat einen Vermerk:
„Am Montagmorgen, um 1.00 Uhr nachts Hongkong-Zeit, erhielt ich einen Anruf von Raymond Ho. Raymond war ungehalten...Einige Ärzte, die aus den Vereinigten Staaten nach Hongkong zurückgekehrt sind, behaupten, ...dass Cutter offenbar überschüssige Lagerbestände mit AIDS verseuchter, alter „Koate“-Präparate in die Entwicklungsländer verscherbelt... ...Es scheint, dass es keine Märkte mehr in Asien gibt, auf denen wir nennenswerte Mengen absetzen können.“
Rückblick: San Francisco, Juli 1983. Viele Amerikaner lassen sich in diesen Jahren regelmäßig Blutplasma abnehmen. Für wenige Dollar. Blutspenden gehört in den USA zum sozialen Netz. Ein bequemer Nebenjob für Geringverdiener, eine Überlebenschance für Arbeits- und Obdachlose. Das große Geld machen Pharmafirmen wie die Bayer-Tochter Cutter. Sie spalten das gelbe Blutplasma in seine Bestandteile, gewinnen daraus Medikamente. Die müssen sich Bluter-Kranke regelmäßig injizieren, weil ihrem Blut die natürliche Fähigkeit zur Gerinnung fehlt. Mit dem therapeutische Fortschritt für die Patienten ist der Bedarf an Rohstoff - gespendetem Blutplasma - erheblich gestiegen. Bluterkranke Kinder wie Jacky in Taipeh sollen davon profitieren. Dessen Mutter will ihm damals die teure medikamentöse Behandlung unbedingt ermöglichen. Obwohl zunächst keine Krankenkasse dafür aufkommt.
Im Herbst 1983 bricht in San Francisco, wo viele Spendestationen für Blutplasma in den Drogen- und Schwulenvierteln wie dem „Mission District“ angesiedelt sind, eine Katastrophe über die Blutindustrie herein: AIDS. Längst hat sich die tödliche Immunschwäche ihren Weg von infizierten Spendern zu den ahnungslosen Bluter-Patienten gebahnt. Als Monate später das HIV-Virus entdeckt wird, rechnet Cutter intern längst mit dem Schlimmsten: einer AIDS-Seuche unter Blutern in der ganzen Welt. Da Zehntausende von Einzelspenden vor der Weiterverarbeitung zu den Medikamenten zusammengeschüttet werden, können bereits einzelne HIV-Infizierte ganze Plasma-Bottiche verseuchen. Doch Cutter spielt auf Zeit. Wie die gesamte Branche. Thomas Drees war damals Präsident eines Konkurrenzunternehmens von Cutter. Er kehrte der Blut-Industrie den Rücken, weil sie die vorhersehbare Katastrophe herunterspielte, um ihre Umsätze nicht zu gefährden.
O-Ton Thomas C. Drees, ehemaliger Präsident „Alpha Therapeutics“:
„Wenn sie diesen Stoff in den Blutkreislauf des Patienten bringen, dieses Virus, das ihn auf zwanzig verschiedene, schreckliche Weisen umbringen kann, durch schlimme Hautveränderungen, durch ein kaputtes Immunsystem, Tuberkulose, Krebs, wie kann man da einfach behaupten, das sei kein Problem? Allen war klar, dieses Virus ist gefährlich! Es wird unsere Patienten umbringen. Und zu hoffen, alles werde vorübergehen, war verrückt!“
Bei Cutter vor den Toren von San Francisco vergeht nach der Entdeckung des AIDS-Virus im April 1984 ein geschlagenes halbes Jahr, ohne dass durchgreifende Maßnahmen gegen die Gefahren ergriffen werden. Dabei liegt längst die Behörden-Zulassung für eine neue Generation des Medikaments „Koate“ vor. Durch eine simple Erhitzung des Präparats können Viren abgetötet werden, wahrscheinlich auch die AIDS-Erreger. Dennoch zögert die Bayer-Tochter mit der Einführung des neuen, hitzebehandelten Produkts „Koate HT“.
Wissenschaftler im amerikanischen Seuchen-Zentrum „Centerfor Disease Control“ (CDC) in Atlanta entdecken im Oktober 1984 in unzähligen Proben des Bluter-Medikaments HIV-Viren - dank eines gerade entwickelten Testverfahrens. Nach Erhitzung der Präparate allerdings, so heißt es in einer Studie des CDC, die „in Zusammenarbeit mit Cutter“ vorgenommen worden sei, habe man hinterher „keine Viren mehr feststellen“ können. Ein eindeutiger Befund.
Im November 1984 tagt in San Francisco Cutters BCC-Komitee, in dem regelmäßig Vermarktungsstrategien festgelegt werden. Die Bayer-Tochter liefert zwar inzwischen das neue „Koate HT“ aus. Doch dann kommt es laut Protokoll zu einem folgenschweren Beschluss:
„Wir haben übermäßige Bestände des alten Produkts auf Lager. Es muß deshalb geprüft werden, ob mehr von diesem Produkt verkauft werden kann.“
Hongkong, November 1984. Zwei Wochen, nachdem Cutters Entscheidungsgremium beschlossen hat, die Lagerbestände der alten AIDS-verseuchten Medikamente nicht zu vernichten, sondern zu verkaufen, geht bei der Vertriebsfirma im Caltex House ein Fernschreiben aus San Francisco ein. Herzlichen Dank „für Ihr Interesse an dem hitzebehandelten Präparat“, heißt es da. Allerdings könne Hongkong das neue „Koate HT“ vorläufig nicht bekommen. Sorry... „..we must use up stocks...“
...„Wir müssen Lagerbestände aufbrauchen...“
Thomas Drees, der ehemalige Boss in der Blutindustrie, kann kaum glauben, was er in Cutters Telex liest. O-Ton Thomas C. Drees:
„Die Cutter-Verantwortlichen suchten offensichtlich einen Weg, die nicht-hitzebehandelten Präparate loszuwerden. Das ist unglaublich. Sie verkauften dieses Zeug nach Hongkong, als sei es gut genug für die Chinesen. Das ist schrecklich! Es gibt dafür keine Rechtfertigung! Man kann nicht sagen, weil wir feste Lieferverträge auf der Basis des billigeren, alten Präparats haben und jetzt das neue Produkt teurer wird, müssen wir euch leider Gift liefern!“
Interne Dokumente, die beweisen, dass Cutter-Verantwortliche damals entschieden, die mit HIV-Viren verseuchten Präparate zu verkaufen statt sie zu vernichten, sind erst vor kurzer Zeit entdeckt worden. O-Ton Lexi J. Hazam, Rechtsanwältin:
„Sie versteckten ihre Akten, verhinderten damit, dass die Geschichte aufgedeckt wird. Die kamen erst unlängst im Rahmen eines Prozesses ans Licht. Wir arbeiteten die Dokumente durch und stellten fest, dass Cutter das alte Präparat sogar eine Zeitlang weiter produzierte, obwohl sie
längst eine Zulassung für das neue besaßen. Der Grund: Sie hatten „fixed-price contracts“, Festpreise für das alte Produkt verabredet und wollten davon profitieren.“
Seit März 1984 laufen bei Cutter zwei Produktionen parallel: die des hitzebehandelten und dadurch AIDS-sicheren „Koate HT“ und die des nicht-erhitzten, gefährlichen Präparats. Dessen Herstellung wird zwar Ende 1984 gestoppt. Doch nur die Patienten in den USA und in Europa kommen in den Genuss des neuen Produkts. Die gefährlichen Chargen gehen nach Asien.
Intern erhalten sie eine spezielle Nummer: „659“. Die Cutter-Verantwortlichen setzen darauf, dass sich das tödliche Risiko ihres Medikaments „Koate“ noch nicht bis zu den Kunden in Fernost herumgesprochen hat.
San Francisco, Februar 1985. Inzwischen gibt es bei Cutter Lieferschwierigkeiten mit dem neuen „Koate HT“, wegen eines Großauftrags aus Kanada. Einer der Vertriebsleute verweist auf die in Hongkong und Taiwan sehr niedrigen Erlöse. Es sei deshalb zweckmäßig, Kanada zu beliefern und dafür die Umstellung in Asien weiter hinauszuzögern. Für Fernost bleibe von Mai bis Juli nur das alte, nicht-erhitzte Medikament. Eine erhebliche Menge sei man dort bereits losgeworden. Die Verkaufsabteilung werde versuchen, mehr abzusetzen.
„Das BCC-Komitee wird die Sache genau im Auge behalten und......nur dann verlangen, Präparate abzuschreiben, wenn alle anderen Optionen geklärt wurden.“
O-Ton Lexi J. Hazam, Rechtsanwältin:
„Sie bewerteten ihren Profit höher als die Gesundheit und das Leben ihrer Patienten!“
Laut Protokoll waren informiert: Jack Ryan, Präsident. Er lehnt jeden Kommentar ab.
Willi Ewald, deutscher Verkaufsmanager: kein Kommentar!
Karl Fischer, deutscher Abteilungsleiter: kein Kommentar!
Pete DeHart, Vertriebsmanager: kein Kommentar!
Wilhelm Schaeffler, deutscher Vorstand: kein Kommentar!
Merrill Boyce, Assistent des Vorstands...
Merrill Boyce ist nach mehr als einem Dutzend Absagen der erste ehemalige Cutter-Manager, der zu einem Interview bereit ist - auf dem Balkon seines Hauses, mit Blick auf San Francisco.
O-Ton Merrill T. Boyce, ehemaliger Cutter-Manager:
„Ich erinnere mich nicht an eine solche Diskussion, unsichere Präparate irgendwo hin abzuschieben. Ich erinnere mich, dass wir Medikamente zurückgerufen haben. Die Leute unseres damaligen Komitees halte ich für absolut integer. Hinter ihrer Entscheidung muss die Annahme gestanden haben, dass die Produkte sicher sind, unabhängig davon, ob sie erhitzt waren oder nicht.“
Ein Kloster, 30 Kilometer außerhalb von Taipeh. Yuan Tsai kommt regelmäßig hierher, um das Grab seines Sohnes Honda zu besuchen, und um im Tempel für dessen Seele zu beten. Yuan und seine Familie leben nach den Regeln strenggläubiger Buddhisten.
Honda Tsai war, als er 1996 an AIDS starb, ein bekannter Künstler in Taiwan. Nach der Diagnose, dass er sich als Bluter durch verseuchte Medikamente von Cutter aus Kalifornien infiziert hatte, zog sich Honda in sich zurück, wurde depressiv. Dieses Selbstbildnis entstand kurz vor seinem Tod.
Hongkong, Mai 1985. Seit einem halben Jahr werden die Patienten inzwischen mit Medikamenten versorgt, die wegen der AIDS-Verseuchung in Europa und in den Vereinigten Staaten längst verboten sind.
Cutters Vertriebsfirma im Caltex House ist empört. Deren Chef wurde bereits ins Gesundheitsministerium von Hongkong zitiert, musste sich fragen lassen, ob die Chinesen in den Augen der Amerikaner Menschen zweiter Klasse seien. Doch wieder geht ein abwiegelndes Fernschreiben aus San Francisco ein:
„...be assured...it is the same fine product we have supplied for years...“
...„Seien Sie versichert, es ist dasselbe feine Produkt, das wir seit Jahren liefern...“
O-Ton Thomas C. Drees:
„Ich erinnere mich, dieses Fernschreiben in den Cutter- Dokumenten gelesen zu haben, in dem es heißt, wir haben zwar nichts von dem neuen, erhitzten Produkt für euch übrig, aber wir haben dieses immer noch blendende Präparat, das so sicher ist. Ich bin überrascht, dass die Vertriebsfirma in Hongkong so dumm war, das Argument immer wieder zu akzeptieren, über dieses angeblich so gute alte Präparat, das die Patienten umbringen würde.“
Im Mai 1985 eskaliert der Streit zwischen Hongkong und San Francisco. Inzwischen hat sich Cutters Exportpolitik herumgesprochen. Patienten gehen auf die Barrikaden, Ärzte sind empört, Journalisten beginnen mit Recherchen. Cutters Exportmanager hält das in einem Vermerk fest.
O-Ton Diktat:
„Die Kontroverse könnte zu Schlagzeilen auf der Titelseite der South China Morning Post führen... Reporter verlangen Auskunft, warum Hongkongs Patienten nicht das hitzebehandelte Produkt bekommen...Noch halten sich die Ärzte die feindliche Presse mit Verzögerungstaktiken vom Hals...“
O-Ton Merrill T. Boyce, ehemaliger Cutter-Manager:
„Haben Sie den Vermerk?“
Autor: „Ja!“
„Kann ich ihn sehen?“
O-Ton Diktat: „Wir haben den Universitäts-Ärzten... 350 Flaschen des neuen, hitzebehandelten „Koates“ besorgt... ... für jene Patienten, die am lautesten jammern.“
O-Ton Merrill T. Boyce/ehemaliger Cutter-Manager:
„Ich denke, dass so eine Entscheidung komplexer ist als das, was Sie da herauslesen. Allerdings, sollte sich herausstellen, dass wir damals schon mit absoluter Sicherheit wussten, dass die alten Präparate infektiös waren, dann wäre es tatsächlich eine schlechte Entscheidung gewesen.“
Taipeh, Juli 1985, wieder zwei Monate später. Während der Vertrieb des nicht-hitzebehandelten „Koate“ in Hongkong zwischenzeitlich wegen drohender Presse-Veröffentlichungen gestoppt wurde, erhalten die bluterkranken Kinder in Taiwan weiterhin das alte Produkt. Im fernen San Francisco sind die Lager immer noch voll.
Auch in Cutters Vertriebsfirma in Taipeh herrscht Alarmstimmung. Sie kontrolliert 80 Prozent des taiwanesischen Marktes. Auf der Insel sind die ersten HIV-Infektionen überhaupt diagnostiziert worden. Ausgerechnet bei Blutern! Bei ihren Kunden! Wurde AIDS durch „Koate“ nach Taiwan eingeschleppt?
Bei Cutter vor den Toren von San Francisco macht man sich mehr Sorgen um die Verkaufszahlen: „Die asiatischen Ärzte sind vorsichtig geworden... „Koate“-Umsätze in Taiwan sind im Keller. Wir werden hitzebehandeltes „Koate“ brauchen, um Umsätze zurück zu gewinnen“
O-Ton Wun-Fu, Medikamenten-Opfer:
„Wir hatten direkten Kontakt mit dem Importeur, der uns die Medikamente verkaufte, die dann im Krankenhaus von den Ärzten gespritzt wurden. Wir hätten sicherlich eine Zeitlang anders behandelt werden können. Aber uns hat damals niemand gewarnt, weder die Firma, noch die Ärzte.“
Wun-Fu lebt seit 20 Jahren mit der Infektion, aber erst seit einem Jahr ist AIDS bei ihm massiv ausgebrochen. Von den damals infizierten Blutern in Taiwan sind inzwischen mehr als zwei Drittel gestorben.
Zwanzig Jahre nach Cutters Entscheidung, AIDS-verseuchte Medikamente nach Asien zu verkaufen, sieht sich John Hink erstmals mit den Opfern konfrontiert.
O-Ton John H. Hink, ehemaliger Cutter-Manager:
„Es tut mir Leid, dass das passiert ist! Aber ich denke auch, dass ich nicht in der Lage bin, zu erklären, dass Entscheidungen, die damals getroffen wurden, an denen ich beteiligt gewesen sein mag oder auch nicht....
...nicht alle Entscheidungen haben sich inzwischen als richtig herausgestellt. Keiner von uns ist unfehlbar!....Die Art, wie Sie Fragen stellen, gibt dem Ganzen sicherlich einen Anstrich, wie: Verdammt, hätten wir das Zeug damals weggeschmissen, hätten diese Menschen wahrscheinlich nicht die Krankheit bekommen...“
Tokio, August 1985, wieder ein Monat später. Auch in Japan geht der Verkauf der verseuchten Präparate weiter. Cutter Japan hat noch riesige Bestände auf Lager. Dabei würde die Arzneimittelbehörde in Tokio dem neuen, AIDS-sicheren Produkt lieber heute als morgen eine Zulassung erteilen.
O-Ton Diktat:
„Wenn die Zulassung noch im August kommt, werden wir...potentiell nicht mehr verkäufliche Präparate...auf Lager haben. ...Cutter Japan könnte versuchen,...die Zulassung des neuen Produkts hinauszuzögern...“
O-Ton Thomas C. Drees: „Klar versuchten sie, das hinauszuzögern, denn so konnten sie hoffen, wir werden das alte Zeug los, das wir noch haben!“
O-Ton John H. Hink, ehemaliger Cutter-Manager:
„Ich weiß...ich war nicht...Ich bin sicher, dass ich damals in diesen Vermerk der Geschäftsleitung nicht eingeweiht wurde! Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich das höre! Was ich gemacht hätte, wenn ich damals davon erfahren hätte? ...Ich vermute, ich hätte gesagt, das ist ihre Angelegenheit, nicht meine.“
O-Ton Merrill T. Boyce, ehemaliger Cutter-Manager:
„Sie sprechen von Schuld, aber ich frage mich, ob eine Firma Schuld haben kann. Sicherlich gibt es eine Verantwortung für Entscheidungen, die getroffen wurden und dafür, dass es unzulässige Entscheidungen waren. Und diese Verantwortung muß die Firma tragen.“
Autor: „Wäre es, nach 20 Jahren, nicht auch eine Pflicht für die damals verantwortlichen Personen, um Verzeihung zu bitten?“
Merrill T. Boyce: „Ich denke...sicherlich...also...dieser Weg ist oft schwer zu beschreiten, ... aber wenn es das ist, was die Opfer und ihre Familien erwarten...Alles was zu tun ist, um ihre ünsche zu befriedigen, sollte wahrscheinlich getan werden.“
O-Ton Jacky:
„Ich denke, sie sollten sich auch entschuldigen. Und bestraft werden! Andererseits: Wenn sie ins Gefängnis gehen, werde ich dadurch auch nicht wieder gesund.“
O-Ton Menn:
„Die Pharmafirma muss vor Gericht gestellt werden! Sie hat das Medikament verkauft, obwohl sie wusste, dass es mit AIDS verseucht ist. Nur wegen des Profits! Das ist doch Mord!“
O-Ton Wun-Fu:
„Natürlich müssen wir vor Gericht kämpfen, damit die ganze Wahrheit ans Licht kommt. Das dauert natürlich. Und ich frage mich, ob sie vielleicht auf eine „biologische Lösung“ spekulieren, also dass ich den Tag vielleicht gar nicht mehr erleben werde.“
O-Ton Charles A. Kozak, Rechtsanwalt:
„Wir haben in den Dokumenten sehen können, dass Bayer gleich zu Anfang der AIDS-Katastrophe jemanden herüberschickte, um die Strategie festzulegen. Und die entschieden dann, dass, obwohl wahrscheinlich innerhalb von ein, zwei Jahren 5.000 Bluter an AIDS erkranken würden, Cutter die Präparate weiter vermarkten solle.“
Auf dem ehemaligen Cutter-Gelände produziert die Bayer AG heute gentechnologische Medikamente. Die Deutschen in der Cutter Führungsetage wussten damals genau, was sie taten. Das belegt ein internes Fernschreiben des Headquarters in San Francisco. Im November 1984, zur selben Zeit, als die Exportabteilung Hongkong wissen ließ,...
„...we must use up stocks“
...“Wir müssen die Lagerbestände des alten Präparats aufbrauchen...“
...warnte der deutsche Vertriebsmanager Willi Ewald einen australischen Kunden vor eben diesem Produkt...
„...angesichts der Gefahren, die nicht-erhitzte Präparate für Bluter bedeuten könnten.“
Jede weitere Verwendung, so Hinks Kollege Ewald...
„...cannot be justified“
...„kann nicht gerechtfertigt werden!“
O-Ton John H. Hink, ehemaliger Cutter-Manager:
„Als die Umstellung kam auf das neue, erhitzte Produkt und der Boss eine Entscheidung verlangte, was mit den Lagerbeständen des alten Produkts gemacht werden soll, wurde entschieden, anstatt sie wegzuschmeissen, wollen wir sie lieber in andere Länder verkaufen...
...Und das führte dann zum Verlust von Menschenleben und zu Gesundheitsschäden.
..Ich denke, ich habe Fehler gemacht...ich denke, ich hätte Dinge besser machen können...und, ich denke, unter diesen Umständen, wenn man die Folgen sieht, bin ich froh, jetzt darüber reden zu können.“
Bis Ende 1985 wurden durch den „tödlichen Ausverkauf“ mehrere hundert Patienten in Asien mit AIDS infiziert. Die genaue Zahl der Opfer ist nicht bekannt, ebenso wenig die Zahl der Überlebenden. Cutter erzielte etwa vier Millionen Dollar aus dem Export der verseuchten Präparate.
Die Bayer AG lehnt jede Stellungnahme zu den konkreten Vorwürfen dieses Filmes ab. Das Unternehmen teilt lediglich mit, man empfinde „größtes Mitgefühl“ mit den Opfern, bestreite aber „jegliches Fehlverhalten bei der Herstellung und Vermarktung dieser Produkte“.
Hinweis: Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Urheberberechtigten unzulässig und strafbar, insbesondere darf er weder vervielfältigt, verbreitet oder zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden.