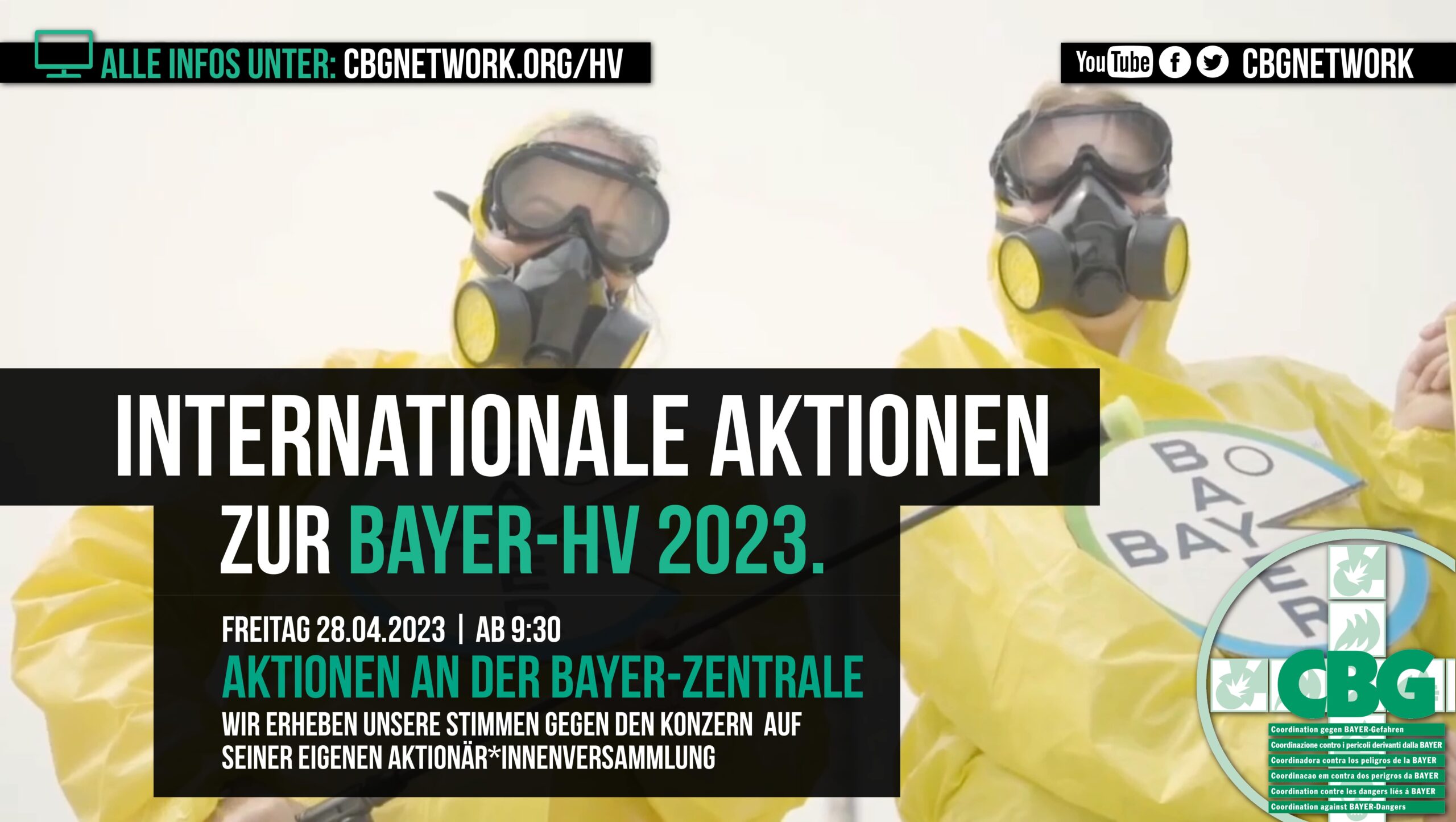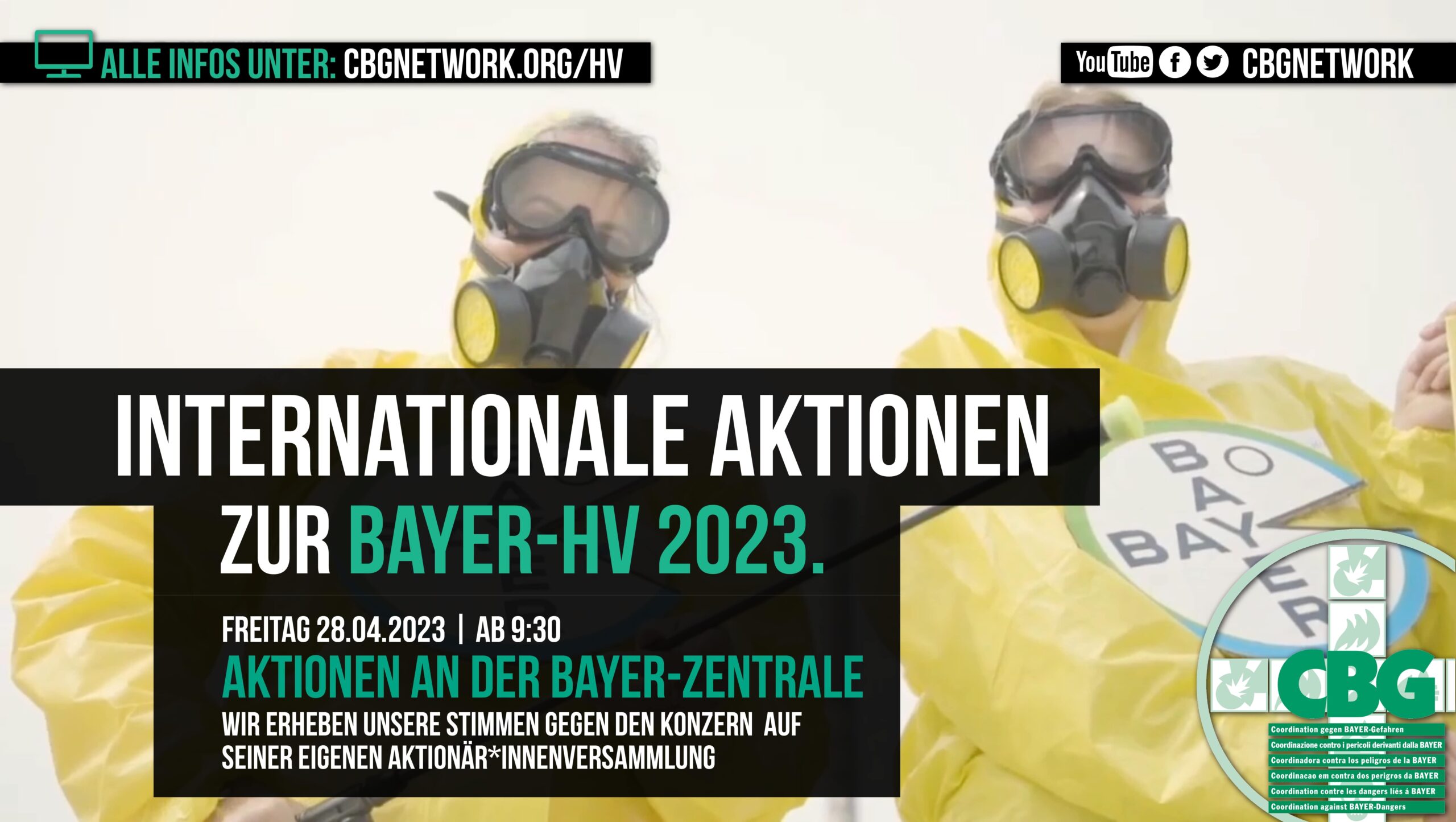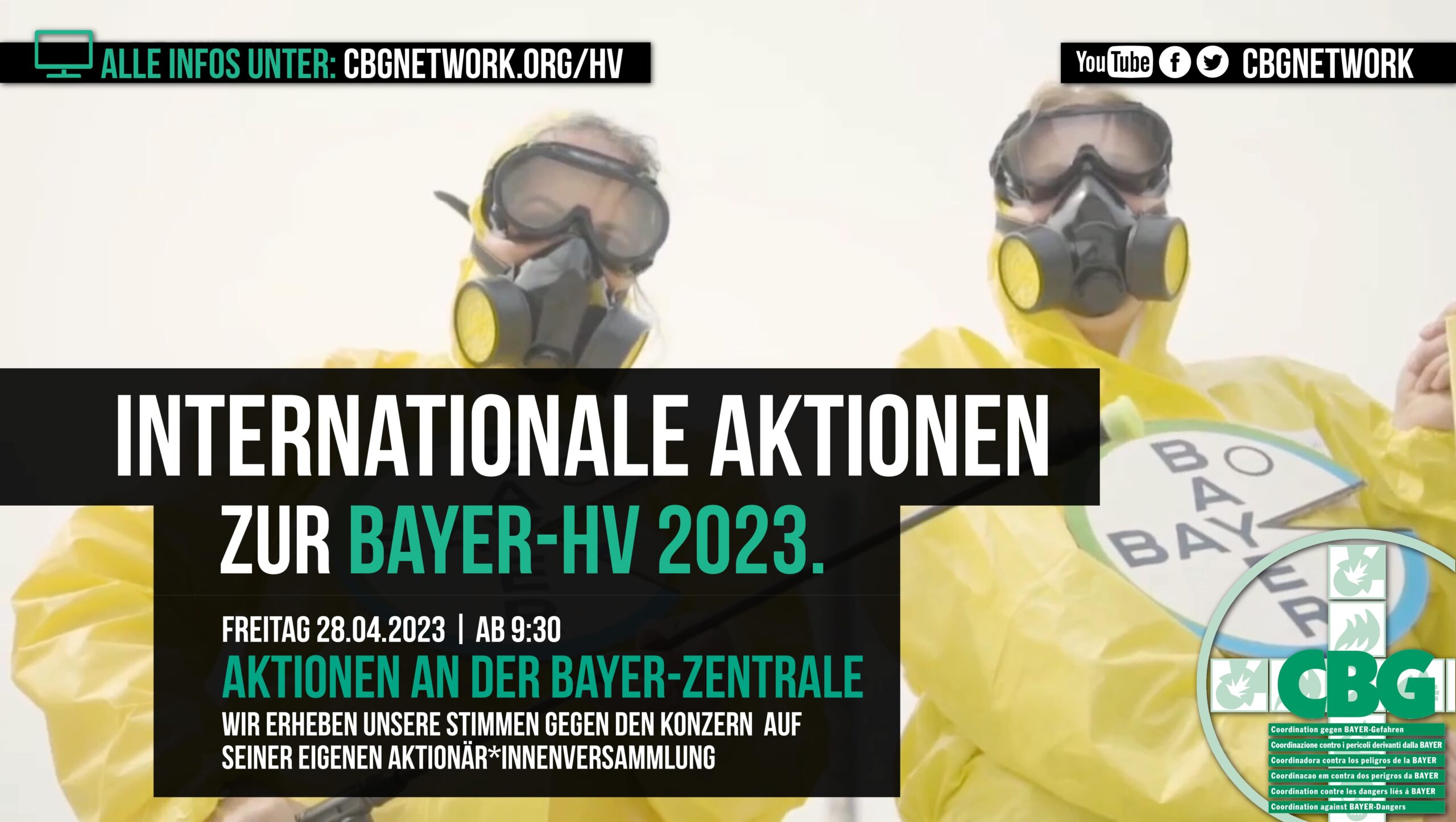Veröffentliche Beiträge von “CBG Redaktion”
Als RednerInnen für die Kundgebung vor der Konzernzentrale konnten wir bisher gewinnen:
Fridays for Future
Secrets Toxiques
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL)
Die Linke Leverkusen
Auf der Hauptversammlung sprechen:
Matthias Wolfschmidt, Stiftung Aurelia Hier geht es zur Rede Bernd Rodekohr, Stiftung Aurelia Hier geht es zur Rede Franz Wagle, Verein ehemaliger Heimkinder in Schleswig-Holstein e.V. Günter Wulf, Verein ehemaliger Heimkinder in Schleswig-Holstein e.V. Alice Werner, Parents for Future Leverkusen Petra Heller, Parents for Future Leverkusen Dr. Peter Clausing, Pestizid-Aktions-Netzwerk e.V. (PAN) Hier geht es zur Rede Annemarie Botzki, Foodwatch Hier geht es zur Rede Dr. Gottfried Arnold, CBG Hier geht es zur Rede Marco Jenni, March against BAYER and SYNGENTA Ludwig Essig, Netzwerk gerechter Welthandel, Umweltinstitut München Hier geht es zur Rede Margret-Rose Pyka, Bund der Duogynongeschädigten (BdD) Regina Sonk, Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) Eliane Fernandes-Ferreira, Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) Marius Stelzmann, CBG Jan Pehrke, CBG Hier geht es zur RedeGegenantrag zur BAYER-Hauptversammlung am 28. April 2023
Hiermit zeigen wir an, dass wir zum Punkt 3 der Tagesordnung den Vorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats widersprechen und die AktionärInnen veranlassen wollen, für den folgenden Gegenantrag zu stimmen:Gegenantrag zu TOP 3:
Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder
Der BAYER-Konzern handelt im Fall des ehemaligen SCHERING-Produktes Duogynon verantwortungslos. Der Aufsichtsrat nimmt an dieser Praxis keinen Anstoß. Darum fordert die Coordination gegen BAYER-Gefahren gemeinsam mit den im NETZWERK DUOGYNON organisierten Geschädigten des Präparats, den Gremien-Mitgliedern die Entlastung zu verwehren. Der hormonbasierte Schwangerschafts-Test Duogynon aus den 60er und 70er Jahren steht seit über 50 Jahren im Verdacht, Tausende von Missbildungen verursacht zu haben. Dennoch verweigert das Unternehmen jegliche Mithilfe bei der Aufklärung des Falls. BAYER versteckt sich hinter der Verjährung und verhinderte so eine gerichtliche Aufklärung in Deutschland. Auf Gesprächsangebote der Geschädigten reagierte BAYER nicht, auch die vom Landgericht Berlin vorgeschlagene Mediation lehnte BAYER ab. Öffentlich einsehbare Unterlagen im Landesarchiv Berlin zeigen deutlich das Ausmaß der Verschleierung und lassen einen zweiten Fall „Contergan“ erahnen. Zum Beispiel finden sich in den Unterlagen zahlreiche Schreiben besorgter Ärzte, die schwere Missbildungen ihrer Patienten beschreiben. Bereits 1969 hatten firmeninterne Tierversuche deutliche Auffälligkeiten und Missbildungen gezeigt. Schering unternahm jedoch nichts und verkaufte das Produkt gewissenlos weiter. Im Ausland wurde das Medikament meist früher vom Markt genommen. Wiederholt traf sich Schering damals auch mit den Vertretern des Contergan-Herstellers Grünenthal. Parallelen zu Contergan sind greifbar. Eine aktuelle Studie des Bundesministeriums für Gesundheit (aus 03/2023) beschreibt den historischen Ablauf im Fall „Duogynon“. Das damalige BGA war wohl personell schwach besetzt und noch unzureichend organisiert. Der Verfasser kritisiert aber auch das Verhalten von Schering an mehreren Stellen. Bis heute haben sich 661 Betroffene beim NETZWERK DUOGYNON gemeldet. Aktuell beschäftigt der Fall Duogynon auch viele Abgeordnete im Bundestag. Es wird dort schon bald zu neuen Diskussionen kommen. Nach dem Contergan-Urteil hätten das BGA und auch Schering anders handeln müssen. Es ist nicht zu verstehen, warum ein Weltkonzern wie BAYER heute so handelt und nicht diese Fehler eingesteht. Ab dem 2. Mai startet eine Anhörung vor einem englischen Gericht. Es geht um eine Wiederaufnahme des Primodos-Verfahrens in England (Primodos = Duogynon). BAYER wird mit Sicherheit eine schlechte Presse in Großbritannien bekommen, und es besteht Aussicht auf einen neuen Prozess, der dann bestimmt weltweit für Aufsehen sorgen wird. An der Charité in Berlin ist ein Forschungsprojekt zu hormonellen Schwangerschaftstests gestartet worden (Riskante Hormone, schwangere Patientinnen und die umstrittene Forschung zu angeborenen Fehlbildungen). Forscher weltweit arbeiten daran. BAYER muss nun endlich für die Fehler der Vorgängerfirma SCHERING aufkommen, sich bei den Familien entschuldigen und schnell Ausgleichszahlungen durchführen. Es ist an der Zeit, diesen Fall zu beenden und endlich verantwortungsbewusst zu handeln! Der Vorstand von BAYER hat keine Maßnahmen eingeleitet, um die Aufklärung des Falls zu betreiben. Bis heute wird gemauert und die Opfer werden abgewimmelt. Ein solches Handeln ist unmoralisch. Dem Vorstand ist daher die Entlastung zu verweigern. Ausführliche Informationen zu dem Fall finden sich auf der Homepage der Betroffenen unter www.duogynonopfer.de Um Mitteilung dieses Gegenantrags sowie der Begründung bitten wir gemäß §§ 125, 126 AktG. Für den Vorstand der Coordination gegen BAYER-Gefahren e. V. - Jan Pehrke -1.000 australische Verhütungsmittel-Geschädigte klagen an
BAYER vor Gericht
Der Melbourner „Victorian Supreme Court" befasst sich seit Dienstag mit einer Sammelklage von mehr als Tausend Australierinnen gegen BAYER und andere Anbieter des Langzeit-Verhütungsmittels ESSURE. Die Frauen machen die kleine Spirale, deren Kunststoff-Fasern für ein so großes Wachstum des Bindegewebes sorgen sollen, dass sich der Eileiter verschließt, für zahlreiche Gesundheitsschädigungen verantwortlich. So bleibt das Medizin-Produkt allzu oft nicht an seinem Bestimmungsort; stattdessen wandert es im Körper umher und verursacht Risse an den Wänden von Organen, was zu lebensgefährlichen inneren Blutungen führen kann. 94 Todesfälle registrierte allein die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA. Auch äußere Blutungen, Unterleibs-, Becken- oder Kopfschmerzen, Depressionen, Angstzustände, Krämpfe, Übelkeit, Allergien, Hautausschläge und Haarausfall zählen zu den Nebenwirkungen des Mittels. „Du fühlst dich, als würdest du sterben, als würdest du von innen heraus sterben", mit diesen Worten beschreibt die Klägerin Simmone Burford ihre Erfahrungen mit ESSURE. Die Mutter dreier Kinder erlitt eine Gesichtslähmung, bekam Ausschlag an den Extremitäten und Magen-Probleme. Gleich büschelweise fielen ihr die Haare aus. Lee-Anne Daffy berichtet über „ständige Gebärmutterschmerzen und Blutungen", und Debra Liberali erinnert sich so an ihr ESSURE-Martyrium: „Es war wie ein scharfer, stechender Schmerz, wie ein Messer im Magen." Sie und ihre Leidensgenossinnen erhalten Unterstützung von der US-amerikanischen VerbraucherInnenschutz-Aktivistin Erin Brockovich, die durch den Hollywood-Film über ihr Engagement zu großer Popularität gelangte. „Ich finde es wirklich bestürzend, wie viel Beharrlichkeit es erfordert, durchzusetzen, dass das Richtige für unsere Gesundheit und unser Wohlergehen geschieht. Also macht weiter!", sprach sie den Frauen bei der Einreichung der Klage im letzten November Mut zu. Brockovich hatte bereits den US-amerikanischen ESSURE-Geschädigten den Rücken gestärkt, die BAYER im Jahr 2020 einen Vergleich abtrotzten. 1,6 Milliarden Dollar musste der Pharma-Riese den rund 39.000 KlägerInnen damals zahlen. Geschlossen ist die Akte „ESSURE" damit in dem Land allerdings noch nicht. Und in Irland, den Niederlanden, England und Brasilien sieht sich der Leverkusener Multi ebenfalls noch mit Schadensersatz-Ansprüchen konfrontiert. Trotz alledem hält der Global Player noch immer unverbrüchlich zu der Spirale: „Wir sind zuversichtlich, dass die Beweise in diesem Fall zeigen werden, dass das Unternehmen nicht für die angeblichen Schäden verantwortlich ist." Beckenschmerzen und Gebärmutter-Blutungen etwa tut die Verteidigungsschrift als ganz normale Alltagsbeschwerden vieler Frauen in gebärfähigen Alter ab. „Es ist unvermeidlich, dass eine beträchtliche Anzahl dieser Frauen in jedem Fall unter einem oder beiden dieser Symptome gelitten hätte", meinen die BAYER-JuristInnen. 750.000 Stück setzte der Arznei-Hersteller weltweit von dem Medizin-Produkt ab, bis er nach Verboten und Gebrauchseinschränkungen in einigen Staaten 2017 den Markt-Rückzug einleitete. Als Gründe für die Einstellung des Verkaufs führte die Aktien-Gesellschaft jedoch nicht etwa die Risiken und Nebenwirkungen, sondern lediglich die „inadäquate und irreführende Berichterstattung über das Mittel" sowie das abnehmende Interesse für Langzeit-Kontrazeptiva an. „Der BAYER-Konzern weigert sich stets bis zum bitteren Ende, Gesundheitsschädigungen durch seine Medikamente einzugestehen. Gerade die Sparte „Frauengesundheit" hat hier traurige Berühmtheit erlangt, nicht nur in Sachen „ESSURE", sondern auch die Verhütungspräparate MIRENA und YASMIN betreffend. Das Leid der Frauen ignorierte der Multi dabei immer konsequent. Ihm ging es nur um den Profit", hält Marius Stelzmann von der Coordination gegen BAYER-Gefahren abschließend fest.. Pressekontakt: Jan Pehrke 0211/30 58 49 presse@cbgnetwork.org
Hier findet Ihr die Gegenanträge, die wir und unsere BündnispartnerInnen zur BAYER-Hauptversammlung 2023 gestellt haben.
Glyphosat
Lieferketten
Mercosur
Doppelte Standards
Lobbyismus
Verwendung des Bilanzgewinns
Virtuelle Hauptversammlungen
Pestizide (Aurelia-Stiftung)
Wahlen zum Aufsichtsrat
Vergütungsbericht
Duogynon