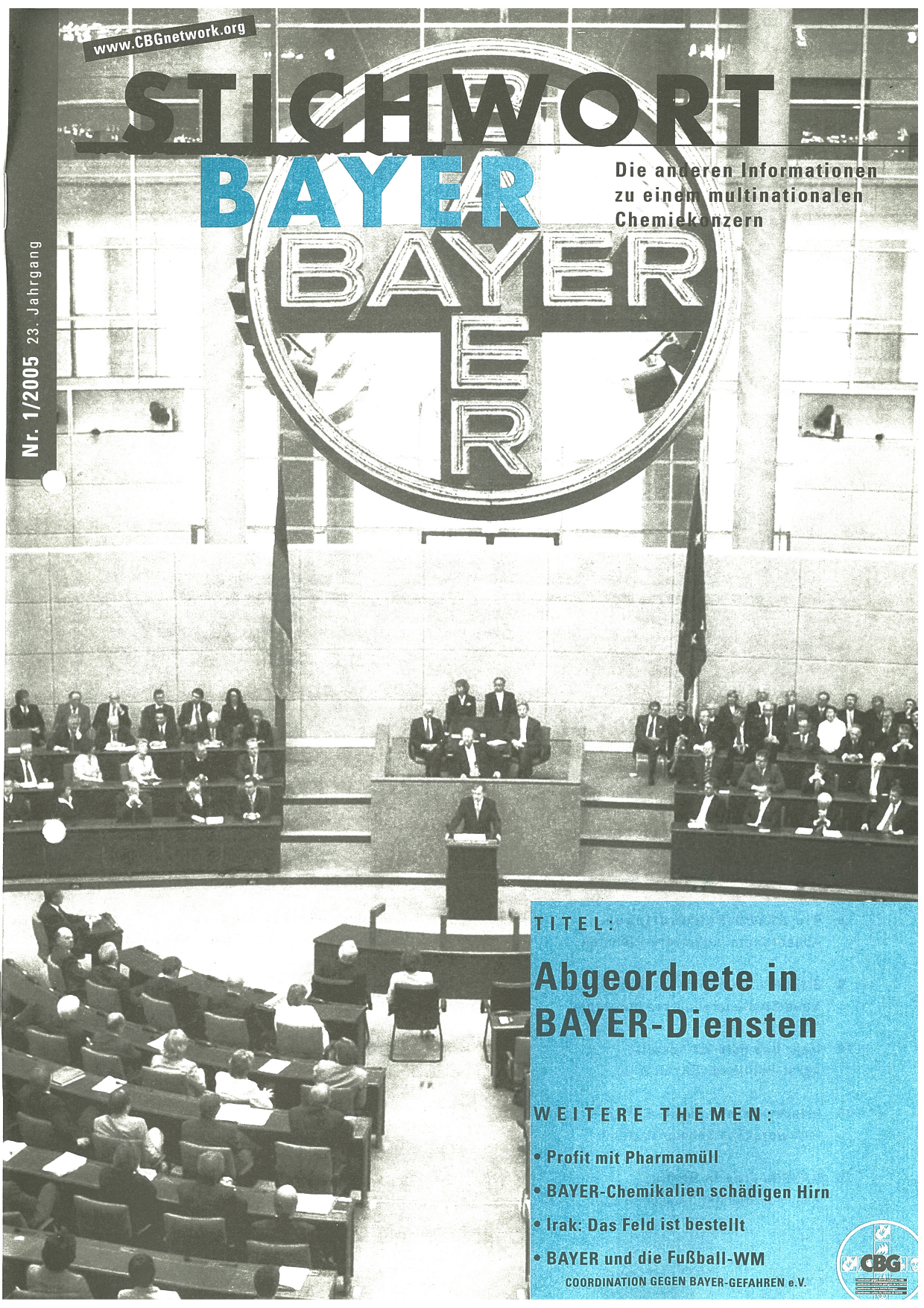AKTION & KRITIK
Proteste gegen Arbeitsplatzvernichtung
Mehrere hundert BAYER-Beschäftigte demonstrierten am 10.12.04 mit einer Lichterkette gegen die Vernichtung von 440 Arbeitsplätzen im Wuppertaler Pharma-Zentrum des Konzerns.
CBG bei Anti-Bush-Demo
BAYER hat George W. Bush durch großzügige Wahlkampf-Spenden massiv unterstützt und profitiert im Gegenzug unter anderem von seiner industrie-freundlichen Umwelt-, Pharma- und Steuerpolitik. Darum gehörte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) am 23. Februar 2005 zu den TeilnehmerInnen der Anti-Bush-Demonstration in Mainz.
Betriebsratsvorsitzender kritisiert BAYER
Reinhard Werner, ein Manager des Brunsbütteler BAYER-Werks, hat versucht, die Politik im Allgemeinen und den SPD-Landtagsabgeordneten Wilhelm Malerius im Besonderen für die Arbeitsplatz-Vernichtung beim Chemie-Riesen verantwortlich zu machen. Das „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ und die - inzwischen gestoppte - Ausweisung von mehr Naturschutz-Gebieten führte er als Beispiele für schlechte wirtschaftliche Rahmenbedingungen an. Dieser Vorstoß erboste den Betriebsratsvorsitzenden Hans-Jürgen Möller. „Da werden eigene Unzulänglichkeiten und hausgemachte Probleme anderen in die Schuhe geschoben“, so Möller. Er nahm stattdessen den Chemie-Multi in die Pflicht, kritisierte das Ausbleiben der von BAYER bereits zugesagten 150-Millionen-Euro-Investition in die Fertigung des Kunststoffes TDI und mahnte die Verbesserung der gesamten Produktionskette im Werk an. Die Landespolitik hingegen verteidigte Möller. Dabei wurde allerdings auch unfreiwillig deutlich, wie beflissen diese versucht, dem Leverkusener Chemie-Multi alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. „Bei der drohenden Ausweisung von Naturschutz-Flächen hat Herr Malerius innerhalb von einer Woche reagiert. Dann war das Problem vom Tisch“, sagte der Gewerkschaftler der Dithmarschener Rundschau.
Errichtung des Mahnpunktes „Zyklon B Dessau“
Der von BAYER mitgegründete Mörder-Konzern IG FARBEN ließ unter anderem in Dessau Zyklon B herstellen. Um das nicht vergessen zu lassen, hat sich in der Stadt die FORSCHUNGSGRUPPE ZYKLON B zusammengefunden. Bereits seit 1996 setzt sie sich für die Errichtung eines Mahnmals ein, sah sich jedoch großen Widerständen in der Stadt gegenüber. Jetzt hat sich die Beharrlichkeit der AntifaschistInnen endlich ausgezahlt. Am 27. Januar 2005, dem 60. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, konnten sie den „Informations- und Mahnpunkt Zyklon B Dessau“ einweihen. Eine Skulptur aus Zyklon-B-Behältern erinnert nun an das Menschheitsverbrechen. Genauere Informationen stellt die Website „www.zyklon-b.info“ bereit. Zum nächsten Jahr bereitet die FORSCHUNGSGRUPPE ZYKLON B darüber hinaus die Erstellung einer Broschüre zu dem Thema vor.
BAYER lagert Bhopal-Gift
1984 kamen bei der Explosion eines Chemie-Werkes im indischen Bhopal ca. 20.000 Menschen um. In den darauffolgenden Jahren starben noch hunderte an den Spätfolgen. Bei der damals freigesetzten Chemikalie handelte es sich um Methyl Isocyanat (MIC). Heute verfügt ein US-amerikanisches BAYER-Werk über 90 Prozent des Methyl Isocyanat-Bestandes in dem Land. Im Falle einer Freisetzung sieht die US-Umweltbehörde EPA das Leben von 300.000 Menschen gefährdet. Die AnwohnerInnen haben wegen dieser Gefahren bereits die Bürgerinitiative PEOPLE CONCERNED ABOUT MIC gegründet. Zum 20. Jahrestag der Bhopal-Katastrophe informierte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) die Öffentlichkeit über diese tickende Zeitbombe und forderte BAYER zu Maßnahmen auf.
NATURE ET PROGRES gegen GAUCHO
Durch BAYERs Saatgut-Behandlungsmittel GAUCHO und das zeitweilig ebenfalls zur Produkt-Palette des Konzerns gehörige REGENT kam es in Frankreich vor geraumer Zeit bei 182 Menschen zu Vergiftungserscheinungen. Fast hundert Milliarden Bienen starben. Deshalb ist die Anwendung der chemischen Keule im Nachbarland schon seit geraumer Zeit untersagt. Im Januar 2005 hat der belgische Naturschutzverband NATURE ET PROGRES in einer Petition die Regierung aufgefordert, GAUCHO auch in Belgien zu verbieten.
Aktion zu „60 Jahre Auschwitz-Befreiung“
Am 27. Januar 2005 jährte sich die Befreiung von Auschwitz zum 60. Mal. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) nahm dieses Ereignis zum Anlass, auf die Verbindungen des von BAYER mitgegründeten Mörder-Konzerns IG FARBEN zu Auschwitz hinzuweisen. Die IG FARBEN wirkten bei der Planung des KZs mit, unterhielten mit Monowitz ein eigenes Lager, aus dem sie ZwangsarbeiterInnen für das nahe gelegene Werk rekrutierten und führten mit Gefangenen Medikamenten-Versuche durch. Die Resonanz auf die Öffentlichkeitsarbeit der COORDINATION war groß. Sogar aus Indien erreichte die CBG eine positive Rückmeldung. „Vielen Dank für die Zusendung des Newsletters. Er hat mir die Augen über die Nazi-Vergangenheit von BAYER geöffnet“, bedankte sich der Empfänger.
EINE-WELT-NETZWERK gegen Kinderarbeit
Das Engagement von GERMAN WATCH und COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) gegen Kinderarbeit bei den Zulieferern von BAYERs indischer Tochter-Firma PROAGRO hat weitere Aktionen angestoßen. So startete das EINE-WELT-NETZWERK im Februar eine Kampagne zu dem Thema. Sie führt eine Plakat-Aktion durch und ruft zu Protest-Mails an die Adresse der Leverkusener Konzern-Zentrale auf.
Menschenrechtsverletzungen von BAYER
Die Initiative ACTION AID hat in einem Report Menschenrechtsverletzungen von Konzernen dokumentiert. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) lieferte hierfür Material über Vergiftungen durch BAYER-Pestizide. Der vollständige Bericht kann bei der CBG angefordert werden.
CBG-Protest beim LANXESS-Börsengang
BAYER entschied sich Ende 2003, die Chemie- und Teile der Kunststoff-Sparte abzuspalten und unter dem Firmen-Namen LANXESS am 31. Januar 2005 an die Börse zu bringen. Den Weg in die Selbstständigkeit pflastert das Unternehmen mit Rationalisierungsmaßnahmen, Lohn-Kürzungen und Arbeitsplatzvernichtung. Deshalb war die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) zum Börsengang in Frankfurt vor Ort und führte gemeinsam mit den ORDENSLEUTEN FÜR DEN FRIEDEN eine Protest-Aktion durch. Eine Kundgebung direkt vor dem Eingang duldete die Polizei nicht. Sie wies den Konzern-KritikerInnen eine abgelegene Stelle am Rande des Vorplatzes zu. Allerdings hatten die OrdnungshüterInnen nicht bedacht, dass sich dort auch die Bulle-und-Bär-Plastik befand, das Börsen-Symbol. Davor wollte sich LANXESS-Chef Axel Heitmann eigentlich telegen ablichten lassen, aber die CBG machte dem Vorstandsvorsitzenden nicht Platz und vermasselte ihm so seinen Medien-Auftritt.
BAYER für „Public Eye Award“ nominiert
Da mag BAYER noch so viel in image-fördernde Greenwashing-Aktivitäten wie dem Beitritt zu „Corporate Accountability“, einer PR-Initiative zu „verantwortungsvollem Unternehmenshandeln“, investieren (siehe PROPAGANDA & MEDIEN), der Konzern belegt doch immer wieder Spitzenplätze in den Hitparaden der Konzerne mit schlechtem Leumund. So war der Leverkusener Chemie-Multi für den am Rande des Davoser Weltwirtschaftsforums verliehenen „Public Eye Award“ nominiert, den besonders rücksichtslose Global Player erhalten. Daran hatte eine von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) erstellte 7-seitige „Schwarzbuch BAYER“-Aufstellung gehörigen Anteil. Sie führte belastendes Material von Kartell-Absprachen und Vermarktung gefährlicher Arzneien über Kinderarbeit bis zu Kriegsgewinnlertum durch Rohstoff-Beschaffung aus dem Kongo auf.
Wieder Nazi-Demo in Leverkusen
Am 9. November 2004 führten rechte Kräfte in Leverkusen einen Umzug durch. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) beteiligte sich an der Antinazi-Kundgebung und stellte eine Strafanzeige, weil die RechtsextremistInnen Sätze wie „Die schönsten Nächte sind aus Kristall“ skandiert hatten (SWB 4/04). Am 29. Januar marschierten die Ewiggestrigen erneut am Stammsitz BAYERs auf. Die CBG organisierte im Rahmen der Vorbereitungen zu den Protesten gegen die NeofaschistInnen die Pressearbeit und nahm an der Gegen-Demonstration teil.
WHO kritisiert BAYER & Co.
Der Europäische Leiter des Umwelt- und Gesundheitsprogrammes der Weltgesundheitsorganisation WHO, Dr. Roberto Bertollini, wirft BAYER und anderen europäischen Chemie-Konzernen vor, in einem beim „Center for Ecotoxicology and Toxicology“ bestellten Report wider besseren Wissens die Kausalbeziehungen zwischen dem Kontakt mit Quecksilber, Blei und Benzol und der Entstehung bestimmter Krankheiten zu leugnen. „Die Industrie leugnet die Zusammenhänge sogar, wenn sie wissenschaftlich belegt sind“, ereifert sich der Mediziner. Bertollini glaubt auch zu wissen, warum BAYER & Co. so handeln. „Ich habe keinen Beweis dafür, aber ich glaube, sie wollen Druck auf die neue EU-Kommission ausüben, um die gesetzlichen Auflagen aufzuweichen“, so der WHO-Wissenschaftler.
KAPITAL & ARBEIT
Brunsbüttel: 225 Jobs weniger
In den kommenden Jahren will BAYER am Standort Brunsbüttel 225 der 827 Arbeitsplätze vernichten, also mehr als ein Viertel. Zudem kündigte der Brunsbütteler Chemie„park“-Leiter Roland Stegmüller an, in Zukunft mehr Aufträge nach außerhalb zu vergeben. „Der Markt hat sich verändert. Heute werden Aufgaben außerhalb der Kern-Kompetenz an spezialisierte Firmen abgegeben, die gleiche Qualität zu niedrigeren Kosten anbieten“, behauptet Stegmüller.
Bestandssicherung bis 2011
Im Brunsbütteler BAYER-Werk kursierten immer wieder Gerüchte über eine Schließung. Jetzt gelang es der Gewerkschaft in einer Betriebsvereinbarung zumindest, den Bestand der vorhandenen Produktionskapazität bis zum Jahr 2011 zu sichern.
LANXESS kürzt Entgelt-Erhöhung
Die nunmehr börsen-notierte BAYER-Abspaltung LANXESS reduziert an allen Ecken und Enden Kosten. An den ausländischen Standorten geht sie dabei noch schonungsloser zu Werke als an den bundesdeutschen. So kürzt sie dort die schon vereinbarten Lohn-Erhöhungen für 2005 nachträglich um 30 Prozent.
Bei BAYER geht die Angst um
„Wir sparen zu Hause jetzt schon, wo es geht“, sagte ein Teilnehmer der Lichterkette gegen die Arbeitsplatzvernichtung im Wuppertaler Pharma-Zentrum (siehe AKTION & KRITIK), um Vorsorge zu treffen in der „für uns alle unsicheren Zeit“. Nach seiner Aussage hat fast jeder BAYER-Beschäftigte Angst um seinen Job. „Die Angst sei da, bei so vielen, sie sei Tag für Tag deutlich zu spüren - bei der Arbeit, in der Mittagspause und auch noch in der Familie daheim“, gibt die Westdeutsche Zeitung seine Worte wieder.
Pseudo-Initiative zur Ausbildung
BAYERs Lehrstellen-Quote liegt unter den 7,1 Prozent, welche die Betriebe im Gebiet Rhein-Wupper durchschnittlich erreichen. Weil der Konzern wegen der dürftigen Zahlen im letzten Jahr fürchtete, eine Ausbildungsplatz-Abgabe von bis zu zwei Millionen Euro zahlen zu müssen, unternahm er einen Vorstoß zur Besänftigung der Politik. Der Leverkusener Chemie-Multi hob das System der Verbund-Lehre aus der Taufe. Er unterstützt Betriebe, die Jugendliche einstellen, finanziell und übernimmt Teile der Ausbildung. Zusätzlicher Vorteil der Entlastungsstrategie: Die Länder beteiligen sich an den Kosten.
Besänftigungsstrategie bei LANXESS
Wie es BAYER gelang, bei der LANXESS-Abspaltung Unruhe in der Belegschaft zu verhindern, schilderte die Berliner Morgenpost. „Um die Arbeitnehmer-Seite beim geplanten Börsen-Gang der Chemie-Sparte LANXESS nicht zum Störfaktor werden zu lassen, wurde ein Erfolg für den Betriebsrat arrangiert. Nur noch 3.000 statt der geplanten 4.000 Stellen sollen an den deutschen Standorten des Konzerns bis Ende 2005 abgebaut werden. Nur beiläufig teilte der Konzern mit, wozu dies führen wird: Ein Großteil der Mitarbeiter wird dem Bereich bedarfsgerechte Einsätze‚ zugeordnet - einer Abteilung, in der es zwar noch Gehalt, aber keine Beschäftigung mehr gibt“, schreibt die Zeitung.
Der Osten als Billiglohnland
Der im Osten vereinbarte Chemie-Tarif beträgt 28 Euro brutto die Stunde. Die ArbeiterInnen im Westen bekommen dagegen 40 Euro. Damit verdienen die Chemie-WerkerInnen in den fünf neuen Bundesländern weniger als ihre US-amerikanischen und japanischen KollegInnen. Und BAYER & Co. sind zuversichtlich, dass sie trotz der bis 2009 avisierten 100-prozentigen Lohn-Angleichung weiter von dem Gefälle profitieren, weil die Belegschaften in Bitterfeld und anderswo 40 Stunden die Woche arbeiten müssen. Trotz dieser paradiesischen Bedingungen vernichteten BAYER & Co. nach der Wende Arbeitsplätze en masse. „Von sechs Arbeitsplätzen blieb im Durchschnitt nur einer übrig“, räumt Rolf Siegert vom „Verband der Chemischen Industrie“ freimütig ein.
„Job-Hemmnis“ Lohn-Angleichung
Georg Frank, Geschäftsführer des Bitterfelder BAYER-Werks, nahm gemeinsam mit Verkehrsminister Manfred Stolpe, dem sachsen-anhaltinischen Ministerpräsidenten Wolfgang Böhmer und Klaus von Dohnanyi an einer Diskussion über den „Aufbau Ost“ teil, die in der Berliner Landesvertretung Sachsen-Anhalts stattfand. Dort wandte er sich vehement gegen die Angleichung der Gehälter in Ost und West. „Der Aufbau von Arbeitsplätzen muss Vorrang vor dem Angleichen der Löhne haben“ forderte der Manager und bezeichnete es als Einstellungshemmnis, „dass wir pro Jahr acht Prozent Lohnkosten-Steigerung haben“. Auch das alte BAYER-Lamento über scheinbar zu hohe Energie-Kosten und die angebliche Blockade-Haltung der Bundesregierung gegenüber der Gentechnik stimmte Frank wieder an.
Entlassung wg. Mülltüten-Klau
Die Mitnahme einer Rolle Mülltüten im Wert von sechs Euro genügte dem Krefelder BAYER-Werk, eine seit 34 Jahren beim Chemie-Multi tätige Frau zu entlassen. Der Betriebsrat kritisierte das Vorgehen, weil es nicht der Verhältnismäßigkeit der Mittel entspräche. Für den Betriebsratsvorsitzenden Peter Kronen ist die Kündigung ein weiteres Zeichen für das rauher gewordene Betriebsklima bei BAYER. Die Betroffene hat vor dem Arbeitsgericht Widerspruch gegen die Entscheidung eingelegt.
Rationalisierungsgewinn bei der Buchhaltung
Im Jahr 2001 fasste BAYER das gesamte Rechnungswesen für die nicht-deutschen Niederlassungen in Barcelona zusammen, was zu Streiks und Protesten bei MitarbeiterInnen führte (Ticker 3/01), weil sie um ihre Stellen fürchteten. Zu Recht, denn die vom Leverkusener Chemie-Multi erzielte 30-prozentige Kosten-Ersparnis durch die Verlagerung der Buchhaltung nach Barcelona dürfte zum größten Teil auf die Vernichtung von Arbeitsplätzen zurückgehen.
Immer mehr Call-Center-Jobs
Bei BAYER nimmt die Zahl der Telefon-Arbeitsplätze zu. Allein am Standort Leverkusen verfügt der Call-Center über 320 MitarbeiterInnen. Zusätzlich hat das Unternehmen ein Teil dieser Aktivitäten ausgelagert und leitet Servicenummer-Anrufe direkt an freie „Call-Center-AgentInnen“ weiter, die der Konzern nicht nach Chemie-Tarifen bezahlen muss.
Neues Aktien-Programm
Im Jahr 2004 bot BAYER den MitarbeiterInnen wieder Aktien-Programme an. Die Beschäftigten konnten die Unternehmenspapiere vergünstigt mit einem Abschlag von 6,75 Euro auf den Kurswert kaufen. Nach Angaben des Konzerns besitzen 55.000 Belegschaftsangehörige und Ehemalige BAYER-Wertpapiere. Mit 15,3 Millionen Aktien halten sie rund zwei Prozent des Kapitals. Teilhabe bedeutet dies jedoch nicht, denn nur Großaktionäre wie Banken, Pensionsfonds und Versicherungen bestimmen die Geschicke des Chemie-Multis.
1 Million weniger für Vereine
BAYER unterstützt nicht nur Sport-Clubs, sondern auch Kultur- und Hobby-Vereine. Aber wie jene leiden auch diese unter dem Einspar-Programm des Konzerns. So stellt der Leverkusener Chemie-Multi anno 2005 eine Million Euro weniger als 2004 zur Förderung von Freizeit-Aktivitäten zur Verfügung.
BAYER schließt Werksbibliothek
Der soziale Kahlschlag beim Leverkusener Chemie-Multi geht weiter. Nach der Schließung des Carl-Duisberg-Bades, der „Galerie am Werk“ und dem Aus für das Kleinkunst-Programm muss demnächst wohl die Werksbibliothek dran glauben. 102 Jahre hat der Konzern sie unterhalten, jetzt aber mag er die nötigen 500.000 Euro nicht mehr aufbringen. Für die Bücherei mit 240.000 Ausleihen pro Jahr ist es ein Tod auf Raten. Bereits 1998 machte der Pharma-Riese die Filialen an anderen Standorten dicht und verringerte die Bestände. Dreisterweise schiebt BAYER die Schuld auch noch auf LANXESS und andere im Chemie-„Park“ angesiedelte Unternehmen, weil sie sich an den Kosten nicht mehr beteiligen wollten. Die KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN FÜR EINE DURCHSCHAUBARE BETRIEBSRATSARBEIT, eine von zwei oppositionellen Betriebsratsgruppen im Leverkusener BAYER-Werk, protestierten gegen die Pläne. „Wir erwarten und fordern, dass der BAYER-Vorstand diese Überlegungen beerdigt und der Belegschaft den Erhalt der Bücherei zusichert“, sagte Klaus Jagusch.
ERSTE & DRITTE WELT
BAYER will Patente in Indien
Der von der Welthandelsorganisation WTO geschlossene TRIPS-Vertrag zum Schutz des geistigen Eigentums verhindert die Versorgung der armen Länder mit erschwinglichen Medikamenten, weil der 20 Jahre geltende Patentschutz die Preise hochtreibt und die Produktion von Nachahmer-Produkten unterbindet. Indien muss die Vereinbarung ab diesem Jahr umsetzen und dürfte deshalb schnell aus der Gruppe der Länder mit den weltweit niedrigsten Medikamenten-Preisen herausfallen. Aber Big Pharma reicht diese neuere Arzneien betreffende Regelung nicht. Sie möchten auch den Schutz ihrer Zulassungsanträge erreichen und damit die nach Ablauf des Schutzes mögliche Produktion von Nachahmer-Präparaten hinauszögern. Darüber hinaus beabsichtigten die Konzerne, Patente auch für ältere Pillen durchzusetzen. BAYER, ELI LILLY und NOVARTIS haben bereits entsprechende Anträge gestellt.
Kongo: Entwicklungshilfe für BAYER
Der Kongo stellt für BAYERs Tochter-Firma HC STARCK wegen des großen Coltan-Vorkommens ein wichtiges Rohstoff-Reservoir dar. Deshalb machte sie auch während des Bürgerkrieges Geschäfte mit den dortigen Warlords und finanzierte damit deren blutiges Treiben. Der Bundesregierung zufolge kann das Land nach Beendigung des Konflikts aufgrund seiner „Größe, des Rohstoff-Reichtums und der zentralen Lage an politischem und wirtschaftlichem Gewicht erheblich gewinnen“. Deshalb verstärkt sie nach Informationen von „www.german-foreign-policy.com“ ihre Aktivitäten in der Region. Vermittlungsgespräche mit den Kriegsparteien und Hilfslieferungen sollen den bundesdeutschen Einfluss in Friedenszeiten stärken und HC STARCK langfristig den Zugang zu Coltan sichern.
IG FARBEN & HEUTE
Beschönigende IG-Ausstellung
Das ehemalige Frankfurter Hauptverwaltungsgebäude des von BAYER mitgegründeten Mörder-Multis IG FARBEN ging 2001 in den Besitz der Universität über. Mit der Dauerausstellung „Von der Grüneburg zum Campus Westend“ wollte die Hochschul-Leitung ihrer „selbstverständlichen Verpflichtung“ nachkommen, an die Verbrechen des Konzerns im Nationalsozialismus zu erinnern. Die von der Agentur „Kontor für Geschichte“ konzipierte und vom „Verband der Chemischen Industrie“ großzügig unterstützte Schau verharmlost die IG-FARBEN-Geschichte allerdings in skandalöser Weise, wie Peter Heinelt in Konkret 1/05 schreibt. Nach Darstellung der Geschichtsagentur hat es erst nach dem Wahlsieg der NSDAP erste Kontakte zwischen der Firmen-Leitung und der Partei gegeben - und dazu ganz unverbindliche: „Stagnierende Produktion, finanzielle Einbußen und die wachsende Arbeitslosigkeit steigern das Interesse der IG an Hitlers wirtschaftspolitischen Plänen“. Die Existenz einer mindestens seit Anfang der 30er Jahre existierenden strategischen Allianz verschweigen die Ausstellungsmacherinnen. In Übereinstimmung mit den Expansionsplänen der Nazis träumte IG-Chef Carl Duisberg schon 1931 von der Schaffung eines „geschlossenen Wirtschaftsblocks von Bordeaux bis Odessa“. In diesem Jahr begannen die IG FARBEN auch, den Wahlkampf der NS-Partei mit Spenden zu finanzieren. Auf die zentrale Bedeutung des Unternehmens bei der Versorgung des Staates mit kriegswichtigen Gütern geht die Ausstellung ebenfalls nicht ein. Selbst bei dem dunkelsten Kapitel der dunklen Firmen-Historie - der Einrichtung des konzern-eigenen KZ Monowitz - betreibt das „Kontor für Geschichte“ noch Geschichtsklitterung. Nach der wahrheitswidrigen Auffassung der GeschichtswissenschaftlerInnen haben nämlich nicht IG-Mitarbeiter die ausgezehrten ZwangsarbeiterInnen ausgesondert und damit ihr schließlich in den Gaskammern von Auschwitz vollstrecktes Todes-Urteil gesprochen, sondern SS-Männer. Darüber hinaus behelligen die KontoristInnen die BesucherInnen auch noch mit dem privaten Carl Duisberg und zeigen den Parteigänger Hitlers als passionierten Käfersammler, was so einiges über die Perspektive der GeschichtsdienstleisterInnen verrät.
POLITIK & EINFLUSS
Clement für Steuerreform
Wirtschaftsminister Wolfgang Clement will das Geld, das die Bundesregierung durch Hartz IV bei den Ärmsten der Armen gespart hat, gleich an BAYER & Co. weiterreichen. Er trat für eine Reform der Unternehmenssteuer ein. „Wir sind nominell in der Unternehmensbesteuerung zu hoch geraten“, erklärte er. Dabei zahlen im EU-Vergleich aufgrund der zahlreichen Schlupflöcher nur noch griechische Multis weniger Abgaben als die bundesdeutschen (SWB 4/04), weshalb sich der „Bundesverband der Deutschen Industrie“ auch vehement gegen eine Mindestbesteuerung ausspricht. Die paradiesischen Zustände schuf der ehemalige Steuer-Chef BAYERs, Heribert Zitzelsberger, im Jahr 2001 als Staatssekretär im Finanzministerium mit seiner Unternehmenssteuer-„Reform“. Sie führte bis 2003 zu Einnahme-Ausfällen des Bundes von mehr als 50 Milliarden Euro - und schuf keinen einzigen Arbeitsplatz. Trotzdem zeigte sich Gerhard Schröder den Plänen Clements gegenüber nicht abgeneigt, er wollte aber nichts überstürzen. So einigte sich die SPD Ende Februar darauf, den Sachverständigen-Rat ein Sondergutachten zur Veränderung des Steuer-Rechts ausarbeiten zu lassen.
Simonis‘ „frohe Botschaft“
Die EU-Kommission will in Norddeutschland Elbe und Umgebung gemäß der „Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie“ zum Naturschutzgebiet erklären. BAYER intervenierte sofort bei der Landesregierung, welche die Unterelbe-Region dem zuständigen Gremium der Europäischen Union dann auch prompt nicht als in Frage kommendes Gebiet meldete. Bei ihrem Besuch des Brunsbütteler BAYER-Werkes sicherte Ministerpräsidentin Heide Simonis dem Chemie-Multi weitere Unterstützung bei der Verhinderung von Naturschutz zu. „Wir dürfen Brüssel keinen Vorwand liefern, hier eingreifen zu müssen“, meinte die Landesmutter. Zudem versprach sie der Konzern-Leitung, Genehmigungsverfahren zum Bau neuer Anlagen industrie-freundlicher zu gestalten.
BAYER-Druck wg. B5-Ausbau
Das Brunsbütteler BAYER-Werk übt massiven Druck auf die Politik aus, um den Ausbau der Bundesstraße B5 voranzutreiben. Die Kreistagssprecherin Ilona Adamski (SPD) beklagte sich gegenüber der Presse über die Erpressung: „BAYER sagt: Macht bis 2007 etwas mit der B5, oder wir ziehen ab!“. Der Chemie-Multi weist jedoch scheinheilig alle Schuld von sich. „Die B5 hat für uns gar keine Priorität. Für uns zählt vor allem der Bau der A 20“, so Konzern-Sprecher Reinhard Werner.
Leverkusens OB traf Wenning
Kaum war der SPD-Politiker Ernst Küchler in Leverkusen zum neuen Oberbürgermeister gewählt, da machte er auch schon einen Antrittsbesuch bei BAYER-Chef Werner Wenning. Die beiden sprachen über das Verhältnis von Kommune und Konzern und präsentierten der Presse als Ergebnis ihres Dialogs die nichtssagende diplomatische Formel, die Beziehungen zwischen der Stadt und der BAYER AG weiterentwickeln zu wollen.
Chinesischer Botschafter bei BAYER
Im März 2004 besuchte der chinesische Botschafter Ma Canrong das Wiesdorfer BAYER-Werk und trug sich dort in das Goldene Buch des Chemie-Multis ein.
Zeng Peiyan bei BAYER
Ende November 2004 besuchte der stellvertretende Ministerpräsident Chinas, Zeng Peiyan, in Begleitung von Ma Canrong, dem Botschafter des Landes in der Bundesrepublik, und einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation das Brunsbütteler BAYER-Werk. Dort machte ihm dann der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Dr. Bernd Rohwer seine Aufwartung. Der Presse gegenüber betonte BAYER-Chef Werner Wenning noch einmal, welche Bedeutung China als wichtigster Zukunftsmarkt für den Leverkusener Chemie-Multi besitzt. Im letzten Jahr machte der Konzern dort einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro.
Schmoldt für Freiland-Versuche
Der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE)-Vorsitzende Hubertus Schmoldt sitzt im BAYER-Aufsichtsrat und hat sich damit den Unternehmenszielen des Chemie-Multis verpflichtet. Darum rührt er in der Öffentlichkeit auch kräftig die Werbetrommel für die „grüne Gentechnik“, ohne einen blassen Schimmer von der Materie zu haben. Auf einer Regional-Konferenz der IG BCE phantasierte er über neue Arbeitsplätze durch die Risiko-Technologie und warnte die GRÜNEN vor einer Nicht-Genehmigung der Freisetzungsversuche, die „ein großes NRW-Unternehmen mit B“ plane. Auch die freischaffenden Gentechnik-GegnerInnen knöpfte sich der Lieblingsgewerkschaftler der Unternehmer vor: „Wer Versuchsfelder zertrampelt, zertrampelt am Ende auch Chancen für Deutschland“.
Schartau besucht Chemie-Forum
Beim fünften Chemie-Forum, das BAYER und andere der im Verband „ChemCologne“ zusammengeschlossenen Unternehmen der Region organisiert haben, konnten die Chemie-Firmen NRW-Wirtschaftsminister Harald Schartau begrüßen. Auf der Veranstaltung im Leverkusener BayKomm sicherte der SPD-Politiker BAYER & Co. unter anderem die finanzielle Unterstützung des Landes beim Bau einer Pipeline von Antwerpen nach Nordrhein-Westfalen zu.
BAYER-Mann UN-Berater
Dr. Wolfgang Kern, Leiter der Vorstands- und Technologie-Kommunikation bei BAYER CROPSCIENCE, ist ein leidenschaftlicher Propagandist der „grünen Gentechnik“. Er tritt bei Bauernvereinen auf und spricht dort über die Zukunftsperspektiven der deutschen Landwirtschaft vor dem Hintergrund globaler und regionaler Entwicklungen„, die natürlich nur Gen-Pflanzen made by BAYER eröffnen und hat es sogar bis zum Berater der UN in Ernährungsfragen gebracht.
Wenning in Top 12 der Wirtschaftsbosse
Die Zeitung euro zählt den BAYER-Chef Werner Wenning zu den 12 einflussreichsten Konzern-Lenkern der Bundesrepublik und verlieh ihm das Attribut “Der radikale Chemiker„. Passend dazu stellt für die Publikation Nordrhein-Westfalen das Wirtschaftsmacht-Zentrum der Bundesrepublik dar. Dem BAYER-Intimus Wolfgang Clement schreibt sie das zweifelhafte Verdienst zu, die “Macht am Rhein„ gehalten und ausgebaut zu haben.
IHK-Sitz für BAYER-Manager
Der Geschäftsführer von BAYER INDUSTRY SERVICES, Dr. Jürgen Hinz, hat bei der Vollversammlungswahl der nordrhein-westfälischen “Industrie- und Handelskammer„ einen Sitz errungen und vertritt nun mit vier weiteren Delegierten das Produzierende Gewerbe aus dem Raum “Leverkusen/Rheinisch-Bergischer Kreis„.
BAYER & Co. drücken Kurth durch
Der bisherige Präsident des “Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizin-Produkte„ (BfArM), Prof. Harald Schweim, fand nicht das Gefallen der Pharma-Industrie (Ticker 2/04). Deshalb bewegten BAYER & Co. Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, ihn abzusetzen und einen ihnen genehmen Nachfolger zu nominieren. Der neue kommissarische Chef der Behörde, Reinhard Kurth, hat vorteilhafterweise nicht so viel Zeit für seinen Job, weil er Leiter des “Robert-Koch-Institutes„ bleibt. Die von ihm angekündigten Reformen lassen die Herzen der Pharma-Industrie jedoch schon einmal höher schlagen. So sprach Kurth sich für die Schaffung eines Vorstandes aus und hatte auch schon Ideen für die Besetzung. Es könne durchaus auch “jemand Hochrangiges aus (...) der Industrie„ sein, meinte er laut Pharma-Brief 9-10/2004. Vor allem an der Beschleunigung der Zulassungsverfahren dürfte der neue Leiter Pharma-GAUs wie dem LIPOBAY-Skandal zum Trotz arbeiten.
NRW gliedert Schuldienst aus
Nordrhein-Westfalens BildungspolitikerInnen haben kein Problem damit, BAYER einen Teil des Lehr-Angebots bestreiten zu lassen. Aus Anlass der Einweihung eines neuen Gen-Labors für SchülerInnen in Leverkusen bekundete die Schulministeriumssprecherin Heike Götte, diese enge Kooperation der privaten Wirtschaft mit dem öffentlichen Bildungssystem leiste einen wertvollen Betrag zum naturwissenschaftlichen Unterricht. Die ebenfalls anwesenden VertreterInnen der Kölner und Düsseldorfer Bezirksregierungen teilten ihre Auffassung, und auch die Presse jublilierte. “Gen-Manipulation ist schon im Schüler-Labor machbar„, frohlockte der Leverkusener Anzeiger und fand nichts Anstößiges an der Ausbildung von bereits über 460.000 BAYER-MutantInnen in den Konzern-Labors.
Regierungspräsident bei BAYER
Der Regierungspräsident Jürgen Roters weihte BAYERs neuen Container-Terminal auf dem Gelände des Leverkusener Chemie-“Parks„ ein und zeigte sich begeistert: “Investitionen wie diese zeigen deutlich, wie das Ergebnis einer unternehmerischen Initiative aussehen kann, die sich an Markt-Entwicklungen, Kunden-Bedarf und Anlagen-Sicherheit orientiert„. Mit der Sicherheit des Terminals scheint es aber nicht so weit her zu sein: Noch wenige Stunden vor der offiziellen Inbetriebnahme kam es zu einem Unfall mit einem Container, bei dem das Brand-Früherkennungssystem seinen ersten Einsatz hatte.
Gute KritikerInnen, schlechte KritikerInnen
Die IFPMA als internationaler Verband von BAYER und den anderen Pharma-Riesen plant, ihre Strategie gegenüber KritikerInnen zu ändern. Sie erhöhte ihren “Dialüg„-Etat und will eine Spaltung der kritischen Gruppen in gute und schlechte betreiben. Gute Initiativen sind nach Ansicht des Lobby-Clubs solche, “die bereit sind, ihre Ansichten auszutauschen und zu einem besseren Verständnis der Industrie zu kommen„. Gegen die übrigen unabhängigen Nichtregierungsorganisationen empfahl ein Berater vom konservativen “American Enterprise Institute„ der IFPMA ein harsches Vorgehen: “Erkenne deine Feinde und neutralisiere sie, und handele, bevor sie es tun!„.
Handelsverträge made by BAYER
BAYER & Co. haben einen großen Einfluss auf die Gestaltung der Handelsverträge, welche die USA mit anderen Nationen schließt. In den entsprechenden Berater-Gremien sitzen bis zu 16 RepräsentantInnen von Big Pharma. Sie sorgen unter anderem für rigide Patent-Regeln, die in den Ländern der Dritten Welt den Zugang zu erschwinglichen Arzneien erschweren. Zudem blockieren die Industrie-Emissäre den Aufbau eines effizienten staatlichen Gesundheitssystems in den betreffenden Ländern und verhindern strenge Regelungen zur Lebensmittelsicherheit, da BAYER & Co. so etwas als “Handelshemmnisse„ betrachten.
Bush schränkt Sammelklagen ein
Die von LIPOBAY-Geschädigten eingereichten Sammelklagen haben den Leverkusener Chemie-Multi bisher über eine Milliarde Dollar gekostet. In Zukunft dürfte der Konzern bei Pharma-GAUs deutlich billiger wegkommen. Der von BAYER großzügig mit Wahlkampf-Spenden bedachte George W. Bush schränkt nämlich die Möglichkeit, Schadensersatz-Ansprüche gegen große Unternehmen durchzusetzen, drastisch ein. Übersteigt der Streitwert fünf Millionen Dollar, sind nach einem neuen Gesetz automatisch die Bundesgerichte zuständig - und die wiesen bereits in der Vergangenheit viele Klagen aus spitzfindigen formaljuristischen Gründen ab.
PROPAGANDA & MEDIEN
BAYER wäscht sich grün
Je weniger BAYER real die Anfordungen an eine umweltbewusste Konzern-Politik erfüllt, wie nicht nur die zunehmende Zahl der Störfälle zeigt, desto mehr Arbeit steckt er ins image-fördernde “Greenwashing„. So gehört der Leverkusener Chemie-Multi zu den Mitbegründern von “Econsense - Forum für nachhaltige Entwicklung„ und nutzt die Veröffentlichungen der Organisation als Werbe-Plattform zur Präsentation seiner “Umwelt-BotschaftlerInnen„. Zudem beteiligte sich der Agro-Riese an “Corporate Accountability„ einer PR-Initiative zu “verantwortlichem Unternehmenshandeln„.
BAYER spendet Computer
Mit der Spende von 70 PCs und Laptops an den Förderverein “Schulnetz Leverkusen„ betreibt BAYER mal wieder Schulpolitik. “Computer-Kenntnisse sind heute unverzichtbar und werden von uns als Arbeitgeber auch erwartet„, sagte der Leverkusener Chemie“park„-Leiter Heinz Bahnmüller bei der Übergabe des Geschenks und enthüllte damit die niederen Beweggründe der noblen Geste.
TIERE & ARZNEIEN
BAYER bei Tier-Arzneien Nr. 4
Die Veterinär-Sparte BAYER ANIMAL HEALTH machte 2003 einen Umsatz von 800 Millionen Euro. Damit ist sie die Nr. 4 auf dem Weltmarkt.
DRUGS & PILLS
Aus für REPINOTAN
BAYER hat die Medikamenten-Versuche mit dem Schlaganfall-Mittel REPINOTAN abgebrochen. “Eine kürzlich durchgeführte Phase IIb-Studie mit REPINOTAN hat nicht die erhofften Ergebnisse gebracht„, verlautbarte das Unternehmen. Nun befindet sich nur noch die Krebs-Arznei BAY 43-9006 in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Für die Financial Times Deutschland demonstriert die Schlappe das besondere Risiko von BAYERs neuer Pharma-Strategie, die Forschung zurückzufahren und sich nur noch auf vier Therapie-Gebiete zu beschränken.
ASPIRIN schädigt Darmwand
Die Liste der Nebenwirkungen von ASPIRIN ist lang. Das Schmerzmittel kann unter anderem das Schlaganfall-Risiko erhöhen, Nieren-Erkrankungen verschlimmern, Kopfschmerzen und Magenbluten auslösen und bei Kindern zum Reye-Syndrom führen, einer Leber- und Gehirn befallenden Krankheit. Eine Untersuchung des Magen-Spezialisten David Graham vom “Veterans Affairs Medical Center„ im texanischen Houston fügte dem “Schwarzbuch ASPIRIN„ jetzt ein weiteres Kapitel zu. Nach seiner Studie führte die Einnahme von ASPIRIN bei 70 Prozent der ProbantInnen mit Gelenk-Beschwerden zu einer Schädigung der Darm-Schleimhaut.
ASPIRIN bekommt Sonderstatus
Pharma-Konzerne betrachten es nicht als ihre ureigene Aufgabe, Arzneien zur Behandlung von möglichst vielen Krankheiten zu erfinden. Sie wollen lediglich Medikamente zur Therapie der verbreitesten Gesundheitsstörungen entwickeln, weil nur das genügend Profit verspricht. Deshalb müssen die GesundheitspolitikerInnen solche Arzneien subventionieren. Diese Aufgabe erfüllt die Verleihung des Orphan-Drug-Status (orphan = engl. Waise). Ein solches Prädikat bekam BAYER jetzt von der Europäischen Union für ihren Tausendsassa ASPIRIN verliehen. Nach Meinung der EU-ExpertInnen kann es bei der Therapie der Blutzellen-Erkrankung Polycythemia vera ergänzend eingesetzt werden, um das Herzinfarkt- und Schlaganfall-Risiko der PatientInnen zu senken. Der Leverkusener Chemie-Multi kommt so in den Genuss einer verlängerten Patent-Laufzeit und geringerer Zulassungsgebühren für das Polycythemia-vera-ASPIRIN. Mit dieser Entscheidung setzen sich die EU-PolitikerInnen über die Meinung vieler WissenschaftlerInnen hinweg, die massive Zweifel an solch einer vorbeugenden Wirkung des Präparats haben.
Mehr Herzschlag-Risiken, mehr ASPIRIN
Ob ASPIRIN ein sinnvolles Medikament zur Verhütung von Herz/Kreislauf-Erkrankungen ist, diskutiert die medizinische Fachwelt äußerst kontrovers. Trotzdem versucht der Leverkusener Chemie-Multi, die Arznei in diesem Anwendungsbereich als ASPIRIN PROTECT möglichst großflächig an den Mann und an die Frau zu bringen. Dem Pharma-Riesen zufolge weisen nämlich 42 Prozent der über 40-jährigen Personen ein erhöhtes Gefährdungspotential auf. Und nach einer von BAYER in Auftrag gegebenen Untersuchung nehmen nur 43 Prozent dieser Gruppe ASPIRIN zu Präventionszwecken ein. Also ruft der Konzern in Tateinheit mit der von ihr großzügig unterstützten AMERICAN HEART ASSOCIATION zu einem vermehrten Konsum des Tausendsassas auf. Diese mehr als zweifelhafte Empfehlung beruht auf einem “erweiterten Risiko-Begriff„. BAYER zählt nämlich alle Menschen, die einer um 10 Prozent höheren Herzinfarkt-Gefahr als der Durchschnitt ausgesetzt sind, zur ASPIRIN-Zielgruppe. Dazu reicht es oft schon zu rauchen, an Diabetes zu leiden, einen erhöhten Blutdruck zu haben, schlechte Cholesterin-Werte aufzuweisen oder zu viel Gewicht auf die Waage zu bringen.
ASPIRIN: Gefährliche Kombinationswirkungen
Magenblutungen zählen zu den bekannten Nebenwirkungen von ASPIRIN. Schluckt eine Person parallel zu diesem Präparat noch andere Medikamente, so steigt diese Gefahr zusätzlich. “Wer zum Beispiel ASPIRIN und ein Rheuma-Mittel gleichzeitig einnimmt, hat ein erhöhtes Risiko von Magenblutungen„, warnt der Pharma-Experte Gunter Hopf von der “Ärztekammer Nordrhein„.
Neuer Diabetes-Wirkstoff
Das Biotech-Unternehmen CURAGEN hatte im Auftrag BAYERs ein Protein identifiziert, das angeblich Einfluss auf den Krankheitsverlauf von Diabetes hat (Ticker 4/01). Der Leverkusener Chemie-Multi hat nun einen Wirkstoff entwickelt, der den Stoffwechsel dieses Proteins beeinflusst und ihn in die präklinische Test-Phase eingebracht. Es gibt zwar schon genügend Präparate zur Behandlung der Zuckerkrankheit, aber der Pharma-Riese sieht noch Marktlücken. Dem Konzern zufolge haben viele gängige Medikamenten nämlich angeblich den Nachteil, das Senken des Blutzuckerspiegels nicht ausreichend steuern zu können, weshalb das Risiko gefährlicher Unterzuckerungen besteht.
Krebsmittel aus Taxol
BAYER forscht an einem Krebs-Medikament auf Taxol-Basis. Taxol ist ein Wirkstoff, der sich aus Rinde und Nadeln der kanadischen Eibe gewinnen lässt. Sollte der Baum-Stoff wirklich einmal Markt-Reife erlangen, dürfte ihn der Pharma-Riese sicherlich als Naturstoff anpreisen, obwohl der BAYER-Pharmakologe Thomas Henkel sich differenzierter äußert. “Die Natur dient als Ideengeber. Wir versuchen, den Naturstoff chemisch nachzubauen„, so Henkel. Nichts anderes hat die Chemie-Industrie ihr ganzes Leben lang getan, angefangen von der Produktion synthetischer Farbstoffe.
KOGENATE bei vielen wirkungslos
BAYERs Blutgerinnungsmittel KOGENATE hilft bei 25 Prozent aller Bluter nicht. Bei diesen Patienten bildet das Immun-System Antikörper gegen KOGENATEs Gerinnungsfaktor VIII und neutralisiert ihn damit. Das Risiko gefährlicher Blutungen bleibt so weiter bestehen. Der Pharma-Riese unterstützt nun ein Forschungsvorhaben mit dem “Special Project Award„, das nach Mitteln und Wegen sucht, diese häufig auftretende Komplikation zu verhindern.
KOGENATE: Neue Darreichungsform
BAYER hat von der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMEA die EU-weite Zulassung für eine neue KOGENATE-Darreichungsform erhalten. Der Leverkusener Chemie-Multi bietet das Präparat, das Bluter mit dem ihnen fehlenden Gerinnungsfaktor VIII versorgt, nunmehr auch in einem Fertigset mit eingebauter Spritze an.
KOGENATE: Neue Darreichungsform
BAYER hat die niederländische Firma ZILIP PHARMA beauftragt, die Darreichungsform für das Bluter-Mittel auf der Grundlage einer von dem Unternehmen neu entwickelten Technologie so zu ändern, dass Patienten nicht mehr einmal täglich, sondern nur noch einmal in der Woche eine Spritze benötigen.
Studie fördert ADALAT-Image
Das blutdruck-senkende Mittel ADALAT (Wirkstoff: Nifedipin) fährt für BAYER die zweitgrößten Umsätze im Arznei-Bereich ein. Der Ruf hat aber stark gelitten. Bereits 1999 schätzte der Mediziner Peter Sawicki, heute Leiter des “Institutes für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen„, die Zahl der auf das Konto von ADALAT und anderen Kalzium-Antagonisten gehenden Todesfälle ab 1979 auf 20.000. Darum entschloss sich der Pharma-Riese zu einer Image-Korrektur, fabrizierte eine länger wirkende ADALAT-Art und gab eine medizinische Studie in Auftrag. Sie lieferte prompt auch das gewünschte Ergebnis. Die Untersuchung bescheinigte dem Präparat, Herz- und Schlaganfälle zu verhindern und die Risiken und Nebenwirkungen der alten Version abgestellt zu haben. An der Glaubwürdigkeit dieses Urteils bestehen allerdings wie bei allen industrie-finanzierten Tests große Zweifel.
LEVITRA-Rechte zurückgekauft
BAYERs Potenz-Mittel LEVITRA hat die hoch gesteckten Erwartungen bisher nicht erfüllt. Eine Milliarde Euro Umsatz pro Jahr wollte das Management mit der Pille gegen “erektile Dysfunktion„ machen, schlappe 133 Millionen waren es dagegen im Geschäftsjahr 2003. Der Markt-Anteil beträgt lediglich 12 Prozent. “Nicht so wie ursprünglich gesehen„ entwickelte sich das Geschäft mit dem Lifestyle-Präparat, räumte BAYER-Chef Werner Wenning dann auch ein. Darum ändert der Konzern die Vermarktungsstrategie und kaufte von GLAXOSMITHKLINE (GSK) für 208 Millionen Euro die Vertriebsrechte für Kanada, Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika zurück. Nur in den USA bleibt die LEVITRA-Distribution in der Hand von GSK.
Weniger Forschung, mehr Lizenzen
BAYER hat die Forschungsanstrengungen im Pharma-Bereich auf vier Therapie-Gebiete reduziert, was viele Arbeitsplätze kostete (Ticker 4/04). Der Konzern will stattdessen die Früchte fremder Arbeit ernten und verstärkt Lizenzen für kurz vor der Marktreife stehende Arzneien zukaufen, wie der Vorstandsvorsitzende Werner Wenning gegenüber der Presse bekannt gab.
Weniger Forschung, mehr Zweitverwertung
BAYER hat im Arznei-Sektor die wissenschaftlichen Anstrengungen zur Entwicklung neuer Medikamente auf vier Therapie-Felder beschränkt. Dafür will der Konzern die Zweitverwertung seiner Arzneien professionalisieren. Dazu hat der Pharma-Riese in Wuppertal eine Abteilung für “produkt-begleitende Forschung„ eingerichtet. Sie soll unter anderem neue Anwendungsmöglichkeiten für alte Pillen finden und so ihre Patent-Laufzeit, die Lizenz für überteuerte Monopol-Preise, verlängern. Die Krankenkassen kostet dieses Arznei-Recycling, das der Leverkusener Chemie-Multi “Life-Cycle-Management„ nennt, Millionen-Summen.
BAYER macht Infarkt-Diagnose
BAYER unterzeichnete mit der PES DIAGNOSESYSTEME GmbH und der an dem Unternehmen beteiligten SIEMENS AG einen Kooperationsvertrag. Nach dieser Vereinbarung vertreibt BAYER HEALTHCARE zukünfig eine von PES entwickelte Apparatur, die bei der Diagnose akuter Herzinfarkte zum Einsatz kommen soll.
Zulassung für Hepatitis-B-Test
Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat BAYER die Zulassung für einen Hepatitis-B-Test erteilt, mit dem MedizinerInnen den Gesundheitszustand von PatientInnen bestimmen können, die an dieser Form von Gelbsucht leiden.
Pharma-Allianz kostet Umsatz
Nach dem LIPOBAY-Skandal entschloss BAYER sich, den Pharma-Bereich zu verkleinern. Im Zuge dieser Maßnahmen gab der Chemie-Multi in den USA seinen eigenen Pillen-Vertrieb auf und ging eine Allianz mit SCHERING-PLOUGH ein (Ticker 4/04). Dadurch muss der Konzern finanzielle Einbußen hinnehmen. Er beziffert den Umsatz-Verlust in der Sparte Pharma/Biologische Produkte exklusive Blutplasma insgesamt auf fünf bis sieben Prozent.
Leere Pharma-Pipeline
Mit dem Krebsmittel BAY 43-9006 befindet sich derzeit nur eine Arznei des Leverkusener Chemie-Multis in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklungsphase III. Drei Kandidaten durchlaufen gerade die Phase II und elf die Phase I. Vorklinische Experimente machen die BAYER-PharmazeutInnen mit 18 Substanzen.
PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE
BAYER profitiert von “Asiatischem Rost„
Auf Soja-Feldern in Lateinamerika grassiert die Pilz-Krankheit “Asiatischer Rost„ und vernichtet einen beträchtlichen Teil der Ernte. Der BAYER-Konzern als Agrochemikalien-Marktführer auf dem Kontinent profitiert von der Lage. In Brasilien steigerte sich der FOLICUR-Umsatz vom zweiten zum dritten Quartal 2004 um 44 Prozent auf 88 Millionen Euro. Mittlerweile haben sich Sporen des Rostes auch bis in die USA hinein verbreitet. Deshalb erteilen die Behörden Sonderzulassungen für den Einsatz von FOLICUR und STRATEGO auf Soja-Kulturen, was große Geschäfte verspricht.
Mehr Biozide aus Nordamerika
Im Jahr 2002 hat BAYER die Biozid-Sparte von ONDEO NALCO übernommen. Die gefährlichen Substanzen auf Basis von Thiabendazol oder Dibromdicyanobutan verhindern die Entstehung von Bakterien, Schimmelpilze oder Hefen, können beim Menschen aber Vergiftungserscheinungen auslösen. Der Leverkusener Multi liefert die Chemikalien Industrie-Kunden, welche die Stoffe dann Farben, Lacken, Kunststoffen, Klebstoffen, Papieren oder anderen Produkten beimengen. Da die Geschäfte gut laufen, will der Konzern die Produktionsstätte in Wellford, South Carolina für 0,5 Millionen Dollar ausbauen und die Produkte mit den Namen TEKTAMER, METASOL und BIOCHEK verstärkt auch in Europa und Asien anbieten.
Genehmigung für PROLINE
Das “Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-Sicherheit„ hat BAYERs Anti-Pilzmittel PROLINE die Zulassung erteilt. Der Leverkusener Chemie-Multi will das Fungizid hauptsächlich als Präparat gegen den Echten Mehltau und andere Pflanzen-Krankheiten im Raps- und Getreide-Anbau vermarkten, zum Teil auch in Kombination mit IMPULSE.
GENE & KLONE
Keine Zulassung für Gen-Mais
Trotz grünen Lichts aus Brüssel für zwei Sorten von gen-manipuliertem BAYER-Mais hat Verbraucherschutz-Ministerin Renate Künast den Labor-Produkten ebenso wenig eine Zulassung erteilt wie vier ihrer KollegInnen aus anderen Ländern. Daraufhin erhöhte die EU-Kommission den Druck auf die MinisterInnen. Ob Künast und die anderen PolitikerInnen bei ihrer Entscheidung bleiben, dürfte sich in naher Zukunft herausstellen.
LIBERTY-Baumwolle in Australien
Die australischen Behörden haben einen Antrag von BAYER auf Zulassung von Gentech-Baumwolle genehmigt. Der Gen-Gigant darf nun Baumwolle anbauen, die resistent gegen das konzern-eigene Unkrautvernichtungsmittel LIBERTY mit den Wirkstoffen Glufosinat und Ammonium ist.
BAYER will Gen-Senf anpflanzen
Nachdem der Agro-Multi Experimente mit Gentech-Senf in Indien stoppen musste, versucht er nun sein Glück in Australien. Der Konzern beantragte die Genehmigung zu Feldversuchen mit gentechnisch manipuliertem indischen Senf aus Leverkusen und löste damit eine Kontroverse zwischen konservativer Regierung und Demokratischer Partei aus.
Neue Projekte bei Biotech-Pflanzen
Die Mehrheit der VerbraucherInnen lehnt die grüne Gentechnik ab, weil sie darin keinen zusätzlichen Nutzen, sondern nur unabsehbare Gefahren erblickt. BAYER verfolgt deshalb die Strategie, durch die Erhöhung des “Gebrauchswertes„ der Pflanzen die Akzeptanz der Risiko-Technologie zu steigern. So entwickelt das Unternehmen gen-manipulierten Raps mit einem angeblich gesundheitsfördernden höheren Gehalt an ungesättigten Fettsäuren. Zudem basteln Konzern-ForscherInnen an Gen-Baumwolle, die sich leichter färben lässt, Wasser abweist und nicht so schnell verknittert. Darüber hinaus will der Gen-Gigant aus Pflanzen kleine Fabriken machen, indem er sie als Bio-Reaktoren nutzt. Sie sollen später einmal Kohlehydrate für Nahrungsmittel, Klebstoffe und andere Anwendungen herstellen. Den Risiken und Nebenwirkungen solcher “Innovationen„ geht der Chemie-Multi selbstredend nicht nach.
PLASTE & ELASTE
Gefährliches GENITRON
In einem Betrieb des Chemie-Unternehmens LANXESS, an dem BAYER eine Aktien-Beteiligung hält, hat der Kunststoff-Zusatz GENITRON bei Beschäftigten Haarausfall und Allergien ausgelöst. Die Substanz mit dem Inhaltsstoff Azodicarbonamid gilt als leicht Krebs erregend. Da sie auch in Lebensmittel-Behältnissen wie den gummierten Innen-Seiten von Deckeln enthalten ist, hat die EU ein Verbot der Verwendung von GENITRON im Lebensmittel-Bereich beschlossen.
BAYER profitiert von DVD-Boom
Im Jahr 2003 produzierte die Elektronik-Industrie sechs Milliarden DVDs. Dieser Boom verhilft dem Leverkusener Chemie-Multi zu einem erhöhten MAKROLON-Absatz, denn ein Drittel aller Disks besteht aus diesem BAYER-Kunststoff.
Preis-Erhöhung für Kunststoffe
In den letzten Jahren hat die Überproduktion im Kunststoff-Sektor zu Preis-Senkungen geführt. BAYER & Co. versuchten dem unter anderem durch Kartell-Absprachen zu begegnen (siehe RECHT & UNBILLIG). 2004 ist die Nachfrage gestiegen. Deshalb erhöht der Leverkusener Chemie-Multi die Produktionskapazitäten und verlangt für seine Erzeugnisse wieder mehr Geld.
WASSER, BODEN & LUFT
Emissionshandel: BAYER lamentiert
Die Chemie-Industrie zählt zu den größten Produzenten des klima-schädigenden Kohlendioxides. Aus den Schornsteinen der BAYER-Werke steigen jährlich 6,1 Millionen Tonnen CO2 in die Luft auf. Mit dem Emissionshandel, wonach die Unternehmen nur bis zu einem bestimmten Oberwert kostenfrei CO2 ausstoßen dürfen, wollte die EU die Konzerne zur Entwicklung umweltfreundlicherer Technologien bewegen. Aber den Chemie-Multis gelang es durch intensive Lobby-Arbeit, die Gesetzes-Vorlage aufzuweichen. So unterliegt bei BAYER jetzt nur das Kohlendioxid, das bei der Strom-Erzeugung der betriebseigenen Kraftwerke entsteht, dem Emissionshandel, nicht aber das von den Produktionsanlagen ausgestoßene. Trotzdem beklagte sich der Leverkusener Chemie-Multi bei der Vorstellung des neuen Nachhaltigkeitsberichtes über die durch den C02-Handel angeblich anfallenden Mehrkosten in zweistelliger Millionen-Höhe. Diese würden Investitionen verhindern und Arbeitsplätze kosten, beklagte sich BAYER-Vorstand Udo Oels wider besseren Wissens.
Noch mehr Sondermüll in Krefeld
BAYER betreibt die Abfall-Entsorgung mittlerweile als Geschäft und nimmt auch Fremd-Aufträge an. So bekam der Chemie-Multi den Zuschlag, für 3,6 Millionen Euro das Betriebsgelände der ELEKTROCHEMISCHEN FABRIK KEMPEN zu sanieren und 95.000 Tonnen Chlor sowie Klebstoff- und Waschmittel-Rückstände nach Krefeld abzutransportieren. Die LokalpolitikerInnen erfuhren von dem Gift-Deal nur aus der Presse und fühlten sich überfahren. Das Ratsmitglied Burkhard Frohnert sah noch reichlich Klärungsbedarf. “Wie wird Flugstaub beim Abkippen verhindert„, fragte er etwa im Rat.
Verbrennungsanlage verunreinigt Luft
Nach dem Bundesimmissionsschutz-Gesetz hat der Leverkusener Chemie-Multi die Pflicht, die Öffentlichkeit über den Schadstoff-Ausstoß bei Giftmüll-Verbrennungen zu informieren. Bei der Krefelder Anlage kam da so einiges zusammen. Die Emissionswerte betrugen für Staub im Jahresmittel 0,26 mg/m3, für Kohlenstoff 1,4, für Chlorwasserstoff 0,9, für Schwefeldioxid 1,7, für Stickstoffdioxid 82, für Kohlenmonoxid 6,3 und für Ammoniak 1,6. Der Halbstundenwert für Chlorwasserstoff überstieg dabei sogar einmal die zulässige Obergrenze.
Hoher Sondermüll-Anteil von Chemie
28,6 Millionen to Sonderabfall produzierte die europäische Industrie im Jahr 1999. Die giftigen Substanzen von BAYER und anderen Chemie-Unternehmen hatten daran einen Anteil von zehn Prozent.
Mehr Rückstandsverbrennung in Dormagen.
Der Leverkusener Chemie-Multi will die Kapazität der Dormagener Rückstandsverbrennungsanlage um 19.000 Tonnen auf 75.000 Tonnen jährlich erweitern. Dazu brachte er einen Eilantrag in den Rat ein. Werksleiter Walter Schulz begründete die Ausbau-Pläne mit der gestiegenen Abfall-Produktion im Chemie-“Park„ und einer höheren Nachfrage auf dem Markt für Verbrennung von Sondermüll.
Rückstellungen wg. Chrom
Das Grundwasser in der Umgebung des im südafrikanischen Durban gelegenen BAYER-Werks ist stark durch Krebs erregende Chrom-Verbindungen belastet (siehe auch SWB 4/04). Der Leverkusener Chemie-Multi bestreitet, dass es sich um aktuelle Einträge handelt, die Chrom-Belastung gehe angeblich auf “historische Verunreinigungen„ zurück. Trotzdem hat BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS wegen etwaiger Schadensersatz-Ansprüche eine Rückstellung in Höhe von 40 Millionen Euro gebildet.
Leichterer Zugang zu Umwelt-Informationen
Die EU erleichtert natürlichen und juristischen Personen den Zugang zu Umwelt-Informationen der Behörden. Nach der neuen Richtlinie müssen die Ämter diese binnen vier Wochen zur Verfügung stellen. Verweigern die staatlichen Stellen die Auskunft, so sind sie zu einer detaillierten Begründung angehalten. AntragstellerInnen haben überdies die Möglichkeit, die Ablehnung anzufechten. Vor zwei Jahre hatte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) eine Anfrage an das NRW-Umweltministerium wegen der Risiken bei Erweiterung von BAYERs Phosgen-Produktion gestellt und monatelang keine Antwort erhalten. Bleibt abzuwarten, ob sich das in Zukunft ändern wird.
PRODUKTION & SICHERHEIT
BAYER überwacht sich selbst
BAYER hat 1949 den Verband der Technischen Überwachungsvereine (TÜV) mitgegründet. Entsprechend wohlwollend und nichtssagend fallen dann auch die Gutachten zu Störfallen aus. Jetzt erreicht die Zusammenarbeit eine neue Stufe. Die 80 für die Sicherheit der Leverkusener BAYER-Anlagen zuständigen MitarbeiterInnen wechseln komplett zur TÜV CHEMIE SERVICE GmbH. “TÜV SÜD und BAYER INDUSTRY SERVICES GmbH & Co. OHG legen damit ihre Branchen-Kompetenz für technische Anlagen-Sicherheit und überwachungsbedürftige Anlagen in der Chemie- und Prozess-Industrie zusammen„, heißt es dazu in einer Presse-Information. Sie stellt eine endgültige Kapitulationserklärung des TÜV vor den Interessen der Industrie zu Lasten des Katastrophenschutzes dar. Hintergrund des “Joint Ventures„ dürfte der Wunsch BAYERs gewesen sein, die Sicherheitsnebenkosten der Immobilie “Chemie-„Park“ zu senken (s. u.).
STANDORTE & PRODUKTION
Krise der Chemie-„Parks“
Mit einem Jahres-Umsatz von 1,5 Millarden Euro ist die BAYER INDUSTRY SERVICES der größte Betreiber von Chemie-„Parks“ in der Bundesrepublik. Aber die Geschäfte laufen nicht so gut. Konkurrenten wie die DEGUSSA versuchen zurzeit, sich von ihren Grundstücken zu trennen. Wegen der hohen Fixkosten, unter anderem durch Sicherheitsauflagen, sagen BeobachterInnen eine „Markt-Bereinigung“ voraus. BAYER sieht jedoch noch keinen Handlungsbedarf. „Es gibt keine Verkaufsgespräche und auch keine Pläne dazu“, sagte ein Konzern-Sprecher. Allerdings versucht der Chemie-Multi, die Parks effizienter zu managen. So plant er in Wiesdorf, das Gelände zu verkleinern und die Verwaltungsgebäude außen vor zu lassen, weil die nötigen Sicherheitsmaßnahmen dann nicht mehr dem Chemie-Standard entsprechen müssen (siehe auch Ticker 4/04).
HC STARCK in Leverkusen
Die BAYER-Tochter HC STARCK, berühmt-berüchigt wg. des Bezuges von Rohstoffen aus dem Bürgerkriegsland Kongo, hat seit 2002 auch eine Niederlassung im Leverkusener Chemie-„Park“. Jetzt richtet sie dort ein neues Verwaltungs- und Forschungsgebäude ein. Sie will in den neuen Labors Leuchtdioden für den TV- und Computermarkt, leitfähige Kunststoffe und Spezial-Chemikalien für die Elektro- und Elektronik-Industrie entwickeln.
BAYER kritisiert die Stadt Leverkusen
Der Pharma-Riese zahlt in Leverkusen im Jahr 2005 keine Gewerbesteuern, was ihn aber nicht davon abhält, immer wieder Forderungen an die Kommune zu stellen. So kritisierten drei BAYER-Teilnehmer an dem Fachkongress „Bio meets Nano and IT“, der in Leverkusens finnischer Partnerstadt Oulu stattfand, die fehlende Präsenz der Stadt bei der Tagung. Während andere Orte wie Halle ihre BürgermeisterInnen mit zum Kongress schickten, glänzte Leverkusens politische Spitze durch Abwesenheit, monierten die BAYER-Vertreter. Die angegriffenen KommunalpolitikerInnen machten die nicht zuletzt durch den Konzern verschuldete schlechte Haushaltslage für ihr Fehlen in Oulu verantwortlich und erläuterten dem Chemie-Multi im Übrigen, welch großen Anteil die „Wirtschaftsförderung Leverkusen“ an der Vorbereitung des Technologie-Meetings gehabt hat.
Streit um Park-Pflege
Während BAYER in Leverkusen 2005 keinen Cent Gewerbesteuer zahlt, erbringt die Kommune nach wie vor viele freiwillige Leistungen für das Unternehmen. So trägt die Stadt mit 40.000 Euro die Hälfte der Kosten für die Pflege des Wiesdorfer BAYER-Parks. Die Ratsfraktion der SPD hat sich jetzt gegen diese Subvention ausgesprochen. „Warum sollen wir BAYER-Gelände pflegen?“, meinte etwa der Ratsherr Johannes Singer. Entsprechende Vorstöße von seiten der Politik hat es bereits in der Vergangenheit gegeben, bisher blieb aber immer alles beim Alten.
Krefeld: Ein Hallenbad weniger
Der Schwimmsport-Verein SSF Aegir errichtete über einem Krefelder Freibad im Winter eine Traglufthalle. BAYER sorgte mit kostenlosen Dampf-Lieferungen für die Beheizung. Im September 2004 stoppte der Leverkusener Chemie-Multi seine Unterstützung. Stadt und Verein können das Geld für den Unterhalt des Bades nicht allein aufbringen, weshalb sie den Winter-Betrieb einstellten. In der Vergangenheit hat das Unternehmen bereits das konzern-eigene Carl-Duisberg-Bad geschlossen und die Zuschüsse für die Dormagener „Römer-Therme“ gekürzt.
Stegmüller Boss in Brunsbüttel
Roland Stegmüller hat im August 2004 die Leitung des Brunsbütteler Chemie-„Parks“ übernommen und tritt damit die Nachfolge von Willy Schiwy an. Werksleiter gibt es bei BAYER nicht mehr, an seine Stelle ist der Chemie „park“-Leiter getreten. Nach den vielen Umstrukturierungen und Ausgliederungen existieren auf den Unternehmensarealen nämlich keine einheitlichen Werke im früheren Sinne mehr. Weil der Chemie-Multi in Brunsbüttel nur Kunststoff herstellt, betreibt nicht wie sonst üblich BAYER INDUSTRY SERVICE den Chemie-„Park“, sondern BAYER MATERIAL SCIENCE.
Genter Forschungszentrum eröffnet
BAYER hat Ende Oktober 2004 das Gentechnik-Forschungszentrum im belgischen Gent in Betrieb genommen. In den nunmehr größten und modernsten Gentech-Laboren des Konzerns sollen die WissenschaftlerInnen gen-manipuliertes Saatgut und neue Produkte der Pflanzen-Biotechnologie entwickeln.
Antwerpen: Neue Anilin-Anlage
BAYER baut im belgischen Antwerpen für 20 Millionen Euro eine neue Anilin-Anlage und erweitert an dem Standort die Kapazität der bereits vorhandenen Fertigungsstätte. Der Konzern setzt den Stoff unter anderem bei der Produktion des Schaumstoffes Polyurethan ein.
BAYER erhöht Kunststoff-Produktion
Der Leverkusener Chemie-Multi kündigte an, seine Kunststoff-Produktion zu steigern und neben der Investition in Antwerpen (s. o.) die Kapazitäten der Fertigungsstätten im spanischen Tarragona, im US-amerikanischen Baytown und in Brunsbüttel zu steigern.
Neue Fabrik auf den Philippinen
BAYER plant, auf den Philippinen eine neue Anlage zur Produktion von Saatgut-Behandlungsmitteln à la GAUCHO aufzubauen, das in Frankreich für ein Bienensterben enormen Ausmaßes verantwortlich war.
IMPERIUM & WELTMARKT
BAYER kauft EHRFELD MIKROTECHNIK
Der Leverkusener Chemie-Multi hat das hessische Unternehmen EHRFELD MICROTECHNIK erworben. Die Firma machte die Mikrotechnik für Produktionsanlagen nutzbar, weshalb diese nicht mehr so einen großen Umfang haben müssen. Zudem erhöht die Einführung der Mikrotechnik die Effizienz der Fertigungsstätten und macht angeblich die chemischen Prozesse kontrollierbarer.
Kooperation mit PHYSIOMICS
BAYER hat einen Kooperationsvertrag mit der britischen Bioinformatik-Firma PHYSIOMICS abgeschlossen. Die beiden Unternehmen wollen ihre Technologien zur pharmakologischen Untersuchung von Stoffen zusammenführen.
Verkauf des Plasma-Geschäfts
Der Leverkusener Chemie-Multi hat seine Blutplasma-Sparte für 450 Millionen Euro an den US-amerikanischen Finanz-Investor CERBERUS verkauft. Damit wechselten Blut-Präparate wie GAMUNEX, GAMIMUNE N, POLYGLOBIN und PROLASTIN den Besitzer. Nur KOGENATE vermarktet der Konzern noch selbst. Um Steuern zu sparen, hält BAYER aber pro forma eine Beteiligung von 10 Prozent „als mittelfristiges Investment“ an dem Blutprodukte-Segment.
Vertrag mit HIKAL
Der Leverkusener Chemie-Multi betreibt drei Ackergift-Produktionen in Indien. Im Herbst hat das Unternehmen mit dem indischen Hersteller HIKAL LTD einen Vertrag über die Lieferung von Feinchemikalien für die Pestizid-Herstellung geschlossen. BAYER hatte sich vor zwei Jahren von der eigenen Feinchemie-Sparte getrennt. BAYER CROPSCIENCE-Vorstand Wolfgang Welter bezeichnete das Eingehen von Kooperationen deshalb jetzt als Teil der neuen globalen Strategie des Konzerns.
ÖKONOMIE & PROFIT
Steuersparen in den USA
BAYER & Co. stöhnen bei jedem passenden und unpassenden Anlass über die angeblich zu hohe Steuer-Belastung in der Bundesrepublik und verweisen im gleichen Atemzug auf die weit unternehmensfreundlicheren Regelungen in den USA. Das ist allerdings reine Propaganda: In den Vereinigten Staaten sind die Steuersätze für Konzerne mit 35 Prozent genauso hoch wie hierzulande - und die Möglichkeiten, sie zu umgehen, genauso zahlreich (siehe auch SWB 4/04). Von den 275 größten Firmen zahlen BOEING, PFIZER, TIME WARNER und 43 andere trotz riesiger Gewinne überhaupt keine Abgaben. Im Durchschnitt bewegte sich das Steuer-Aufkommen der Firmen im Zeitraum zwischen 2002 und 2003 bei weniger als 18 Prozent und damit auf dem niedrigsten Niveau seit dem Zweiten Weltkrieg. Diese paradiesischen Zustände haben die Multis der Politik von George W. Bush zu verdanken. Für BAYER hat sich also die ihm gewährte Wahlkampf-Hilfe mehr als ausgezahlt.
UNFÄLLE & KATASTROPHEN
Fünf Verletzte bei Explosion
Am 23.11.04 kam es im Brunsbütteler BAYER-Werk zu einer Explosion. Die Druckwelle war so stark, dass Beschäftigte durch den Raum stoben und Teile durch die Luft flogen. Fünf Belegschaftsangehörige verletzten sich dabei und mussten sich einer Krankenhaus-Behandlung unterziehen.
Austritt von Adipin-Säure
Auf dem Gelände des BAYER-Chemie-„Parkes“ in Uerdingen kam es am 11.12.04 beim Umladen einer Chemikalie vom LKW in den Werkstank zu einem Unfall. In der Förderleitung entstand ein Leck, aus dem 400 Kilo der giftigen und Reizungen auslösenden Adipin-Säure austraten. Die als Vorprodukt bei der Herstellung von Lacken und Kunststoffen verwendete Säure verbreitete sich bis zu einer angrenzenden Straße. Der Lastkraftwagen-Fahrer musste sich zur Untersuchung in die BAYER-Polyklinik begeben.
Austritt von Acrylonitril
In der im US-amerikanischen Addyston (Bundesstaat Ohio) gelegenen Niederlassung des Chemie-Unternehmens LANXESS, an dem BAYER eine Aktien-Beteiligung hält, passierte im Oktober 2004 ein Unfall. In der Kunststoff-Fertigung kam es zu einer Produktionsstörung, in deren Folge 448 Kilogramm des Krebs erregenden Gases Acrylonitril austraten. Obwohl in der Nähe des Werkes ein Volksfest stattfand, unterließ es die Firmen-Leitung, die Behörden zu informieren.
Austritt von Acrylonitril
Im Addystoner LANXESS-Werk (s. o.) ereignete sich zwei Monate nach dem Acrylonitril-Austritt im Oktober erneut ein Störfall mit dem Krebs erregenden Gas. Am 15. Dezember 2004 traten während der Kunststoff-Produktion 260 Kilogramm der Substanz aus. Die zuständigen Behörden wollen dem Unternehmen nun strengere Sicherheitsauflagen machen.
Austritt von Aktivkohle
Am 29.9.04 ereignete sich im Uerdinger BAYER-Werk ein Unfall, bei dem giftige Substanzen austraten. Acht MitarbeiterInnen kamen in Kontakt mit den Chemikalien und mussten zur Untersuchung ins Krankenhaus. Sechs Beschäftigten entließen die MedizinerInnen nach kurzer Beobachtungszeit, zwei behielten sie länger dort. Nach BAYER-Angaben hat das Gemisch „im Wesentlichen aus Aktivkohle und Wasserdampf“ bestanden. Was „im Unwesentlichen“ noch so alles dabei war, verschwieg der Konzern. Da Aktivkohle dazu dient, giftige Stoffe aus den bei der Produktion anfallenden Reststoffen herauszufiltern, dürfte sie mit so allerhandlei angereichert gewesen sein. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hat in einer Anfrage an das Umweltministerium NRW genauere Informationen über die Vorgänge verlangt und die Medien über den Störfall informiert.
Container-Unfall in Leverkusen
Am 14.9.04 kam es wenige Stunden vor der offiziellen Inbetriebnahme des neuen Container-Terminals auf dem Gelände des Leverkusener Chemie-„Parks“ zu einem Unfall mit einem Container, bei dem BAYERs Brand-Früherkennungssystem Schlimmeres verhinderte.
Brand bei LANXESS
Am 19.1.05 entzündete sich bei einem Produktionsbetrieb der BAYER-Abspaltung LANXESS auf dem Gelände des Leverkusener Chemie-„parks“ die Chemikalie Natriumborhydrid, ein Vorprodukt zur Arznei-Herstellung. Es entstand ein Brand, den die Feuerwehr erst nach einer Stunde unter Kontrolle hatte.
RECHT & UNBILLIG
Wieder Kartell-Strafe für BAYER
BAYERs kriminelle Energie in Sachen „Preis-Absprachen“ ist trotz des jüngsten Verfahrens in den USA wg. Bildung eines Kunststoff-Kartelles ungebrochen. In Portugal hat der Pharma-Riese zusammen mit anderen Unternehmen eine konzertierte Aktion bei Diabetes-Tests beschlossen - und binnen eines Jahres kosteten diese dann nicht mehr 15, sondern 20 Euro. Aber die Sache flog auf. Ein Gericht verurteilte BAYER zu einer Strafe von 658.000 Euro. Schon vor vier Jahren hatten die Konzerne in Italien die Gewinn-Spannen