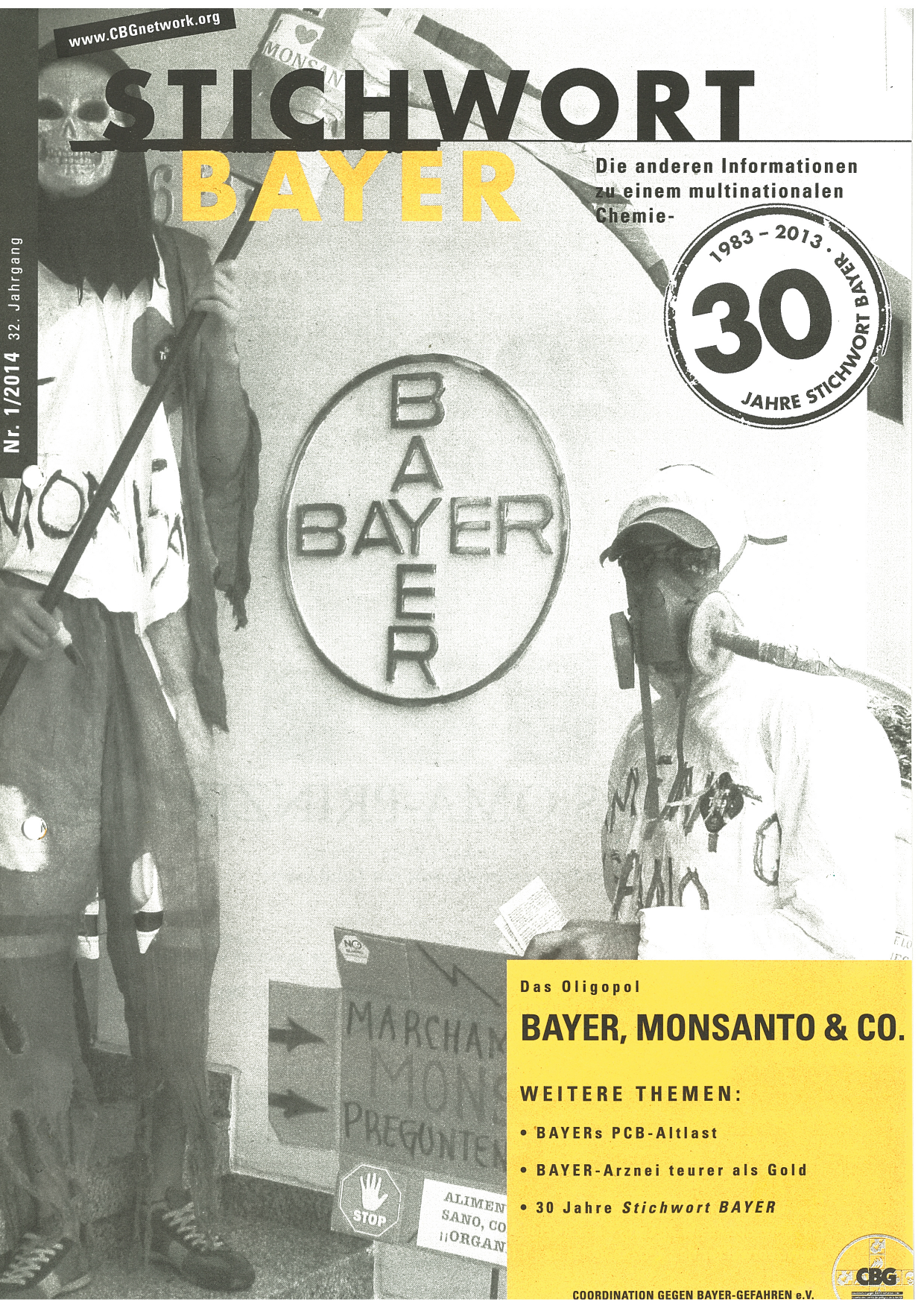16. Januar 2014
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren erhält regelmäßig Erfahrungsberichte von Patienten, die nach Einnahme des Antibiotikums Ciprobay schwere physische und psychische Schäden erleiden. Im vergangenen Jahr veröffentlichten wir die Krankengeschichte eines jungen Amerikaners, die große Anteilnahme auslöste. Hier die Leidensgeschichte einer Betroffenen, die mit der Einnahme des Antibiotikums zusammenhängen könnte.
Erfahrungsbericht: Nebenwirkungen nach Einnahme von Ciprobay
Meine Verzweiflung und mein Leidensdruck waren so groß, dass es nur noch mein Wunsch war, nicht mehr leben zu wollen und das alles nur weil ich vor einer Gallen-OP die Medikamente Ciprobay und Metronidazol ohne Beipackzettel von der Klinik in der Sprechstunde erhalten habe. Seither ist nichts mehr, wie es mal war (das war am 14. März 2013).
Ich hatte Leistenschmerzen, Unterleibsschmerzen und Schmerzen unter der rechten Rippe, allgemein fühlte ich mich sehr unwohl und eher kränklich. Um 22 Uhr ging ich dann ins Bett und es dauerte nicht lange, da fing mein ganzer Körper an zu zittern. Ich dachte, das wäre ein epileptischer Anfall. Wir fuhren sofort in die Klinik, wo ich auch das Medikament bekommen habe. Nach zwei Stunden bekamen wir die Blutergebnisse, Leukozyten waren noch ein bisschen erhöht, ansonsten war das Blut in Ordnung. Der Doktor tastete den Bauch ab und meinte, er findet nichts. Er meinte ich könnte da bleiben, dann könnten wir den nächsten Tag eine Not-OP machen und die Galle gleich entfernen. Die Schmerzen waren bis dahin besser und ich entschied mich heim zu gehen. Keiner kam drauf, dass es von den Medikamenten sein könnte, auch ich nicht.
März: an manchen Tag merkte ich, dass ein Spaziergang von ca. 15 Minuten mich total schwächte. Auch der Bauch wurde immer empfindlicher gegenüber Druck. Ich hatte an einigen Tagen Durchfall und Erbrechen. Ich merkte auch immer vermehrt, dass ich Probleme hatte beim Hose anziehen. Oberkörper nach unten und Bein heben war fast nicht möglich. Ich schob es mehr oder weniger auf das Alter.
Ich hatte einige Tage Lendenwirbelschmerzen und ich fühlte mich um 30 Jahre gealtert, ich hatte ein Schwächegefühl und starke Müdigkeit. Im Allgemeinen merkte ich, dass irgendwas mit meinem Körper nicht stimmte, ich fühlte mich nicht wohl. Musste manchmal alle halbe Stunde auf die Toilette, hatte manchmal Durchfall und dieses ständige Rumoren im Bauch war sehr unangenehm.
7.4.2013 war die Gallen-OP und ich wurde am 10.4. entlassen. Ich merkte, dass ich mich allgemein sehr schlecht davon erholte. Die Narbe am Bauch zog, als zieht mir jemand die Haut ab. Die Seite wo die Galle entfernt wurde, hatte ich das Gefühl sie wird manchmal taub. Meine Hausärztin meinte das sei normal.
Die Tage nach der OP wachte ich oft nachts auf und war im Brustbereich ganz nass geschwitzt. Ich hatte das Gefühl, dass mein Körper elektrisierte und oft kamen dann noch die Darmgeräusche dazu. Auch wachte ich manchmal auf und ich merkte, wie sich mein Körper verkrampfte. Ca. 6 Wochen später wurde nochmals Blut genommen, wegen der OP, alles war wohl in Ordnung. Erzählte dem Arzt so meine Symptome, das wäre alles normal, es wäre ja auch kein kleiner Eingriff gewesen.
Ende Mai hatte ich heftige Lendenwirbelschmerzen und dann einige Tage starken Leistenschmerzen und Hüftschmerzen. Ab dieser Zeit begannen dann auch die Schlafprobleme. Keine Nacht die ich mehr als 2-4 Stunden geschlafen habe. Wenn Schmerzen auftraten, stand ich auf und lief in der Wohnung herum. Legt mich wieder hin und stand wieder auf. Das ging dann Stunden.
Ich ging dann zum Orthopäden, es wurde eine Facettengelenksarthrose festgestellt. Die Leisten- und Hüftschmerzen wurden sofort mit der Arthrose in Verbindung gebracht. Bekam eine Spritze mit Kortison, Akupunktur und KG. Denn als ich die KG begann, fingen auch meine Schmerzen in den Knien und Armen an. Der Krankengymnast stellte mich hin, als wäre das bei mir alles psychisch bedingt. Alle Therapie half nicht. Eine andere KG die mich vertretungsweise auch in der Zeit behandelte, meinte mein Steißbein wäre angeschwollen.
Juni 2013
Mitte Juni kamen dann heftige Knieschmerzen und am linken Arm von dem Ellenbogen zum kleinen Finger heftige Schmerzen. Im Wechsel tat mal die Hüfte weh, dann eher die Leiste, dann mal der Arm (von Ellenbogen zum kleinen Finger), dann tat das Steißbein weh. Ich bemerkte bei meiner Gymnastik, dass ich manchmal die Übungen wo man auf der Seite lag, Schmerzen an den Hüftknochen, genau da wo ich lag, hatte. Ich merkte, dass meine Handgelenke beim Aufstützen wehtaten. Aber auch das war mal besser mal schlechter.
Eine Nacht hatte ich so extreme Knieschmerzen mit Muskelzucken in den Oberschenkeln. Das hielt ganze 2 Wochen an. Mein Körper ist ständig in Krampfstellung. Ich fuhr in die Notaufnahme der Neurologie. Ich ging ja derzeit von einer Borreliose aus. Somit meinte der Arzt, ja das könnte eine Lymeborreliose sein. (Nachtrag 22.10. Seither sind meine Oberschenkel beim Reinkneifen wie taub).
Auch wachte ich oft nachts auf und hatte den Gedanken, mir mit einem großen Messer die Hand abzuhacken. Diesen Gedanken hatte ich dreimal. Ich legte sogar schon das Messer auf den Küchentisch. Bis dahin war mir aber noch nicht klar, warum ich so ein Denken hatte. Denn mein Leben war ja in Ordnung, ich habe eine super Job, einen guten sozialen Kontakt, eine schöne eigene Wohnung, einen Freund. Ich hatte einen Weg im Leben gefunden der mich sehr weise machte und mich bereicherte, den spirituellen Weg. Aber damals war mir noch nicht bewusst, dass das Nebenwirkungen von Ciprobay sein könnten. Dazu später mehr.
Viele Dinge der Unbeweglichkeit wurden meinem Unfall, anfangs des Jahres oder der Gallen-OP zu gesprochen. Ich merkte auf einmal, dass ich bei der Gymnastik auf dem Boden, meine Knie nicht gerade bekam und der Oberkörper nach hinten abgeneigt war. Ich merkte auf einmal, dass ich meine Schuhe nicht mehr wie gewohnt zumachen konnte, ich kam nicht mehr richtig hinunter. Ich merkte wie ich meinen Kopf nicht mehr richtig nach unten beugen konnte. Wie wenn eine Blockade im oberen Bereich wäre.
Hinzu kamen dann ähnliche Symptome wie Hitzewallungen. Mir lief ein Schauer über den Rücken hoch zum Haaransatz und mein Gesicht bekam Wärme, tagsüber aber ohne Schweißbildung. Nachts hatte ich manchmal immer noch Schweißausbrüche. Manchmal hatte ich das Gefühl, jemand steht hinter mir und pustet mir in den Rücken. Ich habe bis heute 10.08. sieben Kilo abgenommen. Auch kann ich seit längerem nicht mehr auf meinem Po sitzen, wie wenn ich auf dem Knochen sitze. Meine Arme sind dünner geworden. Schwäche an den Armen und Beinen. Muskelschwund?
Nebenwirkungen zum damaligen Zeitpunkt:
Mundtrockenheit, Nasentrockenheit.
Ständiger Toilettenbesuch.
Unruhe, Nervosität, Panik, Suizidgedanken
Sehstörungen
Konzentrationsschwierigkeiten
Vergesslichkeit
Gleichgewichtsstörungen
Verwirrt und Orientierungslos
Die Knie sind geschwollen, extrem links, mit Knotenbildung über der Kniescheibe
Verstärktes Herzklopfen, vor allem in der Nacht
Allgemeines Unwohlsein
Herzrhythmusstörungen und Puls immer über Hundert.
Koordinierungsstörungen
Öfters Verkrampfen des Körpers
Untertemperatur, ständiges innere Frieren
Erhöhter Puls
Juli 2013.
2.7. Ging ich nochmals zu meiner Ärztin. Sie meinte, Sie sind in den Wechseljahren und verschrieb mir ein Naturmittel.
9.7. Ging ich zum Neurologen um meine Muskeln und Nerven nachschauen zu lassen. Er stand vor mir und wackelte einmal mit der rechten und dann mit der linken Hand und fragte mich und welche Hand bewegt sich jetzt und welcher Finger bewegt sich jetzt. (Idiot) Er meinte, ich hätte einen Burn Out und müsste Psychopharmaka nehmen.
15.7. Zweitmeinung beim Orthopäden, wegen meinen Knien und Oberschenkelschmerzen. Die Schmerzen kämen wohl von den Muskeln im Po. Aha!
Schmerzen werden immer schlimmer. Muskeln und Sehnen tun inzwischen weh. Was vorher nur nachts war, ist jetzt auch tagsüber. Mal einen Tag weniger, dann wieder mehr.
22.7. Augenarzt wegen den Sehstörungen. Das sei in meinem Alter normal.
22.7. Frauenarzt, Blutentnahme ob die Gelenks- und Gliederschmerzen von beginnenden Wechseljahren kommen. Blutergebnisse kamen, er sagt alles in Ordnung, keine Wechseljahre, dafür sind sie noch viel zu jung.
26.7. Endokrinologen Hormone checken lassen, weil manche Ärzte meinten es könnte auch eine Hormonstörung sein. Ergebnis: alles in Ordnung.
30.7. Radiologe: Schilddrüse in Ordnung. Blutergebnisse in Ordnung.
August 2013
4.8. auf den 5.8. tat mir der ganze Bauch weh, es brannte wie Feuer. Man konnte ihn nicht berühren und das alles in der Nacht. Am nächsten morgen sagte ich zu meinem Freund, ich packe jetzt die Kliniktasche und geh erstmal zu einer Vertretung, da meine Ärztin in Urlaub war und dann in die Klinik, ich kann nicht mehr. Sie tastete meinen Bauch ab, er tat höllisch weh und sie hörte ihn ab und sagte nur also in die Klinik brauche ich sie nicht tun und ich versichere Ihnen, da ist alles in Ordnung und nichts ernsteres und machte mir einen Termin zur Darmspiegelung.
Sie meinte, dass es auch sein könnte, dass es wegen der Fernbeziehung ist, dass es mal da und da weh tut. Ich saß da und dachte ich hör nicht recht und war verzweifelt.
Die Schmerzen waren nicht am Darm oder am Magen, so was kenne ich ja, sie waren direkt an der Innenbauchdecke. (Nachtrag: Vielleicht hängt es damit zusammen, das ich nach der Einnahme von Cipro eine OP hatte)
Schwindel und starke Gleichgewichtsstörungen. Einmal bin ich fast die Treppen runter gefallen oder vom Fahrrad. Inzwischen gehen die Schmerzen sogar an das Schienbein oder Wade. Bauchschmerzen, Rippenschmerzen, Leisten, Hüften, Unterbauchschmerzen, Oberbauchschmerzen, Pomuskelschmerzen, allgemein Muskel- und Gelenksschmerzen, Knieschmerzen, Atemvolumen ist oft bei Laufen von Treppen oder Laufen von größeren Strecken vermindert, Brennschmerzen der Haut, Ziehen in die Brust hinein, ausgeprägtes Frieren, häufiges Wasserlassen, nachts bestimmt 7-10 mal, Kribbeln, Taubheit oder brennende Schmerzen in den Beinen, Zittern und Rötungen am Brustbein, Gesicht, Hals rechts und links und in der Mitte.
Blähungen, Magenschmerzen, Appetitlosigkeit, Konzentrationsstörung. Komme nur noch über die Seitenlage aus der Badewanne, Gefühl wie wenn mir jemand hinten am Rückgrat ein Messer rein sticht. (Zweimal aufgestanden und nicht auf dem Fuß aufgekommen sondern auf den Zehenspitzen (fast hin gefallen).
Sehr ausgetrocknete Haut im Allgemeinen und juckende gerötete Stellen.
13.8.
Heute Nacht bekam ich erst ein Schauer über den Körper und dann verkrampfte sich mein ganzer Körper. Mein Rücken (Lendenwirbel, Steißbein bis über die Pobacke) Schmerzen. Als ich aufstand merkte ich deutlich eine Muskelschwäche, konnte mich kaum auf den Beinen halten. Seit heute merke ich, dass das komische Körpergefühl was ich seit Wochen oft habe, über den Nacken bis hoch zum Haaransatz geht. Mein Rücken schmerzt, meine Knie schmerzen, mein Unterleib schmerzt meine Haut brennt, wie wenn sie mir jemand abzieht.
14.8.
Nach zwei Stunden Schlaf bin ich wieder aufgewacht, der Schauer lief wieder durch meinen Körper und mein Körper verkrampfte sich.
Den ganzen Tag war ich total fertig, weiss im Gesicht und hatte wie immer Schmerzen. An den Knien, an den Rippen, an den Hüften, am Bauch und und und. Allgemein fühlte ich mich orientierungslos und verwirrt und hatte keine Konzentration. Durch den Anfall nachts konnte ich kaum auf meinen Beinen stehen. Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht standhaft, einfach wackelig.
Nachts hatte ich das Gefühl wie wenn irgendwas an meinem Halswirbel in den Kopf steigt. Innerlich merkte ich wie irgendwas hoch wanderte. Ich war verzweifelt und ich habe es niemanden gesagt, weil ich dachte, die halten mich für blöde. So was hat doch kein Mensch.
16.8. -18.8.
Meine Schlaflosigkeit ist schon seit Ende Mai. Manchmal schlafe ich nur 2 Stunden und dann dreh ich mich von einer zur anderen Seite, weil ich Schmerzen habe, im Unterbauchbereich und Wirbelsäule.
Meine Mund trocknet immer mehr aus, morgens habe ich einen stark weissen Belag auf der Zunge und am Rand sind Einkerbungen zu sehen. Auch habe ich einen komischen Geschmack im Mund, den ich so nicht kenne, Metallgeschmack.
Auch merke ich seit Tagen, dass meine Augen immer mehr unangenehm brennen und auch oft gerötete sind. Auch die Sehstörungen werden mal stärker und dann wieder besser. Die Tage habe ich leichten Kopfdruck. Ich merke immer mehr, wie ich Wortfindungsstörungen habe und vergesslicher werde. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich einen Tag zuvor gemacht habe.
.Manchmal sind meine Füße ganz heiß und manchmal ganz kalt. Ich verspüre oft ein Taubheitsgefühl in den Beinen. Inzwischen merke ich auch meine Zähne, manchmal schmerzt der Kiefer. Es ist auch schon passiert, dass ich mein Bein nicht ins Auto bekam und es rein heben musste.
Ich habe das Gefühl vernebelt im Kopf zu sein. Ich kann nicht mehr klar denken. Mir ist aufgefallen, dass mir die letzten Zeiten viele Dinge aus der Hand fallen, oder ich mich oft anstoße. Auch wird mir vermehrt schwindelig.
Wenn ich zur Arbeit gehe, muss ich dreimal in die Tasche schauen ob ich alles habe, muss mir alles aufschreiben. Selbst wenn ich nur Telefon, Schlüssel und Geldbeutel benötige, vergesse ich eins bestimmt. Ich habe das Gefühl an Demenz erkrankt zu sein. Wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich schon war, kann es sein, dass ich auf der Fahrt hin, auf einmal nicht mehr weiß, wo war denn das, wo ich hin muss. Das ist grausam. Besonders wenn man dort schon oft war.
18.8.
Meine Oberschenkel und Knie brannten wieder wie Feuer und taten höllisch weh und mein Körper verkrampfte sich ständig.
Um 17 Uhr entschied ich mich, in die Notfallambulanz zu fahren. Nach drei Stunden wurde ich wieder heim geschickt, mir wurde ganz lieb mitgeteilt, dass keine Betten frei wären und sie ja am Wochenende unterbesetzt wären. Ich soll bei der Ambulanz nächsten Tag Termin weg LP machen. Der Professor meinte auch, nach den Symptomen könnte es eine Lyme Borreliose sein. Der Arzt klopfte mir dreimal mit dem Hämmerchen auf das Knie, es zuckte viermal nach. Er meinte ob das Willkür wäre. (Unverschämt)
19.8.
Wieder nur zwei Stunden geschlafen. Schmerzen in den Hüften, alle Stunde aufgestanden, kalt abgeduscht, Wärmeflasche gemacht. Es gab Nächte, da habe ich mich bald fünfmal kalt abgeduscht. Und seid längerem bin ich sehr durstig. Trinke am Tag bestimmt 4 Liter (weil ich so einen ausgetrockneten Mund habe)
21.8.
Meine Zähne merke ich die Tage auch öfters, sie schmerzen und meine Nase ist immer noch sehr ausgetrocknet. Hatte wieder Nachtschweiß. Wieder sehr wenig geschlafen. Auch meine Oberschenkel schwellen wieder an und sind blau-rot marmoriert gefärbt. (Durchblutungsstörungen?)
MRT vom Kopf gemacht bekommen wegen Schwindel. Alles soweit in Ordnung, außer eine Ader wäre nicht ganz so offen, aber das wäre nicht schlimm.
23.8.
Beim HNO wegen meiner trockenen Nase und Mund gewesen. Abstrich in der Nase, keine Bakterien, Allergietest, keine Allergie.
Meine Augen fühlen sich an, wie wenn um den Augapfel ein Belag wäre, wenn ich in den Himmel schaue, sehe ich oft schwarze Mückenstriche.
Heute war ich wegen meinen beginnenden starken Augenschmerzen und ausgetrockneten Augen nochmals bei einem anderen Augenarzt. Ich erwähnte den Verdacht der Borreliose oder Autoimmunerkrankung Sjörden Syndrom. Ergebnis: Er kann nichts feststellen, es muss was Neurologisches sein.
2.9. Darm- und Magenspiegelung. Naja wie ich mir das schon dachte, es ist alles in Ordnung, außer die Leberwerte waren stark erhöht. Im Stuhlgang waren die Erreger Blastocystis hominis, die hätten aber 20-30 Prozent der Menschen. Leberwerte waren fast dreifach so hoch.
Ich merke schon seit Tagen, dass ich wieder öfters Angstattacken bekomme. Im Einkaufsladen musste ich deswegen ganz schnell raus. Angst in dunklen Räumen, Angst in Räumen ohne Fenster, Angst in kleinen Räumen, Angst wenn das Telefon klingelt, Angst unter Menschenmengen.
Wenn ich diese Angstattacken bekomme, merke ich die Schmerzen und das Unwohlsein verstärkt (Das hängt vielleicht mit der Adrenalin-Ausschüttung zusammen) Mein Kopf ist schon seit Tagen, wie vernebelt. Ich kenne mich nicht wieder. Manchmal habe ich das Gefühl, das bin nicht ich. Wenn ich in den Spiegel schaue sehe ich eine Person, die meinem Wesen nicht entspricht. Das innige Lachen, die Fröhlichkeit, die Zufriedenheit, das Ausgeglichene, die entspannte Person alles war weg. Das erinnert mich oft an manche Reportagen, wo Menschen Drogen genommen haben und einen sehr seltsame aggressive Mimik entwickelt haben. (Nachtrag 2014 : Als ich in der Psychiatrie war, lernte ich eine 23-jähriges Frau kennen, die an Bonsai/Drogen hängen blieb. Wenn sie Medikamente bekommen hat, war sie wie ein kleines Kind. Bevor sie die Medikamente bekam, hatte sie einen Gesichtausdruck, den ich im Nachhinein mit meinem Ausdruck, vergleichen kann. Wenn man davon ausgeht, das Cipro ein Gift/Droge ist, sehe ich da viele Gemeinsamkeiten)
5.9.2013
Heute war ich wieder bei meiner Hausärztin, das erste Mal, das ich bitterlich weinte. Sie nahm nochmal Blut um einiges zu testen. Sie sagte, sie kennt mich schon so lange und sie schaut jetzt was sie machen kann. Sie schaut noch mal nach Viren und Bakterien und nach Entzündungswerten, wegen Rheuma und Borrelien.
Sie verschrieb mir leichtes Beruhigungsmittel.
Am Montag habe ich dann Termin bei einem Borreliosespezialisten.
(Zu dem Zeitpunkt ging ich immer noch davon aus, Borreliose zu haben)
9.9.2013 Termin bei dem Borreliosespezialisten
Erst bekam ich einen Fragebogen von fünf Seiten, wo sämtliche Symptome drauf standen und ich war froh, dass mein Freund dabei war und mal jemand gesehen hat, was so alles zu einer Borreliose gehören kann. Manchmal habe ich ja schon das Gefühl, es glaubt mir keiner. Der Doktor sah sich meine mitgebrachten Untersuchungsergebnisse an und fragte mich, wie meine Beschwerden anfingen. Danach wurde Blut genommen. Nun kann ich wieder 4 Wochen warten, bis die Ergebnisse da sind. Zumindest der LTT dauert drei Wochen.
13.9.2013 Erneut Termin bei einem anderen Neurologen.
Sie hat die Nervenleitströme gemessen und meinte sie wären grenzwertig und ich soll dringend einen schnelleren Termin beim Rheumatologen machen, wegen Autoimmunerkrankung.
16.9. 2013 war ich dann wieder bei meiner Hausärztin in der Hoffnung, dass bei den Blutergebnissen was raus kam. Es wurden Yersienen schwach positiv gefunden. Borreliosetest negativ. Ja ja, klar der Test war negativ. Es gibt ja 16 verschiedenen Borellienarten und der Test misst ja leider nur einen und die Tests sind ja auch nicht zuverlässig. (Über Borreliose könnte ich ein eigenes Buch schreiben)
Ich fing das Rauchen wieder an, obwohl ich seit Mai aufgehört hatte. Ich dachte, wenn ich eh sterben muss, kann ich auch wieder rauchen. Die Zigarette ist mein einziger, bester Freund geworden.
18.9.
Ich ging in den Wald Pilze sammeln. Mir ging es nicht gut. Im Wald wurde ich immer nervöser und überlegte welchen giftigen Pilz kann ich mitnehmen und essen, damit dass alles ein Ende hat. Ich lief im Wald umher, bestimmt zwei Stunden und mein Herz schlug immer schneller. Ich überlegte ob ich im Wald sterben möchte, dort wo ich doch so gerne bin. Es machte mir Angst, über meinen eigenen Tod nach zu denken. Mir ging es immer schlechter, mein Puls raste immer schneller.
Ich ging heim und rief den Notarzt an.
Als er kam, hatte ich schon einen Puls von 170. Sie fuhren mich nach ins Krankenhaus bis ich wieder einigermaßen stabil war. Sie meinten, sie würden mich gerne in der Neurologie in Heidelberg vorstellen. Dort angekommen, wurde ich erstmal unschön begrüßt, mit sie waren ja schon mal da, haben sie die Therapievorschläge nicht befolgt. Ich dann Nein, da ich ja von der Klinik nach einer Woche angerufen wurde, dass eine Lumpalpunktion in meinem Fall ja Körperverletzung wäre. Er machte seine üblichen Tests und stand vor mir, welche Hand wackelt jetzt und welcher Finger jetzt und testete Reflexe. Zur Krönung fragte er noch ob ich was getrunken hätte. (In Gedanken. ne Herr Doktor Du Arsch, ich hab noch nichts gegessen, es ist schon 16 Uhr und in der anderen Klinik habe ich gebrochen und deshalb auch rote Augen und rotes Gesicht) Meine Aggressivität war inzwischen so groß, das ich dachte, wenn nochmal ein Arzt vor mir steht und mit den Händen wackelt, ich ihm eine rein haue und frage, mit welcher Hand habe ich Ihnen jetzt eine rein gehauen.
23.9. Nochmals beim Orthopäden wegen seit Tagen beginnenden Kreuz-Darmschmerzen. Sie verschrieb mir Antibiotika Doxycyclin Al 200
Borreliosespezialisten wegen den Ergebnissen angerufen. Auffällig, Lymphozyten stark erniedrigt, Vitamin B2/B6 erniedrigt, Pantothensäure, Eisen und Folsäure erniedrigt. Borreliose negativ. Ich habe nachts unsagbare starke Schmerzen am Kreuz Darmbereich und schlafe immer noch, nur stundenweise. Meine Wärmflasche ist mein nächtlicher Freund geworden.
Inzwischen habe ich bemerkt dass meine Innenmundbacken angeschwollen sind, wie ein zusätzliches Gewebe. Meine Zähne tun höllisch weh. In dem Lappen von Kinn zur Unterlippen und von der Oberlippe zur Nase, sind im Gewebe lauter kleine tastbare Knötchen. Auch im Bauchraum sind Knoten zu tasten.
1.10. Bei meiner Hausärztin gewesen, wegen meiner geschwollenen Backen. Ich bekam Antibiotika Cefaclor 500 für zehn Tage. Ich erzählte ihr, dass ich die letzte Zeit merke, des öfteren an den Oberinnenschenkeln blaue Flecken zu haben.
Blutabnahme: Neutroph Granuloz erhöht, Lymphozyten stark vermindert und IgG stark vermindert. Die Ärztin saß vor mir und sagte, ich sehe das an ihrem Blut was nicht stimmt, aber ich weiß nicht weiter.
3.10.
Nachts aufgewacht, und ich hatte wieder Schweißausbrüche im Gesicht und auf der Kopfhaut. Ich hatte das Gefühl, dass die linke Seite des Gesichtes taub ist.
Seit Wochen bemerke ich diesen extremen Nebel im Kopf, und ich habe das Gefühl, dass es immer schlimmer wird. Ich merke, wie sich mein Wesen in der ganzen Art verändert hat. Ich hab teilweise in geschlossenen Räumen Unwohlsein. Die Röte steigt mir immer öfters ins Gesicht. Auch am Hals seitlich und in der Mitte des Halses. Ich habe das Gefühl, dass mein Körper nicht mehr zu mir gehört. Es macht mir Angst. Mein Immunsystem scheint gegen irgendwas im Körper zu kämpfen. Und es macht mir Angst, dass es was Schlimmes ist und kein Arzt findet etwas heraus.
Ich komme mir schon so blöde vor, meinen Freunden davon zu erzählen. Denn keiner kann das was in meinem Körper vorgeht, verstehen und nachempfinden. Was ich auch verstehe. Wer hat schon so viel Mist auf einmal. Es sind ja Symptome die man manchmal ganz schwer beschreiben kann, einfach selten und zuviel auf einmal. Wo fängt man an und wo hört man auf. Mitunter sie ja Menschen sind, die Vertrauen zu Ärzten und der Pharmaindustrie haben. Ich war da immer schon skeptischer. Zu meiner Mutter habe ich mal gesagt,: „ Weißt du Mama, ich hätte lieber Krebs, es würde mir an einer Stelle weh tun und ich könnte in einem halben Jahr sterben, als mit dieser Ungewissheit, was zu haben und keiner weiß, was es ist“.
Meine Freundin sagte mal zu mir: „Jetzt denk doch einfach es sind die Wechseljahre“.
7.10.
Wieder beim Borreliosespeziallisten gewesen.
Alle Tests wegen Borreliose waren negativ. Ich fragte ihn ob es sein kann, dass irgendwas den Wert auch negativ verfälscht??? Er meinte ja, es kann auch sein, das der Test das nächste Mal positiv ist. Na super, wieder kein genaues Ergebnis, dabei wäre es ja so wichtig, so früh wie möglich mit Antibiotika anzufangen, falls ich die Borrelien habe. Er sagte ich soll nochmal Blut abnehmen lassen und machte einige Test, wegen Autoimmunerkrankung und Postinfektiöse Komplikation.
In der Zeit ging ich oft ins Bett und betete: Gott du kannst mich holen, ich bin bereit. Jeden morgen bin ich wieder aufgewacht. Segen oder Fluch?
9.10.
Heute stechen in den Leisten, jucken an den Fußsohlen, stechen wie mit Nadeln an manchen Körperstellen, Hals zum Ohr hoch ein Gefühl wie Entzündung, sogar an den Ohrlöchern merke ich eine Art Brennen.
Seit Tagen mache ich mir über den Tod Gedanken. Ich liebe das Leben, aber nicht unter diesen Umständen. Aber es ist gar nicht so einfach, sich über die Art wie man Sterben möchte, nachzudenken. Solche Gedanken hatte ich in meinem Leben noch nie. Klar hat man mal Situationen wo man verzweifelt ist.
2.10.
Gegen Nachmittag ging es mir richtig schlecht. Meine Augen sind ganz glasig ich zittere am ganzen Körper. Mir ist kalt. Meine Knie schmerzen. Mein Rücken zieht wie wenn jemand meine Lende auseinander zieht. Mein Hals ist wie immer rot. Rechts und links außen und genau in der Mitte des Halses auch. Meine Beine schlafen ein, meine Hände kraftlos. Mein Puls schlägt so arg, das man es am Hals sieht wie es pocht. Mein Bauch ist wie aufgeblasen. Ich habe Kopfschmerzen. Meine Schenkel brennen. Meine Oberschenkel sind geschwollen und rot-blau marmoriert. Meine Innenbacken seit Wochen geschwollen. Beim Husten schmerzt der Unterleib. Ich weiß nicht wie lange ich das noch durchhalte. Selbst meine Ohren brennen und am Hals runter zur Schulter brennt es auch. Jeden Tag kämpfe ich mit meinen Symptomen. Hab ständig blaue Flecken am Oberschenkel.
16.10. Beim Borreliosespeziallisten wegen Blutergebnissen angerufen.
Es wurden die Yasienien, Mycoplasmen, Chlamydien, Großes Blutbild, HLA-B27, Ana, Canca, Aka Und HLB 27 und großes Blutbild gemacht. Außer, dass ich wohl Mycoplasmen mit einem Titer aufweise, war alles in Ordnung. Na toll, wieder eines mehr im Körper.
Heute habe ich mich mal hingesetzt und so manche Dinge erledigt, falls mich Gott zu sich holt (Ich hatte das Gefühl, irgendwann sterbe ich. Ja, soweit ist es schon, wenn ich sage, mit meinem Körper stimmt was nicht, dann weiß das keiner wie nur ich. Ich denke ich muss einfach noch einiges regeln, bevor Gott mich zu sich holt. Und eins sollt ihr wissen, ich bin immer noch nicht psychisch krank. Es macht mich nur traurig, in so einer hilflosen Situation zu stecken, zu wissen, dass mein Körper gegen mich arbeitet. Und es macht mich traurig, dass es mir mein Leben nimmt. Und wenn es nicht aufhört dann werde ich gehen wollen.
Dann war ich mal wieder beim Recherchieren und stolperte über die Schädigung durch das Antibiotikum Ciprobay (Gift, Droge) von Bayer. Das ist eins von den Medikamenten, das ich im März wegen der anstehenden Gallen-OP bekommen habe. Und ich entdecke einige Gemeinsamkeiten. Vielleicht bin ich ein Schicksal der Pharmaindustrie. Hier die Geschichte von einem 30 jährigen Mann der dadurch sehr krank wurde: http://www.cbgnetwork.org/4888.html
In den USA wird in so genannten Black Boxen vor dem Medikament gewarnt. Vielleicht habe ich dadurch eine Toxische Vergiftung erlitten. Wer weiß das schon. Ich war noch weit weg vom Glauben, krank durch Medikamente zu sein.
20.10.13
Meine Zähne schmerzen und ich hab gesehen, dass das Zahnfleisch ganz schön zurück geht, ich war doch erst beim Zahnarzt, das hätte sie mir bestimmt gesagt. Inzwischen gehen mir auch vermehrt die Haare aus. Ich bekomme immer öfters im Fuß Krämpfe. Selbst meine Kopfhaut schmerzt. Meine Augen waren heute Morgen so angeschwollen, dass man die Wimpern oben gar nicht gesehen hat. Meine Haut an den Armen juckt. Meine Ohrspeicheldrüsen drücken.
An was werde ich wohl sterben müssen. An einem Herzinfarkt, Lungenentzündung, oder Vergiftung also Sepsis oder Hirnschlag oder Atemlähmung, weil meine Muskel sich auflösen. Und das wird dann auch so in meiner Sterbebescheinigung stehen und keiner wird genau erfahren, was der Grund wirklich war.
21.10.-24.10.
Ich fing schon vor Tagen an, Abschiedsbriefe zu schreiben und meinen Leuten nochmals alles hin zu legen, was ich über Ciprobay recherchiert habe. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss allen Beweisen von woher meine Symptome kommen. Ich schrieb auf, wen sie bei Todesfall benachrichtigen sollen. Meine Kommode war voller Dinge die ich vorbereitet hatte. Sogar für mein Grab, zwei Engel, die ich von einer ganz lieben Freundin zum Geburtstag bekam.
Ich getraute mich zu keinem Arzt mehr zu gehen, weil ja eh alle sagen, es ist alles in Ordnung. Kurz dachte ich, komm geh morgen noch mal zu Deiner Hausärztin und sag ihr das mit den Zähnen und Haaren. Aber was will sie denn tun?
Ich telefonierte mit einer guten Freundin und erzählte ihr die Geschichte mit meinen Zähnen und sie meinte, sie hatte das vor Jahren auch einmal, mit dem Zahnfleischrückgang und ihr Zahnarzt meinte nur, ob sie Antibiotika genommen hätte, er meinte auch ihr wären die ganzen Zähnen ausgegangen. Wohl einer der mehr weiß wie andere.
Ich recherchierte immer mehr im Internet und stieß auf unzählige Berichte von Ciprogeschädigte. Ich lass sogar einen Bericht, wo stand, dass die Nebenwirkungen von Cipro die einer Lyme-Borreliose oder sogar MS ähnlich sind. Bingo, meine Vermutung hat sich bestätigt. Bis zu diesem Zeitpunkt ging ich jeden Tag ins Geschäft. Ich arbeitete als Familienpfleger und habe oft mit Kindern zu tun. Manchmal habe ich gebetet: „Lieber Gott, lass nichts passieren, wenn ich mit einem Kind alleine unterwegs bin“. In der Zeit war ich oft in der Kirche. Auch zu diesem Zeitpunkt hat sich mein Körper noch sehr oft verkrampft.
3. auf 4. 11.2013
Ich lag auf der Couch und wollte schlafen, mein Bauch fing wieder an zu rumoren und auf einmal spürte ich meinen Körper auf der Couch nicht mehr und mein Bauch hörte schlagartig auf zu rumoren. Ich bekam Panik und wusste, jetzt langt es und ich nehme mir das Leben.
Ich habe mir fünfmal mit einem Tapeziermesser in den Arm geschnitten mit einer Ernsthaftigkeit und einer Aggressivität, die ich von mir nicht kenne. Ich habe soweit geschnitten, dass man das Gewebe sehen konnte. Ich habe mich in die Badewanne gelegt ins heiße Wasser. Ich werde Euch verschonen von den Stunden meiner Selbsttötung. Sieben Stunden habe ich versucht, mir das Leben zu nehmen. Nach einer Horrornacht zwischen Leben und Tod hatte ich irgendwann keine Kraft und keinen Mut mehr und rief den Krankenwagen.
Es war die Hauptsehne bis 90% durch, eine Ader fast durch, eine weitere Sehne 40% durch. Wenn Sie mich als Mensch kennen würden, wäre ein so sensibler Mensch wie ich, der nicht einmal beim Blutabnehmen die Spritze sehen kann, oder keine Filme sehen kann, mit Blut, nie in der Lage sich so zu verletzten. Ich wusste, irgendwas hat mich verändert, aber ich wusste noch nicht so genau, was. Denn ich war mir bis dahin noch nicht bewusst, dass ein Medikament solches auslösen kann/könnte.
Aber ich wusste, das bin nicht ich. Und die Schnitte taten nicht mal weh, soweit ist mein Nervensystem wohl schon angegriffen. Auch nach der OP brauchte ich keine Schmerzmittel. Als ich den Ärzten sagte, dass das mit dem Antibiotika zusammen hängt, sagte sie nur, das ist schon lange aus dem Körper. Als ich vor der OP stand, dachte ich nur, lieber Gott, lass mich nach der OP nicht mehr aufwachen. Sie mussten mich an zwanzig verschiedenen Stellen stechen, um Blut zu nehmen, sie fanden keine Adern mehr. Sie stachen mir sogar in die Halsschlagader. Ich habe es nicht mitbekommen, sah aber am nächsten Tag sämtliche Einstiche.
Leider wachte ich wieder auf. Und dann ging der Kampf erst richtig los. Die Vorwürfe meiner Mitmenschen. Ich vergaß, morgens nach der OP stellten sie mir Antibiotika auf den Tisch, ich verweigerte. Der Arzt meinte dann nur, ihm egal. Dann merkte er wohl, was er sagte und korrigierte, das macht nichts, wenn sie das für einen Tag nicht nehmen. Nach der OP ging ich freiwillig in eine Psychiatrie, weil auch meine Freunde meinten, das sei das Beste. Dann fängst du von einfach neu an. Das zeigte mir, dass eigentlich keinem bewusst ist, was ich durch mache. Schmerzen gehen weg, wenn man in die Psychiatrie geht?? Mir war klar, dass auch sie dachten, es ist ein psychisches Problem. Mir war auch klar, dass die Psychiatrie mir nicht helfen kann. Da ich aber einen Gips für drei Wochen hatte und lernen musste mit den Schnittverletzungen klar zu kommen, dachte ich, wäre das für mich das Beste.
Sie wollten mich mit Psychopharmaka voll stopfen. Ich verweigerte. Selbst Tavor wollten sie mir geben, ein Mittel, wo man danach einen Entzug machen muss.
Ich saß vor den Ärzten und erzählte Ihnen von meiner Vermutung wegen dem Antibiotika. Ich fragte sie, was sie denken, was ein sensibler Mensch wie ich es bin, der mitten im Leben steht und glücklich ist, solche spontane Selbstmordgedanken hat, die auf so grausame Weise geschehen sind. Antwort, das Antibiotikum ist schon lange aus ihrem Körper. Nehmen sie Psychopharmaka dann werden ihre Schmerzen besser. Ich sagte dem Chefarzt, dass ich weiß was eine Depression ist, ich nehme lieber die Depression, als das was ich jetzt habe.
(Auch über Psychatrieerfahrung könnte ich ein eigenes Buch verfassen)
In der Psychiatrie sprach ich mit einer Mitpatientin über meine Symptome, dann sagte sie mir, ihre Freundin hat solche Symptome auch. Sie kann manchmal nicht auf dem Po sitzen, hat Muskelschwund, hat den trockenen Mund, hat Herzrasen und Luftnot, hat die Ausschläge wie ich sie habe, hat Sehstörungen und so weiter. Schon sehr seltsam, man wird in die Psychoschiene geschoben und man trifft Menschen die die gleichen Symptome haben. Ob sie auch Chinolone genommen hat?
Am letzten Tag, sagte ich noch zu der Ärztin: „ Ich würde mir wünschen, das Ärzte wieder lernen, einen Menschen ganzheitlich zu betrachten“.
Als ich mich nach 5 Wochen dort selbst entlassen habe und Zuhause weiter recherchierte, stieß ich auf einen Bericht in der Ärztekammer:
Ich habe aus dem Text einige Passagen gekürzt und die mir als wichtig erscheinende Sätze drinnen gelassen.
Mitteilungen: „Aus der UAW-Datenbank“ Suizidalität unter der Behandlung mit 5-Fluorchinolon-Antibiotika
Dtsch Arztebl 2004; 101(22): A-1618 / B-1346 / C-1298
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft
„Aus der UAW-Datenbank“
Suizidalität unter der Behandlung mit 5-Fluorchinolon-Antibiotika
Medikamente können Depressionen und Suizidalität erzeugen. Zu derartigen Substanzen gehören zum Beispiel Interferone, Mefloquin, möglicherweise SSRI und sicher Fluorchinolone.
Im Vordergrund der Meldungen stehen neben Störungen des Verdauungstraktes (35,5 Prozent) und des Muskel- und Skelettsystems (17,9 Prozent) psychiatrische Störungen (30,6 Prozent). Unter den Letzteren wird der Suizidversuch mit 0,5 Prozent relativ zur Gesamtzahl der Berichte angegeben. Dies findet auch Ausdruck in verschiedenen Fachinformationen, zum Beispiel zu Ciprofloxacin-ratiopharm, in der „psychotische Reaktionen (bis hin zur Selbstgefährdung)“ genannt werden.
In der Fachinformation zu Ofloxacin (Tarivid®) ist unter der Rubrik „Nebenwirkungen“ aufgeführt, dass psychotische Reaktionen bis hin zu Selbstgefährdung auftreten können.
=> Ein Patient wurde in den letzten Jahren mehrfach mit Ciprofloxacin beziehungsweise Moxifloxacin behandelt. Er hatte die Medikation bislang problemlos vertragen. Während der erneuten Ciprofloxacin-Einnahme trat bei ihm eine depressive Verstimmung auf. Er erhielt dreimal täglich 250 mg Ciprofloxacin oral wegen einer schweren akuten Prostatitis für insgesamt acht Tage. Sechs Tage nach Absetzen der Medikation wachte der Patient nachts plötzlich auf mit dem fast imperativen Drang, sich umzubringen, und zwar durch Erhängen. Er wurde bereits stranguliert von der Ehefrau in letzter Sekunde gerettet. Ein eventuell vorangegangener Suizidversuch wurde verneint. Eine andere über 60-jährige Patientin berichtete nach Einnahme einer einzigen Tablette Ciprofloxacin (250 mg) über einen „heftigen Wunsch, sich umzubringen“, und sagte, „wenn sie etwas zur Selbstvergiftung dagehabt hätte, hätte sie es getan“. Die Patientin war selbst erschrocken über ihre „Lust auf Selbstmord“, wie sie es bezeichnete. Sie nahm Ciprofloxacin nicht weiter ein und fand erst drei Monate später den Mut, ihrem behandelnden Arzt über ihr Erlebnis zu berichten. Die Patientin hatte nie zuvor in ihrem Leben suizidale Gedanken gehabt; auch in der Familienanamnese gab es keine Suizide.
=> Eine 55-jährige Patientin, die mit Moxifloxacin behandelt wurde, klagte über aggressiv-depressive Stimmung mit Suizidideen und Albträumen. Eine weitere Patientin berichtete nach erstmaliger Einnahme von 400 mg Moxifloxacin über Suizidgedanken. Bei den hier dargestellten Fallbeschreibungen ist auffällig, dass Patienten betroffen sind, die nach Absetzen des Medikamentes überrascht und erstaunt waren über die Tatsache, dass sie Suizidgedanken hatten, ein Phänomen, welches ihnen bis zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt war.
Unter diesem Begriff wurden geäußerte Todeswünsche, Suizidideen, Suizidabsichten sowie suizidale Handlungen (Suizidversuche, Suizide) zusammengefasst. Wir halten es für möglich, dass es eine hohe Dunkelziffer an erfolgreichen Suiziden gibt. www.akdae.de
Ich hatte nie in meinem Leben Gedanken, mich umzubringen.
Meine Backen tun mir teilweise höllisch weh. Auch ein zweiter Besuch beim HNO-Arzt konnte nichts Bedenkliches feststellen. Bisschen erkältet meint er.
Er machte einen Abstrich, Bakterien und Pilze. Negativ
In der Psychiatrie wurden MRT vom Kopf gemacht und es wurde deutliche marginale Schleimhautschwellung links festgestellt, rechts Schwellung in der Keilbeinhöhle, links mit Sekretbildung und Sinusitis maxillaris links. Mit unter wurde beim EEG des Kopfes festgestellt, unregelmäßiges Alpha EEG (dazu wurde geschrieben, letztendlich wahrscheinlich Medikamenten-induziert (Aha, welche Medikamente???), Nachweis unspezifischer paroxysmaler Kriterien, passager leichte Vigilanzschwankung. Ach ne, so was aber auch.
Meine Leberwerte waren auf 222, meine Thrombozyten waren auf fast 800 und die Ärzte meinten alles nicht bedenklich.
Ich fand eine Plattform sanego.de. Da konnte man Medikamentennebenwirkungen bekannt geben. Was geschah ist unfassbar. Sie haben eigenständig meine Beiträge manipuliert und bei, Patient hat geschrieben: Nebenwirkungen behoben.
Und wenn ich Angst habe, verstärken sich die ganzen Symptome.. Manchmal bin ich dankbar, dass ich überhaupt noch laufen oder mich bewegen kann. Obwohl ich schon zweimal für einige Sekunden meine linke Hand nicht bewegen konnte. Auch habe ich inzwischen Nervenzuckungen am ganzen Körper. Mal am Oberarm, mal an der Pobacke, mal an den Waden usw. Wenn ich spazieren gehe, merke ich die Sehnen und Bänder.
So stehe ich mit meinem Problem alleine da und mir geht es täglich nicht gut, ich habe das Gefühl wie wenn mich körperlich irgendwas zerstört. Ich danke Bayer. Das schlimme ist, dass mein Umfeld mit meinem Leiden nicht umgehen kann. Sie denken, sag mal Du hast ja alles. Du liest im Internet zuviel und dann hast du die Symptome. Nein, ich hatte die Symptome und dann habe ich gelesen und gefunden. Du steigerst Dich zu arg rein und Jammern würde ich auch.
Mitunter fand ich dann einen Reportbericht von Geschädigten, von 256 Seiten, auf Englisch und nun wusste ich, Bingo ich hatte recht. Ich fand alle Symptome wieder. Aber es macht mir auch Angst, es stehen zwar viele hilfreiche Tipps drinnen, aber eine Garantie zur Heilung gibt es nicht. Aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Mein Leben war ein glückliches Leben vor der Einnahme. Und es scheint alles außer Kontrolle zu geraten. Ich meide es, meinen Arm anzuschauen. Der ganze Unterarm ist zerschnitten. Manchmal pflege ich ihn mit Olivenöl und ich habe keinen Zugang zu meinem Arm, wie wenn es ein Teil wäre, der nicht zu mir gehört.
Ich bin für jeden Tag dankbar, wo ich laufen kann. Manchmal bin ich einfach nur in einem Tunnel meiner selbst, gefangen. Es fällt mir schwer, mich für das alltägliche zu begeistern. Und ich frage Gott oft, was willst du mir damit sagen, was ist meine Aufgabe, dass du mich hast nicht gehen lassen? Das erinnert mich an Jesus, er litt alleine für die Menschheit und musste dann sterben. Schade, meine ganzen spirituellen Weisheiten und Gefühle, sind mir derzeit verloren gegangen. Mitunter macht das Antibiotika das Gaba-System durcheinander. Oder es verändert die Hormone. Es kann Organe, Nerven, Muskeln, Bänder und Sehnen angreifen.
Auch eine wichtige Seite die ich gefunden habe.
http:www.fluorchinolone.org/mehr-Informationen/mehr-informationen.html
http:www.schmidtlaw.com/antibiotic-nerve-damage-lawsuit/
Inzwischen ist Januar, fast ein Jahr vergangen. Was habe ich gelernt?
Die Tage habe ich mir viel Gedanken gemacht und festgestellt, das hilft alles nichts, weiter in meinem Tunnel zu verharren. Ich suchte nach Möglichkeiten, meinen Körper nicht mehr dem Stress des Gefangenseins auszuliefern und suchte nach Hilfen. Ich lebe ja, also muss es weiter gehen. Ich wurde fündig.
http:www.survivingcipro.com/
http:ciprohilfe.wordpress.com/
Nun versuche ich mein Leben wieder zu finden. Mich aus dem teuflischen Tunnel zu befreien. Sofern die Schäden wieder gut zu machen sind. Meinen spirituellen Weg wieder einzuschlagen und ganz wichtig, zu dem zu stehen, was meine Meinung ist. Ich lernte, es könnte jeder Tag dein letzter sein, versuche ihn zu nutzen. Ich werde das Rauchen, meinem Körper zu liebe, wieder aufgeben. Mich mit Naturprodukten auseinander setzen und der Schulmedizin zum größten Teil aus dem Wege gehen und nur noch mit Vorsicht betrachten.
Ich bin auch sehr stolz auf mich. Denn ich war vor meiner spirituellen und geistigen Entwicklung ein Mensch, der sich von anderen Menschen sehr beeinflussen hat lassen. Das erste Mal im Leben, stand ich zu meinem Körper, meinen Symptomen und zu mir selbst. Obwohl ich zugeben muss, sehr verzweifelt gewesen zu sein und oft dachte, ich kippe mit meinen Gedanken. Viele denken, im Internet steht viel Mist, aber inzwischen glaube ich, dass im Internet mehr Wahrheit steht, als man denkt. Denn ganz ehrlich, wer macht sich die Mühe, wenn er gesund ist, so einen Bericht wie ich zu verfassen. Im Internet stehen oft Dinge, die in den Medien bewusst verheimlicht werden. Ärzte behaupten ja auch, Impfschäden gibt es nicht.
Mein Leitsatz für 2014: Man braucht Mutige um die Wahrheit auszusprechen!!!! (Ghandi)
Ich werde weiterhin zu Ärzten gehen, meine Vermutung sagen und definitiv äußern: Dass es seine Meinung ist, dass es nicht von dem Medikament kommt, meine ist eine andere. Wir haben die Möglichkeit zusammen zu arbeiten und die Schäden die das Medikament verursachen kann/verursacht hat, zu untersuchen (Nieren- und/oder Leberschäden, Hormone, Nerven). Wenn er damit nicht zu Recht kommt, suche ich mir einen anderen Arzt. Ich lasse mich nicht mehr in die Knie zwingen, für die Unwissenheit, mancher Ärzte. Ich KÄMPFE!!!!! Es gibt Tage, da geht es mir besser und Tage, da geht es mir nicht so gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich habe gelernt eigenverantwortlich meinen Körper gegenüber zu sein und ich werde das nächste Mal, wenn mir ein Arzt ein Medikament verschreiben will, mit mehreren Augen darüber schauen und mein Bauchgefühl einschalten. Und der Pharmaindustrie werde ich so gut es geht, den Rücken weisen.
Ich danke all den Menschen, die mir in der schweren Zeit vertrauten und mit Ihrem offenen Ohr, meine Geschichte nie angezweifelt haben. Es waren wenige Menschen, aber es gab sie. DANKE!!!!
Kontakt: bittere.pillen@gmx.de