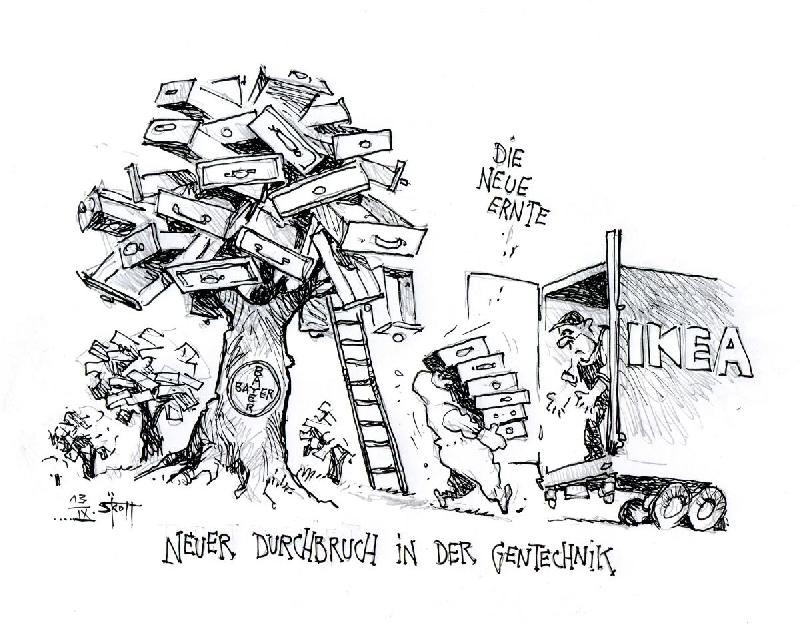
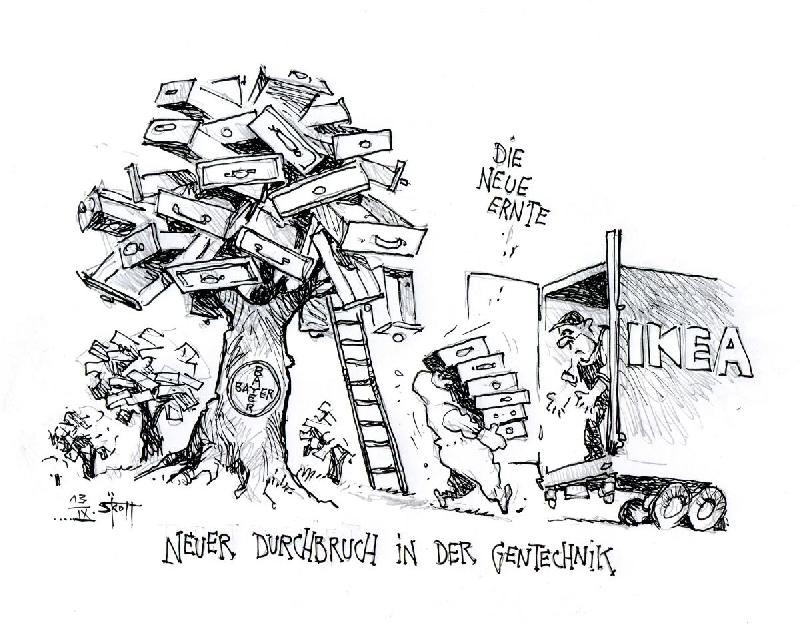
AKTION & KRITIK
XARELTO in der Kritik
Bereits seit längerem weist die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) auf die Risiken und Nebenwirkungen von BAYERs neuem Gerinnungshemmer XARELTO hin, den der Leverkusener Multi mit enormem Werbeaufwand in den Markt drückt. So verzeichnete das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) im Jahr 2012 58 Meldungen über Todesfälle und 750 über schwere Nebenwirkungen wie Blutungen. Im September 2013 griff der Spiegel die Kampagne auf und löste damit ein großes Medien-Echo aus. „BAYER in der Kritik“ und „Nebenwirkungen bei BAYERs Hoffnungsträger“ lauteten etwa die Schlagzeilen. Das BfArM, das bis Ende August 2013 bereits 72 Meldungen über Todesfälle und 968 über schwere Nebenwirkungen vorliegen hatte, versuchte trotzdem, das Gefährdungspotenzial kleinzureden. „Wir sehen keine neuen Gefahren und keinen Anlass für eine neue Risiko-Bewertung“, verlautete aus der Behörde. Sie suchte die Schuld für die vielen unerwünschten Arznei-Effekte vielmehr bei den MedizinerInnen: „Erfahrungen seit Markteinführung deuten darauf hin, dass nicht alle verordnenden Ärzte die Fachinformation hinsichtlich des Managements von Blutungsrisiken gut genug kennen“, hielt das Bundesinstitut fest. Und der Leverkusener Multi sagte das, was er immer sagt, wenn er auf Hauptversammlungen oder anderswo mit Gesundheitsschäden konfrontiert ist, die seine Medikamente verursacht haben: „Am positiven Nutzen/Risiko-Profil hat sich nichts geändert“. Geändert hat sich allerdings jetzt das Markt-Umfeld für XARELTO. Kliniken und MedizinerInnen beginnen, den Versprechungen von BAYERs Pharma-DrückerInnen zu misstrauen und verschreiben das Mittel nicht mehr ganz so exzessiv. Allzu große Einnahme-Verluste oder gar ein Verbot der Arznei hat der Global Player jedoch nicht zu befürchten.
USA: Kritik an GAUCHO & Co. wächst
Im Frühjahr 2013 hatte die von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) mitinitiierte Kampagne für das Verbot der bienengefährlichen BAYER-Pestizide GAUCHO und PONCHO endlich Erfolg: Die EU verkündete einen zunächst auf zwei Jahre befristeten Bann für die wichtigsten Anwendungsbereiche. Und jetzt wird die Luft für die beiden zur Gruppe der Neonicotinoide gehörenden Ackergifte auch in den USA dünner. In einem Offenen Brief forderten die großen Umweltverbände des Landes Präsident Barack Obama auf, das Ausbringen der Substanzen zu untersagen. Dabei stützten die Organisationen sich unter anderem auf eine Untersuchung des niederländischen Toxikologen Dr. Henk Tennekes, welche die CBG erstmals veröffentlicht hatte. Darüber hinaus führte die „Washington European Society“ eine Veranstaltung zu dem Thema durch, für welche die Coordination ebenfalls Input geliefert hatte.
BAYER: Kein Problem mit Importkohle
Der Leverkusener Multi setzt zur Energie-Gewinnung immer mehr billige Import-Kohle ein (SWB 3/13). Doch der Preis ist hoch, denn der Abbau findet unter katastrophalen Bedingungen statt und hat verheerende soziale und ökologische Folgen. So vertreiben die Minen-Besitzer in Kolumbien, woher BAYER jährlich ca. 40.000 Tonnen bezieht, die indigene Bevölkerung von ihrem Land, um die Reservoirs erschließen zu können. Die Förderung selber verschleißt dann durch das Abpumpen, das Waschen des „schwarzen Goldes“ und die Bindung des Staubes enorme Mengen reinen Wassers und verunreinigt im Gegenzug die Flüsse und das Grundwasser mit Sulfat, Schwefelsäure, Schwermetallen und Selen. Eine zusätzliche Belastung stellen die trotz des massiven Wasser-Einsatzes freigesetzten Kohle-Partikel dar, die sich wie ein Schleier über die Abbau-Region legen und die Atemorgane der Menschen angreifen. Darüber hinaus beschäftigen die Firmen ihre Angestellten zu den prekärsten Bedingungen und setzen Beschäftigten-VertreterInnen unter Druck. Sie gaben sogar schon Morde an GewerkschaftlerInnen in Auftrag. Aus all diesen Gründen hat die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) eine Kampagne gestartet. Das BUSINESS AND HUMAN RIGHTS CENTRE hat diese aufgegriffen und das Unternehmen mit kritischen Fragen zu dem Komplex konfrontiert. Dieses beschwichtigte umgehend: „Unser Kohlehändler hat uns versichert, dass er nur mit solchen Partnern in Geschäftsverbindungen tritt, welche die Tests bestanden haben“. Viel mehr Worte fand der Global Player in seiner Antwort allerdings zur CBG. Der Konzern warnte das Centre in bösen Worten vor der Coordination. Besonderen Anstoß nahm der Pharma-Riese an der Absicht des Netzwerkes, BAYER unter soziale Kontrolle stellen zu wollen.
Konzerne aus den Schulen!
BAYER & Co. nehmen zunehmend Einfluss auf die Schulen. Sie stellen Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, prämieren Bildungseinrichtungen mit einem besonders konzern-kompatiblen Lehr-Angebot und halten Weiterbildungsangebote für LehrerInnen bereit. Darum hat die Initiative LOBBYCONTROL eine Kampagne gegen die pädagogischen Umtriebe der Unternehmen gestartet. In ihrer Broschüre „Lobbyarbeit an Schulen“ kritisiert die Organisation in diesem Zusammenhang auch die von BAYER unterhaltenen SchülerInnen-Labore, da sie mit „inhaltlicher Einflussnahme“ einhergehen und beispielsweise die Gentechnik propagieren.
Konzerne aus den Unis!
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) führt seit einiger Zeit einen Prozess, um Einzelheiten über den geheimen Pharma-Kooperationsvertrag zu erfahren, den BAYER mit der Kölner Universität geschlossen hat. Die Coordination fürchtet nämlich eine Ausrichtung der Arznei-Forschung auf Profit, eine Entwicklung von Präparaten ohne therapeutischen Mehrwert, eine Verheimlichung negativer Studienergebnisse und einen Zugriff des Konzerns auf geistiges Eigentum der Hochschul-WissenschaftlerInnen. Diese Sorge treibt auch andere um. So haben schweizer WissenschaftlerInnen die Zusammenarbeit der Universität Zürich mit dem Geldhaus UBS zum Anlass genommen, den Zürcher Appell zur initiieren. „Als Staatsbürger, Forscherinnen, Wissenschaftler und Studierende appellieren wir an die Leitung der Universitäten und an alle Bildungsverantwortlichen im In- und Ausland, dem kostbaren und von der Verfassung geschützten Gut der akademischen Freiheit und Unabhängigkeit Sorge zu tragen und das wissenschaftliche Ethos nicht mit problematischen Kooperationen zu gefährden“, heißt es in dem Aufruf.
Piraten wollen Transparenz
Die nordrhein-westfälische Landtagsfraktion der Piraten-Partei hat – in Zusammenarbeit mit der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) – nicht nur zwei Anfragen zur umstrittenen Kooperation BAYERs mit der Kölner Hochschule (s. o.) gestellt, der Kasus fand vermittelt auch Eingang in ihren Gesetzentwurf zu Transparenz und Informationsfreiheit. So heißt es in dem Schriftstück: „Der Veröffentlichungspflicht unterliegen zwischen Hochschulen des Landes und Dritten geschlossene Verträge, insbesondere Kooperations- und Drittmittel-Verträge, hinsichtlich der Vertragspartner, der Vertragslaufzeit und des Finanzvolumens.“
Menschenrechtsverstöße ahnden!
Der Leverkusener Multi hat in seiner Geschichte vielfach gegen Menschenrechte verstoßen. Er benutzte Menschen aus der „Dritten Welt“ ohne deren Wissen als Versuchskaninchen für neue Pharma-Produkte, übte Druck auf GewerkschaftlerInnen aus und bediente sich der Kinderarbeit. Um solche Rechtsverstöße der Global Player besser ahnden zu können, hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen vor einiger Zeit „Guiding Principles on Business and Human Rights“ verabschiedet. Diese Leitlinien sehen auch die Einrichtung von Klage-Möglichkeiten in den Ländern vor, in denen die Konzerne ihre Stammsitze haben. Die EU hat ihre Mitgliedsstaaten daraufhin angehalten, eigene Aktionspläne zu erstellen. Während Nationen wie die Niederlande schon ihre Gesetze geändert und Beschwerdestellen eingerichtet haben, tat die Bundesrepublik bisher nichts dergleichen. Deshalb haben die Grünen den Antrag „Transnationale Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft ziehen“ in den Bundestag eingebracht, in dem die Partei die Bundesregierung auffordert, ihren internationalen Verpflichtungen nachzukommen und einen rechtlichen Rahmen zur Ahndung von Menschenrechtsverletzungen durch die Multis zu schaffen.
Studentenwerk hält zu Duisberg
Am 29. September 2011 jährte sich der Geburtstag des langjährigen BAYER-Generaldirektors Carl Duisberg zum 150. Mal. Da zahlreiche mediale Ständchen für den Mann drohten, der im 1. Weltkrieg verantwortlich für den Einsatz von Giftgas und die Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen war und später einen maßgeblichen Anteil an der Gründung des Mörderkonzerns IG FARBEN hatte, rief die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) eine Kampagne ins Leben. Sie forderte anlässlich des Jahrestags die Umbenennung von Straßen und Schulen, die Duisbergs Namen tragen, sowie den Entzug der Leverkusener Ehrenbürgerschaft (siehe SWB 1/12). Davon inspiriert, appellierte eine Marburgerin an das dortige Studentenwerk, eine andere Bezeichnung für das StudentInnen-Wohnheim „Dr. Carl-Duisberg-Haus“ zu finden. Die Einrichtung entschied sich zwar dagegen, brachte aber zumindest eine Gedenktafel mit Informationen zur umstrittenen Vita des Chemikers an und dankte der Frau für ihr Engagement. „Gern möchte ich Ihnen, auch im Namen des Verwaltungsrats, für den Anstoß zu einer sehr kritischen Diskussion um die Person Dr. Carl Duisberg danken“, hieß es in dem Schreiben.
KAPITAL & ARBEIT
BMS: BAYER streicht 700 Jobs
Bereits vor sechs Jahren hatte der Leverkusener Multi seiner Kunststoff-Sparte BAYER MATERIAL SCIENCE (BMS) Rationalisierungsmaßnahmen verordnet. Er verpflichtete den Plaste-Bereich auf ein Rendite-Ziel von 18 Prozent. Ein 300 Millionen Euro schweres Sparprogramm, das unter anderem die Vernichtung von 1.500 Arbeitsplätzen – ein Zehntel aller Stellen in diesem Bereich – umfasste, war die Folge. Nach Ausbruch der Finanz-Krise erhöhte der Vorstand die Vorgabe dann noch einmal um 50 Millionen Euro, was unter anderem das Schicksal der in Krefeld angesiedelten Forschungsabteilung besiegelte. Und jetzt sieht der Global Player wieder Handlungsbedarf, da der Gewinn im zweiten Quartal 2013 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 28,9 Prozent auf 143 Millionen Euro sank und die Rendite „nur“ noch 9,5 Prozent betrug. Neben den angeblich zu hohen Energie-Kosten macht BAYER-Chef Marijn Dekkers vor allem Überkapazitäten – vor denen die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) angesichts der vielen neuen Anlagen von BAYER & Co. vor allem in China bereits 2008 gewarnt hatte – für die sinkenden Erträge verantwortlich. „Deshalb müssen wir weiter Kosten sparen und noch effizienter werden“, meint BAYER-Chef Marijn Dekkers. Binnen der nächsten vier Jahre will der Konzern 700 Arbeitsplätze vernichten, 180 davon in der Bundesrepublik, obwohl die Aufwändungen für Personal nur 20 Prozent der Gesamtkosten von BAYER MATERIAL SCIENCE ausmachen. Und was der Holländer „kleine Anpassungen in den Strukturen“ nennt, bezeichnet der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Thomas de Win als „nicht nachvollziehbar und mehr als bedenklich“. Besonders kritisiert der Gewerkschaftler die Ankündigung, das in den Planungen schon weit vorangeschrittene Projekt eines neuen MDI-Werkes in Brunsbüttel vorerst auf Eis zu legen, das die CBG wegen des hohen Ressourcen-Verbrauchs und der massenhaften Verwendung von hochgiftigem Phosgen ablehnt. Zudem missbilligt er das Vorgehen des Vorstands, die Ausgaben für Forschung & Entwicklung an der Leistungskraft der einzelnen Sparten zu bemessen, weil das für BMS de facto eine Kürzung bedeutet. „Dies kann aus Sicht des Betriebsrates die Perspektive eines Unternehmens grundsätzlich in Frage stellen“, so de Win. BAYER-Chef Marijn Dekkers betont zwar immer wieder, die Kunststoff-Sparte nicht verkaufen zu wollen, aber die jüngsten Entwicklungen dürften die Diskussion noch einmal befeuern, zumal der Ober-BAYER auch vorher schon gegenüber Investoren stets die Leistungskraft der beiden anderen Konzern-Sparten herausgehoben hatte. So warb er mit den Worten für den Global Player, dass „ein erheblicher Teil unserer Finanz-Ergebnisse durch unsere zwei LifeScience-Geschäfte angetrieben“ werde. Finanz-AnalystInnen fordern schon seit Jahr und Tag von dem Unternehmen, sich von der Kunststoff-Fertigung zu trennen. Und die Börsen strafen die bisherige Weigerung des Pharma-Riesen, dem Folge zu leisten, regelmäßig mit einem Konglomeratsabschlag. Spätestens wenn die Pillen-Abteilung vor der Möglichkeit steht, sich mit einem attraktiven Zukauf zu verstärken, sehen BeobachterInnen das Schicksal der Plaste-Produktion als besiegelt an.
BAYER gliedert Arznei-Tests aus
Der Leverkusener Multi führt Medikamenten-Tests der Phasen I bis IIa in Zukunft nicht mehr selbst durch, sondern betraut die CRS CLINICAL RESEARCH SERVICES mit dieser Aufgabe. Der Pharma-Riese vernichtet durch diese Maßnahme 23 Arbeitsplätze innerhalb des Konzerns: Die Beschäftigten der BAYER-Studienzentren in Wuppertal und Berlin wechseln zu CRS. „Indem die gesamte Frühphasen-Entwicklung als Paket an einen einzigen Partner vergeben wird, versuchen die Arznei-Entwickler Entwicklungszeiten zu verkürzen und so Kosten zu optimieren“, erläutert CRS-Manager David Surjo die Motive. BAYER beschränkt sich künftig auf die Konzeption und Überwachung der klinischen Prüfungen. Die Qualität der Tests, um die es eh schon nicht allzu gut bestellt ist (siehe DRUGS & PILLS), dürfte damit weiter abnehmen, denn die Pharma-Dienstleister stehen unter dem Erfolgsdruck, möglichst viele Pillen ihrer Auftraggeber durch die Erprobungsphasen zu bringen. Da CRS & Co. manche Pillen-Studien der ersten Phasen bereits mit ProbandInnen durchführen, setzen diese sich so einem erhöhten Risiko aus, das später dann auch die PatientInnen tragen müssen.
Der Weg des Titandioxids
Der Leverkusener Multi trennte sich im Zuge der „Konzentration auf das Kerngeschäft peu à peu von seiner Titandioxid-Produktion. 1998 überführte er die Uerdinger Fabrik in ein gemeinsam mit KERR-MCGEE betriebenes Joint Venture. 2001 übernahm das US-amerikanische Unternehmen das Geschäft ganz. 2006 dann gliederte es selber den Bereich in eine eigenständige Gesellschaft aus, die 2009 Insolvenz anmelden musste. 2012 schließlich verkaufte der Insolvenzverwalter die inzwischen unter dem Namen CRENOX firmierende Fertigungsstätten an BAYERs einstmaligen Konkurrenten SACHTLEBEN. Und mit diesem zum US-Konzern ROCKWOOD gehörenden Betrieb dürften sie bald schon wieder den Besitzer wechseln, denn die Mutter-Gesellschaft will SACHTLEBEN abstoßen. Mit den Nachwirkungen der Titandioxid-Herstellung in Uerdingen haben die Behörden derweil noch immer ihre liebe Mühe. Sie arbeiten nämlich bereits seit vielen Jahren an der Sanierung der Deponie in Rheinberg, in der lange Zeit die Produktionsrückstände von BAYER und SACHTLEBEN gelandet waren (TICKER 2/11).
ERSTE & DRITTE WELT
BAYER zahlt keinen Mindestlohn
BAYERs Saatgut-Tochter NUNHEMS arbeitet in Indien mit Zuliefer-Betrieben zusammen, die ihren Beschäftigten teilweise nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn zahlen. Besonders Frauen zählen zu den Benachteiligten. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie „Wages of Inequality“ von Jacob Kalle und Dr. Davuluri Venketeswarlu, einem langjährigen Kooperationspartner der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN.
POLITIK & EINFLUSS
Dekkers kritisiert Energiewende
BAYER-Chef Marijn Dekkers begründete das Rationalisierungsprogramm (siehe KAPITAL & ARBEIT) für die Kunststoff-Sparte BAYER MATERIAL SCIENCE (BMS) auch mit Versäumnissen der Politik. „Sie muss mehr tun, um den Innovations- und Investitionsstandort Deutschland zu stärken“, sagte er. Besonders die hohen Energiekosten kritisierte der Holländer. „Deutschland hat mit der Energiewende einen radikalen Wandel eingeleitet. Die Folgen sind erhebliche Wettbewerbsnachteile für die energie-intensiven Industrien“, klagte Dekkers und rechnete vor: „Unser Teilkonzern BMS zahlt heute in Deutschland, hauptsächlich in NRW, doppelt so viel für Strom wie in Amerika.“
US-Lobbykosten: sechs Millionen
In den USA gibt keine Branche so viel Geld für Lobby-Aktivitäten aus wie die Pharma-Industrie. Von 1998 bis 2012 investierte diese 2,5 Milliarden Dollar in die Pflege der politischen Landschaft. Und immer vorne mit dabei: der BAYER-Konzern. Allein 2012 ließ er sich das Antichambrieren 5,8 Millionen Dollar kosten.
BAYERs Mann im US-Kongress
Der US-Kongress muss sich in nächster Zeit durch die halbe Angebotspalette von BAYERs Kunststoff-Geschäft arbeiten. 20 Anträge zur Gewährung bzw. Verlängerung von Zollbefreiungen für BAYOWET, BAYPURE, DISFLAMOLL, CRELAN, DESMODUR und andere Stoffe liegen ihm nämlich vor. Geschrieben hat sie alle der republikanische Politiker Tim Murphy. Andere Aktivitäten hat er hingegen kaum entfaltet. „Es scheint fast so, als ob Tim Murphy BAYER im US-Kongress repräsentiert“, hält die Website thatsmycongress.com deshalb fest. Allzu teuer kam den Global Player das nicht: Etwas über 14.000 Dollar an Wahlkampf-Hilfe investierte er in den Mann.
Üppige Parteispenden des VCI
Der Leverkusener Multi spendet in der Bundesrepublik nicht selber an politische Parteien, weil das den Eindruck direkt gekaufter Entscheidungen erwecken könnte. Er überlässt den Job lieber dem „Verband der Chemischen Industrie“ (VCI). Und der hat in der Endphase des Bundestagswahlkampfs 2013 noch einmal kräftig zugelangt. 100.000 Euro überwies er der CDU und 64.000 der FDP. Um den Eindruck der Parteilichkeit etwas zu verwischen, gingen auch SPD und Grüne nicht ganz leer aus. Die SozialdemokratInnen bekamen 50.000 Euro und Trittin & Co. 10.000 Euro.
Schramm leitet Agrar-Verband
Dr. Helmut Schramm, der Geschäftsführer von BAYER CROPSCIENCE, steht seit Mai 2013 dem Industrieverband Agrar (IVA) als Präsident vor.
Lemke neuer Umweltberater
Anfang Mai 2013 berief die Bundesregierung neue UmweltberaterInnen. Unter den Auserwählten befindet sich auch der Meeresforscher Peter Lemke vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut, dem der Leverkusener Multi 2010 den „BAYER Climate Award“ verliehen hatte.
RisikoforscherInnen mit Verbindungen
In der EU läuft zurzeit gerade ein Forschungsprojekt zu den Risiken und Nebenwirkungen der grünen Gentechnologie. Allzu bedenklich dürften die Ergebnisse jedoch nicht ausfallen, denn viele der beteiligten WissenschaftlerInnen haben enge Beziehungen zu konzern-nahen Biotech-Einrichtungen. So gehören einige von ihnen der „International Society for Biosafety Research“ (ISBR) an oder haben Verbindungen zum „International Life Sciences Institute“ (ILSI) – beides Organisationen, die Gelder von MONSANTO, BAYER, SYNGENTA oder anderen Agro-Multis erhalten.
Kraft bei BAYER in Berkeley
Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft besuchte das BAYER-Werk im US-amerikanischen Berkeley. Im Schlepptau hatte die Politikerin eine 28-köpfige Delegation, die aus VertreterInnen der Landesregierung, BeraterInnen und JournalistInnen bestand. Dem Leverkusener Multi zufolge interessierte sich die Sozialdemokratin vor allem für die Möglichkeiten, BAYER & Co. durch Bildungsprogramme und andere Fördermaßnahmen NaturwissenschaftlerInnen zuzuführen, während der Agro-Riese sich als politischer Wohltäter in Szene zu setzen versuchte, der die umliegenden „Gemeinden in Umwelt-, Bildungs- und sozialwirtschaftlichen Belangen unterstützt“.
Duin bei BAYER
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hatte sich gegen BAYERs Plan ausgesprochen, in Dormagen eine Anlage zur Produktion des Kunststoffes TDI zu errichten, weil diese nicht dem neuesten Stand der Technik entspricht. So ummantelt der Multi die Fertigungsstätte nur mit Blech statt mit Beton. Zudem verzichtet der Konzern auf den Einbau einer Schutzwand, die bei einer Explosion mit nachfolgendem Phosgen-Austritt neutralisierendes Ammoniak freisetzen könnte. Auch der hohe Ressourcen-Einsatz, das Fehlen von „Worst Case“-Szenarien sowie die Verwendung hochgefährlicher Zwischenprodukte wie Phosgen sprechen gegen das Projekt. Der CBG gelang es allerdings nicht, sich mit ihren Einwänden durchzusetzen. Die Bezirksregierung winkte das Vorhaben durch, und der Leverkusener Multi begann mit dem Bau. Ende Juli 2013 feierte er nun Richtfest und durfte dazu als Ehrengast den nordrhein-westfälischen Wirtschaftsminister Garrelt Duin begrüßen. „Mit der Investition in die TDI-Anlage hat sich BAYER bewusst entschieden, den Chemie-Standort Nordrhein-Westfalen zu stärken. Das zeigt, dass wir in unserem Land hoch attraktiv für eine erfolgreiche Industrie sind. Wir müssen daran arbeiten, dass das so bleibt“, hielt der SPD-Politiker in seiner Rede fest.
EU gegen Nutzen-Bewertungen
BAYER & Co. haben jede Menge Medikamente ohne ausreichende Wirksamkeitsnachweise in ihrer Produkt-Palette. Damit diese Pillen die Etats der Krankenkassen nicht mehr über Gebühr belasten, gibt es hierzulande seit 2011 eine unabhängige Kosten/Nutzen-Bewertung von Arzneien. Die Pharma-Riesen hatten sich mit aller Macht gegen eine solche Einrichtung gewehrt, konnten sich jedoch nicht durchsetzen. Jetzt allerdings kommt Unterstützung aus Brüssel. Die EU-Kommission legte nämlich einen Richtlinien-Entwurf vor, der solche Nachprüfungen von Pharmazeutika verbietet – und die LobbyistInnen der Konzerne dürften fleißig daran mitgeschrieben haben.
EU will Arznei-Tests erleichtern
Die Pillen-Riesen lagern immer mehr Arznei-Tests in ärmere Länder aus. Dort winken günstigere Preise, ein großes Reservoir an ProbandInnen und eine mangelhafte Aufsicht. Die Folge: Immer wieder kommt es zu Todesfällen. Allein in Indien starben 2011 20 Menschen bei Erprobungen von BAYER-Medikamenten. Die EU will diesen Outsourcing-Trend stoppen und die Pharma-Konzerne mit laxeren Vorschriften für Medikamenten-Prüfungen wieder in heimische Gefilde locken. So sah ein Verordnungsvorschlag vor, klinische Studien künftig ohne vorherige Begutachtung durch Ethik-Kommissionen stattfinden zu lassen. Nach massiven Protesten musste dieser Passus wie noch so manch anderer allerdings wieder aus dem Entwurf verschwinden. Aber es stehen noch genug heikle Punkte in dem Papier. Beispielsweise soll es in Ausnahmefällen möglich sein, Pillen-Erprobungen ohne informiertes Einverständnis der ProbandInnen durchzuführen. Auch die Auflagen zur Transparenz bleiben Stückwerk. Die vorläufige Fassung der Richtlinie schreibt zwar grundsätzlich die Veröffentlichung von Pharmazeutika-Studien vor, aber das Publizieren der sehr aussagekräftigen Rohdaten möchte sie den Unternehmen weiterhin ersparen. Das ist ganz im Sinne des Leverkusener Multis, der sich lediglich dafür ausspricht, der Öffentlichkeit die Test-Ergebnisse „auf geeignete Art und Weise“ zu präsentieren. Im Oktober 2013 befasst sich das EU-Parlament mit dem Paragrafen-Werk.
PROPAGANDA & MEDIEN
BAYER finanziert Bienen-Studie
Mit allen Mitteln versuchen BAYER, BASF und SYNGENTA, ihre Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide von dem Vorwurf zu entlasten, sie würden das Bienensterben befördern. Beispielsweise finanzierten sie im großen Stil Entlastungsstudien. In Österreich stiegen die Konzerne mit 115.000 Euro in eine schon laufende Untersuchung des österreichischen Umweltministeriums ein und schafften es so, ihr die kritische Ausrichtung zu nehmen. So wusste die Expertise auf einmal von „Bienenschäden, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht durch insektizide Beizmittel verursacht waren“. Und zu einem ähnlichen Resultat kam die ebenfalls von den Agro-Riesen gesponserte Studie „Bienengesundheit in Europa – Zahlen und Fakten 2013“ der italienischen Universität „Cattolica del Sacro Cuore“. Aber es nützte alles nichts: Ende April 2013 zog die EU GAUCHO und andere Agro-Chemikalien vorerst aus dem Verkehr (siehe Ticker 3/13).
Blühstreifen gegen Bienensterben?
Durch die Diskussion um die Risiken und Nebenwirkungen der industriellen Landwirtschaft im Allgemeinen und der bienentötenden Wirkung der BAYER-Pestizide GAUCHO und PONCHO im Besonderen sah sich der Leverkusener Multi zu Reaktionen gezwungen. In Tateinheit mit SYNGENTA legte er einen Aktionsplan vor, der unter anderem auch die Anlage von Ackerrand-Streifen mit pollen-reichen Blütenpflanzen umfasste. Hier sollten die Bienen Asyl finden, wenn GAUCHO & Co. die Äcker heimsuchten. Am Oberrhein bei Bühl, wo der Agro-Riese gemeinsam mit dem „Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz“ und dem „Institut für Agrar-Ökologie und Biodiversität“ einen Feldversuch gestartet hat, halten sich die Erfolge jedoch in Grenzen. Die Artenvielfalt ist durch die Naturreservate nicht gestiegen, lediglich bei den Unkräutern gibt es Zuwachs. Der für die Grünen im Bundestag sitzende Agrar-Experte Harald Ebner hält das Ganze nicht nur deshalb für ein „Herumdoktern an Symptomen“. Und das Urteil der ImkerInnen fällt noch harscher aus. „Auf der einen Seite vergiften sie Bienen, auf der anderen wollen sie sich für den Umweltschutz engagieren“, kritisiert etwa Dorle Raimann.
ASPIRIN-Sozialpreis verliehen
Seit einiger Zeit versucht der Leverkusener Multi, sich ein soziales Image zu verschaffen. Zu diesem Behufe hat er die Düsseldorfer PR-Agentur KETCHUM PLEON engagiert. Diese dachte sich für den Konzern dann unter anderem den ASPIRIN-Sozialpreis aus. In diesem Jahr erhielt die „Katholische Stiftung Marienheim Aachen-Brand die zweifelhafte Auszeichnung für ihr Projekt „Generationsbrücke Deutschland“.
Saalfrank neue Schirmherrin
BAYERs BEPANTHEN-Kinderförderung unterstützt seit längerem das Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“, das dem evangelikalen Verband „Deutsche Evangelische Allianz“ angehört, sowie Freizeitförderprogramme und Sozialforschungsprojekte. Und damit das SozialarbeiterInnen-Image, das sich der Konzern mit diesen milden Gaben schaffen will, eine größere Verbreitung findet, hat das Unternehmen jetzt die aus umstrittenen Privatfernseh-Formaten bekannte Pädagogin Katharina Saalfrank als Schirmherrin eingekauft.
Ballack neuer Schirmherr
BAYERs gemeinsam mit der „Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe“ initiierte Kampagne „Rote Karte dem Schlaganfall“ wirbt für Vorbeuge-Maßnahmen im Allgemeinen und für den umstrittenen Gerinnungshemmer XARELTO (siehe AKTION & KRITIK) im Besonderen. Einen Prominenten, welcher der PR-Aktion mediale Aufmerksamkeit verschaffen soll, hat der Leverkusener Multi auch verpflichten können: Der ehemalige Fußball-Profi Michael Ballack fungiert als Schirmherr.
BAYERs Pharma-VertreterInnen lügen
„Die Hersteller haben sich selbst strenge Regeln für die Kooperation mit Ärzten auferlegt“, stellt BAYER-Sprecher Herbert Schäfer fest. Und bei MedizinerInnen-Besuchen hielten sich die Pharma-ReferentInnen an das Arzneimittel-Gesetz als Richtschnur, so Schäfer. Die Praxis in den Praxen sieht allerdings anders aus. So überreichen Pillen-DrückerInnen des Leverkusener Multis DoktorInnen gerne Kästchen des Konzerns mit Erkältungstests, ASPIRIN sowie Antibiotika und verweisen dabei darauf, LungenfachärztInnen hätten die Sets bereits in ihre Behandlungsrichtlinien übernommen. Der Mediziner Michael Freitag prüfte das nach – und fand keinerlei Belege dafür.
„Tag der Offenen Tür“ in Gatersleben
„Der Biotechnologie-Park Gatersleben ist eine der modernsten Infrastruktur-Einrichtungen rund um die Pflanze“, heißt es in der Eigenwerbung. Das „Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzen-Forschung“ hat dort seinen Sitz, und natürlich darf auch BAYER nicht fehlen. Der Leverkusener Multi betreibt an dem Standort sein Weizenforschungszentrum. Und da all das Herumdoktern an den Ackerfrüchten nicht in dem besten Ruf steht, haben BAYER & Co. den 8. Juni 2013 zum „Tag der Offenen Tür“ erklärt, um ihre Labore und Gewächshäuser herzuzeigen und auf diese Weise zu versuchen, dem Akzeptanz-Problem entgegenzuwirken.
TIERE & ARZNEIEN
USA: 23.000 Bakterien-Tote
1.734 Tonnen Antibiotika landeten nach Angaben der Bundesregierung 2011 in den Tier-Ställen. Pharmazeutika aus der Gruppe der Fluorchinolone, zu denen BAYERs BAYTRIL zählt, waren mit acht Tonnen dabei. Der massenhafte Einsatz dieser Mittel in der Massenzucht fördert die massenhafte Entwicklung resistenter Erreger. In den menschlichen Organismus gelangt, können diese Krankheiten auslösen, gegen die Antibiotika dann nicht mehr wirken. Auch die zu sorglose Verschreibung von CIPROBAY und anderen Antibiotika in der Humanmedizin trägt zu dieser Gefährdungslage bei. Die US-amerikanische Regierung hat die Gesundheitsrisiken jetzt erstmals wissenschaftlich untersuchen lassen. Und die Zahlen des „Centers for Disease Control and Prevention“ sind erschreckend: Jedes Jahr sterben in den Vereinigten Staaten 23.000 Menschen an Infektionen, die Bakterien ausgelöst hatten, gegen die kein Kraut mehr gewachsen war.
DRUGS & PILLS
Zeugungsunfähig durch NEBIDO & Co.
Mit großer Anstrengung arbeitet der Leverkusener Multi daran, die „Männergesundheit“ als neues Geschäftsfeld zu etablieren und seinen Potenzpillen und Hormon-Präparaten neue und nur selten zweckdienliche Anwendungsmöglichkeiten zu erschließen. So hat der Pharma-Riese die Krankheit „Testosteron-Mangel“ erfunden und sie zu „männlichen Wechseljahresstörungen“ erhoben, um seine Hormon-Pillen an den Mann zu bringen. Und er hat viele Kranke dazu gefunden. Allein in den USA stiegen die Verordnungen seit 1993 um rund 500 Prozent. Allerdings hat das gerade für die Männlichkeit beträchtliche Folgen. Nach einer Studie einer ForscherInnen-Gruppe um Jared L. Moss von der Universität Knoxville beeinträchtigt das Einnehmen von Testosteron-Pillen die Zeugungsfähigkeit: 65 Prozent der Testosteron-Probanden produzierten nach einem halben Jahr keine Spermien mehr. Zudem beobachteten die WissenschaftlerInnen Schrumpfungen des Hodengewebes und Samenzellen-Missbildungen. Damit fügten sie der langen Liste von Risiken und Nebenwirkungen der Mittel wie Herzinfarkt, Prostata-Krebs, Harntrakt-Schädigungen, Brust-Wachstum, Bluthochdruck, Ödeme, Blutverdickung und Leberschäden einige weitere Einträge hinzu.
Schnellere Zulassung für Riociguat?
BAYER hat in den USA, Europa und Japan einen Zulassungsantrag für eine Arznei zur Behandlung von Lungenhochdruck gestellt. Die Vereinigten Staaten haben dem Medikament wegen angeblich vielversprechender Studien-Daten sogar schon ein schnelleres Genehmigungsverfahren zugebilligt. Der Wirkstoff Riociguat soll in der Lunge ein Enzym stimulieren, das für eine Erweiterung der Blutgefäße sorgt und so die Sauerstoff-Aufnahme verbessert. Der Leverkusener Multi erwartet von dem Mittel einen Umsatz von 500 Millionen Euro im Jahr.
OP-Risiko ASPIRIN
Mit zunehmendem Erfolg vermarktet BAYER ASPIRIN als Mittel zur Schlaganfall- und Herzinfarkt-Prophylaxe. Die massenhafte Verbreitung des „Tausendsassas“ stellt jedoch ein großes Risiko dar. Das Medikament wirkt nämlich blutverdünnend, was Blutungen befördern kann. Besonders bei medizinischen Eingriffen besteht diese Gefahr. Deshalb raten die „Deutsche Fachgesellschaft für Kardiologie“ und die „European Society of Cardiology“ ASPIRIN-PatientInnen, denen eine Operation bevorsteht, mit ihren ÄrztInnen zu besprechen, ob sie das Mittel zeitweilig absetzen sollten.
Kein ASPIRIN gegen Schlaganfälle
Die „Deutsche Fachgesellschaft für Kardiologie“ (DGK) rät davon ab, PatientInnen mit Vorhofflimmern zur Schlaganfall-Prophylaxe ASPIRIN zu verabreichen und empfiehlt stattdessen Medikamente aus der Gruppe der Vitamin-K-Antagonisten wie MARCUMAR. Diese wirken nach Ansicht der DGK nicht nur besser, sie haben auch weniger Nebenwirkungen als das BAYER-Mittel, das häufiger zu Blutungen führen kann. In ihren aktualisierten Leitlinien zur Behandlung von Menschen mit Vorhofflimmern spricht die Fachgesellschaft sich allerdings auch für BAYERs neuen Gerinnungshemmer XARELTO aus, obwohl die „Arzneimittel-Kommission der deutschen Ärzteschaft“ das Pharmazeutika nur als Ersatz-Medikation bei MARCUMAR-Unverträglichkeit ansieht (siehe auch AKTION & KRITIK).
Kein ASPIRIN gegen Thromboembolien
Auch zur Thromboembolie-Prophylaxe bei PatientInnen mit Vorhofflimmern kann die „Deutsche Fachgesellschaft für Kardiologie“ (DGK) BAYERs ASPIRIN mit dem Wirkstoff Acetylsalicylsäure nicht empfehlen. Unter „Abwägung des Blutungsrisikos“ sollte nach Meinung der DGK die Verabreichung von Vitamin-K-Antagonisten wie MARCUMAR oder anderen Gerinnungshemmern „einer Therapie mit Acetylsalicylsäure vorgezogen werden“.
MELIANE-Verkauf bricht ein
Frauen, welche die BAYER-Verhütungsmittel YASMIN, YAZ, MELIANE oder andere Kontrazeptiva der dritten oder vierten Generation einnehmen, tragen ein erhöhtes Risiko, Thromboembolien oder Schlaganfälle zu erleiden. In Frankreich erhob die Geschädigte Marion Larat deshalb Klage gegen den Leverkusener Multi, was große mediale Resonanz fand, wie ihre Eltern auf der letzten BAYER-Hauptversammlung berichten konnten. Die Krankenkassen reagierten prompt und erstatteten die Kosten für die Mittel nicht länger. Dies hatte umgehend Folgen: Die Verschreibungszahlen gingen um 38 Prozent zurück.
Spaniens Krankenkassen meutern
Nicht nur in Frankreich (s. o.), sondern auch in Spanien zahlen die Krankenkassen nicht mehr für die Verhütungsmittel der neuesten Generation. Sie listeten mehrere Mittel aus, darunter zwei BAYER-Produkte. Ausschlaggebend dafür waren allerdings nicht die im Vergleich zu älteren Mitteln erhöhten Thromboembolie-Risiken, die von diesen Kontrazeptiva ausgehen – die drastischen Preise der Pillen führten zu der Entscheidung.
Mehr Konkurrenz für LEVITRA
Im Juni 2013 hat VIAGRA seinen Patentschutz verloren. Der Hersteller PFIZER selber und andere Konzerne bringen deshalb Nachahmer-Präparate des Mittels gegen „erektile Dysfunktion“ zu deutlich niedrigeren Preisen heraus. Das dürfte sich negativ auf das Geschäft des Leverkusener Multis mit seinem Potenz-Präparat LEVITRA auswirken – und so manchen Mann vor dessen Nebenwirkungen wie temporärer Gedächtnisverlust, zeitweilige oder dauerhafte Hörschäden, Sehstörungen bis zum Sehverlust, Schwindel, Höhenangst, Kopfschmerzen, Nasenschleimhaut-Entzündungen, Grippe-Symptome und Gesichtsrötungen bewahren.
NEXAVAR bei Schilddrüsenkrebs?
BAYERs Krebs-Medikament NEXAVAR hat bisher Zulassungen für die Behandlung bestimmter Formen von Nieren- und Leberkrebs erhalten. Dafür genügte es, in den entsprechenden Tests den Nachweis zu erbringen, das Tumor-Wachstum um zwei bis drei Monate hinauszögern zu können. Als Medikament zum Einsatz bei Lungen-, Haut-, Brust- und Bauchspeicheldrüsenkrebs scheiterte das Präparat dagegen in den klinischen Prüfungen. Trotzdem versucht BAYER weiterhin mit allen Mitteln, das Anwendungsspektrum der Arznei zu erweitern. So strebt der Konzern im Moment eine Genehmigung für die Indikation „Schilddrüsenkrebs“ an. Er verweist dabei auf Studien-Daten, wonach es der Arznei mit dem Wirkstoff Sorafenib angeblich gelang, die Progression von Krebs-Geschwülsten fünf Monate lang aufzuhalten, was die Behörden dazu bewog, das Prüfverfahren zu beschleunigen. Trotz der bescheidenen Therapie-Erfolge verlangt BAYER für das Krebsmittel eine immense Summe. So kostet NEXAVAR die Krankenkassen 4.200 Euro im Monat. Entsprechend hoch ist der Umsatz des Leverkusener Multis mit dem Mittel, 2012 betrug er 792 Millionen Euro.
Noch mehr STIVARGA-Zulassungen
Der Leverkusener Multi kann in Japan das Anwendungsspektrum seines Krebsmedikamentes STIVARGA erweitern. Bisher für die Behandlung von PatientInnen mit fortgeschrittenem Darmkrebs zugelassen, dürfen MedizinerInnen es jetzt auch bei Magenkrebs und anderen Verdauungstrakt-Tumoren verschreiben. Zurzeit testet BAYER das Präparat mit dem Wirkstoff Regorafenib – eine Weiterentwicklung des NEXAVAR-Stoffes Sorafenib – außerdem noch als Medikament zur Therapie von fortgeschrittenem Leberkrebs. Ein Wundermittel hat der Pharma-Riese mit STIVARGA aber nicht entwickelt. So steigerte die Substanz bei den klinischen Prüfungen die Gesamtüberlebenszeit von Darmkrebs-Kranken gerade einmal um 1,4 Monate und schenkte ihnen bloß eine um 0,2 Monate längere Zeit ohne weiteres Tumor-Wachstum.
MS-Zulassung für Alemtuzumab
Das von BAYER und GENZYME gemeinsam entwickelte Gentech-Medikament LEMTRADA (Wirkstoff: Alemtuzumab) hat eine Genehmigung zur Behandlung einer seltenen Leukämie-Art. Diese PatientInnen stehen jetzt allerdings auf dem Schlauch. Der Leverkusener Multi und die GENZYME-Muttergesellschaft SANOFI haben für das Mittel nämlich eine Zulassung zur Therapie von Multipler Sklerose erhalten und bieten es deshalb für Leukämie-Kranke nicht mehr an. Hintergrund des zunächst unverständlich wirkenden Schachzugs: Nur wenige hundert PatientInnen in Deutschland benötigten das Leukämie-Präparat, die Einnahmen waren dadurch begrenzt. Der Markt für MS-Medikamente hingegen ist weitaus interessanter – allein in Deutschland gibt es rund 130.000 Betroffene, weltweit sind es 2,5 Millionen. Zudem haben die beiden Unternehmen die Möglichkeit, für die Indikation „MS“ einen höheren Arznei-Preis zu berechnen. Aber da ein Wirkstoff für unterschiedliche Anwendungen nicht unterschiedliche Preise haben darf, standen die Konzerne vor einem Problem, denn zu dem früheren Preis versprach die MS-Therapie mit Alemtuzumab keine großen Umsätze. Orientierte sich der Preis hingegen an den üblichen Behandlungskosten von MS, würde er sich für Leukämie-PatientInnen extrem erhöhen, was zwangsläufig KritikerInnen auf den Plan riefe. Und um diesem Dilemma zu entgehen, gaben SANOFI und BAYER das wenig lukrative Anwendungsgebiet „Leukämie“ lieber ganz auf. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN kritisierte dieses Vorgehen scharf. „Wieder einmal wird deutlich, dass für BAYER, SANOFI & Co. allein der Profit zählt. Das PatientInnenwohl ist dabei nachrangig. Nebenbei zeigt sich, dass die Preisbildung von Medikamenten nichts mit den Entwicklungskosten zu tun hat: Ein und dasselbe Medikament kann vollkommen unterschiedliche Preise haben, je nachdem, was sich am Markt durchsetzen lässt“, hieß es in der CBG-Presseerklärung.
Deal mit SEATTLE GENETICS
Der Leverkusener Multi hat sich den Zugriff auf ein neues Verfahren der Krebstherapie gesichert, das von der US-Firma SEATTLE GENETICS stammt. Die „Antikörper-Wirkstoff-Konjugate-Technologie“ soll pharmazeutische Stoffe erst in der Tumorzelle selbst freisetzen und so gesunde Zellen verschonen, so BAYERs Pharma-Manager Andreas Busch. Wenn es dem Leverkusener Multi gelingt, diese Entwicklung zur Serien-Reife voranzutreiben und zum Wirkmechanismus von Medikamenten zu machen, kann SEATTLE GENETICS Zahlungen von bis zu 500 Millionen Dollar erwarten.
Deal mit COMPUGEN
Krebs-Medikamente versprechen auf dem Pharma-Markt die höchsten Renditen. Darum baut der Leverkusener Multi dieses Geschäftsfeld konsequent aus, obwohl sich die Therapie-Erfolge von NEXAVAR & Co. in engen Grenzen halten. Zur Zeit gilt den Immuntherapien das besondere Interesse des Konzerns (siehe FORSCHUNG & LEHRE). Darum sicherte er sich im August 2013 den Zugriff auf eine von dem israelischen Biotech-Unternehmen COMPUGEN entwickelte, auf Antikörpern basierende Form dieser Krebsbehandlungsart. BAYER zahlt COMPUGEN für das Pharmazeutikum, das sich in der vorklinischen Erprobungsphase befindet, zunächst zehn Millionen Dollar. Sollte das Mittel jedoch höhere Test-Stufen erreichen, muss der Konzern weitere Beträge überweisen.
Zweifelhafte Arznei-Tests
Die Pharma-Riesen sieben die Personen, die sich als ProbandInnen für Arznei-Tests zur Verfügung stellen, kräftig aus, damit die Resultate so positiv wie möglich ausfallen. Das ergab eine Untersuchung von Keith Humphreys und seinen KollegInnen, die das Journal of the American Medicine Association veröffentlicht hat. Durchschnittlich fielen 40 Prozent der BewerberInnen durch, obwohl ihr Krankheitsbild den Anforderungen der Studien entsprochen hätte. Auch BAYER bedient sich dieser Praxis. So hat der Leverkusener Multi sich für die Erprobung seines umstrittenen Gerinnungshemmers XARELTO (siehe AKTION & KRITIK) besonders fitte und relativ junge TesterInnen ausgesucht, die noch nie eine Schlaganfall erlitten hatten und auch nicht unter Nieren-Schädigungen litten. Die beiden Mediziner Dr. Matthew Roe und Dr. Magnus Ohman hatten in dem Fachblatt New England Journal of Medicine deshalb starke Zweifel an der Aussagekraft der Prüfungsergebnisse angemeldet.
Angeleitete Leitlinien
Die medinischen Fachgesellschaften legen in ihren Leitlinien die Behandlungsgrundlagen für Krankheiten fest. Jene entsprechen jedoch nicht immer rein wissenschaftlichen Erkenntnissen – viele beteiligte MedizinerInnen haben Beziehungen zur Pharma-Industrie. Der Sozialwissenschaftler Thomas Langer fand allerdings nur in 60 der 297 von ihm untersuchten Leitlinien Angaben zu Interessenskonflikten. Dann aber nicht zu knapp: 680 von 1.379 Personen offenbarten, von den Pillen-Firmen Geld für Vorträge, Schulungen, GutachterInnen- oder Beratungstätigkeiten erhalten zu haben. So erklärt sich dann wohl auch so manch ominöses Votum wie etwa das der „Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe“ (DGGG) zur Gabe von Hormonen bei Wechseljahresbeschwerden. Trotz alarmierender Befunde zu den Risiken und Nebenwirkungen will die DGGG partout nicht von den Mitteln abraten, mit denen BAYER & Co. gute Geschäfte machen.
PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE
Vergiftungen in Thailand
Thailand gehört zu den weltgrößten Exportländern von Reis und strebt diesen Status auch für andere Nahrungsmittel an. Entsprechend hoch ist der Pestizid-Einsatz – und die Zahl der Vergiftungen unter den LandarbeiterInnen. Auch die Rückstände in den Lebensmitteln erreichen nach Angaben des THAI PESTICIDE ALERT NETWORK alarmierende Werte. So überstiegen die Level von EPN, Methidathion und der auch in BAYER-Produkten enthaltenen Wirkstoffe Chlorpyrifos und Carbofuran (für dieses Mittel hat der Leverkusener Multi 2009 einen Produktionsstopp verkündet) die EU-Limits um mehr als das Hundertfache!
UBA fordert strengere Verfahren
Die Universität Koblenz-Landau testete für das Umweltbundesamt (UBA), wie vorschriftsmäßig ausgebrachte Pestizide auf Frosch-Populationen wirken. Das Ergebnis war niederschmetternd. Die Agro-Chemikalien dezimierten die Bestände massiv. So waren nach einer Woche Kontakt mit dem BAYER-Fungizid PROSPER (Wirkstoff: Spiroxamine) 60 Prozent aller Tiere tot. Andere Substanzen sorgten für noch höhere Sterbe-Raten. Als Konsequenz aus der Untersuchung fordert das UBA strengere Zulassungsverfahren. Zudem gab es eine weitere Expertise in Auftrag. Da sich die Effekte der Produkte trotz identischer Wirksubstanzen oft stark voneinander unterschieden, sollen die ForscherInnen nun die Gefahren genauer in den Blick nehmen, die von den in den Ackergiften jeweils enthaltenen Lösemitteln ausgehen.
Ausbau des Pestizid-Geschäfts
BAYER kündigt den Ausbau des Pestizid-Geschäftes an. „Die Nachfrage nach unseren Produkten nimmt so stark zu, dass wir unsere Kapazitäten deutlich verstärken werden“, sagte Liam Condon von BAYER CROPSCIENCE. Deshalb erweiterte der Agro-Riese sein Investitionsbudget bis 2016 um eine Milliarde Euro auf 2,4 Milliarden Euro. Allein mit 380 Millionen Euro schlägt dabei der Bau einer neuen Produktionsanlage im US-amerikanischen Mobile zu Buche. Der Konzern will dort das Herbizid Glufosinat herstellen, ungeachtet seiner gesundheitsschädlichen Wirkung, welche die EU nicht mehr lange zu tolerieren gedenkt: 2017 läuft in den Mitgliedsländern die Zulassung aus.
Glyphosat macht krank
Das hauptsächlich in Kombination mit Genpflanzen der „ROUND UP“-Baureihe, aber auch in BAYER-Produkten (siehe GENE & KLONE) zum Einsatz kommende MONSANTO-Pestizid Glyphosat stört das natürliche Gleichgewicht des menschlichen Organismus und kann Krankheiten wie Alzheimer, Diabetes und Krebs mit auslösen und negativen Einfluss auf die Fortpflanzungsfähigkeit nehmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine im Fachmagazin Entropy veröffentlichte Studie des „Massachusetts Institute of Technology“.
858 % mehr Pestizide in Argentinien
Der globale Fleischmarkt verlangt nach immer Soja für die gezüchteten Tiere. Ein Hauptlieferant ist Argentinien, das seine Anbauflächen in den letzten Jahren rasant ausgeweitet hat. Unter anderem deshalb steigt der Pestizid-Verbrauch immens. In den letzten 22 Jahren erhöhte er sich um 858 Prozent auf über 300 Millionen Kilogramm im Jahr. Den größten Anteil daran hat der auch vom Leverkusener Multi eingesetzte MONSANTO-Wirkstoff Glyphosat. Die Substanz Chlorpyrifos, die in den BAYER-Produkten BLATTANEX, PROFICID und RIDDER Verwendung findet, ist ebenfalls ganz vorne mit dabei. Mit der wachsenden Nachfrage nach den Agro-Chemikalien nimmt auch die Zahl der Vergiftungen zu. Und der Wasserhaushalt des Staates, die Artenvielfalt und die Böden leiden gleichfalls unter der Monokultur. Zudem hat der Agro-Boom soziale Folgen, denn der Landhunger der großen FarmerInnen führt zur Vertreibung der indigenen Bevölkerung.
PFLANZEN & SAATEN
Neues Weizenzucht-Zentrum
Für den Leverkusener Multi ist Weizen „das wichtigste Grundnahrungsmittel weltweit“. Deshalb baut er sein Geschäft mit der Nutzpflanze kontinuierlich aus. So verfügt er nach der Inbetriebnahme des neuen Weizenzucht-Zentrums im französischen Milly-La-Foret mittlerweile schon über sechs solcher Einrichtungen. Zudem hat der Agro-Multi mit zahlreichen Universitäten Forschungskooperationen in diesem Bereich vereinbart. Und 2015 will der Konzern die ersten „Hochertragssorten“ aus eigener Entwicklung auf den Markt bringen.
Noch mehr Weizen mit KEYGENE
Der Leverkusener Multi arbeitet bereits seit längerem mit dem niederländischen Unternehmen KEYGENE zusammen. So haben beide Konzerne gemeinsam mit US-amerikanischen und chinesischen Universitäten schon das komplette Erbgut einer Raps-Sorte entschlüsselt. In einem neuen Deal sicherte sich BAYER nun den Zugriff auf eine neue KEYGENE-Technologie zur Züchtung von dürre-resistenten Weizen-Arten, das „Hochdurchsatz-Mutagenese-Verfahren“. Ob es sich dabei um Gentechnik oder eine konventionelle Methode handelt – darüber befindet zurzeit gerade die EU.
Hybridmais-Verkauf an RASI SEEDS
Die indische BAYER-Niederlassung hat ihr Geschäft mit hybridem, also nicht für die Wiederaussaat geeigneten Mais an das einheimische Unternehmen RAIS SEEDS verkauft. Auch die Züchtungsstationen in Bangalore, Hyderbad und Nordindien übernahm der neue Besitzer.
Konzentration auf dem Saatgut-Markt
Die Konzentration im Saatgut-Bereich schreitet unaufhaltsam voran. Besaßen die vier größten Anbieter 1985 zusammen noch einen Marktanteil von sieben Prozent, so waren es 2011 schon 58 Prozent. BAYER kommt auf drei Prozent und belegt damit unter den zehn größten Herstellern nach MONSANTO, DUPONT, SYNGENTA, LIMAGRAIN, LAND O’LAKE und KWS den siebenten Rang.
Umzug nach West Sacramento
Der Leverkusener Multi konzentriert seine US-amerikanischen Standorte für Gemüse-Saatgut und biologische Pestizide in West Sacramento und gibt dafür seine Niederlassung in Davis auf. Der Konzern will „das Potenzial unserer globalen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten durch Zusammenlegungen und Erweiterungen noch besser ausschöpfen“, heißt es zur Begründung. Auch die größere Nähe zur University of California, mit der BAYER in Sachen „Pflanzenzucht“ kooperiert, hat bei der Entscheidung eine Rolle gespielt.
GENE & KLONE
Kooperation mit MONSANTO
Das die Agrar-Märkte kontrollierende Oligopol von BAYER, MONSANTO, SYNGENTA & Co. stößt zunehmend an seine Grenzen. Ihr Angebot an Pestiziden und Gen-Pflanzen, die gegen diese Substanzen resistent sind, sieht nämlich recht überschaubar aus und wächst nur bescheiden. Deshalb gewöhnen sich Unkräuter und Schadinsekten zunehmend an die Gifte. Nach Einschätzung von Liam Condon, dem Vorstandsvorsitzenden von BAYER CROPSCIENCE, klagt in den USA schon die Hälfte der LandwirtInnen über unwirksame Agro-Chemikalien. Die Konzerne ziehen aus dieser Entwicklung die Konsequenz, sich gegenseitig Zugriff auf ihre Technologien zu gewähren. Auf diese Weise können sie ihre Labor-Früchte gleich gegen mehrere Agrochemikalien zugleich immunisieren, was den FarmerInnen mehr Flexiblität bei der Anwendung der Substanzen erlaubt. Das letzte Austauschgeschäft dieser Art hat BAYER mit MONSANTO vereinbart. Der Leverkusener Multi erhält Lizenzen für die neuesten ROUND-UP-READY-Entwicklungen GENUITY und YIELD und bietet dem US-Unternehmen dafür unter anderem Nutzungsrechte für Ackergifte zur Tötung des Maiswurzelbohrers an. Und Condon kündigte weitere Kooperationen dieser Art an. Kern der Strategie sei, die eigenen Produkte so weit wie möglich verfügbar zu machen, sagte er laut Faz. So wächst das Oligopol langsam aber sicher zu einem einzigen Mega-Multi zusammen.
Kritik an Glyphosat-Zulassung
WissenschaftlerInnen haben das Zulassungsverfahren der EU für das Pestizid Glyphosat analysiert und gravierende Mängel festgestellt. Die Genehmigung für das Mittel, das hauptsächlich in Kombination mit MONSANTO-Genpflanzen der „ROUND UP“-Baureihe, aber auch in den BAYER-Pestiziden GLYPHOS und USTINEX zum Einsatz kommt und bald wohl schon zusammen mit Laborfrüchten des Leverkusener Multis (s. o.), sei auf der Grundlage „schlechter Wissenschaft“ erfolgt, resümieren die ForscherInnen. Eine besondere Rolle spielten dabei deutsche Behörden. So hätten diese den in den Test-Daten dokumentierten Geburtsfehler eines Versuchstieres kurzerhand zu einer Entwicklungsvariation uminterpretiert, um dem Mittel die Zulassung nicht verweigern zu müssen, schreiben Michael Antoniou und seine KollegInnen in ihrem Aufsatz für das Fachmagazin Journal of Environmental and Analytical Toxicology.
Glufosinat-Auskreuzung
In Niedersachsen fanden sich in konventionellen Mais-Kulturen Spuren von gentechnisch veränderten Organismen. Das ergab eine Untersuchung des dortigen Landesumweltamtes. ForscherInnen wiesen in dem Mais Reste der Gentech-Pflanze TC 1507 nach, der die Hersteller PIONEER und DOW AGRO SCIENCES mit einer Resistenz gegen das Herbizid Glufosinat auch eine Eigenschaft der BAYER-Produktreihe LIBERTY LINK eingezüchtet hatten.
Kein LIBERTY LINK-Reis in Europa?
Bereits seit zehn Jahren liegt der EU BAYERs Antrag vor, Importe der Genreis-Sorte LL62 zuzulassen. 2011 forderte Brüssel den Leverkusener Multi auf, zusätzliche Studien zur Sicherheit der Laborfrucht vorzulegen. Der Konzern reagierte darauf allerdings bis heute nicht. Er rechnet bei den Vorbelastungen – 2006 kontaminierte sein LL601-Reis in den USA rund 30 Prozent der konventionell gezüchteten Bestände und löste so einen der größten Gen-GAUs der Geschichte aus – wohl selber nicht mehr mit einem positiven Bescheid.
NICE gibt grünes Licht für EYLEA
Das „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWiG) hatte BAYERs Gentech-Augenpräparat EYLEA keinen Zusatznutzen bei der Behandlung der feuchten Makula-Degeneration – einer Augenerkrankung, die zur Blindheit führen kann – bescheinigt und deshalb auch keine Kostenübernahme durch die Krankenkassen empfehlen können. Das britische IQWiG-Pendant NICE sprach sich hingegen für das Mittel aus, zu dessen Nebenwirkungen Bindehaut-Blutungen, grauer Star, Augenschmerzen, Glaskörper-Trübungen und Erhöhung des Augeninnendrucks zählen. Allerdings musste der Leverkusener Multi dafür mit dem Preis heruntergehen.
Neue EYLEA-Zulassung
Die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA hat empfohlen, BAYERs bisher nur zur Therapie der feuchten Makula-Degeneration (s. o.) zugelassenes Gentech-Augenpräparat EYLEA auch grünes Licht zur Behandlung der Folgen eines Zentralvenen-Verschlusses der Netzhaut zu geben. Darüber hinaus strebt der Pharma-Riese Genehmigungen zu den Indikationen „diabetisches Makula-Ödem“ und „choroidale Neovaskularisation“ – einer Gewebe-Wucherung am Seh-Organ – an. Als Augen-Allheilmittel kommt der gemeinsam mit der Firma REGENERON entwickelte EYLEA-Wirkstoff Aflibercept aber nicht in Betracht. In den Tests, die zur ersten Zulassung führten, demonstrierte er nämlich lediglich seine Nicht-Unterlegenheit gegenüber Ranibizumab. Zudem traten während der Erprobungen zahlreiche Nebenwirkungen (s. o.) auf.
Neues KOGENATE
Das einzig neue bei neuen BAYER-Medikamenten ist oft die Darreichungsform. So entwickelte der Leverkusener Multi jetzt eine Variante seines gentechnisch hergestellten Bluterpräparats KOGENATE, die sich länger im Blut hält, weshalb die Patienten es nicht mehr so oft injizieren müssen. Klinische Prüfungen mit dem Wirkstoff BAY 94-9027 befinden sich gerade in der dritten und letzten Phase. Auch an Kindern testet der Pharma-Riese das Mittel.
WASSER, BODEN & LUFT
Bergkamen stinkt weiter
„An wohl keinem anderen BAYER-Standort genießen Pilze, Hefen und Bakterien dieselbe hohe Wertschätzung wie in Bergkamen“, konstatierte der Leverkusener Multi anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Mikrobiologie“. Aber da täuscht sich der Global Player gewaltig. Seit Jahren nämlich schon leiden die BergkamenerInnen unter den von dem Werk herrührenden Geruchsbelästigungen. Die 2008 eingeleiteten Umbau-Maßnahmen haben bislang keine Abhilfe schaffen können. Aus immer neuen Quellen dringt schlechte Luft nach außen. Ende Juli 2011 sorgte eine defekte Pumpe für Mief. Wenige Tage später flossen unvorhergesehen saure und basische Abwässer zusammen, was übel aufstieß (Ticker 4/11). Und kurz danach kam es zu einem erneuten Angriff auf die Riech-Organe. 2012 entschloss sich der Konzern deshalb zu Sanierungsarbeiten in der Kläranlage. Aber auch diese vermochten die Düfte nicht zu vertreiben. Im Juni 2013 beschwerten sich die BergkamerInnen wieder und klagten über Übelkeit und Kopfschmerzen. Der Leverkusener Multi stritt umgehend ab, dafür verantwortlich zu sein: „Unser System hat keinerlei Geruchsbelästigungen innerhalb des Werkes registriert.“ Später mochte Unternehmenssprecher Martin Pape jedoch nicht mehr ganz ausschließen, dass das Abtragen von Ablagerungen in den Klärbecken zu dem Gestank geführt hatte.
Land unter in Bitterfeld
Langsam muss sich auch BAYER mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen, den das Unternehmen mit seinen Kohlendioxid-Emissionen kräftig vorantreibt. So bekam das Bitterfelder BAYER-Werk im Sommer 2013 die Auswirkungen der Flut massiv zu spüren. „Durch die anhaltenden Niederschläge ist die Hochwasser-Situation im Umfeld der BAYER BITTERFELD GmbH und in der Chemie-Region Bitterfeld sehr angespannt“, verlautete aus der sachsen-anhaltinischen Konzern-Niederlassung. HelferInnen legten Hochwasser-Sperren rund um das Firmen-Areal, und zwischenzeitlich stand sogar die Produktion still, weil die Stromversorgung aus Sicherheitsgründen unterbrochen werden musste.
CO & CO.
Forum floppt
Auf Anfang November 2013 hat die Bezirksregierung den Erörterungstermin für die 24.000 gegen BAYERs Kohlenmonoxid-Pipeline eingereichten Einwendungen gelegt. Im Vorfeld startete der Leverkusener Multi eine Kommunikationsoffensive und engagierte zu diesem Behufe die PR-Agentur IFOK GmbH (SWB 3/13). Sie sollte Krisen-Management betreiben und Gespräche mit den KritikerInnen suchen. Allerdings nicht mit allen. „Mit der CBG führen wir keinen Dialog, das macht keinen Sinn“, so ein Konzern-Sprecher. Das kombinierte Einbindungs- und Spaltungskonzept ging allerdings nicht auf, denn diejenigen, mit denen BAYER gerne einen Dialog geführt hätte, sahen ihrerseits keinen Sinn darin. Sowohl die Bürgerinitiativen als auch die betroffenen Städte verweigerten sich dem Angebot. So fanden sich dann Ende Juli 2013 in Krefeld hinter verschlossenen Türen nur 19 Personen ein – 14 ursprünglich Dialog-Willige hatten aus terminlichen Gründen kurzfristig abgesagt. Pipeline-GegnerInnen waren kaum unter den TeilnehmerInnen. Stattdessen kamen GewerkschaftlerInnen, BetriebsrätInnen, Landtagsabgeordnete, VertreterInnen von Wirtschaftsverbänden, Abgesandte von Jugendorganisationen und ein paar MedizinerInnen. Die IFOK wertete das Ganze trotzdem tapfer als Erfolg und drohte weitere Treffen an.
Duin kritisiert BAYERs CO-Management
Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) hat BAYER Versäumnisse beim Pipeline-Krisenmanagement vorgeworfen. „In den Bürgerinitiativen sitzen keine Wutbürger, sondern Ingenieure, Ärzte, Rettungssanitäter und andere Fachleute. Deren Fragen muss man ernst nehmen. Es kommt bei Großprojekten stärker als früher auf den Dialog im Vorfeld an. Davon hängt ab, ob ich fünf Einwendungen von Bürgern gegen das Projekt habe oder, wie jetzt im Fall der CO-Pipeline, 20.000“, sagte der Sozialdemokrat. Allerdings sieht Duin den Leverkusener Multi auf dem Weg der Besserung. Und prinzipielle Einwände gegen die Giftgas-Leitung hat er ohnehin nicht.
UNFÄLLE & KATASTROPHEN
CO-Austritt in Brunsbüttel
Am 24. September kam es im Brunsbütteler BAYER-Werk zu einem schweren Unfall. Durch eine undichte Leitung trat Kohlenmonoxid aus. Fünf Beschäftigte atmeten das geruchslose Gas ein, zwei wurden bewusstlos. Eine von ihnen schwebte in Lebensgefahr und musste reanimiert werden. Schon in der Vergangenheit hatten sich bei BAYER solche CO-Zwischenfälle ereignet. Im Jahr 2006 gab es einen Brand in der Krefelder Kohlenmonoxid-Anlage, und 2009 gelangte im US-amerikanischen Baytown CO ins Freie. Der jüngste Vorfall macht noch einmal die Gefährdungen deutlich, die von dem Vorhaben des Leverkusener Multis ausgehen, zwischen seinen Standorten Dormagen und Krefeld eine 67 Kilometer lange Kohlenmonoxid-Pipeline in Betrieb zu nehmen. „Das Unglück zeigt einmal mehr, wie gefährlich Kohlenmonoxid für die Menschen ist. Und zum zweiten zeigt es, dass Lecks an CO-Leitungen vorkommen und zuerst den Menschen Schaden zufügen, ehe diese Lecks erkannt werden“, sagte dann auch Dieter Donner von der Initiative STOPP BAYER-CO-PIPELINE. BAYER hingegen sieht keinen Anlass, von den Plänen abzurücken. Die Anlage in Brunsbüttel sei mit der Pipeline im Rheinland technisch nicht vergleichbar, verlautete aus der Konzern-Zentrale.
Ammoniak-Austritt in Muskegon
Auf dem Werksgelände des US-amerikanischen BAYER-Standortes Muskegon kam es am 3.9.13 zu einem Zwischenfall. 100 Kilogramm Ammoniak – ein Stoff, der zu Verätzungen, Gefäß-Verengungen und Augen-Schädigungen führen kann – traten aus. Beschäftigte hatten das Leck nach Wartungsarbeiten an einer Anlage beim Wiederhochfahren entdeckt.
STANDORTE & PRODUKTION
40 Jahre Brunsbüttel
Zusätzlich zu seinem 150. Geburtstag feiert der Leverkusener Multi 2013 auch „40 Jahre Brunsbüttel“. Das dortige BAYER-Werk nahm damals eine zentrale Stellung innerhalb eines Industrie-Projektes ein, das in Europa seinesgleichen suchte. „Hier entsteht ein neuer Ruhrpott“, lauteten die entsprechenden Schlagzeilen. Und der Pharma-Riese hat kaum etwas dazugezahlt, denn das 376 Hektar große Firmen-Gelände bekam er geschenkt. Mit Arbeitsplätzen wollte die Aktiengesellschaft danken, 4.500 Jobs stellte sie in Aussicht. Die anderen Unternehmen machten ähnlich vollmundige Versprechungen. Bezogen auf diese Zahlen, subventionierte das Land Schleswig-Holstein jede Stelle mit ca. 50.000 Euro. Unterm Strich wurde es jedoch noch teurer, weil die Konzerne viel weniger Menschen Arbeit boten – die BAYER-Fertigungsstätte hat heute nur noch ca. 550 Belegschaftsangehörige. Zumindest in Sachen „Umweltzerstörung“ konnte es das Projekt aber mit dem Ruhrpott aufnehmen. Ganze Dörfer mussten der Industrie weichen, was erbitterten Widerstand auslöste. Zudem richtete der Wasser-Verbrauch der Produktionsanlagen große Flurschäden an. Er führte zu Grundwasser-Absenkungen und infolgedessen zu Kratern auf Äckern und Rissen in Gebäuden, weshalb der Landwirt Hans Möller bereits seit Jahren gegen den Pharma-Riesen prozessiert. Und das, was dann bei dem Global Player an verschmutztem Wasser hinten wieder rauskam, raubte vielen ElbfischerInnen die Existenz. Massen von toten Fischen zogen sie aus dem Fluss, denen auch die Leverkusener Bosse in die Augen schauen mussten, als die FischerInnen sie vor der Zentrale abluden. Von all dem war bei den Geburtstagsfeierlichkeiten natürlich keine Rede.
Shanghai: neues Innovationszentrum
BAYER MATERIAL SCIENCE (BMS) eröffnet in Shanghai ein neues Innovationszentrum, das an das am Standort bereits bestehende Forschungs- und Entwicklungseinrichtung für Polymer-Kunststoffe angegliedert ist. Über 200 Beschäftigte widmen sich in dem Zentrum künftig der Aufgabe, neue Anwendungen für Plaste und Elaste zu finden. „Es soll in Bezug auf Expertise, Projekte und Produkte unverzichtbar werden. Wir wollen Innovationen von BAYER und seinen Partnern global präsent machen, indem wir bis 2020 Techniken aus ganz China in die ganze Welt exportieren“, sagt BMS-Boss Patrick Thomas über das Projekt. Mit der Inbetriebnahme des Baus setzt er die Strategie fort, nicht nur die Fertigung, sondern zunehmend auch die Wissensarbeit im Ausland anzusiedeln. So bekam von ihm jüngst eine Konzern-Niederlassung in den USA den Zuschlag, eine Prozessdesign-Zentrale zur Vereinheitlichung der globalen Betriebsabläufe mit Hilfe von SAP-Computerprogrammen aufzubauen.
Mehr XARELTO aus Wuppertal
BAYERs Geschäfte mit dem Gerinnungshemmer XARELTO laufen gut, obwohl beim „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) im letzten Jahr 58 Meldungen über Todesfälle und 750 über schwere Nebenwirkungen wie Blutungen eingingen und die „Arzneimittel-Kommission der deutschen Ärzteschaft“ vom Verschreiben des Mittels abrät (siehe auch AKTION & KRITIK). Die Marketing-Abteilung des Konzerns hat nämlich mal wieder ganze Arbeit geleistet. Im Geschäftsjahr 2012 betrug der Umsatz 322 Millionen Euro. Und der Pharma-Riese rechnet mit weiteren Steigerungsraten, da die Genehmigungsbehörden die Arznei für immer mehr Anwendungsgebiete zulassen. Darum hat der Global Player am Standort Wuppertal in Anwesenheit der örtlichen Polit-Prominenz zwei neue Produktionsstraßen in Betrieb genommen.
Baulärm in Wuppertal
„Es wird überall gebaut, überall investiert“, jubiliert BAYERs Wuppertaler Standort-Leiter Klaus Jelich. So erweitert der Pharma-Riese nicht nur die XARELTO-Produktion (s. o.), sondern errichtet unter anderem noch ein Blockheizkraft-Werk und ein Zellbiologie-Technikum. Die AnwohnerInnen können Jelichs Begeisterung darüber nicht teilen. „Seit Wochen ist der Baulärm vom Werksgelände so schlimm, dass wir auf der Terrasse unser eigenes Wort nicht verstehen“, klagt etwa Ina Thieme-Garmann. Die Reaktion des Leverkusener Multis: Er schickte ihr ein Päckchen Ohrstöpsel. Als blanken Hohn empfand Thieme-Garmann das. Erst nachdem die Proteste sich verstärkten, nahm BAYER einen Kurswechsel vor und begann mit der Öffentlichkeitsarbeit. So lud der Konzern Anfang September 2013 zu einer Informationsveranstaltung über die Bau-Arbeiten ein.
Neuer Standort für Kindergarten
Ursprünglich hatte BAYER in unmittelbarer Nähe des Leverkusener Werkes einen neuen Kindergarten errichten wollen, aber die Seveso-Richtlinie machte diese Pläne zunichte. Diese schreibt nämlich einen ausreichenden Abstand zwischen Industrie-Anlagen und anderen Gebäuden vor. Jetzt baut der Konzern am Kurtekottenweg. Aber auch dieser Standort ist nicht unumstritten, da er an einen Flughafen angrenzt. Das Unternehmen versprach zwar, dass es „Gefährdungen durch den Flugverkehr und für den Flugbetrieb minimieren will“, baurechtlich gesehen reichen solche Absichtserklärungen jedoch nicht. Es waren vielmehr feine juristische Winkelzüge nötig, um grünes Licht für die Kita zu erhalten. Erst diese bescheinigten dem Projekt mit Verweis auf ähnliche Bauten in der Umgebung nämlich, „keine neue Entwicklung im Sinne der Störfall-Verordnung“ zu sein.
Neuer Standort für Feuerwehr
Die Stadt Leverkusen hatte für die städtische Feuerwehr ursprünglich das Gelände des ehemaligen BAYER-Autohofs als neue Heimstätte ausgewählt (Ticker 2/13). Unter dem Pflaster schlummern nach Auskunft des Kataster-Amts aber vermutlich giftige Abfälle aus der Frühzeit des Konzerns, weshalb die Feuerwehr-Leute sich gegen den Standort wehrten. Und sie konnten sich durchsetzen. Jetzt zieht die Feuerwache auf ein Areal am Kurtekotten.
Keine Windräder in Bergkamen
Die Stadt Bergkamen hatte freies BAYER-Gelände als optimales Areal für einen Windenergie-Park auserkoren. Aber der Leverkusener Multi legte ein Veto e
Vor 150 Jahren wurde die Firma „Friedr. Bayer et comp.“ gegründet. Die Bayer AG stieg in der Folge zu einem der größten Chemie- und Pharmakonzerne der Welt auf. Für Profite ging das Unternehmen immer wieder über Leichen. Kanzlerin Merkel hielt dies nicht davon ab, bei der Jubiläumsfeier persönlich zu gratulieren.
Von Philipp Mimkes
Am 1. August 1863 gründeten der Kaufmann Friedrich Bayer und der Färber Friedrich Weskott in Wuppertal-Barmen die Firma „Friedr. Bayer et comp“. Mit zunächst drei Mitarbeitern wurden Farbstoffe für die boomende Textilindustrie produziert.
Erst kurz zuvor war in England die Gewinnung synthetischer Farbstoffe aus Teer entwickelt worden. Da die deutschen Länder keine ausländischen Patente anerkannten, schossen überall Teerfarbenfabriken aus dem Boden. Fast alle deutschen Chemieunternehmen - neben Bayer auch BASF, Hoechst und Agfa – haben daher ihren Ursprung in der Herstellung von Farbstoffen.
Rasch setzte ein Konzentrationsprozess ein, den nur wenige Firmen überlebten. Bayer baute schon nach wenigen Jahren eine größere Fabrik in Wuppertal-Elberfeld und wurde 1881 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Zum Ende des Jahrhunderts hatte die Firma bereits mehrere tausend Mitarbeiter; zwei Drittel aller Farbstoffe weltweit wurden nun von deutschen Firmen erzeugt.
Noch im 19. Jahrhundert eröffnete Bayer die ersten Auslands-Repräsentanzen, zunächst in Russland, Lateinamerika und den USA, später auch in China und Japan. Auch die ersten Pharmaprodukte, Pestizide und Photochemikalien wurden in das Portfolio aufgenommen.
Hustenmittel Heroin
1884 trat der 22-jährige Chemiker Carl Duisberg in die Bayer AG ein. Bis zu seinem Tod im Jahr 1935 sollte er die Geschicke der Firma und die der chemischen Industrie insgesamt maßgeblich bestimmen.
Duisberg baute zunächst ein leistungsfähiges Pharma-Forschungslabor auf. Eine der ersten Entwicklungen war das Schmerzmittel Aspirin, das 1899 auf den Markt kam. In seinen Festschriften feiert der Konzern das Präparat heute als „Jahrhundertpharmakon“ - vollkommen zu Recht. Doch Aspirin ist nur das eine neue Medikament, das Bayer zu einem der führenden Pharma-Anbieter machte. Das andere Wundermittel verschweigt die Unternehmensgeschichte wohlweislich, obwohl es zum wirtschaftlichen Aufstieg mindestens ebenso viel beitrug: Heroin. Das „Beruhigungsmittel bei Husten“ wurde ebenfalls ab 1899 angeboten.
Im Jahr 1900 startete Bayer für die beiden Präparate einen bis dahin nie da gewesenen Werbefeldzug. Auf dem ganzen Globus wurden Anzeigen geschaltet, Ärzte wurden erstmals flächendeckend mit Gratisproben versorgt, und Niederlassungen von Brasilien bis China brachten die Präparate bis in die entlegensten Gebiete. Heroin wurde für eine breite Palette von Krankheiten beworben, darunter Multiple Sklerose, Asthma, Magenkrebs, Epilepsie und Schizophrenie.
Als Wissenschaftler auf das Suchtpotential des Tausendsassas hinwiesen, forderte Carl Duisberg, die Querulanten „mundtot zu schlagen“. Und weiter: „Wir dürfen nicht dulden, dass in der Welt behauptet wird, wir hätten unvorsichtigerweise Präparate poussiert, die nicht sorgfältig probiert sind“. Der sensationelle Erfolg verschaffte Carl Duisberg am 1. Januar 1900 den Vorstandsposten bei Bayer.
Umweltprobleme im 19. Jahrhundert
Schon der Aufbau der Chemie-Industrie führte zu großen Umweltschäden. Bereits im 19. Jahrhundert sah sich die Firma mit ersten Protesten und Klagen konfrontiert. So legten 23 Barmener Anwohner Einspruch gegen die Konzessionen für Friedrich Bayer ein. Sie befürchteten „Schäden an Gesundheit und Vegetation“ durch die Produktion von Zinn- und Eisenbeize, Indigokarmin und Blaupulver. Im Sommer 1864 musste das erst im Jahr zuvor gegründete Unternehmen die ersten Entschädigungen leisten. Immer mehr Beschwerden kamen in der Nachbarschaft auf, die Höhe der Abfindungssummen nahm zu. Die Firmenleitung reagierte mit einem ersten Umzug des Werks nach Wuppertal-Elberfeld.
Dort gingen die Probleme jedoch weiter, besonders wegen der Entsorgung giftiger Produktionsabfälle. Fabrikrevisionen im Jahr 1872 zeigten, dass Bayer es mit den Konzessionsauflagen nicht sonderlich genau nahm, was erneut zu Geldstrafen und sogar einem Eingreifen des Elberfelder Bürgermeisters führte. Eine Auseinandersetzung um austretende Dämpfe beschäftigte sogar das Ministerium für Handel und Gewerbe in Berlin. Einen Höhepunkt erreichten die Proteste im Juni 1889, als sich 66 Anwohner mit einem Protestschreiben an die Königliche Regierung wandten. Der Historiker Ralf Henneking vermutet, dass das Unternehmen vor behördlichen Inspektionen gewarnt wurde, weswegen die Strafzahlungen zum Ende des Jahrhunderts hin zurückgingen.
Durch die Tallage der Wuppertaler Fabrik waren die Expansionsmöglichkeiten begrenzt, weswegen ab 1895 der Bau des Leverkusener Werks vorangetrieben wurde. Auch hier gab es zunächst Konflikte mit Nachbarn und Behörden. So reichten Anwohner Beschwerden gegen die Errichtung von Salz- und Schwefelsäureanlagen ein, da sie durch die Abgase Gefahren für ihre Gesundheit befürchteten. In drei weiteren Fällen kam der Einspruch von Seiten der Stadt Köln, die eine Schädigung für ihr Stadtgebiet befürchtete. Einige Nachbarn zogen ihre Einwendungen freiwillig zurück, wahrscheinlich nach diskreten Geldzahlungen. Für die Landbesitzer wurde es ohnehin lukrativer, von den deutlich gestiegenen Grundstückspreisen zu profitieren, so dass Bayer nach und nach eine Fläche von fünf Quadratkilometern aufkaufen konnte. 1912 wurde der Firmensitz schließlich ganz nach Leverkusen verlegt.
Wasserverschmutzung
Von Anfang an versuchte die Firma Bayer, die Ausgaben für die Reinhaltung von Luft und Wasser zu minimieren. So kam eine Untersuchung der preußischen Regierung aus dem Jahr 1876 zu dem Ergebnis, dass die Wupper im Raum Barmen-Elberfeld „meistens einem Tintenstrom“ gleiche. Der Umzug nach Leverkusen wurde auch vor dem Hintergrund betrieben, dass der Rhein deutlich größere Mengen chemischer Abwässer aufnehmen konnte.
Die ersten Genehmigungen für die Abwassereinleitung in den Rhein enthielten jedoch noch die Bedingung, dass das Wasser frei von schädlichen oder übelriechenden Beimengungen und möglichst rein sein müsse. Behördliche Untersuchungen bemängelten, dass die Abwässer stark sauer reagierten. Die Unternehmensleitung versprach daraufhin, eine Abwasserkommission zu bilden und eine Selbstkontrolle vorzunehmen.
Stattdessen wurde jedoch zunächst ein Gutachten beauftragt, mit dessen Erstellung Curt Weigelt, ein langjähriger Lobbyist der chemischen Industrie, betraut wurde. Weigelt bezeichnete die Verunreinigung des Rheins denn auch als „unvermeidlich“; eine vorwärtsstrebende Industrie müsse die Kosten für die Abwasserreinigung so niedrig wie möglich halten und könne ohne das staatliche Zugeständnis einer „größeren Opferstrecke“ nicht auskommen. Carl Duisberg bekräftigte, dass technische Maßnahmen zur Abwasserreinigung eine „Vergeudung von Nationalkapital“ seien. Duisberg trat für die „Freiheit der fließenden Welle“ ein und forderte eine unbeschränkte industrielle Nutzung des Rheins. Auf Grundlage des Gutachtens teilte die Unternehmensleitung dem zuständigen Landrat mit, dass die Auflagen nicht erfüllt werden könnten. Die Konzessionen blieben dennoch bestehen.
Teile der damaligen Genehmigung haben Auswirkungen bis in die Gegenwart: so entnimmt allein das Leverkusener Werk dem Boden jährlich rund 85 Millionen Kubikmeter Grundwasser - mehr als der Trinkwasserbedarf der benachbarten Millionenstadt Köln. Während die Städte Köln und Düsseldorf mit hohem Kostenaufwand Wasser aus Rhein-Uferfiltrat gewinnen müssen, nutzt Bayer das weit sauberere Grundwasser. Aufgrund der alten „Wasserrechte“ musste das Unternehmen bis vor wenigen Jahren hierfür nicht einmal Abgaben leisten, weswegen Investitionen in wassersparende Technologien weitgehend unterblieben.
Sprengstoff und Giftgas
Im 1. Weltkrieg griff die deutsche Chemie-Industrie erstmals in den Lauf der Weltgeschichte ein. Aufgrund der englischen Seeblockade versiegte der Nachschub von Chile-Salpeter, der für die Produktion von Sprengstoff unabdingbar war. Eine für den Herbst 1914 geplante Offensive musste abgeblasen werden.
Zur Entschärfung der Lage richtete die Oberste Heeresleitung eine Salpeter-Kommission ein. Ende 1914 gaben Carl Bosch von der BASF und Carl Duisberg den Militärs das sogenannte „Salpeter-Versprechen“ und sicherten die Bereitstellung großer Mengen Ammoniumnitrat zu. Im Gegenzug erhielten die Firmen langfristige Abnahmegarantien und Darlehen in Millionenhöhe. Schon im Frühjahr 1915 konnte die Salpeter-Produktion aufgenommen werden, die Industrie hatte dadurch nach eigenen Worten „den Krieg gerettet“. Allein für das Ammoniak- und Salpeterwerk in Leuna wurden Reichskredite in Höhe von 432 Millionen Mark gewährt. Diese wurden sogar zurückgezahlt – allerdings erst 1923 auf dem Höhepunkt der Hyperinflation.
Historisch wichtig ist auch die Rolle von Bayer bei der Ausbeutung von Zwangsarbeitern. Im Herbst 1916 beklagte Carl Duisberg den Mangel an Arbeitskräften und forderte mit dem Ausspruch „öffnen Sie das große Menschenbassin Belgien“ den Einsatz von Zwangsarbeitern. Das Reichsamt des Inneren griff den Vorschlag auf und ließ rund 60.000 Belgier deportieren. Das Vorhaben scheiterte zwar größtenteils, unter anderem wegen eines Streiks der Belgier. Die Deportation gilt jedoch als Blaupause für das ungleich mörderischere Zwangsarbeiter-Programm im 2. Weltkrieg. Duisberg plädierte bis zuletzt dafür, die Arbeitsmöglichkeiten und die Lebensmittel in Belgien zu rationieren, um die „Arbeitslust“ der Belgier in Deutschland zu steigern.
Zur selben Zeit entwickelte Bayer chemische Kampfstoffe. Carl Duisberg war bei den ersten Chlorgasversuchen auf dem Truppenübungsplatz in Köln-Wahn persönlich anwesend und pries den Chemie-Tod begeistert: „Die Gegner merken und wissen gar nicht, wenn Gelände damit bespritzt ist, in welcher Gefahr sie sich befinden und bleiben ruhig liegen, bis die Folgen eintreten.“ Kurz darauf erfolgte der erste Einsatz durch das deutsche Heer im belgischen Ypern. Unter Duisbergs Leitung wurden bei Bayer weitere Kampfstoffe entwickelt: das weit giftigere Phosgen („Grünkreuz“), das bis heute als Vorprodukt von Kunststoffen produziert wird, und später Senfgas. Duisberg forderte vehement den Einsatz der Kampfstoffe: „Die einzig richtige Stelle aber ist die Front, an der man so etwas heute probieren kann und auch für die Zukunft nicht sobald wieder Gelegenheit hat, so etwas auszuprobieren. ... Ich kann deshalb nur noch einmal dringend empfehlen, die Gelegenheit dieses Krieges nicht vorübergehen zu lassen“. Insgesamt geht die Forschung von 60.000 Toten des von Deutschland begonnen Gaskrieges aus.
IG Farben
Die Krönung des Lebenswerks von Carl Duisberg war die 1925 erfolgte Gründung der IG Farben, dem damals größten europäischen Konzern und – nach Standard Oil – zweitgrößten der Welt. Der Zusammenschluss umfasste Bayer, BASF, Hoechst und einige kleinere Firmen. Duisburg wurde erster Aufsichtsratsvorsitzender.
Spätestens ab 1930 leisteten die IG Farben direkte Spenden an die NSDAP. Im Sommer 1932 schloss der langjährige Assistent Duisbergs, Heinrich Gattineau, mit Hitler und Rudolf Heß den sogenannten „Benzinpakt“. Die IG sicherte dem auf Autarkie versessenen Hitler die unbegrenzte Lieferung von Treibstoffen zu. Im Gegenzug erhielt die Firma nach 1933 Absatzgarantien für synthetischen Treibstoff und Kautschuk („Buna“). Eine gigantische Fehlinvestition der IG Farben - die aufwendige Kohlehydrierung war auf dem Weltmarkt bis dahin nicht konkurrenzfähig – amortisierte sich dadurch im Nachhinein.
In den folgenden Jahren kollaborierte kein anderes Unternehmen so eng mit dem Dritten Reich wie die IG Farben. Der 1936 verordnete Vierjahresplan zur Umstellung auf eine Kriegswirtschaft basierte größtenteils auf Vorschlägen der Firma; in der neu geschaffenen Vierjahresplanbehörde wurden hauptsächlich Vertreter der IG beschäftigt. Das Unternehmen war denn auch eng in den Eroberungskrieg des Dritten Reichs eingebunden. Der Konzern folgte der Wehrmacht in die eroberten Länder Europas und übernahm meist innerhalb weniger Wochen die dortige Chemie-Industrie, Kohlegruben und Ölquellen.
Als Teil der IG Farben beteiligte sich Bayer während des Krieges an den grässlichsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. So lieferte die Degesch, eine Tochterfirma von IG Farben und Degussa, das Zyklon B für die Gaskammern. Im Auftrag der IG wurden in Buchenwald und Auschwitz tödliche Experimente an Häftlingen durchgeführt, besonders mit Impfstoffen. Und die IG Farben ließen sich in Auschwitz eine riesige neue Fabrik von Sklavenarbeitern bauen. Im konzerneigenen Konzentrationslager Auschwitz-Monowitz kamen rund 30.000 Zwangsarbeiter ums Leben. Den Aufbau des benachbarten Vernichtungslagers Birkenau unterstützte die Firma finanziell und logistisch.
Wie eng der Austausch von Firma und KZ-Leitung war, belegt ein Zitat von Otto Ambros, Vorstandsmitglied des Technischen Ausschusses der IG Farben: „Unsere neue Freundschaft mit der SS wirkt sich sehr segensreich aus. Anlässlich eines Abendessens, das uns die Leitung des KZ gab, haben wir weiterhin alle Maßnahmen festgelegt, welche die Einschaltung des KZ-Lagers zugunsten der Buna-Werke betreffen“. Zur Behandlung der Zwangsarbeiter ordnete IG-Vorstandsmitglied Christian Schneider an: „Oberster Grundsatz bleibt es, aus den Kriegsgefangenen soviel Arbeitsleistung herauszuholen, als nur irgend möglich. Alle diese Menschen müssen so ernährt, untergebracht und behandelt werden, dass sie bei denkbar sparsamstem Aufwand die größtmögliche Leistung vollbringen“. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Arbeitssklaven betrug denn auch nur neun Monate.
Ohne die IG Farben hätte Auschwitz zweifellos nicht seine unvergleichliche Bedeutung als größtes Todeslager der Geschichte erlangen können.
Entnazifizierung
1952 wurden die IG Farben auf Verfügung der Alliierten in ihre ursprünglichen Bestandteile zerlegt. Die Bayer AG erhielt die Werke am Niederrhein und ein Stammkapital in Höhe von 388 Millionen Mark.
Zuvor hatte sich in den Nürnberger Prozessen ein eigenes Verfahren mit den Verbrechen der chemischen Industrie beschäftigt. Die zunächst sehr gründlichen Ermittlungen wurden jedoch wegen des aufkommenden Kalten Kriegs immer halbherziger geführt. Zudem hatten die IG Farben ab 1944 systematisch belastende Unterlagen vernichtet. Zwar werden im Urteil alle Verbrechen des Konzerns genannt: „a) die Rolle der I.G. bei dem Sklavenprogramm des Dritten Reiches, b) die Verwendung von Giftgas bei der Ausrottung von Konzentrationslagerinsassen, c) die Lieferung von giftigen Chemikalien der I. G. für verbrecherische medizinische Versuche an versklavten Personen, d) die unmenschliche Handlungsweise der Angeklagten in Zusammenhang mit dem Werk Auschwitz der I.G.“.
Dennoch wurden die Manager lediglich zu Haftstrafen von maximal acht Jahren verurteilt. Schon 1951 waren alle wieder auf freien Fuß und konnten ihre Karriere fortsetzen. So wurde Fritz ter Mer, der den Aufbau des Werks Auschwitz mitorganisiert hatte, nach seiner Haft Aufsichtsratsvorsitzender der Bayer AG. Für die Arbeitssklaven brachte ter Meer auch im Nachhinein wenig Mitgefühl auf: ihnen sei „kein besonderes Leid zugefügt worden, da man sie ohnedies getötet hätte“. Bayer benannte später sogar eine Studienstiftung in „Fritz-ter-Meer-Stiftung“.
Auch heute noch regt sich beim Konzern kein Unrechtsbewusstsein. So bezeichnet die von Bayer herausgegebene Festschrift Meilensteine die „Verstrickung“ der IG Farben im Dritten Reich schlicht als „Folge einer Zwangslage, in der die meisten nicht anders gehandelt hätten und gehandelt haben.“
Wiederaufstieg der großen drei
Bayer, BASF und Hoechst wurden zwar formal aufgespalten, stimmten aber ihre Geschäfte über Jahrzehnte hinweg eng aufeinander ab. So glückte in vielen Bereichen die Rückkehr an die Weltspitze. Der Leverkusener Konzern behauptete sich vor allem in den Segmenten Pestizide, Kunststoffe und Pharma und jüngst auch im Bereich Saatgut/Gentechnik (siehe „Chemie satt“, jW vom 8. Juli 2013). Der Verkauf von Basis-Chemikalien, Fotoprodukten und Farbstoffen hingegen wurde in den letzten zwei Jahrzehnten aufgegeben. Der Umsatz von Bayer stieg kontinuierlich auf heute 40 Milliarden Euro an.
Bis heute hat der Konzern zahlreiche hochproblematische Produkte im Sortiment. So schätzt die Weltgesundheitsorganisation die Zahl der jährlichen Pestizidvergiftungen auf bis zu 20 Millionen, rund 200.000 Fälle verlaufen tödlich. Für einen großen Teil der Vergiftungen sind Bayer-Produkte verantwortlich; mit einem Weltmarktanteil von rund 20% ist die Firma der zweitgrößte Pestizidhersteller der Welt. Obwohl das Unternehmen einräumt, dass „der sachgerechte Umgang mit Pflanzenschutzmitteln unter bestimmten Bedingungen in einigen Ländern der Dritten Welt nicht immer gewährleistet ist“, verkauft Bayer weiterhin hochgiftige Wirkstoffe, vor allem in Entwicklungsländern.
Historisch gesehen stammen die meisten Agrogifte aus der Giftgas-Forschung. Dr. Gerhard Schrader, der während des Dritten Reichs in den Wuppertaler Bayer-Laboren Kampfgase wie Sarin und Tabun entwickelt hatte, sattelte nach dem Krieg um und übernahm die Leitung der Pestizidabteilung. Ganz an den Nagel gehängt wurde die Herstellung von Giftgas jedoch nicht: während des Vietnam-Kriegs produzierte die von Bayer und Monsanto gegründete Firma Mobay das berüchtigte Entlaubungsmittel „Agent Orange“.
Und auch im Pharmabereich ging der Konzern immer wieder über Leichen. So wurde in den 80er Jahren etwa die Hälfte aller Bluter weltweit mit HIV oder Hepatitis C infiziert, ein Großteil durch Produkte des Weltmarktführers Bayer. Bestehende Inaktivierungsverfahren setzte der Konzern aus Kostengründen jahrelang nicht ein. Nach dem Verbot unbehandelter Blutprodukte in den USA und Europa wurden die übriggebliebenen Chargen nach Lateinamerika und Asien exportiert. Tausende Bluter bezahlten mit ihrem Leben.
Jüngere Pharma-Skandale verbinden sich mit dem Cholesterinsenker Lipobay, der trotz interner Warnungen auf den Markt gedrückt wurde und der den Konzern über eine Milliarde Entschädigungszahlungen kostete, sowie mit Antibabypillen der Yasmin-Gruppe. Die Einnahme der Pillen geht mit einem deutlich erhöhten Thrombose- und Schlaganfall-Risiko einher, mehrere hundert Frauen. Allein in den USA musste Bayer über eine Milliarde Dollar an Geschädigte und Hinterbliebene zahlen.
Historie weißgewaschen
Zum 150-jährigen Bestehen organisiert die Firma Bayer zahlreiche Festveranstaltungen mit prominenten Gästen. Ein eigens gebautes Luftschiff wirbt in allen fünf Kontinenten für den Konzern. Auch eine Ausstellung wurde von Leverkusen aus um die Welt geschickt.
Die Kehrseiten der Firmengeschichte werden in den zahlreichen Festschriften jedoch ausgeklammert. In der jüngsten Hauptversammlung wiesen Kritische Aktionäre zwar darauf hin, dass Bayer für Verbrechen wie Zwangsarbeit, Giftgas-Einsatz und Pestizidvergiftungen mitverantwortlich sei. Der Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers bezeichnete den Hinweis jedoch als „schlichtweg abenteuerlich“. Das Unternehmen habe sich immer für Umweltschutz und zumutbare Arbeitszeiten eingesetzt, über die Geschichte werde „offen und transparent“ informiert.
Angela Merkel, die es sich bei der großen Geburtstagsfeier vor zwei Wochen in den Kölner Messehallen nicht nehmen ließ, persönlich zu gratulieren, schlug in dieselbe Kerbe: Bayer sei ein „wichtiges Standbein der deutschen Industrie“ und blicke auf eine „sehr beeindruckende Geschichte“ zurück. Kritische Fragen kamen in der Laudatio erwartungsgemäß nicht zur Sprache. Ein Offener Brief, in dem die Kanzlerin aufgefordert wurde, sich an der Weißwaschung der Firmenhistorie nicht zu beteiligen, blieb ohne Antwort.
Liebe Leserinnen und Leser,
zwischen 1933 und 1945 fielen hunderttausende Menschen den „rassehygienischen“ Maßnahmen des NS-Staates zum Opfer. Die Verfolgung eingeläutet hatte das erste NS-Rassegesetz, das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (GzVeN), das die Kategorie des „lebensunwerten Lebens“ in das Rechtssystem einführte. In der ersten Phase der „Euthanasie“ töteten ÄrztInnen über 70.000 Menschen in als Duschen getarnten Räumen durch einströmendes Gas. Diese Vorläufer der späteren Gaskammern waren in sechs Tötungsanstalten des Reichs eingerichtet, welche die von BAYER mitgegründeten IG FARBEN mit Kohlenmonoxid belieferten, bis Hitler 1941 den Stopp der so genannten Aktion T4 anordnete. Danach mordeten MedizinerInnen und Pflegepersonal durch tödliche Medikamente und Nahrungsentzug weiter.
Nach 1945 hatte das Rassegesetz der Nazis für die Zwangssterilisierten und „Euthanasie“-Opfer oder ihre Nachkommen weiterhin Bedeutung, weil die politischen VertreterInnen in den alliierten Besatzungszonen und später in den Bundesländern mit seiner Existenz unterschiedlich umgingen. Von den Siegermächten hob nur die Sowjetunion das GzVeN auf, von den Bundesländern nur Bayern und Thüringen. Die anderen Zonen bzw. Länder fanden unterschiedliche Gründe, dieses nicht zu tun. Bei der britischen Militär-Regierung hieß es sogar, man könne es vielleicht noch einmal brauchen.
Der „Wiedergutmachungsausschuss“ des Parlaments, dem drei ehemalige NS-Mediziner bzw. „Rasse-Hygieniker“ angehörten, entschied 1961, dass das GzVeN nicht im Widerspruch zu rechtsstaatlichen Grundsätzen gestanden habe. Darum erhielten die Betroffenen oder ihre Angehörigen auch keine Entschädigungen: Das Bundesentschädigungsschlussgesetz von 1965 erkannte zwangssterilisierte und „Euthanasie“-Geschädigte nicht als Verfolgte des Nationalsozialismus an.
Erst im Dezember 1994 ächtete der Deutsche Bundestag die durchgeführten Zwangssterilisationen und „Euthanasie“-Morde. Und erst am 24. Mai 2007 gelang es dem BUND DER „EUTHANASIE“-GESCHÄDIGTEN UND ZWANGSSTERILISIERTEN (BEZ) nach langen Bemühungen, die Ächtung des GzVeN selbst zu erreichen.
Die jetzt gültige Rechtssituation geht davon aus, dass das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses nie in der Bundesrepublik Deutschland gegolten habe und dass es von Anfang an nicht mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen sei. Dass die historische Entwicklung eine andere war, haben die Opfer in den vielen vergeblich geführten Prozessen um Rehabilitation und Entschädigungsleistungen erfahren, in denen die RichterInnen ihr Leid als „nicht-typisches NS-Unrecht“ eingestuft hatten.
Das spiegelt sich auch in den Entschädigungszahlungen wieder, die Zwangssterilisierte erst seit 1980 und „Euthanasie“-Geschädigte erst seit 2002 erhalten. Als der Bundestag sich 2011 symbolträchtig am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus noch einmal mit dieser Frage beschäftigte, hatten die Betroffenen Hoffnung nicht nur auf Leistungsverbesserungen, sondern auch auf ihre Anerkennung als Verfolgte. Diese sollte sich jedoch als trügerisch erweisen. Nach den Beschlüssen erweiterte sich der Kreis der Anspruchsberechtigten lediglich um drei Personen. Und das Entscheidende bleibt beiden Opfer-Gruppen weiterhin versagt: die ethische und moralische Anerkennung als NS-Verfolgte. Für die Regierung eines demokratischen Landes eine vernichtende Bilanz.
Margret Hamm gehört dem BUND DER „EUTHANASIE“-GESCHÄDIGTEN UND ZWANGSSTERILISIERTEN (BEZ) an.
Zum 150. Firmen-Jubiläum brachten Bundeskanzlerin Angela Merkel und NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft BAYER ihre Geburtstagsständchen. Dabei lobten sie den Konzern nicht nur „über den Klee“, wie die Nachrichtenagentur dpa befand, sondern hatten zudem noch ein besonderes Geschenk im Gepäck. Sie versicherten dem Konzern, sich bei der EU in Brüssel für den Erhalt der Ausnahmeregelungen zur Ökosteuer einzusetzen, die den großen Stromverbrauchern Millionen Euro an Energie-Kosten erspart. Standesgemäß versuchte der Leverkusener Multi auch sonst, Profit aus seinem Namenstag zu ziehen und begleitete ihn mit einer Unmenge von Werbe-Aktionen. „Wir wollen das Jubiläum nutzen, um den Namen BAYER auf der ganzen Welt noch bekannter zu machen“, hatte der oberste Öffentlichkeitsarbeiter Michael Schade als Devise ausgegeben.
Von Jan Pehrke
„Der BAYER-Konzern (...) hat eine beeindruckende Geschichte“, meint Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zum unfeierlichen Anlass des 150-jährigen Firmen-Jubiläums hatte die Politikerin Mitte Juli 2013 ihren wöchentlichen Podcast dem Leverkusener Multi gewidmet und ihm bescheinigt, „pars pro toto für die gesamte chemische Industrie“ zu stehen. Auf der großen Geburtstagsparty in den Kölner Messehallen setzte sie ihre Laudatio dann fort und beschrieb die Unternehmenshistorie exakt aus der Perspektive der Chef-Etage als die eines unermüdlichen ForscherInnen-Dranges. „Die Tinte, mit der diese Erfolgsgeschichte geschrieben wurde, ist Innovation“, konstatierte Merkel. Darüber hinaus bestätigte sie dem Global Player, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein vorbildlich miteinander in Einklang zu bringen. Und zum Abschluss ihrer Rede bedankte sich die Kanzlerin „dafür, dass BAYER mit seinem BAYER-Kreuz das ist, was es heute ist: ein weithin leuchtendes Aushängeschild Deutschlands“.
Eine ähnliche Ergebenheitsadresse steuerte die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft bei. Aber die beiden Damen zeigten sich der Aktien-Gesellschaft nicht nur in Worten, sondern auch in Taten gewogen. „Die Landesregierung will dazu beitragen, dass BAYER sich in Nordrhein-Westfalen wohlfühlt“, betonte Kraft. Ihre CDU-Kollegin zählte derweil all die kleinen Aufmerksamkeiten der Bundesregierung für BAYER & Co. auf: die Gesundheitswirtschaftskonferenz, das Rahmenprogramm „Gesundheitsforschung“, die Nationale Forschungsstrategie „Bioökonomie 2030“ und die erhöhten Bildungs- und Forschungsausgaben. „Wir arbeiten also an Rahmenbedingungen, unter denen Sie bei BAYER und andere Unternehmen im weltweiten Wettbewerb bestehen können“, resümierte die Bundeskanzlerin.
Ein besonderes Geschenk
Und dann brachten Merkel & Kraft dem Konzern noch ein besonderes Geschenk mit. Hatte ein BAYER-Sprecher sich noch kurz vor der großen Feier über die Pläne der EU beklagt, die sich auf 4,7 Milliarden Euro belaufenden Ökosteuer-Rabatte für die Industrie als unerlaubte Subventionen einzustufen und gewarnt: „Ohne die Sonderregelung für energieintensive Unternehmen könnten wir am Standort Deutschland nicht wettbewerbsfähig produzieren“, so versprachen die Politikerinnen in der Kölner Messehalle sogleich Abhilfe. „Deshalb – ich habe darüber mit der Ministerpräsidentin vor dieser Veranstaltung noch einmal gesprochen – werden wir auch in Brüssel entschieden dafür kämpfen, dass die Ausnahmeregelungen für die energieintensive Industrie weiterhin Gültigkeit haben, denn sie sind eine Voraussetzung für weltweite Wettbewerbsfähigkeit“, versicherte Angela Merkel dem Vorstandsvorsitzenden Marijn Dekkers.
Vergeblich hatte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) Angela Merkel vor der Veranstaltung in einem Offenen Brief aufgefordert, auch auf die Teile der BAYER-Geschichte zu sprechen zu kommen, die der Konzern in seinen eigenen Publikationen verschweigt. Aber weder die Produktion von chemischen Kampfstoffen oder die willige Hilfe für den NS-Staat noch die Pestizid-Vergiftungen oder die Schadstoff-Emissionen fanden in ihrer Rede Erwähnung. „Die beiden Top-Gratulantinnen übertrafen sich hinsichtlich des Lobs für den Konzern gegenseitig“, urteilte der Kölner Stadtanzeiger und sogar die Nachrichtenagentur dpa konstatierte, Merkel und Kraft hätten den Pharma-Riesen „über den Klee“ gelobt.
Mit diesen Ergebenheitsadressen stellten die beiden sich in die lange Tradition von PolitikerInnen unterschiedlicher Couleur, die stets in Treue fest zur Chemie-Industrie standen und immer wieder gerne zu Gast bei Freunden waren. So weihte Gerhard Schröder im Jahr 2000 BAYERs neues Pharma-Zentrum in Wuppertal ein und schützte die Branche wie heuer Angela Merkel vor drohender Unbill aus Brüssel. Erfolgreich bewahrte er BAYER & Co. vor einer umfassenden Einbeziehung in den Emissionshandel mit Kohlendioxid-Verschmutzungsrechten. Auch die Chemikalien-Richtlinie, die den Unternehmen auferlegte, vorher niemals untersuchte Substanzen auf ihre Gefährlichkeit hin zu testen, weichte er auf. Und bei seiner Unternehmenssteuer-„Reform“ verließ der SPD-Politiker sich gleich auf einen Mann vom Leverkusener Multi. BAYERs ehemaliger Finanzchef Heribert Zitzelsberger wechselte als Finanzstaatssekretär nach Bonn und konzipierte das Gesetz, das den Konzernen Einsparungen in Milliarden-Höhe bescherte. Schröders Vorgänger Helmut Kohl hatte sogar Stallgeruch. Der CDUler begann als Chemie-Praktikant bei BASF, arbeitete lange als Referent der rheinland-pfälzischen Abteilung des „Verbandes der Chemischen Industrie“ und blieb diesem Industrie-Zweig auch in seiner Politiker-Zeit stets verbunden.
Dekkers’ Rundumschlag
Den Grundstein für BAYERs symbiotische Beziehung zur Macht hatte der ehemalige Generaldirektor Carl Duisberg schon in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts gelegt. „Wo wir einwirken können und müssen, das ist die Parteipolitik ... Was ist zur Durchsetzung unserer Gedanken notwendig? Geld“, hielt er fest und konstatierte: „Alle Schwierigkeiten lassen sich nur überwinden durch planmäßige Beeinflussung.“ Die Methoden haben sich inzwischen etwas geändert, aber ganz im Sinne des Altvorderen nutzte auch der jetzige BAYER-Boss Marijn Dekkers das öffentliche Interesse an dem Jubiläum zur einer solchen „planmäßigen Beeinflussung“. In seiner Geburtstagsrede geißelte er die Hindernisse, auf die der „Forscher-Geist“ von BAYER & Co. hierzulande oft stößt. Dabei hatte er wohl nicht zuletzt die „geniale Erfindung“, giftiges Kohlenmonoxid per Pipeline 67 Kilometer weit quer durch Nordrhein-Westfalen zu leiten im Sinn, der die Bevölkerung entlang der Trasse einen erbitterten Widerstand entgegenbringt. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass so lange über die Risiken gesprochen wird, bis die Chancen komplett vertan sind“, meinte der Große Vorsitzende. Darüber hinaus monierte der Ober-BAYER, dass Erfindungen aus Deutschland häufig im Ausland statt im Inland zur Produkt- und Marktreife gelangen. „Können wir uns es wirklich leisten, dass die Wertschöpfung woanders stattfindet“, fragte Dekkers rhetorisch und schlussfolgerte: Wir müssen in den kommenden Jahren noch einen Zahn zulegen.“ In Interviews spitzte er diese Aussagen dann noch einmal zu und holte zu einem Rundumschlag aus. „Die Deutschen sind sehr, sehr konservativ. Man will Fortschritt, ohne etwas zu wagen, ohne etwas aufzugeben“, sagte er dem Handelsblatt.
Nicht einmal an seinem runden Geburtstag konnte der Leverkusener Multi ganz einfach nur feiern, das zeigte sich auch jenseits solcher Einlassungen immer wieder. Standesgemäß wollte er aus dem Jubiläum Kapital schlagen und demonstrierte auf diese Weise, was ihn statt des immer wieder gerne in den Vordergrund gestellten Forscherdranges wirklich antreibt: die Jagd nach Profit. „Wir wollen das Jubiläum nutzen, um den Namen ‚BAYER’ auf der ganzen Welt noch bekannter zu machen“, das hatte der Konzern-Kommunikationschef Michael Schade als Devise für das Jahr 2013 ausgegeben. Und so schickte das Unternehmen ein riesiges Luftschiff auf die Reise zu den einzelnen Standorten und konzipierte eine Schau rund um seine Leitmaxime „Science For A Better Life“, bei der sich zu jedem Buchstaben des „Claims“ scheinbar Wissenswertes zum Chemie-Multi finden ließ. Des Weiteren veranstaltete der Global Player in Berlin eine große Schau mit Werken aus seiner Kunstsammlung. Und an die wissenschaftliche Community denkt er ebenfalls: Für den Herbst kündigt der Gen-Gigant ein Symposion an.
Familien-Aufstellung
„Ein weiterer Fokus liegt auf der Einbindung und Aktivierung der 110.000 Mitarbeiter“, hält das Marketing-Fachmagazin BlachReport fest. Zu diesem Behufe spielte der Konzern am „Celebration Day“ sogar einmal „verkehrte Welt“. In Leverkusen stellte sich BAYER-Chef Marijn Dekkers persönlich hinter die Theke des BAYER-Kasinos und bediente die Beschäftigten. Auch ein Geschenk hatte der Multi für seine Belegschaftsangehörigen parat. Er bedachte sie mit einer Goldmünze, welche die Prägung „150 Jahre BAYER“ trägt. Allerdings hatte die Großherzigkeit Grenzen. So wollte die Aktien-Gesellschaft die KollegInnen der 60-prozentigen BAYER-Tochter CURRENTA leer ausgehen lassen. „Was das Geschenk angeht, so wurde entschieden, dass in Deutschland alle BAYER-Mitarbeiter ein Geschenk erhalten, die im Jubiläumsjahr 2013 bei BAYER bzw. einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft von BAYER arbeiten“, erklärte der Global Player. Die Unternehmen der CURRENTA-Gruppe hätten dagegen zahlreiche eigene Regelungen und eigene Identitäten, die unabhängig von BAYER bestünden, legte er dar. Die Entscheidung des Pharma-Riesen löste einen Proteststurm aus. Deshalb lenkte er schließlich doch noch ein und beschenkte auch seine verstoßenen Kinder.
Der Vorfall zeigte, wie wenig der Konzern nach all den Jahren der profit-getriebenen Ausgliederungen und Umstrukturierungen selber noch weiß, wer überhaupt noch ganz, wer nur teilweise und wer gar nicht mehr zu ihm gehört. Trotzdem oder gerade deshalb inszenierte der Multi die Jubiläumsparty am 29. Juni in der Bayarena als die ganz große Familien-Zusammenführung. „Wir sind BAYER“, lautete das Motto des Mega-Events mit 30.000 ZuschauerInnen, welche das Stadion allerdings nicht ganz ausfüllen konnten. David Garrett hatte das Unternehmen als Stargast eingekauft. Guido Cantz und Anke Feller vom WDR moderierten die Show und baten Ehrenämtler, Geburtstagskinder und Paare, die sich beim Leverkusener Multi gefunden hatten, auf die Bühne. Höhepunkt des Events sollte die Formierung des BAYER-Kreuzes durch die BesucherInnen werden. So richtig eindrucksvoll geriet diese Familien-Aufstellung jedoch nicht, denn der Konzern-Schriftzug und die Losung „Science For A Better Life“ waren schon vorgegeben. Die Menschen hatten sich lediglich in den freien Segmenten dazwischen einzufinden und ihre Kärtchen mit den Konzern-Farben Grün und Blau hochzuhalten.
Wie es um das an diesem Tag viel beschworene Wir-Gefühl wirklich steht, formulierte ein BAYER-Pensionär in der WDR-Dokumentation „Die BAYER-Story“. Verbittert vor allem von den Kürzungen im Sportvereinsbereich, klagte er: „Das Unternehmen BAYER war ein Familien-Unternehmen, und das ist es heute nicht mehr. Heute ist es eine Holding-Gesellschaft geworden, die kauft und verkauft.“ Und zwar nicht nur Produkte, sondern auch Menschen, resümierte der ehemalige BAYER-Werker bitter.
Anders als Angela Merkel und Hannelore Kraft beleuchtete der Film die Unternehmensgeschichte kritisch und folgte darin der Linie nicht weniger Medien. Er brachte die Rolle des Konzerns im Faschismus ebenso zur Sprache wie seine Umweltsünden und gefährlichen Produkte. Als Kronzeugin für die dunklen Kapitel diente die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG). Axel Köhler-Schnura, der Aktivist der ersten Stunde, berichtete von den spektakulären Bootsprotesten auf dem Rhein gegen die Einleitung von Chemikalien in den Fluss und ordnete den Widerstand in eine lange Tradition ein, die beinahe ebenso alt ist wie die Firma selbst.
Davon konnte sich in der Sendung dann auch der BAYER-Aufsichtsratsvorsitzende Werner Wenning nicht ganz unberührt zeigen. „Ich glaube auch, dass sicherlich einiges, was von unseren externen Kritikern gekommen ist, bestimmte Abläufe noch einmal beschleunigt hat“, sagte er mit Verweis auf die Behebung der gröbsten Umweltsünden wider Wasser, Boden & Luft. Aber es handelte sich dabei dann doch um mehr als eine kleine Starthilfe, wie Axel Köhler-Schnura erläuterte: „Kein einziger Filter ist freiwillig eingebaut, keine einzige Umweltmaßnahme ist freiwillig, weil die nur Geld kostet und den Profit schmälert. Alles ist immer durch öffentlichen Druck erzwungen.“ Und dieser dürfte nach den Darlegungen Dekkers’ zum Wirken eines Chemie-Konzerns auch weiterhin nötig sein. „Wenn man neue Moleküle erfindet, dann macht man das, um irgendwie die Natur zu beeinflussen (...) Wenn man versucht, Pflanzen besser wachsen zu lassen, damit die Insekten die Pflanzen nicht aufessen, dann beeinflusst man die Natur. Und mit etwas Positivem kommt vielleicht auch etwas Negatives“, sagte der Vorstandsvorsitzende in „Die BAYER-Story“. Die Kunst sei dann, das Negative zu kontrollieren und das Positive wirklich nach vorne zu bringen, so Dekkers. Und gerade diese Kunst der Kontrolle beherrscht der Leverkusener Multi auch nach 150 Jahren noch nicht. Das zeigt nicht zuletzt das ständige aktualisierte Sündenregister, das die Coordination alle zwölf Monate zu den BAYER-Hauptversammlungen präsentiert.
In der Diskussion um gentechnisch manipuliertes Saatgut dominiert die Kritik an der Geschäftstätigkeit von MONSANTO. Im Windschatten des US-Multis ist die Firma BAYER zu einem der größten Agro-Konzerne der Welt aufgestiegen. Bei Pestiziden und Saatgut gehört der Leverkusener Multi bereits zu den führenden Anbietern. Eine Recherche am Europäischen Patentamt zeigt, dass der Konzern bei der Zahl der erteilten Gentech-Patente sogar den Spitzenplatz belegt.
Von Dr. Ruth Tippe (KEIN PATENT AUF LEBEN!) und Philipp Mimkes
Mais, Weizen, Reis, Gerste, Sojabohnen, Baumwolle, Zuckerrüben, Raps, Sonnenblumen, Kartoffeln, Tabak, Tomaten, Erbsen, Linsen, Weintrauben – die Liste transgener Pflanzen, auf welche die Firma BAYER CROPSCIENCE Patente besitzt, ist lang. Selbst genmanipulierte Bäume, zum Beispiel Pappeln, Kiefern und Eukalyptus, hat sich der Konzern schützen lassen. Dies ergab eine aktuelle Recherche der Initiative KEIN PATENT AUF LEBEN! am Europäischen Patentamt in München. Die Organisation untersuchte hierfür alle Zulassungs-Anträge, welche in den vergangenen zwanzig Jahren eingereicht wurden, sowie die erteilten Patente. BAYER besitzt demnach 206 der insgesamt rund 2.000 Patente, die in Europa auf transgene Pflanzen erteilt wurden. Damit liegt das Unternehmen auf Platz eins, noch vor PIONEER (179), BASF (144), SYNGENTA (135) und MONSANTO (119).
detaillierte Liste der BAYER-Patente
zunehmende Konzentration
BAYER CROPSCIENCE, eine hundertprozentige Tochter der BAYER AG, ist mit einem Weltmarktanteil von rund 20 Prozent der zweitgrößte Pestizidhersteller der Welt (nach SYNGENTA). Bei Saatgut liegt die Firma aus dem rheinischen Monheim mit einem Anteil von 3 Prozent auf dem siebten Rang.
Im Agro-Markt ist seit Jahrzehnten ein starker Konzentrationsprozess zu beobachten. Bei Pestiziden und Saatgut besitzen die zehn größten Unternehmen einen Marktanteil von über 70 Prozent. Ziel des Oligopols ist es, den Markt unter sich aufzuteilen, Preise und politische Rahmenbedingungen zu diktieren und letztlich die Ernährungsgrundlagen der Menschheit zu kontrollieren – und damit die Geschicke des ganzen Planeten. „Wer das Saatgut kontrolliert, beherrscht die Welt“, hat der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger einmal festgehalten. Und Patente auf Pflanzen und Tiere sind dabei ein zentrales Hilfsmittel.
Dabei hatte schon im Jahr 2008 der von den Vereinten Nationen und der Weltbank initiierte Weltagrarbericht davor gewarnt, dass Forschung und Wissensverbreitung durch die zunehmende Patentierung eingeschränkt werden. Gerade in Entwicklungsländern würden dadurch lokal angepasste Praktiken des Ackerbaus verhindert, die zu Ernährungssicherheit und ökonomischer Nachhaltigkeit beitragen.
Einsatz von Herbiziden steigt
Der weltweit größte Anbieter von genmanipuliertem Saatgut ist – mit Abstand – die Firma MONSANTO. Das Unternehmen hat Dutzende von kleineren Saatgutproduzenten und Züchtern aufgekauft und erreicht dadurch einen Anteil am Saatgutmarkt von rund 27 Prozent. Auch beim Verkauf von Herbiziden liegt die US-Firma vorne: 95 Prozent des gentechnisch veränderten Sojas und 75 Prozent von Genpflanzen wie Mais oder Baumwolle sind gegen das von MONSANTO entwickelte Pestizid Glyphosat (Handelsname: ROUNDUP) immun.
Studien weisen darauf hin, dass der Einsatz dieses Mittels sowohl Geburtsschäden als auch Krebs verursachen kann. Die Zahl der Vergiftungsfälle von LandwirtInnen und LandarbeiterInnen wird immer größer, besonders in Lateinamerika. Glyphosat findet sich mittlerweile sogar im Urin europäischer Großstadtbewohner, die weitab von Feldern und Gewächshäusern leben. Anders als von der Industrie stets versprochen, hat der Pestizidverbrauch durch den Einsatz genmanipulierter Pflanzen keineswegs ab-, sondern stetig zugenommen. MONSANTO steht daher völlig zu Recht im Zentrum der öffentlichen Kritik.
Für die deutschen Firmen Bayer und BASF ist diese Situation komfortabel, da sie kaum einer öffentlichen Diskussion ausgesetzt sind. Dabei ist das BAYER-Pestizid Glufosinat, das chemisch mit Glyphosat verwandt ist und ebenfalls in Kombination mit herbizid-tolerantem Saatgut angeboten wird, nicht weniger gefährlich – im Gegenteil: Der Wirkstoff kann Missbildungen bei Föten verursachen und ist deshalb als „reproduktionstoxisch“ klassifiziert. In der EU muss das Herbizid bis spätestens 2017 vom Markt genommen werden. Dies hinderte den BAYER-Konzern aber nicht, Mitte Mai den Bau einer riesigen neuen Glufosinat-Fabrik in den USA anzukündigen. Der Konzern will damit in die Lücke vorstoßen, die sich durch die zunehmende Unwirksamkeit von Glyphosat gegen Wildkräuter aufgetan hat.
BAYER auf der Überholspur
Im Bereich der „grünen Gentechnik“ hat BAYER beständig aufgeholt. Der Konzern forscht seit den 1980er Jahren an genmanipulierten Pflanzen und stieg im Jahr 2001 durch die Übernahme der Firma AVENTIS CROPSCIENCE, die ihrerseits aus den Gentechnik-Sparten von SCHERING, RHONE POULENC und HOECHST hervorgegangen war, in die erste Liga auf. Danach folgte der Zukauf von Unternehmen wie PLANT GENETICS SYSTEMS, PLANTTEC, PROSOY GENETICS und ATHENIX. Hinzu kamen Kooperationsverträge mit Biotech-Firmen wie EVOGENE (Reisforschung), MERTEC (Soja) und FUTURAGENE (Baumwolle) sowie mit Forschungs-Instituten wie der „Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation“ (Weizen) oder dem brasilianischen „Zentrum für Zuckerrohr-Technologie“.
Den größten Umsatz macht BAYER aktuell mit Baumwoll-Saatgut. Hierauf hält der Konzern allein 18 Patente. Zudem bietet BAYER genmanipulierten Raps, Zuckerrüben, Mais und Soja an. Für genmanipulierten Reis der Sorte LL62 hat der Konzern bereits vor zehn Jahren einen Antrag auf eine EU-Importzulassung gestellt.
206 Gen-Patente von BAYER
Die aktuelle Recherche zeigt, dass BAYER in den vergangenen zwanzig Jahren insgesamt 771 Anträge am Europäischen Patentamt (EPA) eingereicht hat. In 206 Fällen wurde diesen stattgegeben (siehe Tabelle). In den vergangenen drei Jahren lagen bei der Zahl der erteilten Patente gleich zwei deutsche Firmen vorne: BASF (69) und BAYER (56).
Allein 26 Patente besitzt BAYER auf Stärke und Zucker. Mittels gen-veränderter Pflanzen soll in großem Unfang Stärke für die Industrie sowie Zucker für Spezialanwendungen produziert werden.
23 BAYER-Patente beziehen sich auf Resistenzen gegen Herbizide. Die Patente zur Glufosinat-Resistenz stammen zum Teil aus den 1980er Jahren und sind mittlerweile abgelaufen. Um die Laufzeit zu verlängern, hat BAYER bei wichtigen Pflanzen wie Soja und Baumwolle kleine Veränderungen am Erbgut vorgenommen und darauf neue Patente beantragt.
Da auch das Patent des MONSANTO-Präparats Glyphosat abgelaufen ist, produziert BAYER diesen Wirkstoff inzwischen selbst und hält hierzu zehn eigene Patente. Zum Beispiel beschreibt das Patent mit der Nummer EP 1994158 ein Verfahren zur Glyphosat-Resistenz, mit dem BAYER Ansprüche auf gleich 23 Pflanzenarten anmeldet, darunter Mais, Weizen, Gerste, Soja und Reis, verschiedene Bäume und sogar Gras. Das bis zum Jahr 2027 gültige Patent stammt ursprünglich von der US-Firma ATHENIX, die im Jahr 2009 von BAYER übernommen wurde.
GREENPEACE-Landwirtschaftsexperte Dr. Dirk Zimmermann kritisiert das Forschungsprogramm des Unternehmens scharf: „Die Patent-Politik von Bayer offenbart, dass der Konzern nichts aus den verheerenden Erfahrungen mit Glyphosat-resistentem Saatgut gelernt hat. Anstatt das Praxis-Versagen herbizidresistenter Pflanzen anzuerkennen, werden weiterhin Scheinlösungen auf Kosten von Umwelt und Landwirten geplant. Mittelfristig werden auch diese scheitern und im besten Fall nur den finanziellen Interessen von Konzern und Aktionären gedient haben.“
Testverfahren monopolisiert
Im August 2011 erhielt BAYER eine EU-Importzulassung für glufosinat-resistentes Soja der Sorte A5547-127, auch bekannt als „BASTA-Bohne“ (benannt nach dem Glufosinat-Handelsnamen BASTA). Diese Art soll vor allem in Südamerika angebaut und als Tierfutter nach Europa importiert werden.
Nur wenige Monate zuvor hatte der Konzern auf die BASTA-Bohne ein bis 2026 geltendes Patent erhalten. Dieses verleiht dem Konzern zudem noch das exklusive Recht, Saatgut auf Kontaminationen mit dieser gentechnisch veränderten Soja-Sorte zu testen, was dazu dienen könnte, unabhängige Kontrollen zu verhindern.
Eine gegen Glufosinat resistente Pflanze war auch für den bislang größten Kontaminations-Skandal der Gentech-Geschichte verantwortlich: Im Jahr 2006 war genveränderter Reis der Sorte LL601 weltweit in Supermarkt-Packungen aufgetaucht, obwohl hierfür keinerlei Zulassung vorlag. Rund 30 Prozent der US-amerikanischen Ernte war verunreinigt, die EU und Japan stoppten alle Reis-Importe aus Nordamerika. Im vergangenen Jahr musste BAYER die betroffenen Landwirte mit über 900 Millionen US-Dollar entschädigen. Und bis heute ist LL601 nicht aus der Welt und wird öfters in konventionellem Handelsreis nachgewiesen.
Terminator-Patente
Seit Jahrtausenden erzeugen LandwirtInnen eigenes Saatgut. Hierdurch züchteten sie Pflanzen-Sorten, die optimal an die lokalen Gegebenheiten angepasst sind. Den großen Saatgut-Herstellern ist diese Eigenproduktion naturgemäß ein Dorn im Auge. Der perfideste Schachzug, den freien Nachbau von Saatgut zu unterminieren, unternahmen die Agro-Riesen mit der so genannten Terminator-Technologie: mit Hilfe eines gentechnischen Eingriffs werden die Pflanzen nach einer einmaligen Aussaat steril. Die Landwirte sind so gezwungen, jedes Jahr neues Saatgut zu kaufen.
Alle großen Agrokonzerne forschen an Terminator-Saatgut und haben hierzu Patente angemeldet. Durch die Übernahme der HOECHST SCHERING AGREVO GmbH (später Aventis) besitzt auch BAYER eine Reihe von Terminator-Patenten. Diese tragen Titel wie „Verfahren zur Herstellung weiblich steriler Pflanzen“ oder „Pflanzen mit modifizierten Blüten“.
Zwar kommen Terminator-Pflanzen bislang nicht zum Einsatz, da seit dem Jahr 2000 im Rahmen der UN-Konvention zur Biologischen Vielfalt ein Moratorium besteht. Dieses ist jedoch rechtlich nicht bindend. Wiederholt gab es Versuche, das Verbot aufzuweichen. Ein solcher Schritt wäre eine immense Bedrohung für die biologische Vielfalt und für die Ernährungssicherheit von Millionen Menschen, die ausschließlich von der Landwirtschaft leben - vor allem in den „Entwicklungsländern“. Die „Coordination gegen BAYER-Gefahren“ und Umweltinitiativen aus aller Welt fordern daher ein dauerhaftes Verbot der Technik. Auch entsprechende Patente müssen nach Ansicht der Verbände entzogen werden.
Patent-Tausch
Trotz der Vielzahl von Patenten und Kooperationen beruht das Gentechnik-Programm von BAYER im Wesentlichen auf nur zwei Techniken: zum einen herbizid-resistentes Saatgut, das in Kombination mit den Pestiziden Glufosinat oder Glyphosat verkauft wird, zum anderen Pflanzen, die das giftige Bakterium Bacillus thuringiensis (Bt) enthalten und dadurch Insekten abtöten.
Beide Verfahren sind schon seit den 90er Jahren auf dem Markt. Wegen der Gefahren für Mensch und Umwelt müssen Glufosinat und Glyphosat nach Ansicht der Coordination gegen BAYER-Gefahren sofort vom Markt genommen werden. Darüber hinaus sind beide Techniken wegen der zunehmenden Resistenzbildung allenfalls noch ein paar Jahre wirksam und daher kaum zukunftstauglich.
Wegen der zunehmend wirkungslosen Gen-Pflanzen hat BAYER in den vergangenen Jahren zahlreiche Tausch-Abkommen mit anderen Unternehmen geschlossen, unter anderem mit MONSANTO, DUPONT, SYNGENTA und DOW. Die Firmen verwenden nun auch Verfahren der Konkurrenz und bieten Saatgut an, das gegen zwei oder gar drei Herbizide immun ist. So wurde im vergangenen Jahr eine Soja-Sorte vorgestellt, die gegen Glufosinat, Glyphosat und 2,4-D tolerant ist (2,4-D war Teil des Entlaubungsmittels „Agent Orange“). Anfang März kündigten BAYER und SYNGENTA die Markteinführung einer weiteren Soja-Sorte an, die ebenfalls gegen drei Wirkstoffe - Mesotrion, Glufosinat und Isoxaflutol – tolerant ist. Und MONSANTO beantragte eine EU-Importzulassung für SMARTSTAX-Mais, der nicht nur gegen Glufosinat und Glyphosat gewappnet, sondern darüber hinaus noch mit sechs Toxinen des Bacillus thuringiensis gegen den Maiszünsler und andere Insekten bestückt ist.
Patente auf konventionell gezüchtete Pflanzen
Zu dem Problem der Resistenz-Bildungen, das eine Nebenwirkung des Saatgut-Oligopols mit seiner äußerst überschaubaren Produkt-Palette ist, kommen noch politische Schwierigkeiten hinzu. So gelang es BAYER & Co. nicht, die Skepsis der europäischen VerbraucherInnen gegenüber der „Zukunftstechnologie“ zu erschüttern. BASF hat sogar schon resigniert und die ganze Gentech-Forschung in die USA verlegt.
Darüber hinaus haben sich die mit den gentechnischen Eingriffen verbundenen Prophezeiungen nicht erfüllt. Weder wurden die Erträge signifikant gesteigert, noch wurde der Pestizid-Einsatz reduziert. Aus all diesen Gründen setzt BAYER wieder verstärkt auf konventionelle Züchtungsarten, ohne jedoch die Gentechnik abzuschreiben. Da sich die herkömmliche Züchtung aber nur rentiert, wenn der Konzern dafür Rechte auf geistiges Eigentum geltend machen kann, versucht er, auch dafür Patente zu erhalten – mit Erfolg. So erteilte das EPA dem BAYER-Konzern im August 2011 ein bis 2024 gültiges Patent auf die Züchtung von Pflanzen mit einer erhöhten Stress-Resistenz (Patent EP1616013), das im Zusatz auch erbgut-manipulierende Technologien umfasst. Hierdurch erhält BAYER Monopolrechte über wichtige Nutzpflanzen, auch wenn diese nicht einzeln genannt werden (in der Patentschrift heißt es hierzu schlicht „transgene und mutierte Pflanzen“). Unter Stress-Resistenz fallen demnach Trockenheit, hohe Lichtintensität, Hitze oder knappe Nährstoffe.
Rund 100 der 2.000 vom Europäischen Patentamt vergebenen Pflanzenpatente beziehen sich auf solche konventionellen Züchtungen. Gängig ist auch die Praxis, in herkömmlich entwickelte Pflanzen nachträglich eine Genmanipulation mit gleichem Ziel einzufügen, da auf diese Weise leichter ein Patent zu erhalten ist. Mit der Erteilung solcher Patente segnet das EPA dann die Umwidmung gezüchteter Pflanzen in eine „Erfindung“ und die Monopolisierung der genetischen Ressourcen ab.
Damit hat das internationale Patentwesen eine weite Entwicklung durchgemacht. Ursprünglich hatten sowohl das Straßburger Patent-Übereinkommen von 1963 wie auch das 1977 beschlossene Europäische Patent-Übereinkommen Eigentumsansprüche auf „im Wesentlichen biologische Verfahren“ ausgeschlossen. Züchtungen von Tieren oder Pflanzen bzw. ganzen Tierarten und Pflanzen-Sorten galten nicht als schützenswerte Erfindungen, weil Lebensprozesse nicht zur Handelsware verkommen sollten. Nach dieser Lage der Dinge hätte jedoch aus der Gentechnik kaum ein lukrativer Wirtschaftszweig werden können. Also setzten die Lobby-Verbände von BAYER & Co. mittels akrobatischer juristischer Winkelzüge alles daran, die Paragrafen so auszulegen oder zu verändern, dass sie ihnen „GENiale Geschäfte“ ermöglichten. Der Durchbruch gelang ihnen 1980, als das US-Patentamt ein Bakterium urheberrechtlich schützte. Ein Bakterium sei einer unbelebten chemischen Verbindung weit ähnlicher als Pferden, Bienen oder Himbeeren, argumentierte der Oberste Gerichtshof. Danach ging es zügig weiter. So gelang es der Harvard University 1988, sich die so genannte Krebs-Maus als geistiges Eigentum deklarieren zu lassen und schloss daraufhin sogleich einen Lizenz-Vertrag mit DUPONT. Und heutzutage gewährt das EPA sogar schon Schutzrechte auf konventionell gezüchtete Pflanzen.
Aber es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer. Auf seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschloss der Deutsche Bundestag eine Änderung des deutschen Patentgesetzes. Es schließt nunmehr das Recht auf geistiges Eigentum an konventionell gezüchtete Tiere und Pflanzen aus. Die Novelle lässt zwar einige Hintertürchen offen, und tangiert auch die Praxis des Europäischen Patentamts nicht. Christoph Then von KEINE PATENTE AUF SAATGUT! begrüßt sie dennoch: „Von der heutigen Abstimmung geht ein wichtiges Signal aus. Es herrscht bei allen Parteien im Bundestag Einigkeit darüber, dass wir dem Zugriff der Konzerne auf unsere Lebensgrundlagen klare Grenzen setzen müssen. Allerdings müssen wir auch in Zukunft über die Formulierung der Gesetze weiter streiten – das gilt sowohl für Deutschland als auch für die europäische Ebene“.
erteilte Patente am Europäischen Patentamt 1980-2012
1. BAYER: 206
2. DUPONT-PIONEER: 179
3. BASF: 144
4. SYNGENTA: 135
5. MONSANTO: 119
6. DOW: 20
Agrogentechnik: Zahl der Patentanträge 1980-2012
1. DUPONT-PIONEER: 1.454
2. BASF: 1.273
3. SYNGENTA: 961
4. MONSANTO: 811
5. BAYER: 771
6. DOW: 228
„Der Pflanzenschutzdienst berät heute in allen Fragen des Pflanzenschutzes und der Pflanzenschutztechnik. Schwerpunkte sind der integrierte und der biologische Pflanzenschutz. Hierdurch leisten wir einen aktiven Beitrag zum Schutz der Verbraucher und der Umwelt. Auf Grund des hohen Qualitätsstandards unserer Arbeit wurden uns die Zertifikate „Gute Laborpraxis„ und „Gute Experimentelle Praxis“ zuerkannt“ – so die eigene Aussage dieses Dienstes.
Die LWK NRW stellt auf der Website landwirtschaftskammer.de Informationen bereit, wie etwa die „Pflanzenschutzthemen der letzten Monate“ im Bereich Gemüsebau. Eine Stichprobe für März / April 2012 ergab einen eindeutigen Schwerpunkt der chemischen Bekämpfung von Schädlingen und Pilzerkrankungen, obwohl der integrierte Anbau eine Brücke von konventionell zu bio ist. Berücksichtigt werden muss hierbei, dass die Landwirtschaftskammern grundsätzlich Hinweise zur fachgerechten Anwendung chemischer Mittel geben müssen. Ihre Informationen suggerieren jedoch in den hier genannten Fällen, dass es gar keinen biologischen Weg gibt. Dieser ist für alle im Folgenden erwähnten Schädlinge und Krankheiten dokumentiert, andernfalls hätte der Ökolandbau schon längst einpacken müssen; zu seinen Methoden zählen Erhalt der Bodenfruchtbarkeit als Basis für gesunde, widerstandsfähige Pflanzen, oder Mischkultur von Pflanzen, die sich erfahrungsgemäß gegenseitig schützen.
Die Landwirtschaftskammer NRW nennt u. a. in den Pflanzenschutzthemen April 2012 das Präparat Floramite 240 SC gegen Spinnmilben, ein Mittel von der Firma Spiess-Urania Chemicals GmbH in Hamburg, Gesellschafter ist Mitsui & Co. Deutschland. Nur wenige Absätze weiter steht im Informationspapier, laut Mitteilung der Firma BASF sei das Insektizid „Perfektion“ in Kohlrabi und Schnittlauch genehmigt (gegen die Kleine Kohlfliege, Lauchminier- und Zwiebelfliege). Es geht im Text weiter mit „Karate Zeon“ gegen beißende und saugende Insekten an diversen Gemüsesorten und Kräutern. Die Suche nach „Karate Zeon“ führt direkt zur Website von Syngenta. Im März-Papier von 2012 werden kurz Bedingungen angesprochen, die Pilzerkrankungen wie Grauschimmel fördern, dann folgen Produktnamen, hier ohne Hinweis auf die Herstellerfirma, wie Rovral WG (BASF), Signum (BASF), Teldor (BAYER), sowie gegen weitere Erkrankungen Score (Syngenta) oder Basagran (BASF).
Dass Produktnamen immer wieder zu denselben Konzernen führen, hängt natürlich mit Marktstrukturen zusammen. Das nächste Beispiel zeigt aber, dass Ausgewogenheit an Informationen bewusst versäumt wird. Ein Artikel desselben Pflanzenschutzdienstes, „Schädlinge an Kübelpflanzen“, bezieht sich zwar speziell auf Zierpflanzen, zählt aber Schädlingsarten auf, die man im Gemüse- und Kräuteranbau ebenfalls kennt. Die LWK informiert hier nicht näher über die Schädlinge, auch nicht über Bedingungen, die sie fördern, Jahreszeiten, in denen mit ihnen zu rechnen ist, Pflanzenteile, an denen sie „angreifen“. Der Pflanzenschutzdienst empfiehlt Kübelpflanzen-BesitzerInnen beim Auftreten bestimmter Schädlinge (diverse Lausarten, Spinnmilben, Weiße Fliege) ausschließlich die Verwendung von Agrochemie. Genannt werden im Artikel folgende Firmen: Bayer 6x, davon 2x mit demselben Produkt, Compo 3x, Celaflor 2x und schließlich ein Produkt von Cheminova. Bayer Garten Zierpflanzenspray Lizetan, Bayer Garten Bio-Schädlingsfrei Neem, Bayer Garten Combistäbchen Lizetan Neu, Bayer Garten Spinnmilbenspray Plus… Andere Firmen, die biologische Pflanzenschutzmittel (auch auf Neem-Basis!) herstellen, wurden gar nicht genannt, obwohl es sie gibt.
Mails mit kritischem Hinweis auf diese Häufung des Namens BAYER, geschrieben an die LWK selbst sowie an den Verbraucherlotsen (des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Bonn), zeigten folgende Wirkung: „Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat bezüglich der geschilderten Vorgänge keinerlei Zuständigkeiten oder Befugnisse.“ (Antwort aus Bonn vom Verbraucherlotsen im Bundesministerium). Zur Aufsicht über die LWK NRW sagt das Landwirtschaftskammergesetz §23 (Fn 14) 1: „Die Landwirtschaftskammer unterliegt der Aufsicht des Ministeriums (Aufsichtsbehörde).“ Es wurde in der Antwortmail keine Zuständigkeit genannt - und ein Bundesministerium für Landwirtschaft steht schließlich über dem Landesministerium für Landwirtschaft, könnte also als Vorgesetzter durchaus aktiv werden.
Eine Antwortmail aus Düsseldorf (Referat II A 5 „Pflanzenproduktion, Gartenbau“ im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen) wies darauf hin, es seien in dem Artikel nicht nur Präparate der Firma BAYER genannt worden, sondern „Bayer, Celaflor, Cheminova und Compo“. Dazu ist jedoch anzumerken, dass Scott’s Celaflor Monsanto’s Roundup für den Hobbygarten vertreibt, Cheminova Vereinbarungen mit Bayer CropScience geschlossen bzw. Produkte übernommen hat, ebenso von Syngenta, und seit 2000 gibt es laut Unternehmens-Historie ein Joint Venture mit Dow AgroScience. Und Compo? Kooperiert „seit 2005 intensiv mit Syngenta“.
Der Referatsleiter wies den Vorwurf der Werbung für BAYER zurück und erklärte unter anderem, die „vermissten biologischen Maßnahmen“ würden „nach Erfahrung des Pflanzenschutzdienstes“ nicht ausreichen, das „zweimal erwähnte Produkt Bayer Garten Bio-Schädlingsfrei Neem“ gehöre zu den biologischen Präparaten. Die Mail befasste sich dann mit den in der kritischen Rückfrage erwähnten Kräuterjauchen, diese seien kein Pflanzenschutzmittel im rechtlichen Sinne, ihr Wirkungsgrad sei häufig viel zu gering, Wirkung auf Nützlinge sei nicht bekannt, und „phytotoxische Eigenschaften“ könnten nicht ausgeschlossen werden. „Als Pflanzenschutzmittel zugelassene Präparate sind dagegen umfassend geprüft worden.“
Die Antwort aus dem Ministerium in Düsseldorf legt damit nahe, eine aus nicht zulassungspflichtigen Bestandteilen Wasser und Kräutern (z. B. Brennnesseln) durch simples Stehenlassen hergestellte Jauche könne ernste Schäden hervorrufen, und sei nicht hinreichend geprüft (s. dazu Fachliteratur zum biologischen Anbau). Es folgt in der Mail ein juristischer Vermerk, im Haus- und Kleingarten dürften nur zugelassene und gekennzeichnete Pflanzenschutzmittel angewendet werden, die eigene Herstellung sei nicht gestattet.
Dass hier versucht wird, Unsicherheit zu bewirken und auch mittels leiser Drohung die Anwendung biologischer Mittel als illegal hinzustellen, sah das Ministerium nicht so. Eine „leise Drohung“ könne man in der Wiedergabe der Rechtslage nicht erkennen, teilte es dazu schriftlich per Post mit.
Was die LWK NRW so nachdrücklich an chemischen Hilfsmitteln empfiehlt, ist im Ökolandbau verboten. Was nun? Die „Richtlinien des ECOVIN Bundesverbandes“ (d. h. Weinbau), initiiert „im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer Landbau“ legen die Jauchen unter der Kategorie Pflanzenpräparate ab. Die Mitarbeiter der LWK mögen sich an Spitzfindigkeiten - Schutzmittel oder Stärkungsmittel - festgehalten haben. In der Fachliteratur zum biologischen Anbau finden sich stets Hinweise zu Jauchen, Auszügen, Tees und Brühen, verwendet als Dünger, Pflanzenstärkungsmittel, Spritzmittel (auch gegen Blattläuse) und sie helfen, wie z. B. (Acker-) Schachtelhalm gegen Pilzerkrankungen. Das Pflanzenschutzamt Berlin gibt übrigens ein Merkblatt zu solchen alternativen Pflanzenschutzmethoden für HobbygärtnerInnen heraus. Der NABU informiert ebenfalls.
Nach eigenen Angaben soll die LWK NRW laut Gesetz beraten, aufklären und schulen.
30. September 2013, von Sylvia Schmidt
Presse Info vom 25. September 2013
Im Brunsbütteler BAYER-Werk kam es gestern zu einem schweren Zwischenfall: zwei Mitarbeiter wurden bewusstlos aufgefunden, drei weitere wurden durch das Einatmen giftiger Gase verletzt. Ein Betroffener schwebte in Lebensgefahr und musste reanimiert werden. Die Polizei gab zunächst an, dass es sich bei dem Giftstoff wahrscheinlich um Kohlenmonoxid (CO) handele. Dies wurde heute „definitiv bestätigt“.
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) fordert eine Untersuchung des Unfalls und eine umfassende Information der Öffentlichkeit (auf der website des Werks findet sich auch 30 Stunden nach dem Gas-Austritt keinerlei Hinweis). Weiterhin fordert die CBG, dass der Unfall Konsequenzen für die CO-Pipeline zwischen den BAYER-Werken Dormagen und Krefeld haben muss. Der Unfall in Brunsbüttel auf gut gesichertem Werksgelände mit gut geschultem Personal zeigt, welch tödliches und unbeherrschbares Risiko Kohlenmonoxid in sich birgt.
Philipp Mimkes vom Vorstand der CBG: „Giftige Gase wie Chlor, Kohlenmonoxid oder Phosgen dürfen allenfalls in gut gesicherten Werken verarbeitet werden. Ein Transport solcher hochgefährlichen Chemikalien verbietet sich - zumal durch dicht besiedelte Wohngebiete. Es wäre unverantwortlich, die Bevölkerung diesem unnötigen Risiko auszusetzen“.
Dieter Donner, Pressekoordinator der Stopp Bayer-CO-Pipeline-Initiativen, ergänzt: „Das Unglück zeigt einmal mehr, wie gefährlich Kohlenmonoxid für die Menschen ist. Und zum zweiten zeigt es, dass Lecks an CO-Leitungen vorkommen und zuerst den Menschen Schaden zufügen, ehe diese Lecks erkannt werden.“
Durch einen Vollbruch der Kohlenmonoxid-Pipeline wären laut einem Gutachten der Stadt Ratingen mehr als 100.000 AnwohnerInnen gefährdet. Auch Polizei, Feuerwehr und medizinische Dienste haben erklärt, dass sie die Sicherheit der Bevölkerung bei einem Unfall nicht gewährleisten können. Sämtliche betroffenen Kommunen lehnen eine Inbetriebnahme daher ab, mehr als 120.000 Menschen haben Protesterklärungen gegen das Projekt unterschrieben. Gegen das laufende Planänderungsverfahren richten sich zudem 24.000 Einwendungen, die im November bei einem Erörterungstermin in der Essener Grugahalle diskutiert werden sollen.
Schon in der Vergangenheit war es bei BAYER mehrfach zu CO-Unfällen gekommen, so im Jahr 2009, als im US-Werk Baytown Kohlenmonoxid und Monochlorbenzol austraten, oder im Jahr 2006, als die Krefelder CO-Anlage brannte und die Produktion fünf Wochen lang ruhen musste.
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren fordert den BAYER-Konzern seit vielen Jahren auf, zum Schutz von MitarbeiterInnen und AnwohnerInnen gefahrlosere Verfahren zu entwickeln. Beispielsweise kann der Kunststoff Polycarbonat ohne den Einsatz des Ultra-Gifts Phosgen produziert werden. Anders als die Konkurrenz setzt BAYER solche ungefährlicheren Verfahren jedoch noch nicht ein.
PS vom 26.9.: Der WDR berichtet, „nach dem Unfall im Bayer-Werk Brunsbüttel fordern Umweltaktivisten jetzt Konsequenzen für die Bayer-Gas-Pipeline zwischen Dormagen und Krefeld. Nach Ansicht der Pipeline-Gegner verbiete sich ein Transport des giftigen Gases. Bayer hat diese Forderung zurück gewiesen. Die Anlage in Brunsbüttel sei mit der Pipeline im Rheinland technisch nicht vergleichbar“.
Die Aussage des Konzerns lenkt vom Thema ab: natürlich ist eine Pipeline etwas anderes als eine Produktionsanlage für Kunststoff. Aber die Chemikalie ist dieselbe! Und wenn deren Handhabung schon mit gut ausgebildeten Mitarbeitern und innerhalb eines stark gesicherten Werks hochgefährlich ist (wie der aktuelle Zwischenfall zeigt), dann ist die Verlagerung dieser Risikoquelle in dicht besiedelte Gebiete nicht zu verantworten.
PPS: die Rheinische Post schreibt: „dass ein Betroffener in Lebensgefahr war und reanimiert werden musste, bestätigte sich laut Heise aber nicht“. Dies verwundert etwas. In der Meldung der Polizei hieß es „Der 56jährige war nicht ansprechbar und musste vor Ort erfolgreich reanimiert werden“. Der ermittelnde Kripo-Beamte bestätigte uns telefonisch, dass zwei Mitarbeiter nur gerettet werden konnten, weil sie „fünf vor zwölf gefunden wurden“. Die Öffentlichkeit hat in jedem Fall Anspruch auf eine umfassende Information!
weitere Informationen zur CO-Pipeline
Aufstellung „Störfälle bei BAYER“
Presse Info vom 24. September 2013
Ein Jahrzehnt lang wurde der Wirkstoff Alemtuzumab unter dem Handelsnamen MabCampath zur Behandlung von Leukämie eingesetzt. Um den Umsatz zu erhöhen, wurde die Indikation jedoch im vergangenen Jahr aufgegeben. Das Medikament erhielt nun unter dem Namen Lemtrada eine Zulassung zur MS-Therapie und soll zu einem weit höheren Preis verkauft werden. Die Leukämie-Patienten werden im Regen stehen gelassen.
Die Firma GENZYME, eine Tochter von SANOFI, erhielt in der vergangenen Woche für den monoklonalen Antikörper Alemtuzumab eine Zulassung zur Behandlung von Multipler Sklerose. Die Firma BAYER war an der Entwicklung des Präparats beteiligt und partizipiert an den Erlösen. Im letzten Jahr war das Medikament zur Krebsbehandlung vom Markt genommen worden, obwohl es für einige Formen der Leukämie die beste Behandlungsmöglichkeit darstellt.
Hintergrund des zunächst unverständlich wirkenden Schachzugs: Nur wenige hundert PatientInnen in Deutschland benötigen das Leukämie-Präparat, die Einnahmen waren dadurch begrenzt. Der Markt für MS-Medikamente hingegen ist weitaus interessanter: allein in Deutschland gibt es rund 130.000 Betroffene, weltweit sind es 2,5 Millionen. MS-PatientInnen leben zudem länger und müssen daher länger behandelt werden.
Für MS wird jedoch eine viel geringere Dosis benötigt, jährlich zwischen 30 und 60 mg. Zur Behandlung von Leukämie hingegen wurden in einem Therapiezyklus 1.100 mg verabreicht. Da ein Wirkstoff für unterschiedliche Anwendungen nicht unterschiedliche Preise haben darf, standen die Konzerne vor einem Problem: zu dem früheren Preis versprach die MS-Therapie mit Alemtuzumab keine großen Umsätze. Orientiert sich der Preis hingegen an den üblichen Behandlungskosten von MS, würde er sich für Leukämie-Patienten extrem erhöhen, was zu Kritik von Betroffenen und Krankenkassen führen würde. Um dem Dilemma zu entgehen, gaben SANOFI und BAYER die wenig lukrative Indikation „Leukämie“ lieber ganz auf.
Philipp Mimkes von der Coordination gegen BAYER-Gefahren kritisiert: „Wieder einmal wird deutlich, dass für BAYER, SANOFI & Co. allein der Profit zählt. Das Patientenwohl ist dabei nachrangig. Nebenbei zeigt sich, dass die Preisbildung von Medikamenten nichts mit den Entwicklungskosten zu tun hat: ein und dasselbe Medikament kann vollkommen unterschiedliche Preise haben - je nachdem, was sich am Markt durchsetzen lässt.“
Scharfe Kritik hatte bereits im vergangenen Jahr die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft geäußert: „Aus Sicht der AkdÄ übernimmt ein pharmazeutischer Unternehmer mit der Zulassung eines Arzneimittels auch die Verantwortung für eine dauerhaft sichere und unkomplizierte Versorgung der betroffenen Patienten. Mit der freiwilligen Marktrücknahme und dem geplanten „Indikations-Hopping“ entzieht sich der pharmazeutische Unternehmer seiner Verantwortung auf inakzeptable Weise. Um ein solches Vorgehen zukünftig zu verhindern, müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen entsprechend angepasst werden.“ Torsten Hoppe-Tichy, Präsident des Bundesverbands Deutscher Krankenhausapotheker ergänzte: „Der Stakeholder-Value wird hier in bisher nicht dagewesener Weise vor das Patientenwohl gesetzt.“
Die SCHERING AG, die später in den BAYER-Konzern aufging, hatte sich an der Entwicklung von Alemtuzumab beteiligt. Dank der Lizenzabkommen mit GENZYME profitiert BAYER bis heute von der Vermarktung. Im jüngsten Geschäftsbericht hieß es hierzu: „BAYER beteiligt sich weiterhin an der gemeinsamen Entwicklung und hat bei erfolgreichem Abschluss die Möglichkeit einer weltweiten Co-Promotion sowie Anspruch auf Lizenzgebühren und umsatzabhängige Meilensteinzahlungen.“
24. September 2013, Polizeidirektion Itzehoe
Zwei Arbeiter auf dem Gelände der Bayer AG sind am heutigen Tage durch das Einatmen von Gas zusammen gebrochen, einer war nicht mehr ansprechbar und musste reanimiert werden.
Am 24.09. gegen 08.26 Uhr wurde ein Arbeitunfall auf dem Bayer-Gelände in der Fährstraße mitgeteilt. Festgestellt durch die entsandten Beamten wurde, dass zu dem Zeitpunkt ein 56jähriger Arbeiter aus Henstedt-Ulzburg und ein 55jähriger aus Hochdonn arbeiten auf dem Gelände durchgeführt haben und zusammen gebrochen aufgefunden worden sind. Der 56jährige war nicht ansprechbar und musste vor Ort erfolgreich reanimiert werden. Ursache dafür könnte eine Leckage in einem Rohsystem gewesen sein, aus dem dann CO-Gas ausgetreten ist. Genau kann dies aber erst nach weiteren Untersuchungen gesagt werden. Die Personen kamen ins Krankenhaus und die Kripo Brunsbüttel hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Gefahr für die Umwelt bestand nach Aussage der Werkesleitung nicht.
Sachbearbeitung durch Kripo Brunsbüttel, Tel. 04852 / 6024-0
Auflistung Störfälle bei BAYER
Die in Brunsbüttel geplante MDI-Anlage soll einem Sparpaket zum Opfer fallen. Erst im Frühjahr hatte der Erörterungstermin für das umstrittene Projekt stattgefunden. Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) hatte zahlreiche Einwendungen gegen die Anlage eingereicht. Die CBG lehnt den Bau der Fabrik wegen des hohen Ressourcen-Verbrauchs und der massenhaften Verwendung von hochgiftigem Phosgen ab. Der Verzicht auf das Projekt dürfe aber nicht zulasten der Belegschaft dienen, schließlich sei der Konzern weiterhin hochprofitabel.
18. September 2013
Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates bei Bayer, Thomas de Win wirft dem Vorstand nach der Veröffentlichung der geplanten Einsparungen Konzeptionslosigkeit in der Kunststoffsparte vor
Ungewöhnlich harsch fällt die Reaktion des Betriebsrats auf das neue Sparprogramm für Bayer Material Science (BMS) aus. Der Vorstand hat in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses am vorigen Freitag drei Schwerpunkte genannt: Eine neue Anlage für das Kunststoff-Vorprodukt MDI (Methylendiisocyanat) in Brunsbüttel – geplant für 2014 bis 2015 – wird vorerst nicht gebaut. Thomas de Win, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates bei Bayer, hält das für „nicht akzeptabel“.
Fast noch mehr wurmt ihn, dass der Vorstand noch einmal das Forschungsbudget bei BMS zusammenstreichen will. „Dies kann aus Sicht des Betriebsrates die Perspektive eines Unternehmens grundsätzlich in Frage stellen“, lautet seine Kritik. Es könne nicht angehen, das Forschungsbudget „einer rein wirtschaftlichen Betrachtung zu unterwerfen“. Das sei vom Vorstand „kurzfristig gedacht“. Zudem würden Zusagen an die Beschäftigten in der Forschung „nicht eingehalten“.
100 Chempark-Jobs in Gefahr
Zu dem Sparprogramm, dessen Bedeutung Vorstandschef Marijn Dekkers am Montagabend noch tief gehängt hatte, gehört Stellenabbau. Weltweit sollen bis 2017 rund 700 Jobs gestrichen werden, etwa 180 davon in Deutschland, rund die Hälfte davon wiederum in Leverkusen. De Win kündigt an, um jeden Job zu kämpfen. Am Montag sei es in einer Betriebsversammlung mit rund 1000 Kollegen hoch her gegangen.
Im Forum der oppositionellen Basisbetriebsräte tauchte nach der Versammlung ein Fragenkatalog auf. Unter anderem wollen die Beschäftigten von BMS-Vorstandschef Patrick Thomas wissen: „Was ist am Abbau von 180 Arbeitsplätzen innovativ? Wie entstehen neue Innovationen ohne Mitarbeiter? Wie wird langfristige Forschung und Entwicklung trotz dramatischer Budgetkürzung sichergestellt? Mit welchen Geschäftsfeldern wird es BMS in fünf Jahren noch geben?“
Testbiotech, 17. September 2013
Testbiotech veröffentlicht heute eine globale Übersicht über Fälle von unkontrollierter Ausbreitung von gentechnisch verändertem Raps. Betroffen sind Kanada, die USA, Japan, Australien und auch Europa. In vielen Fällen hat sich das Erbgut von transgenem Raps weit über die Äcker hinaus in der Umwelt verbreitet. In einigen Fällen finden sich die DNA-Konstrukte auch in Populationen verwandter wildwachsender Arten. Zudem sind neue Kombinationen von gentechnisch verändertem Erbgut entstanden, die nicht auf Risiken untersucht oder für Freisetzungen zugelassen wurden. Anlass der Veröffentlichung ist eine Konferenz (ABIC) im kanadischen Calgary, bei der sich die internationale Agro-Gentechnik-Industrie trifft.
„Kanada ist eines der Länder, in denen gentechnisch veränderter Raps in großem Stil angebaut wird. Dass die Gentechnik-Pflanzen sich dort unkontrolliert verbreiten, weiß man schon seit etwa zehn Jahren. Aber bisher wurden keine Gegenmaßnahmen ergriffen“, sagt Christoph Then von Testbiotech. „Wir sehen einen gravierenden Mangel an Problembewusstsein, vor allem bei der Industrie.“
Die Folgen einer räumlich und zeitlich nicht begrenzten Ausbreitung von gentechnisch veränderten Pflanzen lassen sich nicht abschätzen. Für evolutionäre Zeiträume können keine ausreichend verlässliche Vorhersagen getroffen werden. Auch können veränderte Umweltbedingungen wie der Klimawandel zu unerwarteten Wechselwirkungen zwischen den Pflanzen und der biologischen Vielfalt führen. Zeigen sich negative Auswirkungen, ist es möglicherweise schon zu spät für Gegenmaßnahmen: Die Pflanzen lassen sich kaum mehr aus der Umwelt zurückholen.
Wie schwierig es ist, diese Pflanzen wieder aus der Umwelt zu entfernen, zeigt das Beispiel der EU. Obwohl hier gentechnisch veränderter Raps nie großflächig angebaut wurde, finden sich immer wieder Verunreinigungen der Ernte. Ursache ist transgener Raps der Firma Bayer, der 1996 zur Saatgutproduktion zugelassen wurde und dessen Marktzulassung 2007 erloschen ist. Die EU-Kommission erlaubte in diesem Fall für einen Zeitraum von fünf Jahren Verunreinigungen mit dem Raps. Doch Ende 2012 musste diese Regelung um weitere fünf Jahre verlängert werden, weil entsprechende Kontaminationen immer noch ein Problem sind.
Testbiotech fordert internationale Regelungen, die das Vorsorgeprinzip stärken. Eine Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen müsse insbesondere dann ausgeschlossen werden, wenn deren Rückholbarkeit nicht gewährleistet ist.
Studie: http://www.testbiotech.de/sites/default/files/TBT%20Transgene%20Escape_Raps_0.pdf
17. September 2013
Per Pipeline will der Leverkusener BAYER-Konzern hochgiftiges Kohlenmonoxid von Dormagen nach Krefeld leiten. Mitten durch dichtbesiedelte Gebiete. Dank des erbitterten Widerstands der Bevölkerung und massiver Proteste der Kommunalpolitik konnte die Inbetriebnahme bislang verhindert werden. Im November werden 24.000 Einwendungen gegen das Projekt verhandelt.
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) protestiert weiter gegen die Kohlenmonoxid-Leitung zwischen den BAYER-Werken Dormagen und Krefeld. Die hohen Risiken für die Bevölkerung lassen sich nicht rechtfertigen. Ein Gutachten der Stadt Ratingen kam zu dem Ergebnis, dass durch einen Bruch der Pipeline mehr als 100.000 AnwohnerInnen gefährdet wären. Denkbare Beschädigungen könnten durch Bauarbeiten, Flugzeugabstürze, Erdbeben oder auch terroristische Anschläge erfolgen. „Wenn hier etwas passiert, ist die halbe Stadt platt", kommentierte ein Feuerwehrmann in Hilden. Der ehemalige Monheimer Bürgermeister sprach gar von einem „Todesstreifen“ entlang der Leitung.
Milliarden-Profite
Trotz allen Widerstands hält BAYER an der CO-Pipeline fest. Dabei gilt seit über einhundert Jahren das Prinzip, wonach hochgefährliche Stoffe dort hergestellt werden müssen, wo sie in der Produktion benötigt werden. Die CO-Pipeline soll nun der „Eisbrecher“ sein. Wenn sie in Betrieb geht, werden unweigerlich weitere gefährliche Pipelines folgen. Damit bekommt die Allgemeinheit die Kosten und Risiken der Gefahrenabwehr aufgebürdet. Für BAYER und die gesamte Gefahrstoff-Industrie winken milliardenschwere Profite.
Entsprechend verlogen sind die Argumente des BAYER-Konzerns. So sollen mit der Pipeline „die Anlagen besser ausgelastet“ werden, was dem Allgemeinwohl diene. Doch lassen sich mit einer besseren Auslastung keine Enteignungen begründen, wie sie die Landesregierung für den Konzern vollstreckt hat.
Anhaltender Widerstand
Seit nunmehr acht Jahren sieht sich BAYER in Nordrhein-Westfalen mit anhaltendem Widerstand konfrontiert:
=> Mehr als 120.000 Menschen haben die Protesterklärung unterschrieben.
=> 24.000 rechtliche Einwendungen wurden jüngst bei der zuständigen Bezirksregierung eingereicht.
=> In zweiter Instanz wurde dem Konzern die Inbetriebnahme des Projektes untersagt.
=> Sämtliche betroffene Kommunen, darunter die Landeshauptstadt Düsseldorf, haben das Vorhaben abgelehnt - über alle politischen Lager hinweg.
=> Die Polizei, die medizinischen Dienste, die Feuerwehren und der Katastrophenschutz haben unmissverständlich erklärt, dass sie die Sicherheit der Bevölkerung bei einem Unfall nicht gewährleisten können.
Auch existiert im BAYER-Werk Dormagen gar kein Kohlenmonoxid-Überschuss, wie vom Konzern ursprünglich behauptet. Vielmehr wird gegenwärtig eine zusätzliche Anlage zur zentralen Verteilung errichtet. Diese könnte auch im Werk Krefeld, dort wo das CO benötigt wird, gebaut werden.
Erörterungstermin im November in Essen
Doch noch ist offen, ob die Todesleitung durchkommt. Anfang November muss sich der Konzern in der Essener Grugahalle den 24.000 Einwendungen stellen (der genaue Termin wurde trotz wiederholter Nachfrage noch nicht mitgeteilt).
Um die Stimmung im Vorfeld der Anhörung zu wenden und die Giftgasleitung zu retten, wollte BAYER den Widerstand spalten und brechen. Mit Einschaltung der IFOK GmbH aus Düsseldorf, einer „international führenden Agentur für Strategie- und Kommunikationsberatung“. Doch die Bürgerinitiativen ließen sich nicht spalten. Auch die Kommunen, durch deren Gebiet die Leitung verläuft, ließen sich nicht in irgendwelche „Dialoge“ einbinden. Die Beschwichtigungskampagne lief ins Leere.
Für uns gilt weiterhin: Die CO-Pipeline muss gestoppt werden! Den Widerstand verstärken! Bitte achten Sie auf die Ankündigungen und kommen Sie im November zum Erörterungstermin in der Essener Grugahalle.
Spenden Sie zur Unterstützung der Kampagne bitte online oder per Überweisung auf das Konto 31 99 991 bei der EthikBank, BLZ 830 944 95
weitere Informationen und unsere online-Unterschriftensammlung finden Sie auf unserer Kampagnenseite
13. September 2013
Chinesische Behörden haben ein Büro des deutschen Pharmakonzerns in der Volksrepublik wegen möglicher Preisabsprachen durchsucht.
Die Durchsuchung habe Ende August stattgefunden. Das Unternehmen kooperiere vollständig mit den Behörden. Zuletzt waren in China mehrere Pharmakonzerne wegen des Verdachts auf Korruption im Gesundheitswesen in die Schlagzeilen geraten. Als erstes waren entsprechende Vorwürfe gegen den britischen Konzern GlaxoSmithKline erhoben worden. Im Visier der Ermittler stehen auch die Pharmakonzerne Novartis aus der Schweiz, Sanofi aus Frankreich sowie Eli Lilly aus den USA.
BAYER hatte sich in der Vergangenheit mehrfach an Kartellen beteiligt und hatte hierfür Strafzahlungen in dreistelliger Millionenhöhe leisten müssen. Die Coordination gegen BAYER-Gefahren stellte Strafanzeige gegen die Verantwortlichen im BAYER-Vorstand.
der SPIEGEL greift in seiner heutigen Ausgabe die Kampagne der CBG zu Nebenwirkungen des Gerinnungshemmers Xarelto auf. Zahlreiche Medien griffen das Thema auf (s.u.). Eine Kurzversion erschien auch auf Spiegel Online.
9. September 2013, Rheinische Post
Das Blutverdünnungsmittel Xarelto ist Bayers großer Hoffnungsträger. Im vergangenen Jahr sorgte es für einen Umsatz von gut 300 Millionen Euro, künftig sollen es zwei Milliarden Euro werden. Doch nun gerät das Medikament immer stärker in die Kritik – wegen möglicher Nebenwirkungen. Die Sorge: Xarelto kann nicht nur das Blut verdünnen, um wie erwünscht Thrombosen (Blutgerinnsel) zu vermeiden, sondern kann auch zu unerwünschten Blutungen führen, die womöglich schwer zu stoppen sind.
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte habe für das Jahr 2012 bereits 750 Verdachtsfälle von unerwünschten Nebenwirkungen bei Xarelto registriert, darunter 58 Todesfälle von Patienten, die das Präparat genommen haben, berichtet der „Spiegel“. In diesem Jahr seien dem Bundesinstitut bereits 968 Verdachtsfälle und 72 Todesfälle von Patienten, die Xarelto genommen haben, gemeldet worden. Das bedeute hochgerechnet auf 2013 eine Verdoppelung.
Bayer erklärte, bei diesen Zahlen handele sich um Spontanmeldungen. „Diese liefern keine ausreichende Grundlage für die Ermittlung von Inzidenzraten (Anzahl von Nebenwirkungen in einem bestimmten Zeitraum bei einer genau definierten Anwendergruppe).“ Patientensicherheit habe höchste Priorität, es gebe entsprechende Verschreibungsleitfäden.
Xarelto ist unter anderem zugelassen, um Patienten beim Einsatz künstlicher Hüft- und Kniegelenke vor Thrombosen zu schützen. Möglicherweise wird es von Ärzten aber auch bei Fällen wie Krampfader-Operationen genutzt. Die pharma-kritische Fachzeitschrift „Arznei-Telegramm“ warnt jedoch, Xarelto als Standard-Präparat einzusetzen: Das Bayer-Mittel habe den Nachteil, dass möglicherweise auftretende Blutungen nicht durch ein Gegenmittel gestoppt werden können. Im schlimmsten Fall drohen damit Patienten, zu verbluten, wenn die Blutungen nicht durch andere (etwa chirurgische) Maßnahmen gestoppt werden können.
Das ist bei anderen, bisher verwendeten Blutverdünnungsmittel anders: Für Macumar etwa gibt es ein Gegenmittel, das Ärzte einsetzen können, falls es zu Blutungen kommt. Zudem ist Macumar, für das der Patentschutz abgelaufen ist, viel günstiger als Xarelto. Allerdings müssen Macumar-Patienten aufwendig auf ihre Dosierung eingestellt werden.
Bereits früher stand Bayer wegen seines enormen Marketings-Aufwands für Xarelto in der Kritik. Der Konzern soll Ärzten Musterpackungen unverlangt zugesandt haben und erst an der Haustür eine Bestellung habe unterschreiben lassen.
BLUTUNGEN SCHWER ZU STOPPEN - NOCH KEIN GEGENMITTEL
Wie bei den anderen neuen Gerinnungshemmern Pradaxa von Boehringer Ingelheim und Eliquis von Pfizer und Bristol-Myers Squibb besteht auch bei Xarelto ein Blutungsrisiko. Pradaxa war bereits wegen Todesfällen in die Schlagzeilen geraten. Für die neuen Tabletten gibt es noch kein Gegenmittel, das im Notfall lebensbedrohliche Blutungen schnell stoppen kann. Schon 2011 hatte das einflussreiche „New England Journal of Medicine“ in einem Leitartikel darauf hingewiesen. Inzwischen arbeiten die Unternehmen daran - auch Bayer. Bei dem seit Jahrzehnten als Standardmedikament verwendeten Warfarin kann als Gegenmittel Vitamin K gegeben werden. Allerdings gilt das inzwischen patentfreie Warfarin als schwer dosierbar. Zudem müssen strikte Diätvorschriften eingehalten werden und regelmäßige Bluttests sind notwendig.
In der vergangenen Woche hatte die Arzneibehörde BfArM bemängelt, „dass nicht alle Ärzte die Fachinformation zum Management von Blutungsrisiken gut genug kennen.“ Es bestehe nicht nur bei älteren, sondern auch bei den neuen Gerinnungshemmern „ein signifikantes Risiko“ von schweren Blutungen, auch mit Todesfolge. Verschreibende Ärzte sollten diese Gefahr einzeln prüfen und Angaben zu Dosierung, Gegenanzeigen und Warnhinweise beachten.
Wirtschaftsblatt
Magazinbericht. Ausgerechnet das wichtigste Medikament des Pharmakonzerns ist schweren Vorwürfen ausgesetzt. Heuer gab es hunderte Fälle unerwünschter Nebenwirkungen, von denen etliche tödlich endeten.
Frankfurt. Die Berichte über Nebenwirkungen beim Bayer-Blutverdünner Xarelto häufen sich einem Magazinbericht zufolge. In den ersten acht Monaten dieses Jahres seien 968 Fälle unerwünschter Wirkungen mit 72 Todesfällen beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) registriert worden, berichtete „Der Spiegel“. Im gesamten Jahr 2012 seien dagegen 750 Verdachtsberichte unerwünschter Wirkungen, darunter 58 Todesfälle, gemeldet worden. Ein Bayer-Sprecher sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass der Nutzen des Medikaments die Risiken weiterhin überwiege. Beim BfArM war am Sonntag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.
Xarelto ist für Bayer derzeit das wichtigste neue Medikament. In allen Einsatzgebieten zusammengenommen traut der Pharmakonzern dem Mittel jährliche Spitzenumsätze von mehr als zwei Milliarden Euro zu. Allein im zweiten Quartal erlöste Bayer 219 Millionen Euro mit dem Blutverdünner - mehr als dreimal so viel wie noch vor einem Jahr.
Alternative Medikamente schwierig zu handeln
Wie bei allen Gerinnungshemmern besteht auch bei Xarelto ein Blutungsrisiko. Auch das Konkurrenzmedikament Pradaxa von Boehringer Ingelheim war wegen Todesfällen in die Schlagzeilen geraten. Für diese neuen Gerinnungshemmern gibt es noch keine Gegenmittel, die die Wirkung bei lebensbedrohlichen Blutungen schnell umkehren können. Bei dem seit Jahrzehnten als Standardmedikament verwendeten Warfarin zur Vorbeugung von Schlaganfällen leistet dies Vitamin K. Allerdings gilt das inzwischen patentfreie Warfarin als schwer dosierbar. Zudem müssen strikte Diätvorschriften eingehalten werden und regelmäßige Bluttests sind notwendig.
Deshalb werden zunehmend die neuen, teueren Gerinnungshemmer wie Xarelto und Pradaxa verschrieben. Im vergangenen Jahr seien 25,5 Millionen Tagesdosen verordnet worden, nach 700.000 im Jahr 2011, berichtete „Der Spiegel“ unter Verweis auf den neuen Arzneiverordnungs-Report, der am Donnerstag veröffentlicht werden soll. Mit Xarelto „sind wir seit Mai dieses Jahres weltweit Marktführer bei den Thrombosemitteln“, sagte Bayer-Chef Marijn Dekkers der „WirtschaftsWoche“.
Das BfArM bemängelt, „dass nicht alle verordnenden Ärzte die Fachinformation hinsichtlich des Managements von Blutungsrisiken gut genug kennen“, wie es in einem am Freitag veröffentlichten Informationsbrief heißt. Es bestehe auch bei den neuen Gerinnungshemmern „ein signifikantes Risiko“ von schweren Blutungen, auch mit Todesfolge, betonte die Behörde.
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren gehört zu den Mit-Herausgebern eines Positionspapiers deutscher Menschenrechts-Organisationen zu Rohstoff-Importen. Der vollständige Forderungskatalog findet sich unter http://bit.ly/1dUDgd8.
Viele Produkte „Made in Germany“ sind stark von Rohstoffimporten abhängig. Damit steht Deutschland in einer hohen Verantwortung für die sozialen und ökologischen Folgen des weltweiten Rohstoffabbaus. Die bisherige Politik der Bundesregierung wird dieser Verantwortung nicht ausreichend gerecht. „Anstatt über Wege zur Rohstoffsicherung der Industrie zu diskutieren, muss die Senkung des inländischen Rohstoffverbrauchs auf ein global gerechtes Niveau das zentrale Ziel sein“, fordert Klaus Seitz, Leiter der Abteilung Politik von Brot für die Welt im Vorfeld des ersten Deutschen Rohstofftags am 11. September in Berlin.
Zwar steht der vom BMZ organisierte Tag unter dem Motto „Strategien für eine nachhaltige Rohstoffversorgung“, doch de facto ist die Rohstoffpolitik der Bundesregierung alles andere als nachhaltig: „Der jetzige Rohstoffhunger droht zu einer Überschreitung der ökologischen Grenzen des Planeten zu führen“, ergänzt Damian Ludewig, Geschäftsführer des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. „Ein Steuer- und Abgabensystem, das weitgehend auf die Belastung des Faktors Arbeit setzt, schafft für die Steigerung der Ressourceneffizienz nicht die geeigneten Anreize. Daher müssen umweltschädliche Subventionen abgebaut und durch Ressourcensteuern die richtigen Preissignale gesetzt werden.“
Deutschland importiert einen Großteil seiner metallischen und energetischen Rohstoffe vorwiegend aus Entwicklungs- und Schwellenländern, in denen es beim Abbau häufig zu gravierenden Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden kommt. „Eine deutsche Rohstoffpolitik muss dies beachten. Menschenrechte müssen vor Profitinteressen stehen, das gilt auch für deutsche Konzerne, ihre Tochterunternehmen und Zulieferer. Die Bundesregierung muss daher menschenrechtliche Sorgfaltspflichten verbindlich vorschreiben“, fordert Bernd Bornhorst, Leiter der Abteilung „Politik und globale Zukunftsfragen“ bei Misereor.
In ihrem Positionspaper „Für eine demokratische und global gerechte Rohstoffpolitik“ fordern mehr als 35 Umwelt-, Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen eine andere Rohstoffpolitik. Der jetzigen mangelt es an einer breiten Konsultation von Parlamenten und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Stattdessen wird der deutschen Industrie ein privilegierter Zugang zu politischen Entscheidungen gewährt. „So ist es wenig verwunderlich“, merkt Johanna Fincke, Referentin für Kampagnen bei der Christlichen Initiative Romero, an, „dass bei Veranstaltungen wie dem Deutschen Rohstofftag von der Bundesregierung Industrievertreter/innen auf Podien mitdiskutieren, während Vertreter/innen der Zivilgesellschaft aus den rohstoffreichen Ländern oder von betroffenen Organisationen nicht einmal eingeladen werden.“
9. September 2013
Der BAYER-Konzern kündigte heute an, eine Geißel der Menschheit zu bekämpfen: das Doppelkinn. 2014 soll die Zulassung für die Fett-weg-Spritze ATX-101 beantragt werden.
Das ins Fettgewebe zu spritzende Medikament soll Fettdepots unter dem Kinn bekämpfen. Die Risiken einer solchen Behandlung sind jedoch völlig unklar. Zu befürchten ist, dass die zerstörten Fettzellen Gefäßverschlüsse und Schlaganfälle auslösen können. Auch zu Infektionen kann es kommen. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat daher mehrfach vor fettbehandelnden Spritzen gewarnt.
Philipp Mimkes von der Coordination gegen BAYER-Gefahren kommentiert: „In der Schönheits-Medizin kommt es immer wieder zu schweren Zwischenfällen und sogar Todesfällen. Lifestyle-Medikamente mit unklarem Risikoprofil sind daher abzulehnen! Die Behörden sind aufgefordert, keine Zulassung für solchen Pharma-Schrott zu erteilen. Leider hat es bei BAYER Tradition, unsinnige und sogar gefährliche Präparate auf den Markt zu bringen.“
BAYER arbeitet bei der Vermarktung der Anti-Fettspritze mit der Firma Kythera Biopharmaceuticals zusammen. BAYER besitzt die Vertriebsrechte außerhalb der USA und Kanada. Der Konzern traut dem Präparat einen Jahresumsatz von bis zu 250 Millionen Euro zu, die USA nicht eingerechnet.
Hier finden Sie einen Kommentar von Prof. Gerd Glaeske
Der folgende Hinweis wurde heute vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) versandt
5. September 2013
Sehr geehrte Damen und Herren,
Eliquis® (Apixaban), Pradaxa® (Dabigatranetexilat) und Xarelto® (Rivaroxaban) sind orale Antikoagulanzien, die in den letzten Jahren in Indikationen zugelassen wurden, in denen seit Jahrzehnten Vitamin-K-Antagonisten (Warfarin, Phenprocoumon, Acenocoumarol) oder niedermolekulare Heparine gebräuchlich waren. Im Gegensatz zur Anwendung von Vitamin-K-Antagonisten ist die routinemäßige Überwachung der antikoagulatorischen Aktivität bei der Anwendung dieser neuen Präparate nicht notwendig.
Meldungen aus klinischen Studien sowie aus der Anwendung seit Markteinführung haben jedoch gezeigt, dass schwere Blutungsereignisse, auch mit Todesfolge, nicht nur unter Vitamin-K-Antagonisten und niedermolekularen Heparinen auftreten, sondern dass auch bei den neuen oralen Antikoagulanzien ein signifikantes Risiko besteht. Zudem deuten Erfahrungen seit Markteinführung darauf hin, dass nicht alle verordnenden Ärzte die Fachinformation hinsichtlich des Managements von Blutungsrisiken gut genug kennen.
Vor dem oben beschriebenen Hintergrund ist es die Aufgabe der verordnenden Ärzte, das Blutungsrisiko des Patienten individuell zu beurteilen und die Angaben zu osierung, Gegenanzeigen sowie Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung zu beachten. Zwar bestehen bei den Gegenanzeigen Unterschiede zwischen den neuen oralen Antikoagulanzien, die folgenden Gegenanzeigen haben sie jedoch gemeinsam:
•Akute, klinisch relevante Blutungen.
•Läsionen oder klinische Situationen, die als signifikanter Risikofaktor einer schweren Blutung angesehen werden. Dies kann z.B. akute oder kürzlich aufgetretene gastrointestinale Ulzerationen, maligne Neoplasien mit hohem Blutungsrisiko, kürzlich aufgetretene Hirn-oder Rückenmarksverletzungen, kürzlich erfolgte chirurgische ingriffe an Gehirn, Rückenmark oder Augen, kürzlich aufgetretene intrakranielle Blutungen, bekannte oder vermutete Ösophagusvarizen, arteriovenöse Fehlbildungen, askuläre Aneurysmen oder größere intraspinale oder intrazerebrale vaskuläre Anomalien beinhalten.
•Die gleichzeitige Anwendung von anderen Antikoagulanzien z.B. unfraktionierteHeparine, niedermolekulare Heparine (Enoxaparin, Dalteparin etc.), Heparinderivate Fondaparinux etc.), orale Antikoagulanzien (Warfarin etc.), außer bei der Umstellung der Antikoagulationstherapie von diesem oder auf dieses Arzneimittel oder wenn unfraktioniertes Heparin in Dosen gegeben wird, die notwendig sind, um die Durchgängigkeit eines zentralvenösen oder arteriellen Katheters zu erhalten.
Es ist sehr wichtig, die empfohlene Dosierung sowie die Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung zu beachten, um das Blutungsrisiko zu minimieren. Hierzu gehört auch eine sorgfältige Abwägung von Nutzen und Risiken bei Patienten mit Läsionen, in klinischen Situationen, bei Eingriffen und/oder Therapien (z.B. mit nichtsteroidalen Antirheumatika oder Thrombozytenaggregationshemmern), die das Risiko für schwere Blutungen erhöhen. Zusätzlich wird empfohlen, die Patienten während der gesamten Behandlungsdauer hinsichtlich klinischer Zeichen und Symptome von Blutungen zu überwachen, insbesondere Patienten mit erhöhtem Blutungsrisiko.
Vor Einleitung der Behandlung sowie im weiteren Verlauf sollte auch die Nierenfunktion beurteilt werden. Eine Nierenfunktionsstörung kann eine Gegenanzeige darstellen oder Anlass zur Überlegung geben, das Arzneimittel nicht anzuwenden oder seine Dosis zu reduzieren. Näheres hierzu ist der jeweiligen Fachinformation zu entnehmen, da für die drei Arzneimittel unterschiedliche Empfehlungen gelten.
Ein spezifisches Antidot für Eliquis®, Pradaxa® oder Xarelto® ist derzeit nicht verfügbar. Die Fachformationen der einzelnen Arzneimittel enthalten Hinweise zum therapeutischen Vorgehen beim Auftreten von Blutungskomplikationen.
3. September 2013, Informationsdienst Gentechnik
Der deutsche Agrochemiekonzern Bayer Cropscience darf eine weitere gentechnisch veränderte Sojapflanze in den USA vermarkten. Sie ist resistent gegen ein ebenfalls von Bayer hergestelltes Spritzmittel, das als „wahrscheinlich krebserregend“ gilt. Die Organisation Center for Food Safety befürchtet, dass künftig deutlich größere Mengen des umweltschädlichen Spritzmittels eingesetzt werden.
Das Landwirtschaftsministerium in Washington gab der Sojapflanze FG72 kürzlich grünes Licht. Die Soja ist in Bayer-Laboren so genmanipuliert worden, dass sie die Anwendung des Herbizids Isoxaflutol übersteht, während Wildkräuter eingehen. Laut dem Center for Food Safety versucht der Chemie-Produzent, auf diese Weise einen Ersatz für ältere Gentechnik-Saaten auf den Markt zu bringen. Diese haben mittlerweile in vielen Teilen der USA ihre Wirkung verloren, weil sich das Unkraut an die Dauerbelastung mit anderen Herbiziden, vor allem dem Weltbestseller Glyphosat, angepasst haben. Bei Soja und Mais werden in den USA zu je circa 90 Prozent gentechnisch veränderte Sorten verwendet, der Einsatz von Chemikalien auf den Monokulturen mit resistenten Pflanzen ist dementsprechend hoch.
Für Bill Freese vom Center for Food Safety ist FG72 nur die erste einer Reihe von Gentechnik-Pflanzen, die gegen noch giftigere Chemikalien als Glyphosat widerstandsfähig gemacht wurden. Die Abhängigkeit der US-Landwirte von den toxischen Herbiziden werde noch weiter zunehmen. Weitere Gentechnik-Sorten, die mit Giften wie Dicamba und 2,4-D besprüht werden, warten auf eine Zulassung durch die Behörden. Das Problem der resistenten Unkräuter könne so aber nicht gelöst werden, meint Freese. Denn auch an diese Chemikalien würden sich die Wildkräuter nach und nach gewöhnen. „Die Ironie ist, dass die vermeintlich ‚hochmoderne‘ Biotechnologie die amerikanische Landwirtschaft ein halbes Jahrhundert und mehr zurück in eine giftigere Vergangenheit führt.“
Isoxaflutol wurde vor über 20 Jahren von Aventis entwickelt, das später von Bayer aufgekauft wurde. Die US-amerikanische Umweltbehörde EPA hat das Herbizid als B2-Carcinogen eingestuft. Das bedeutet, dass ausreichende Belege für eine krebserregende Wirkung bei Tieren vorliegen, Daten zur Wirkung auf den menschlichen Organismus jedoch nicht vorliegen. Dass Isoxaflutol auch beim Menschen Krebs verursache, sei jedoch „wahrscheinlich“. Außerdem könne die Chemikalie sich im Grund- und Oberflächenwasser anreichern. dh