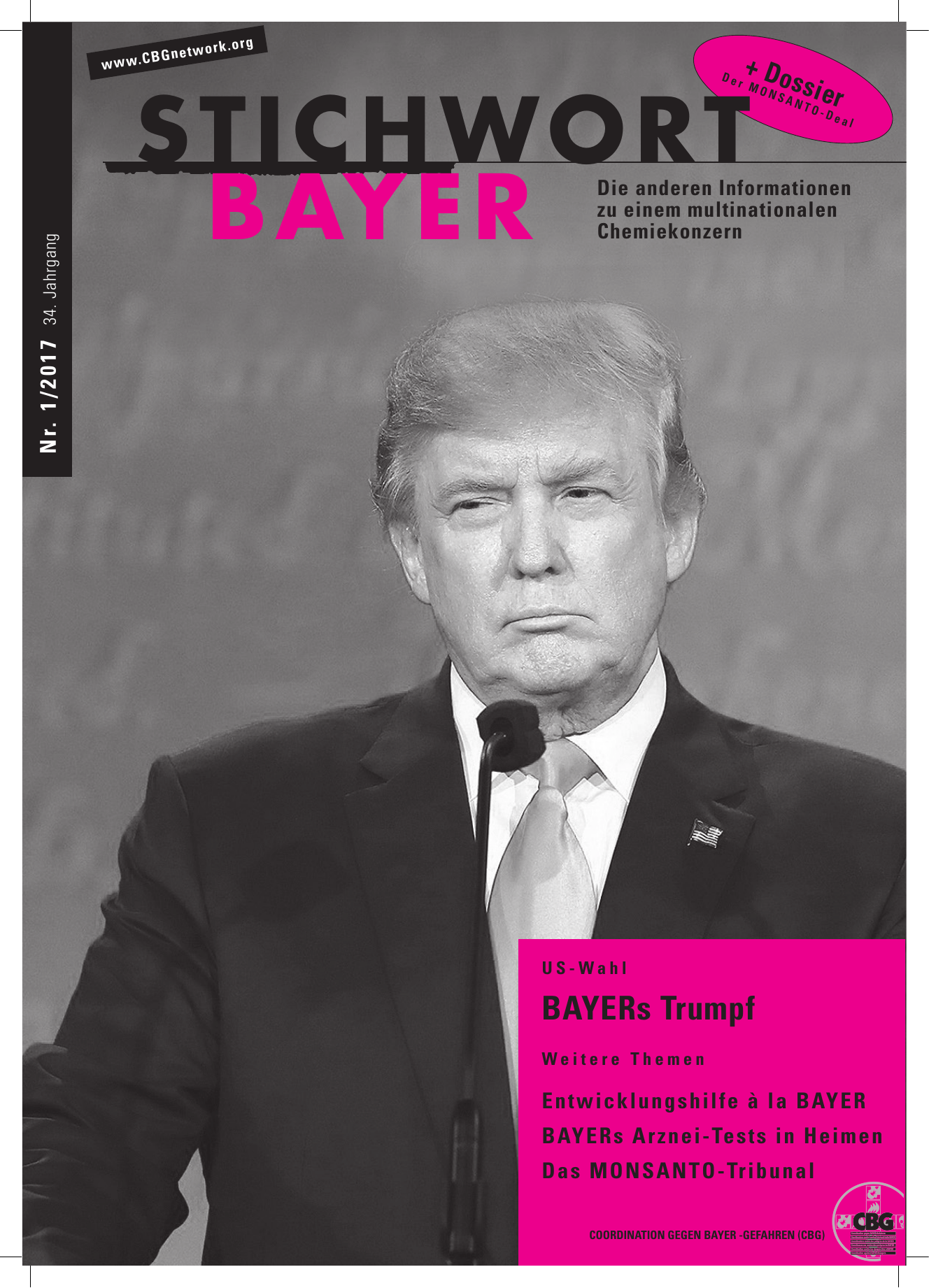Beiträge verschlagwortet als “SWB 01/2017”
Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
Die von BAYER avisierte MONSANTO-Übernahme, zu der die AktionärInnen des US-Unternehmens am 13. Dezember kurz vor dem Redaktionsschluss von Stichwort BAYER ihren Segen gegeben haben, hält uns immer noch in Atem. Aber es gibt dazu auch Erfreuliches zu vermelden. Bei dem „Betriebsausflug“ der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN nach Den Haag zum MONSANTO-Tribunal und zur angegliederten People’s Assembly gelang es uns, viele Initiativen und Einzelpersonen als Mitstreiter gegen den Mega-Deal zu finden. Das SWB war natürlich mit vor Ort und berichtet gleich in doppelter Ausführung aus Holland.
Und während unser Karikaturist Berndt Skott sich in diesem Heft noch zeichnerisch von unserem alten Geschäftsführer Philipp Mimkes verabschiedet, kann die Redaktion zum ersten Mal seinen Nachfolger Toni Michelmann als Autoren präsentieren. Aus gegebenem Anlass widmet sich der Chemiker dem neuen US-Präsidenten Donald Trump. Der Leverkusener Multi hatte nämlich bei seiner Wahlkampf-Unterstützung ganz auf die Republikaner gesetzt und aus dem dafür bereitgestellten und mit 555.500 Dollar gefüllten Topf zu 80 Prozent KandidatInnen dieser Partei bedacht.
Auch auf anderen Kontinenten verfolgt der Konzern seine Geschäftsinteressen gnadenlos. In Afrika und Asien versteht er es dabei sogar noch, das als Entwicklungshilfe auszugeben. Gemeinsam mit dem „Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung“ betreibt er dort Landwirtschaftsprojekte, die ihm lediglich als Türöffner dazu dienen, seinen Pestiziden neue Märkte zu erschließen. Oxfam hat sich einige dieser Vorhaben für diese Ausgabe einmal etwas genauer angeschaut.
Im Gegensatz zu Oxfam hält der Agro-Riese seine Pestizide für unbedenklich. Sachgemäß angewandt, könnten sie der Gesundheit nicht schaden, betont er bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Das entsprechende Sicherheitsprofil erstellt BAYER auf der Basis von Tierversuchen. Wie viele Unsicherheitsfaktoren das birgt, erläutert für das SWB Lars Neumeister, der unter anderem GREENPEACE, den BUND und den WWF wissenschaftlich berät.
Aber der Global Player unternimmt nicht nur Tier-, sondern auch Menschenversuche. Und bis in die 1970er Jahre hinein fanden in bundesdeutschen Kinderheimen und Jugend-Psychiatrien Tests mit Psychopharmaka des Unternehmens statt. Wir schlagen in dieser Nummer die Akten des Landeskrankenhauses Schleswig auf. Schließlich wäre da noch die unendliche Dhünnaue-Geschichte. Die Bezirksregierung Köln fügte der Auseinandersetzung um BAYERs Giftmüll-Deponie im November 2016 ein weiteres Kapitel zu. Sie gab grünes Licht für den Ausbau der Autobahn A1 nebst neuer Brücke, obwohl der „Landesbetrieb Straßenbau NRW“ dafür das Chemie-Grab öffnen muss.
Also wieder viel Lesestoff bis zur letzten Seite – buchstäblich. Diese möchte ich Ihnen besonders ans Herz legen. Dort setzt sich nämlich der bekannte Liedermacher Konstantin Wecker für die CBG ein und bittet darum, unser Netzwerk finanziell zu unterstützen, denn es warten im Jahr 2017 so einige große Aufgaben auf uns. So planen wir etwa, die nächsten BAYER-Hauptversammlung am 28. April zu einem Forum für die internationalen Proteste gegen die MONSANTO-Übernahme zu machen und dazu auch die nächste People’s Assembly nach Köln zu holen. Dazu demnächst mehr, jetzt aber erst einmal eine anregende Lektüre wünscht
Erste & Dritte Welt
Entwicklungshelfer BAYER
Vom Bock zum Gärtner
2012 rief das „Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (BMZ) mit BAYER, BASF, SYNGENTA und ca. 30 weiteren Konzernen die „German Food Partnership“ (GFP) ins Leben. „Mit ihrem Kapital, vor allem aber ihrem Know-how und ihrer Wertschätzung für Umwelt- und Sozialstandards trägt die Privatwirtschaft ganz wesentlich zu entwicklungspolitischen Fortschritten bei“, so die Begründung des damaligen Entwicklungsministers Dirk Niebel (FDP) für den „Schulterschluss mit der Privatwirtschaft“. Ende 2015 erklärte das Ministerium die GFP zwar für beendet, aber die auf den Weg gebrachten Projekte laufen vorerst weiter. OXFAM hat sich drei von ihnen einmal genauer angeschaut.
Weltweit werden genügend Lebensmittel produziert, um die gesamte Menschheit zu ernähren. Dennoch leiden nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 800 Millionen Menschen chronisch unter Hunger. Dieser Fakt deutet darauf hin, dass Hunger kein Problem des Mangels ist, sondern von Armut und der Verletzung von Menschenrechten. Das hat auch damit zu tun, dass eine kleine Elite von Regierungen und Konzernen das globale Ernährungssystem dominiert. Die Hauptproduzenten der Lebensmittel - hunderte Millionen von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern - sowie die Milliarden VerbraucherInnen bleiben dagegen außen vor. Wenn der Hunger bis 2030 wirklich weltweit beseitigt und die globalen Nachhaltigkeitsziele erreicht werden sollen, wie es die Vereinten Nationen 2015 versprachen, muss dieses ungerechte Ernährungssystem grundlegend transformiert werden.
Doch die staatliche Entwicklungszusammenarbeit macht genau das Gegenteil, kooperiert verstärkt mit den großen Agrarkonzernen und macht damit den Bock zum Gärtner. Diese Kooperation begann Ende der 1990er Jahre und verstärkte sich nach dem Weltwirtschaftsforum 2011. Die dort verabschiedete „Neue Vision für die Landwirtschaft“ beförderte die Gründung der Investitionsplattform „GROW Africa“ und der „Neuen Allianz für Ernährungssicherheit“ der G8 und inspirierte zudem den damaligen deutschen Entwicklungsminister Dirk Niebel, eine „German Food Partnership“ GFP) ins Leben zu rufen.
Mehr als 30 Unternehmen und Verbände hatten die GFP Mitte 2012 unter der Schirmherrschaft des Entwicklungsministeriums als große, langfristig angelegte öffentlich-private Partnerschaft (PPP) gegründet. Selbsterklärtes Ziel war es, die Ernährungssituation in Entwicklungs- und Schwellenländern durch mehr und qualitativ höherwertige Lebensmittel zu verbessern. Mit den GFP-Projekten sollte die Produktivität und die Leistungsfähigkeit entlang der Wertschöpfungskette auf eine sozial und ökologisch nachhaltige Art und Weise gesteigert werden, indem Bauern und Bäuerinnen der Zugang zu Betriebsmitteln und Märkten erleichtert wird. Betriebseinkommen sollten erhöht, die Ernährung von lokalen Bauern, insbesondere Kleinbauern und -bäuerinnen, sowie von VerbraucherInnen verbessert werden.
Am 05.11.2013 wurden die ersten PPPs der GFP öffentlich lanciert. In Reaktion auf die Kritik von Seiten vieler Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sagte das BMZ vollständige Transparenz zu. NGOs bekämen alle Informationen, die sie wollen. Oxfam hatte bereits eine Woche später nachgehakt und Informationen zu den Projekten angefordert. Damit begann eine lange Zeit des Wartens. Nach zehn Monaten schließlich entschloss sich OXFAM eine offizielle Anfrage mit Verweis auf das Informationsfreiheitsgesetz zu stellen. Im Dezember 2014 erhielt OXFAM den schriftlichen Bescheid vom BMZ, brachte aber aufgrund von fehlenden Informationen Ende 2014 ein Widerspruchsverfahren auf den Weg. Und erst Anfang Oktober lagen auch die angeforderten Schulungsmaterialen vor. Auf der Grundlage dieser Dokumente und eines Lokaltermins in Kenia hat OXFAM dann drei Kooperationen näher analysiert.
Die CARI-Initiative
Die „Competitive African Rice Initiative“ (CARI) mit BAYER als Industrie-Partner hat einen Etat von 18,4 Millionen Euro, den die „Bill and Melinda Gates“-Stiftung zu 73 Prozent und das Entwicklungsministerium (BMZ) zu 27 Prozent tragen. Sie erstreckt sich auf die Länder Nigeria, Ghana, Burkina Faso und Tansania.
Die Analyse der in Nigeria zur Anwendung kommenden Trainingsmaterialien ergab, dass CARI stark ein input-basiertes Agrarmodell fördert. Die Anwendung von Pestiziden wird als die vorzuziehende und überlegene Methode zur Beseitigung von Unkräutern, Krankheiten und Schädlingen dargestellt: Formulierungen wie „Chemisches Jäten spart Zeit und Geld“ oder „Säubern des Landes mit Herbiziden“ zeigen dies exemplarisch. Während der Einsatz von zugelassenen und empfohlenen Pestiziden nur bei Schädlings- bzw. Krankheitsbefall angeraten wird, gibt es keinen einzigen Hinweis auf alternative biologische Schädlingsbekämpfungsansätze. Das vom BMZ geforderte Prinzip der Wahlfreiheit wurde missachtet, denn CARI beinhaltet Empfehlungen für den Einsatz von spezifischen Pestiziden. Entgegen den Aussagen des BMZ werden bei CARI den Kleinbäuerinnen und -bauern keine ökologischen Anbauverfahren als Option vorgestellt.
CARI empfiehlt den Einsatz von hochgefährlichen Pestiziden (Highly Hazardous Pesticides, HHPs) wie Lambda-Cyhalothrin, Cypermethrin, Deltamethrin und Mancozeb, die auf der Schwarzen Liste des PESTIZID AKTIONS-NETZWERKES (PAN) stehen. Lambda-Cyhalothrin ist ein akut toxisches Pestizid, das verhängnisvoll bis tödlich („fatal if inhaled“) bei Inhalation sein kann. Ursprünglich wurde auch Glyphosat empfohlen, dies ist aber inzwischen wieder geändert worden. In der aktuellen Online-Version vom 13.5.2016 ist es nicht mehr zu finden. Im Rahmen von CARI – nachgewiesen in einer gemeinsamen Studie von der „Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit“ (GIZ) und CARI zum integrierten Pflanzenschutz in Nigeria - werden sechs kommerzielle Produkte von BAYER CROPSCIENCE empfohlen, wobei zwei als „besonders nützlich“ hervorgehoben werden: INNOVA und ROUTINE. Auch Glyphosat steht auf der Liste der empfohlenen Pestizide. Es werden also entgegen den Aussagen des BMZ besonders umweltschädliche Produkte und spezifische Pestizide im Rahmen von CARI empfohlen. Das im Guide verankerte Prinzip der Wahlfreiheit in Bezug auf die Anwendung von Inputs wurde nicht beachtet. Die Bundesregierung hatte im Oktober 2015 angekündigt, dass die PAN-Liste und deren Fortschreibungen zeitnah in der GIZ-internen Beschaffungsrichtlinie berücksichtigt werden. Gleichwohl hat das nicht dazu geführt, dass die hochgefährlichen Pestizide bei der nachträglichen Änderung des CARI-Schulungsmaterials im Mai 2016 komplett ausgeschlossen wurden.
Der Einsatz von Pestiziden wird ab dem Erreichen bestimmter Schadschwellen empfohlen („Schadschwellenprinzip“, siehe auch GFP-Guide). Dieser Ansatz ist unnötig schädlich und veraltet angesichts der letzten Innovationen in der Reisproduktion, die eine Steigerung der Produktion ohne den Einsatz von Pestiziden erlauben. Auch ein im Unterrichtsmaterial enthaltener Vergleich von zwei verschiedenen Anbaumethoden – mit und ohne Inputs wie Pestiziden – stellt sich bei näherer Betrachtung als kaum verhohlene Empfehlung eines pestizid-basierten Ansatzes heraus. Auf agrar-ökologische Anbaumethoden wie das „System of Rice Intensification“ (SRI), das erhebliche Ertragssteigerungen gerade bei traditionellen Reissorten ermöglicht, wird gar nicht eingegangen.
Beim Saatgut werden ausschließlich verbesserte und zertifizierte Sorten empfohlen. Beim Erwerb von zertifizierten Sorten müssen die LandwirtInnen Lizenzgebühren zahlen, während traditionelle Sorten frei getauscht und nach der Ernte wiederverwendet werden können. Zwei von fünf Empfehlungen beinhalten den Einsatz der Reissorte Nerica, die in Afrika als „Wunder-Pflanze“ gepriesen wurde, in der Praxis aber nicht hielt, was sie versprach. Das Wort „Bodenfruchtbarkeit“ taucht nur einmal im 57-seitigen Schulungsdokument auf. CARI hakt das Thema mit dem Hinweis ab, dass es besser sei, für den Reisanbau ein Stück Land zu wählen, wo in der vorherigen Saison z. B. Reis, Kuhbohnen oder Sojabohnen angebaut wurden. Entgegen den Aussagen des BMZs ist der Erhalt und gar die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit nicht im Fokus von CARI.
Zusammenfassend betrachtet ist das CARI-Schulungsmaterial im Hinblick auf die direkte und eindeutige Förderung von agro-chemischen Inputs (Düngemittel, Pestizide) sehr kritisch zu sehen, weil potenziell negative wirtschaftliche, Umwelt- und Gesundheitsfolgen komplett bzw. nicht hinreichend berücksichtigt werden. Auch werden keine Alternativen (z. B. biologische Schädlingsbekämpfung) aufgezeigt. Hochgefährliche Pestizide und Markenprodukte von BAYER werden explizit empfohlen. Es ist ein untragbarer Umstand für ein groß angelegtes Programm wie CARI, dass die ökologische Nachhaltigkeit vernachlässigt wird. Dieser Umstand wird von der GIZ in ihrem Angebot in einem Punkt auch explizit eingeräumt. Dort heißt es: „Durch die Intensivierung von Bewässerungsreis trägt das Vorhaben nicht zu vermehrtem Umweltschutz bei“.
Die „Better Rice Initiative“
An der „Better Rice Initiative Asia“ (BRIA) nehmen außer BAYER noch BASF, Royal DSM, die DEUTSCHE BANK und weitere Unternehmen teil. Diese tragen den zehn Millionen Euro schweren Etat auch zu 70 Prozent; 30 Prozent steuert das Entwicklungsministerium bei. Die Landwirtschaftsministerien von Indonesien, Thailand, Vietnam und von den Philippinen – die Länder, in denen die Projekte stattfinden – fungieren als offizielle Partner.
Das Schulungsmaterial ist für die Philippinen sehr umfassend und für Indonesien sehr beschränkt, während jenes in Thailand nur in thailändisch verfügbar ist und für dieses Dossier nicht analysiert werden konnte. Verglichen mit CARI sind die Module von BRIA-Philippinen umfassender und breiter gefächert. Sie enthalten auch mehr Optionen. Auch hier ist ein starker Fokus auf eine input-basierte Landwirtschaft vorzufinden. Gleichwohl erwähnen die Module einige Alternativen wie das „System of Rice Intensification“ (SRI) oder Saatgutbanken auf Gemeindeebene, ohne sie jedoch im Detail ausführlich zu erklären. Im Hinblick auf Saatgut wird zertifiziertes Saatgut gefördert, traditionelle Sorten werden wie bei CARI nicht erwähnt. Hinweise auf die Vorteile der Agrobiodiversität sucht man ebenso vergeblich.
Den Kern der Schulungsmaterialien bildet das so genannte PalayCheck System. Es stellt grundsätzlich einen integrierten Ansatz dar, fällt aber hinter andere Anbaumethoden wie SRI zurück, die weniger Düngemittel und Pestizide erfordern. PalayCheck gibt wenig Orientierung bezüglich der Bedeutung von organischer Substanz für das Bodenleben und des Alters der Setzlinge und ihrer Anordnung, was wichtig für die Ausbildung von gesunden Wurzeln ist. In puncto Bodenfruchtbarkeit wird zwar eine gute Vorbereitung des Feldes und die Integration von Pflanzenresten hervorgehoben, aber wenig über die Bedeutung von organischen Düngemitteln wie zum Beispiel Kompost oder anderer Biomasse gesagt. Stattdessen wird sehr einseitig auf die positiven Effekte und die Notwendigkeit von synthetischen Düngemitteln als einem hervorragenden Ansatz zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit verwiesen.
In einem Modul bietet BRIA BAYER CROPSCIENCE eine Plattform, um die Vorteile chemischer Schädlingsbekämpfung zu präsentieren. Auch wenn keine spezifischen Produkte genannt werden, ist die Botschaft trotzdem klar: „Pestizide sind hilfreich zum Pflanzenschutz“ und „negative Auswirkungen von Pestiziden sind bei korrekter Anwendung vermeidbar“. Diese Empfehlungen ignorieren bedauerlicherweise die Erfahrungen mit der Anwendung von SRI, bei dem der Einsatz von Pestiziden gar nicht oder nur sehr spärlich erfolgt. Ähnlich wie bei CARI werden auch bei BRIA hochgefährliche Pestizide empfohlen, die auf der Liste von PAN International stehen, zum Beispiel Mancozeb und Carbendazim.
Insgesamt geben die BRIA-Schulungsmaterialien input-basierten Technologien den Vorrang gegenüber nachhaltigen Ansätzen wie der biologischen Schädlingsbekämpfung. Gleichwohl verweisen einige Folien auf agrarökologische Anbauverfahren. Einige Module enthalten Empfehlungen von spezifischen Pestiziden und Düngemittelprodukten. Der Auflage des BMZs, keine Marken-Werbung zu betreiben, wurde somit nicht entsprochen. Manche Pestizide sind hochgefährlich und werden in der Liste von PAN International aufgeführt. Ebenso wurde entgegen den Aussagen des BMZs kein besonderer Wert auf die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit gelegt.
An der „Potato Initiative Africa“ (PIA) nehmen außer BAYER noch SYNGENTA, die Landmaschinen-Hersteller Lemken und Grimme sowie weitere Unternehmen teil. Sie brachten auch 50 Prozent des 1,4 Millionen Euro umfassenden Etats auf, das BMZ die andere Hälfte. Bei dem Projekt kamen Pestizide von BAYER CROPSCIENCE und SYNGENTA zum Einsatz. Die Aussage des BMZs, dass der Einsatz „spezifischer Pflanzenschutzmittel“ nicht vorgesehen sei, dürfte sich nicht nur auf Trainings, sondern auf alle Vorhaben bezogen haben. Insofern ist davon auszugehen, dass die Richtlinien nicht eingehalten wurden. Inwieweit die eingesetzten Pestizide als hochgefährlich einzustufen sind, kann aufgrund fehlender Informationen nicht beurteilt werden. Explizit ökologische Anbauverfahren wurden entgegen den Aussagen des BMZs bei diesem Projekt quasi ausgeschlossen, da sie nicht angewendet wurden. Auch wurde in diesem Fall nicht sichergestellt, dass die Bodenfruchtbarkeit verbessert wird. Eine Anforderung, die gemäß dem BMZ und dem GFP-Guide für alle Vorhaben gilt.
Nicht nachhaltig
Eine vollständige Bewertung der PPPs ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich, zumal die Reisprojekte bis Ende 2017 laufen. Es müssten zudem die Baseline-Studien und die Evaluierungsberichte nach Abschluss der Projekte vorliegen. Diese Analyse stellt vielmehr ein Zwischenfazit im Hinblick auf die Erfüllung der BMZ-Anforderungen im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit und der Wahlfreiheit für Bauern und Bäuerinnen dar und problematisiert die einseitige Festlegung auf ein input-basiertes Agrarmodell mit seinen negativen Auswirkungen. Angesichts der sich verschlechternden Umweltbedingungen und der Überschreitung planetarischer Grenzen ist es verantwortungslos, die Dimension der ökologischen Nachhaltigkeit derart zu vernachlässigen, wie das bei den PPPs der Fall ist. Zahlreiche Beispiele belegen, dass diversifizierte Anbausysteme weniger anfällig für Krankheiten und Schädlingsbefall sind. Mit der Fokussierung auf den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln werden die Umweltprobleme in der Landwirtschaft und die schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen, die mit dem Einsatz insbesondere hochgefährlicher Pestizide einhergehen, nicht angegangen, sondern mittel- und langfristig eher noch verschärft. Wichtige Ansätze, die die Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft bei fortschreitender Bodenzerstörung, zunehmender Wasserknappheit und der Häufung extremer Wetter-Ereignissen erhöhen könnten, werden ignoriert.
Marktorientierung
„Die Zielgruppe sind marktorientierte Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die nicht ausschließlich subsistenzorientiert arbeiten“, erklärt die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen zu den GFP-Projekten. Im GIZ-Angebot bei CARI werden als Zielgruppe Reisbauern und -bäuerinnen mit einem Einkommen von weniger als 2 US-Dollar am Tag benannt, bei PIA kleinbäuerliche ErzeugerInnen mit 1 bis 5 ha und durchschnittlichen Erträgen von 3 bis 7 Tonnen pro Hektar. Bei BRIA wird die Zielgruppe nicht genauer spezifiziert. Mit dem Wertschöpfungskettenansatz können in der Tat nur die marktorientierten Kleinbauern und Kleinbäuerinnen – oder wie das BMZ auch formuliert: „die Potenzialbauern und -bäuerinnen“ erreicht werden. Ihr Anteil wird allgemein auf 10 bis 25 Prozent der kleinbäuerlichen ErzeugerInnen geschätzt. Marginalisierte Gruppen, also die ärmsten Bauern und Bäuerinnen, fallen gänzlich durch das Raster. Deren Diskriminierung – oft Grund für Hunger und Armut – wird weiter verschärft. Dabei erfordert das Menschenrecht auf Nahrung, dass insbesondere marginalisierte und vulnerable Gruppen im Fokus stehen und dass ihre Partizipation sichergestellt wird. Bei großangelegten Entwicklungsprojekten ist es nicht nur wichtig, die Netto-Einkommenseffekte, die ökologische Nachhaltigkeit und die Resilienz zu analysieren, sondern auch die Auswirkungen auf die kleinbäuerlichen ErzeugerInnen und andere vulnerablen Gruppen, die nicht Teil des Projektes sind. Eine entsprechende Risikoanalyse findet sich in den Projektkonzepten nicht. Mit der „Modernisierung der Landwirtschaft“ nach europäischem Vorbild werden zudem der Strukturwandel befördert und Arbeitskräfte freigesetzt werden. Mangels anderer Wirtschaftssektoren, die den Verlust landwirtschaftlicher Arbeitsplätze auffangen könnten, werden so immer mehr Menschen ins Abseits gedrängt. Ohne eine Gesamtagrarstrategie, die niemanden zurücklässt („Leave no one behind“, Agenda 2030), wird es nur bessere Lebensbedingungen für bessergestellte, marktteilnehmende Bauern und Bäuerinnen geben, während auch weiterhin marginalisierte Kleinbauern und Kleinbäuerinnen vernachlässigt und diskriminiert werden.
In den 558 Seiten (ohne Trainingsmaterialien), die uns vom BMZ zugesandt wurden, hat OXFAM keinen Hinweis dafür gefunden, dass Kleinbauern und Kleinbäuerinnen bzw. LandwirtInnen- und Frauenorganisationen bei der Entwicklung eines der Projekte eng eingebunden wurden. Dabei ist dies ein wichtiges menschenrechtliches Prinzip, das grundsätzlich vom BMZ anerkannt und auch im GFP-Guide mit der Vorgabe zur notwendigen Einhaltung des Rechts auf Nahrung festgehalten ist. Es ist frappierend, dass Projekte immer noch ohne die Zielgruppen entwickelt werden. Dabei sollten insbesondere die Menschen, die von Armut und Hunger betroffen sind, in die Entwicklung von Projekten und Programmen eingebunden werden. Nur wenn ihr Wissen, ihre Bedürfnisse und ihre Prioritäten stärker berücksichtigt werden, kann das Ziel der Beendigung des Hungers bis 2030 erreicht werden.
Kontaktpflege für BAYER
Im BRIA-Kooperationsvertrag mit BAYER CROPSCIENCE ist klar beschrieben, dass der Konzern über die Kooperation mit der GIZ seine Kontakte zu LandwirtInnen ausweiten will. Bei CARI wird dargelegt, dass die Unternehmen permanent anstreben, eigene Wettbewerbsvorteile zu erhalten oder zu erreichen, wodurch auch im Interesse der staatlichen Träger die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Wertschöpfungskette gestärkt werde. Im PIA-Konzept wird das Unternehmensinteresse am ausführlichsten beschrieben: Alle beteiligten Unternehmen möchten durch die Zusammenarbeit mit der GIZ, Regierungsbehörden etc. ihren Marktzugang in Nigeria und Kenia stärken. Besonders interessiert seien die Unternehmen daran, Kleinbauern und –bäuerinnen zu erreichen und dadurch ihre Beschaffung von Agrarprodukten und den Verkauf ihrer Inputs (Pestizide etc.) zu erhöhen. Es werde davon ausgegangen, dass das bessere Verständnis von LandwirtInnen in puncto Profitabilität von besseren Prozessen, Saatgut, Schädlingsbekämpfung und Düngung deren Nachfrage nach den von den Unternehmen angebotenen Lösungen erhöhe und damit schlussendlich die Marktsichtbarkeit, die Marktanteile und Geschäftsmöglichkeiten der Unternehmen verbessert würden. Durch die Kooperation mit der GIZ werde ein besseres Erreichen der Zielgruppe erwartet.
Das Interesse der Unternehmen liegt wie oben beschrieben klar auf der Hand. Die GIZ ist für sie ein nützlicher Türöffner, um ihren Zugang zu den Märkten der Entwicklungsländer zu stärken bzw. zu verbessern. Politisch wird zumindest in Kauf genommen, dass die deutsche Entwicklungszusammenarbeit genutzt wird, um den Markt-Auftritt deutscher Unternehmen gegenüber einheimischen oder anderen internationalen Unternehmen zu verbessern. Implizit stellt die öffentlich-private Partnerschaft somit ein Instrument der Wirtschaftsförderung dar und wirft wettbewerbsrechtliche Fragen auf. Die GIZ selbst sieht sich indessen als „Broker“ zwischen den zu verfolgenden Entwicklungszielen und den Unternehmensinteressen und hat auch vor allem marktorientierte Kleinbauern und Kleinbäuerinnen im Blick.
OXFAM möchte mit der Analyse die notwendige Diskussion über diese zentralen Fragestellungen voranbringen. Bislang werden die Hinweise auf die Risiken nach wie vor vom BMZ und von der GIZ nicht angemessen diskutiert oder gar berücksichtigt. Eine umfassende Evaluierung der landwirtschaftlichen PPPs liegt bislang nicht vor. Es wäre sinnvoll, in einem ergebnisoffenen Prozess den Rahmen zu definieren und einzugrenzen, in dem eine Kooperation mit der Agrar- und Ernährungswirtschaft aus Entwicklungsperspektive förderlich sein könnte. Es ist unbestritten, dass eine Kooperation mit Unternehmen aus Entwicklungsperspektive einen Beitrag zur Armutsreduzierung leisten kann. Gleichwohl ist es wichtig, die Implikationen auf der Mikro- und Makroebene bei der Ausgestaltung zu berücksichtigen und die Einflusssphären der Unternehmen zu begrenzen. Im Hinblick auf die direkte Verbesserung der Ernährungssituation von Menschen, die unter Hunger leiden, darf die Sinnhaftigkeit dieser Art von PPPs bezweifelt werden. Marktbasierte Entwicklungsmodelle unterschätzen die Risiken für vulnerable Haushalte, und Wertschöpfungsketten-Ansätze adressieren nicht die Bedürfnisse der vulnerabelsten Menschen. Die Verwendung hochgefährlicher Pestizide bringt erhebliche Gesundheits- und Umweltprobleme mit sich. Die Bundesregierung sollte ihren Einsatz in der Entwicklungszusammenarbeit grundsätzlich ausschließen. Statt eine industrielle Landwirtschaft zu befördern, sollte der Schwerpunkt auf Anbauverfahren liegen, die Bodenfruchtbarkeit verbessern, die biologische Vielfalt erhalten und eine Anpassung an den Klimawandel ermöglichen.
Dieser Text basiert auf der OXFAM-Broschüre „Böcke zu Gärtnern“. Für die vorliegende Fassung hat die Redaktion jedoch Kürzungen vorgenommen.
Wasser, Boden & Luft
Unter dem Pflaster liegt BAYERs Giftmüll
Grünes Licht für A1-Ausbau
Am 11. November 2016 hat die Bezirksregierung Köln dem landeseigenen Straßenbetrieb die Genehmigung erteilt, für den Ausbau der A1-Autobahn BAYERs Dhünnaue-Deponie wieder zu öffnen.
Von Jan Pehrke
„Im Rahmen des Anhörungsverfahrens hat die Bezirksregierung Köln alle vorgetragenen Einwendungen und Stellungnahmen sorgfältig geprüft und über den Antrag des Landesbetriebs Straßenbau NRW positiv entschieden“, erklärte die Behörde am 11. November 2016. Für den Ausbau der Autobahn A1 erlaubte sie Straßen.NRW, BAYERs Giftmüll-Deponie Dhünnaue, die erst zur Bundesgartenschau 2005 in langjähriger Arbeit halbwegs gesichert wurde, wieder zu öffnen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) protestierte scharf gegen den Beschluss. „Es ist unverantwortlich von der Bezirksregierung, Straßen.NRW Hand an BAYERs Giftgrab legen zu lassen, in dem Millionen Tonnen toxischer Abfälle von Quecksilber über Arsen und Chrom bis zu Blei schlummern. Aus reinen Kosten-Erwägungen heraus beschwört sie damit Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt herauf“, hieß es in der entsprechenden Presseerklärung.
Für das Fundament der Trasse hat Straßen.NRW vor, eine Erdschicht von zwei Metern Tiefe, die 87.820 Kubikmeter Giftmüll birgt, abzutragen. Bei dem Erörterungstermin, der Anfang Juli 2016 in der Stadthalle von Köln-Mülheim stattfand, wertete der Straßenbetrieb das selbst als einen nur „beschränkt optimierten Eingriff“. Ein Ingenieur bezeichnete stattdessen die Auskofferung des ganzen Giftgrabes ganz offen als die „optimale Gründung“ für die A1. Eine solche Auskofferung hatten die CBG und andere Initiativen schon gefordert, als Anfang der 1990er Jahre die Debatte um die Sanierung der Dhünnaue anhob. Aus Kostengründen erfolgte jedoch nur eine Abdichtung, was Ernst Grigat von der 60-prozentigen BAYER-Tochter CURRENTA nun bedauert. Der Leverkusener Chempark-Leiter nannte es gegenüber dem Kölner Stadtanzeiger einen Fehler, damals die giftigen Hinterlassenschaften nicht geborgen und verbrannt zu haben.
Diese geben nämlich keine Ruhe. In der Deponie rumort es bisweilen noch kräftig. Der organische Anteil des Mülls zersetzt sich und das Volumen nimmt ab, weshab mit Bodenabsenkungen zu rechnen ist. Das tut auch Straßen.NRW. In ihren Planungen gehen die IngenieurInnen vorsichtshalber schon einmal von einstürzenden Neubauten aus. „Eine ggf. erforderliche vorzeitige Instandsetzung des Oberbaus ist berücksichtigt“, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme des Landesbetriebs zu der Einwendung, welche die CBG im Rahmen des Planfeststellungsverfahren eingereicht hatte.
Aber auch nach der Entscheidung der Bezirksregierung kann der Straßenbetrieb des Landes nicht einfach loslegen, denn die Initiativen haben gegen den Planfeststellungsbeschluss eine Klage eingereicht. Und die Proteste gehen ebenfalls weiter. So luden sich Umweltverbände, die CBG und andere Gruppen am 7 Dezember 2016 selbst zur Feier zu „125 Jahre BAYER in Leverkusen“ ein und vermiesten dem Global Player, seiner Gratulantin Hannelore Kraft und den anderen Gästen gehörig die Stimmung.
Drugs & Pills
BAYER-Psychopharmaka beteiligt
Arznei-Tests mit Heimkindern
In den 1950er Jahren begannen MedizinerInnen mit Medikamenten-Versuchen in Kinderheimen und Jugend-Psychiatrien. Dabei testeten sie auch Psychopharmaka von BAYER.
Von Jan Pehrke
Die bundesdeutschen Kinderheime haben eine dunkle Vergangenheit. Die Pharmazeutin Sylvia Wagner fügte dieser Geschichte jetzt ein weiteres skandalträchtiges Kapitel zu. Bei den Recherchen zu ihrer Dissertation fand sie heraus, dass in diesen Einrichtungen von den 1950er bis zu den 1970er Jahren Medikamenten-Versuche stattfanden. Damit nicht genug, testeten die MedizinerInnen auch in Jugendpsychiatrien Pillen.
Die Doktorandin stieß mit ihrer Arbeit sogleich weitere Nachforschungen an. Ein Team des NDR sah sich beispielsweise die Akten des Landeskrankenhauses Schleswig genauer an und fand Belege für Versuchsreihen mit BAYER-Arzneien. So erprobten MedizinerInnen der jugendpsychiatrischen Abteilung zwei Pharmazeutika des Pharma-Riesen. Das Neuroleptikum MEGAPHEN mit dem Wirkstoff Chlorpromazin testeten die ÄrztInnen als Therapeutikum gegen zu „zappelige“ SchülerInnen. 23 „anstaltsgebundenen Sonderschul-Kindern“ verabreichten sie es. Das Neuroleptikum AOLEPT mussten sogar 141 Kinder und Jugendliche schlucken. Dabei zeigten sich gravierende Nebenwirkungen wie etwa „Muskelverkrampfungen an den Augen, des Rückens und der mimischen Muskulatur“.
Die Ergebnisse der Pillen-Prüfungen publizierten die DoktorInnen in der Schriftenreihe des Hospitals, und dabei konnten sie es kaum erwarten, mit der nächsten Runde zu beginnen. „Die Industrie bemüht sich gegenwärtig schon um die Schaffung von Kombinationspräparaten, z. B. wurde uns gerade eine MEGAPHEN-Kombination folgender Zusammensetzung zur Erprobung an die Hand gegeben: Megaphen 25 mg, Atosil 5 mg, Reserpin 0,5 mg“, hieß es in der Veröffentlichung.
Weder die Kinder noch ihre Erziehungsberechtigten haben damals ihre Einwilligung zu den Tests erklärt. Zudem unterzogen die MedizinerInnen oftmals völlig gesunde Heranwachsende der Prozedur. Auch führten die ÄrztInnen in der Regel keine Voruntersuchungen durch. „Das ist ethisch problematische Forschung. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen: ‚Das ist ethisch unzulässige Forschung’“, sagt die Kieler Medizin-Ethikerin Alena Buyx deshalb. Selbst damaligen Standards habe das Vorgehen der ÄrztInnen nicht entsprochen, konstatiert die Wissenschaftlerin.
BAYERs Erklärung zu dieser ethisch problematischen Forschung fällt äußerst knapp aus. Dazu gebe es intern keine Unterlagen, verlautet aus der Konzern-Zentrale. Arznei-Tests mit den Schwächsten der Schwachen haben beim Pillen-Riesen allerdings eine unrühmliche Tradition. Das Unternehmen hat während des Dritten Reichs Medikamente gegen Fleckfieber und andere Präparate an KZ-Häftlingen ausprobiert. Und noch heute führt es klinische Erprobungen in armen Ländern wie Indien durch, weil dort unschlagbare Preise, schnellere Verfahren und eine mangelhafte Aufsicht locken.
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) fordert BAYER auf, Konsequenzen aus den Enthüllungen zu ziehen und die Opfer zu entschädigen. Überdies sieht die Coordination den Global Player in der
Pflicht, seinen Teil zur vollständigen Aufklärung des Skandals beizutragen.
Tiere & Versuche
Unsicherheitsfaktor Tierversuche
Von Menschen und Mäusen
In der Diskussion um Pestizid-Rückstände in Lebensmitteln wird oft angeführt, dass die Rückstandshöchstgehalte (RHG) „extra sicher“ wären. Eine beliebte Begründung: hohe „Sicherheitsfaktoren“ bei der Ableitung der aus Tierversuchen gewonnenen toxikologischen Grenzwerte. Diese Argumentation zeugt von einer Verkennung der Sachlage.
Von Lars Neumeister
Um die Giftigkeit eines Pestizids oder anderer Schadstoffe für den Menschen zu beurteilen, werden in der Regel immer noch viele Tierversuche gemacht. Dabei werden gesunde Labortiere einem einzelnen Stoff unter kontrollierten Bedingungen ausgesetzt und bestimmte Effekte und die Effektschwellen1 beobachtet. Aus diesen Beobachtungen2 werden dann toxikologische Grenzwerte, wie ADI/TDI oder ARfD abgeleitet.
Die Übertragung von Ergebnissen von Experimenten mit gesunden Labortieren zum Menschen in all seiner Vielfalt (Gesunde, Kranke, Gestresste, Alte, Junge, Föten usw.) ist aber sehr schwierig. Deswegen hat man in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts pauschal Faktoren3 eingeführt, die Unterschiede und Unwissen irgendwie berücksichtigen sollen:
1. Da man nicht sicher weiß, wie empfindlich ein Mensch im Vergleich zum Versuchstier ist, hat man einen Sicherheitsfaktor von 10 eingeführt.
2. Man geht pauschal davon aus, dass es innerhalb der menschlichen Bevölkerung Unterschiede in der Empfindlichkeit von maximal 10 geben kann – daraus leitet sich ein nochmaliger Faktor von 10 ab.
3. Ein zusätzlicher Faktor in beliebiger Höhe kann angewendet werden, wenn die Behörden wegen ungenügender Datenlage (z. B. fehlende Tests) zu wenig über die Giftigkeit eines Stoffes wissen.
Diese Unsicherheitsfaktoren wurden erfunden, weil man es in den 1950er Jahren nicht besser wusste. Sie sind also eher Unwissenheitsfaktoren. In der wissenschaftlichen Literatur werden sie dementsprechend häufig und richtig „uncertainty factors (UF)“ genannt4,5,6, und auch die US-amerikanische Umweltbehörde EPA verwendet fast ausschließlich diesen Begriff. Deshalb heißt es z. B in der IRIS Datenbank konsequent „UF“. Würden gesunde, standardisierte Labortiere die gleiche Empfindlichkeit gegenüber einem Stoff haben, wie z. B. ein unter Medikamenten stehender Kranker, ein sich entwickelnder Fötus usw., dann könnte man von „Sicherheitsfaktoren“ reden. Die gegenwärtigen Unsicherheitsfaktoren decken aber nicht einmal die spezielle Empfindlichkeit von Neugeborenen, Alten und Kinder ab (Dorne 20077; Dorne 20108). Sie spiegeln auch nicht ausreichend die Unterschiede zwischen den Arten wieder (Bokkers & Slob 20079).
Nicht alle Ratten sind gleich
Nicht einmal innerhalb einer Art kann man die Variabilität der Empfindlichkeit auf einen Faktor von 10 beschränken. Hier einige Beispiele:
1. Bei Fütterungsversuchen mit zwei verschiedenen Rattentypen (Fischer-Ratten10 und Sprague-Dawley-Ratten) wurde der gleiche Effekt einmal bei 20mg/kg pro Tag und einmal bei etwa 1600 mg/kg pro Tag beobachtet. Die Empfindlichkeit der Fischer-Ratten war in diesem Fall 800-mal höher als die der Sprague-Dawley-Ratten. Die gleichen Autoren führten ebenfalls Versuche mit Frauen durch und leiteten daraus einen weiteren „uncertainty factor“ von 200 für die Empfindlichkeit des Menschen ab (Boogaard et al 2012)11.
2. Wie unterschiedlich empfindlich verschiedene Rattentypen sein können, zeigt auch ein Infektionsversuch an fünf Rattentypen. Einer der Rattentypen hatte nach dem Versuch über 1000 Zysten im Gehirn, die anderen vier hatten gar keine (Gao et al. 2015)12.
3. Hermsen et al. (2015)13 untersuchten die genetische Struktur von 40 unterschiedlichen Laborratten-Typen und fanden allein zwischen den verschiedenen Varianten der Laborratten eine starke Variabilität. Wie stark die Variabilität ist, lässt sich aus dem Artikel allein allerdings nicht ableiten.
Selbst zwischen nah verwandten Arten kann es erhebliche Unterschiede geben, die Unsicherheitsfaktoren von 10 nicht berücksichtigen können. Bei Studien zur möglichen Schädigung des Immunsystems durch Pestizide hat die EPA z. B. festgestellt, dass ein Fungizid (Cyflufenamide) zwar das Immunsystem von Ratten, nicht aber das von Mäusen unterdrückt. Bei einem anderen Fungizid (Penthiopyrad) war es genau umgekehrt (US EPA 201314). Die gleiche Untersuchung zeigte für einige Pestizide auch erhebliche Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Tieren. Die Effektschwellen waren je nach Geschlecht 4-6 Mal höher bzw. niedriger (ebenda).
Menschen reagieren anders
Insgesamt ist die Übertragung der Ergebnisse von Tierversuchen auf den Menschen mit vielen Unsicherheiten behaftet. Eine vergleichende Studie der Pharmaindustrie zeigte, dass bei 30 Prozent der Untersuchungen (verglichen wurden Experimente mit 150 Medikamenten) zwar Symptome beim Menschen festgestellt wurden, aber keine bei Tieren (Olson et al. 200015). Am schlechtesten stimmten die Ergebnisse zwischen Tier- und Menschenversuchen bei Effekten an der Haut, dem Hormonsystem und dem Leber-Galle-Trakt überein (Dourson et al. 200116).
Unsicherheitsfaktoren, die berücksichtigen, dass der moderne Mensch täglich unzähligen Chemikalien gleichzeitig ausgesetzt ist, fehlen ganz und gar. Sehr viele Stoffe, denen wir ausgesetzt sind, wirken sehr ähnlich (siehe u. a. EFSA 201317), und diese Realität wird in der heutigen Risikobewertung komplett ausgeblendet. Bei der Bewertung der Pestizid-Rückstände für die Smartphone-App „Essen ohne Chemie“ wird dies aber berücksichtigt.
In meinem Artikel „Warum nicht gleich würfeln? – Über die Festlegung von Höchstgehalten von Pestiziden im Essen“ beschreibe ich, dass Rückstandshöchstgehalte (RHG) für Pestizide keiner Sicherheitsbewertung unterliegen. Die Risiko-Bewertung betrachtet einen willkürlich gewählten Rückstand, der im Schnitt 7-mal unter der gesetzlich erlaubten Menge im Essen liegt. Das ist so, als wenn man ein Fahrzeug für eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h zuließe, den Crash-Test aber mit 10 km/h machen würde. Für Pestizid-Rückstandshöchstgehalte bedeutet das mathematisch nichts weiter, als dass sich einer der vermeintlichen Sicherheitsfaktoren fast wieder aufhebt.
Zusammenfassend kann man sagen: Der gegenwärtige angewandte Unsicherheitsfaktor von 100 (10 x 10) wurde schon vor über 60 Jahren entwickelt (Dorne & Renwick 2005)18 und seitdem nicht mehr verändert. Er stellt eine politische Vereinbarung dar. Keine Sicherheit.
Zum Autor: Lars Neumeister betreibt den Blog „Essen ohne Chemie“, hat die Ratgeber-App „Essen ohne Chemie“ entwickelt und arbeitet selbstständig für Organisationen wie GREENPEACE, BUND, WWF und andere.
Fußnoten und Quellen
1 z. B. der „no observed adverse effect level“ (NOAEL) und der „lowest observed adverse effect level“ (LOAEL)
2 In den USA oder auf internationaler Ebene (z. B. Codex Alimentarius Commission) werden auch Daten aus Versuchen mit Menschen verwendet. Die EU akzeptiert solche Daten nicht.
3 Mathematisch gesehen handelt es sich nicht um einen Faktor, sondern um einen Divisor: der „no observed adverse effect level“ (NOAEL) wird durch 10 geteilt.
4 z. B. Gürtler R (2010): Safety of food additives from a German and European point of view. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 53(6):554-60. doi: 10.1007/s00103-010-1073-4.
5 Dorne JL (2010): Metabolism, variability and risk assessment. Toxicology 268(3):156-64. doi: 10.1016/j.tox.2009.11.004.
6 Raffaele KC & Rees C (1990): Neurotoxicology dose/response assessment for several cholinesterase inhibitors: use of uncertainty factors. Neurotoxicology 11(2):237-56
7 Dorne JL (2007): Human variability in hepatic and renal elimination: implications for risk assessment. Journal of Applied Toxicology (2007): 27(5):411-20
8 Dorne JL (2010): Metabolism, variability and risk assessment. Toxicology 268(3):156-64. doi: 10.1016/j.tox.2009.11.004.
9 Bokkers BG & Slob W (2007): Deriving a data-based interspecies assessment factor using the NOAEL and the benchmark dose approach. Critical Review of Toxicology 37(5):355-73.
10 Der volle Name ist „Fischer 344 Ratten“.
11 Boogaard PJ, Goyak KO, Biles RW, van Stee LL, Miller MS, & Miller MJ (2012): Comparative toxicokinetics of low-viscosity mineral oil in Fischer 344 rats, Sprague-Dawley rats, and humans–implications for an Acceptable Daily Intake (ADI). Regulatory Toxicology and Pharmacology, 63(1), 69-77.
12 Gao JM, Yi S, Wu MS, Geng GQ, Shen JL, Lu FL, Hide G, Lai DH, Lun ZR (2015): Investigation of infectivity of neonates and adults from different rat strains to Toxoplasma gondii Prugniaud shows both variation which correlates with iNOS and Arginase-1 activity and increased susceptibility of neonates to infection. Experimental Parasitology 149:47-53. doi: 10.1016/j.exppara.2014.12.008.
13 Hermsen R, de Ligt J. Spee W, Blokzijl F, Schäfer S, Adami E, Cuppen E (2015): Genomic landscape of rat strain and substrain variation. BMC Genomics, 16(1), 357. doi:10.1186/s12864-015-1594-1 Open Access Artikel
14 US EPA (2013): A Retrospective analysis of immunotoxicity studies (870.7800). Office of Pesticide Programs, U.S. Environmental Protection Agency (US EPA).
15 Olson H, Betton G, Robinson D, Thomas K, Monro A, Kolaja G, Lilly P, Sanders J, Sipes G, Bracken W, Dorato M, Van Deun K, Smith P, Berger B & Heller A (2000): Concordance of the toxicity of pharmaceuticals in humans and in animals. Regul. Toxicol. Pharmacol. 32, 56–67.
16 Dourson ML, Andersen ME, Erdreich LS & MacGregor JA (2001): Using human data to protect the public’s health. Regul Toxicol Pharmacol. 33(2):234-56.
17 EFSA (2014b): Scientific Opinion on the identification of pesticides to be included in cumulative assessment groups on the basis of their toxicological profile (2014 update). EFSA Journal 11(7):3293, 131 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3293
18 Dorne JL & Renwick AG (2005): The refinement of uncertainty/safety factors in risk assessment by the incorporation of data on toxicokinetic variability in humans. Toxicololgical Science 86(1):20-6. Open Access Artikel
Griff nach der Marktmacht
Mit dem Kauf von MONSANTO steigt der BAYER-Konzern zum mit Abstand größten Agrar-Unternehmen der Welt auf. Der Konzentrationsprozess der Branche erreicht damit einen vorläufigen Höhepunkt.
„Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir von der Qualität des Managements, der Qualität der Produkte, der Stärke der Innovationskraft und auch von der Kultur MONSANTOs sehr überzeugt sind“, erklärte BAYER-Chef Werner Baumann zum Abschluss der Übernahme-Verhandlungen mit dem US-amerikanischen Agro-Unternehmen. 128 Dollar zahlt der Leverkusener Multi pro Aktie – das bedeutet einen kräftigen Aufschlag gegenüber dem derzeitigen Kurs. Der Kaufpreis summiert sich so auf 66 Milliarden Dollar. 19 Milliarden davon will BAYER durch eine Eigenkapital-Erhöhung aufbringen; den Rest über Kredite von CREDIT SUISSE, der BANK OF AMERICA/MERRILL LYNCH und anderen Geldhäusern.
Der Deal ist der vorerst letzte Akt im neuerlichen Monopoly-Spiel der Agro-Industrie, die Aufzüge davor hatten DUPONT & DOW und CHEMCHINA & SYNGENTA bestritten. Im Düngemittel-Bereich schlossen sich POTASH und AGRIUM zusammen, und auch bei den Herstellern von Landmaschinen kam es zu Aufkäufen und Joint Ventures. In diesem Sektor beherrschen aktuell die Top 3 der Branche 50 Prozent des Weltmarkts.
„Endkampf um Marktanteile“
War die Konzentrationswelle vor 20 Jahren hauptsächlich von der Gentechnik getrieben, die den Zugriff auf Saatgut-Firmen verlangte, um in den Besitz des „Rohstoffes“ für die Laborfrüchte zu gelangen, so löste die schlechte Ertragssituation der LandwirtInnen das jetzige Revirement aus. In den USA rechnet das Landwirtschaftsministerium für dieses Jahr mit Einkommensrückgängen im zweistelligen Bereich auf das Niveau von 2009, was zur Kauf-Zurückhaltung bei Pestiziden und anderen Betriebsmitteln führt. Argentinien und Brasilien, die beiden größten Anbau-Länder in Lateinamerika, gehen derweil durch mehr oder weniger große Wirtschaftskrisen, und auch China kämpft aktuell mit sinkenden Wachstumsraten.
In einer solchen Situation erscheint es BAYER & Co. nicht sinnvoll, in den Ausbau der eigenen Kapazitäten zu investieren und etwa neue Pestizid-Fabriken zu bauen. Und da auch Arbeitsplatz-Vernichtungen und andere Rationalisierungsmaßnahmen die Renditen nicht mehr in dem von den Finanzmärkten gewünschten Maße erhöhen, gehen die Unternehmen auf Einkaufstour. „Wenn Du keine andere Option hast, mache einen Mega-Deal“, so resümiert der Wirtschaftsmedien-Konzern BLOOMBERG die Gedankengänge in den Chef-Etagen. Auf diese Weise können die Firmen nämlich selbst in Zeiten der Flaute noch Boden gutmachen. Von „einer Art Endkampf um Marktanteile“ spricht die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung in diesem Zusammenhang.
Kämen alle Transaktionen vollumfänglich zustande, was noch nicht ausgemacht ist, da die Zustimmung der Kartellbehörden und in manchen Fällen auch diejenige der AktionärInnen – bei MONSANTO findet die entsprechende Versammlung am 13. Dezember statt – noch aussteht, ginge der Leverkusener Multi als klarer Sieger aus diesem Endkampf hervor. Die Geschäftszahlen von 2015 zugrunde gelegt, erzielen die Landwirtschaftssparten von BAYER und MONSANTO zusammen einen Umsatz von 23,1 Milliarden Dollar. Damit kann niemand aus der Branche mithalten. Die frisch vermählten Paare bzw. arrangierten Zwangsehen SYNGENTA/CHEMCHINA und DUPONT/DOW folgen mit weitem Abstand (14,8 bzw. 14,6 Milliarden), und auf Rang vier landet abgeschlagen BASF mit 5,8 Milliarden. Bei den Pestiziden erreichen BAYER und MONSANTO zusammen einen Marktanteil von rund 25 Prozent, beim Saatgut für gentechnisch veränderte und konventionelle Ackerfrüchte einen von rund 30 Prozent. Allein die Gen-Pflanzen betrachtet, erlangen die beiden Konzerne vereint mit weit über 90 Prozent sogar eine Monopol-Stellung. Entsprechend besorgt reagierte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG). „Wir schlagen Alarm: ‚Wer das Saatgut kontrolliert, beherrscht die Welt’, hat Henry Kissinger einmal gesagt. Durch die Übernahme droht ein weltweites Lebensmittel-Monopol. Die Welternährung gerät in ernste Gefahr“, so Axel Köhler-Schnura vom Vorstand der CBG.
Risiken und Nebenwirkungen
Der Deal hat jedoch noch weitere negative Folgen. „Der Merger wird den Landwirten wehtun“, sagt Jim Benham von der INDIANA FARMERS UNION: „Je mehr Konsolidierung wir bei den Anbietern unserer Betriebsmittel haben, desto schlimmer wird’s.“ Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums haben sich allein die Preise für Mais- und Baumwoll-Saatgut in den vergangenen 20 Jahren vervierfacht. Und BAYER schickt sich an, diese Tradition fortzusetzen. Der Chef von BAYER CROPSCIENCE, Liam Condon, schloss gegenüber der New York Times weitere Preis-Steigerungen auch gar nicht erst aus. Allerdings versicherte er scheinheilig, der Konzern würde den FarmerInnen dafür in jedem Fall einen Mehrwert bieten.
Überdies reduziert die Übernahme die Produkt-Vielfalt. Die oligopol-artigen Strukturen haben jetzt schon einen riesigen Innovationsstau mit sich gebracht, und die neue Übersichtlichkeit dürfte die Malaise noch verstärken. An eine Landwirtschaft ohne Chemie verschwenden die Unternehmen sowieso keinen Gedanken, sie schaffen es noch nicht einmal, Ersatz für ihre Alt-Mittel zu finden. BAYERs Glufosinat oder MONSANTOs Glyphosat haben schon über 40 Jahre auf dem Buckel. Deshalb trotzen immer mehr Unkräuter diesen Substanzen. Den LandwirtInnen bleibt so nichts anderes übrig, als die Gift-Dosis zu erhöhen. Und der Leverkusener Multi leugnet diesen Tatbestand keineswegs. „Seit über 25 Jahren hat die weltweite Pflanzenschutz-Industrie kein wirtschaftlich bedeutendes Herbizid mit neuem Wirkmechanismus mehr für Flächen-Kulturen entwickelt und auf den Markt gebracht – unter anderem eine Folge der Konsolidierung der Industrie, die mit einer deutlichen Reduktion der Forschungsaufwendungen für neue Herbizide einherging“, so der BAYER-Forscher Dr. Hermann Stübler. Warum denn auch nach Neuem suchen, wenn es kaum Konkurrenz gibt und der Zugang zu dem, was Stüblers Boss Werner Baumann „den Profit-Pool der Branche“ nennt, so bequem ist? Der vom Leverkusener Multi mitgegründete Chemie-Monopolist IG FARBEN ging seinerzeit den Weg, zur Sicherung der Innovationskraft miteinander im Wettstreit um Entdeckungen liegende Abteilungen aufzubauen, dies scheint für Baumann & Co. bisher jedoch keine Option zu sein.
Synergie-Effekte
Die Beschäftigten von MONSANTO und BAYER müssen sich ebenfalls auf härtere Zeiten einstellen, obwohl Baumann am Tag der Vertragsunterzeichnung verkündete: „Dieser Zusammenschluss bietet eine großartige Gelegenheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Zunächst einmal sehen sich die rund 140.000 Belegschaftsangehörigen der beiden Konzerne mit den bei solchen Deals immer wieder gerne beschworenen Synergie-Effekten konfrontiert. Diese taxiert der Leverkusener Multi auf 1,5 Milliarden Dollar schon drei Jahre nach dem Vollzug der Übernahme. Dabei entfallen 1,2 Milliarden auf Kosten-Synergien und 300 Millionen auf Ertragssynergien. Wie viele Jobs das genau kostet, konnte der Vorstandsvorsitzende noch nicht sagen: „Das haben wir (...) nicht in Arbeitsplätze umgerechnet.“ Einspar-Potenziale sieht der Global Player aber unter anderem bei der Infrastruktur, bei den IT-Aufwendungen, beim Vertrieb, beim Einkauf und in der Forschung. So kündigte Liam Condon schon einmal die Schließung von Labors im US-amerikanischen Cropscience-Headquarter an, das in North Carolinas „Triangle Research Park“ liegt.
Da sich das Sortiment der beiden Unternehmen jedoch kaum überschneidet, dürften sich die unmittelbar mit dem Vollzug der Übernahme verbundenen Job-Streichungen zunächst einmal in Grenzen halten. Größere Unbill droht erst später, wenn die Kartell-Behörden den Deal prüfen und vor der Aufgabe stehen, trotz des neuen Big Players wenigstens Reste von Wettbewerb in dem Sektor zu retten. BAYER und MONSANTO selber kalkulieren schon ein, sich von Geschäften in einem Umfang von bis zu 1,6 Milliarden Umsatz trennen zu müssen. Sollten sich aber die Wettbewerbskommission der EU und ihre Pendants in den anderen Ländern nicht daran orientieren und stattdessen eigene Rechnungen anstellen, könnte es noch mehr werden. Wenn dieses Paket dann irgendwann zu BASF oder einem anderen Agro-Riesen wandert, beginnt der zweite Akt im Spiel um die Synergie-Effekte, und für einen Teil der Beschäftigten dürfte dieser ohne Happy End ausgehen.
Damit nicht genug, entsteht Druck auf die Belegschaft auch durch die hohen Schulden, die der Leverkusener Multi sich in Sachen „MONSANTO“ aufgebürdet hat. Vernichtung von Arbeitsplätzen in diesem Zusammenhang hat der Konzern nur für die Bundesrepublik ausgeschlossen. „Rationalisierungsmaßnahmen zur Finanzierung der Akquisition werden in Deutschland nicht stattfinden“, heißt es in einer mit dem Gesamtbetriebsrat geschlossenen Vereinbarung. Das Abstoßen einzelner Sparten treibt der Global Player jedoch bereits kräftig voran. Noch während der Verhandlungen mit dem MONSANTO-Management hat er bekanntgegeben, sich vom Dermatologie- und vom Kontrastmittel-Geschäft trennen zu wollen. Auch die Tiermedizin-Abteilung steht auf der Kippe. Pläne für solche „De-Investitionen“ mit den entsprechenden Entlassungen existieren zwar teilweise schon länger, aber die MONSANTO-Übernahme macht ihre Realisierung zweifelsohne dringlicher und sicher auch umfangreicher. Zudem sind Effizienz-Programme, also weitere Job-Streichungen, zur Verringerung der Schuldenlast zu befürchten. Vor welche Probleme BAYER die Finanzierung des Deals stellt, machten die Schwierigkeiten deutlich, die der Konzern mit der Platzierung seiner vier Milliarden Euro schweren Wandelanleihe am Markt hatte. Er musste den institutionellen Investoren dafür eine Verzinsung von 5,625 Prozent bieten, was prompt den Aktien-Kurs auf Talfahrt brachte. Seine Rendite-Ziele jedenfalls hat die Aktien-Gesellschaft zur Beruhigung der Finanzmärkte schon eine Woche nach der Vertragsunterzeichnung hochgesetzt.
Nicht nur deshalb teilt die Belegschaft die Begeisterung des Managements keineswegs. „Wir legen uns mit dem Teufel ins Bett“, „Das passt nicht zusammen“ – mit solchen Reaktionen konfrontierte die Wirtschaftswoche den Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Wenning. Der jedoch wiegelte ab: „Das spiegelt nicht die Stimmung bei BAYER wider. Nachdem der Vorstand die Transaktion eingehend erläutern konnte, hat die Übernahme bei den Mitarbeitern sehr viel Zustimmung erfahren.“ Wenn das wirklich so wäre, hätte der Konzern den Beschäftigten jedoch kaum untersagen müssen, mit JournalistInnen über den MONSANTO-Deal zu sprechen. Und als die Zeitschrift mit Verweis auf die Trennung von der Chemie- und der Kunststoff-Sparte den Dauerumbau beim Chemie-Multi ansprach und fragte: „Müssen Manager heute kreative Zerstörer sein?“, war Wenning not amused. „Das Wort ‚Zerstörer’ stört mich“, antwortete er und hob zu Erfolgsstorys über die Abspaltungen LANXESS und COVESTRO an.
Die Standort-Städte müssen sich ebenfalls auf so einiges gefasst machen. Ihnen ist die letzte Einkaufstour des Multis noch in denkbar schlechter Erinnerung. Unmittelbar nach dem Kauf der MERCK-Sparte mit den nicht rezeptpflichtigen Arzneien hatte der Multi nämlich verkündet: „BAYER rechnet ab dem ersten Jahr nach dem Vollzug mit signifikanten Steuer-Einsparungen.“ Und prompt hat er die Akquisition dann auch von der Steuer abgesetzt, dabei die erweiterten Möglichkeiten der „Unternehmenssteuerreform“ von 2001 nutzend, für die der ehemalige BAYER-Finanzchef Heribert Zitzelsberger als Staatssekretär im Finanzministerium eine wesentliche Verantwortung trug. Vor allem den Stammsitz Leverkusen trieb der MERCK-Erwerb deshalb noch einmal tiefer in die Verschuldung.
All diese Risiken und Nebenwirkungen lassen nicht einmal die wirtschaftsfreundlichen Zeitungen unberührt. Die Faz, an dessen Vorläufer, der Frankfurter Zeitung, die IG Farben bis zu 49 Prozent der Geschäftsanteile hielt, sieht „die Ego-Strategie einfallsloser Manager auf der Suche nach Boni auf dem Fusionspfad“ am Werk und zweifelt daran, ob die Probleme der Welternährung auf diesem Weg zu lösen sind: „Für Innovationen braucht man Größe nicht.“ Das Handelsblatt listet derweil die Vielzahl der nicht eben erfolgreichen Merger auf, und die New York Times verweist dazu auf eine Studie der Rating-Agentur STANDARD & POOR’S, wonach das neue Unternehmensganze oftmals weniger ist als die Summe seiner alten Teile. „In general ‚M & A’-Deals underperform“, mit diesen Worten zitiert das Blatt den STANDARD & POOR’S-Analysten Richard Tortoriello. Zu dessen Befund von der Zeitung befragt, gab sich ein BAYER-Sprecher zugeknöpft – er lehnte jeden Kommentar ab.
Sogar Finanzinvestoren wie JUPITER und HENDERSON sprachen sich gegen den MONSANTO-Kauf aus, weil sie sich vom Pharma-Geschäft einträglichere Renditen versprechen und um die Arznei-Investitionen bangen. Nicht einmal bei BAYER selbst herrschte Einigkeit über den Coup. Der frühere BAYER-Chef Marijn Dekkers lehnte die Übernahme im Gegensatz zu Baumann und dem Aufsichtsratschef Werner Wenning ab und zog deshalb seinen ohnehin schon geplanten Abgang noch einmal vor. Der von ihm verpflichtete PR-Chef Herbert Heitmann ging ebenfalls, nicht ohne dem „‚Pre-MONSANTO’-BAYER“ auf Twitter eine Träne nachzuweinen.
Die Rolle von BLACKROCK
Aber wer trieb den Deal dann voran? Das waren vor allem die großen Finanzmarkt-Akteure mit dem Branchen-Primus BLACKROCK an der Spitze. Der Vermögensverwalter gebietet über rund fünf Billionen Dollar. Diese Summe, hinter der das Kapital von Groß- und KleinaktionärInnen, von Rentenfonds, vor allem aber auch vieler Ultra-Reicher steckt, übersteigt das Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik um mehr als das Dreifache.
Die Mutter aller Investment-Gesellschaften hält sich nicht mit Detail-Analysen auf wie JUPITER und andere Unternehmen. Sie durchleuchtet nicht die Produkt-Pipelines der Global Player auf der Suche nach besonders zukunftsträchtigen Anlage-Möglichkeiten und hält auch nicht nach besonders attraktiven Firmen Ausschau. So reichen ihr fünf Angestellte zur Betreuung der ca. 600 Unternehmensbeteiligungen in Europa, während bei HERMES EQUITY ein Beschäftigter für bloß zehn bis zwanzig Firmen zuständig ist. Der Finanz-Mogul agiert anders. Er hat Aktien fast aller großen Konzerne im Depot und investiert hauptsächlich in Fonds, die Aktien-Indizes wie den Dax oder den Dow Jones nachbilden.
BLACKROCK gehören nicht nur BAYER-Papiere im Kurswert von ca. 5,2 Milliarden. Euro, sondern auch MONSANTO-Aktien für rund 2,6 Milliarden. Euro. Beim Leverkusener Multi nimmt er damit die Position des größten Investors ein, beim US-Multi die des zweitgrößten. Andere Finanz-Investoren halten ähnliche Crossover-Beteilungen mit entsprechenden Interessen. VANGUARD zum Beispiel ist die Nr. 1 bei MONSANTO und die Nr. 4 bei BAYER, CAPITAL bei beiden Unternehmen die Nr. 3. Sie sitzen somit an beiden Seiten des Verhandlungstisches und können ihre Profite somit bestens optimieren.
BLACKROCK agiert als eine Art ideeler Gesamtkapitalist, dem am Maximal-Profit des großen Ganzen liegt. Übernahmen und Fusionen sind dabei das probate Mittel. Diese treibt der Konzern bei jeder Gelegenheit voran. Jüngst forderte er solche Transaktionen etwa im Finanz-Sektor. „Der europäische Banken-Markt ist überbesetzt, deshalb müssen auch grenzüberschreitende Fusionen möglich sein“, verlangte der BLACKROCK-Manager Philipp Hildebrand Anfang des Monats in der Faz. Im Zuge der Verhandlungen zwischen BAYER und MONSANTO erhöhte er rasch seinen Aktien-Anteil von fünf auf sieben Prozent. Bei dem Kauf-Angebot von 128 Dollar pro Papier streicht der Vermögensverwalter allein dadurch rund eine Milliarde Euro ein. Vor allem aber setzt er bei seiner Strategie auf das, wovor die LandwirtInnen so viel Angst haben: steigende Preise. Mit den höheren Margen steigen nämlich die Profite.
Und genau das strebt BLACKROCK nicht nur mit dem Forcieren von Mergern, sondern auch mit den flächendeckenden Branchen-Engagements an – äußerst erfolgreich, wie der Finanz-Ökonom Martin Schmalz in einer Studie herausfand. Der Dozent der University of Michigan untersuchte die Folgen eines verstärkten BLACKROCK-Investments in Flug-Gesellschaften und wies überdurchschnittliche Preissteigerungsraten nach. Und die machen zur Freude des Anlegers die ganze Branche profitabler, während der Konkurrenzkampf um Markt-Anteile für einen so breit aufgestellten Finanzinvestor wie BLACKROCK nur ein Nullsummenspiel darstellt.
BLACKROCK realisiert also ein höchst attraktives Geschäftsmodell. Allerdings ist es in letzter Zeit etwas in Verruf geraten. „Die Monopol-Kommission sieht ein wesentliches wettbewerbsverzerrendes Potenzial“, heißt es im diesjährigen Hauptgutachten der Kartellwächter über BLACKROCK & Co. Achim Wambach, der Leiter der Kommission, fordert deshalb von der Wettbewerbsbehörde der EU, deren Treiben auch zum Gegenstand des Prüfverfahrens zur Genehmigung des MONSANTO-Deals zu machen. „Der US-Investor BLACKROCK ist an beiden Unternehmen zu sechs bis sieben Prozent beteiligt. Hier schließen sich also zwei Unternehmen zusammen, die zu Teilen dem gleichen Eigentümer gehören. Außerdem halten BLACKROCK und andere institutionelle Anleger gleichzeitig an allen großen Konkurrenten dieser beiden Unternehmen Anteile. Das sollten die Behörden beachten“, sagte er der Rheinischen Post. Und zumindest die US-amerikanische „Federal Trade Commission“ hat schon einmal angekündigt, das Agieren des Vermögensverwalters in den Blick nehmen zu wollen. Der Finanz-Konzern selbst weist dabei alle Anschuldigungen zurück. „Die Idee, dass wir unsere Anteile auf ganze Industrie-Zweige verteilen, (...) anstatt zu versuchen, aus jedem einzelnen Investment das Beste herauszuholen, ist falsch“, so BLACKROCK-Sprecher Ed Sweeney. Als der The Street-Journalist dann aber nachhakte und fragte, wann der Finanzmogul denn bei einem einzelnen Unternehmen zuletzt einmal eine aktive Rolle gespielt habe, konnte Sweeney nur ein Beispiel nennen.
Dabei tut sein Arbeitgeber das sehr wohl, wenn sich die Dinge nicht in dem gewünschten Sinne entwickeln oder wichtige Entscheidungen anstehen. Den Druck von Seiten der Finanzinvestoren wird BAYER auch nach der MONSANTO-Übernahme noch spüren. Irgendwann haben diese sich nämlich genügend an den abfallenden Synergie-Effekten gelabt und sinnen nach neuen Gaumenfreuden. Da aber, was „Mergers & Acquisitions“ betrifft, in der Branche kaum noch Luft nach oben ist, stellt sich die Frage, wie die Entwicklung weitergeht. Zur Wahl stände außer einem Duopol oder einem wirklichen Monopol nur noch, BAYER oder auch BASF zu zwingen, ihre Agro-Sparten an die Börse zu bringen, ähnlich wie es DOW und DUPONT planen. Das würde nämlich Extra-Geld in die Kasse spülen.
Ein paar Auflagen
Erst einmal müssen die Agro-Deals allerdings das Prüf-Prozedere der Wettbewerbsbehörden durchlaufen. MONSANTO hat sich vorsorglich im Vertrag schon einmal eine Ausfallgarantie in Höhe von zwei Milliarden Dollar zusichern lassen, falls die Sache schief geht. Das steht zwar nicht zu erwarten, aber unbeschadet dürfte der Leverkusener Multi den Prozess kaum überstehen. „Wir werden eine Markt-Analyse berücksichtigen, die sich mit den Folgen eines solchen Zusammenschlusses für die Landwirte beschäftigt“, gab die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager die Richtung vor. Auch die Auswirkungen auf die Forschungsleistungen und die VerbraucherInnen will die Dänin zum Gegenstand des Verfahrens machen. Die Folgen für die Arbeitsplätze und das Steuer-Aufkommen der Standort-Städte fehlen jedoch auf ihrer Agenda. Nicht nur deshalb sieht BAYER-Chef Werner Baumann dem Ganzen eher entspannt entgegen. „Ich war in der vergangenen Woche in Brüssel. Dort kam klar zum Ausdruck, dass die Europäische Kommission sachorientiert entscheidet“, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Und in der Tat wäre es sehr verwunderlich, wenn die Auflagen zum Verkauf einzelner Geschäftsbereiche zu wesentlich größeren Umsatz-Einbußen als den 1,6 Milliarden Dollar führten, die der Leverkusener Multi selbst veranschlagt hat.
Von dieser Seite her ist also kaum mit ernsthaften Schritten gegen das Projekt zu rechnen, das laut Baumann dazu dient, die Welternährung zu sichern. Eine solche Mission kaufen ihm jedoch noch nicht einmal die konservativen Zeitungen ab. Als eine „stets etwas salbungsvoll klingende Kapitalmarkt-Story für den Mega-Deal“ bezeichnete etwa die Faz die diesbezüglichen Aussagen des Vorstandsvorsitzenden. Und in der Tat hat BAYER & Co. das Schicksal der Menschen im Tschad, in Sambia oder anderen armen Länder nie groß interessiert, und das wird es auch in Zukunft nicht tun. Der agro-industrielle Komplex hat nur ein Interesse: seinen Profit zu steigern. Und dafür produziert er vornehmlich Soja- und Mais-Monokulturen für die Futtertröge der Massentierhaltung, lässt er hochriskante Verfahren wie die Gentechnik zum Einsatz kommen und bringt er immer mehr Gifte auf die Felder, statt nach Alternativen Ausschau zu halten. Sowohl BAYER als auch MONSANTO haben in ihrer Geschichte eindrucksvolle Belege für eine menschenverachtende Haltung geliefert, der Renditen über alles gehen. Dafür stehen auf der Seite des Leverkusener Multis hauptsächlich die Entwicklung von chemischen Kampfstoffen und die Beteiligung am Holocaust, auf Seiten des US-Unternehmens AGENT ORANGE und der skrupellose Umgang mit den LandwirtInnen.
DIE COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN versucht deshalb, gemeinsam mit anderen Initiativen ein breites gesellschaftliches Bündnis zu organisieren, um dem Treiben von BAYER & Co. Einhalt zu gebieten. Erste Schritte dazu unternahm die Coordination auf dem MONSANTO-Tribunal in Den Haag. Dabei darf es nach Ansicht der CBG nicht bei Forderungen nach einem sofortigen Glyphosat-Stopp, einem wirksameren Schutz vor der Gentechnik und einer Beschränkung der ökonomischen Macht der Agro-Riesen bleiben. Vielmehr müssen auch die Eigentumsfragen auf die Agenda der konzern-kritischen Bewegung, denn ein Sektor, dem die Versorgung der Menschheit mit Nahrungsmitteln obliegt, bedarf der demokratischen Kontrolle. Eine Handhabe dazu böte etwa der Vergesellschaftungsparagraf der nordrhein-westfälischen Landesverfassung.
AKTION & KRITIK
CBG-Jahrestagung 2016
Aus gegebenem Anlass widmete die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) ihre diesjährige Jahrestagung dem Thema: „BAYER/MONSANTO – Tod auf den Äckern, Gifte im Essen“. Zu Beginn referierte Uli Müller von LobbyControl über die vielfältigen Möglichkeiten der Agro-Riesen., Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Bei den Verhandlungen zum Freihandelsabkommen TTIP, das die EU und die USA zurzeit verhandeln, hatten die Konzerne Müller zufolge „auf beiden Seiten die Finger im Spiel“. Über ihre Lobby-Organisationen wie die „European Crop Protection Association“ oder „Croplife America“ versuchten die Multis beiderseits des Atlantiks, niedrigere Auflagen für Pestizide und Gen-Pflanzen durchzudrücken. Und Brüssel diente sich ihnen dabei zu allem Übel auch noch als williger Helfer an. Dies belegte der Politikwissenschaftler mit Zitaten aus Briefwechseln. So erbat die Europäische Kommission von BAYER & Co. etwa Informationen darüber, „wie wir die Rahmenbedingungen für die Industrie verbessern können“. Der grüne Europa-Abgeordnete Sven Giegold widmete sich anschließend dem Agrar-Markt der EU. Am Beispiel einer Studie über Saatgut zeichnete er die Entwicklung zu einer immer größeren Konzentration der Anbieter nach, die mit den angekündigten Zusammenschlüssen von BAYER/MONSANTO, DOW/DUPONT und SYNGENTA/CHEMCHINA einem vorläufigen Höhepunkt zustrebt. Die bei der Europäischen Kommission für die Prüfung der Deals verantwortliche Wettbewerbskommissarin Margrethe Verstager versicherte dem einstigen ATTAC-Aktivisten, die Untersuchung werde bei dem Verfahren eine Rolle spielen. Giegold setzt auf solche Einflussmöglichkeiten und plädierte im Übrigen für eine Arbeitsteilung zwischen parlamentarischen und außerparlamentarischen Initiativen: „Den Lärm müsst ihr machen.“ Dazu erklärte sich der neue CBG-Geschäftsführer Toni Michelmann zu Beginn seines Vortrags auch gerne bereit. Mit dem Bekenntnis: „Ich bin zum Krawall machen hier“ begann er seinen Vortrag. Dann skizzierte er die ungeheure Macht des Leverkusener Unternehmens und gab ein Bild davon, was der Menschheit blüht, wenn es dem Global Player gelingen sollte, sich MONSANTO einzuverleiben: Eine durch Glyphosat & Co. vergiftete Welt mit grünen Wüsten, auf denen nichts mehr kreucht und fleucht. Der Chemiker zeigte sich jedoch guter Hoffnung, dass es nicht so weit kommt. Er berichtete vom Den Haager MONSANTO-Tribunal und der angegliederten People’s Assembly, wo die CBG viele Kontakte knüpfte und zur nächsten BAYER-Hauptversammlung bereits konkrete Aktionen gegen die „Hochzeit des Todes“ verabredete. Und so traten die rund 60 BesucherInnen der CBG-Jahrestagung ihre Heimreise am Abend dann in dem Bewusstsein an, dem Monopoly-Spiel der Agro-Riesen nicht hilflos ausgeliefert zu sein.
ForscherInnen für GAUCHO-Stopp
Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide wie BAYERs Saatgutbehandlungsmittel GAUCHO (Wirkstoff: Imidacloprid) und PONCHO (Clothianidin) haben einen wesentlichen Anteil am weltweiten Bienensterben. Die EU hat einige dieser Agrochemikalien deshalb schon mit einem vorläufigen Verkaufsbann belegt. Vielen WissenschaftlerInnen reicht dies jedoch nicht aus. In einer „Resolution zum Schutz der mitteleuropäischen Insektenfauna, insbesondere der Wildbienen“ fordern 77 BiologInnen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) deshalb auf, „ein vollständiges Verbot von Neonicotinoiden, mindestens aber ein vollständiges, ausnahmsloses Moratorium für ihren Einsatz bis zum wissenschaftlich sauberen Nachweis ihrer Umweltverträglichkeit“ zu erlassen. Zudem verlangen die ForscherInnen in dem Schriftstück Maßnahmen zur Erhöhung der Strukturvielfalt von Kulturlandschaften und ein Insekten-Langzeitmonitoring.
Aktion bei BAYER in Belgien
Am 4. November 2016 schlug am BAYER-Sitz im belgischen Diegem die Natur zurück. Verkleidet in Tier-Kostüme, statteten AktivistInnen der Initiative EZLN der Niederlassung des Leverkusener Multis einen Besuch ab und gestalteten die Eingangshalle mit etwas Laub, Erde und Geäst um. Zudem brachten die EZLNlerInnen ein Transparent mit der Aufschrift „BAYER-MONSANTO – TTIP kills life“ an. Damit protestierten sie gegen das zwischen der EU und den USA geplante Freihandelsabkommen, das niedrigere Standards bei der Regulierung von Pestiziden, hormon-wirksamen Substanzen und anderen Stoffen vorsieht und aus eben diesen Gründen von den Konzernen mit aller Lobby-Macht vorangetrieben wird. „Es ist dringend nötig, die Einflussnahme des Privatsektors auf die Politik zu stoppen“, erklärte die Organisation, dabei nicht nur auf TTIP, sondern auch auf die Obstruktion des Klimaschutzes verweisend.
Petition gegen Hormon-Gifte
Chemische Stoffe haben viele gesundheitsgefährdende Eigenschaften. Eine der unheimlichsten: Manche Substanzen wirken ähnlich wie Hormone und können damit den menschlichen Organismus gehörig durcheinander wirbeln (siehe auch SWB 4/16). Pestizide des Leverkusener Multis wie RUNNER, PROVOST OPTI, FOLICUR und NATIVO oder Industrie-Chemikalien made by BAYER wie Bisphenol A sind deshalb imstande, Krebs, Diabetes, Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit und andere Gesundheitsstörungen auszulösen. Hormonell wirksame Ackergifte wollte die EU eigentlich schon 2009 im Rahmen einer Neuordnung der Zulassung verbieten. Dazu kam es allerdings nicht. Nach Ansicht Brüssels galt es zunächst, genaue Kriterien zur Definition der Pseudo-Hormone – sogenannter „endokriner Disruptoren“ (EDCs) – zu entwickeln. Mit drei Jahren Verspätung legte die Europäische Kommission den entsprechenden Entwurf im Sommer 2016 vor. Die Bestimmungen kehren jedoch die Beweislast um und fordern eindeutige Belege für die gesundheitsschädliche Wirkung der EDCs; ein plausibler Verdacht reicht Juncker & Co. nicht aus. Da dies nicht dem Vorsorge-Prinzip entspricht, hat das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK die Online-Petition „Gesundheit geht vor – Hormon-Gifte stoppen“ initiiert, welche der BUND, die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und zahlreiche andere Initiativen mittragen. So konnte das Bündnis der Bundesumweltministerin Barbara Hendricks am 30.11.2016 rund 100.000 Unterschriften übergeben.
Petition gegen CIPROBAY & Co.
BAYERs CIPROBAY hat ebenso wie andere Antibiotika aus der Gruppe der Fluorchinolone zahlreiche Nebenwirkungen (siehe auch RECHT & UNBILLIG). Am häufigsten treten Gesundheitsstörungen im Bereich der Sehnen, Knorpel, Muskeln und Knochen oder des Nervensystems auf. Aber auch Herzinfarkte, Unterzuckerungen, Hepatitis, Autoimmun-Krankheiten und Leber- oder Nierenversagen zählen zu den Risiken. Bundesdeutsche Geschädigte haben nun auf der „We act“-Plattform des Aktionsnetzwerks CAMPACT eine Petition veröffentlicht. Darin fordern sie das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) und die europäische Arzneimittel-Behörde EMA auf, mehr Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Sie verlangen von den Institutionen, den Einsatz der zu den Reserve-Antibiotika zählenden Mittel auf lebensbedrohliche Situationen zu beschränken. BAYER & Co. müssten zudem zum Anbringen eines Warn-Symbols auf den Packungen und zu Unverträglichkeitstests vor dem Verschreiben der Arzneien gezwungen werden, so die AktivistInnen. Anfang Oktober 2016 hatten schon über 2.000 Personen die Petition unterschrieben.
KAPITAL & ARBEIT
Entlassungen in Mission Bay
BAYER stellt am Standort Mission Bay nahe San Francisco die Forschungen zu Blut- und Augenkrankheiten ein und streicht die Stellen der WissenschaftlerInnen, die auf diesen Gebieten gearbeitet haben.
Werksfeuerwehr-Leute bessergestellt
Seit Jahren kämpft die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE um eine Besserstellung der Beschäftigten bei den Werksfeuerwehren. Schon im Jahr 2014 kam es in der Sache zu einer Protest-Veranstaltung vor dem BAYER-Casino. Aber die Chemie-Industrie schaltete immer auf stur. Darum musste sich eine höhere Instanz damit befassen: Zum ersten Mal seit 20 Jahren traten die „Tarifpartner“ der Branche in ein Schlichtungsverfahren ein. Und erst im Zuge dieses Prozederes zeigten sich BAYER & Co. zu Zugeständnissen bereit. Sie garantieren nun den Feuerwehr-Leuten – allein bei der 60-prozentigen BAYER-Tochter CURRENTA arbeiten rund 360 – Ersatz-Arbeitsplätze, wenn diese aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sein sollten, die anspruchsvolle Tätigkeit auszuüben. Auch Zuschläge für Nacht-Einsätze und sonntägliche Dienste zahlen die Unternehmen jetzt.
KONZERN & VERGANGENHEIT
Arzneitests in Kinderheimen
Ausgehend von den Recherchen der Pharmazeutin Sylvia Wagner machen seit einiger Zeit Meldungen über Arznei-Tests in Kinderheimen und Jugend-Psychiatrien Schlagzeilen, die zwischen den 1950er und 1970er Jahren stattfanden. Ende November 2016 stießen ReporterInnen des NDR auf Unterlagen des Landeskrankenhauses Schleswig, die Versuche auch mit BAYER-Medikamenten dokumentieren (siehe auch SWB 1/17). So erprobten MedizinerInnen der jugendpsychiatrischen Abteilung zwei Pharmazeutika des Pillen-Riesen, ohne dafür eine Einwilligung der ProbandInnen oder ihrer Erziehungsberechtigten eingeholt zu haben. Das Neuroleptikum MEGAPHEN mit dem Wirkstoff Chlorpromazin testeten die ÄrztInnen als Therapeutikum gegen zu „zappelige“ SchülerInnen. 23 „anstaltsgebundenen Sonderschul-Kindern“ verabreichten sie es. Das Neuroleptikum AOLEPT mussten sogar 141 Kinder und Jugendliche schlucken. Dabei zeigten sich gravierende Nebenwirkungen wie etwa „Muskelverkrampfungen an den Augen, des Rückens und der mimischen Muskulatur“. Die Kieler Medizin-Ethikerin Alena Buyx hält die Praxis sogar nach damaligen Maßstäben für höchst problematisch. „Das ist ethisch unzulässige Forschung“, urteilte sie in dem NDR-Bericht.
IG FARBEN & HEUTE
IG-Manager bleibt KIT-Ehrensenator
Über ihren Nachruhm können sich viele Manager des von BAYER mitgegründeten Mörder-Konzerns IG FARBEN nicht beklagen. So lebt etwa Carl Wurster nicht nur im Straßenbild von Ludwigshafen weiter, wo ein Platz nach dem ehemaligen Wehrwirtschaftsführer benannt ist. Beim Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat es der Chemiker, der für die IG im Aufsichtsrat des Zyklon B-Produzenten DEGESCH saß, sogar zum Ehrensenator gebracht. Davon ließ sich das KIT nicht einmal durch massive Proteste abbringen. Es bedauert zwar, „dass es Ehrungen von Personen gab, die in Aktivitäten des nationalsozialistischen Unrechtsstaats verstrickt waren“, ist aber dennoch „der vorherrschenden Rechtsauffassung gefolgt, dass die Ehrung als höchstpersönliches Recht mit den Tod des/der Geehrten erlischt und damit eine nachträgliche Aberkennung faktisch nicht mehr möglich ist“.
POLITIK & EINFLUSS
Hannelore Kraft bei BAYER
Am 7. Dezember 2016 feierte der BAYER-Konzern das 125-jähriges Bestehen am Standort Leverkusen. Zu den GratulantInnen in seinem Erholungshaus konnte das Unternehmen auch die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft begrüßen. Wie bereits 2013 zum 150-jährigen Firmen-Jubiläum hatte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) die Ministerpräsidentin aufgefordert, in ihrem Geburtstagsständchen das lange Sündenregister des Global Players nicht auszuklammern. „Obwohl die Stadt Leverkusen Stammsitz eines der größten Konzerne der Welt ist, erlebt sie eine Rekord-Finanznot. Bei Schulen, Kinderbetreuung, Gesundheit und Freizeit – überall ist der Mangel spürbar. Die Kommune ist sogar auf die Unterstützung des Landes aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen angewiesen. Und das alles, weil BAYER sich durch „tausend legale Steuertricks“ um Abgaben in Millionen-Höhe drückt. Statt Lobreden erwarten wir deshalb Kritik von Hannelore Kraft“, hieß es in der Presseerklärung der CBG. Auch zu anderen dunklen Kapiteln aus der Firmen-Geschichte wie etwa der Rolle im Nationalsozialismus dürfe Kraft nicht schweigen, mahnte die Coordination. Aber die Sozialdemokratin entpuppte sich als Wiederholungstäterin und sprach die heiklen Themen wie schon 2013 nicht an. Stattdessen stand sie in Treue fest zu BAYER. „Wir sind ein Industrieland. Und wir wollen es bleiben“, konstatierte Hannelore Kraft. Die Ministerpräsidentin versprach, den Leverkusener Multi auch in Zukunft vor allem Unbill zu schützen. Vor allem dasjenige, das aus Richtung der EU droht, wie etwa der Plan, den Ausstoß des klima-schädlichen Kohlendioxids durch eine Verteuerung der Verschmutzungsrechte stärker zu sanktionieren, hatte sie dabei im Blick. „Wir kämpfen weiter für den Industrie-Standort, auch in Brüssel“, erklärte Kraft.
EU fördert Geheimniskrämerei
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hat schon so einige leidige Erfahrungen mit BAYERs Geschäftsgeheimnissen machen müssen. So weigerte sich der Leverkusener Multi unter Berufung auf ebendiese erfolgreich, Einblick in den mit der Universität Köln geschlossenen Forschungskooperationsvertrag zu gewähren. Auch auf den Hauptversammlungen nutzt er gern diese Ausrede, um Fragen zu den Verkaufszahlen umstrittener Produkte unbeantwortet zu lassen. Nichtsdestotrotz will die EU diese Geheimniskrämerei der Konzerne künftig noch weiter fördern. In einer neuen Richtlinie „über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb und rechtswidriger Nutzung und Offenlegung“ erklärt sie jede Information für sakrosankt, deren Veröffentlichung den Unternehmen zu ökonomischem Schaden gereichen könnte. Vergeblich hatte der Whistleblower Antoine Deltour, der den LuxLeaks-Steuerskandal aufgedeckt hatte, an die Europäische Union appelliert, das Vorhaben fallenzulassen. Auch die Kritik von JournalistInnen-Verbänden und Gewerkschaften, die durch das Paragrafen-Werk „in erheblichen Umfang die Meinungs- und Pressefreiheit“ beschränkt sahen, fand kein Gehör.
Wenning im FDP-Wirtschaftsforum
„Fast 70 Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft unterstützen das Comeback der Freien Demokraten. Sie haben sich dazu im FDP-Wirtschaftsforum organisiert, um die Parteiführung zu beraten“, vermeldet die FDP. Zu diesen ManagerInnen, deren Zahl mittlerweile auf 77 angestiegen ist, gehört auch BAYERs Aufsichtsratschef Werner Wenning. Er und seine KollegInnen haben der Partei bisher unter anderem „einfache Unternehmensgründungen“, „eine leistungsfähige Infrastruktur für Verkehr und Datenübertragung“ und nicht zuletzt „ein Steuerrecht, das Wachstumsbremsen löst, anstatt sie weiter anzuziehen“ auf die Agenda gesetzt.
PROPAGANDA & MEDIEN
Neues Media Center schafft Akzeptanz
„Mangel an gesellschaftlicher Akzeptanz wurde in einer Studie des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) als eines der Top-Hemmnisse für Innovationen benannt“, konstatiert Denise Rennmann, die bei BAYER den Bereich „Public & Governmental Affairs“ leitet. Die zunehmende Kritik an der Gentechnik und anderen neuen Hervorbringungen der Industrie bereitet dem Leverkusener Multi schon länger Sorge. Darum hat er sich Gedanken über eine „intensivere Wissenschaftskommunikation“ gemacht und die Idee ausgebrütet, ein „Science Media Center“ zu gründen. Dieses soll nach britischem Vorbild JournalistInnen mit „objektiven“ Informationen zu strittigen Themen aus dem Forschungsbereich versorgen. Im Jahr 2012 lud der Global Player zu diesem Behufe interessierte Kreise nach Berlin ein. Anschließend betraute er eine Arbeitsgruppe mit der Entwicklung eines Konzepts für eine solche Unternehmung und warb parallel dazu bei anderen Firmen, Zeitungen und Forschungseinrichtungen um Unterstützung. 2015 schließlich war es soweit. Die „Science Media Center Germany gGmbH“, getragen von der Stiftung des SAP-Mitgründers Klaus Tschira, nahm ihre Arbeit auf. „Wenn Journalisten den öffentlichen Diskurs mit verlässlichem Wissen und kompetenten Stellungnahmen bereichern wollen, dann steht ihnen das SMC Germany dabei zur Seite“, heißt es auf der Website. Einige Stichproben konnten das allerdings nicht bestätigen. Zu den Themen „Bienensterben“ oder „hormon-ähnliche Chemikalien“ findet sich beim SMC nichts. Und während der Eintrag zu Glyphosat einigermaßen ausgewogen daherkommt, lässt das Center bei den Informationen zur neuen Gentechnik CRISPR/Cas kritische Positionen unter den Tisch fallen.
14 Millionen für US-MedizinerInnen
Im Jahr 2015 standen 2.400 bundesdeutsche ÄrztInnen auf der Gehaltsliste von BAYER. Der Leverkusener Multi engagierte sie unter anderem als RednerInnen auf Kongressen, BeraterInnen oder lud sie zu Fortbildungsveranstaltungen ein. 7,5 Millionen Euro gab der Konzern dafür aus. In den USA ließ er sich das noch mehr kosten. Wie die US-Plattform ProPublica recherchierte, investierte der Pharma-Riese dort von August 2013 bis Dezember 2014 14 Millionen Dollar in die Pflege der medizinischen Landschaft.
1,3 Millionen für Fachgesellschaften
BAYER lässt sich die Pflege der medizinischen Landschaft so einiges kosten. Der Leverkusener Multi bedenkt nicht nur ÄrztInnen und Krankenhäuser mit Millionen-Beträgen (siehe oben und Ticker 4/16), sondern auch die medizinischen Fachgesellschaften. Rund 1,3 Millionen Euro erhielten diese im Jahr 2015. Und wenn sich die Tätigkeit der Organisationen auf ein Gebiet erstreckt, für das der Konzern die passende Arznei im Angebot hat, überweist er ihnen besonders viel Geld. So konnte sich die „Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit“ über 253.000 Euro freuen – und der Pharma-Riese bestimmt bald über mehr Rezepte für seine umstrittenen Testosteron-Präparate (siehe DRUGS & PILLS). Zur Umsatz-Steigerung seines risiko-reichen Gerinnungshemmers XARELTO investierte er indessen 189.000 Euro in die „Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung“ und 122.000 Euro in die „Gesellschaft für Thrombose und Hämostase-Forschung“.
PR für NEBIDO & Co.
Eigentlich sollten die Pharma-Firmen Medikamente für bestimmte Krankheiten entwickeln. Manchmal gehen sie jedoch den umgekehrten Weg und entwickeln Krankheiten für bestimmte Medikamente. So hat BAYER die männlichen Wechseljahre erfunden, um einen größeren Markt für NEBIDO und andere Hormon-Präparate zu schaffen. Praktischerweise hat der Konzern dafür auch gleich noch einen Fachbegriff in Beschlag genommen, der eigentlich nur einen wirklich krankhaften Testosteron-Mangel beschreibt: Hypogonadismus. Allerdings stehen NEBIDO & Co. seit einiger Zeit wegen ihrer zahlreichen Risiken und Nebenwirkungen in der Kritik. Deshalb geht der Leverkusener Multi nun in die Offensive. Beim europäischen Kongress für Männergesundheit, den die von ihm großzügig alimentierte „European Academy of Andrology“ in Rotterdam ausrichtete, sponserte er ein Symposion, das sich mit der Frage befasste: „Long-term treatment of hypogonadism – just a risky lifestyle intervention?“ Die vom Leverkusener Multi engagierten „Mietmäuler“ Abraham Morgentaler, Farid Saad, Kevin S. Channer und Linda Vignozzi antworteten natürlich unisono: „Nein.“
Mehr PR für DR SCHOLL’S & Co.
In den USA hat BAYER dieses Jahr größere Anstrengungen unternommen, um die Werbetrommel für seine rezeptfreien Medizin-Produkte, die so genannte „Over the Counter“-Ware (OTCs), zu rühren. Vor allem mit dem Bekanntheitsgrad der Sonnenschutzmittel aus der COPPERTONE-Reihe und der Fußpflege-Artikel der DR SCHOLL’S-Familie, die mit dem Kauf der OTC-Sparte von MERCK ins Portefeuille des Leverkusener Multis gelangten, zeigten sich die Konzern-StrategInnen unzufrieden (siehe auch ÖKONOMIE & PROFIT). „Ich hoffe, die Leute werden in den nächsten Jahren lernen, dass BAYER mehr ist als ASPIRIN“, so Phil Blake, der US-Chef des Pharma-Riesen, zum Sinn der Übung. Der Konzern lässt dabei keinen Kanal ungenutzt. Von TV und Zeitungen über FACEBOOK und INSTAGRAM bis hin zu TWITTER erstreckt sich die Kampagne.
BAYERs Shitstormer
Rund 500 Beschäftigte arbeiten in BAYERs PR-Abteilung. Das reicht allerdings nicht, um gegen den notorisch schlechten Ruf des Unternehmens anzukämpfen. Deshalb bedient sich der Konzern zusätzlich externer Kräfte. Gilt es etwa, im Zuge eines Skandals vertrauensbildende Maßnahmen einzuleiten, so greift der Leverkusener Multi gerne auf die Dienste von Christian Schwerg zurück. Dieser hat nämlich die Krisen-Kommunikation zu seinem Spezialgebiet auserkoren – den „Shitstormer“ nennt Die Zeit ihn deshalb. „Wir können nichts ungeschehen machen. Ab einer bestimmten medialen Verbreitung kann man nur offensiv vorgehen und das Thema in die Rehabilitationsstrategie integrieren“, sagt er über seine Arbeitsweise. Schwerg bietet für BAYER & Co. sogar vorbeugende Maßnahmen an, um deren ÖffentlichkeitsarbeiterInnen zu lehren, gut mit „bad news“ umzugehen. „Wir simulieren auch gerne mal Nachrichten auf News-Portalen oder geben uns als Journalisten aus, rufen an und senden E-Mails mit Vorwürfen“, plaudert der PR-Profi aus dem Nähkästchen.
TIERE & VERSUCHE
Tierversuchs-Richtlinie verwässert
Bei der Ausarbeitung der Tierversuchs-Richtlinie der EU hatten PolitikerInnen aus Deutschland BAYER & Co. vor allzu strengen Auflagen bewahrt. Und bei der Umsetzung in bundesdeutsches Recht musste das Paragrafen-Werk noch einmal gehörig Federn lassen. So unterliegen zu Bildungszwecken vorgenommene Tier-Experimente keiner Genehmigungspflicht mehr, sondern nur noch einer Meldepflicht. Auch ein Verbot besonders leidvoller Erprobungen fehlt in der deutschen Version. Der Jurist Dr. Christoph Maisack stellte in einem Gutachten insgesamt 18 Abweichungen vom ursprünglichen Text fest, die es dem Leverkusener Multi leichter machen, seine Tierversuche – im Geschäftsjahr 2015 waren es 133.666 – nicht zu reduzieren. Der Verein ÄRZTE GEGEN TIERVERSUCHE hat bei der EU-Kommission wegen der Aufweichung der Richtlinie eine Beschwerde eingereicht.
DRUGS & PILLS
30.000 ESSURE-Geschädigte
Bei ESSURE, BAYERs ohne Hormone auskommendes Mittel zur Sterilisation, handelt es sich um eine kleine Spirale, deren Kunststoff-Fasern für ein so großes Wachstum des Bindegewebes sorgen sollen, dass sich die Eileiter verschließen. Allzu oft jedoch bleibt das Medizin-Produkt nicht an dem vorgesehenen Ort, sondern wandert im Körper umher und verursacht Risse an den Wänden innerer Organe, was zu lebensgefährlichen inneren Blutungen führen kann. Auch Hautausschläge, Kopfschmerzen, Übelkeit und Allergien zählen zu den Nebenwirkungen. 30.000 Meldungen über solche unerwünschten Arznei-Effekte hat BAYER bereits erhalten.
NICE nicht nice zu NEXAVAR
Das britische „National Institute for Health and Care Excellence“ (NICE) hat eine Kosten/Nutzen-Analyse von BAYERs NEXAVAR zu Behandlung von Leberkrebs durchgeführt und der Arznei kein gutes Zeugnis ausgestellt. „Es bleiben signifikante Unsicherheiten“, konstatierte die Behörde. Selbst eine vom Pillen-Riesen vorgenommene Preissenkung konnte die PrüferInnen nicht erweichen, dem „National Health Service“ die Übernahme der Therapie-Kosten zu empfehlen. Aber der Leverkusener Multi gibt sich noch nicht geschlagen und hofft weiter auf ein positives NICE-Votum in Sachen „NEXAVAR“.
Alzheimer durch ANTRA
Protonenpumpen-Hemmer mit dem Wirkstoff Omeprazol wie BAYERs ANTRA steigern das Alzheimer-Risiko. Das ergab eine Studie der Universität Bonn. Der Untersuchung zufolge setzen sich ANTRA-PatientInnen einer um 44 Prozent höheren Gefährdung aus, diese Krankheit zu bekommen, als Menschen, welche die Mittel nicht einnehmen. Die Präparate, die hauptsächlich bei Sodbrennen, aber auch zum Schutz vor Blutungen der Magenschleimhaut zum Einsatz kommen, haben jedoch noch mehr Nebenwirkungen. Da die Arzneien die Magensäure-Produktion fast komplett unterbinden, verschaffen sie Bakterien ein gedeihlicheres Klima, was den Ausbruch von Infektionen fördert. Zudem stören die Medikamente die Kalzium-Gewinnung aus der Nahrung und schwächen so die Knochen. Wegen solcher Gegenanzeigen warnen bundesdeutsche MedizinerInnen bereits seit Langem vor einem zu sorglosen Umgang mit ANTRA & Co. Allerdings fruchteten ihre Warnungen nicht – seit einiger Zeit sind diese Medikamente nicht einmal mehr verschreibungspflichtig. Und nicht zuletzt deshalb verfünffachte sich ihre Einnahme in den letzten Jahren.
Blockbuster EYLEA
EYLEA, das BAYER-Präparat zur Behandlung der feuchten Makula-Degeneration – einer Augenerkrankung, die zur Blindheit führen kann – erschließt nicht gerade medizinisches Neuland. Laut Konzern zeigte das Pharmazeutikum in Tests lediglich „eine vergleichbare Wirkung (‚Nicht-Unterlegenheit’) gegenüber der Behandlung mit LUCENTIS“. Einen Zusatznutzen mochte das „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWIG) dem Gentech-Medikament deshalb nicht zu bescheinigen. Trotzdem entwickelt sich die Arznei dank BAYERs massivem Werbeaufwand zu einem Blockbuster. Dem „Innovationsreport 2016“ der Techniker Krankenkasse zufolge verzeichnete es die größten Umsatz-Zuwächse aller hierzulande im Jahr 2012 neu zugelassenen Medikamente. 2014 kam das Präparat auf fast 18 Millionen Euro – ein Plus von 458 Prozent gegenüber 2013.
USA: mehr Auflagen für NEBIDO & Co.
Mit großer Anstrengung arbeitet der Leverkusener Multi daran, die „Männergesundheit“ als neues Geschäftsfeld zu etablieren und Hormon-Präparaten wie NEBIDO oder TESTOGEL neue, nur selten zweckdienliche Anwendungsmöglichkeiten zu erschließen. Zu diesem Behufe hat der Pharma-Riese die Krankheit „Testosteron-Mangel“ erfunden und sie zu „männlichen Wechseljahresstörungen“ erhoben. Studien warnen allerdings vor den Gefahren der Mittel. So können die Arzneien neuesten Untersuchungen zufolge das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle erhöhen, was die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA zu einer Reaktion veranlasste. Sie zwang BAYER & Co., auf den Packungen vor diesen möglichen Nebenwirkungen zu warnen. Überdies müssen die Pharma-Firmen nun darauf hinweisen, dass die Pharmazeutika nur bei krankhaftem Testosteron-Mangel und nicht bei einem rein altersbedingten Rückgang der Hormon-Produktion Anwendung finden dürfen.
Neues Nahrungsergänzungsmittel
Menschen, die sich ausgewogen ernähren, brauchen keine zusätzliche Vitamine, Mineralien oder andere Stoffe. Deren Einnahme kann in manchen Fällen sogar schaden. Trotzdem hat BAYER eine Unmenge an Vitamin-Präparaten und Nahrungsergänzungsmitteln im Angebot. SANATOGEN, SUPRADYN, BEROCCA, CAL-D-VITA, ELEVIT, REDOXON und vieles mehr findet sich in der Produkt-Palette des Konzerns. Allein unter dem Markennamen ONE-A-DAY verkauft er Dutzende unterschiedlicher Pillen. Da die Geschäfte vor allem in den USA gut laufen, schmeißt der Pharma-Riese dort jetzt noch ein neues Mittelchen auf den Markt: TRUBIOTICS. Das mit den Mikroorganismen Lactobacillus acidophilus und Bifidobacterium animalis bestückte Probiotikum soll angeblich gute Werke im Verdauungstrakt verrichten.
ASPIRIN nur noch für vier Tage?
Das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-Produkte“ (BfArM) tritt bereits seit Langem dafür ein, ASPIRIN und andere Schmerzmittel in den Apotheken nur noch dann ohne Rezept abzugeben, wenn die Anwendungsdauer auf vier Tage beschränkt ist. Die Präparate haben nämlich beträchtliche Nebenwirkungen; ASPIRIN kann vor allem Magenbluten verursachen. „Selbst bei den niedrigen Dosierungen, die zur Prävention von Schlaganfall und Herzinfarkt dienen sollen“, besteht dem ehemaligen BfArM-Präsidenten Walter Schwerdtfeger zufolge dieses Risiko. Der „Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht“ lehnte die Forderung nach einer Verkleinerung der Packungen zwar bereits 2012 ab, aber endgültig vom Tisch ist die Sache noch nicht. „Die Studien-Ergebnisse werden zur Zeit ausgewertet“, ließ sich das Bundesgesundheitsministerium in der TV-Dokumentation „Angst vor Schmerzen“ vernehmen.
ASPIRIN im Freizeitsport
SportlerInnen verlangen ihrem Körper viel ab und überschreiten dabei oft die Schmerzgrenze. Deshalb greifen nicht wenige von ihnen zu Schmerzmitteln wie ASPIRIN (Wirkstoff: Acetylsalicylsäure) – und das nicht nur Profis. Nach einer Untersuchung der WissenschaftlerInnen Pavel Dietz und Antje Dresen nimmt auch eine große Zahl von Freizeit-SportlerInnen die Präparate ein. Den ForscherInnen zufolge schluckt die Hälfte aller TeilnehmerInnen von Langstrecken-Rennen ASPIRIN oder andere Analgetika. „Wir waren überrascht, dass es in so einer Häufigkeit ein Thema ist“, so Antje Dresen. Die LäuferInnen setzen sich damit erheblichen Gesundheitsrisiken aus, denn durch die körperliche Belastung können die Nebenwirkungen der Mittel – im Fall von BAYERs „Tausendsassa“ ist das hauptsächlich das Magenbluten – noch mehr durchschlagen. Die Stöße, die während des Langstrecken-Laufs auf den Magen einwirken, erhöhen nämlich die Durchlässigkeit der Organ-Wände für die Acetylsalicylsäure.
YASMIN hilft nicht mehr gegen Akne
Frauen, die drospirenon-haltige Pillen wie BAYERs YASMIN zur Empfängnis-Verhütung einnehmen, tragen im Vergleich zu solchen, die levonorgestrel-haltige Kontrazeptiva bevorzugen, ein bis zu dreimal so hohes Risiko, eine Thromboembolie zu erleiden. Trotzdem bewirbt der Leverkusener Multi die Mittel als Lifestyle-Präparate, die etwa gegen Akne helfen. In der Schweiz darf er das jetzt jedoch nicht mehr tun. Mit Verweis auf das Gefährdungspotenzial der Pharmazeutika untersagte die eidgenössische Aufsichtsbehörde Swissmedic BAYER und anderen Herstellern, weiter Reklame für die angeblichen dermatologischen Qualitäten von YASMIN & Co. zu machen.
FDA zweifelt nicht an XARELTO-Tests
Bei der Klinischen Erprobung von BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO erhielt die Kontrollgruppe den marktgängigen Wirkstoff Warfarin (MARCUMAR). Das Gerät, das bei diesen ProbandInnen die Blutgerinnung bestimmte, arbeitete jedoch nicht korrekt. Es zeigte geringere Werte als die wirklichen an. Deshalb bekamen die TeilnehmerInnen mehr Warfarin als nötig – und in der Folge auch mehr gesundheitliche Probleme als die PatientInnen, die das orale Antikoagulans des bundesdeutschen Pharma-Riesen schluckten. Das schmälert die Aussagekraft des zur Zulassung von XARELTO eingereichten Rocket-AF-Tests erheblich, was in der Fachwelt für einige Empörung sorgte. „Es lässt an den Ergebnissen zweifeln, die benutzt wurden, um den Gebrauch des weltweit meistverkauften neuen oralen Antikoagulans zu befördern“, sagt etwa Dr. Deborah Cohen. Gemeinsam mit den anderen Mitherausgebern des British Medical Journal kritisierte sie die Studie in einem Artikel massiv. Der Leverkusener Multi hielt jedoch an dieser fest. Schon unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Unstimmigkeiten hatte er eine Nachuntersuchung in Auftrag gegeben, die erwartungsgemäß die Rocket-Resultate bestätigte. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA gab Anfang Februar 2016 ebenfalls Entwarnung. Und die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA prüfte zwar bedeutend länger als ihr EU-Pendant, schloss sich dann aber im Oktober 2016 dem EMA-Votum an.
BAYER setzt auf Krebs-Arzneien
Krebs-Medikamente versprechen den Pharma-Riesen den größten Profit. Das „IMS Institute for Healthcare Informatics“ rechnet für das Jahr 2018 mit einem 100-Milliarden-Dollar-Markt. Schon jetzt fressen die Präparate – ohne die Lebenszeit der PatientInnen entscheidend verlängern zu können – in der Bundesrepublik rund ein Viertel des Medikamenten-Budgets der Krankenkassen. Folgerichtig setzt BAYER ganz auf dieses Segment. Mit NEXAVAR, STIVARGA und XOFIGO bietet das Unternehmen bereits drei Onkologie-Präparate an; zudem befinden sich 17 Wirkstoffe in der klinischen Erprobung. Die Konkurrenz hat jedoch noch mehr im Köcher. So testet ROCHE zurzeit 34 Arzneien. Der Schweizer Konzern lässt sich das alles auch mehr kosten als der Leverkusener Multi. Im Jahr 2014 gab er mit 8,4 Milliarden Dollar 6,4 Milliarden mehr für die Pillen-Forschung aus als der Leverkusener Multi.
Schnellere Arznei-Zulassungen?
Wie unzureichend die Genehmigungsverfahren für Arzneimittel sind, belegen die zahlreichen Todesfälle, die unter anderem BAYER-Pharmazeutika wie YASMIN und XARELTO verursacht haben. Das ficht die europäische Arzneimittel-Behörde EMA allerdings nicht an. Sie beabsichtigt, das Prozedere noch einmal zu beschleunigen und will künftig Zulassungen schon nach dem erfolgreichen Absolvieren von zwei Phasen der Klinischen Prüfungen ermöglichen. Was bisher die dritte Stufe war, sollen jetzt Praxis-Tests richten. „Real World Data“ lautet das Zauberwort. Und das alles, obwohl die Erprobungen der Kategorie 2 sich auf einen kleineren ProbandInnen-Kreis beschränken und ohne Vergleichsgruppe auskommen. Nicht umsonst bleibt gegenwärtig an der dritten Hürde noch einmal rund die Hälfte der Medikamenten-Kandidaten hängen. Die Arznei-Behörde hat jedoch nur das Wohlergehen der Pillen-Produzenten im Sinn. „Die potenziellen Vorteile für die Hersteller wären ein früherer Einkommensfluss als bei konventionellen Zulassungswegen und weniger teure und kürzere klinische Studien“, erklärt der EMA-Mann Georg Eichler frank und frei. Bei den Vorbereitungen zu den Schnelltests und den Pilotprojekten arbeiteten die willigen Helfer der Arznei-Branche dann auch an führenden Stellen mit. Trotzdem behauptet der von BAYER gegründete „Verband der forschenden Arzneimittel-Hersteller“ (VFA) steif und fest, die geplante „Reform“ sei „klar an medizinischen Zielen ausgerichtet und kein ökonomisches Entgegenkommen gegenüber den Unternehmen“. Das nimmt ihm jedoch kaum jemand ab. So kritisierte die ÄrztInnen-Organisation MEIN ESSEN ZAHL ICH SELBST (MEZIS) das Vorhaben scharf: „Klar erkennbar ist bei diesem Vorstoß der zu erwartende ökonomische Nutzen der Pharma-Industrie – auf Kosten der Sicherheit der PatientInnen.“ Die BUKO-PHARMA-KAMPAGNE und die gesetzlichen Krankenkassen lehnen das Projekt ebenfalls ab.
Lieferengpässe bei Arzneien
In der Bundesrepublik kommt es in letzter Zeit verstärkt zu Liefer-Engpässen bei Arzneimitteln. Auf der aktuellen Fehl-Liste des „Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizin-Produkte“ findet sich mit dem Mittel NIMOTOP, das die Gehirn-Durchblutung fördert, auch ein BAYER-Medikament. „Probleme bei der Herstellung“ gibt der Leverkusener Multi als Grund an. Und die gab es in der Vergangenheit auch schon beim Krebsmittel XOFIGO. Schätzungen zufolge sind bis zu 60 Pharmazeutika kurz- oder längerfristig nicht erhältlich. Die „Probleme bei der Herstellung“ treten oftmals deshalb auf, weil die Pharma-Riesen die Fertigung gnadenlos rationalisiert haben. So versuchen sie etwa verstärkt, „just in time“ zu produzieren und auf diese Weise Lager-Kapazitäten abzubauen. Überdies gliedern sie gerne die Wirkstoff-Herstellung aus oder verlegen diese in Drittwelt-Länder. „In den letzten Jahren ist (...) meiner Ansicht nach etwas in der Unternehmensphilosophie einiger Pharmazeutischer Hersteller verloren gegangen: Verantwortungsbewusstsein, was zugunsten der Profit-Maximierung abgebaut wurde“, kritisiert deshalb Rudolf Bernhard, der Leiter der Krankenhausapotheke im Münchner „Klinikum rechts der Isar“. Um gegen die Missstände anzugehen, fordert der Pharmazeut unter anderem eine Meldepflicht bei Liefer-Problemen – bisher informieren BAYER & Co. nur auf freiwilliger Basis – und einen Zwang, bestimmte Arznei-Mengen immer auf Lager zu haben. Die Große Koalition sieht da jedoch keinen Handlungsbedarf, wie aus ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Partei „Die Linke“ hervorgeht. „Es liegen der Bundesregierung keine Anzeichen vor, dass die Register nicht die wesentlichen Lieferengpässe der relevanten Arzneimittel abdecken“, heißt es in dem Schriftstück. Dass etwa BAYERs Johanniskraut-Präparat LAIF zur Behandlung von milden Depressionen dort nicht verzeichnet ist, ficht Merkel & Co. offenbar nicht an. Den Pharma-Riesen zur Auflage zu machen, einen Vorrat an Medikamenten anzulegen, lehnen CDU und SPD ebenfalls ab. Ihrer Ansicht nach reicht es, wenn die Apotheken und Pillen-Großhändler die Arzneien immer parat haben: „Eine darüber hinausgehende Bevorratung durch den Pharmazeutischen Unternehmer ist daher nicht notwendig.“
„Consumer Health“ schwächelt
Der Leverkusener Multi hat das Geschäft mit den rezeptfreien Arzneien in der letzten Zeit stark ausgebaut und ist in diesem Bereich zur Nr. 2 auf der Welt aufgestiegen. Aber nicht nur die 2014 zugekaufte MERCK-Sparte erfüllte ihre Erwartungen bisher nicht (siehe ÖKONOMIE & PROFIT), auch der Absatz der restlichen Produkte schwächelt. Im 3. Quartal 2016 machte der Leverkusener Multi gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Verlust von 20 Millionen Euro. Dazu trug vor allem die schlechtere ökonomische Lage in Russland, China und Brasilien bei – diese Schwellenländer hatten zwischen 2012 bis 2014 noch 70 Prozent zum Umsatzwachstum von BAYER in diesem Markt-Segment beigetragen.
AGRO & CHEMIE
GAUCHO & Co. gefährden Wildbienen
Immer neue Studien belegen die Bienengefährlichkeit von Pestiziden aus der Gruppe der Neonicotinoide wie BAYERs Saatgutbehandlungsmittel GAUCHO (Wirkstoff: Imidacloprid) und PONCHO (Clothianidin). So hat der britische Insektenforscher Ben Woodcock vom „Zentrum für Ökologie und Hydrologie“ (NERC) die Auswirkungen dieser Wirkstoff-Gruppe, welche die EU bereits mit einem vorläufigen Verkaufsbann belegt hat, auf Wildbienen untersucht. Er kam zu einem alarmierenden Befund: Waren die Tiere GAUCHO & Co. ausgesetzt, so beschleunigte sich das Schrumpfen der Populationen im Vergleich zu denjenigen, die nicht in Kontakt mit den Giften kamen, um den Faktor drei. Der Leverkusener Multi hatte bisher immer die Validität von wissenschaftlichen Arbeiten zu Neonicotinoiden angezweifelt, die unter Laborbedingungen entstanden. Von „unrealistischen Expositionsbedingungen“ sprach er stets und von Expositionsdosen, „die unter realistischen Feld-Bedingungen in dieser Form niemals auftreten würden“. Das traf zwar auf kaum eine Studie zu, verfehlte aber seine Wirkung nicht. Da Woodcock jedoch auf freier Wildbahn zu seinen Ergebnissen kam, stößt diese Verteidigungsstrategie des Konzerns nun auch an ihre Grenzen. Diese will er jedoch nicht wahrhaben. Von Mitgliedern der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN mit den Resultaten des Wissenschaftlers konfrontiert, meinte der Global Player auf einmal darauf hinweisen zu müssen, dass „auch Feld-Untersuchungen ihre Tücken haben, da sie sehr komplex und mitunter nicht leicht zu interpretieren sind“. Und – fast unnötig zu betonen – hatte die Woodcock-Arbeit nach Ansicht des Unternehmens solche Tücken.
Top bei Grenzwert-Überschreitungen
Bei Grenzwert-Überschreitungen von Pestizid-Rückständen in Lebensmitteln toppen Ackergifte made by BAYER alles. Nach den neuesten verfügbaren Zahlen, die aus den Jahren 2012 und 2013 stammen, finden sich nach Angaben der Bundesregierung unter den sieben „am häufigsten beanstandeten Wirkstoffen“ mit Imidacloprid (s. o.), Ethephon und Carbendazim drei, die auch in Produkten des Leverkusener Multis enthalten sind.
Pestizide in Orangen
Das Delmenhorster „Labor für Chemische und Mikrobiologische Analytik“ untersuchte für die WDR-Sendung Markt Orangen auf Rückstände von Pestiziden. In allen Proben stießen die WissenschaftlerInnen auf Spuren der Ackergifte. Diese blieben zwar unter den Grenzwerten, stellen aber trotzdem eine Gefahr dar. In den Früchten fanden sich nämlich bis zu fünf Agrochemikalien gleichzeitig, was Kombinationseffekte hervorrufen kann. Auch BAYER-Pestizide wiesen die ForscherInnen nach. So enthielten die Orangen Chlorpyrifos, das der Leverkusener Multi unter den Produktnamen BLATTANEX, PROFICID und RIDDER vermarktet, Fenhexamid (TELDOR), Imazalil (BAYTAN und MANTA PLUS) sowie Pyrimethanil (CLARINET, FLINT STAR, MYSTIC, MYTHOS, SCALA, SIGANEX, VISION und WALABI).
Parkinson keine Berufskrankheit
Pestizide können viele Gesundheitsschädigungen auslösen. Frankreich hat deshalb Krebs und Parkinson bei LandwirtInnen als Berufskrankheiten anerkannt. In der Bundesrepublik steht das vorerst nicht an, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Partei „Die Linke“ hervorgeht. Merkel & Co. stützen sich dabei auf einen Sachverständigenbeirat, der die Sachlage bei Parkinson 2011 und 2012 geprüft hat und befand: „Im Ergebnis war die Studien-Lage heterogen.“ „Erhebliche Unsicherheiten im Hinblick auf eine eindeutige Diagnose-Stellung“ machten die ExpertInnen fest. Im Moment werten diese allerdings neue Untersuchungen aus. In Sachen „Krebs“ haben es immerhin Erkrankungen in die Liste der Berufskrankheiten geschafft, welche die in vielen Agro-Chemikalien enthaltenen Halogen-Kohlenwasserstoffe auslösen können. Die „Anerkennung im Einzelfall“ hängt jedoch der Großen Koalition zufolge von vielen Parametern wie der Tumor-Art, dem gebrauchten Pestizid und der Dauer der Anwendung ab.
WASSER, BODEN & LUFT
Gerupfter Klimaschutzplan
Im Übereinkommen von Paris hatten sich die Mitgliedsländer der Vereinten Nationen 2015 darauf verständigt, die Erd-Erwärmung deutlich unter zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu halten. Im Vorfeld hatten sich die EU-Länder bereits geeinigt, die Treibhausgas-Emissionen bis 2050 um 80 bis 95 Prozent gegenüber dem Wert von 1990 zu verringern. Den bundesdeutschen Beitrag zur Umsetzung dieser Ziele wollte die Große Koalition mit dem „Klimaschutzplan 2050“ festlegen. Um diesen Plan entbrannte jedoch heftiger politischer Streit. Der „Bundesverband der deutschen Industrie“ (BDI), der „Verband der Chemischen Industrie“ (VCI), die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) und die industrie-freundliche nordrhein-westfälische Landesregierung taten alles dafür, BAYER & Co. vor allzu drastischen Anforderungen zu bewahren. Ein „fester Beitrag zur Erreichung eines nationalen Klimaschutz-Ziels“ sei nicht im Voraus bestimmbar, dekretierte etwa der VCI. Maßnahmen zur Verteuerung der derzeit zum Schnäppchen-Preis erhältlichen Kohlendioxid-Verschmutzungsrechte lehnte der Verband ebenfalls ab. Und so kam es, dass Umweltministerin Barbara Hendricks den schon fertiggestellten Klimaschutzplan nach einer Intervention von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) wieder in die Tonne kloppen musste. In der überarbeiteten Fassung bekennt sich die Bundesregierung nun dazu, „ein zentrales Augenmerk auf den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft“ zu legen. Darum senkte sie die Spar-Vorgaben für die Industrie gegenüber den ursprünglichen Plänen um zehn Millionen Tonnen CO2 auf 140 bis 143 Millionen Tonnen bis 2030 ab und bürdete das Quantum kurzerhand der Wohnungswirtschaft auf. Auch setzte die Große Koalition hinter die Regelungen zur Reform des Emissionshandels – ganz wie vom VCI gefordert – den Vermerk „kann wegfallen“. Jetzt braucht der Leverkusener Multi, der 2015 fast zehn Millionen Tonnen Kohlendioxid ausstieß, seine Wirtschaftsweise nicht groß zu ändern. Für die Zukunft des Planeten bedeutet das allerdings nichts Gutes. „Die geplanten Maßnahmen sind nicht ehrgeizig genug, um die Klima-Ziele bis zur Mitte des Jahrhunderts zu erreichen“, konstatierte der nordrhein-westfälische Umweltminister Johannes Remmel von Bündnis 90/Die Grünen besorgt.
Die Deponie unter der Deponie
Anfang November 2016 hat die Bezirksregierung Köln dem Landesbetrieb Straßenbau NRW die Genehmigung erteilt, BAYERs Dhünnaue-Deponie wieder zu öffnen, um darauf das Fundament für die Erweiterung der A1-Autobahn und des Neubaus der Rheinbrücke zu gründen (siehe auch RECHT & UNBILLIG). Damit beschwor sie Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt herauf. Und diese dürften nach Recherchen des WDR-Magazins Westpol sogar noch größer sein, als selbst die KritikerInnen des Projektes angenommen haben. Über einem 13 Hektar großen Teil des erst zur Landesgartenschau 2005 halbwegs abgedichteten Giftgrabs liegt nämlich die noch in Betrieb befindliche Sondermüll-Deponie Bürrig der BAYER-Tochter CURRENTA. Eine Absicherung nach unten hin existiert nicht, weshalb die Aufschüttungen auf die Altlast drücken und zu chemischen Reaktionen führen könnten. Trotzdem spielte Bürrig bei der Sicherheitsanalyse von Straßen.NRW keine Rolle und fand auch in den Antragsunterlagen zur Genehmigung keine Erwähnung. „Die aktive Deponie ist von den Planungen nicht betroffen“, antwortet die Bezirksregierung Köln auf eine Anfrage des WDR. Harald Friedrich, der ehemalige Abteilungsleiter im NRW-Umweltministerium, teilt diese Einschätzung nicht: „Man hätte eine Gefährdungsabschätzung machen müssen.“
BAYTRIL fördert Methan-Ausstoß
Rinder, die Antibiotika wie BAYERs BAYTRIL verabreicht bekommen, geben mehr klimaschädigende Methan-Gase an die Umwelt ab als solche, welche die Präparate nicht schlucken müssen. Das ergab eine Studie, welche die Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society B veröffentlichte. Den ForscherInnen um Tobin J. Hammer zufolge stieg die Methan-Freisetzung um den Faktor 1,8. Die WissenschaftlerInnen vermuten, dass BAYTRIL & Co. die Gas-Produktion fördern, indem sie Einfluss auf im Verdauungstrakt der Tiere wirkenden Mikrobakterien nehmen.
Plastik in Speisefischen
Immer mehr Plastikabfälle gelangen in die Weltmeere und bedrohen so das aquatische Ökosystem. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums finden sich die Rückstände mittlerweile in 330 Tierarten wieder. Als einer der weltgrößten Kunststoff-Produzenten trägt BAYER maßgeblich zu diesem Umweltverbrechen bei. ForscherInnen des „Alfred-Wegener-Institutes“ wiesen jetzt sogar Plaste-Reste in Speisefischen aus der Nord- und Ostsee nach. Zumeist stießen die BiologInnen in den Verdauungsorganen der Tiere auf die Partikel. Obwohl die Heringe, Dorsche, Makrelen und Flundern vor der Lieferung an den Lebensmittel-Zwischenhandel ausgenommen werden, mochten die WissenschaftlerInnen Chemie-Rückstände in ihren Körpern nicht ausschließen: „Wir sind mit der Erforschung der Effekte noch ganz am Anfang.“
IMPERIUM & WELTMACHT
Abschreibungen in Venezuela
Die sinkenden Öl-Preise haben Venezuela in eine tiefe Krise gestürzt. Unter anderem leidet das Land an einer hohen Inflation, weshalb die heimische Währung gegenüber dem Dollar immer mehr an Boden verliert. Auch bei den Pharma-Firmen hat die Nation immense Schulden. Um diese wenigstens teilweise zu tilgen, hat die Regierung BAYER, SANOFI und NOVARTIS nun Anleihen der staatlichen Öl-Gesellschaft PDVSA übertragen.
Diese notieren zwar in Dollar und nicht in Bolívar, haben gegenüber ihrem Nennwert jedoch viel verloren. Die Konzerne nehmen die Verluste jedoch in Kauf und verkaufen trotzdem. NOVARTIS etwa erhielt für seine 200-Millionen-Dollar-Bonds nur 73 Millionen, und der Leverkusener Multi dürfte seine Papiere mit ähnlich hohen Abschlägen veräußert haben.
ÖKONOMIE & PROFIT
Synergie-Defekte beim MERCK-Deal
Schicken sich Unternehmen an, ihre Konkurrenten zu übernehmen oder Geschäftsteile von ihnen zu erwerben, preisen sie stets die mit den Deals angeblich verbundenen Synergie-Effekte. Im Fall des geplanten Kaufs von MONSANTO wusste BAYER diese sogar schon genau zu taxieren: 1,5 Milliarden Dollar per anno schon drei Jahre nach dem Vollzug der Transaktion. Allerdings können sich die Konzerne dabei auch verkalkulieren. Beispielsweise zahlte sich der 2014 vorgenommene Kauf einer MERCK-Sparte für den Leverkusener Multi bis jetzt nicht in dem erhofften Maß aus. So lag der Umsatz des Sortiments um 100 Millionen Dollar niedriger, als von MERCK angegeben. Auch erwies sich die Entwicklungspipeline als „nicht annähernd so gut wie präsentiert“, wie der Global Player beklagt. Zudem musste er mehr Geld als erwartet in Werbung für die Fußpflege-Artikel aus der DR SCHOLL’S-Reihe oder die COPPERTONE-Sonnenschutzmittel investieren, was sich obendrein nicht immer auszahlte: Im dritten Quartal des Jahres 2016 ging der COPPERTONE-Umsatz gegenüber dem Vergleichszeitraum um fünf Prozent zurück. Die 2001 erfolgte AVENTIS-Akquisition blieb ebenfalls lange hinter den Erwartungen zurück. Wegen falscher Angaben des AVENTIS-Managements über den Wert der Agro-Abteilung zog BAYER damals sogar vor Gericht.
Steuern sparen mit Lizenzen
Das Steuerrecht ermöglicht es den Konzernen, Geschäfte mit sich selber zu machen, um ihre Abgabenlast zu senken. So können einzelne Unternehmensteile von anderen Abteilungen Lizenzen erwerben, und die Kosten dafür senken den zu versteuernden Ertrag. Der Leverkusener Multi hat für solche Operationen die Tochter-Gesellschaft BAYER INTELLECTUAL PROPERTY (BIP) ins Leben gerufen, die Standorte in Monheim, Eschborn und Schönefeld hat. Wie hoch diese steuer-mindernden Lizenz-Gebühren z. B. für Marken-Rechte ausfallen, lassen die Zahlungen erahnen, welche der Global Player für die darauf entfallenden Einnahmen allein im bundesdeutschen Steuerparadies Monheim an das Finanzamt leistet: rund 20 Millionen Euro.
Monheim – einfach paradiesisch
Die Stadt Monheim wirbt mit einem Gewerbesteuer-Hebesatz von 300 Punkten – dem niedrigsten in ganz Nordrhein-Westfalen – um Industrie-Ansiedlungen. BAYER ließ sich das nicht zweimal sagen. Der Agro-Riese verlegte nicht nur einen Teil seiner Patent-Abteilung dorthin (s. o.), sondern auch die CROPSCIENCE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, deren Haupttätigkeit „im Bereich Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben“ liegt.
COVESTRO spart Steuern
Letztes Jahr brachte der Leverkusener Multi seine Kunststoff-Sparte COVESTRO an die Börse. Und im Zuge des Loslösungsprozesses sucht sich das Unternehmen nach dem Vorbild der Muttergesellschaft schon einmal besonders günstige Steuerstandorte. Wie BAYER ist es dabei unter anderem in Monheim (s. o.) und in Belgien fündig geworden. Zusätzlich hat die Plaste-Gesellschaft sich jedoch noch die Schweiz auserkoren, wirbt doch das Nachbarland damit, dass es „international weiterhin auf Rang 8 der steuergünstigsten Standorte steht“. Die COVESTRO INTERNATIONAL SA mit Sitz im Kanton Fribourg hält Beteiligungen an überall auf der Welt verstreuten Niederlassungen. Ein Großteil von deren Erträgen wandert so an den eidgenössischen Steuerstandort zurück, wo die Finanzämter unschlagbare Konditionen bieten: „Holding-Gesellschaften sind von kantonalen Gewinn-Steuern ganz befreit, der Kapitalsteuersatz ist reduziert“.
BAYSANTO & MONSAYER
MONSANTO-HV stimmt Übernahme zu
Am 13. Dezember 2016 haben die MONSANTO-AktionärInnen der Übernahme des Konzerns durch BAYER zugestimmt. Die großen Anteilshalter wie BLACKROCK und andere Finanzinvestoren sorgten für das klare Ergebnis von 99 Prozent Zustimmung für das Angebot des Leverkusener Multis, pro MONSANTO-Papier 128 Dollar zu zahlen. Grünes Licht für den Deal hat der bundesdeutsche Konzern aber auch damit noch nicht. Rund 30 Kartellbehörden müssen die Transaktion noch genehmigen.
Klage gegen Übernahme scheitert
Im November 2016 hatten einige MONSANTO-AktionärInnen eine Klage gegen die Übernahme des Konzerns durch BAYER eingereicht. Sie warfen den ManagerInnen des US-Unternehmens eine Verletzung ihrer Treue-Pflichten vor, weil diese den Global Player ihrer Meinung nach zu billig hergegeben hatten. Kurz vor der entscheidenden MONSANTO-Hauptversammlung (s. o.) wies ein Richter das Begehren jedoch ab. Allerdings besteht für die Aktien-HalterInnen noch die Möglichkeit, in Delaware, dem Stammsitz des Agro-Riesen, ein Gericht anzurufen.
Grüne schreiben Offenen Brief
Die Grünen haben die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in einem Offenen Brief dazu aufgefordert, der Übernahme MONSANTOs durch BAYER die Zustimmung zu verweigern. Der Fraktionschef Anton Hofreiter und weitere Bundestagstagsabgeordnete appellierten stattdessen an die Dänin, „die Spirale der Hochfusionierung im Agrochemie-Markt zu stoppen“. Unter anderem befürchtet die Partei durch den Deal höhere Preise für LandwirtInnen und VerbraucherInnen.
RECHT & UNBILLIG
13.800 XARELTO-Klagen
BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO mit dem Wirkstoff Rivaroxaban hat gefährliche Nebenwirkungen – im Jahr 2015 gingen allein beim „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) 137 Meldungen über Todesfälle ein. In den USA ziehen deshalb immer mehr Geschädigte bzw. deren Hinterbliebene vor Gericht. Das Aufkommen der Klagen erhöhte sich von Ende Januar 2016 bis Mitte Oktober von 4.300 auf 13.800.
Über 1.000 ESSURE-Klagen
ESSURE, BAYERs ohne Hormone auskommendes Mittel zur Sterilisation, beschäftigt in den USA zunehmend die Gerichte. Die kleine Spirale, deren Kunststoff-Fasern für ein so großes Wachstum des Bindegewebes sorgen sollen, dass sich die Eileiter verschließen, hat nämlich zahlreiche Nebenwirkungen. Allzu oft bleibt das Medizin-Produkt nicht an dem vorgesehenen Ort, sondern wandert im Körper umher und verursacht Risse an den Wänden innerer Organe, was zu lebensgefährlichen inneren Blutungen führen kann. Auch Hautausschläge, Kopfschmerzen, Übelkeit und Allergien zählen zu den Gesundheitsschädigungen, über die Frauen berichten. Über 1.000 von ihnen haben in den Vereinigten Staaten deshalb schon eine Klage gegen BAYER eingereicht.
CIPROBAY vor Gericht
Das Antibiotikum CIPROBAY, das zur Gruppe der Fluorchinolone gehört, hat zahlreiche Nebenwirkungen. So registrierte die US-Gesundheitsbehörde FDA zwischen 1998 und 2013 3.000 Todesfälle, die im Zusammenhang mit fluorchinolon-haltigen Medikamenten stehen. Insgesamt erhielt die Institution rund 50.000 Meldungen über unerwünschte Arznei-Effekte. Am häufigsten treten Gesundheitsschäden im Bereich der Sehnen, Knorpel, Muskeln und Knochen auf. Die Pharmazeutika stören nämlich das Zusammenspiel zwischen Nerven und Muskeln, weil sie die Weiterleitung des Neurotransmitters Acetylcholine behindern. Auch Störungen des zentralen Nervensystems, die sich in Psychosen, Angst-Attacken, Verwirrtheitszuständen, Schlaflosigkeit und anderen psychiatrischen Krankheitsbildern manifestieren, beobachten die MedizinerInnen. Darüber hinaus sind CIPROBAY & Co. für Herzinfarkte, Unterzuckerungen, Hepatitis, Autoimmun-Krankheiten, Leber- oder Nierenversagen und Erbgut-Schädigungen verantwortlich. Bei Cheryl Tigley löste CIPROBAY, das BAYER in den USA unter dem Namen AVELOX vertreibt, eine Schädigung des peripheren Nervensystems aus. Deshalb zog die US-Amerikanerin vor Gericht und verklagte den Leverkusener Multi auf Schadensersatz.
CIPROBAY nicht vor Gericht
Kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 kam es in den USA durch per Post verschickte Milzbrand-Erreger zu fünf Todesfällen. Die Regierungsstellen trafen daraufhin Vorsorge-Maßnahmen und kauften große Mengen von BAYERs Antibiotikum CIPROBAY als Gegenmittel. Zudem hoben sie das Verbot auf, die Arznei Kindern zu verabreichen – der Leverkusener Multi hatte für die Gewährung des exklusiven Vermarktungsrechtes lediglich Unbedenklichkeitsstudien nachzureichen. Bei diesen Untersuchungen hat der Pharma-Riese allerdings massive Manipulationen vorgenommen. Der an den Klinischen Prüfungen beteiligte Mediziner Dr. Juan Walterspiel wirft dem Unternehmen vor, Daten gefälscht zu haben, um Nebenwirkungen wie Muskelschwäche und Knorpelschäden zu verbergen. BAYER habe lange Datenkolonnen einfach in die Berichtsbögen eingefügt, so Walterspiel: „Diese Zahlen wiederholten sich endlos.“ Zudem haben die Erprobungen in den USA Walterspiel zufolge auffallend mehr Risiken und Nebenwirkungen zu Tage gefördert als solche, die der Konzern in Mexiko und anderen ärmeren Ländern durchgeführt hat. Die Versuche des Arztes, wegen der unsauberen Tests gerichtlich gegen den Leverkusener Multi vorzugehen, gestalten sich jedoch schwierig. So hat es der Oberste Gerichtshof der USA, der Supreme Court, im Juli 2016 abgelehnt, Walterspiel als Whistleblower gerichtlichen Beistand zu gewähren.
Pestizid-Klage in Indien
Das indische Agrar-Ministerium hatte 2015 ein ExpertInnen-Gremium damit beauftragt, die Risiken und Nebenwirkungen von 66 Pestiziden zu bewerten, die andere Länder längst verboten haben. Da in dem Ausschuss auch Industrie-VertreterInnen saßen, fiel die Empfehlung moderat aus. Die Kommission legte dem Staat nahe, 13 Agro-Chemikalien sofort aus dem Verkehr zu ziehen, darunter mit Fenthion und Methyl Parathion auch solche Wirkstoffe, die in BAYER-Produkten enthalten sind. Darüber hinaus schlug sie vor, die Zulassung für sechs Ackergifte 2020 auslaufen zu lassen und 27 im Jahr 2018 noch einmal in Augenschein zu nehmen. Aber der Regierung ging selbst das zu weit. Sie machte keine Anstalten, die Ratschläge zu befolgen. Deshalb sehen sich Modi & Co. nun mit einer Klage konfrontiert.
USA verbieten primäres Mikroplastik
Immer mehr Plastik-Abfälle gelangen in die Weltmeere und bedrohen so das aquatische Ökosystem. Durch Wellenbewegungen und Sonnen-Einwirkung kleingemahlen oder gleich in winziger Form als primäres Mikro-Plastik in das Wasser geraten, nehmen Fische und andere Tier-Arten die Partikel auf und setzen sich so großen Gesundheitsgefahren aus. Als einer der weltgrößten Kunststoff-Produzenten trägt BAYER maßgeblich zu diesem Desaster bei. Die USA hat jetzt jedoch erste Schritte zum Schutz der Wasser-Lebewesen eingeleitet. Sie verbot die Herstellung von primärem Mikro-Plastik, den sogenannten Microbeads, wie sie sich unter anderem in einigen Sorten des Durethan-Kunststoffs der BAYER-Tochter COVESTRO finden.
PCB: Kein Verfahren gegen RAG
Polychlorierte Biphenyle (PCB) gehören zu den giftigsten Hervorbringungen der Chlorchemie (SWB 1/14). Die vor allem von BAYER und MONSANTO in Umlauf gebrachten gefährlichen „Alleskönner“ kamen bis zu ihrem vollständigen Verbot 1989 in Elektrogeräten, Fugendichtungsmassen, Farben, Ölen, Lacken und Bodenbelägen zum Einsatz – und stellen immer noch ein beträchtliches Gesundheitsrisiko dar. Von den 1985 in der Bundesrepublik verkauften 72.000 Tonnen landete mehr als ein Sechstel im Bergbau, wo die schweren Gerätschaften viel Hydraulik-Öl brauchten. „Wir sind mit dem Zeug umgegangen, als wäre es Milch“, zitiert der Spiegel einen Bergmann. Dementsprechend leiden viele seiner KollegInnen heute an den Spätfolgen und zeigen Vergiftungssymptome wie Haut-, Nieren- und Leberschäden. Die Altlasten lagern in Fässern und anderen Behältern, die nicht selten Leckagen aufweisen. Nicht zuletzt deshalb gelangt jetzt PCB mit dem abgepumpten Grubenwasser aus den kontaminierten Stollen in die Flüsse. Das nordrhein-westfälische Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz entnahm unter anderem an den Bergwerken in Prosper-Haniel, Bergkamen und Essen Proben und wies PCB-Belastungen nach, die an manchen Stellen um das Dreifache über den Grenzwerten lagen. Der BUND reichte deshalb eine Strafanzeige gegen den Bergbau-Konzern RAG ein. Anfang September stellte die Bochumer Staatsanwaltschaft die Ermittlungen allerdings ein. Das Unternehmen hätte wasserrechtliche Genehmigungen für die Einleitungen, und die Gewässer hätten kein Schaden genommen, erklärte Oberstaatsanwalt Paul Jansen zur Begründung. Er behauptete sogar, das Unternehmen hätte immer die Grenzwerte eingehalten.
Klage wg. Diskriminierung
Anfang Dezember 2016 hat eine US-amerikanische BAYER-Angestellte den Konzern wegen Diskriminierung verklagt. Dr. Irene Laurora, welcher der Leverkusener Multi 2012 noch den Titel der „Working Mother of the Year“ verliehen hatte, wirft dem Unternehmen vor, sie wegen ihres Einsatzes für Frauenrechte entlassen zu haben. Die Pharmakologin hatte 2015 eine schwangere Frau in ihr Projekt geholt, wogegen Lauroras Vorgesetzter wegen des bevorstehenden Mutterschaftsurlaubs allerdings Einspruch erhob. Die Wissenschaftlerin protestierte gegen die Intervention ihres Chefs, was zu Zurückstufungen und schließlich zur Kündigung führte. „Anstatt Dr. Lauroras Anstrengungen zu unterstützen, gegen die Diskriminierung Schwangerer vorzugehen, versuchte BAYER sie rechtswidrig durch eine Freisetzung mundtot zu machen“, kritisiert der Rechtsanwalt der Klägerin. Beim Pharma-Riesen ist das nicht der erste Fall dieser Art: Bereits im Jahr 2011 hatten acht weibliche Angestellte rechtliche Schritte gegen den Konzern wegen frauenfeindlichen Verhaltens eingeleitet (siehe SWB 3/11).
Auch Uni Mainz darf weiter mauern
Am 18. August 2015 hatte das Oberverwaltungsgericht Münster der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) die Einsichtnahme in den Vertrag verwehrt, den BAYER mit der Universität Köln geschlossen hatte. Antworten auf Fragen zur finanziellen Ausgestaltung der Kooperation, zu den Verwertungsrechten, zu den Forschungsvorgaben des Leverkusener Multis und zum Umgang mit negativen Forschungsergebnissen bleiben der Öffentlichkeit damit verwehrt. Der Richter Sebastian Beimesche hatte sich bei seinem Urteil auf die Paragrafen des nordrhein-westfälischen Informationsfreiheitsgesetzes und des Hochschulzukunftsgesetzes gestützt. Die entsprechenden Abschnitte entbinden Forschung & Lehre von der Transparenz-Pflicht. Und der Jurist legte diese so „weitreichend“ aus, dass sie auch die Forschungsplanung einbeziehen. Mit dem Verweis auf eine ähnliche Ausnahme-Regelung in den rheinland-pfälzischen Gesetzen bewahrte das Verwaltungsgericht Mainz Mitte September 2016 nun auch die Universität Mainz und BOEHRINGER davor, Details ihrer Zusammenarbeit offenlegen zu müssen.
Grünes Licht für Autobahn-Ausbau
Die Bezirksregierung Köln hat dem Landesbetrieb Straßen.NRW Anfang November 2016 die Genehmigung erteilt, die Autobahn A1 zwischen Köln-Niehl und dem Autobahn-Kreuz Leverkusen-West auszubauen und dafür auch eine neue Rheinbrücke zu errichten (siehe auch SWB 1/17). Dass der „Vorhaben-Träger“ dafür BAYERs erst zur Landesgartenschau 2005 in langjähriger Arbeit halbwegs gesicherte Dhünnaue-Deponie wieder öffnen muss, focht die Behörde bei ihrer Entscheidung nicht an. Sie setzte sich mit ihrem Beschluss über 300 Einwendungen verschiedener Initiativen und Einzelpersonen – auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hatte im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens eine Beschwerde eingereicht – und über massiven BürgerInnen-Protest hinweg.. Die GegnerInnen des Projektes verstummen dennoch nicht. So luden sich Umweltverbände, die CBG und andere Gruppen am 7. Dezember 2016 einfach selbst zur Feier von „125 Jahre BAYER in Leverkusen“ ein und vermiesten dem Global Player, seiner Gratulantin Hannelore Kraft und den anderen Gästen gehörig die Stimmung. Zudem wollen einige Organisationen gegen den Planfeststellungsbeschluss klagen.
FORSCHUNG & LEHRE
Kooperation mit der Uni Hamburg
BAYER hat mit der Universität Hamburg eine Forschungskooperation auf dem Gebiet der „Digitalen Landwirtschaft“ vereinbart. GeologInnen und InformatikerInnen der Hochschule wollen für den Leverkusener Multi im Rahmen dieser Zusammenarbeit ein Modell zur Erhebung von Wetter- und Bodendaten entwickeln, um „die Nutzung bestehender landwirtschaftlicher Ressourcen weiter zu optimieren“.
Kooperation mit der Uni Göttingen
Der Leverkusener Multi lagert immer größere Bereiche seiner Forschungsarbeiten aus. Rund 20 Prozent seines über 4,3 Milliarden Euro schweren Forschungsetats steckt er mittlerweile in Kooperationen mit Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten. Der Göttinger Georg-August-Universität hat er gleich zwei Aufträge erteilt. Das dortige „Department für Nutzpflanzen-Wissenschaften“ ergründet für den Global Player zum Preis von 141.250 Euro, warum das Pestizid Flufenacet Wildgräsern nichts mehr anhaben kann. Das andere, nicht näher bezeichnete Agrochemie-Projekt läuft Ende 2016 aus und kommt BAYER mit 180.000 Euro noch teurer zu stehen.
BAYER stiftet Lehrstuhl
BAYER pflegt die akademische Landschaft nicht nur hierzulande mit Stiftungsprofessuren, sondern auch im Ausland. So hat der Leverkusener Multi der Universität Manitoba in Tateinheit mit den Nachkommen eines Arztes einen Lehrstuhl zur Erforschung von Blut-Krankheiten spendiert.