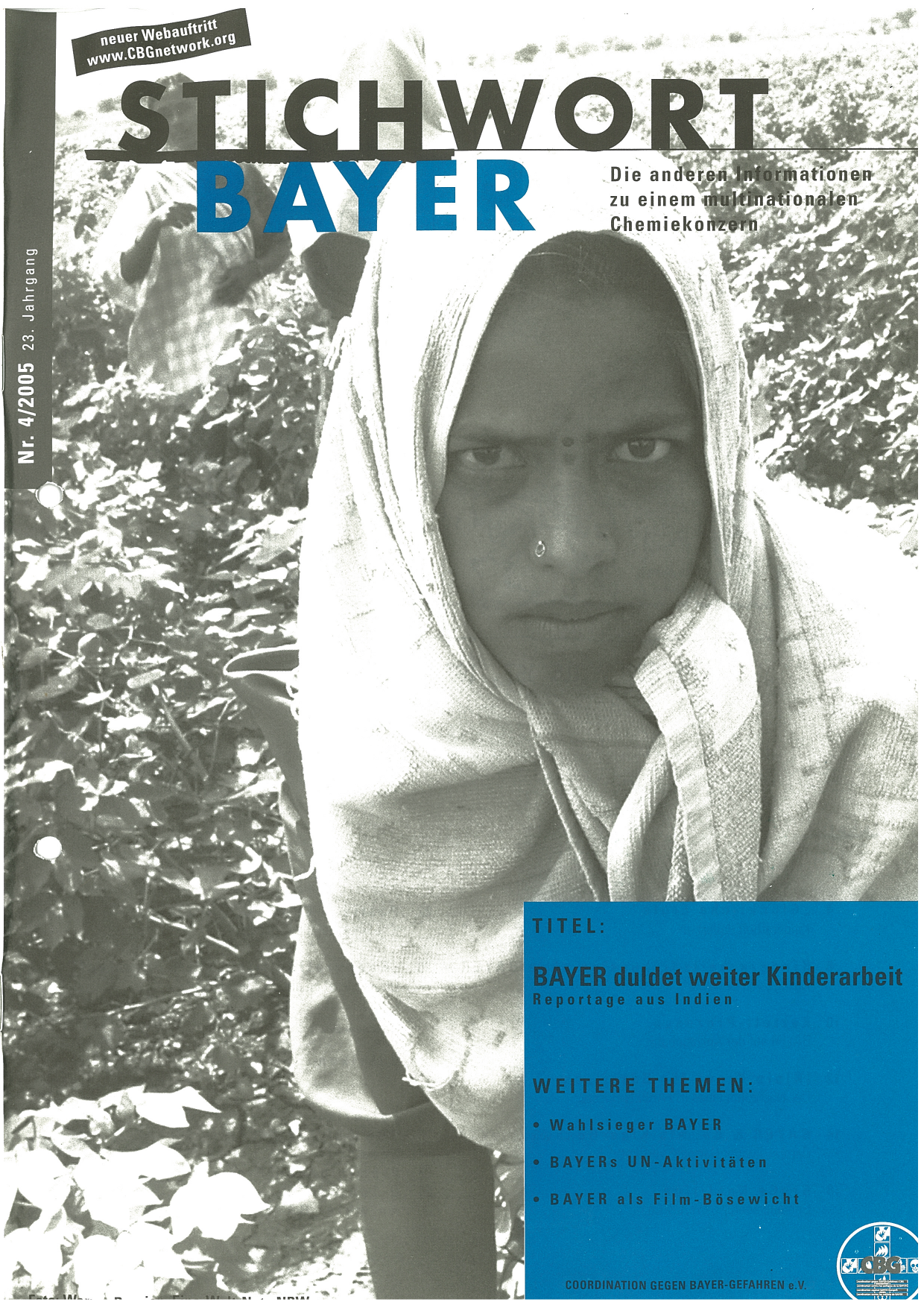AKTION & KRITIK
Streik bei BAYER-Italien
Im November 2005 streikten am italienischen BAYER-Standort Filago mit Unterstützung der großen Gewerkschaften CGIL, CISL und UIL 500 Belegschaftsangehörige, um gegen die Entlassung von neun MitarbeiterInnen zu protestieren. Die Beschäftigten von LANXESS, der Anfang des Jahres vom Leverkusener Multi abgestoßenen Kunststoffsparte, legten aus Verbundenheit mit den vom Rauswurf Bedrohten ebenfalls die Arbeit nieder. Die Betroffenen arbeiteten in der Haushaltsinsektizid-Produktion. Nach dem Verkauf des Insektenmittels AUTAN an JOHNSON & JOHNSON fuhr BAYER die Produktion herunter. Viele Beschäftigte wechselten daraufhin in andere Bereiche, aber den Neun bot der Agroriese keine neuen Arbeitsplätze an. „Einen derartigen Fall hat es hier noch nicht gegeben. Wir müssen in jedem Fall auch für die übrig gebliebenen Angestellten eine würdige Lösung finden“, meint Elisabetta Giglio von der Gewerkschaft CGIL. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hat den Streikenden ihre Solidarität bekundet.
Die CBG-Jahrestagung 2005
Am 12. November 2005 fand im Düsseldorfer Umweltzentrum die Jahrestagung der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) zum Thema „Konzernmacht und Sozialraub - BAYER & Co. entfesseln den Kapitalismus“ statt. Conrad Schuhler vom Münchner „Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung“ hielt einen Vortrag über den Kapitalismus in Zeiten der Globalisierung, als dessen Hauptmerkmale er die anwachsende Macht der Finanzmärkte, höhere Profite für die Konzerne und eine forcierte Ausbeutung der abhängig Beschäftigten ansah. Otto Meyer, Pfarrer im Unruhestand, dekonstruierte die sieben Mythen des Neoliberalismus von der „Kostenexplosion in den Sozialsystemen“ bis hin zur „Überalterung“. Der CBG-Vorständler Jan Pehrke schließlich befasste sich mit der Geschichte des Sozialen bei BAYER, die Ende des 19. Jahrhunderts als Befriedungsstrategie ihren Anfang nahm. Alle Referenten fassten den gegenwärtigen Neoliberalismus nicht als eine Schicksalsmacht, sondern als ein qua Politik geschaffenes Gesellschaftsmodell auf, das also qua Politik auch wieder rückholbar ist. Deshalb kam es im Anschluss der Referate jeweils zu fruchtbaren Diskussionen über Alternativen zum gegenwärtigen Status quo. So nahmen die TeilnehmerInnen von der Jahrestagung neue Kraft für ihre politische Arbeit in ihren jeweiligen Zusammenhängen mit nach Haus.
3.500 Beschäftigte demonstrierten
BAYER INDUSTRY SERVICES (BIS) plant ein drastisches Einsparprogramm (siehe KAPITAL & ARBEIT). Am 5. November wollte die Geschäftsleitung mit den Betriebsräten im Wirtschaftsausschuss die Einzelheiten besprechen. Darum versammelten sich 3.500 Belegschaftsangehörige aller Standorte der BAYER AG vor den Wiesdorfer Arkaden, um ihren Unmut über das Vorgehen des BIS-Managements zum Ausdruck zu bringen - mit Pfiffen, bösen Kommentaren und Buh-Rufen für den BIS-Vize Heinz Bahnmüller. Eine Protestversammlung dieser Größe hat es beim Leverkusener Chemiemulti lange nicht mehr gegeben.
Proteste gegen Genreis
Mit gentechnisch verändertem Reis wollen BAYER und andere Agromultis groß ins globale Ernährungsgeschäft einsteigen. Vor allem aus den Ländern der „Dritten Welt“ regt sich dagegen Widerstand. GREENPEACE sowie Initiativen aus Indien, Thailand, Indonesien und anderen Staaten nahmen den Welternährungstag am 16. Oktober zum Anlass, ein Verbot von genmanipuliertem Reis zu fordern. Sie wählten dieses Datum mit Bedacht, denn anders als von der UN-Welternährungsorganisation FAO propagiert, stellt der Laborreis in ihren Augen keinen Beitrag zur Lösung des Hungerproblems dar. Deshalb übergaben die Gruppen einem FAO-Vertreter in Bangkok ein Manifest. Darin warnten sie vor den Gesundheitsrisiken der neuen Technologie und kritisierten die aggressive Vermarktungsstrategien von BAYER & Co.. „Reis ist das weltweit wichtigste Grundnahrungsmittel. Wir werden nicht zulassen, dass einige wenige Agromultis die Zukunft dieser Pflanze aufs Spiel setzen“, sagte die südostasiatische GREENPEACE-Aktivistin Varoonvarn Svangsopakul.
Immer mehr Gen-GegnerInnen
Das FORSA-Institut befragte die BundesbürgerInnen nach ihrer Meinung zu Genfood und bescherte BAYER & Co. ein niederschmetterndes Ergebnis: Drei Viertel der Befragten sprach sich gegen gentechnisch produzierte Lebensmittel aus.
Verbände gegen neue Gentechpolitik
Mehrere Initiativen haben Angela Merkel in einem Offenen Brief zu einer Kehrtwende in der Gentechnik-Politik aufgefordert. Sie appellierten an die Bundeskanzlerin, bei der beabsichtigten Novellierung des Gentechnik-Gesetzes nicht die Koexistenz von konventioneller und gentechnik-basierter Landwirtschaft zu verhinden, nicht die Wahlfreiheit der VerbraucherInnen einzuschränken und den Umweltschutz nicht zu vernachlässigen. „Lassen Sie nicht zu, dass über die Revision des Gentechnik-Gesetzes einer schleichenden gentechnischen Verunreinigung konventioneller und biologischer Ernten sowie von Natur und Landschaft Tür und Tor geöffnet wird!“, schließt das Schreiben. Zu den Unterzeichnern zählten unter anderem BIOLAND, GREENPEACE, das GEN-ETHISCHE NETZWERK, die ZUKUNFTSSTIFTUNG LANDWIRTSCHAFT und der BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ (BUND).
JapanerInnen schreiben Landwirtschaftsminister
Ein Großteil der Rapsernte aus Australien geht nach Japan. Das Land akzeptiert jedoch keine Verunreinigungen durch genmanipulierten Raps. Deshalb nahm eine VerbraucherInnen-Organisation die jüngst festgestellte Kontamination von konventionell angebautem Raps durch BAYERs LIBERTY-LINK-Sorte (siehe GENE & KLONE) zum Anlass, den australischen Landwirtschaftsminister Peter McGauran in einem Brief aufzufordern, strengere Maßnahmen zur Verhinderung solcher Auskreuzungen zu ergreifen und die Auflagen für Freisetzungsversuche zu erhöhen.
ÄrztInnen fordern REACH-Nachbesserungen
Die Bundesärztekammer hat das geplante Chemikaliengesetz der EU kritisiert. Nach Meinung der MedizinerInnen-Organisation fällt es weit hinter dem ursprünglichen Entwurf zurück. Sie fordert unter anderem Nachbesserungen wie Risikobewertungen auch für Stoffe unterhalb einer Produktionsmenge von einer Tonne, die Einführung von Langzeittests und Monitoringverfahren. Darüber hinaus tritt die Ärztekammer für eine Hersteller-Haftung im Falle von Gesundheitsschäden durch Chemie-Gifte ein.
CBG stört Greenwashing
Im US-amerikanischen Pittsburgh hat der Leverkusener Multi einen Umweltfilm-Wettbewerb für Schüler gesponsort, um sich einmal mehr öffentlichkeitswirksam von seiner grünen Seite zu zeigen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hat den Veranstaltern Material über die Umweltsünden des Konzerns zur Verfügung gestellt und sie über die Greenwashing-Strategie des Agromultis aufgeklärt. Das blieb nicht ohne Wirkung. Die „Pittburgh Filmmakers“ versprachen, eine weitere Zusammenarbeit mit BAYER zu überdenken. Eine Filmregisseurin verteilte während des Filmwettbewerbs sogar Handzettel mit kritischen Informationen über das Unternehmen.
PAN gegen Lindan
Seit BAYER die US-Firma GUSTAFSON erwarb, befindet sich der unter anderem durch den Holzgifte-Skandal mit seinen unzähligen Opfern berühmt-berüchtige Pestizid-Wirkstoff Lindan wieder im Sortiment des Konzerns. Die zur Familie der chlorierten Kohlenwasserstoffe gehörende Substanz zählt zu den giftigsten Chemikalien der Welt. Nur in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada dürfen BAYER und andere Hersteller sie noch vermarkten. Darum hat die US-amerikanische Sektion des PESTIZID-AKTIONS-NETZWERKES (PAN) in diesen Ländern eine Verbotskampagne gestartet (siehe auch Ticker 2/05). Die Initiative hat sich mit einer Petition an die staatliche Umweltbehörde EPA gewandt, RegierungsvertreterInnen aus den USA, Mexiko und Kanada zu einem „Lindan-Essen“ gebeten und ist BAYER mit einer Telefon-Aktion auf den Pelz gerückt. Als Lohn ihrer Arbeit lässt Mexiko die Genehmigung für das Ultragift Ende des Jahres auslaufen. Zudem wollen mehrere US-Bundesstaaten der Pharma-Industrie die weitere Verwendung von Lindan untersagen.
Kein PONCHO statt GAUCHO!
Das BAYER-Pestizid GAUCHO war für ein Bienensterben in großem Ausmaß verantwortlich, was in Frankreich zu einem Anwendungsverbot für bestimmte Kulturen wie Sonnenblumen und Mais führte. Das brachte den Agromulti dazu, mit PONCHO ein Nachfolgeprodukt zu lancieren. Die französische Umweltschutz-Initiative MOUVEMENT POUR LE DROIT ET LE RESPECT DES GÉNÉRATIONS FUTURES (MDRGF) hält es jedoch lediglich für alten Wein in neuen Schläuchen, weil der PONCHO-Inhaltsstoff Clothianidin zur selben Wirkstofffamilie wie GAUCHOs Imidacloprid gehört. Darum hat die MDRGF den französischen Landwirtschaftsminister aufgefordert, PONCHO die Zulassung zu verweigern.
Sechs Jahre Tauccamarca
Am 22. Oktober 1999 starben 24 peruanische Schulkinder aus Tauccamarca an einer Pestizid-Vergiftung. Die Frau eines Lehrers hatte das Gift versehentlich in die Schulmilch gemischt. Bei der Agrochemikalie handelte es sich um das BAYER-Produkt FOLIDOL mit einem Parathion-Wirkstoff. In den ländlichen Regionen Perus mit ihrer hohen AnalphabetInnen-Rate war eine solche Verwechslung vorprogrammiert, weil sich auf der Packung kein deutlicher Hinweis auf die Gefährlichkeit der Agrochemikalie befindet. Darum hat die lateinamerikanische Sektion des PESTIZID-AKTIONS-NETZWERKES (PAN) BAYER auf einem öffentlichen Tribunal, das anlässlich des sechsten Jahrestages des schrecklichen Ereignisses in Tauccamarca stattfand, auch eine Mitschuld am Tod der Kinder gegeben.
Umweltgruppe gegen Glyphosate
Die Behörden der mexikanischen Stadt Guadalajara rücken - einer Empfehlung der Nationalen Wasserkommission folgend - den üppigen Wasserlilien auf dem Chapala-See mit dem Herbizid Glyphosate zu Leibe. Weil der auch in BAYER-Produkten wie GLYPHOS und USTINEX G verwendete Wirkstoff das als Trinkwasserreservoir dienende Gewässer vergiften kann, hat die Initiative COLECTIVO ECOLOGISTA JALISCO (CEJ) im Rahmen einer Aktionswoche gegen die Glyphosate-Ausbringung der Kommune protestiert.
Pestizid-Proteste in Alaska
Der US-Bundesstaat Alaska hob im Jahr 2003 das Verbot, Pestizide per Flugzeug auszubringen, auf. Deshalb beantragte das Unternehmen KLUKWAN bei den Behörden die Genehmigung zum Besprühen einer riesigen Waldfläche mit Agrochemikalien. Zum Einsatz kommen sollten die Wirkstoffe Imazapyr und Glyphosate, das in BAYER-Produkten wie GLYPHOS und USTINEX G enthalten ist. Dagegen erhob sich jedoch Protest von FischerInnen, UmweltaktivistInnen, LokalpolitikerInnen und indigenen Völkern, dem sich die Verantwortlichen schließlich beugten.
Pestizid-Proteste in Costa Rica
Flugzeuge versprühen auf den Bananenplantagen Costa Ricas in rauhen Mengen Pestizide. Da die Felder in unmittelbarer Nähe von Ortschaften liegen, kommt es dort immer wieder zu Vergiftungsfällen. Dabei stellt der unter anderem in BAYERs PRONTO PLUS BRAVO-PACK enthaltene Wirkstoff Chlorthalonil einen der Hauptauslöser von Symptomen wie Hautausschläge, Atembeschwerden und Allergien dar. Deshalb haben Kommunen der Provinz El Limon bei staatlichen Stellen offiziell Protest gegen die Sprüheinsätze eingelegt. Aber die Verantwortlichen haben sich dem Druck der Bananenbarone gebeugt und den Giftspritzern die Lizenz verlängert.
KAPITAL & ARBEIT
Sparprogramm bei BIS
Seit der Umstrukturierung von BAYER zu einer Holding stehen die einzelnen Bereiche in einer geschäftlichen Beziehung zueinander. BAYER INDUSTRIAL SERVICES (BIS) betreibt beispielsweise die Chemie„parks“ inklusive Energieversorgung, Abfallmanagement und Werkschutz und bietet diese Dienstleistungen den anderen Konzern-Gesellschaften an. Diese allerdings üben Kaufzurückhaltung und machen Druck auf die Preise, wobei sich besonders die Chemie-Abspaltung LANXESS, die 40 Prozent der Anteile an der BIS hält, hervortut. In der Folge sanken die Erlöse der Service-Gesellschaft stark. Die BIS legte deshalb schon vor drei Jahren ein 131 Millionen Euro schweres Einsparprogramm auf, in dessen Rahmen sie bis 2006 über ein Sechstel der 7.300 Arbeitsplätze vernichten will. Da die Umsätze aber noch um mehr als die erwarteten 20 Prozent zurückgingen, plant die Gesellschaft jetzt neben weiteren Stellenstreichungen auch Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnausgleich. Zudem beabsichtigt sie, die tarifllich vereinbarten Einmalzahlungen einzubehalten sowie Unternehmensteile auszugliedern, um die Beschäftigten nicht länger nach dem Chemie-Tarif bezahlen zu müssen. Auch einen eigenen Betriebsrat ohne Anbindung an den Mutterkonzern strebt das BIS-Management an. Hätte die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) BAYER & Co. in den Tarifverhandlungen nicht so viele Öffnungsklauseln zugestanden, hätte die BIS bei ihren Rationalisierungsmaßnahmen bedeutend mehr Schwierigkeiten zu überwinden.
BAYER verlegt Diabetes-Zentrale
Der Leverkusener Multi schließt seine US-amerikanische Diabetes-Zentrale in Elkhart, was dort 160 Arbeitsplätze kostet, und verlegt sie nach New York. Damit existiert das Hauptwerk in der Stadt nicht mehr, lediglich noch eine Produktionsstätte mit 600 Beschäftigten. Elkhart hatte in den Augen des Konzerns einen gravierenden Standort-Nachteil aufzuweisen: Es gab dort eine Gewerkschaft.
Unterschiede bei den Sonderzahlungen
Bei BAYER fächert sich das Entlohnungsgefüge weiter auf. Die bei florierenden Geschäften ausgeschütteten übertariflichen Sonderzahlungen kommen nicht allen MitarbeiterInnen gleichermaßen zugute. Bei BAYER INDUSTRIAL SERVICES (BIS) machen sie lediglich fünf Prozent des Jahresgehalts aus, während die übrigen Gesellschaften des Multis sechs Prozent zahlen. Zudem können BIS-Beschäftigte sich nicht an BAYERs Aktienoptionen-Programm beteiligen.
BAYER ohne Antiinfektiva
Die Pillensparte von BAYER will sich von der Antinfektiva-Forschung trennen und damit weitere Arbeitsplätze im Werk vernichten. Das Unternehmen führt bereits aussichtsreiche Verkaufsgespräche mit HEXAL.
„Innovationsinitiative“ der IG BCE
Für die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) besteht zwischen Kapital und Arbeit kein Gegensatz. Daher kann sie BAYER & Co. die Arbeitsplatzvernichtung nicht anlasten. Statt Kapitalismuskritik zu üben, muss die Gewerkschaft positiv denken und auf den arbeitsplatzspendenden Segen von Innovationen setzen - ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen. Zu diesem Zweck hat die IG BCE bei BAYER das Projekt „Innovationsstandort Leverkusen“ gestartet, nachdem sich viele ihrer Betriebsräte bereits Anfang des Jahres bei der „Initiative pro Industriepolitik“ engagiert hatten. Die Chemie-Gewerkschaft hat auch schon ihre wahren Widersacher ausgemacht. „Die Grünen tun mit ihren ständigen Bedenken alles, um die deutsche Wirtschaft kaputt zu machen“, tönte BAYERs Gesamtbetriebsratschef Erhard Gipperich beispielsweise im Frühjahr.
AnalystInnen fordern weitere Abspaltungen
Nach der Abspaltung ist vor der Abspaltung: Die Trennung vom Chemie-Geschäft sehen viele Finanz-AnalystInnen nur als einen ersten Schritt. Sie fordern BAYER zur Abstoßung weiterer Geschäftsteile auf und haben dabei vor allem den Pharma-Bereich im Auge.
LANXESS gliedert Feinchemie aus
Wie bei der BAYER-Abspaltung AGFA bereits seit Jahren, so setzt sich auch bei der nunmehr selbstständigen Chemiesparte LANXESS der Teilungsprozess munter fort. Anfang November gab das Management Pläne bekannt, das Feinchemie-Geschäft ausgliedern zu wollen. Axel Westerhaus als Chef des künftig unter dem Namen SALTIGO GmbH firmierenden Unternehmens kündigte als erste Amtshandlung ein Programm zur Senkung der Produktionskosten um 25 Prozent an. Es umfasst unter anderem die Vernichtung von 500 Arbeitsplätzen und Betriebsschließungen.
LANXESS verkauft ISL-Chemie
Die unendliche Teilung, Teil 2: Anfang Dezember 2005 verkaufte die BAYER-Abspaltung LANXESS die Kürtener Firma ISL-Chemie, die vorwiegend Farben und Lacke für Kunststoffe herstellte, für 20 Millionen Euro an die BERLAC AG und verringerte so nochmals ihren Personalstamm.
ERSTE & DRITTE WELT
Mercosur gegen Bush
Die USA, China und die EU ringen um ökonomische Einflussspären in Südamerika. Die Europäische Union versucht seit geraumer Zeit, die Mercosur-Länder Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay stärker an sich zu binden und BAYER & Co. so bessere Kapitalverwertungsbedingungen zu schaffen. Diese Politik hat sich als erfolgreich erwiesen. Im November 2005 erlangte Bush für sein Projekt einer gesamtamerikanischen Freihandelszone auf dem Südamerika-Gipfel keine Mehrheit - Widerstand kam vor allem von Seiten der Mercosur-Staaten.
ERSTE & DRITTE WELT
AVALOX in der Tbc-Therapie?
Die Pharmamultis haben die ärmeren Staaten nicht in ihrer Kundendatei. Deshalb müssen öffentliche oder private Institutionen einspringen, um Medikamenten-Entwicklungen für Krankheiten zu fördern, die besonders häufig in Entwicklungsländern auftreten. Eine solche Organisation ist die „Global Alliance for TB-Drug-Development“. Bill Gates, die Rockefeller Foundation, die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA und diverse andere Vereinigungen finanzieren im Rahmen der Alliance die Suche nach neuen Tuberkulose-Behandlungsmethoden. So fließt auch Geld für die Erprobung einer Kombinationstherapie von Tbc-Arzneien mit BAYERs Antibiotikum AVALOX. Das Präparat soll den Heilungsprozess beschleunigen, die Bildung Antibiotika-resistenter Bakterienstämme eindämmen und so die Überlebenchancen der PatientInnen erhöhen. In der Fachwelt ist das BAYER-Mittel allerdings umstritten. Der Arzneimittelverordnungsreport ‚97 zählt Antibiotika mit Wirkstoffen aus der Gruppe der Fluorchinole wie AVALOX aufgrund der vielen Nebenwirkungen zu den „nicht primär empfehlenswerten Substanzen“. Schon bevor erste Ergebnisse der klinischen Tests feststehen, nutzt der Leverkusener Multi die PR um den neuen Tbc-Therapieansatz und verspricht, das Medikament in der so genannten Dritten Welt zu einem erschwinglichen Preis zu vermarkten, falls es sich als wirksam erweisen sollte.
IG FARBEN & HEUTE
Eine Zwangsarbeiterin berichtet
Die von BAYER mitgegründeten IG FARBEN eilte mit ihrem Antisemitismus sogar der NSDAP voraus und behandelte ihre SlavenarbeiterInnen viel schlechter als Unternehmen wie SIEMENS oder die AEG. Inge Deutschkron berichtet darüber in ihrem Buch „Ich trug den gelben Stern“, woraus die vom Bezirksamt Lichtenberg herausgegebene Publikation „Versklavt und fast vergessen“ Auszüge nachgedruckt hat. Über ihre Erfahrungen als zwangsverpflichtete Arbeiterin in der Perlon-Produktion schreibt die Autorin: „Diese Fabrik gehörte zum IG FARBEN-Konzern und war in Berlin bekannt für seine schlechte Behandlung von Juden (...) Man drückte uns den Judenstern in die Hand, der am Arbeitskittel zu befestigen war, mit den Worten: ‘Wehe, wenn ihr den vergesst.‚ Diese Kennzeichnung von Juden wurde amtlich erst Monate später angeordnet. Die IG FARBEN handelten eigenmächtig.“ Inge Deutschkron brachte sich schließlich selbst eine Knieverletzung bei, um ihre Entlassung zu provozieren. Wobei sie paradoxerweise wieder vom Antisemitismus des Unternehmens profitierte: Die IG-eigene Krankenkasse zahlte nämlich nicht gern für Juden mit Gesundheitsproblemen und wollte sie deshalb immer so schnell wie möglich loswerden.
IG-FARBEN-Mahnmal geschändet
Im Herbst 2005 haben Neonazis das Dessauer Zykon-B-Mahnmal geschändet, das erst Anfang des Jahres eingeweiht wurde. Die FORSCHUNGSGRUPPE ZYKLON B hatte sich neun lange Jahre für die Errichtung des „Informations- und Mahnpunkts Zyklon B Dessau“ eingesetzt, der daran erinnern sollte, dass der von BAYER mitgegründete Mörder-Konzern IG FARBEN in der Stadt einst Zyklon B produzierte.
POLITIK & EINFLUSS
Chemie-Arbeitgeber laufen Amok
Der Vorsitzende des „Bundesarbeitgeberverbandes Chemie“ (BAVC), der BASF-Vize Eggert Voscherau, hat in drastischen Worten drastische wirtschaftspolitische Maßnahmen eingefordert. Er trat in der Süddeutschen Zeitung für einen dreijährigen Verzicht auf Gesetze zum Arbeitsrecht und zur Umweltpolitik, für niedrigere Unternehmenssteuern, eine Reduzierung des Urlaubs und eine Streichung von Feiertagen ein. Besonders die Arbeitslosen will Voscherau härter an die Kandare nehmen. „Ich schätze mal, dass etwa ein Drittel der als arbeitslos Gemeldeten gar keine Arbeit sucht“, tönt er und verlangt Sanktionen für Vermittlungsunwillige, die „unter die Grenze dessen gehen, was heute als Existenzminimum gilt“. Bei BAYER & Co. können Joblose aber auf keinen Fall ein Unterkommen finden. „Grundsätzlich werden wir in der Industrie, auch in der Chemieindustrie, weiter Stellen abbauen. Wir steigern unsere Produktivität und stellen mit weniger Leuten mehr her“, bekannte er in dem Interview.
Chemiegesetz abermals abgeschwächt
Das Chemikaliengesetz REACH hat das EU-Parlament in Straßburg passiert - in abermals abgeschwächter Form. Nun müssen nicht mehr 30.000 Stoffe, sondern nur noch rund 5.000 Stoffe genauer auf ihre gesundheitsgefährdende Wirkung hin getestet werden. Für Substanzen bis zu einer Produktionsmenge von zehn Jahrestonnen gibt es einen Freifahrtschein, für solche bis 100 Jahrestonnen fallen die Langzeituntersuchungen weg. Auch müssen nicht mehr die Konzerne die Daten zusammentragen, die EU überantwortete diese Aufgabe ihrer Chemie-Agentur. Ein Sieg für die Chemie-Lobby und eine Niederlage für den VerbraucherInnenschutz. „Die deutschen Politiker stehen lieber BASF oder BAYER stramm zur Seite, allen voran Angela Merkel“, kommentierte die taz.
Umweltmedizin unter Druck
BAYER & Co. haben es geschafft, den Status der Umweltmedizin zu unterminieren. „Umweltmedizin“ gilt berufsständisch nun nicht länger als Zusatzbezeichnung, weshalb es auch keine Qualifizierungsangebote für dieses Fachgebiet mehr gibt.
IG BCE will BAYER & Co. stärken
Die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) betätigt sich einmal mehr als Bauchredner von BAYER & Co.. Sie gab zusammen mit dem Fraunhofer-Institut bei der Hans-Böckler-Stiftung die Untersuchung „Stärkung des Pharmastandortes Deutschland“ in Auftrag, die auch von der Pillen-Industrie hätte finanziert sein können. Als „Stärkungsmittel“ schlägt die Studie unter anderem mehr staatliches Geld für Gentechnik-Forschung, eine Verbesserung des Wissenstransfers von den Universitäten zur Industrie und eine konzertierte Aktion von Politik, Industrie, Wissenschaft, MedizinerInnen und Krankenkassen zur Entwicklung einer „nationalen Pharmastrategie“ vor. Soviel Liebesdienerei verwunderte selbst den Vorsitzenden des von BAYER gegründeten „Verbandes der forschenden Arzneimittelhersteller“, Andreas Barner. „Mit der IG BCE haben wir die einzigartige Situation, dass sich eine Gewerkschaft einsetzt für den Erhalt ihrer Industrie“, lobte er.
Verheugen will BAYER & Co. stärken
Der Brüsseler Lobby-Verband von BAYER & Co., der „European Roundtable of Industrialists“ (ERT) forderte im Februar 2004 in einem Brief an den damaligen Ratsvorsitzenden Bertie Ahern einen EU-Kommissar, „der sich exklusiv um alle Aspekte einer zum Wachstum führenden Industrie-Strategie kümmert“ - und ihnen lästige Umweltbestimmungen wie z. B. das geplante Chemikaliengesetz REACH verträglich gestaltet (SWB 4/04). Günter Verheugen tut als neuer Industrie-Kommissar alles, um der ihm zugedachten Rolle gerecht zu werden. Im Juni 2005 stellte er die Brüsseler Strategie zur Stärkung der pharmazeutischen Industrie vor. Diese sieht vor, die Projekte der Pillen-Produzenten im Rahmen des 7. Forschungsprogramms der Europäischen Union besonders zu fördern. Zudem will die Europäische Union 2,6 Milliarden Euro für neue Biotech-Firmen bereitstellen und BAYER & Co. mehr Freiheit bei der Preisgestaltung ermöglichen, also für noch höhere Pharmaprofite sorgen.
BAYER in DIURON-Kommission
BAYERs Ultragift DIURON steht seit langem in der Kritik (siehe auch PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE). So hat die EU eine Task Force in Sachen „DIURON“ gebildet, dabei allerdings mal wieder den Bock zum Gärtner gemacht. In dem Gremium haben nämlich die beiden Hauptproduzenten BAYER und GRIFFIN VertreterInnen sitzen. So dauerte es dann auch nicht lange, bis die Task Force dem gefährlichen Herbizid eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellte.
PROPAGANDA & MEDIEN
LEVITRA-Kampagne verboten
BAYER versucht mit allen Marketingmitteln, den Verkauf des hinter den Umsatzerwartungen zurückbleibenden Potenzmittels LEVITRA anzukurbeln. Eines davon hat sich jetzt als nicht mit dem Verhaltenscodex des australischen Pharmaverbandes vereinbar erwiesen. Der Leverkusener Multi hatte auf seiner Homepage eine „Gesundheitsberatung“ zum Thema „errektile Dysfunktion“ durchgeführt, dabei Daten über Patienten gesammelt und diese an 1.000 MedizinerInnen weiterverwiesen. Die Praxen erhielten dann ein LEVITRA-Informationspaket, das von berufener Ärztehand in die des „Kranken“ wandern sollte. Die Urologen wussten allerdings gar nichts von ihrem Glück und waren über die Vielzahl von LEVITRA verlangenden Patienten „not amused“. Sie beschwerten sich beim australischen Pharmaverband, der BAYER daraufhin zum Stopp der Verkaufsaktion aufforderte. Ähnliches widerfuhr dem Konzern bereits einmal in den USA. In einer TV-Werbung versprach er allzu Wundersames über die Heilwirkung des Mittels und musste den Spot einstampfen.
BAYER unterstützt WM-Kampagne
Bei der Kommerzialisierung des Fußballs hat der Agromulti eine Vorreiterrolle gespielt. Aus seinem Werksclub BAYER Leverkusen machte er die erste GmbH der Bundesliga-Geschichte. Darum ist der Konzern natürlich auch mit von der Partie, wenn es anlässlich der Fußball-WM darum geht, das Sportliche mit dem Geschäftlichen zu verbinden. Das Unternehmen unterstützt die vom „Bundesverband der Industrie“ (BDI) initierte Kampagne „Deutschland - Land der Ideen“, welche die öffentlichkeitswirksame Balltreterei nutzen will, um für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu werben, mit ca. einer Million Euro.
Kunstfreund BAYER
Im italienischen Sienna fördert der Leverkusener Multi eine Ausstellung über mittelalterliche Kunst - und seine Beziehungen zum auch als Sponsor mit im Boot sitzenden Bankhaus MONTE DEI PASCHI, das sich finanziell besonders im Bereich „Biotechnik“ engagiert.
BAYER fördert Selbsthilfegruppen
Der Leverkusener Multi unterstützt genau diejenigen medizinischen Fachverbände oder Selbsthilfeorganisationen, von denen er sich eine Werbewirkung für seine Arzneiprodukte zur Behandlung von Krebs, Diabetes, Hämophilie und Herzkrankheiten verspricht. Jüngst erhielten die US-Verbände „National Coalition for Cancer Survivorship“, „Juvenile Diabetes Research Foundation“, „National Hemophilia Foundation“ und „American Heart Association“ Schecks über je 100.000 Dollar. In der Vergangenheit haben die Gruppen sich für diese Zuwendung immer recht schnell dankbar gezeigt.
Urologen zeichnen LEVITRA aus
Die Werbearbeit von BAYERs PharmadrückerInnen für die Potenzpille LEVITRA hat sich ausgezahlt. Bundesdeutsche Urologen wählten das Mittel gegen „erektile Dysfunktion“ zum innovativsten Arzneimittel des Jahres 2005. Die lange Liste der Nebenwirkungen des Präparates, die von Blindheit, Kopfschmerzen und Gesichtsrötungen über Nasenschleimhaut-Entzündungen und Grippe-Symptome bis hin zu Verdauungsbeschwerden reicht, hat das Votum der Mediziner offenbar nicht weiter beeinflusst.
Mehr PR-Bedarf bei LANXESS
Die BAYER-Abspaltung LANXESS gibt in regelmäßigen Abständen Arbeitsplatzvernichtungen bekannt, was viel Öffentlichkeitsarbeit erfordert. Darum hat das Unternehmen seine PR-Abteilung vergrößert und die Leitung BAYERs früherem Krisenkommunikator Thomas Nisters übertragen.
TIERE & VERSUCHE
Tierversuchszahl steigt
Die Zahl der Tierversuche steigt mit kurzen Unterbrechungen seit Jahren kontinuierlich an. Während 1997 „bloß“ 1,49 Millionen Wirbeltiere starben, kamen im Jahr 2004 schon 2,26 Millionen in den Laboren von BAYER und anderen Konzernen um.
DRUGS & PILLS
Arzneiausgaben: plus 19 Prozent
Von Januar bis September 2005 stiegen die Aufwändungen der Krankenkassen für Medikamente um 19,1 Prozent auf 17,4 Milliarden Euro. Die Pillen von BAYER & Co. stellen mit einem Anteil von 17,6 Prozent am Budget den zweitgrößten Ausgabe-Posten dar und lassen die mit der Gesundheits„reform“ in Aussicht gestellten Beitragssenkungen als unrealistisch erscheinen. Die große Koalition plant deshalb, die Pharmariesen in ein Kostendämpfungsprogramm einzubinden und ihnen zwei Milliarden Euro abzutrotzen, wogegen der von BAYER gegründete „Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller“ sogleich Protest angemeldet hat.
BAYER vermarktet Alphakit-Tests
In der Risikogesellschaft gibt es keine Gesunden mehr, sondern lediglich noch die Unterscheidung zwischen manifest und potenziell Kranken. Besonders diverse Diagnose-Verfahren, die Anlagen für dieses und jenes aufspüren und eine - natürlich pillenförmige - Prävention angeraten sein lassen, tragen dazu bei. So hat der Leverkusener Multi einen Test auf einen Alpha-Antitrypsin-Mangel im Angebot, an dessen Resultate er selbst nicht so recht glaubt, denn zu wenig Alpha-Antitrypsin ist keinesfalls immer ein schlechtes Omen. „Auch wenn nicht jeder Betroffene ein Alpha-Antitrypsin-bedingtes Lungenemphysem entwickelt, so ist doch eine entsprechende Lebensweise mit Vermeidung inhalativer Schadstoffe hilfreich“, rät Dr. BAYER.
ALEVE mit Warnhinweisen
Schmerzmittel wie BAYERs ALEVE können Herz und Kreislauf schädigen. Nach einer im Herbst 2004 vom US-amerikanischen „National Institute of Aging“ veröffentlichten Studie steigerte BAYERs Schmerzmittel ALEVE mit dem Wirkstoff Naproxen für die ProbandInnen das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, um 50 Prozent (SWB 1/05). Das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ hat jetzt auf Alarmmeldungen dieser Art reagiert. Es verlangte von BAYER & Co., auf den Beipackzetteln vor einem erhöhten Risiko von Herz/Kreislauf-Erkrankungen durch die Einnahme der Schmerzmittel zu warnen.
EU-Zulassungsantrag für NEXAVAR
Der Leverkusener Multi hat für das gemeinsam mit ONYX gentechnisch entwickelte Krebsmedikament NEXAVAR eine Zulassung bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMEA beantragt. BAYER rechnet mit einer ab dem zweiten Halbjahr 2006 geltenden Genehmigung zur Behandlung von Nierenkrebs im fortgeschrittenen Stadium.
BAYER übt SORAFENIB-Vermarktung
BAYER bereitet sich schon auf die Vermarktung des kurz vor der Zulassung stehenden Krebsmittels NEXAVAR vor. Um „Facharzt-Expertise“ aufzubauen, startet die Vertriebsabteilung in den USA einen Testlauf durch die Praxen mit dem Präparat des JOHNSON & JOHNSON-Ablegers ORTHO-MCNEIL.
AVALOX in Japan
Der Leverkusener Multi hat für das Antibiotikum AVALOX in Japan eine Zulassung erhalten. Der Konzern will das Mittel gemeinsam mit dem einheimischen Unternehmen SHIONOGI auf dem weltweit zweitgrößten Pharma-Markt einführen. Der AVALOX-Wirkstoff Moxifloxacin gehört zur Gruppe der Fluorchinole. Die Fachwelt beurteilt diese Stoffklasse kritisch. Für den „Arzneimittelverordnungsreport“ zählen die Fluorchinole nicht zu den primär empfehlenswerten Substanzen. „Aufgrund der unerwünschten Wirkungen“ rät das Fachbuch zu einer „sorgfältigen Indikationsstellung“.
Neue Thrombose-Kooperation
BAYERs geschrumpfte Pharmasparte setzt verstärkt auf Kooperationen. So will der Konzern sein in der dritten und letzten Phase der klinischen Tests befindliches Präparat zur Verhütung von Thrombosen gemeinsam mit JOHNSON & JOHNSON weiterentwickeln und vermarkten. Das US-Unternehmen übernimmt dabei 50 Prozent der Kosten und zahlt BAYER eine Garantiesumme sowie erfolgsabhängige Prämien von insgesamt 290 Millionen Dollar. Die Zulassung des Pharmazeutikums, das angeblich den Gerinnungsfaktor Xa hemmt, ist für den Multi von entscheidender Bedeutung. „Vom Erfolg des Medikaments Xa (...) hängt das Überleben der BAYER-Sparte maßgeblich ab“, kommentiert die Financial Times Deutschland mit Verweis auf die wenigen neuen Blockbuster-Kandidaten aus den Wuppertaler Pharma-Labors.
„Faktor Xa“ auch gegen Schlaganfälle?
Als Mittel zur Verhütung von Thrombosen beginnt für BAYERs Medikament „Faktor Xa“ gerade die dritte und letzte Versuchsreihe. Profit verspricht sich der Konzern aber besonders von seiner Anwendung als Präparat zur Behandlung von Thrombosen und zur Verhütung von Schlaganfällen bei Vorhofflimmern. Für diese Indikationen läufen gerade Tests der Phase 2b. Prophylaktisch rührt der Konzern aber unter dem Motto „Schlaganfall vorbeugen - Lebensqualität erhalten“ schon mal die Werbetrommel. „Hoffnung gibt eine neue Substanz aus der Pharmaforschung von BAYER zur Vorbeugung und Therapie von Thrombosen“, heißt es in der halbseitigen Zeitungsanzeige.
BAYER kauft fremde Medikamente
BAYER hat seine Pharma-Forschung drastisch reduziert und viele Arbeitsplätze in diesem Bereich vernichtet. Dafür will der Leverkusener Multi verstärkt auf die Forschungsleistungen anderer Unternehmen zurückgreifen und Lizenzen für die neuen Arzneien erwerben.
GENE & KLONE
Die BAYER-Kartoffel kommt
BAYER will im Jahr 2007 eine gentechnisch manipulierte Kartoffel mit einem erhöhten Stärkegehalt, die für diverse industrielle Anwendungen bestimmt ist, auf den Markt bringen. Da zahlreiche Branchen wie die Papier-, Textil-, Pharma-, Bau- und Kunststoffindustrie Stärke als Rohstoff benötigen, hofft der Leverkusener Gengigant auf ein gutes Geschäft mit der getuneten Knolle. Die Risiken und Nebenwirkungen interessieren ihn dabei herzlich wenig.
Geheime Gensache
BAYER & Co. brauchen die Öffentlichkeit nicht umfassend über Risiken und Nebenwirkungen ihrer Genpflanzen in Kenntnis zu setzen. Nach Vorschlägen, die ein ExpertInnen-Gremium der EU erarbeitete, können die Konzerne alle Unterlagen, welche die genaue genetische Zusammensetzung des Produkts und andere das Patent berührende Informationen enthalten, unter Verschluss halten. Sie haben auch nicht die Pflicht, Mitteilungen über Risiken und Nebenwirkungen ihrer Produkte zu machen. „Die detaillierte Information, die sich im Falle einer Veröffentlichung negativ auf das Unternehmen auswirken könnte, darf vertraulich bleiben“, heißt es in dem Papier. Nur in Ausnahmefällen wollen die EU-BürokratInnen die Agromultis dazu veranlassen, das Geheimnis um die Toxizitätsdaten der genmanipulierten Pflanzen zu lüften. Den Anlass für die Ausarbeitung der Richtlinien hatte BAYER gegeben. Belgische Behörden verlangten genauere Auskünfte über eine gentechnisch manipulierte Ackerfrucht des Leverkusener Multis, was dieser aber mit Verweis auf das „Betriebsgeheimnis“ verweigerte. Daraufhin wandte sich die belgische Regierung mit der Bitte um Klärung der Veröffentlichungspflichten an Brüssel.
Genspuren im Raps
In Australien hat sich Genraps von BAYER, der gegen das konzern-eigene Herbizid LIBERTY LINK immun ist, in konventionell angebaute Kulturen eingekreuzt. WissenschaftlerInnen maßen eine 0,5-prozentige Verunreinigung. Dem Landwirt Geoffrey Carracher, der seine Ernte nun nicht mehr in Länder mit strengen Anti-Genfood-Richtlinien exportieren kann, entstand ein Schaden von 48.000 Dollar. Aus diesem Grund verlangt er vom Leverkusener Multi eine Entschädigung. „Der BAYER-Konzern muss die Verantwortung übernehmen. Ihm gehört das Patent, und er macht den Profit, deshalb sollte er für das, was Farmern wie mir passierte, haften“, so Carracher. Die australische GREENPEACE-Sektion vermutet Methode hinter den Kontaminationen. „Es mag zynisch klingen, aber es hat den Anschein, als ob hinter den Verunreinigungen eine regelrechte Strategie der Genmultis steht, die Akzeptanz für ihre Produkte erzwingen soll“, sagt der GREENPEACEler John Hepburn. „If you can‘t beat them, join them“ - so lautet das Kalkül von BAYER & Co.. Die Organisation fordert als Konsequenz aus den Vorfällen dagegen strengere Kontrollen und Rückstandsgrenzwerte kaum über „Normalnull“.
EU genehmigt Raps-Import
Innerhalb der europäischen Union ist der Anbau von gentechnisch verändertem Raps nicht erlaubt. Gegen eine Einfuhr der Laborfrüchte hat die EU aber nichts einzuwenden. Sie genehmigte im August 2005 einen entsprechenden Antrag des Agromultis MONSANTO. Da darf sich BAYER auch berechtigte Hoffnungen auf ein „Ja“ aus Brüssel zum Import des Leverkusener Rapsöl-Saatguts machen, das die Kommission in den Mitgliedsländern nicht angepflanzt sehen wollte.
Genmais mit weniger Ertrag
Kanadische WissenschafterInnen haben über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg den Ertrag von Bt-Mais, dessen mittels Gentechnik eingebauter Bacillus thuringiensis die Pflanze vor Insektenfraß schützen soll, mit demjenigen konventionell angebauter Sorten verglichen. Der Naturmais schnitt um bis zu 12 Prozent besser ab. Da er zudem billiger ist, empfiehlt sich den ForscherInnen zufolge schon aus rein wirtschaftlichen Gründen der Anbau von traditionellem Mais.
Genmais auf Frankreichs Feldern
Die grüne Gentechnik à la française: Im Nachbarland gibt es zwar Regeln für Freisetzungsversuche, nicht aber für den kommerziellen Anbau. Das hat der Maiserzeuger-Verband AGPM mit freundlicher Unterstützung von BAYER & Co. ausgenutzt. Er schaffte Fakten und sorgte für blühende Genmais-Landschaften von 1.000 Hektar Größe. Die Öffentlichkeit erfuhr von all dem nichts, bis die Zeitung Le Figaro den Skandal aufdeckte. Dann erst rückte das Landwirtschaftsministerium mit dem Geständnis heraus, es habe für Sorten wie BAYERs T25-Mais, die ihre Zulassung vor dem 1999er Moratorium der EU erhalten hatten, grünes Licht gegeben. Ab 2006 wollen die PolitikerInnen de gentechnischen Wildwuchs zumindest durch Regularien begrenzen.
Neuer Gentest
BAYER hat in den USA die Zulassung für einen Hepatitis B-Test erhalten. Dieser will die Krankheit über die Bestimmung von Antigenen, die für die Bildung von Antikörpern verantwortlich sind, diagnostizieren.
BAYER erwägt Saatgut-Zukauf
BAYER CROPSCIENCE erwirtschaftet eine Rendite von fast 25 Prozent und hat daher viel Geld für Akquisitionen. Da für den weltweit zweitgrößten Pestizid-Hersteller Ackergift-Zukäufe aus kartellrechtlichen Gründen nicht in Frage kommen, erwägt die Gesellschaft Einkaufstouren im Saatgut-Bereich.
WASSER, BODEN & LUFT
Täglich 60 kg Phospat im Rhein
Der Leverkusener Chemie„park“ von BAYER leitet seiner Kläranlage täglich 2.000 kg Phosphat zu. Nach den Reinigungs- und Aufbereitungsprozessen bleiben davon noch 60 kg übrig, die in den Rhein gelangen. Da es sich bei Phosphaten um Nährstoffe handelt, sorgen diese in den Gewässern für ein vermehrtes Wachstum von Algen und anderen Wasserpflanzen. Die abgestorbene Flora zersetzen Mikroorganismen weiter. Sie entziehen dem Wasser dabei allerdings viel Sauerstoff, was wiederum zu Fäulnisprozessen führt und die Flüsse zum Himmel stinken lässt.
250.000 Euro für Wasseraufbereitung
BAYER betreibt nur Umweltschutz, wenn es nichts kostet oder andere die finanziellen Lasten tragen. Im September 2005 gelang es dem Multi, aus EU-Töpfen 250.000 Euro für eine neue Technologie zur Klärschlamm-Aufbereitung abzugreifen. Das Verfahren macht aus festen Bestandteilen lösliche und setzt dabei Biogas frei, das als Energiequelle dienen kann. Der nordrhein-westfälische Umweltminister Eckhard Uhlenberg (CDU) gratulierte als erster zum geglückten Subventionscoup.
Chemie in Auto-Innenluft
Die Autoindustrie ist ein Großabnehmer von BAYER-Kunststoffen. Viele dieser Materialien haben es in sich. Sie enthalten nämlich unter anderem gesundheitsgefährdende Weichmacher, Trennmittel, Flammschutzmittel, Versiegelungsaufträge, Stabilisatoren und Lösemittel (siehe auch SWB 4/99). Eine Untersuchung, die der BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DEUTSCHLAND (BUND) in Auftrag gab, wies bis zu 100 Chemiestoffe in der Innenraumluft von Kraftfahrzeugen nach. „Der Giftcocktail in den Autos ist Besorgnis erregend. Die Konzentration der Chemikalien überschreitet die erlaubten Grenzwerte um ein Vielfaches“, kommentierte die BUND-Chemieexpertin Patricia Cameron das Ergebnis der Studie.
PLASTE & ELASTE
Öl macht Polycarbonat teurer
Die höheren Kosten für den Rohstoff Öl haben BAYER bewogen, die Preise für die Makrolon-Grundsubstanz Polycarbonat um neun Prozent anzuheben. Die CD-Produzenten als größte Makrolon-Nachfrager sind darüber nicht amused, und Unternehmensberater geben ihnen schon den Tipp, nach anderen Herstellungsverfahren Ausschau zu halten.
Diabetes durch Bisphenol
Die in dem BAYER-Kunststoff Makrolon verarbeitete Chemikalie Bisphenol A wirkt hormon-ähnlich, was Stoffwechsel-Prozesse stört und so unter anderem das Krebs-Risiko erhöht. Jetzt haben WissenschaftlerInnen eine weitere Gefahr entdeckt. Nach ihren Untersuchungen kann Bisphenol A die Arbeit der Bauchspeicheldrüse beeinträchtigen und so Diabetes II auslösen. Zu diesem Resultat hätten die ForscherInnen allerdings aufgrund der bisher bekannt gewordenen Bisphenol-Nebenwirkungen auch ohne Tierversuche kommen können.
BAYER hofft auf „Rita“-Aufträge
Mit den aus den Schornsteinen der BAYER-Werke jährlich aufsteigenden 6,1 Millionen Tonnen Kohlendioxid trägt der Konzern maßgeblich zur Klimaerwärmung und damit auch zum vermehrten Auftreten von Wirbelstürmen bei. In den USA hat der Multi die Auswirkungen seines verantwortungslosen Handelns zum ersten Mal am eigenen Leib zu spüren bekommen. Er musste wegen des herannahenden Hurrikans „Rita“ die Produktion des Werkes im texanischen Baytown stoppen. Aber den ersten Schock hatte das Unternehmen bald überwunden. Dann begann wieder das „Business as usual“: Der Agromulti überlegte, wie er von der Katastrophe profitieren könnte. Er witterte für seine Baumaterialien aus Kunststoff ein gutes Geschäft beim Wiederaufbau und brachte sich dafür gleich mit einer Großspende für die „Rita“-Opfer im Wert von vier Millionen Dollar ins Gespräch.
PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE
Pestizid-Vergiftungen in Indien
Die Studien über Pestizidvergiftungen in Indien häufen sich (siehe auch Ticker 3/05). Das „Center for Science and Environment“ (CSE) des Landes wies im Blut von BewohnerInnen der Punjab-Region sechs bis dreizehn Ackergifte nach. Die auch in BAYER-Produkten enthaltenen Wirkstoffe Monocrotrophos und Chlorpyrifos spürten die WissenschaftlerInnen in 75 bzw. 85 Prozent aller Proben auf. Allein die Monocrotrophos-Konzentration überstieg den von der Weltgesundheitsorganisation WHO festgelegten Grenzwert für eine Kurzzeit-Exposition um das 4fache und den für eine Langzeit-Exposition um das 158fache. Das in der Bundesrepublik längst verbotene Monocrotophos lässt der Leverkusener Multi in Fabriken der Region Vapi herstellen, wo es keinerlei Umwelt- und Sicherheitsauflagen gibt und sich entsprechend oft Chemie-Unfälle ereignen (siehe auch SWB 1/04). „Die Studie des CSE zeigt einmal mehr auf das Deutlichste, dass ein sicherer Umgang mit Pestiziden in Entwicklungs- und Schwellenländern nicht möglich ist“, kommentierte das PESTIZID-AKTIONS-NETZWERK (PAN) die Ergebnisse der Untersuchung.
Pestizid-Vergiftungen in den USA
Der US-Bundesstaat Washington hat im Jahr 2004 ein Monitoring-Programm zur Gesundheitskontrolle von LandarbeiterInnen, die mit Pestiziden in Kontakt kommen, gestartet. Bei über 20 Prozent der FarmarbeiterInnen fanden sich hohe Agrochemie-Konzentrationen im Blut. Unter den vier am häufigsten nachgewiesenen Ackergiften befand sich mit GUTHION (Wirkstoff: Azinophos Methyl) auch eines von BAYER.
Giftige Pestizidwolken
Pestizide, welche die LandwirtInnen direkt in die Erde einspritzen, um gegen Insekten, Würmer, Unkraut oder Pilze vorzugehen, gehören zu den gefährlichsten. 90 Prozent dieser Wirkstoffe, wie sie mit Chloropicrin oder Methylisocyanate (MIC) auch BAYER herstellt, sickert nämlich ins Grundwasser oder steigt in die Luft auf und bildet Giftwolken. Eine solche Wolke mit Chloropicrin ist z. B. im Oktober 2003 über den US-amerikanischen Ort Lamont niedergegangen und hat 250 Menschen vergiftet. Sie bildeten unter anderem Symptome wie Kopfschmerzen, Asthma, Brechreiz, Schwindel und Zitteranfälle aus.
Kein Aldicarb für Vogeljäger
In Schottland ist die illegale Praxis der Vergiftung von Raubvögeln mittels Pestizidködern weit verbreitet. Sie hat bereits zu einer Besorgnis erregenden Reduzierung der Bestände geführt. Aus diesem Grund haben die Behörden nun schon den bloßen Besitz des auch von BAYER hergestellten Aldicarbs und anderer Pestizide unter Strafe gestellt, sofern die betreffende Person keinen landwirtschaftlichem Gebrauch nachweisen kann.
Australien erwägt DIURON-Verbot
Das BAYER-Herbizid DIURON zählt zu denjenigen Agrochemikalien, die weltweit die größte Belastung für Flüsse und Küstengewässer darstellen. Nicht nur wegen des Wirkstoffes Diuron selber hat das Produkt es in sich. Beim Herstellungsprozess gelangen zudem Reste der Dioxin-ähnlichen Stoffe Tetrachloroazobenzene (TCAB) und Tetrachloroazoxybenzene (TCAOB) in das Anti-Unkrautmittel. Als Abbauprodukt entsteht zudem das das Muttergift an Gefährlichkeit noch übertreffende 3,4-Dichloroaniline. Aus diesen Gründen erwägt die australische Regierung ein Verbot der BAYER-Substanz.
GAUCHO-Verbot wirkt
Französische ImkerInnen machten das BAYER-Pestizid GAUCHO für ein Bienensterben in großem Ausmaß verantwortlich. Deshalb hat die Regierung vorläufig eine Ausbringung der Agrochemikalie auf Mais- und Sonnenblumenfeldern verboten. Prompt erwachten die Bienenvölker wieder zum Leben. Der ImkerInnenverband konnte sich im Jahr 2005 über stabile Bestände und eine gute Honigernte freuen. Der Leverkusener Multi bestreitet die gefährlichen Nebenwirkungen seines Ackergiftes noch immer, hat es nach dem nun von den BienenzüchterInnen erbrachten indirekten Beweis aber noch schwerer, seine Position überzeugend zu vertreten.
Chlorpyrifos weiter zugelassen
Die USA haben bereits im Jahr 2000 die Anwendung des Pestizidwirkstoffes Chlorpyrifos, enthalten unter anderem in BAYERs RIDDER, stark eingeschränkt. Die EU hat sich davon allerdings nicht beeindrucken lassen - von der Chemielobby jedoch umso mehr - und erteilte dem Ultragift im Juni 2005 die Absolution.
MCS durch „Holzschutzmittel“
BAYERs Tochter-Firma DESOWAG hat bis Mitte der 80er Jahre „Holzschutzmittel“ wie XYLADECOR produziert, die Gesundheitsschädigungen bei 200.000 Menschen verursachten. Das führte zum so genannten Holzgifte-Prozess - dem größten Umwelt-Strafverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Anklageschrift lieferte nun einem Studenten der Universität Bremen das Datenmaterial für eine Magisterarbeit über den Zusammenhang von Holzgiften und der Entstehung der „Multiplen Chemikalien-Unverträglichkeit“ (MCS). Nach seiner Untersuchung bildete sich bei einem Großteil der Personen, die über einen längeren Zeitraum hinweg XYLADECOR oder anderen Mitteln ausgesetzt waren, eine Chemikalien-Unverträglichkeit heraus. Das Ausmaß dieser erhöhten Empfindlichkeit variierte dabei in Abhängigkeit vom Alter und Geschlecht der Geschädigten sowie der Dauer ihrer Gift-Exposition. Psychische Veränderungen stellten sich der Magisterarbeit zufolge erst im Verlauf der Krankheitsgeschichte ein, weshalb sie nicht als Ursache von MCS gelten können.
Müdigkeitssyndrom durch Insektizide
Insektizide können das „Chronische Müdigkeitssyndrom“ (CFS) auslösen. Das hat ein Team um den spanischen Forscher J. Fernandez-Sola herausgefunden. Die WissenschaftlerInnen untersuchten 26 Personen, die auf ihrem Arbeitsplatz nach einer Desinfektionsmaßnahme den Anti-Insektenmitteln von BAYER & Co. ausgesetzt waren. Alle erkrankten an CFS, verbunden mit Schädigungen der oberen Luftwege und von Bindegewebe und Muskeln (Fibromyalgie). Bei drei Personen bildete sich zusätzlich eine „Multiple Chemikalien-Unverträglichkeit“ (MCS) heraus. 15 PatientInnen litten länger als ein Jahr an dem Müdigkeitssyndrom, sechs wurden arbeitsunfähig.
GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV
Chemie in Baby-Körpern
Die US-amerikanische Organisation ENVIRONMENTAL WORKING GROUP (EWG) hat das Nabelschnurblut von Neugeborenen untersucht und 287 Chemikalien oder andere giftige Substanzen nachgewiesen. Die WissenschaftlerInnen spürten Flammschutzmittel, Quecksilber, Polychlorierte Biphenyle (PCB), Pestizidwirkstoffe wie Lindan und Endosulfan sowie weitere Stoffe auf, die auch aus dem Hause BAYER stammen.
Chemie in Kleidung
Viele Kleidungsstücke haben es in sich: Sie enthalten Pestizide, Flammschutzmittel, Weichmacher, Weißtöner und andere gesundheitsschädliche Substanzen aus der Produktpalette von BAYER & Co. So litt eine Modegeschäft-Inhaberin lange Zeit an diffusen Krankheitssymptomen, bis ein Umweltmediziner ihr Blut untersuchte und den auch von BAYER hergestellten Pestizidwirkstoff Lindan in einer hohen Konzentration nachwies. Die 42-jährige Frau ist inzwischen Frührentnerin und das erste Kind ihrer ebenfalls in der Textilbranche tätig gewesenen Tochter leidet unter massiven Allergien.
Chemie in Eiern
Eine Initiative zum Verbot der gefährlichsten Pestizide und Industrie-Chemikalien, der so genannten POPs (Persistant Organic Pollutants), hat weltweit Eier von freilaufenden Hühnern untersucht und darin Spuren aller möglichen Substanzen gefunden. Das INTERNATIONAL POPS ELIMINATION NETWORK (IPEN) wies unter anderem Dioxine, Furane, Flammschutzmittel und Pestizide nach. Der auch von BAYER vertriebene Ackergift-Wirkstoff Lindan (siehe AKTION & KRITIK) fehlte in keinem Ei.
Benzol giftiger als erwartet
Nach einer im Wissenschaftsmagazin Science (Bd. 306) veröffentlichten Studie hat die Fachwelt bislang die Giftigkeit von Benzol unterschätzt. Selbst in kleinsten Dosen verursacht der Stoff bereits Schäden an Blut- und Knochenmarkszellen. Der BAYER-Konzern zählt Benzol in seinem „Nachhaltigkeitsbericht 2004“ zu den am häufigsten in der Produktion verwandten Grundchemikalien. Sie kommen unter anderem bei der Herstellung von Kunststoffen und Farben zum Einsatz.
Falsche Grenzwerte für Lösemittel
Die auch von BAYER in der Produktion verwandten Lösemittel Benzol, Phenol, Toluol und Styrol zählen zu den flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs). Sie können unter anderem die Hirnkrankheit Enzephalopathie und das „Sick Building Syndrom“ (SBS) auslösen. Nach Ansicht des Umweltmediziners Tino Merz verhindern die bisherigen Belastungsobergrenzen, wie sie die MAK-Werte (Maximale Konzentration am Arbeitsplatz) festlegen, keine Gesundheitsschädigungen. Nach dem neuesten Stand der Forschung müsste das Bundesarbeitsministerium die Grenzwerte um den Faktor 1.000 niedriger ansetzen, schreibt Merz in der Fachzeitschrift umwelt-medizin-gesellschaft.
PRODUKTION & SICHERHEIT
Sicherheitsbestimmungen reichen nicht
Im Wuppertaler BAYER-Werk ereignete sich am 8.6.1999 ein Großunfall. Im Kesselwerk 216 explodierten 600 kg 2-Chlor-5-nitrotoluol, 1.200 kg Dimethylsulfoxid und 500 kg Ätzkali. Die austretenden Chemikalien und der Brandruß verletzten über 100 Menschen. Der ehemalige Chemie-Professor Jürgen Rochlitz, Mitglied der NRW-Störfallkommission und Beirat der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG), kritisierte schon damals die mangelhaften Sicherheitsbestimmungen. In einem Antrag an den „Technischen Ausschuss für Anlagesicherheit“ machte er jetzt konkrete Verbesserungsvorschläge. Er regte an, in der „Technische Regel Anlagensicherheit 410“ detaillierte Vorschriften zur Verhinderung gefährlicher Reaktionen im Zusammenhang mit bestimmten Chlorverbindungen sowie in Verbindung mit dem Freiwerden von Wärme zu machen. Ersteres lehnte die Kommission ab, über das zweite Begehr hat sie noch nicht endgültig entschieden.
STANDORTE & PRODUKTION
Neue Reinigungsanlage für Wasserstoff
Für die Herstellung des ultragiftigen Chlors und anderer Chemikalien benötigt der Agromulti Wasserstoff. Durch ein von AIR LIQUIDE in Nordrhein-Westfalen betriebenes Pipeline-Netz gelangt dieser von einem BAYER-Standort zum nächsten. Der Konzern kann allerdings nur qualitativ hochwertigen Wasserstoff in das Röhrensystem einspeisen. Deshalb hat er in Leverkusen mit dem Bau einer sechs Millionen Euro teuren Reinigungsanlage begonnen.
IMPERIUM & WELTMARKT
Verkauf der Infektiva-Abteilung
Die Pharmasparte von BAYER trennt sich von der Antinfektiva-Forschung und führt bereits Verkaufsgespräche mit HEXAL.
Automatisierung mit SIEMENS
BAYER vermarktet Rationalisierungsverfahren für Anlagen mit Prozesstechnik künftig gemeinsam mit SIEMENS.
BAYER ohne BOOTS
Der Leverkusener Pharmariese gehört zu den größten Herstellern von rezeptfreien Medikamenten und wollte seine Position durch den Erwerb der entsprechenden Sparte von BOOTS noch ausbauen. 2,1 Milliarden Euro bot der Konzern dafür, was Finanzkreise als zu hoch betrachteten. Die BOOTS-ManagerInnen gaben sich mit diesem Betrag allerdings nicht zufrieden, woraufhin BAYER aus dem Bieterkreis ausschied.
Mehr Investitionen in Mexiko
Nach Aussage von BAYER-Chef Werner Wenning spielt Mexiko in Lateinamerika „die Rolle des Wachstumsmotors“. Im ersten Halbjahr 2005 hat der Konzern dort seinen Umsatz um 44 Prozent auf 285 Millionen Euro gesteigert. Die wachsenden Profite bewogen den Agromulti nun, sein wirtschaftliches Engagement in dem Land zu verstärken. Er will dort bis 2008 den Betrag von 100 Millionen Euro investieren.
Mehr Investitionen in Japan
BAYER will in Japan, dem drittgrößten Absatzmarkt des Konzerns, bis zum Jahr 2008 130 Millionen Euro investieren. Besonders viel Profit wirft dort das Pharmageschäft ab. In dem Land lassen sich nämlich teure Marken-Medikamente besonders gut verkaufen, während Nachahmerprodukte kaum Abnehmer finden. Erst allmählich ändert sich diese Tendenz. Aber weder das, noch eine von der Politik verordnete Preissenkung für Medikamente hält den Pharma-Riesen von seinem Nippon-Engagement ab.
UNFÄLLE & KATASTROPHEN
Unfall im Chemiepark
Im Dormagener Chemie„park“ von BAYER hat sich am 14.11.05 ein schwerer Unfall ereignet. Ein 18-jähriger Arbeiter einer Baufirma stürzte von einem Dach und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.
RECHT & UNBILLIG
Portugal vs. BAYER
Trotz diverser Verfahren ist die kriminelle Energie BAYERs in Sachen „Kartellen“ ungebrochen. In Portugal hatte der Konzern sich mit anderen Unternehmen abgesprochen, den Krankenhausmarkt untereinander aufzuteilen und für ihre Medikamente und Medizinprodukte dieselben Preise zu verlangen. So konnte der Leverkusener Multi mit der Lieferung von Diabetes-Tests hohe Gewinne erzielen. Doch der Schwindel flog auf. Die portugiesische Kartellbehörde verurteilte den Leverkusener Multi wegen Verstoßes gegen gesetzliche Bestimmungen in 26 Fällen zu einer Strafe in Höhe von 5,2 Millionen Euro (siehe SWB 4/05).
Brasilien vs. BAYER
Ein besonders perfides Kartell bildete BAYER gemeinsam mit anderen Pharmamultis in Brasilien. Die Unternehmen kamen überein, den Import preiswerter Nachahmer-Arzneien nach Brasilien durch Druck auf ihre Zulieferer zu behindern. So sabotierten sie eine erschwingliche medizinische Versorgung für die ärmeren Bevölkerungsgruppen. Aber die illegalen Machenschaften kamen ans Tageslicht. Nach einem sechsmonatigen Prozess verurteilte die brasilianische Kartellbehörde BAYER und die anderen beteiligten Firmen zu Strafzahlungen in Höhe von ein bis zwei Prozent ihres Jahresumsatzes (siehe SWB 4/05).
Quijano-Prozess läuft immer noch
Dr. Romy Quijano untersuchte in Kamukhaan auf den Philippinen die Risiken und Nebenwirkungen der auf einer Bananen-Plantage ausgebrachten Pestizide von BAYER und anderen Herstellern. Der Bananenbaron wollte ihn darufhin mundtot machen und hat Quijano im Jahr 2002 bereits zum zweiten Mal verklagt. Dabei schreckte jener nicht einmal davor zurück, DorfbewohnerInnen mit Bestechungsgeldern zu Aussagen gegen Romy Quijano zu veranlassen. Der Prozess läuft immer noch und hat den Wissenschaftler bis jetzt bereits 5.000 Dollar gekostet.
Noch eine „Medicare“-Klage
Der Leverkusener Chemie-Multi hat „Medicaid“ und „Medicare“, die US-amerikanische Gesundheitsprogramme zur Versorgung sozial Schwacher mit Medikamenten, um eine dreistelligen Millionen-Betrag betrogen (SWB 4/02), indem er bei den Abrechnungen zu hohe Arznei-Preise angab. Ein Gericht in Massachusetts verurteilte BAYER deshalb im April 2003 zu einer Strafe von 255,6 Millionen Dollar. Es folgten Klagen von sechs weiteren Bundesstaaten gegen BAYER und ein Dutzend anderer Pharma-Multis. Jetzt hat auch ein texanisches Gericht juristische Schritte in Sachen „Medicare“ eingeleitet.
Rattenmittel vergiften Kinder
Anti-Rattenmittel wie BAYERs RACUMIN mit den Wirkstoffen Cumatetralyl und Cholecalciferol stellen für Minderjährige eine große Gefahr dar. Allein in den USA schätzen die Behörden die Zahl der jährlichen Vergiftungsfälle auf 60.000. Betroffen sind vor allem Kinder aus den ärmeren Bevölkerungsteilen. Weil die US-Umweltbehörde EPA es versäumt hat, die Industrie zur Herstellung von kindersichereren Produkten zu zwingen, haben die beiden Initiativen WEST HARLEM ENVIRONMENTAL ACTION (WEACT) und NATIONAL RESSOURCES DEFENSE COUNCIL (NRDC) die Institution jetzt verklagt.
Das Umweltschadengesetz kommt
Das Bundesumweltamt hat, einer EU-Richtlinie folgend, den Entwurf zum Umweltschadengesetz erarbeitet. Die Regelung orientiert sich am Verursacherprinzip und sieht juristische Konsequenzen für Unternehmen vor, die geschützte Arten, natürliche Lebensräume, Böden oder Gewässer vergiften. Die RichterInnen können das Paragrafenwerk jedoch nur anwenden, wenn die bisherigen Bundesgesetze den zur Verhandlung stehenden Umweltschaden nicht genau erfassen.
Patentklage gegen BAYER
Das US-Unternehmen THIRD WAVE TECHNOLOGIES hat BAYER wegen Patent-Verletzung angeklagt. Die Biotech-Firma wirft dem Leverkusener Multi vor, bei der Entwicklung seiner Hepatitis-C-Tests Eigentumsrechte von THIRD WAVE missachtet zu haben.
FORSCHUNG & LEHRE
Start-Ups starten BAYER up
Mit der „BAYER Start up Initiative“ will der Multi junge innovative Unternehmen an den Konzern binden, um von ihren Forschungsarbeiten zu profitieren. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Neugründungen aus dem Universitätsbereich. „Es besteht eine natürliche Symbiose zwischen einem universitären Umfeld, welches zum Ausarbeiten von Entwicklungen ideal geeignet ist, und der Industrie“, meint der BAYER-Manager Volker Wege. Bislang ging dem Konzern unter anderem die INFORMIUM AG, die TAURUS GmbH und die BIOGENIUS GmbH ins Netz.
BAYER verleiht Infektologie-Preis
Das Stiften des „Klinische Infektiologie 2005“-Preises erlaubt BAYER, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Zum einen baut der Pharma-Riese seine Beziehungen zur „Deutschen Gesellschaft für Infektiologie“ aus, mit der er die Auszeichnung gemeinsam verleiht, und zum anderen bindet das Unternehmen WissenschaftlerInnen verstärkt an sich. In diesem Jahr prämierte der Multi nicht zufällig eine Arbeit von Dr. Dirk Meyer-Olson. Er erforschte den molekularen Krankheitsverlauf von Hepatitis C, wovon der Global Player als großer Hersteller von Hepatitis-C-Tests profitieren könnte.