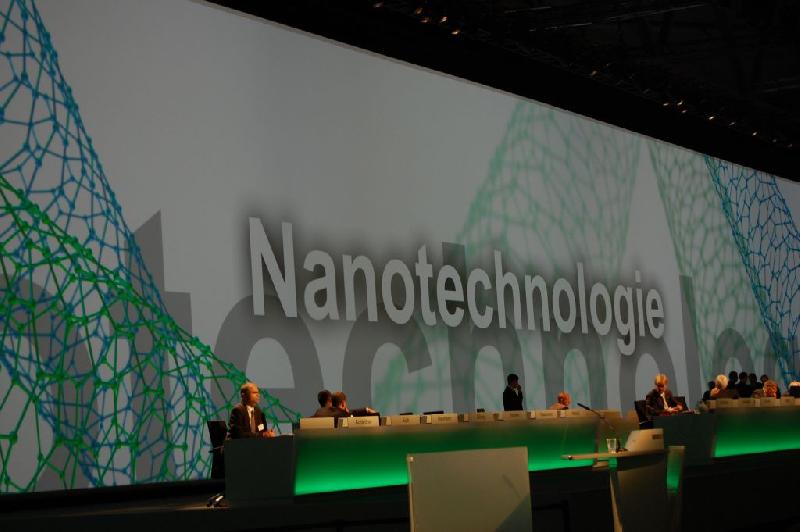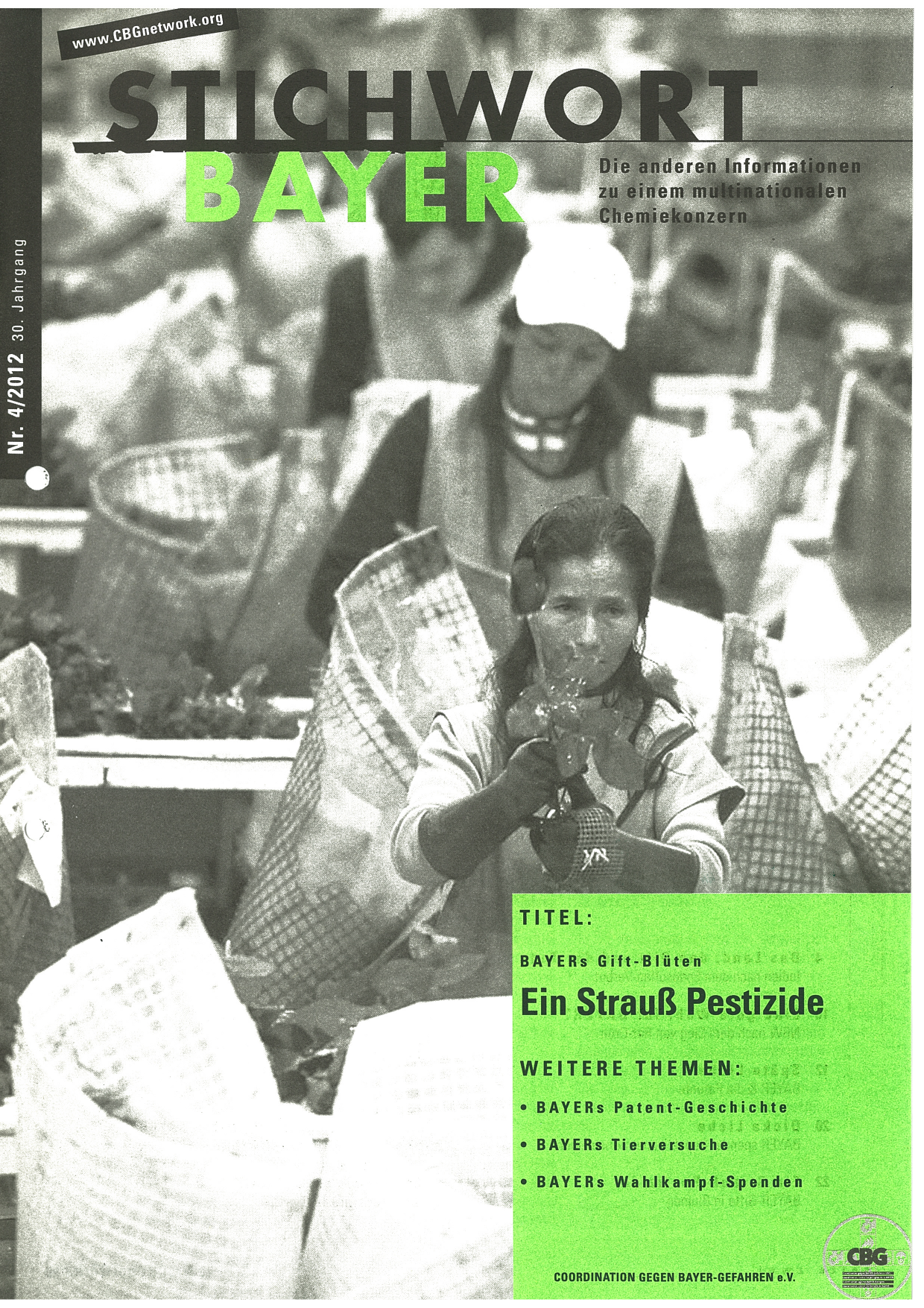AKTION & KRITIK
Marion Larat „Frau des Jahres“
Marion Larat ist in Frankreich wegen ihres Engagements gegen den Leverkusener Multi zur „Frau des Jahres“ gewählt worden. Larat hatte 2006 durch das BAYER-Verhütungsmittel MELIANE (Wirkstoffe: Gestoden und Ethinylestradiol) einen Gehirnschlag erlitten und entschloss sich 2012 als erste Frau in ihrem Land, eine Klage gegen den Pharma-Riesen anzustrengen. Das ermunterte viele Geschädigte, es ihr gleichzutun und löste eine Diskussion über die Gefährlichkeit der Pillen aus. Als Konsequenz daraus wies die Gesundheitsministerin Marisol Touraine die Krankenkassen an, die Kosten für MELIANE und andere Verhütungspillen der 3. und 4. Generation nicht mehr zu übernehmen.
CBG-Anfrage zu PCB
Polychlorierte Biphenyle (PCB) gehören zu den giftigsten Hervorbringungen der Chlorchemie (SWB 1/14). Die vor allem von BAYER und MONSANTO in Umlauf gebrachten gefährlichen „Alleskönner“ kamen bis zu ihrem vollständigen Verbot 1989 in Elektrogeräten, Fugendichtungsmassen, Farben, Lacken und Bodenbelägen zum Einsatz – und stellen immer noch ein beträchlichtes Risiko dar. Deshalb finden quer durch die Republik aufwendige Sanierungen von Universitäten und Schulen statt. Um einen detaillierten PCB-Schadensbericht zu erhalten, hat die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN gemeinsam mit der Partei „Die Linke“ eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Die Antworten fielen allerdings dürftig aus. So behauptet die Große Koalition etwa wider besseren Wissens: „In den letzten zehn Jahren sind keine PCB-Vergiftungsfälle und Todesfälle gemeldet worden.“ Eine genaue Kenntnis über den Umfang der PCB-Kontaminationen öffentlicher Gebäude habe sie auch nicht, weil die Verantwortung für die Einrichtungen teilweise in Länderhoheit läge. Und mit Absichten, ihren Informationsstand zu erhöhen, trägt sich die Regierungskoalition nicht. Eine Untersuchungspflicht sei nicht geplant, heißt es in der Bundestagsdrucksache 18/178. Da wundert es nicht weiter, dass SPD und CDU es ablehnen, BAYER & Co. an den Sanierungskosten zu beteiligen, wie es in der PCB-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft von 1976 einmal vorgesehen war, ehe jene dem Lobbyismus zum Opfer fiel. „Gemäß dem Verursacherprinzip sind die Kosten für die Beseitigung von PCB (...) zu tragen von den Besitzern (...) und/oder den früheren Besitzern oder dem Hersteller von PCB“, hieß es dort unmissverständlich.
USA: Kritik an GAUCHO & Co. wächst
Im Frühjahr 2013 hatte die von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) mitinitiierte Kampagne für das Verbot der bienengefährlichen BAYER-Pestizide GAUCHO und PONCHO endlich Erfolg: Die EU verkündete einen zunächst auf zwei Jahre befristeten Bann für die wichtigsten Anwendungsbereiche. Und jetzt wird die Luft für die beiden zur Gruppe der Neonicotinoide gehörenden Ackergifte auch in den USA dünner. Ende März 2014 fand ein zweitägiges Hearing des US-Kongresses zu GAUCHO & Co. statt, und begleitend dazu initiierte die Umweltgruppe FRIENDS OF THE EARTH eine Veranstaltung mit ImkerInnen und anderen KritikerInnen der Substanzen. BAYER sah sich deshalb zu einer PR-Offensive veranlasst. Der Leverkusener Multi zog durch mehrere Universitätsstädte und setzte sich als großer Bienen-Kümmerer in Szene, was AktivistInnen allerdings nicht unwidersprochen ließen.
Gentech-Kennzeichnung: Neuer Anlauf
In Kalifornien fand Ende 2012 ein BürgerInnen-Begehren zur Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln, die Gentech-Ausgangsstoffe enthalten, statt. Mit 46,9 zu 53,1 Prozent der Stimmen scheiterte es knapp, nicht zuletzt, weil die Konzerne 25 Millionen Dollar – BAYER-Anteil: zwei Millionen – in eine Gegen-Kampagne investierten. Jetzt gibt es jedoch einen neuen Anlauf. Die Demokratin Noreen Evans brachte eine abgespeckte Version der Vorlage in den kalifornischen Senat ein.
Kein „Public Eye Award“ für BAYER
Die Global Player halten jeweils zu Beginn des neuen Jahres in Davos ihr Klassentreffen ab. Die Schweizer Initiativen ERKLÄRUNG VON BERN und PRO NATURE nutzen die Gelegenheit stets, um als Spielverderber aufzutreten und dem Unternehmen mit den fragwürdigsten Geschäftspraktiken den „Public Eye Award“ zu verleihen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN nommierte den Leverkusener Multi wegen der Vermarktung bienenschädigender Pestizide. Der Konzern musste sich am Ende jedoch GAZPROM und GAP geschlagen geben und landete gemeinsam mit BASF und SYNGENTA nur auf dem zweiten Platz.
BAYERs Nutzen/Risiko-Rechnung
Bei der diesjährigen Bilanzpressekonferenz konnte BAYER mal wieder einen Rekord-Gewinn annoncieren (s. u.). Dennoch haderte der Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers mit der Welt. Seiner Meinung nach honoriert diese den Beitrag des Konzerns zur öffentlichen Gesundheit nicht in ausreichendem Maße. Das Molekül, die Erfindung, das Medikament werde zu wenig wertgeschätzt, lamentierte er laut Rheinischer Post und kritisierte zudem die seiner Meinung nach übertriebene Furcht der Gesellschaft vor Innovationen. In ihrem Kommentar machte die Zeitung dann richtigerweise auf den blinden Fleck in der Argumentation Dekkers’ aufmerksam. „Wenn er aber beklagt, dass bei den Menschen zu oft die Angst vor neuen Verfahren und Produkten im Vordergrund stehe und weniger der Nutzen, so muss auch gefragt werden, wie beides verteilt ist. Beispiel Kohlenmonoxid-Pipeline zwischen Uerdingen und Dormagen: Wer trägt den Nutzen, und wer trägt das Risiko“, fragte der Journalist Peter Kurz.
KAPITAL & ARBEIT
BAYER macht mehr Gewinn
Auf 40,15 Milliarden Euro erhöhte sich BAYERs Umsatz im Geschäftsjahr 2013 (2012: 39,7 Milliarden). Der Gewinn vor Steuern stieg von 3,9 auf 4,9 Milliarden Euro.
Vorstand
kostet 24,7 Millionen
Der Vorstand des Leverkusener Multis kann sich mal wieder über ein sattes Gehaltsplus freuen. Die Bezüge der vier Mitglieder stiegen im Geschäftsjahr 2013 von 12,9 auf 13,5 Millionen Euro. Allein BAYER-Chef Marijn Dekkers erhält davon 4,8 Millionen Euro. Dazu kommen noch Pensionszusagen, aktien-basierte Vergütungsanteile und andere Kleinigkeiten, weshalb das Quartett insgesamt mit 24,7 Millionen Euro zu Buche schlägt (2012: 20,9 Millionen)
Tarifverträge immer noch Mangelware
Weltweit hat der Leverkusener Multi nur mit knapp der Hälfte seiner Beschäftigten Tarifverträge abgeschlossen, und gegenüber 2012 haben sich die Zahlen kaum verändert. Nur in der Asien/Pazifik-Region ist mit 24 Prozent (2012: 15) ein Anstieg zu verzeichnen. In Europa bestehen solche Vereinbarungen mit 88 Prozent der Belegschaftsangehörigen (2012: 87), in Lateinamerika beträgt die Quote 45 Prozent (2012: 46) und Schlusslicht bleiben die Vereinigten Staaten mit nach wie vor fünf Prozent.
Tarifrunde 2014
In der Tarifrunde 2014 einigten sich der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) und die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE auf eine Entgelt-Erhöhung von 3,7 Prozent für die nächsten 14 Monate. Auf das Jahr gerechnet macht das jedoch bloß 3,16 Prozent aus. Zudem haben Unternehmen in wirtschaftlich schwieriger Lage die Möglichkeit, die Umsetzung des Tarifabschlusses um zwei Monate zu verzögern. Verlangt hatte die IG BCE 5,5 Prozent für 12 Monate. Auch mit einer anderen Forderung konnte die Gewerkschaft sich nicht durchsetzen. Sie wollte von BAYER & Co. nach dem Vorbild der Metall-Unternehmen die bindende Zusage, alle Auszubildenden zu übernehmen. Das lehnte die BAVC aber ab. BAYER & Co. erklärten sich lediglich zu einem größeren Ausbildungsplatz-Angebot bereit. Sie mochten nicht einmal zugestehen, den „Auserwählten“ wenigstens unbefristete Verträge anzubieten. Übrig blieb eine freiwillige Selbstverpflichtung, wonach eine „unbefristete Einstellung zum Normalfall“ werden soll.
BAYERs Zweiklassen-Gesellschaft
In BAYERs Belegschaft gibt es eine Zweiklassen-Gesellschaft, bestehend aus dem Dienstleistungs- und dem Produktionsbereich. Der Leverkusener Multi hat nämlich vor einigen Jahren die Öffnungsklauseln der Tarifvereinbarungen genutzt, um bei seinen Service-Gesellschaften aus den Flächentarifverträgen auszusteigen und eigene Haustarife abzuschließen. Bei BAYER TECHNOLOGY SERVICES (BTS) und bei BAYER BUSINESS SERVICES (BBS) führte der Konzern die 40-Stunden-Woche – ohne Lohnausgleich – wieder ein. Bei der BBS-Personaldienstleistungstochter BDS kürzte er derweil die Jahresprämie und legte sie auf die gesamten zwölf Monate um. Einige dieser Regelungen nahm der Pharma-Riese inzwischen wieder zurück. Die BTSlerInnen arbeiten jetzt wieder 37,5 Stunden und die BBSlerInnen auch, diese verdienen aber immer noch 3,3 Prozent weniger als ihre KollegInnen aus den Sparten Gesundheit, Kunststoffe oder Landwirtschaft. Darum fordern die KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN FÜR EINE DURCHSCHAUBARE BETRIEBSRATSARBEIT, eine alternative Gewerkschaftsgruppe im Leverkusener Werk: „Das Ziel muss sein, für die Beschäftigten aller BAYER-Gesellschaften wieder die Gültigkeit des Flächentarifvertrages wiederherzustellen.“
Burnout bei BAYER
3,6 Prozent aller Beschäftigten der bundesdeutschen BAYER-Niederlassungen leiden am Burnout-Syndrom, ebenso viele wie bei HENKEL und THYSSEN. Bei E.ON waren es sogar 5,1 Prozent. Das ergab eine 2012 veröffentlichte Schätzung der ASKLEPIOS-Kliniken auf Basis der stationär behandelten PatientInnen. Die Psychologin Rosemarie Bender nennt als Grund für die vielen psychisch Erkrankten bei den Unternehmen Arbeitdruck, ständige Erreichbarkeit und unklare Aufgabenverteilung. Thomas Kley von der Bochumer Ruhr-Universität macht dagegen vor allem die ständigen Umstrukturierungen für die hohen Fallzahlen verantwortlich.
LANXESS in Schwierigkeiten
Im Zuge der „Konzentration auf das Kerngeschäft“ hat BAYER viele Unternehmensteile abgestoßen. Eine aussichtsreiche Zukunft erwartete die Abteilungen nicht. Entweder gingen sie Pleite, schrumpften empfindlich oder wurden von anderen Konzernen geschluckt. Nur LANXESS schien ein besseres Schicksal zu ereilen. Obwohl nur mit BAYERs Reste-Rampe – dem Standardchemikalien-Geschäft – gestartet, begab sich die Firma auf Expansionskurs und schaffte sogar den Aufstieg in den DAX. Nun aber erfolgt doch der Absturz. Das Unternehmen weist für 2013 einen Verlust von 139 Millionen Euro aus, vernichtet 1.000 Arbeitsplätze und schasst den Vorstandsvorsitzenden Axel Heitmann. Wilkommen also im Club von DYSTAR, DYNEVO, TANATEX, KRONOS TITAN und AGFA!
BMS verkauft Harz-Produktion
BAYER MATERIAL SCIENCE stieß das Geschäft mit Polyester-Pulverharzen und flüssigen Polyester-Harzen ab und verkaufte es für 45 Millionen Dollar an das US-Unternehmen STEPAN.
Schließung von Nera Montoro?
BAYER MATERIAL SCIENCE stellt die Kunststoff-Herstellung im italienischen Nera Montoro und damit 60 Arbeitsplätze zur Disposition. Eine entsprechende Fertigungsstätte in Frankfurt produziere kostengünstiger, argumentiert der Konzern. Er hebt dabei besonders die mit 12 Cent im Vergleich zu 16 Cent pro Kilogramm Plaste günstigeren Energie-Preise hervor. Hierzulande beklagt der Global Player sich hingegen bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit über die angeblich zu hohe Stromrechnung.
Fixt Arbeit„geber“-Beträge
Die schwarze-gelbe Regierungskoalition hatte die Krankenkassen-Versicherungsbeiträge auf 8,2 Prozent für die Belegschaftsangehörigen und 7,3 Prozent für die Unternehmen erhöht. Die GroKo setzt den Ausstieg aus dem solidarisch finanzierten Gesundheitssystem jetzt fort. Sie schrieb den Arbeit„geber“-Anteil auf 7,3 Prozent fest, während der Beschäftigten-Anteil sich erhöhen darf. Und mit einem solchen Anstieg rechnen CDU und SPD auch: Intern haben sie schon einmal eine Schmerzgrenze festgelegt, bis zu der die Krankenkassen ungestraft gehen können.
ERSTE & DRITTE WELT
Dekkers sagt die Wahrheit
Das passiert auch nicht alle Tage: Manager-Mund tut Wahrheit kund! Das Kunststück gelang jetzt BAYER-Chef Marijn Dekkers. Er plauderte frank und frei aus, dass es dem Leverkusener Multi bei der Forschung nach Pharmazeutika nicht darum geht, die Menschheit von den Plagen schlimmer Krankheiten zu befreien, sondern schlicht darum, Geld zu machen. „Wir haben diese Arznei nicht für Inder entwickelt (...) Wir haben sie für westliche PatientInnen entwickelt, die sie sich auch leisten können“, sagte er über das Krebsmittel NEXAVAR, das gerade Gegenstand eines Rechtsstreits zwischen dem Pharma-Riesen und dem indischen Staat ist. BAYER ficht nämlich die Entscheidung der dortigen Patent-Behörde an, der Firma NATCO PHARMA erlaubt zu haben, eine preisgünstige Nachahmer-Version des patent-geschützten Pharmazeutikums herzustellen, weil sich PatientInnen in dem Land das 4.200 Euro pro Monat kostende Medikament sonst nicht leisten können.
USA kämpft um „NEXAVAR“-Patent
Die Entscheidung eines indischen Patentgerichtes, sich auf einen Paragrafen des Patentabkommen TRIPS zu berufen und der Firma NATCO PHARMA eine Zwangslizenz zur Produktion einer Generika-Version von BAYERs Krebsmittel NEXAVAR zu erteilen (s. o.), hat die US-amerikanische Regierung zu diversen Aktivitäten veranlasst. Bereits 2012 sicherte ein hochrangiges Mitglied der Obama-Administration dem Leverkusener Multi zu, in dieser Sache Druck auf die indische Regierung auszuüben. Im Kongress unterstützten auch die Republikaner diesen Kurs. Ihr Abgeordneter Bob Goodlatte drohte in der Debatte sogar damit, den Fall vor das Schiedsgericht der Welthandelsorganisation WTO zu bringen (Ticker 4/12). Mitte Dezember 2013 initiierte das US-Parlament unterdessen eine Anhörung zu der Frage. Neben einem Vertreter des Leverkusener Multis kamen dort allerdings auch KritikerInnen des Patent-Regimes das Wort. Und im März 2014 appellierten US-PolitikerInnen schließlich erneut an das Land, die Entscheidung rückgängig zu machen. Der indische Handelsminister Anand Sharma wies das Anliegen umgehend zurück. Was Indien getan habe, wäre eine Option, die allen Staaten offenstehe, so Sharma. Die Vereinigten Staaten akzeptieren diesen Standpunkt allerdings nicht und erwägen Sanktionen gegen den südasiatischen Staat.
KONZERN & VERGANGENHEIT
BAYER im Drogen-Museum
Ab 1898 vermarktete BAYER Heroin als Arznei. Der Leverkusener Multi bewarb die Droge als Therapeutikum für eine breite Palette von Krankheiten wie Husten, Multiple Sklerose, Asthma, Magenkrebs, Epilepsie und Schizophrenie. Sogar bei Darmkoliken von Säuglingen empfahl der Konzern das Produkt. Als KritikerInnen die Sicherheit des Stoffes in Frage stellten, forderte der damalige Generaldirektor Carl Duisberg, die Querulanten „mundtot zu schlagen“. Und obwohl schon bald kein Zweifel mehr am Suchtpotenzial bestand, führte das Unternehmen den gewinnbringenden Verkauf über Jahrzehnte hinweg fort. Darum fand der Dealer BAYER jetzt auch Eingang in das Drogen-Museum, das die auf Rauschgift-Kriminalität spezialisierte US-Strafverfolgungsbehörde DEA in Arlington eröffnete. Die BesucherInnen können dort etwa eine Werbe-Anzeige des Pharma-Riesen wie bestaunen, auf der eine treusorgende Mutter ihrer Tochter die Droge löffelweise als Medizin gegen Husten verabreicht.
POLITIK & EINFLUSS
Üppige Parteispenden des VCI
Der Leverkusener Multi spendet in der Bundesrepublik nicht selber an politische Parteien, weil das den Eindruck direkt gekaufter Entscheidungen erwecken könnte. Er überlässt den Job lieber dem „Verband der Chemischen Industrie“ (VCI). Die jüngst veröffentlichten Rechenschaftsberichte von CDU, SPD, FDP und Grünen weisen für das Jahr 2012 üppige Zuwendungen von Seiten des Lobby-Clubs aus. Die ChristdemokratInnen bekamen 44.000 Euro, die SozialdemokratInnen 34.000 und die FDP 24.500 Euro. Bündnis 90/Die Grünen – seit 2011 vom VCI mitbedacht – strichen 12.500 Euro ein. Nur „Die Linke“ erhielt kein Geld.
Akzeptanz-Beschaffer Garrelt Duin
Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) reist unermüdlich durch die Lande, um das dank ihrer umstrittenen Infrastruktur-Projekte und umweltgefährdenden Produktionsanlagen angeschlagene Image der Konzerne aufzuhübschen. Mitte Februar 2013 machte er am BAYER-Standort Dormagen Station. Im Kreiskulturzentrum hielt der Sozialdemokrat eine Rede zum Thema „Nachhaltigkeit und Akzeptanz von Industrie und Wirtschaft“.
GroKo will Akzeptanz schaffen
Die Große Koalition dient sich BAYER & Co. als PR-Agentur an. Da Deutschland „seine starke wirtschaftliche Rolle einer besonders leistungsfähigen Industrie“ verdanke, das „öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung“ der Konzerne aber abnehme, wie der Koalitionsvertrag konstatiert, planen SPD und CDU Gegenmaßnahmen. „Wir werden deshalb einen Dialog über die Rolle und das Selbstverständnis sowie die gesellschaftliche Akzeptanz einer zukunftsorientierten Industrie anstoßen“, drohen sie an.
BAYER & Co. gegen Hochschulreform
Im Jahr 2008 ging BAYER mit der Kölner Hochschule eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Pharma-Forschung ein. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) und andere Initiativen befürchteten eine Ausrichtung der Arznei-Forschung auf Konzern-Interessen. Deshalb forderten die Organisationen eine Offenlegung des Vertrages. Die Universität verweigerte das jedoch, weshalb die CBG die Hochschule im Mai 2011 verklagte. In ihrem neuen Hochschulzukunftsgesetz will die rot-grüne Landesregierung bei solchen Kooperationen jetzt für ein bisschen mehr Transparenz sorgen. „Das Präsidium informiert die Öffentlichkeit in geeigneter Weise über Forschungsvorhaben (...), insbesondere über deren Themen, den Umfang der Mittel Dritter sowie über die Person des jeweiligen Dritten“, heißt es im Paragraf 71 des ReferentInnen-Entwurfs. Und sofort brach ein Sturm der Entrüstung los. „Sollte der Entwurf Gesetz werden, wird das nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der nordrhein-westfälischen Hochschulen (...), sondern auch den Wirtschaftsstandort NRW erheblich schwächen“, warnt der BDI. Die nordrhein-westfälischen Hochschulratsvorsitzenden, unter ihnen der dieses Amt an der Universität Köln bekleidende, 2013 aus dem BAYER-Vorstand ausgeschiedene Richard Pott, pflichteten bei. „Die Regelungen des § 71a sind von tiefem Misstrauen gegen Drittmittel-Einwerbung geprägt“, konstatieren sie und halten fest: „Themenscharfe Veröffentlichung von Drittmittel-Einwerbungen und -aufträgen führt zu Nachteilen im akademischen Wettbewerb.“ Die Zusammenarbeit von Universität und Industrie, die ihrer Meinung nach ein wesentlicher Baustein für Innovation und wirtschaftlichen Erfolg ist, sehen die Räte durch das Gesetzesvorhaben „auf das Empfindlichste“ gestört. Den Studierenden der Kölner Hochschule, dessen Rektor Axel Freimuth zu den vehementesten KritikerInnen des Paragrafen-Werkes gehört, geht die Landesregierung indes nicht weit genug. „Eine Transparenz bei den Drittmitteln zu schaffen, ist eines der höchsten Anliegen, die derzeit in der Studierendenschaft vorliegen. Leider werden aber auch mit dieser Regelung allein die Verträge noch nicht veröffentlicht“, bedauert der ASTA. Der ARBEITSKREIS ZIVILKLAUSEL DER UNIVERSITÄT KÖLN moniert zudem, dass für die Landesregierung die Offenlegungspflicht dort an Grenzen stößt, wo die Konzerne Geschäftsgeheimnisse gelten machen, wie es BAYER derzeit im Rechtsstreit mit der CBG tut. Da sich dieser Passus nur im Kleingedruckten des ReferentInnen-Entwurfs fand, hat Wissenschaftsministerin Svenja Schulze ihn den Konzernen zuliebe noch einmal präzisiert. Demnach können Unternehmen und Universitäten die Auskunft verweigern, wenn „ein Betriebsgeheimnis offenbart wird und dadurch die Gefahr eines wirtschaftlichen Schadens entsteht“. Allerdings gilt das nicht, „wenn die Allgemeinheit ein überwiegendes Interesse an der Gewährung der Information hat, und der Schaden nur geringfügig wäre“. Zudem sicherte Schulze den Kooperationspartnern noch zu, Details zu ihrer Zusammenarbeit erst nach Abschluss des jeweiligen Projekts bekanntgeben zu müssen.
Umweltministerium zweifelt am TTIP
Bei den Verhandlungen zum Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit den USA diktieren BAYER & Co. den PolitikerInnen die Agenda. Allein von Anfang 2012 bis April 2013 fanden 130 Treffen der EU-Bevollmächtigten mit Konzern-VertreterInnen oder Unternehmensverbänden statt. Für Mensch, Tier und Umwelt bedeutet das nichts Gutes. Das Umweltministerium warnt bereits vor den Folgen des Vertragswerks. „Bei TTIP bestehen grundsätzliche Gefahren aus umweltpolitischer Sicht“. Die Ministerin Barbara Hendricks (SPD) und ihre MitarbeiterInnen fürchten eine Senkung von Umwelt- und VerbraucherInnenschutz-Standards und eine Abkehr vom Vorsorge-Prinzip. Als Beispiele nennt das interne Papier die Zulassung von Chemikalien, Pestiziden und gen-manipulierten Pflanzen.
Remmel will Kohleausstiegsgesetz
Die Kohle-Verstromung, die bei BAYER ein Drittel des Energiemixes ausmacht, ist maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich. Darum plant der nordrhein-westfälische Umweltminister Johannes Remmel von den Grünen ein Kohleausstiegsgesetz. „Der mittelfristige Ausstieg aus der klima-schädlichen Kohleverstromung ist somit ein zentraler Eckpfeiler einer Energie-Versorgung, die mit den im Klimaschutzgesetz verankerten CO2-Reduktionszielen im Einklang steht“, heißt es in dem Papier einer Arbeitsgruppe. Ob der Minister sich mit seinem Vorhaben durchsetzen kann, erscheint jedoch fraglich. Der Koalitionspartner SPD hat nämlich schon einmal Widerspruch angemeldet. So sagte Wirtschaftsminister Garrelt Duin: „Wenn man aus der Atomkraft 2022 aussteigt, kann man nicht 2040 aus der Kohle aussteigen, ohne massive Gefährdung der Versorgungssicherheit.“
BAYER-Aufsichtsrat leitet DGB
Der für die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE im BAYER-Aufsichtsrat sitzende Reiner Hoffmann wird neuer Vorsitzender des DEUTSCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES. Damit dürfte auch der Einfluss der traditionell konservativen und auf „Co-Management“ setzenden Einzelgewerkschaft innerhalb des DGB wachsen.
Gentechnik: Druck auf China
Ein Großteil der chinesischen Bevölkerung steht der Gentechnik skeptisch gegenüber. Deshalb hat die Regierung bisher den Anbau von Labor-Früchten nicht genehmigt. Und auch beim Import von Pflanzen mit verändertem Erbgut zeigt sich das Land zunehmend restriktiver. Seit im letzten Jahr an den Häfen eine Ladung Soja anlandete, das mit SYNGENTAs in dem Staat nicht zugelassenen Produkt AGRISURE VIPTERA kontaminiert war, ließen die Behörden ein Fünftel der Lieferungen wieder zurückgehen. Zudem nimmt sich das Reich der Mitte viel Zeit für Genehmigungsverfahren. BAYER & Co. kritisierten dieses Verhalten jetzt scharf. Chinas Umgang mit der Technologie sei „allzu politisch“, „intransparent“ und „unkalkulierbar“, monierte die Konzern-Vereinigung „American Chamber of Commerce“.
PROPAGANDA & MEDIEN
Kampagne gegen Patent-Gesetz
Mit Patenten auf Pharmazeutika sichern sich BAYER & Co. Monopol-Profite. Das macht die Arzneien besonders für Menschen in Armutsregionen unerschwinglich. Doch immer mehr Länder versuchen, ihrer Bevölkerung trotzdem den Zugang zu den benötigten Arzneien zu sichern. So hat etwa das „Indian Patent Office“ BAYERs Patent an dem Krebs-Medikament NEXAVAR aufgehoben und dem einheimischen Generika-Hersteller NATCO PHARMA eine Zwangslizenz zur Herstellung einer preisgünstigen Version erteilt (Ticker 2/12), wobei es sich auf einen Ausnahme-Paragraphen des internationalen Patentabkommens TRIPS berief. Und jetzt plant auch Südafrika, den Schutz des geistigen Eigentums patientInnen-gerechter zu gestalten. Das wollen die Pharma-Multis allerdings verhindern. Der US-amerikanische Pillenhersteller-Verband PhRMA engagierte für 450.000 Dollar eine PR-Agentur, um eine Kampagne gegen das Vorhaben zu starten. Wie aus einem internen Papier hervorgeht, besteht die Strategie von PUBLIC AFFAIRS ENGAGEMENT darin, negative wirtschaftliche Folgen der Reform auszumalen. „Stimmen innerhalb und außerhalb Südafrika mobilisieren, welche die Botschaft aussenden, dass die neue Patent-Politik Investitionen verhindert und so das ökonomische und soziale Wohlergehen bedroht“, schlägt das Dokument unter anderem vor. Es gibt auch detaillierte Empfehlungen zum Umgang mit den Argumenten von KritikerInnen, wie etwa die, vor allem keine Debatte über die Arznei-Preise aufkommen zu lassen. Der südafrikanische Gesundheitsminister, der Mediziner Aaron Motsoaledi, nannte das Konzept einen Plan „satanischen Ausmaßes“, das versuche, einen „Genozid“ vorzubereiten.
Kampagne gegen Vorsorge-Prinzip
„Wichtig ist vor allem, dass in der Gesellschaft ein Klima vorherrscht, Neuem aufgeschlossen gegenüberzustehen. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass die Menschen aus Angst vor Risiken die Chancen gar nicht erst wahrnehmen wollen“, diesen Sermon predigt BAYER-Chef Marijn Dekkers bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Im Oktober 2013 fand er sogar Partner dafür. Gemeinsam mit den Bossen von SYNGENTA, NOVARTIS, DOW CHEMICAL, HENKEL und anderen Unternehmen setzte er in der Sache einen Offenen Brief an die EU-Kommission auf. In dem Schreiben drückten Dekkers & Co. ihre tiefe Besorgnis über die Art und Weise aus, wie die Europäische Union mit dem Gefährdungspotenzial von Neuentwicklungen umgeht. „Innovationen sind per definitionem mit Risiken verbunden“, halten die Konzern-Lenker fest. Deshalb fordern sie Brüssel auf, bei Genehmigungsverfahren nicht mehr bloß das Vorsorge-Prinzip, sondern auch das „Innovationsprinzip“ zu berücksichtigen.
IVA übt sich in Pestizid-Panikmache
Im Jahr 2009 verabschiedete die Europäische Union eine Pestizid-Verordnung mit dem Ziel, bis 2011 besonders gefährliche Ackergifte aus dem Verkehr zu ziehen. Auf der Schwarzen Liste befanden sich mit Glufosinat, Carbendazim, Mancozeb, Tebuconazole, Bifenthrin und Thiacloprid unter anderem sechs Wirkstoffe, die auch in BAYER-Mitteln enthalten sind. Aber die EU hatte Erbarmen mit dem Leverkusener Multi und den anderen Agrar-Riesen. Sie verlängerte den Mitteln 2011 die Galgenfrist bis Ende 2017. Die Konzerne nutzten die Zeit jedoch nicht, um Alternativ-Produkte zu entwickeln. Stattdessen betreibt der „Industrieverband Agrar“ nun Panikmache. „Landwirten gehen bald die Mittel aus“, warnte er Mitte Januar 2014 in einer Presse-Mitteilung und konstatierte: „Das System steuert auf den Kollaps zu.“
TIERE & ARZNEIEN
PAN kritisiert Tierarznei-Rückstände
BAYER und andere Pharma-Konzerne liefern massenhaft Arzneien an die MassentierhalterInnen. Ein nicht geringer Teil dieser Mittel gelangt über die Ausscheidungen von Schwein & Co. in die Umwelt und belastet Böden und Gewässer. Das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK (PAN) sieht deshalb Handlungsbedarf. Es fordert, die Zulassungsverfahren für die Veterinär-Produkte um eine Umweltprüfung zu ergänzen und besonders schädliche Stoffe nicht länger zu genehmigen. Zudem verlangt PAN, die Verkaufs- und Rückstandsmengen systematisch zu erfassen – und nicht zuletzt, auf eine artgerechtere, weniger auf Pharmazeutika setzende Fleisch-Produktion umzusteigen.
DRUGS & PILLS
Noch mehr XARELTO-Tote
Die Zahl der durch BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO verursachten Todesfälle stieg im letzten Jahr von 58 auf 133. Das ergab eine Anfrage der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN beim „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM). Zudem gingen 2013 bei der Behörde 1.399 Meldungen über schwere Nebenwirkungen ein. Ein alarmierender Befund, denn längst nicht alle MedizinerInnen informieren die zuständigen Stellen über beobachtete Nebenwirkungen. Das Bundesinstitut sieht jedoch keinen Grund zur Besorgnis. Es erklärt die Entwicklung mit der Zunahme der Verschreibungen und bemerkt zu den 133 Toten: „Diese Zahl bedeutet aber nicht zwingend, dass eine oder mehrere der beschriebenen Nebenwirkungen unmittelbar ursächlich für den tödlichen Verlauf waren.“
Kein XARELTO für ACS
Der Leverkusener Multi scheiterte auch beim dritten Versuch, in den USA eine Zulassung für seinen Gerinnungshemmer XARELTO zur Behandlung der Herzkrankheit ACS zu erhalten. Die Gesundheitsbehörde hatte die Genehmigung immer wieder herausgezögert und dabei auf die Unterschlagung von drei Todesfällen, den Ausschluss unerwünschter ProbandInnen sowie fehlende Informationen über den Gesundheitszustand der TeilnehmerInnen nach Ende der klinischen Prüfungen verwiesen. Sie forderte stattdessen neues Zahlen-Material an. Dieses lieferten der Pharma-Riese und sein US-amerikanischer Partner JOHNSON & JOHNSON dann zwar auch, aber nach Ansicht der FDA-ExpertInnen reichten die Unterlagen nicht aus, um die Bedenken hinsichtlich lebensgefährlicher Blutungen zu zerstreuen. „Die Therapie hat Vor- und Nachteile, und in diesem Kontext kommt der Qualität der Daten eine besondere Bedeutung zu“, so begründete das Gremiumsmitglied Steven Nissen im Januar 2014 die Entscheidung, keine Genehmigungsempfehlung auszusprechen. Und die Behörde richtete sich danach: Vier Wochen später sagte sie endgültig „Nein“.
Asthma durch ASPIRIN
ASPIRIN und andere Schmerzmittel können bei PatientInnen, die an Nasen-Erkrankungen wie Polypen oder angeschwollenen Schleimhäuten leiden, Asthma-Anfälle und andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen. MedizinerInnen sprechen dabei vom Analgetika-Asthma-Syndrom oder auch einfach nur von Schmerzmittel-Asthma.
Schlank durch ASPIRIN?
Nach einer Studie des Mediziners Simon Hawley von der schottischen „University of Dundee“ kann ASPIRIN die Fettverbrennung forcieren und so das Abnehmen befördern. Allerdings sind dazu hohe Dosen nötig, was wegen der ASPIRIN-Nebenwirkung „Blutungen“ große Risiken birgt.
Comeback für DIANE
In Deutschland und Frankreich hat BAYERs Hormon-Präparat DIANE 35 nur eine Zulassung als Arznei zur Behandlung von Haut-Krankheiten. Im Nachbarland haben jedoch mehr als 300.000 Frauen die Pille mit den Wirkstoffen Ethinylestradiol und Cyproteronacetat auch zur Verhütung eingenommen – was dem Leverkusener Multi nur schwerlich entgangen sein dürfte. Vier der Nutzerinnen bezahlten das mit ihrem Leben: Das Mittel hatte todbringende Thrombosen ausgelöst. Nach Bekanntwerden der Fälle zog die staatliche Arznei-Aufsicht ANSM das Pharmazeutikum aus dem Verkehr und forderte die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA auf, die Sicherheit von DIANE zu überprüfen. Obwohl die Einrichtung dem Produkt ein positives Nutzen/Risiko-Profil bescheinigte, wollte die ANSM es nicht wieder freigeben. Mitte Januar 2014 kam es aber doch zu einer Einigung mit dem Leverkusener Multi, weshalb dieser die Pille im Nachbarland nun wieder auf den Markt bringen darf.
FDA gibt ESSURE-Entwarnung
2013 hat BAYER das US-amerikanische Pharma-Unternehmen CONCEPTUS erworben und mit ihm das Medizin-Produkt ESSURE. Dabei handelt es sich um ein ohne Hormone auskommendes Mittel zur Sterilisation, dessen Entwicklung die „Bill & Melinda Gates Stiftung“ in der Erwartung gefördert hat, es in seinen Familienplanungsprogrammen für „Entwicklungsländer“ einsetzen zu können. Implantieren MedizinerInnen der Frau die kleine Spirale, wofür keine Vollnarkose nötig ist, so sorgen Kunststoff-Fasern für ein so großes Wachstum des Bindegewebes, dass es die Eileiter verschließt. Allerdings gehen von dem Präparat beträchtliche Gesundheitsgefahren aus. Im Oktober 2013 erhielt die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA sogar einen Bericht über einen mutmaßlich von ESSURE ausgelösten Todesfall. Insgesamt gingen bei der Einrichtung bis Oktober 2013 943 Meldungen über schwere Nebenwirkungen ein. Blutungen, Hautausschläge, Kopfschmerzen, Übelkeit und Allergien gehörten dazu, manche Frauen mussten sich sogar die Gebärmutter entfernen lassen. Wegen dieser Risiken und Nebenwirkungen haben sich in den Vereinigten Staaten schon Selbsthilfegruppen gegründet. Zudem hat die Aktivistin Erin Brockovich, die durch einen Hollywood-Film über ihr Umwelt-Engagement zu großer Popularität gelangte, eine Kampagne initiiert. Dieser öffentliche Druck hat die FDA jetzt zu einer Überprüfung des Gefährdungspotenzials von ESSURE veranlasst. Die Gesundheitsbehörde sieht allerdings keinen Anlass zur Beunruhigung. Sie wertete die noch von CONCEPTUS durchgeführte Post-Zulassungsuntersuchung aus und kam zu dem Ergebnis: „Die Studie weist nicht auf neue Sicherheitsprobleme oder eine Häufung der schon bekannten Probleme hin.“ Der Leverkusener Multi kann die Spirale also unbeschwert weiter vermarkten und sich über die Gewinne freuen. Allein im Zeitraum von Juni bis Ende Dezember 2013 setzte er damit 74 Millionen Euro um.
BAYER verkauft KYTHERA
Der Leverkusener Multi hatte gemeinsam mit dem Unternehmen KYTHERA eine Substanz entwickelt, die – unter die Haut gespritzt – kleinere Fettpolster am Kinn auflösen soll. Der Zulassungsantrag für das Lifestyle-Präparat mit der vorläufigen Bezeichnung ATX-101 liegt der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA schon vor. Im März 2014 gab BAYER die Vertriebsrechte jedoch an KYTHERA zurück. Er erhielt dafür Firmen-Anteile im Wert von 33 Millionen Dollar sowie einen Schuldschein in Höhe von 51 Millionen Dollar. Zudem hat sich der Pharma-Riese eine Beteiligung an dem zu erwartenden Umsatz zusichern lassen. „Unsere Beteiligung an KYTERA zeigt, dass wir weiterhin an das Potenzial von ATX-101 glauben“, betont Konzern-Managerin Erica Mann. Andere warnen indessen vor dem Medikament. Der Pharmazeut Gerd Glaeske etwa befürchtet, die zerstörten Fettzellen könnten im Körper umherwandern, zusammenklumpen und Gefäß-Verschlüsse oder Schlaganfälle verursachen. Zudem prophezeit er Hautschäden an den behandelten Stellen.
BAYER kauft ALGETA
Der Leverkusener Multi hat für 2,1 Milliarden Euro das Unternehmen ALGETA erworben. Damit besitzt der Pharma-Riese nunmehr die alleinigen Rechte an dem von ALGETA entwickelten Strahlentherapie-Medikament XOFIGO, die er sich zuvor im Rahmen eines Kooperationsvertrages noch mit dem norwegischen Konzern teilen musste. Die in den USA und Europa bereits zugelassene Arznei kommt bei der Prostatakrebs-Art CRPC zum Einsatz, wenn eine Hormon-Behandlung erfolglos geblieben ist und sich zudem noch Metastasen im Knochen gebildet haben. Dann soll eine radioaktive Bestrahlung mit dem Wirkstoff Radium-223-Dichlorid das Wachstum der Tumor-Zellen hemmen. Bei den Klinischen Tests verhalf das den PatientInnen jedoch nur zu einem noch nicht einmal drei Monate längeren Leben. BAYER-Chef Marijn Dekkers setzt trotzdem große Hoffnungen in das Strahlentherapeutikum: „Wir sind absolut überzeugt vom Potenzial dieses Medikamentes.“ Der Holländer sieht durch den Zukauf die Onkologie-Sparte gestärkt, die zu den gewinnträchtigsten im Pillen-Bereich zählt. Auf dem globalen Pharma-Markt sorgten Krebsmedikamente 2012 mit 61,6 Milliarden Dollar für den höchsten Umsatz.
BAYER kauft DIHON
Der Leverkusener Multi hat das chinesische Unternehmen DIHON erworben, das freiverkäufliche Medizinprodukte herstellt, darunter Mittel gegen Hautkrankheiten und Arzneien auf pflanzlicher Basis. Die Gesellschaft erwirtschaftete 2012 mit 2.400 Beschäftigten einen Umsatz von 123 Millionen Euro und hat unter anderem in Tansania, Nigeria, Vietnam, Myanmar und Kambodscha Niederlassungen. Zu den bekanntesten DIHON-Produkten zählen SKINEAL zur Behandlung von Pilz-Infektionen der Haut und HAICUEAL, das bei Schuppen und anderen Kopfhaut-Problemen Verwendung findet. Der Pharma-Riese will mit der Akquisition jedoch nicht nur sein Angebot mit nicht rezeptpflichtigen Produkten erweitern. „Gleichermaßen wichtig ist für uns hierbei der Einstieg in das Gebiet der traditionellen chinesischen Medizin“, betont der „BAYER HEALTH CARE“-Vorsitzende Dr. Olivier Brandicourt. Dieses Gebiet hat nämlich bei den freiverkäuflichen Pharmazeutika einen Marktanteil von 50 Prozent, und dafür weicht der Global Player auch gerne mal vom schulmedizinischen Pfad ab. Aus ähnlichem Kalkül hat er vor kurzem das Naturheilmittel-Unternehmen STEIGERWALD erstanden. Und jetzt hofft Brandicourt auf Synergie-Effekte: „Wir gehen davon aus, dass sich durch eine Kombination des kürzlich von STEIGERWALD erworbenen Geschäfts mit der Expertise und dem pflanzlichen (...) Portfolio von DIHON ein zusätzlicher Nutzen für beide Bereiche erzielen lässt.“
Kooperation mit dem „Broad Institute“
BAYER hat mit dem in Cambridge ansässigen „Broad Institute“ eine Zusammenarbeit vereinbart. Die beiden Partner wollen gemeinsam Krebs-Medikamente entwickeln, die gezielt auf die Erbanlagen von Tumorzellen einwirken.
Kooperation mit INCEPTION
Augen-Arzneien gehören zum Kerngeschäft von BAYERs Pharma-Sparte. So machte er mit dem Gentech-Präparat EYLEA zur Behandlung der feuchten Makula-Degeneration – einer Augenerkrankung, die zur Blindheit führen kann – 2013 einen Umsatz in Höhe von 473 Millionen Euro. Darum will der Leverkusener Multi nun weitere Medikamente für dieses Therapiefeld auf den Markt bringen. Allerdings sourct er die Entwicklung aus: Er beauftragte das Unternehmen INCEPTION SCIENCES mit den entsprechenden Arbeiten.
Weniger Rabatt und Nutzenbewertung
Im Jahr 2011 hatte die damalige Bundesregierung eine Kosten/Nutzen-Bewertung von neuen Medikamenten und ein Preis-Moratorium eingeführt. So wollte sie die Pillen-Ausgaben auf ein vernünftiges Maß zurückführen. Bis die Regelung Ergebnisse zeitigt, sollten BAYER & Co. – befristet bis Anfang 2014 – auf Arznei-Innovationen nicht mehr wie bisher sechs, sondern 16 Prozent Rabatt gewähren. Doch das Instrument des Pharmazeutika-TÜVs verfehlte das Einspar-Ziel von mehr als einer Milliarde Euro mit bisher 120 Millionen deutlich. Darum will die Große Koalition den Rabatt nun auf sieben Prozent festlegen und sich weitere Erhöhungen vorbehalten. Der von BAYER gegründete „Verband der forschenden Arzneimittel-Hersteller“ (VFA) rechnet 2014 wegen des Auslaufens der 16-Prozent-Zwischenlösung mit einem Geldsegen für die Branche. Eine Gewinn-Steigerung von 4,7 Prozent auf 40 Milliarden Euro prophezeit er, während die Krankenkassen Mehraufwendungen in Höhe von zwei Milliarden Euro erwarten. Trotzdem verzichten SPD und CDU auch noch darauf, die Kosten/Nutzen-Bewertung auf die alten Pillen auszuweiten und gaben damit einer Forderung des Leverkusener Multis und anderer Pharma-Riesen nach. Die „Arzneimittel-Kommission der deutschen Ärzteschaft“ (AkdÄ) kritisierte das scharf. „Die Nutzenbewertung für bereits auf dem Markt befindliche Arzneimittel ist für eine qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Arzneimittel-Versorgung unentbehrlich“, so der Vorsitzende Wolf-Dieter Ludwig.
Verschärfte Kosten/Nutzen-Bewertung?
Die Kosten/Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln hat bisher nicht die gewünschten Einsparungen erbracht (s. o.) Darum plant die Große Koalition Änderungen. Künftig soll die Schiedsstelle auch festlegen, was ein Medikament höchstens kosten darf, und nicht mehr wie bisher nur die Höhe des Abschlags. Die alte Regelung hatte für BAYER & Co. den Vorteil, den Listenpreis einer Arznei nicht zu tangieren, der beispielsweise bestimmt, wieviel der Leverkusener Multi im Ausland für seine Pharmazeutika verlangen kann. Darum reagierten die Pharma-Riesen scharf. Der von BAYER gegründete „Verband der forschenden Arzneimittel-Hersteller“ (VFA) nannte das Vorhaben einen Eingriff von „fundamentaler ordnungspolitischer Bedeutung“.
FDA in der Kritik
ForscherInnen der „Yale University“ haben die Arzneimittel-Zulassungspraxis der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA untersucht und dabei gravierende Mängel festgestellt. Obwohl die Einrichtung laut Statut eigentlich zwei Studien zur Bedingung einer Genehmigung macht, gibt sie sich in einem Drittel der Fälle mit nur einer Untersuchung zufrieden, monierten die WissenschaftlerInnen. Zudem kritisierten die MedizinerInnen, dass die Tests, selbst wenn es sich um Medikamente für chronisch Kranke handelte, zum überwiegenden Teil nur ein halbes Jahr dauerten und sich die Hälfte der Erprobungen gar nicht dem Krankheitssymptom selbst, sondern einer abgeleiteten Größe wie etwa dem Blutwert widmeten.
PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE
Schärfere GAUCHO-Grenzwerte
Das BAYER-Pestizid GAUCHO steht seit Jahren wegen seiner bienenschädigenden Wirkung in der Kritik. Im Frühjahr 2013 entschloss sich die EU deshalb endlich, die Ausbringung auf solchen Pflanzen, deren Pollen Bienen zur Nahrung dienen, für zunächst zwei Jahre zu verbieten. Das zur Gruppe der Neonicotinoide gehörende Ackergift mit dem Wirkstoff Imidacloprid birgt jedoch noch andere Gefahren. So kann es einer neuen japanischen Studie zufolge durch seine nikotin-ähnliche Wirkung die Entwicklung des Embryos im Mutterleib stören und Schädigungen an seinem Nervensystem hervorrufen. Die „Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit“ (EFSA) reagierte für ihre Verhältnisse ungewöhnlich schnell und riet zu schärferen Grenzwerten für imidacloprid- und acetamiprid-haltige Produkte. BAYER zeigte sich verschnupft: „Wir sind überrascht, dass die EFSA hauptsächlich auf der Basis von simplen Zellkultur-Experimenten empfahl, eine Veränderung der Imidacloprid-Zulassung vorzunehmen.“
PFLANZEN & SAATEN
Saatgut-Markt: BAYER Nr. 9
Die zehn größten Saatgut-Unternehmen der Welt beherrschen nach der von den Grünen im Europa-Parlament in Auftrag gegebenen Studie „Concentration of Market Power in the EU Seed Market“ mehr als die Hälfte des globalen Geschäfts. Sie kommen insgesamt auf einen Marktanteil von 62 Prozent. BAYER belegt in dieser Rangliste mit einem Wert von 2,2 Prozent den neunten Platz. Auf EU-Ebene hat der Leverkusener Multi vor allem im Tomaten-Bereich eine starke Stellung. Gemeinsam mit MONSANTO, SYNGENTA, LIMAGRAIN und RIJKZWAAN kontrolliert der Konzern 45 Prozent des Handels mit der Gemüse-Art.
Keine neue Saatgut-Verordnung
Anfang Mai 2013 hatte die EU-Kommission einen Entwurf für eine neue Saatgut-Verordnung präsentiert. Dieser stärkt die Position von Industrie-Saatgut. So gestattet die Vorlage BAYER & Co., die Qualitätskontrolle für ihre Produkte selber zu übernehmen. Zudem macht sie es alten und lokalen Sorten schwerer, einen Marktzugang zu erhalten, was die Artenvielfalt bedroht. Aber gegen diese Pläne formierte sich Widerstand, der Erfolg zeigte. Im März 2014 lehnte das EU-Parlament das Vorhaben ab und brachte es damit zum Scheitern.
GENE & KLONE
1507-Mais vor der Zulassung
In der EU steht der Genmais 1507 vor der Zulassung. Nachdem sich bei einer Sitzung der EU-UmweltministerInnen – auch wegen der Enthaltung der Bundesregierung – keine ausreichende Mehrheit für eine Ablehnung gefunden hatte, entschloss sich EU-Kommission, die Laborfrucht von PIONEER und DOW AGROSCIENCES für den Anbau zuzulassen. Diese enthält den „Bacillus thuringiensis“ (Bt) in einer Gift-Konzentration, welche diejenige von MONSANTOs 810-Mais um das 350fache übersteigt. Zudem verfügt die Pflanze über eine Resistenz gegen die BAYER-Agrochemikalie Glufosinat, deren Tage in Europa allerdings gezählt sind. Nicht nur deshalb reagierte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN mit Unverständnis auf das Votum der Europäischen Union. „Es ist vollkommen unverständlich, warum die EU eine Genpflanze mit einer eingebauten Resistenz gegen ein Pestizid zulassen will, das wegen seiner Gefährlichkeit bereits in drei Jahren vom Markt verschwinden soll.“ Zu den zahlreichen KritikerInnen der Entscheidung zählte auch das „Bundesamt für Naturschutz“. „Mit dem aktuellen Vorschlag der Kommission vom 6. November 2013 würde 1507-Mais ohne ausreichende Risiko-Prüfung sowie ohne ausreichendes Risiko-Management und Monitoring zugelassen“, hält die Behörde fest. Wie wichtig ein solcher Sicherheitscheck gewesen wäre, zeigt sich unter anderem daran, dass die Sorte sich klammheimlich schon auf hiesige Äcker geschlichen hat: Das niedersächsische Landesumweltamt hat 2013 in konventionellen Mais-Kulturen 1507-Spuren gefunden. Auch von Erfahrungen aus der Praxis hat sich die EU bei ihrer Entscheidung nicht groß irritieren lassen, sonst hätte sie das Gewächs wohl kaum genehmigt. In Brasilien etwa haben sich die Schadinsekten nämlich bereits an das Gen-Konstrukt gewöhnt, weshalb die LandwirtInnen trotz Erhöhung der Chemie-Dosis mit Ernte-Ausfällen kämpfen. Ob der Mais wirklich die bundesdeutschen Felder heimsuchen wird, steht allerdings noch in Frage: Gegenwärtig berät die Europäische Union über eine Richtlinie, die es den Mitgliedsländern gestattet, selbstständig über den Anbau von 1507 & Co. zu entscheiden.
Gentests in Indien
In Indien hat sich die gen-manipulierte Baumwolle durchgesetzt. Auf dreiviertel aller Felder wachsen meist von MONSANTO produzierte Laborfrüchte. Aber auch BAYER drängt in den Markt. So führt der Leverkusener Multi in dem südasiatischen Staat derzeit zwei Freisetzungsversuche durch. Er testet dort die glyphosat-resistente und zusätzlich noch mit dem für Insekten tödlichen Bacillus thuringiensis (Bt) bestückte Sorte GHB119 und das glufosinat-resistente und Bt-bewehrte Produkt T304-40.
Vermarktung von Gentech-Raps
BAYER hat 2013 mit der Vermarktung des Gentech-Raps’ „IH 50 RR“ in Australien begonnen. Die Laborfrucht auf Basis der von MONSANTO entwickelten „ROUNDUP READY“-Technologie ist mit einer Resistenz gegen das Herbizid Glyphosat ausgestattet.
EYLEA: kein Zusatznutzen
BAYERs zur Therapie der feuchten Makula-Degeneration – einer Augenerkrankung, die zur Blindheit führen kann – zugelassene Augen-Arznei EYLEA (Ticker 2/12) erschließt nicht gerade medizinisches Neuland. In den klinischen Prüfungen gelang es dem Gentech-Medikament nicht, das NOVARTIS-Präparat LUCENTIS zu übertrumpfen, was der Leverkusener Multi auch selbst einräumen musste. Laut Konzern zeigte das Pharmazeutikum in Tests lediglich „eine vergleichbare Wirkung (‚Nicht-Unterlegenheit’) gegenüber der Behandlung mit LUCENTIS“. Das „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWIG) erkannte im Januar 2014 ebenfalls keinen Zusatznutzen. Deshalb ist der Pharma-Riese jetzt gezwungen, sich bei der Preisgestaltung an den altbewährten Mitteln zu orientieren.
EYLEA-Forschungskooperationen
473 Millionen Euro Umsatz hat BAYER im Geschäftsjahr 2013 mit seinem Augen-Präparat EYLEA gemacht. Darum setzt der Leverkusener Multi trotz nicht gerade berauschender Heilungserfolge (s. o.) des gentechnisch hergestellten Medikaments weiter auf dieses Therapiefeld. So vereinbarte er nicht nur mit INCEPTION SCIENCES (siehe DRUGS & PILLS), sondern auch mit REGENERON eine Kooperation. Das US-Unternehmen entwickelt für den Pharma-Riesen einen Antikörper, der in Kombination mit EYLEA zum Einsatz kommen soll.
WASSER, BODEN & LUFT
CO2-Emissionen steigen
Im Geschäftsjahr 2013 sind bei BAYER die klima-schädigenden Kohlendioxid-Emissionen abermals gestiegen. Sie erhöhten sich von 8,36 auf 8,37 Millionen Tonnen.
Weniger ODS- und VOC-Ausstoß
Nicht nur Kohlendioxid wirkt klima-schädigend. Das tun auch andere, unter dem Begriff „Ozone Depleting Substances“ (ODS) subsummierte Stoffe. Deren Ausstoß verringerte sich bei BAYER im Geschäftsjahr 2013 ebenso wie derjenige der flüchtigen organischen Substanzen (VOC), weil sich auf der Dauerbaustelle am indischen Standort Vapi, der für ein Gutteil dieser Emissionen sorgt, endlich etwas zu tun scheint. Die Werte reduzierten sich von 16,3 auf 15,7 bzw. von 2,60 auf 2,27 Tonnen.
Etwas weniger Luftverschmutzung
Im Geschäftsjahr 2013 bliesen die BAYER-Schlote mit 900 Tonnen 100 Tonnen Kohlenmonoxid weniger in die Luft als 2012. Der Schwefeloxid-Ausstoß verringerte sich von 3.100 auf 2.500 Tonnen, und der Stickstoff-Ausstoß ging von 1.900 auf 1.300 Tonnen zurück. Die Feinstaub-Emissionen verharrten dagegen bei 200 Tonnen.
Konstant hohe Wasser-Belastung
BAYERs Einleitungen von Schadstoffen in Gewässer verharrten 2012 auf konstant hohem Niveau. Die Emissionen von organisch gebundenem Kohlenstoff legten von 1.420 auf 1.530 Tonnen zu, diejenigen von Stickstoff bewegten sich weiter um die 700 Tonnen. Die Schwermetall- und Phosphor-Frachten reduzierten sich dagegen etwas, sie senkten sich von 9,8 auf 9,1 Tonnen bzw. von 150 auf 110 Tonnen ab. Auch mussten die Flüsse nicht mehr ganz so viel anorganische Salze aufnehmen. Das Volumen schrumpfte von 1.048.000 auf 946.000 Tonnen.
Wasser-Schadstoff PCB
2008 hat die EU eine Schwarze Liste mit 33 Stoffen veröffentlicht, die eine besonders große Belastung für die Gewässer darstellen und die Mitgliedsstaaten aufgefordert, bis zum Jahr 2021 Vorschläge zur Reduzierung der Einträge vorzulegen. Im letzten Jahr ergänzte Brüssel die Aufstellung um elf Substanzen. Unter ihnen befinden sich auch die vom Leverkusener Multi bis zu ihrem endgültigen Verbot 1989 massenhaft hergestellten Polychlorierten Biphenyle (siehe AKTION & KRITIK). Das PCB befindet sich damit in der schlechten Gesellschaft der anderen von der Europäischen Union inkriminierten Wasserverschmutzer made by BAYER wie Chlorpyrifos, Dichlormethan, Diuron, Endosulfan, Fluoranthen, Hexachlorcyclohexan, Blei, Quecksilber, Nickel, Nonylphenol, Trichlormethan und Trifluralin.
Sanierungsmaßnahmen in Hagerstown
Bis Mitte der 1980er Jahre haben BAYER und andere Chemie-Multis ihre Pestizid-Wirkstoffe im US-amerikanischen Hagerstown zu fertigen Produkten weiterverarbeiten lassen. Die Veredelungsprozesse führten zu massiven Verunreinigungen des Bodens, des Grundwassers und der nahe gelegenen Oberflächen-Gewässer. Die US-amerikanische Umweltbehörde EPA fand unter anderem Spuren der Ackergifte DDT, Lindan, Dieldrin und Aldrin sowie Blei und Arsen. Auf ca. 250.000 Dollar schätzt sie die Aufwändungen für die Sanierung der Schäden. An diesen Kosten müssen sich außer dem Leverkusener Multi noch 15 weitere Firmen beteiligen.
Brückenbau auf Deponie-Gelände
Die Deponie Dhünnaue diente BAYER von 1923 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs als Giftmüll-Schlucker. Danach ließ der Leverkusener Multi nicht nur Gras über die Sache wachsen, sondern auch 220 Wohneinheiten sowie eine Schule, einen Kindergarten und ein Altersheim. Die Folge: Allein in der Hauptschule am Rand des Geländes traten 15 Krebserkrankungen und fünf Todesfälle auf. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen begannen erst in den 1990er Jahren. Der Konzern trug das verseuchte Erdreich jedoch keineswegs ab und umschloss es auch nicht vollständig. Lediglich zum Rhein hin sicherte er die Altlast mit Spundwänden ab. Deshalb ist es erforderlich, stündlich 750 Kubikmeter verseuchtes Wasser abzupumpen und zu reinigen – über Jahrhunderte hinweg. Und deshalb müssen jetzt auch die Sondierungsarbeiten zum Bau einer Autobahn-Brücke auf dem Areal äußerst vorsichtig verlaufen. Jedes Bohrloch birgt bis zu zwei Tonnen Sondermüll, was die Beschäftigten dazu nötigt, einen Ganzkörperschutz zu tragen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) fordert eine vollständige Sicherung des Geländes auf Kosten des Global Players, die Übernahme aller Folgekosten sowie einen Gedenkstein für die Opfer. „Die entstehenden Mehrkosten beim Bau der Autobahn müssen von BAYER getragen werden. Umwelt und Anlieger haben jahrzehntelang unter der Gift-Belastung gelitten. Der Öffentlichkeit dürfen nicht noch weitere Folgekosten entstehen“, so Philipp Mimkes vom Vorstand der CBG.
Gas-Kraftwerk in Leverkusen
Wie in Krefeld plante BAYER auch in Leverkusen ursprünglich ein Kohlekraftwerk. Und wie in Krefeld entschied sich der Chemie-Multi nach massivem Protest gegen den Bau der klima-schädigenden Dreckschleuder und stattdessen für ein Gas- und Dampfkraftwerk. Während er die Entscheidung in Krefeld 2013 aber erst einmal widerrief und sich zwei Jahre Bedenkzeit einräumte, gibt es am Stammsitz nach ebenfalls langem Hin und Her nun eine Vorentscheidung. Der Betreiber REPOWER hat im März 2014 einen Vorvertrag für die Anlage geschlossen, die den Chemie-„Park“ mit 570 Megawatt Strom pro Stunde versorgen soll.
GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV
Schärferer Bisphenol-Grenzwert?
BAYER ist mit einer Jahresproduktion von ca. einer Million Tonnen einer der größten Produzenten der Industrie-Chemikalie Bisphenol A. Drei Prozent davon finden in Lebensmittel-Verpackungen wie etwa Konservendosen Verwendung. Die Substanz ähnelt in ihrem chemischen Aufbau Hormonen, was Auswirkungen auf den menschlichen Stoffwechsel hat und zu Schädigungen des Nervensystems, Übergewicht, Unfruchtbarkeit, Diabetes sowie Herz- und Lebererkrankungen führen kann. Deshalb steht der Stoff seit Jahren in der Kritik. Die EU, die im März 2011 bereits seine Verwendung in Babyflaschen untersagt hatte (Ticker 1/12), plant jetzt eine Verschärfung des Grenzwertes. Sie will eine Belastung nur noch bis zu fünf Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht tolerieren (bisher 50 Mikrogramm). Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) begrüßt dieses Vorhaben, fordert jedoch weitere Maßnahmen. „Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung. Nun muss ein Bisphenol A-Verbot in Trinkflaschen, Spielzeug und Lebensmittel-Verpackungen folgen. Hormonaktive Substanzen haben in Produkten des täglichen Bedarfs absolut nichts verloren! Die Leugnung der Risiken durch BAYER, DOW und Co. darf nicht weiter zur Gefährdung der Verbraucher führen“, heißt es in der CBG-Presseerklärung.
Greift Bisphenol A die Zähne an?
Trotz guter Zahnpflege breitet sich unter Kindern eine neue Krankheit aus. Ihre Zähne haben wegen einer unzureichenden Mineralisation nicht genügend Festigkeit und zersetzen sich langsam. „Molar-Incisor-Hypomineralisation“ (MIH) nennen MedizinerInnen diese Gesundheitsstörung, von der ca. 10 Prozent der SchülerInnen betroffen sind. Als Auslöser von MIH haben WissenschaftlerInnen die von BAYER in rauen Mengen hergestellte Industrie-Chemikalie Bisphenol A (s. o.) in Verdacht, die etwa bei der Produktion von Plastik-Flaschen und anderen Lebensmittel-Verpackungen zum Einsatz kommt. In Tierversuchen störte sie nämlich die Mineralisation der Zähne von Ratten. Der Mediziner Dr. Norbert Krämer von der Gießener Poliklinik für Kinder-Zahnheilkunde rät deshalb zur Vorsicht: „Das Trinken aus der Plastikflasche würde ich abstellen.“ Auch empfiehlt er, auf Lebensmittel zu verzichten, deren Hüllen Bisphenol-Anteile aufweisen.
CO & CO.
Marode Alt-Pipeline
Nicht nur die zwischen den BAYER-Werken Dormagen und Krefeld verlegte Kohlenmonoxid-Pipeline wirft Sicherheitsfragen auf. Auch die in den 1960er Jahren zwischen Dormagen und Leverkusen gebaute Leitung, die der Leverkusener Multi seit 2001 für den Transport von CO nutzt, ohne von der Bezirksregierung dafür mit einem neuen Genehmigungsverfahren oder schärferen Auflagen behelligt worden zu sein, hat gravierende Mängel. Das musste die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN nach Einsichtnahme in die Behörden-Bescheide und Untersuchungsberichte feststellen. Besonders dort, wo die Pipeline den Rhein unterquert, zeigen sich Korrosionsschäden, also Abnutzungserscheinungen an den Bau-Bestandteilen. So treten an diesem Rhein-Düker nach einem Bericht des TÜV Rheinland „gravierende externe Materialverluste“ auf, weswegen jener „nicht dem Stand der Technik“ entspreche. Damit nicht genug, beträgt die mittlere Verlegungstiefe des Röhren-Werks nur ein Meter, und kein Warnband (Geogrid) weist auf seine Existenz hin. Der Leverkusener Multi sieht jedoch keinen Grund zur Beunruhigung: „Die Leitung wird sicher betrieben, ständig überwacht und regelmäßig kontrolliert.“ Kritik an der Alt-Pipeline weist er zurück und bezeichnet diese als „Stimmungsmache von Industriegegnern aus dem Lager der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN“. Den Bau eines neuen Dükers plant der Konzern aber trotzdem – so ganz sicher scheint er sich betreffs der Sicherheitslage also nicht zu sein. Die Bezirksregierung Köln plant ebenfalls Maßnahmen: Sie hat eine Sonderprüfung angekündigt. Und die nordrhein-westfälische Landesregierung versucht auf Bundesebene ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das die Betreiber von Rohrleitungen zwingt, diese ständig dem jeweiligen Stand der Technik anzupassen. Bisher sträubt sich die Bundesregierung jedoch gegen ein solches Paragrafen-Werk.
Unrentable Neu-Pipeline
Die rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben, das untersuchen sollte, ob die Pipeline für BAYER die einzige Möglichkeit darstellte, das Werk in Uerdingen mit Kohlenmonoxid zu versorgen. Die Expertise des „Bielefelder Instituts für Umweltanalyse“ beantwortet die Frage eindeutig mit „Nein“ und betrachtet die Errichtung sogar als die teurere Lösung. „Zusammenfassend stellte somit die technisch zur Verfügung stehende Alternative der CO-Erzeugung vor Ort in Uerdingen zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung für den Bau und Betrieb der CO-Pipeline aus Sicht der wettbewerbsfähigen CO-Kosten die kostengünstigere Alternative dar“, befindet die Untersuchung. Hat sich der Konzern also einfach verrechnet? Erich Hennen von der Duisburger Initiative CONTRA PIPELINE mag daran nicht glauben. Er vermutet, das Unternehmen habe das Röhrenwerk gar nicht zur Durchleitung, sondern zur Speicherung von Kohlenmonoxid konstruiert. Dem Aktivisten zufolge wurde es als „längster Gasometer der Welt“ konzipiert, auf den die Werke beliebig – etwa bei Versorgungsstörungen – zurückgreifen können, weshalb auch Entnahme-Möglichkeiten an beiden Enden der Leitung bestehen.
Anhörung vor dem OVG Münster
Das Gutachten des „Bielefelder Instituts für Umweltanalyse“ zu den Pipeline-Alternativen (s. o.) besitzt auch für den Prozess Relevanz, der vor dem Münsteraner Oberverwaltungsgericht (OVG) anhängig ist. Dort rechtfertigt BAYER nämlich die im Zuge der Baumaßnahmen vorgenommenen Enteignungen mit dem Argument, die Rohrleitung sei für den Wirtschaftsstandort unerlässlich und diene daher dem Allgemeinwohl. Bei der Anhörung, die vom 15. bis 19. Februar stattfand, spielte die Expertise zwar noch keine Rolle, aber auch so konnte sich der zum „Allgemeinwohl“ um seinen Grund und Boden gebrachte Landwirt Heinz-Josef Mohr in seinem Rechtsempfinden bestätigt sehen. Der Senat habe erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Enteignung seines Mandaten geäußert, resümierte der Rechtsanwalt Dr. Jochen Heide laut Rheinischer Post: „Für uns läuft es in die richtige Richtung.“
PLASTE & ELASTE
Maue Kunststoff-Sparte
BAYERs Kunststoff-Sparte verliert gegenüber den Bereichen „Gesundheit“ und „Landwirtschaft“ immer mehr an Bedeutung. Machte ihr Anteil am Umsatz im Geschäftsjahr 2013 noch rund 30 Prozent aus, so schrumpfte ihr Beitrag zum bereinigten Gewinn auf bloße zehn Prozent. Das dürfte die ohnehin schon gefährdete Stellung von BAYER MATERIAL SCIENCE innerhalb des Unternehmens noch ein Stückchen unsicherer machen.
PRODUKTION & SICHERHEIT
Mehr Arbeitsunfälle in Europa
Die Zahl der Arbeitsunfälle bei BAYER blieb im Geschäftsjahr 2013 gegenüber 2012 relativ konstant. Es gab wie im Vorjahres-Zeitraum zwei Tote zu beklagen. Statistisch gesehen kam es über den Zeitraum von 200.000 Arbeitsstunden zu 0,47 Ereignissen (2012: 0,49). Während der Wert in den Regionen Nordamerika, Asien/Pazifik und Lateinamerika sank, erhöhte er sich in Europa von 0,21 auf 0,72 – mehr als eine Verdreifachung! Eine Erklärung hat der Leverkusener Multi dafür nicht. „Der ungewöhnlich starke Anstieg der (...) Unfall-Quote in Europa wird derzeit intensiv untersucht“, heißt es im Geschäftsbericht lediglich.
UNFÄLLE & KATASTROPHEN
Doppelt so viele Störfälle
Die Zahl der Störfälle in BAYER-Werken hat sich im Geschäftsjahr 2013 von fünf auf zehn verdoppelt. Dazu kommen noch fünf Vorfälle, die dem Leverkusener Multi aus unerfindlichen Gründen nicht als „Umweltereignisse“ gelten sowie ein – von dem Konzern offenbar vergessener – Ammoniak-Austritt am US-Standort Muskegon.
Methanol-Austritt in Muskegon
Am 28.2.13 kam es auf dem Gelände des US-amerikanischen BAYER-Standorts Muskegon zu einem Zwischenfall. Während der Wartung einer Anlage trat gasförmiges Methanol aus.
Methanol-Austritt in Wuppertal
Aus einer Produktionsanlage von BAYER HEALTH CARE in Wuppertal traten am 10.3.13 ca. 600 Liter Methanol aus.
Chlorwasserstoff-Austritt in Vapi
Am 13.3.13 brach auf dem BAYER-Firmenareal im indischen Vapi eine Kunststoff-Pipeline. Daraufhin gelangten 20 Kubikmeter einer Flüssigkeit, die Chlorwasserstoff enthielt, ins Freie.
DESMODUR läuft aus
- 1
Am 4.4.13 beschädigte am BAYER-Standort Knoxville (Tennessee) ein Gabelstabler beim Verladen einen mit dem Flüssigklebstoff DESMODUR befüllten Behälter, weshalb 225 Liter der Substanz ausliefen, die krebserregend wirken, die Atemorgane schädigen, die Haut angreifen und Asthma auslösen kann.
DESMODUR läuft aus
- 2
Am 17.7.13 kam es während eines Lade-Vorgangs abermals zu einem Zwischenfall mit dem Flüssigklebstoff DESMODUR. Ein Transport-Fahrzeug beschädigte ein mit der Substanz gefülltes Fass. Daraufhin liefen 200 Liter des Stoffes aus.
Polyol gelangt ins Meer
Auf einem Seetransport von Brasilien nach Argentinien kam es am 9.4.13 beim Reinigen eines Tanks zu einem Zwischenfall, in dessen Folge 35 Tonnen von BAYERs Kunststoff-Vorprodukt Polyol ins Meer flossen.
Polyol trat aus
Während eines Seetransportes nach Hongkong schlug am 3.12.13 ein mit dem Kunststoff-Vorprodukt Polyol befüllter Container Leck. Über 1.000 Kilogramm der Substanz traten aus.
Ammoniak-Austritt in Kansas
Auf dem Areal des BAYER-Standorts Kansas City traten am 11.5.13 790 Kilogramm Ammoniak aus. Als Ursache des Störfalls gab der Leverkusener Multi einen defekten Dichtungsring am Überdruck-Ventil an.
Salzsäure-Austritt in Krefeld
Im Krefelder BAYER-Werk trat am 19.6.13 aus einer Leitung, die zwei Tanklager miteinander verbindet, wegen eines defekten Restentleerungshahnes Salzsäure aus. Zur Menge machte der Leverkusener Multi keine Angaben.
Isoamylacetat entzündet sich
Durch Funkenflug, der von Schweißarbeiten herrührte, entzündete sich am 25.12.13 auf dem Gelände des chinesischen BAYER-Standorts Chengdu ein Behälter, der mit der gesundheitsschädlichen Chemikalie Isoamylacetat gefüllt war.
Sechs LKW-Unfälle
Im Geschäftsjahr 2013 verunglückten sechs mit BAYER-Stoffen beladene LKWs, wodurch fast immer Chemikalien ins Freie gelangten.
CO-Unfall wg. undichter Sicherung
Am 25. September 2013 kam es im Brunsbütteler BAYER-Werk zu einer Freisetzung von Kohlenmonoxid. Zwei Beschäftigte wurden bewusstlos aufgefunden, drei weitere atmeten das Giftgas ein (siehe Ticker 1/14). Als Ursache des Unglücks gibt der Leverkusener Multi in seinem Geschäftsbericht eine undichte Unterdruck-Sicherung an.
STANDORTE & PRODUKTION
Leverkusen darbt
Die Stadt, in der einer der 100 größten Konzerne der Welt seinen Stammsitz hat, darbt. Mehrere Jahre lang musste Leverkusen mit Nothaushalten über die Runden kommen, weil BAYER weniger Gewerbesteuern überwies – und manchmal wie 1999, 2001, 2003 und 2004 – auch gar keine. So viel wie der Konzern 1990 noch aufbrachte – 123 Millionen Euro – nimmt der Kämmerer Rainer Häusler heute nicht einmal mehr von allen Unternehmen zusammen ein: 2013 belief sich das Gewerbesteuer-Aufkommen auf ca. 70 Millionen Euro. Häusler grollt dem Pharma-Riesen dennoch nicht. „BAYER hat uns dominiert, und die Stadt hat stark davon profitiert. Die Nachteile sind die Sprünge in der Gewerbe -Entwicklung.“ Für diese Sprünge sorgte vor allem die Unternehmenssteuer„reform“ des Jahres 2000, die BAYERs ehemaliger Steuer-Chef Heribert Zitzelsberger als Staatssekretär im Finanzministerium maßgeblich mitgeprägt hat. Aber auch die „Konzentration auf das Kerngeschäft“, in deren Folge sich der Global Player von Unternehmensteilen trennte, brachte der Stadtkasse Verluste, weil diese Abspaltungen entweder eingingen oder Leverkusen verließen, wie es aktuell auch LANXESS plant.
KOGENATE aus Deutschland
Der Leverkusener Multi stellt das Bluter-Präparat KOGENATE bisher ausschließlich im US-amerikanischen Berkeley her. Für die Weiterentwicklungen, die sich in der Abschlussphase der klinischen Tests befinden, will der Konzern jedoch nicht dort 500 Millionen Euro in neue Produktionskapazitäten investieren und 500 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, sondern in Wuppertal und Leverkusen. Das Investitionsklima in Berkeley sieht der Konzern offenbar als nicht allzu günstig an, handelt es sich doch um einen der wenigen BAYER-Standorte in den USA mit einer gewerkschaftlich organisierten Belegschaft.
IMPERIUM & WELTMARKT
Malik neu im Vorstand
Der Leverkusener Multi hat Kemal Malik neu in den Vorstand berufen. Er tritt die Nachfolge von Wolfgang Plischke an, der in Pension geht, und übern