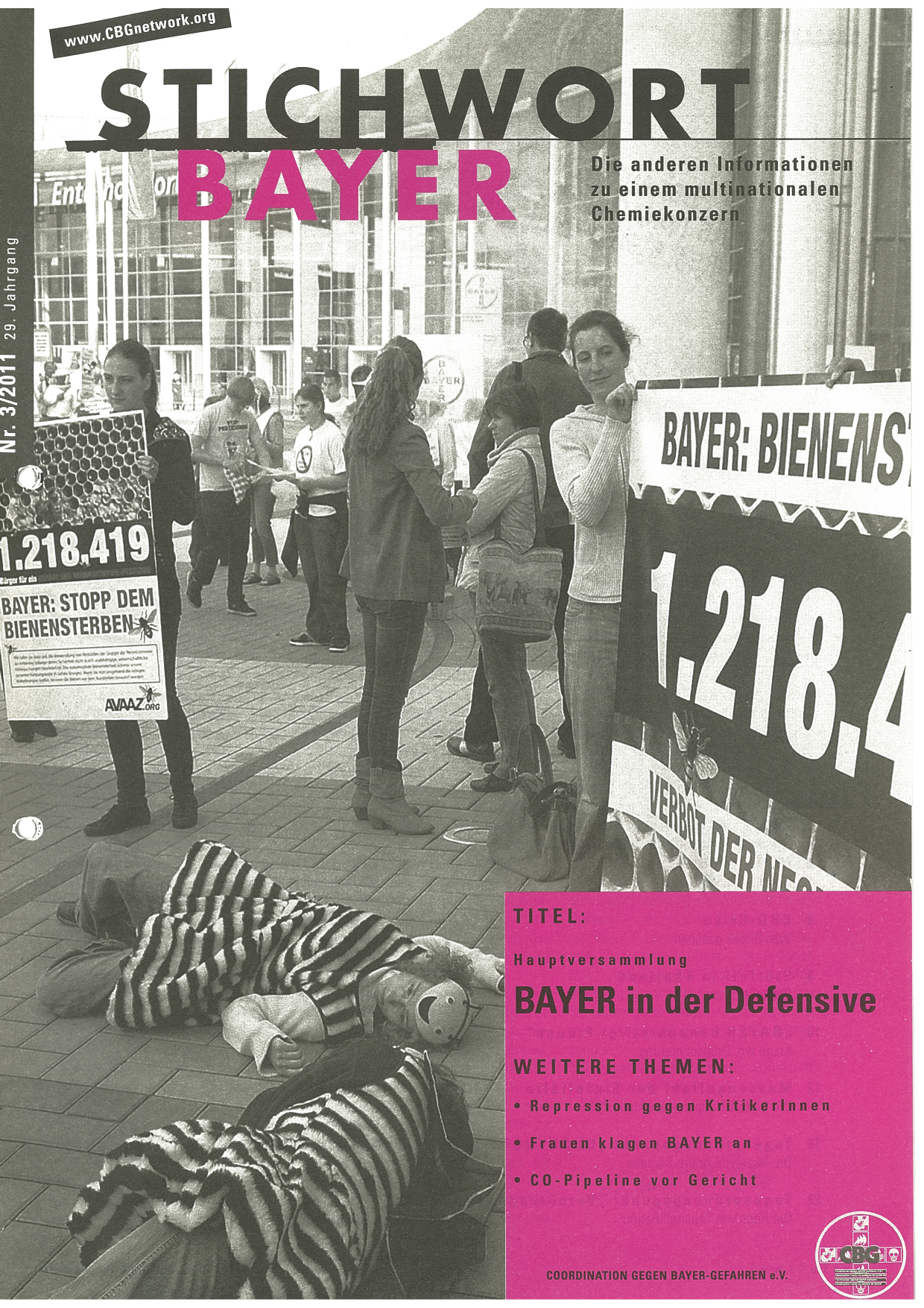Veröffentliche Beiträge in “SWB 03/2011”
Turbulente BAYER-Hauptversammlung
Massenauflauf der Einzelfälle
Die BAYER-Hauptversammlung entwickelt sich mehr und mehr zu einem Hort von Konzern-KritikerInnen. Rund 150 Menschen kamen am 29. April 2011 nach Köln, um den AktionärInnen zu demonstrieren, mit welch desaströsen Folgen das erkauft ist, was Konzern-Chef Marijn Dekkers in seiner Eröffnungsrede als „höchsten Umsatz der BAYER-Geschichte“ pries.
Von Jan Pehrke
ImkerInnen in Berufskleidung mit Rauchgeräten, eine Person in einem Käfig, Menschen mit Schildern wie „Warum wurden wir als Versuchskaninchen missbraucht?“ und junge Frauen in roten T-Shirts nahmen die BesucherInnen der Hauptversammlung am Eingang der Kölner Messehalle 7 in Empfang. „Was hat das alles mit BAYER zu tun?“, mochten sich die AktionärInnen gefragt haben, als sie sich einen Weg durch den Pulk bahnten. Aber längst nicht alle wollten das wirklich wissen. Viele würdigten die Konzern-KritikerInnen keines Blickes, und manche beschimpften sie sogar: „Ihr solltet euch schämen!“.
Wer jedoch aufgeschlossener war, der bekam auf der „Protestmeile“ die Antwort plastisch vor Augen geführt. So hatten die Bienenzüchter reichlich Anschauungsmaterial mit nach Köln gebracht, das die verheerenden Wirkungen der BAYER-Pestizide illustrierte: Auf einem weißen Laken zeigten sie den Aktien-Haltern ihre von den Ackergiften en masse getöteten Bienen. Die Person im Käfig entpuppte sich bei näherer Betrachtung als die Verkörperung eines von Pillen made in Leverkusen malträtierten Versuchskaninchens. Den Frauen in der roten Kluft stand schon auf den Leib geschrieben, was Produkte des Leverkusener Multis ihnen angetan hatten. „Erfolgsbilanz Die Pille: Susan, 29 Lungenembolie“ war da etwa zu lesen. Und nicht wenigen der Versammelten schließlich vermochten die Hauptversammlungsgäste sogar gleich die Schädigungen anzusehen, die der Schwangerschaftstest DUOGYNON - bis Mitte der 1970er Jahre vom inzwischen zu BAYER gehörenden SCHERING-Konzern vertrieben - verursacht hat: entstellte Hände, Kleinwüchsigkeit oder lädierte Augen.
Einige suchten dann auch den Kontakt zu den Gehandicapten, die nie eine Entschädigung erhalten haben, und unterstützten ihr Ansinnen, den Pharma-Riesen per Gericht zur Herausgabe von internen Dokumenten über das Präparat zu zwingen. „Ich bin schon der Meinung, dass BAYER Akten-Einsicht gewähren muss“, sagte etwa eine ehemalige Beschäftigte des Konzerns laut Westfälischer Rundschau. Der Uerdinger SPD-Vorsitzende Peter Schröder reagierte weniger verständnisvoll auf die DUOGYNON-AnklägerInnen, die teilweise sogar aus England angereist waren. „Der Wohlstand, den wir haben, der hat auch etwas mit dieser Firma zu tun“, sagte er einer von ihnen aufs Gesicht zu. „Ich habe keinen Wohlstand durch BAYER“, entgegnete ihm die Angesprochene daraufhin erbost, „Ich habe ein behindertes Kind“.
Seinen Wohlstandsspruch hätte Schröder auch den GegnerInnen der Kohlenmonoxid-Pipeline, den AktivistInnen von der ARBEITSGEMEINSCHAFT BÄUERLICHE LANDWIRTSCHAFT oder Mitgliedern der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) an den Kopf werfen können, denn diese komplettierten die Protest-Aktion. Rund 150 Menschen nahmen daran teil, so viel wie noch nie. Das entging auch der Presse nicht. Von BAYER-KritikerInnen, „die gefühlt immer stärker werden“, kündete die Rheinische Post, und als „außerordentlich lebhaft“ beschrieb der Kölner Stadtanzeiger das Treiben vor der Messehalle.
Verlesung der Anklagen
Drinnen im Saal ging es nicht weniger turbulent weiter. Hatten die Konzern-KritikerInnen Vorstand und Aufsichtsrat in früheren Jahren zumeist „nur“ mit ihren Reden traktiert, so setzten sie diesmal zusätzlich auf non-verbale Kommunikation. Die DUOGYNON-Geschädigten traten zu mehreren ans RednerInnen-Pult, stellten sich kurz vor und übergaben dann das Wort an den CBG-Mitstreiter Friedhelm Meyer. Als dieser sich daranmachte, die Übersetzung des Beitrages von Karl Murphy zu verlesen, setzte ein Teil der Gruppe sich in Bewegung, schritt die Gasse zwischen Bühne und Publikum ab und zeigte den ManagerInnen auf dem Podium ihre deformierten Hände. Fast zehn Minuten lang mussten Dekkers & Co. diese stumme Prozession über sich ergehen lassen, während Meyer ihnen darlegte, wie genau die SCHERING-Verantwortlichen damals über die Risiken und Nebenwirkungen des Schwangerschaftstests informiert waren. „Dieses Hormon sollte nicht eingesetzt werden, wenn eine Schwangerschaft besteht und die Verwendung in einer kritischen Phase der Organ-Entwicklung erfolgen könnte“, zitierte der Pfarrer im Ruhestand aus internen Firmen-Dokumenten.
Einen umfassenden Einblick in diese Unterlagen verlangt Andre Sommer. Bisher hat BAYER diesen verweigert, und auch eine Auskunftsklage konnte in der ersten Instanz noch keine „Akten-Einsicht“ erzwingen. „Aus welchem Grund verweigert BAYER-SCHERING die Auskunft über DUOGYNON?“, fragte er deshalb auf der Hauptversammlung. Der Grundschullehrer hat die Website www.duogynonopfer.de initiiert und seither mehr als 3.500 Emails und Briefe von Menschen erhalten, die mit schweren Schädigungen wie offenem Rücken, Wasserköpfen, Harnleiter-Fehlbildungen, Verstümmelungen an den Gliedmaßen oder Nieren-Krankheiten auf die Welt kamen. Eindrucksvoll begründete Sommer, weshalb den Betroffenen eine Einsichtnahme in das Firmen-Material so wichtig ist. „Sie leben tagtäglich mit dem Trauma und denken, wenn nicht täglich, dann immer wieder daran und stellen die Frage nach dem Warum (...) Diese Menschen wollen nun endlich Gewissheit haben, ob DUOGYNON schuld an Missbildungen hatte oder nicht“, führte er aus. Der Engländer John Santiago unterstützte die Forderung Sommers. „Bei dem Gerichtsverfahren in Berlin vor ein paar Monaten hatten Sie Gelegenheit, die Verantwortung zu übernehmen. Stattdessen fanden Ihre clevere Anwälte einen formalen Ausweg: Ansprüche müssen innerhalb von dreißig Jahren angemeldet werden, seien jetzt also verjährt“, hielt er dem Vorstand vor und schloss mit den Worten: „Wachen Sie auf, BAYER. Helfen Sie den Geschädigten!“.
Auch die Geschädigten eines anderen Präparates des Pharmariesen, des Verhütungsmittels YASMIN und seiner Ableger, traten diesmal gemeinsam vor das Mikrofon. So wollten die Frauen von vornherein verhindern, als Einzel-Schicksale bagatellisiert zu werden, was Dekkers-Vorgänger Werner Wenning im letzten Jahr versucht hatte. „Ich bin heute hier nicht allein - ich bin kein anonymer Einzelfall“, stellte Felicitas Rohrer deshalb von Anfang an klar und wies auf die Leidensgenossinnen neben ihr. „Mit mir sind hier: Nana, Lungenembolie mit 30 nach Einnahme der YAZ; Susan, Lungenembolie mit 29 nach Einnahme der YASMINELLE; Britta, beidseitige Lungenembolie mit Rechtsherz-Insuffizienz mit 32 nach Einnahme der YASMINELLE; Antonia, sieben Lungenembolien ab dem Alter von 16 Jahren nach der Einnahme der YASMIN“, zählte die junge Frau auf und vergaß auch diejenigen nicht, die kein Glück im Unglück hatten. „Sind zwölf tote Frauen in Deutschland und rund 200 tote Frauen in den USA wirklich als Einzelfälle zu bewerten?“, fragte sie den Vorstand.
Ein anderer durch Pharmazeutika von BAYER um seine Gesundheit Gebrachter konnte nicht mehr nach Köln reisen: Andreas Bemeleit vom Bluter-Netzwerk ROBIN BLOOD. Nur durch seine Worte war er in der Halle präsent, denen dann auch die Erklärung dafür zu entnehmen war: „Wäre da nicht diese alte Geschichte, dann würde nicht Frau Schneider hier stehen und meine Rede für mich verlesen“. Und diese alte Geschichte, das ist die seiner ab den 1970er Jahren erfolgten Infektion mit Hepatitis C durch verseuchte Blut-Präparate des Global Players. „Wir Bluter hatten darauf vertraut, dass wir mit sicheren Medikamenten versorgt werden. Doch die Konzerne benutzten für die Herstellung der Gerinnungspräparate vor allem preiswertes Blut von Hochrisikogruppen wie Gefängnis-Insassen“, so schilderte Bemeleit seine Krankheitsgeschichte. Eine Einladung zu einem Gespräch, ein Bekenntnis zur Verantwortung oder gar ein Entschädigungsangebot - auf all das wartete der Bluter bisher ebenso vergeblich wie die VorrednerInnen. Trotzdem machte er noch mal einen Vorschlag zur Güte: „Wäre es für die Außenwirkung der BAYER AG nicht von Vorteil, sich als verantwortungsvolles Unternehmen darzustellen, indem sie eine für alle Beteiligten annehmbare Regelung vereinbart?“.
Aber der Konzern blieb hart. Marijn Dekkers stritt ein Fehlverhalten ab und kündigte an, das Unternehmen werde „entschieden gegen die Ansprüche vorgehen“. Auch den DUOGYNON-Geschädigten kam er nicht entgegen. Der BAYER-Chef verwies auf die bereits von seinem Vorgänger bekundete Anteilnahme, um sich dann aber gleich wieder unerbittlich zu zeigen. „Ich kann das nur wiederholen. Wiederholen kann ich allerdings auch, dass sich nichts an den Fakten geändert hat. Sie sprechen eindeutig gegen ihr Anliegen. Es gibt keinen Nachweis für einen ursächlichen Zusammenhang zwischen DUOGYNON bzw. PRIMODOS und den diskutierten embryonalen Missbildungen“, so der Ober-BAYER. Und selbstverständlich auch keinen zwischen den firmen-eigenen Verhütungsmitteln und Embolien. Auf YASMIN & Co. zurückzugreifen, sei die „sicherste, komfortabelste Methode, eine Schwangerschaft zu verhüten“, behauptete der Vorstandsvorsitzende. Überdies versprach er der auf den Hauptversammlungen stets als BAYER-Claqueurin auftretenden Betriebsrätin Gudrun Kiesler, ihre Anregung aufzugreifen und in Zukunft die vermeintlichen Vorteile der konzern-eigenen Kontrazeptiva stärker herauszustreichen. Die betroffenen Frauen hielt es kaum auf den Sitzen ob einer solchen Ignoranz.
Risikogesellschaft BAYER
Aber lebensgefährlich ist nicht nur die Pharma-Produktion des Global Players. Das Thema „Risiken“ zog sich als Leitmotiv durch fast alle Gegenreden der Konzern-KritikerInnen. Und die Bezugnahme auf Fukushima fehlte auch fast nie. Marijn Dekkers hingegen haben die Ereignisse in Japan nicht zu einem Umdenken bewogen. Hatte er in einem Interview bereits die bundesdeutschen Reaktionen auf die Atom-Katastrophe als überzogen bezeichnet, so legte er in seiner Eröffnungsrede noch einmal nach: „Ich halte es für bedenklich, dass unsere Gesellschaft Risiken am liebsten komplett ausschließen will“.
CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes hielt gerade diese Waghalsigkeit für bedenklich, da sie beim Leverkusener Multi in der Vergangenheit bereits für einige mittlere Katastrophen gesorgt hat. Aus aktuellem Anlass begann sein Überblick über die BAYER-Risikogesellschaft ohne Haftung bei der Atomkraft. Der gelernte Physiker erinnerte daran, dass der Konzern bei der Einführung der Kernkraft in der Bundesrepublik zu den treibenden Kräften gehört hatte und dieser Energieform bis zuletzt - etwa durch die Teilnahme an der Kampagne zur Laufzeit-Verlängerung - in Treue fest verbunden blieb. Und wer solche Gefahren nicht scheut, der nimmt auch gerne die Gefährdungen in Kauf, die von dem als Kunststoff-Zwischenprodukt verwendeten Giftgas Phosgen ausgehen, obwohl die Konkurrenz teilweise bereits Alternativ-Verfahren in Betrieb hat. Aber BAYER zeigt zu einer Umstellung ebenso wenig Bereitschaft wie dazu, zu Gunsten einer unbedenklicheren Vorort-Fertigung des lebensbedrohlichen Kohlenmonoxids (CO) auf eine fast 70 Kilometer lange, Wohngebiete streifende Pipeline zu verzichten, monierte der CBGler. Wohin diese Haltung führen kann, das hatte vor drei Jahren die Explosion in Institute deutlich gemacht, bei der zwei Menschen starben. Was der Gen-Gigant als Risikobereitschaft darstellt, bezeichnete das US-amerikanische „Chemical Safety Board“ in einer Untersuchung des Vorfalls laut Mimkes als mangelnde Anlagen-Sicherheit. „Der Tod der Arbeiter ist umso tragischer, als er hätte vermieden werden können“, zitierte er aus dem Untersuchungsbericht.
Auf das vom CBG-Vorständler nur gestreifte Thema „CO-Leitung“ ging Dieter Donner in voller Breite ein. Und auch ihm kam dabei Fukushima in den Sinn. „Das Gas Kohlenmonoxid, das Sie durch diese Pipeline leiten wollen, ist extrem heimtückisch und im Falle einer Leckage in seiner Wirkung durchaus Auswirkungen eines Atomunglücks vergleichbar“, redete der Aktivist von der STOPP-BAYER-CO-PIPELINE-Initiative dem Vorstand ins Gewissen. Angesichts katastrophaler Katastrophen-Pläne, bestehender Alternativen und einer wegbrechenden Geschäftsgrundlage für die Pipeline - der CO-Überschuss in Dormagen existiert nicht mehr - forderte er Dekkers zu einem Baustopp auf. Dabei konnte Donner sich auch auf eine Entscheidung des Stuttgarter Verwaltungsgerichts berufen, das ein ähnliches Vorhaben zu Fall gebracht hat, weil es wie das BAYER-Projekt den von der „Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung“ vorgegebenen Sicherheitsabstand zur Wohnbebauung nicht einhält.
Philipp Strom von der österreichischen GREENPEACE-Sektion zog derweil Parallelen zwischen der Gentechnik und der Kernkraft. „Die größte Gemeinsamkeit ist wohl, dass beide nicht wirklich kontrollierbar sind und dass - wenn etwas schief geht - die Auswirkungen katastrophal und unumkehrbar sind“, so Strom. Und bei BAYER ist da schon etwas schief gegangen. Der Greenpeaceler erinnerte die AktionärInnen in seiner Rede an BAYERs LL601-Reis, der 2006 plötzlich in allen möglichen Supermarkt-Sorten auftauchte. Axel Köhler-Schnura schließlich nannte in seinem Beitrag noch andere GAU-Kandidaten aus dem BAYER-Angebot: die Nanotechnik und die für das weltweite Bienensterben mitverantwortlichen Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide. „Meine Damen und Herren, auch wenn die Bienen nur kleine Mitbewohner unseres Planeten sind - ohne sie können wir einpacken. Sie sind nämlich maßgeblich verantwortlich für die Bestäubung der Pflanzenwelt und damit für die weltweite Lebensmittel-Produktion. Ohne Bienen keine Lebensmittel - so einfach ist das. Und wenn der kritische Punkt überschritten ist, dann haben wir eine BAYER-verursachte Menschheitskatastrophe!“ mahnte er.
Ein Menetekel für diese Apokalypse stellten 2008 die Ereignisse in der Rheinebene südlich von Karlsruhe dar. „Über 12.500 Bienenvölker sind damals nachweislich durch das BAYER-Saatgut PONCHO bzw. PONCHO PLUS vergiftet worden“, klagte der Imker Christoph Koch an. Der Leverkusener Multi machte jedoch nicht die Produkte an sich, sondern nur eine fehlerhafte Verarbeitung dafür verantwortlich. Obwohl er diese Mängel inzwischen behoben hat, kommt es in Ländern wie Österreich, in denen der Konzern die Mittel nach wie vor verkaufen darf, weiterhin zu Vergiftungen. Dafür hatte Koch sogar Beweismaterial mit nach Köln gebracht. Er zeigte ein großes Foto mit einem Maissaatkorn hoch, dessen Beiz-Hülle aufgeplatzt war und erläuterte: „Dieser Abrieb, dieses Absplittern aber ist der Grund für die immer noch stattfindenden Bienenvergiftungen“. Aufgrund dieser neuen Befunde stellte auch sein Kollege Walter Haefeker, der Präsident des Europäischen Berufsimkerverbandes EPBA, fest: „Eine bienen-ungefährliche Anwendung dieser Produkte ist offensichtlich in der Praxis nicht möglich“. Und dass die BienenzüchterInnen mit dieser Meinung nicht alleine dastehen, demonstrierte an diesem Freitag Stephanie Brancaforte vom Kampagnen-Netzwerk AVAAZ. Sie übergab der Vorstandsriege eine Petition zum Verkaufsstopp von PONCHO & Co., die über 1,2 Millionen Menschen unterzeichnet haben. „Diese gewaltige Anzahl Unterschriften bringt das Ausmaß der öffentlichen Besorgnis - und gewiss auch der Empörung - zum Ausdruck“, erläuterte Brancaforte.
Da brauchte der Imker Bernhard Heuvel gar nicht mehr in eigener Sache zu sprechen, weshalb er die Gelegenheit nutzte, um grundsätzlicher zu werden. „Wie die vielen in den Vorreden vorgestellten Fälle von menschlichem Leid zeigen, scheint hier auch ein allgemeines Problem mit der Risikobewertung vorzuliegen“, konstatierte er. Aus diesem Grund machte der Bienenzüchter dem Agro-Riesen den Vorschlag, nicht erst ein Produkt zu entwickeln und anschließend eine Risiko-Bewertung vorzunehmen, sondern es von Anfang auf mögliche Nebenwirkungen hin zu untersuchen.
Sicher, sicherer, BAYER
Der Leverkusener Multi sah dazu keinerlei Veranlassung. Seine Pestizide hält er bei sachgerechter Anwendung für bienensicher. Gleiches gilt auch für seine Gen-Pflanzen. „Bei der Gentechnik gibt es wissenschaftlichen Studien zufolge keine Risiken“, beschied Dekkers Philipp Strom. In puncto „Phosgen“ kannte der Holländer ebenfalls keine Bedenken. „Ich kann Ihnen versichern, dass der Umgang mit Phosgen sicher ist“, antwortete er dem CBGler Philipp Mimkes. Und bei der geplanten Kohlenmonoxid-Pipeline gewähre der Konzern sogar Sicherheit über das geforderte Maß hinaus. So war Fukushima dann nicht mehr überall bei BAYER, sondern nirgends. Dass Axel Köhler-Schnura BAYER in die Nähe von Atom-Katastrophen rücke, zeige, wie genau er es mit der Realität nehme, hielt der BAYER-Chef dem CBGler deshalb vor.
Wie nicht anders zu erwarten, empfand der Vorstandsvorsitzende auch den übrigen Teil der Rede Köhler-Schnuras als wirklichkeitsfern. Dabei zeigte der Diplom-Kaufmann nicht nur die Ursache für die real existierende Gemeingefährlichkeit vieler Produkte, Produktionen und Projekte des Multis auf - die gnadenlose Profit-Jagd - , er schilderte darüber hinaus die Auswirkungen der Rendite-Vorgaben auf die Belegschaft und konnte dafür sogar mit konkreten Zahlen aufwarten. „4.500 Arbeitsplätze sollen an den alten BAYER-Standorten vernichtet werden“, monierte das CBG-Vorstandsmitglied und prangerte überdies die ständig zunehmende Arbeitsverdichtung und die ständig abnehmenden Steuerzahlungen an. Das alles mochte Dekkers nicht auf sich sitzen lassen. „Sie liegen mit ihrer pauschalen Kritik an unserem Unternehmen total daneben“, teilte er dem Konzern-Kritiker mit und resümierte: „Mir ist bewusst, dass Sie ein völlig anderes Wertesystem haben“.
Das scheint aber mittlerweile auch ein Teil der eigenen Belegschaft zu haben. Zum ersten Mal nach vielen Jahren nutzten Beschäftigte die Hauptversammlung wieder als Forum für Kritik an dem Pharma-Riesen. Eine Lohnabhängige gab ihrer Sorge um den Pharma-Standort Berlin Ausdruck und zog eine bittere Bilanz der 2006 erfolgten SCHERING-Übernahme. Versprach BAYER den SCHERINGlerInnen damals „weitere Vorteile“ aus dem Zusammenschluss, so ist davon heute nichts zu sehen. Arbeitsplatzvernichtung im großen Stil, Reduzierung des dortigen Vorstands, Streichung des Namens „SCHERING“ und Verlegung der Leitung nach Leverkusen - Maßnahmen wie diese „kann man nicht als Erfüllung der Zusage werten“, meinte die Belegschaftsangehörige. Dekkers jedoch ging mit keinem Wort auf die Zukunftsängste der BerlinerInnen ein; für ihn blieb der Erwerb von SCHERING „eine Erfolgsgeschichte“.
Eine solche dokumentiert für den Manager auch der Nachhaltigkeitsbericht des Global Players, obwohl dieser einen erhöhten Kohlendioxid-Ausstoß, Schadstoff-Emissionen en masse und Störfälle dokumentiert, wie der Autor dieses Artikels darlegte. „Zur Kritik besteht kein Anlass“, entgegnete Dekkers ihm.
In den angesprochenen Nachhaltigkeitsberichten finden sich ebenfalls regelmäßig Bekenntnisse zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Tierversuchen. „Die Prinzipien gelten auch für externe Studien und werden von unserem Tierschutz-Beauftragten kontrolliert“, heißt es da etwa. Wie wenig das der Realität entspricht, schilderte die Tierärztin Christine Esch von der Tierrechtsorganisation PETA. Sie berichtete von unhaltbaren Zuständen bei einem Unternehmen, das für BAYER das Flohmittel ADVANTAGE testen ließ. Die Beschäftigten schleuderten die Tiere in ihre Käfige, spritzten sie mit Hochdruck-Reinigern ab und rissen ihnen die Krallen heraus. Und natürlich kein BAYER-Tierschutzbeauftragter weit und breit.
Warum der Multi nicht dafür gesorgt habe, den Kreaturen dieses Leid zu ersparen, wollte Esch wissen. Der BAYER-Chef bekundete, sofort nach Veröffentlichung des PETA-Recherchematerials die Geschäftsbeziehungen zu dem Kooperationspartner abgebrochen zu haben - eine dreiste Lüge, denn zu dem Zeitpunkt waren die ADVANTAGE-Versuche schon längst beendet. Die anderen Fragen von Christine Esch beantwortete er dann - wenn überhaupt - ähnlich inadäquat, wie diejenigen der anderen RednerInnen. Philipp Mimkes, dem der Versammlungsleiter Manfred Schneider überdies noch das Wort entzog, veranlasste das, Widerspruch zu Protokoll zu geben.
BeobachterInnen, die BAYERs Antwort-Praxis aus den früheren Jahren noch nicht kannten, hat dieses Verhalten, besonders den Medikamenten-Geschädigten gegenüber, tief verstört. „Wenn Menschen von Angesicht zu Angesicht von ihrem Leiden erzählen und das einfach weggewischt wird - ich habe das als unmenschlich empfunden. Ich konnte es menschlich nicht nachvollziehen, und das schockt mich“, hielt der Imker Bernhard Heuvel in seiner Nachbetrachtung fest. Einer Aktionärin erging es genauso. „Ich bin eigentlich kein sonderlich emotionaler Mensch, aber die Rede zum Thema „Schädigungen durch die Antibabypille“ hat mich trotzdem sehr berührt. Umso unverständlicher fand ich dann die Reaktion darauf, und es hat mir für die Betroffenen sehr leid getan, so abgekanzelt worden zu sein“, schrieb sie der Coordination nach der Hauptversammlung. Die Frau hatte daraus die Konsequenz gezogen, zum ersten Mal in ihrem Leben gegen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat zu stimmen. Und genau wegen solcher Reaktionen lohnt der ganze Einsatz, der besonders den Pharma-Geschädigten viel Stärke und Mut abverlangt.
Proteste in der Bayer HV am 29. April: Videos, Reden, Fotos und Medienberichte
Repression im Dienst von BAYER & Co.
Das Imperium schlägt zurück
Politisches Engagement sieht sich seit einiger Zeit verstärkter Repression ausgesetzt. Besonders für Initiativen, die sich in ihrer Arbeit auf Wirtschaftsunternehmen konzentrieren, steigt der Druck. Das bekommen vor allem TierrechtlerInnen zu spüren, aber unter das Verdikt „Öko-Terrorismus“ können auch Gentechnik-GegnerInnen und andere AktivistInnen fallen. In den USA weckt das aufgeheizte Klima schon Erinnerungen an das antikommunistische McCarthy-Regime.
Von Jan Pehrke
Von der Demonstrationsfreiheit hat der britische Oberste Gerichtshof nur eine sehr begrenzte Vorstellung. Im Fall „BAYER CROPSCIENCE LIMITED vs. STOP HUNTINGDON CRUELTY (SHAC) untersagte er der Tierrechtsinitiative 2008 auf der Grundlage eines Gesetzes zum Schutz vor Belästigungen, künftig in der Nähe der Konzern-Niederlassungen in Cambridge, Great Chishill und anderswo zu demonstrieren. Ein umfangreiches Kartenwerk im Anhang des Urteils gibt dabei exakt Auskunft über den Verlauf der Bannmeilen und weist den AktivistInnen, die gegen den Pharma-Riesen wegen seiner Geschäftsbeziehungen zum Tierversuchsmulti HUNTINGDON Kampagnen durchführen, stattdessen „designated protest areas“ (DPAs) in den hintersten Winkeln zu. Noch dazu dürfen diese nie mehr als 20 SHAClerInnen gleichzeitig betreten und das auch nicht mehr als zwei Stunden lang. Leise müssen sie ebenfalls sein: Das Mitführen von Instrumenten verboten die JuristInnen. Alles andere würde den Tatbestand der Belästigung erfüllen.
Hohe Haftstrafen
Ähnlich hatte bereits 2004 ein RichterInnen-Spruch BAYER-Gelände zur No-Go-Area erklärt und verbriefte Grundrechte auf diese Weise zur Farce werden lassen. Aber das alles ist gar nichts im Vergleich zu anderen Prozess-Ausgängen. Im Januar 2010 verurteilte ein Gericht sieben SHAC-Mitglieder zu Haftstrafen bis zu elf Jahren, und zehn Monate früher mussten fünf SHAC-Angehörige für 15 Monate bis sechs Jahre ins Gefängnis. Der Winchester Crown Court hielt sie für schuldig, Angestellte von Huntingdon-Geschäftspartnern per Flugblatt der Päderastie bezichtigt, ihnen mit angeblich HIV-verseuchten Tampons Angst eingejagt und ihre Häuser, Autos und nähere Umgebung mit Bezeichnungen wie „Welpen-Killer“, „Mörder“ und „Abschaum“ besprüht zu haben.
Vielleicht mag einem diese Kampagne geschmacklos, überzogen und unpassend vorkommen, aber doch wohl kaum als „gleichbedeutend mit Einschüchterung, Gewalt und Terror“, als die sie das Gericht brandmarkte. Die Justiz musste sich noch nicht einmal die Mühe machen, den Angeklagten die Delikte direkt zuzuordnen. Sie erkannte auf organisierte Kriminalität und brachte eine „Verschwörung zur Erpressung“ und eine „Verschwörung zum Eingriff in ein bestehendes Vertragsverhältnis zum Schaden von Tierversuchsunternehmen“ zur Anklage.
Bei solchen zum Teil passgenau für SHAC und andere Tierrechtsorganisationen entworfenen Straftatbeständen war es zum vernichtenden Urteil dann nur noch ein kleiner Schritt. Sie hatten 2005 Eingang in den „Serious Organized Crime and Police Act“ (SOCPA) gefunden. Die Abschnitte 145 bis 149 widmen sich exquisit dem Treiben von SHAC & Co. und stellen den „Eingriff in ein bestehendes Vertragsverhältnis“ ebenso unter Strafe wie die Einschüchterung von deren Beschäftigten.
Aber auch sonst ist der SOCPA nicht ohne. Er erleichtert Verhaftungen, schränkt das Demonstrationsrecht ein und weitet den Schutz von BAYER & Co. vor Belästigungen erheblich aus. Dabei gelang der Labour-Regierung sogar das Kunststück, ein ursprünglich zur Ahndung von Stalking geschaffenes Paragraphen-Werk gegen politische AktivistInnen zu wenden, wenn auch nur unter erheblicher Kraftanstrengung. Da es nicht einmal die engagiertesten TierrechterInnen schaffen, den Konzernen permanent nachzustellen, können sie das nun bereits an einem Tag erledigen. Die findigen PolitikerInnen griffen zur paradoxen Konstruktion des Instant-Stalkings, um die Möglichkeit zu schaffen, auch gegen einmalige Aktionen vorzugehen. Und die Justiz machte von dieser Handreichung schon ausgiebig Gebrauch. Das Gesetz „wurde von der Polizei und den Gerichten benutzt, um fast alle Formen von Protest zu kriminalisieren“, bilanzierte der Journalist George Monbiot im Guardian.
In den USA gab es ähnliche Entwicklungen. 1992 verabschiedete der Kongress den „Animal Enterprise Protection Act“. Zehn Jahre später verschärfte er das Gesetz, und 2006 mutierte es auf Initiative des republikanischen Senators James Inhofe schließlich zum „Animal Enterprise Terrorism Act“ - natürlich nicht ohne nochmalige „Nachbesserungen“. In den Genuss dieser zusätzlichen Repressionen kamen die sieben TierrechtlerInnen noch nicht, die im Frühjahr 2006 im US-amerikanischen Trenton vor Gericht standen, aber es reichte auch so schon zu drastischen Strafen. Der Richter verurteilte sechs der sieben AktivistInnen, die seither unter dem Namen „SHAC 7“ bekannt sind, zu bis zu sechs Jahren Haft und einer Entschädigungszahlung von einer Million Dollar. Zur Last legte er ihnen eine Web-Kampagne, welche die Adressen von TierversuchswissenschaftlerInnen und anderen veröffentlichte und toner-fressende schwarze Faxe versendete. Mit dem Nachweis einer individuellen „Tatbeteiligung“ hielt der Jurist sich nicht lange auf. Er verwies auf das „Wir“ in diversen postings und sah eine Verschwörung am Werk bzw. sogar zwei: eine zur Verletzung des „Animal Enterprise Protection Acts“ und eine zur Belästigung vermittels moderner Kommunikationsmittel. Bei den Ermittlungen gegen TierschützerInnen gaben sich die staatlichen Stellen ebenfalls wenig zimperlich. Sie infiltrieren die Szene mit V-Leuten und schreckten nicht einmal vor dem Einsatz von agents provocateurs zurück.
Verdeckte ErmittlerInnen trugen auch in Österreich das belastende Material gegen den VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN (VGT) zusammen, das den Telefonabhör-Aktionen und Observationen der Sonderkommission Pelztier entging. 10.000 Ordner-Seiten füllt es mittlerweile und befeuert einen Prozess gegen zehn TierrechtlerInnen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung nach Paragraph 278a. Allerdings mangelt es trotz des beeindruckenden Akten-Bestandes noch an schlagkräftigen Beweisen. Das Gericht tut sich sichtlich schwer damit, den Angeklagten Buttersäure-Attentate auf Kleidergeschäfte, das Ansägen eines Hochsitzes und die Beschädigung von Autos nachzuweisen. Aber selbst wenn das zu Freisprüchen führen sollte, sind die Zehn durch die über dreimonatige Untersuchungshaft, die lange Verfahrensdauer und die dadurch entstandenen immensen Anwaltskosten schon genug gestraft.
Darüber hinaus versuchte die SOKO Pelztier, dem VGT die Finanzierung zu erschweren. So setzten sich die BeamtInnen mit dem Finanzministerium zusammen, um eine Aberkennung der Gemeinnützigkeit in die Wege zu leiten. Die Steuerfahndung durchsuchte anschließend die Geschäftsräume, prüfte die Unterlagen und ordnete die Streichung der Gemeinnützigkeit an. Der Verein verfolge politische Ziele, die „ein nicht unbeachtlicher Teil der Bevölkerung“ nicht teile und die deshalb auch nicht dem Allgemeinwohl dienten, lautete die Begründung. Aber der Coup gelang nicht. Kurz vor Prozess-Beginn bestätigte das zuständige Finanzamt den bisherigen Status des VGT.
Nicht nur TierrechtlerInnen
Unter dem zunehmenden Druck leiden jedoch nicht nur TierrechtlerInnen. So definiert der Paragraph 278a des österreichischen Strafgesetzbuchs „kriminelle Organisation“ in einer Weise, die es erlaubt, fast alle politische Initiativen unter Generalverdacht zu stellen. „Eine auf längere Zeit angelegte unternehmensähnliche Verbindung“ mit „einer größeren Anzahl von Personen“, die „erheblichen Einfluss auf Politik oder Wirtschaft anstrebt“, ist nämlich beinahe jede politisch arbeitende Gruppe. Und deshalb auch entsprechend gefährdet - nicht nur in Österreich. Martin Balluch, einer der angeklagten AktivistInnen vom VGT, hat sich in seinem Buch „Widerstand in der Demokratie“ umfassend mit dem neuen Repressionsregime beschäftigt und schreibt: „Die Entwicklung, dass Organisationsdelikte und die erweiterte Gefahrenforschung gegen NGO-Arbeit und völlig legalen und demokratiepolitisch unbedenklichen politischen Aktivismus eingesetzt werden, ist mittlerweile global zu bemerken“.
Globaler „Öko-Terror“
In Neuseeland betrachteten die Behörden die Friedensbewegung und eine Initiative für die Rechte der UreinwohnerInnen als kriminelle Vereinigungen und starteten das ganze Programm mit Lauschangriffen, Hausdurchsuchungen und Untersuchungshaft. Allerdings wollte es der Generalstaatsanwalt später nicht weiterführen und klagte die Beschuldigten schließlich nicht mehr wegen eines gemeinschaftlich begangenen Verbrechens an. Genau das aber hat die sächsische Staatsanwaltschaft mit 17 AntifaschistInnen vor. „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ legt sie ihnen wegen vermeintlicher Angriffe auf Neonazis zur Last und durchkämmte zur Beweissicherung in einer Großrazzia 20 Wohnungen. Auch für bundesdeutsche Gentechnik-GegnerInnen brechen härtere Zeiten an. So verbüßt Jörg Bergstedt gerade eine sechsmonatige Haftstrafe, weil er an einer Feldbefreiungsaktion teilgenommen hat.
In den USA rollte 2004 die „Operation Backfire“ an, die neben TierrechtlerInnen auch Mitglieder der EARTH LIBERATION FRONT (ELF) auf die Fahndungsliste setzte. „Help find four Eco-Terrorists“ forderte das FBI die Bevölkerung auf seiner Internet-Seite in einer „Top Story“ auf, die Osama Bin Laden ins Kleingedruckte verbannte. Aber wenn eine Gruppe daherkommt und die Einrichtung eines Ski-Gebiets im netten Vail mit Sabotage-Aktionen verhindern will, wie es die Staatsanwaltschaft dem Quartett vorwirft, können die Prioritäten offenbar schon einmal durcheinander geraten. Auch den Anschlag auf ein botanisches Versuchslabor der Washingtoner Universität werteten die Gerichte als „domestic terrorism“ - und handelten entsprechend: Für die den Angeklagten zur Last gelegten Delikte verhängten sie Strafen von bis zu neun Jahren. Einer der ELF-AktivistInnen erlebte die Urteilsverkündigung nicht mehr: Bill Rodgers hatte sich schon einen Monat nach seiner Inhaftierung in seiner Gefängniszelle das Leben genommen.
Aber nach „Terrorismus minus islamistisch“ suchte das FBI auch anderswo. Es observierte die TierschützerInnen von PETA, den sich für Bürgerrechte engagierenden „Thomas Merton Center“, GREENPEACE und selbst eine katholische Friedensgruppe. Einige republikanische Politiker wollten für diesen erweiterten Terrorismus-Begriff sogar eine gesetzliche Grundlage schaffen. Der Kongress lehnte den von George Nethercutt eingebrachten „Agro-Terrorism Prevention Act“ jedoch ebenso ab wie der Senat den Antrag von Orrin G. Hatch auf Einführung einer „Öko-Terrorismus“-Datenbank.
In England fand der Stalker-Paragraph „Protection from Harassment“ unter anderem Anwendung bei der Verfolgung von Protesten gegen eine Raketenabwehr-Station des US-Militärs und gegen einen Stromkonzern. Auch das Versenden zweier E-Mails an eine Pharma-Firma mit dem Appell, auf Tierversuche zu verzichten, sahen die StaatsanwältInnen als Belästigung an. Schon der Kommentar auf einer Indymedia-Seite zu den Urteilen im SHAC-Prozess, der dazu aufforderte, dem Richter seine Meinung zu sagen, reichte für eine Verhaftung nach dem „Serious Organized Crime and Police Act“.
Und an BAYER war es, all die unterschiedlichen Gruppen in einem einzigen Rechtsstreit auf der Anklagebank zu versammeln. In dem 2004 geführten Gerichtsverfahren nach dem notorischen Belästigungsparagraphen fanden sich dort neben SHAC-AktivistInnen auch Angehörige der Initiativen STOP BAYERS GM-CROPS, LEEDS EARTH FIRST und BAYER HAZARD wieder. Gegen die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hatte der Chemie-Multi ebenfalls schon wiederholt die RechtsanwältInnen eingeschaltet. 1987 verklagte er die CBG wegen eines Aufrufs, in dem es geheißen hatte: „In seiner grenzenlosen Sucht nach Gewinnen und Profiten verletzt BAYER demokratische Prinzipien, Menschenrechte und politische Fairness. Missliebige Kritiker werden bespitzelt und unter Druck gesetzt, rechte und willfährige Politiker werden unterstützt und finanziert“. In den ersten Instanzen bekam das Unternehmen Recht; ein Richter forderte sogar eine dreijährige Haftstrafe für einen CBGler. Die Coordination musste bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und ein erhebliches finanzielles Wagnis eingehen, um dem Recht auf Meinungsfreiheit fünf Jahre nach Beginn des Prozesses wieder Geltung zu verschaffen. Im Jahr 2001 klagte der Gen-Gigant die CBG dann wegen „Verletzung des Namensrechts“ an, weil diese das Wort „BAYER“ zusammen mit dem Begriff „watch“ in einem Domain-Namen verwendet hatte. Aus Angst vor den hohen Verfahrenskosten legte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN keinen Widerspruch ein und beugte sich der Einstweiligen Verfügung, die mit einer Strafandrohung von 50.000 Euro bewehrt war.
Aber der Pharma-Riese ging nicht nur rechtlich gegen die Coordination vor. Anfang der 1980er Jahre nutzte er den kurzen Dienstweg zum Wuppertaler Polizeipräsidenten, um diesen anzuhalten, der CBG die Gemeinnützigkeit zu bestreiten. Der tat wie geheißen und unterwies das Amtsgericht Solingen postwendend, die „Förderung zu unterbinden“. Daran hielten die JuristInnen sich dann auch und schnitten die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN so von dringend benötigten finanziellen Ressourcen ab.
Die Last des Erfolges
Der Hauptgrund für die zunehmende Repression ist der Erfolg von Initiativen, die sich auf Unternehmen konzentrieren. So gelang es SHAC mit seinen Kampagnen, HUNTINGDON dazu zu bringen, England zu verlassen und in den USA ökonomisches Asyl zu suchen. Auch dem Leverkusener Multi als gutem Kunde von HUNTINGDON und Konzern mit über 170.000 Tierversuchen pro Jahr machten die SHAClerInnen das Leben schon schwer. Die Gruppe setzte ihn ganz oben auf ihre Liste der inkriminierten Konzerne und agiert seit mehr als zehn Jahren global gegen den Global Player. Sie blockierte die Werkstore in Uruguay, demonstrierte vor dem Wuppertaler Pharma-Zentrum, sprach dank einer Einladung der CBG auf der BAYER-Hauptsammlung in Köln, protestierte vor der chilenischen Zentrale, störte ein BAYER-Dinner in Irland, entrollte in der Lobby der Washingtoner Zweigstelle Transparente und suchten schwedische und englische Niederlassungen heim.
Nicht umsonst konstatierte das US-amerikanische Heimatschutz-Departement deshalb: „Von Tierrechtsextremisten und Öko-Terroristen verübte Attacken gegen Unternehmen verursachen den betroffenen Unternehmen hohe Kosten und können auf die Dauer das Vertrauen in die Wirtschaft erschüttern“.
BAYER & Co. als Gesetzgeber
Auf dieses Vertrauen aber sind die Global Player in Zeiten des immer entfesselter auftretenden Kapitalismus besonders angewiesen, um ihren AktionärInnen weiterhin Extra-Renditen sichern zu können. Darum reagieren die großen Firmen empfindlicher denn je auf Störungen des „Business as usual“ - und fordern Schutzmaßnahmen ein. In den USA war die Industrie die treibende Kraft hinter den Strafverschärfungen. Sie nahm an den Senatsanhörungen teil, die den Boden für die „homeland terrorism“-Beschlüsse bereiten sollten, und unterstützte die willigsten PolitikerInnen. BAYER etwa überwies den Republikanern James Inhofe, George Nethercutt und Orrin G. Hatch, welche die Gesetzesinitiativen zum Öko-, Agrar- und Tierrechts„terrorismus“ einbrachten, großzügige Wahlkampfspenden. Ausgearbeitet hatte ihre Entwürfe das „American Legislative Exchange Council“ (ALEC), eine von den Konzernen gesponserte JuristInnen-Vereinigung. „Limited Government, Free Enterprise und Federalism“ hat sie sich auf die Fahnen geschrieben, die der Leverkusener Multi mit hochhält. Die BAYER-Managerin Sandra Oliver sitzt für den Agro-Riesen in dem Beirat, der EmissärInnen aus der freien Wirtschaft vorbehalten ist. Mike Birdsong gehört der „Health and Human Services Task Force“ an, und Bill Corley, das ALEC-Mitglied des Jahres 2005 in der Sektion „Privatwirtschaft“, steht im Bundesstaat Arkansas demjenigen Gremium vor, das sich um das legislative Wohlergehen von BAYER & Co. kümmert.
Green Scare
Die Strategie, die Anschläge vom 11. September 2001 dafür zu instrumentalisieren, aus dem Begriff „Terrorismus“ ein Passepartout für alle möglichen unliebsamen politischen Aktivitäten zu machen, hat in den USA ein hysterisches Klima geschaffen, das an die McCarthy-Ära erinnert. Nur die Signalfarbe hat sich geändert: Grün ist das neue Rot. Was dem republikanischen Senator der „Red Scare“ war, die Beschwörung des vom Kommunismus angeblich ausgehenden roten Schreckens, das ist heutigen Zeiten der „Green Scare“ mit Tierrechts- und Umweltgruppen als Trägern. „Angst. Es dreht sich alles um Angst. Es geht darum, die Profite der Unternehmen zu schützen, indem man den Hauptströmungen der Tierrechts- und Umweltinitiativen - und allen anderen wachsamen sozialen Bewegungen - Angst macht, die ihnen zustehenden Rechte zu nutzen“, schreibt der Journalist Will Potter in seinem Blog „Green is the New Red“.
Auf besonders widerspenstige Gruppen zielen, aber alle treffen wollen - diese Absicht verfolgt der „Green Scare“ nach Meinung von Potter. Er appelliert deshalb an die politischen Initiativen, sich nicht auseinanderdividieren zu lassen wie zu McCarthys Zeiten. „Wir müssen starke aktivistische Gemeinschaften aufbauen, die ihre Rechte kennen und wissen, wie sie bedroht sind und was auf dem Spiel steht, wenn wir nachgeben“, sagte Will Potter in einem Interview mit der Jungle World.
Und dies gilt trotz so einiger zweifelhafter Methoden wie Sachbeschädigungen umso mehr, als die neuen Gesetze immer häufiger einst ganz legale Inanspruchnahmen der verbrieften Grundrechte als illegal inkriminieren und die demokratisch nicht legitimierte Übermacht der Konzerne ein Ungleichgewicht der Kräfte schafft, das - wenn überhaupt - nur konfrontative Kampagnen ausbalancieren können. Wenn es nämlich einen Terror gibt, dann den einen: den Terror der Ökonomie.
Liebe Leserinnen und Leser,
„Die größte terroristische Bedrohung im Inland“, sagt John Lewis, ein hoher FBI-Beamter, geht vom Öko-Terrorismus, von der Tierrechtsbewegung aus“. Die Tierrechts- und Umweltbewegung hat, wie jede andere soziale Bewegung in der Geschichte, legale und illegale Elemente. Es gibt darunter Menschen, die Flugblätter verteilen, Eingaben schreiben und sich bei der Politik Gehör verschaffen. Dann gibt es Menschen, die protestieren und zivilen Ungehorsam praktizieren. Und schließlich gibt es Menschen in Gruppen wie der ANIMAL LIBERATION FRONT und der EARTH LIBERATION FRONT, die Fenster einschmeißen, Geländewagen anzünden und Tiere aus Nerzfarmen befreien.
Tierrechts- und UmweltaktivistInnen haben keine Flugzeuge auf Gebäude gelenkt, Geiseln genommen oder Anthrax per Brief versandt. Sie haben nie irgendjemanden verletzt. Der einzige Mordversuch in der Geschichte der US-amerikanischen Tierrechtsbewegung wurde von einem Agent Provocateur initiiert. Trotzdem sieht das FBI diese Menschen als größte inländische terroristische Bedrohung an. Dieser völlig unverhältnismäßige Umgang mit der Tierrechts- und Umweltbewegung, einhergehend mit dem inflationären Gebrauch des Wortes „Terroristen“, wird oft „Green Scare“ genannt („grüne Gefahr“- in Anlehnung an die während der McCarthy-Ära beschworene „rote Gefahr“/Red Scare, Anm. SWB). Genau wie der „Red Scare“ mit seiner Hexenjagd auf KommunistInnen nutzt der „Green Scare“ ein Wort - dieses Mal ist es „Terrorist“ - um eine bestimmte politische Agenda zu verfolgen, Angst zu verbreiten und die Bewegung zu spalten.
Aber warum passiert das alles? Die Regierung und die Unternehmen machen gar keinen Hehl daraus, dass das alles geschieht, um die Profite der Multis zu schützen. So warnte das Heimatschutz-Departement die Exekutiv-Organe in einem Bulletin: „Von Tierrechtsextremisten und Öko-Terroristen verübte Attacken gegen Unternehmen verursachen den betroffenen Firmen hohe Kosten und können auf die Dauer das Vertrauen in die Wirtschaft erschüttern“. Und in einer geleakten PowerPoint-Präsentation des State Departements vor Konzernen hieß es: „Obwohl Ereignisse, die mit dem Terrorismus in Verbindung gebracht werden, die Schlagzeilen beherrschen, ist es der Tierrechtsextremismus, der Ihre gewöhnlichen Geschäftsoperationen am ehesten stören kann.
Darum geht die Regierung so hart gegen die militanten AktivistInnen vor. Angst. Es dreht sich alles um Angst. Es geht darum, die Profite der Unternehmen zu schützen, indem man den gemäßigten Tierrechts- und Umweltinitiativen - und allen anderen wachsamen sozialen Bewegungen - Angst macht, die ihnen zustehenden Rechte zu nutzen.
Industrie-Vereinigungen sagen über die „Green Scare“-Kampagne: „Das ist erst der Anfang“. Aber es könnte auch der Anfang für die AktivistInnen sein. Ich habe in den vergangenen Jahren mit Hunderten von AktivistInnen aus dem ganzen Land gesprochen. Da ist viel Angst. Aber da ist auch viel Wut. Und das ist gut. Denn die gegenwärtige Repressionswelle mag viele Taktiken des „Red Scare“ übernehmen, aber die Antwort darauf muss heutzutage eine andere sein. Es geht nicht an, sich feige von einer als Kommunist beziehungsweise Terrorist gebrandmarkten Person zu distanzieren. Das Denunzieren und Treue-Eide schwören half damals den AktivistInnen nicht und tut es auch heute nicht.
Der einzige Weg für die AktivistInnen und für die Grundrechte, diese Situation zu überstehen, besteht darin, offensiv damit umzugehen. Das bedeutet, den Durchschnittsbürgern zu erklären, dass es eine Verschwendung von Antiterrorismus-Ressourcen und eine Beleidigung der Opfer des 11. Septembers darstellt, AktivistInnen als TerroristInnen zu bezeichnen. Und das bedeutet, allen Engagierten klarzumachen, dass das Schicksal dieser AktivistInnen vielleicht nur vorwegnimmt, was uns allen blühen könnte.
Nur zusammen können wir verhindern, dass die Geschichte sich wiederholt.
Will Potter ist ein US-amerikanischer Journalist und Autor des Buches „Green is the new Red“.
Niederlage für BAYER
Gericht stoppt CO-Pipeline
Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hat am 25. Mai 2011 die Inbetriebnahme von BAYERs Kohlenmonoxid-Pipeline wegen ihrer mangelnden Erdbeben-Sicherheit untersagt.
Als vernachlässigbar hatte die Düsseldorfer Bezirksregierung die Erdbeben-Sicherheit von BAYERs CO-Leitung angesehen. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht teilte die Meinung der Genehmigungsbehörde nicht. Deshalb erklärte es Ende Mai 2011 den Planfeststellungsbeschluss zu der zwischen Dormagen und Krefeld geplanten Kohlenmonoxid-Pipeline für „rechtswidrig und vorerst nicht vollziehbar“. Nach Meinung von Richter Winfried Schwerdtfeger versäumte es die Behörde zu prüfen, ob die oberirdisch verlaufenden Rohr-Brücken Erschütterungen standhalten. Zudem warf das Gericht ihr vor, keine Untersuchung des Grundwasser-Standes unter der Trasse vorgenommen zu haben, obwohl ein besonders hoher Pegel im Zusammenspiel mit ungünstigen Bodenverhältnissen bei einem Beben zu Erd-Absackungen mit verheerenden Folgen für das Röhrenwerk führen kann.
„Bis auf die Knochen blamiert“ sehen die STOPP-BAYER-CO-PIPELINE-Intiativen nun BAYER, den TÜV als Gutachter und die Bezirksregierung, die sich dann auch bass erstaunt über die „völlig neue Rechtsauffassung der Kammer“ zeigte. Die Gruppen werteten das Urteil als „Etappen-Sieg“. Am Ziel wähnen sie sich noch nicht. Die JuristInnen haben dem Projekt nämlich zugebilligt, dem Allgemeinwohl dienlich zu sein, und deshalb keinen Anstoß an den Enteignungen entlang des Streckenverlaufes genommen. Zudem haben sie den Streckenverlauf trotz bestehender Alternativen abgesegnet und sich auch nicht an den teilweise schon rostenden Bau-Teilen gestört. „Denken Sie daran, wie rostig die Stahlstreben sind, die in Stahlbeton eingebaut werden. Das ändert an der Sicherheit des so entstandenen Hauses gar nichts“, hatte der Sachverständige dem Richter erfolgreich ins Gewissen geredet.
Darum akzeptieren die Anwohner, die gegen ihre Zwangsenteignung geklagt hatten, das Urteil nicht und gehen in Berufung. Die Bezirksregierung muss indessen ein Planergänzungsverfahren auf den Weg bringen. Die grüne Regierungspräsidentin Anne Lütkes kündigte an, dieses transparent und unter Einbeziehung der BürgerInnen gestalten zu wollen. Trotzdem macht BAYER gute Miene zum bösen Spiel. „Die geringfügigen Nachbesserungen zur Erdbeben-Sicherheit sind unproblematisch“, erklärte ein Konzern-Justiziar nach dem Urteil.
Der Gerichtsbeschluss dürfte den Genehmigungsprozess jedoch nochmals empfindlich verzögern. Schon seit Jahren ist die Inbetriebnahme der Leitung ausgesetzt, da das Oberverwaltungsgericht Münster im Dezember 2007 erhebliche Zweifel an der Gemeinnützigkeit des Projekts geäußert hatte. Zudem liegen noch mehr als 40 weitere Klagen vor. Aber der Widerstand beschränkt sich nicht auf die juristische Ebene. Die Bürgerinitiativen entlang der Trasse zeigen ein beeindruckendes Engagement und haben beispielsweise mehr als 110.000 Unterschriften gegen den Bau gesammelt. Die CBG hat auf den BAYER-Hauptversammlungen mehrfach Gegenanträge zu dem umstrittenen Projekt eingereicht. Sogar die Feuerwehren haben sich gegen das Vorhaben ausgesprochen, denn sie sehen sich außerstande, die Bevölkerung im Fall eines Gas-Austritts umfassend zu schützen. Und selbst innerhalb der Belegschaft des Leverkusener Multis gibt es Pipeline-GegnerInnen.
Der Pharma-Riese zeigt sich sichtlich überrascht von der breiten Ablehnung. Er hatte das Ganze lange als reine Formsache betrachtet. Schon bevor der nordrhein-westfälische Landtag das Rohrleitungsgesetz verabschiedete und die Bezirksregierung sich mit der Genehmigung befasste, hatte er Verträge über Gas-Lieferungen nach Krefeld mit LINDE geschlossen. Steif und fest behauptete BAYER stets, dass „Pipelines sowohl unter Sicherheits- als auch unter Umweltaspekten das beste Transportmittel“ wären, weil diese Schiffs- oder LKW-Frachten ersetzten. Tatsächlich finden auf diesen Wegen jedoch keine nennenswerten CO-Transporte statt. Nicht nur deshalb muss nach Auffassung der Coordination weiter das Prinzip gelten, Gefahrstoffe nur am Ort ihrer Verwendung zu produzieren. Und dies gilt umso mehr, als durch die Errichtung neuer Kunststoff-Fertigungsstätten in Dormagen dort nun gar kein überschüssiges Kohlenmonoxid mehr anfällt, das per Röhren-Verbund nach Krefeld geleitet werden könnte, denn genau das hatte der Global Player ursprünglich zur Begründung seiner Pläne angeführt.
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG), welche die BürgerInnen-Proteste Anfang 2006 mitinitiiert hatte, nimmt deshalb das Urteil des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts zum Anlass, abermals ein Ende des Projekts zu fordern. „Wir beglückwünschen die Kläger und die Bürgerinitiativen zu diesem großen Erfolg! Nun ist der Moment gekommen, dieses unselige Vorhaben zu beerdigen“, heißt es in ihrer Presseerklärung.
Von Philipp Mimkes und Jan Pehrke
AKTION & KRITIK
TESTBIOTECH kritisiert EFSA
Der Verein TESTBIOTECH hat Kritik an der Art und Weise, wie die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA die Risiken der Laborfrüchte von BAYER & Co. beurteilt, geübt. So unterlässt es die EFSA, die unlängst durch ihre Verfilzung mit den Gen-Giganten für Schlagzeilen sorgte (Ticker 2/11), die Wechselwirkung zwischen dem Erbgut der Pflanze, dem eingebauten Gen und der Umwelt zu untersuchen. Auch fehlen der Behörde klare Kriterien für ein Negativ-Urteil, monierte die Initiative.
CBG verlangt Phosgen-Verzicht
Der Leverkusener Multi will in Brunsbüttel und Krefeld seine Polycarbonat-Produktion erweitern, dabei aber weiterhin das gefährliche Vorprodukt Phosgen verwenden, obwohl es bereits seit langem Alternativ-Verfahren gibt. Dagegen hat die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN gemeinsam mit dem BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ protestiert. „Die Phosgen-Chemie gehört nach Atomkraftwerken zu den risiko-reichsten Technologien in Deutschland. Fukushima zeigt, dass das Undenkbare möglich ist! Das Risiko, jährlich Hunderttausende Tonnen eines Giftgases zu produzieren, ist schlichtweg zu hoch - zumal es Alternativen gibt. Wir fordern, dass neue Werke nach dem neuesten Stand der Technik gebaut werden müssen“, heißt es in der Presseerklärung.
Leserbrief zu Phosgen-Produktion
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hatte in Presse-Erklärungen die von BAYER in Brunsbüttel und Krefeld geplante Ausweitung der Polyurethan-Produktion kritisiert, weil der Leverkusener Multi dabei weiterhin auf ein Verfahren mit dem Giftgas Phosgen setzt, obwohl Alternativen bestehen (s. o.). Daran knüpfte eine Leserin der Brunsbütteler Zeitung an. Sie schrieb dem Blatt: „Ich frage mich, ob der Brunsbütteler Bevölkerung eigentlich bekannt ist, was BAYER dort plant und welche Auswirkungen das hochgiftige Phosgen-Gas haben kann. Dieses Gas - im 1. Weltkrieg als Kampfgas genutzt - ist für den Menschen schon in geringsten Dosen tödlich! Es ist bekannt, dass von BAYER in Brunsbüttel viele oder sehr viele Arbeitsplätze abhängen und daher evtl. niemand so recht wagt, etwas dagegen zu sagen. Aber eventuell toten - vielleicht vielen toten - Menschen nützen irgendwelche Arbeitsplätze dann auch nichts mehr“.
CBG-Leserbrief an die SZ
Der BAYER seit langen Jahren besonders zugetane Journalist Stefan Weber von der Süddeutschen Zeitung verfasste für die Serie „Starke Marken“ eine halbseitige ASPIRIN-Eloge, ohne sich weiter den Risiken und Nebenwirkungen des „Tausendsassas“ zu widmen. Das tat dann die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN in einem Leserbrief. „Der Wirkstoff greift tief in den biochemischen Haushalt des Körpers ein und kann u. a. Blutungen im Magen-Darm-Trakt und Magengeschwüre verursachen. Trotzdem versucht die BAYER AG das Präparat als Wunderpille zu vermarkten - zum Beispiel mit der website WonderDrug.com. Von den Gefahren findet sich in der Werbung kein Wort. Dabei sterben in den USA mehr Menschen an ASPIRIN-Nebenwirkungen als beispielsweise an HIV oder Verkehrsunfällen“, heißt es in der Zuschrift.
Proteste vor Brüsseler BAYER-Büro
Die TeilnehmerInnen der „Europäischen Saatguttage“, die Mitte April 2011 in Brüssel stattfanden, haben auch vor BAYERs Brüsseler Niederlassung demonstriert. Der Leverkusener Multi gehört nämlich zu den Hauptprofiteuren der von der EU geplanten Novelle des Saatgutrechts, will diese den LandwirtInnen doch untersagen, selber Saatgut in Verkehr zu bringen und so das Monopol der Agro-Riesen zementieren. Noch dazu sollen wichtige Prüfungen künftig in den Händen von BAYER & Co. oder in denen der von Industrie-VertreterInnen durchsetzten „Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit“ liegen (siehe auch Ticker 2/11). Zum Zeichen des Protestes gegen das Projekt haben die AktivistInnen den Europa-ParlamentarierInnen außerdem 51.416 Unterschriften übergeben.
KAPITAL & ARBEIT
Pharma-Fusion unter Gleichen?
Mit schöner Regelmäßigkeit stellt BAYER-Chef Marijn Dekkers Unternehmensteile zur Disposition. Hatte er im März 2011 die Bereitschaft erkennen lassen, die Kunststoff-Sparte zu veräußern, falls der Konzern Geld für eine Akquisition benötige, so zeigte er sich zwei Monate später gegenüber Veränderungen im Pharma-Bereich aufgeschlossen. „Wir würden möglicherweise einen Zusammenschluss unter Gleichen in der Healthcare-Sparte erwägen“, sagte er nicht irgendwo, sondern bei einem Besuch der Finanzagentur BLOOMBERG in New York. Bei einem solchen Joint-Venture wäre es leichter, die Prämie für die AktionärInnen zurückzuverdienen als bei Übernahmen, führte der Holländer laut Financial Times Deutschland aus. Allerdings stellt sich bei Deals dieser Art oftmals keine echte Parität ein. Einer der Partner ist nicht selten ein wenig gleicher als der andere.
„Pharma-Campus“ schrumpft
Als der Leverkusener Multi 2006 SCHERING übernahm, stellte er den Beschäftigten Vorteile aus dem Zusammenschluss in Aussicht. Die Realität sah jedoch anders aus. 1.000 Belegschaftsangehörige mussten sofort gehen. Mit dem neuen BAYER-Chef Marijn Dekkers brachen dann noch härtere Zeiten an. Er tilgte den Namen und unterstellte die Pillen-Schmiede direkt dem Kommando des Pharma-Chefs Jörg Reinhardt. Auch von dem Job-Abbau, den Dekkers kurz nach seinem Amtsantritt ankündigte, sind die BerlinerInnen in besonders hohem Ausmaß betroffen. Das alles „kann man nicht als Erfüllung der Zusage werten“, warf eine Angestellte dem Vorstandsvorsitzenden auf der Hauptversammlung im April 2011 deshalb vor. Sie fragte den Holländer ebenfalls nach der Zukunft der hochtrabenden „Pharma-Campus“-Pläne, in die nicht zuletzt der Senat der Hauptstadt große Hoffnungen steckt, weil er sich davon eine Sogwirkung auf andere Unternehmen verspricht. Der Ober-BAYER drückte sich um eine klare Antwort. Aber zwei Wochen später wurde der Konzern deutlicher. Er präsentierte eine deutlich abgespeckte Version des Masterplans; der Bau eines Hochhauses steht jetzt nicht mehr zur Debatte.
BAYER gliedert BBS aus
Der Leverkusener Multi gliedert Teile seiner IT-Sparte BAYER BUSINESS SERVICES aus; künftig übernimmt eine SIEMENS-Tochter die Dienstleistungen. Durch diese Maßnahme vernichtet BAYER im Konzern-Verbund die Arbeitsplätze von 260 Belegschaftsangehörigen und 290 LeiharbeiterInnen. Die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE kritisierte diesen Schritt deshalb scharf. „Offensichtlich verstehen die Arbeitgeber unter Wettbewerbsfähigkeit nur die Maximierung betriebswirtschaftlicher Kennziffern, mit denen sie die Finanzmärkte begeistern wollen“, so Reiner Hoffmann, Landesbezirksleiter der Gewerkschaft.
Job-Streichungen in Emeryville
Auch über sein im November 2010 beschlossenes Rationalisierungsprogramm hinaus vernichtet der Leverkusener Multi noch Arbeitsplätze. So stellt er die Fertigung des Multiple-Sklerose-Wirkstoffs Betaferon im US-amerikanischen Emeryville ein. Künftig übernimmt BOEHRINGER für BAYER die Herstellung. Die meisten der 540 Beschäftigten verlieren durch diese Maßnahme ihren Job. Damit bleibt der Konzern seiner Devise treu, bevorzugt Produktionen zu schließen, in denen sich Betriebsgruppen von Gewerkschaften konstituieren wollen. In Emeryville hatte das Unternehmen die Gründung hintertrieben, indem es mit Stellen-Streichungen drohte und die Beschäftigten-VertreterInnen als „Schmarotzer“ diffamierte, die es nur auf die Beiträge der Belegschaftsangehörigen abgesehen hätten.
Job-Streichungen in Leverkusen
Auch am Stammsitz Leverkusen streicht BAYER Stellen. Nach Informationen der Gewerkschaften will der Konzern 61 Arbeitsplätze in den der Geschäftsführung zuarbeitenden Corporate Centern vernichten.
Fabrik-Verkauf in Norwich
Im Rahmen seines Rationalisierungsprogramms will sich BAYER von seiner Pestizid-Fabrik im englischen Norwich trennen und stellt damit 280 Arbeitsplätze im Konzern zur Disposition. Der Leverkusener Multi, der 2010 noch elf Millionen Pfund in den Standort investiert hatte, sucht Werksleiter Tim Green zufolge einen Interessenten für die Produktionsanlagen. Er dürfte allerdings selbst kaum daran glauben, auch einen zu finden, denn als Käufer kämen nur vier, fünf Konzerne aus dem exklusiven Club des Agrochemie-Oligopols in Betracht - und nach Neuerwerbungen steht denen im Moment nicht der Sinn. Es besteht also die Gefahr, dass von Norwich nur eine Mensch, Tier und Umwelt schädigende Altlast übrig bleibt, wofür die Fertigungsstätte in Hauxton nahe Cambridge ein warnendes Beispiel abgibt (Ticker 2/10).
4,1 Prozent mehr Lohn
Die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE hat sich mit dem „Arbeitgeberverband Chemie“ auf eine Lohnerhöhung in Höhe von 4,1 Prozent geeinigt. Nach Berechnungen der KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN FÜR EINE DURCHSCHAUBARE BETRIEBSRATSARBEIT, eine alternative Gewerkschaftsgruppe im Leverkusener Werk, bleiben davon inflationsbereinigt zwei Prozent übrig. Auszubildende erhalten nach dem neuen Tarifvertrag, der eine Laufzeit von 15 Monaten hat, 35 Euro mehr. „Das Ergebnis ist weder überragend, noch ist es schlecht, es bewegt sich in einer Größenordnung, die man im Allgemeinen als moderat bezeichnen kann“, resümieren die Durchschaubaren das Ergebnis. Ihrer Ansicht nach fehlten auf der Verhandlungsagenda die Themen „gleicher Lohn für LeiharbeiterInnen“ und „Festgeld-Erhöhung“, also das Streiten für die Anhebung des Tarifs um einen bestimmten Betrag, was mehr Verteilungsgerechtigkeit verspricht. Von einem prozentualen Zuwachs profitieren die oberen Einkommensgruppen nämlich mehr als die unteren.
Zehn Millionen für den Vorstand
Der Vorstand des Leverkusener Multis darf sich über üppige Bezüge freuen. Mehr als zehn Millionen Euro strich die Riege im Geschäftsjahr 2010 ein - über eine Million Euro mehr als 2009. Allein BAYER-Chef Marijn Dekkers erhielt fast vier Millionen Euro. Erstmals orientiert sich die Hälfte der variablen Vergütung an der Entwicklung der BAYER-Aktie während eines Zeitraums von drei Jahren, aber gnädigerweise hat der Konzern zweien seiner Vorstände für die „System-Umstellung“ noch einen Aufschlag von fünf Prozent gewährt.
BAYER zahlt Ex-Manager Entschädigung
BAYERs Top-ManagerInnen können mit einer Lohnfortzahlung im Ausscheidungsfall rechnen. Weil die Führungskräfte nicht direkt vom Leverkusener Multi zur Konkurrenz wechseln dürfen, erhalten sie dafür beim Abschied eine Art Schmerzensgeld. So zahlte der Global Player seinem im April 2010 ausgeschiedenen Finanz-Vorstand Klaus Kühn laut Geschäftsbericht 765.000 Euro „als Entschädigung für dieses Wettbewerbsverbot“.
BAYER gliedert Werksschutz aus
BAYER CROPSCIENCE hat am Stammsitz Monheim den Werksschutz ausgegliedert. Fortan übernehmen - wie bereits im Brunsbütteler BAYER-Werk - Beschäftigte des Sicherheitsunternehmens VSU diese Aufgabe. „Damit leisten wir einen Beitrag zur Verbesserung der Kosten-Situation an den rheinischen und niederrheinischen BAYER-Standorten“, so die Landwirtschaftssparte zur Begründung des Schrittes. Betriebsrat und Chemie-Gewerkschaft kritisieren die Maßnahme scharf. „Wir schätzen, dass die immerhin über eine formale Ausbildung verfügenden künftigen Werksschützer einen Stundenlohn zwischen zwölf und dreizehn Euro erhalten. Das liegt deutlich unter der niedrigsten Lohnstufe, in die zum Beispiel Produktionshelfer in der Chemischen Industrie eingestuft werden“, moniert der Betriebsratsvorsitzende Oliver Zühlke. Von „Lohndumping in stark sensiblen Tätigkeitsfeldern“ spricht er deshalb. Die 17 bisherigen WerksschützerInnen erhalten nach BAYER-Angaben andere Job-Angebote im Konzern.
Wenning EON-Aufsichtsratschef
Der ehemalige BAYER-Chef Werner Wenning wäre nach seiner Amtszeit am liebsten bruchlos Aufsichtsratsvorsitzender beim Leverkusener Multi geworden. Das erlauben jedoch die Gesetze nicht mehr. Also trainiert er bis zur Rückkehr an die alte Wirkungsstätte schon einmal bei anderen Konzernen. So leitet er seit 2010 den EON-Aufsichtsrat und sitzt bei der DEUTSCHEN BANK, HDI und TALANX in den Kontrollgremien. Darüber hinaus gehört er den Gesellschafter-Ausschüssen von HENKEL und BAYER Leverkusen an und ist Vize-Präsident des „Verbandes der Chemischen Industrie“.
Neues Projekt der BASIS-BETRIEBSRÄTE
Mitglieder der BASIS-BETRIEBSRÄTE, einer alternativen Gewerkschaftsgruppe im Leverkusener BAYER-Werk, haben das Projekt „Wechselwirkung LEV“ ins Leben gerufen. Es hat sich zum Ziel gesetzt, ein gemeinsamer Anlaufpunkt für Erwerbslose, prekär Arbeitende und regulär Beschäftigte in der Stadt zu werden. „Alle Leute, die unbequem sind, die raus sind aus dem Chemie-„Park“ oder in sonstiger Weise nicht der Gewerkschaft angepasst sind“, sollen dort nach den Worten des Mitinitiators Nikolaus Roth zusammenkommen. Auch der Zersplitterung der BAYER-Belegschaft, die sich inzwischen auf die unterschiedlichsten Tochter-Gesellschaften mit den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen verteilt und so die oppositionelle Betriebsratsarbeit erschwert, will Roth durch die „Wechselwirkung LEV“ entgegenwirken.
ERSTE & DRITTE WELT
Immer mehr Menschenversuche
BAYER & Co. gehen in immer früheren Test-Phasen dazu über, Medikamente an Menschen zu erproben. Die Pharma-Riesen wollen schneller belastbare Informationen über die Praxis-Tauglichkeit einer neuen Arznei erhalten und so Entwicklungskosten sparen. Als Reservoir für die Versuchsreihen dienen vornehmlich die Länder der „Dritten Welt“. Dort locken ein großes Reservoir an ProbandInnen, unschlagbare Preise, schnelle Verfahren und eine mangelhafte Aufsicht (SWB 2-3/10). Zu einem der beliebtesten Staaten für dieses Geschäft hat sich mittlerweile Indien entwickelt. BAYER lässt dort unter anderem das Multiple-Sklerose-Medikament BETAFERON, die Hautgeschwür-Arznei IMPAVIDO sowie vier Krebs-Präparate großflächig erproben.
Klagerecht für BAYER & Co.
Die Europäische Union schließt fleißig Freihandelsabkommen ab (SWB 2/11). Die Verträge mit Kolumbien, Peru und Südkorea sind schon unterschrieben, ein Abschluss mit Indien steht noch in diesem Jahr an. BAYER & Co. haben die Agenda der EU bei den Verhandlungen entscheidend mitbestimmt und profitieren entsprechend von den Ergebnissen wie strengere Patent-Regeln, freiere Marktzugänge, mehr Investitionsschutz, Gleichbehandlung mit inländischen Unternehmen und verbesserte Zugriffe auf Rohstoffe. Und jetzt geht die EU noch einen Schritt weiter. Sie räumt den Konzernen bei bilateralen Investitionsabkommen ein Klagerecht gegen Umwelt- und Sozialgesetze der Vertragspartner ein. „Diese Investitionsabkommen hebeln die Demokratie aus. Konzerne haben dadurch häufig mehr Rechte als Regierungen. Sie sind eine Gefahr für jede ökologische und soziale Politik und das öffentliche Interesse“, kritisiert deshalb Roland Süß von ATTAC.
POLITIK & EINFLUSS
Üppige Parteispenden des VCI
Der Leverkusener Multi spendet in der Bundesrepublik nicht selber an politische Parteien, um den Eindruck direkt gekaufter Entscheidungen zu vermeiden. Er überlässt diesen Job dem „Verband der Chemischen Industrie“ (VCI). Die jüngst veröffentlichen Rechenschaftsberichte von CDU, SPD und FDP weisen für das Wahlkampf-Jahr 2009 üppige Zuwändungen von Seiten des Lobby-Clubs aus. Die ChristdemokratInnen bekamen 228.000 Euro, die Liberalen 118.000 Euro und die SozialdemokratInnen 56.000. Bündnis 90/Die Grünen und „Die Linke“ erhielten nichts.
Dekkers bei Merkel
Kaum hatte Marijn Dekkers beim Leverkusener Multi den Chef-Sessel übernommen, da machte er auch schon seinen Antrittsbesuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Visite „diente dem gegenseitigen Kennenlernen, aber auch bereits der ersten Diskussion wichtiger politischer und wirtschaftlicher Fragen“, hielt BAYERs Propaganda-Postille direkt fest.
Yu Zhengsheng bei BAYER
Im April 2011 besuchte Yu Zhengsheng, der Parteisekretär von Shanghai, BAYERs Konzern-Zentrale in Leverkusen und sprach mit dem Vorstandsvorsitzenden Marijn Dekkers und anderen Managern über die Bauvorhaben des Global Players in China.
Krüger im Wissenschaftsministerium
Obwohl Nano-Teilchen eine asbest-ähnliche Wirkung entfalten können, hat die nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin Svenja Schulze die neue Technologie zur Chef-Sache erklärt und fördert Forschung & Entwicklung in diesem Bereich mit 50 Millionen Euro bis 2050. Da bleiben wiederholte Treffen mit BAYER-ManagerInnen nicht aus. So lud sie im Mai 2011 den „Expertenkreis Nano-Technologie zu einem „Runden Tisch“ ins Wissenschaftsministerium ein, dem auch Péter Krüger von BAYER MATERIAL SCIENCE angehört. Zum Sinn und Zweck des Meetings erklärte dieser: „Die Nanotechnologie gehört zu den Zukunftsthemen schlechthin. Es wird erwartet, dass im Jahr 2015 die Eigenschaften von 15 bis 20 Prozent der weltweit produzierten Güter wesentlich durch Nano-Technologie bestimmt sein werden. Dabei liegt es auf der Hand, dass echte Entwicklungsoptionen über die Grenzen von rein technologischen und ökonomischen Aspekten hinaus gedacht werden müssen.“
SPDlerInnen bei BAYER
Im Januar besuchten hochrangige nordrhein-westfälische SPD-Landespolitiker das Bergkamener BAYER-Werk. Der Fraktionsvorsitzende Norbert Römer, der wirtschaftspolitische Sprecher Thomas Eiskirch und der Wahlkreis-Abgeordnete Rüdiger Weiß lobten trotz eines Kohlendioxid-Ausstoßes von acht Millionen Tonnen im Geschäftsjahr 2009 die Umweltschutz-Anstrengungen des Leverkusener Multis und versicherten dem Konzern ihren Beistand bei so umstrittenen Projekten wie der Kohlenmonoxid-Pipeline und Kohlekraftwerken. „Speziell forschungsorientierte Unternehmen geben vielfach positive Impulse für die gesamte Gesellschaft. Deshalb braucht die Politik gerade dort starke Partner“, so Römer.
Weiter Druck auf Remmel
Die rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hatte bei ihrem Amtsantritt 2010 unter anderem ein Klimaschutz-Gesetz angekündigt - angesichts eines NRW-Anteiles an den bundesweiten Kohlendioxid-Emissionen von 33 Prozent eine überfällige Maßnahme. Nach einem ersten Entwurf nimmt sich Rot-Grün vor, den CO2-Ausstoß im Land bis 2020 um 25 Prozent und bis 2050 um 80 bis 90 Prozent zu senken. Ein Klimaschutzplan soll regeln, wieviel jede Branche noch emittieren darf und auch als Maßstab für die Bewilligung neuer Anlagen dienen. Sofort nach Bekanntwerden der Pläne brach ein Sturm der Entrüstung los (Ticker 2/11), der sich auch nicht mehr legte. So gab „Unternehmer NRW“, der Interessensverband von BAYER & Co., ein Gutachten in Auftrag, das in dem Paragraphen-Werk einen Verstoß gegen die Verfassung sah. Die politischen Interventionen verfehlen ihren Einfluss auf die SozialdemokratInnen nicht. Deren wirtschaftspolitischer Sprecher Thomas Eiskirch, gern gesehener Gast bei BAYER (s. o.), erklärte bereits: „Ein Klimaschutzziel von 80 bis 90 Prozent gibt es so im Gesetz nicht“. Das Vorhaben dürfte den Landtag also kaum ohne „Nachbesserungen“ passieren.
Voigtsberger bei BAYER
Der NRW-Wirtschaftsminister Harry Voigtsberger (SPD) besuchte die Zusammenkunft des nordrhein-westfälischen Chemie-Verbundes „ChemCologne“ im Leverkusener Baykomm und hielt dort einen Vortrag zum Thema „Bedeutung und Zukunft der Chemie-Industrie in NRW“.
Birgit Fischer neue VFA-Chefin
Die frühere BAYER-Angestellte Cornelia Yzer musste den GeschäftsführerInnen-Posten beim „Verband der Forschenden Arzneimittel-Hersteller (VFA), den der Leverkusener Multi mitgegründet hat, räumen (Ticker 2/11). Die Pharma-Riesen werfen ihr vor, die im Zuge des „Gesetzes zur Neuordnung des Arzneimittel-Marktes“ (AMNOG) beschlossene Erhöhung des Krankenkassen-Rabattes für neue Medikamente ebenso wenig verhindert zu haben wie ein Ende der Preisfindung nach Gutsherren-Art und eine Kosten/Nutzen-Bewertung für Medikamente. Ihr folgt die frühere SPD-Gesundheitsministerin von Nordrhein-Westfalen, Birgit Fischer, nach, die das AMNOG in ihrer früheren Position als Chefin der BARMER-Krankenkasse noch als zu industrie-freundlich kritisiert hatte. BAYER-Vorstand Wolfgang Plischke erklärte in seiner Funktion als VFA-Vorsitzender die überraschende Personalie mit der Notwendigkeit, den Dialog mit allen AkteurInnen der Gesundheitsbranche zu intensivieren. Der CDU-Gesundheitspolitiker Jens Spahn vermutet indes ganz andere Motive hinter der Verpflichtung Fischers: „Da wettet ein Verband 30 Monate vor der Bundestagswahl gegen die amtierende Regierung auf einen Wechsel“.
Große Entrup „econsense“-Boss
Wolfgang Große Entrup ist der Umweltpolitiker des Leverkusener Multis. Er steht dem BAYER-Stab „Politik und Umwelt“ vor und leitet die Umweltkommission beim CDU-Wirtschaftsrat, den industrie-hörige ChristdemokratInnen in den 1960er Jahren präventiv aus Angst vor einem Linksschwenk Konrad Adenauers gegründet hatten. Seit kurzem hat Große Entrup noch einen Posten inne. Er hat den Chefsessel bei „econsense“ eingenommen, einer auf anti-ökologisches Lobbying spezialisierten Ausgründung des „Bundesverbandes der deutschen Industrie“.
Thomas sitzt „Plastics Europe“ vor
Patrick Thomas, der Chef von BAYER MATERIAL SCIENCE, hat den Vorsitz des Verbandes „Plastics Europe“ übernommen, der die Interessen der Kunststoff-Hersteller auf europäischer Ebene vertritt.
Agrar-Subventionen für Bauer BAYER
Die EU bedenkt den Leverkusener Multi seit geraumer Zeit üppig mit Agrar-Subventionen. 183.000 Euro strich der Konzern im letzten Jahr ein. Das Geld dürfte wie ehedem BAYERs Laarcher Hof in Monheim bekommen haben, der als klassischer Ackerbau-Betrieb firmiert, obwohl er nur eine Versuchsküche für die Pestizide des Konzerns ist.
BAYERs Griechenland-Geschäfte
Von dem Geld im zweistelligen Millionen-Bereich, das griechische Hospitäler ihm schuldeten, musste der Leverkusener Multi jüngst rund 20 Prozent abschreiben. Trotzdem will der Konzern auf diesen Markt auch künftig nicht verzichten, darum lässt er seinen KundInnen ab 2010 ein Jahr Zeit, ihre Rechnungen zu begleichen.
Andere bundesdeutsche Unternehmen warten ebenfalls auf Überweisungen aus dem südosteuropäischen Land, weshalb BAYER & Co. natürlich ein vitales Interesse an den Zahlungsfähigkeit gewährleistenden Milliarden-Krediten haben.
Politikbrief mit Prominenten
„Mit dem BAYER-Politikbrief Beitrag bringen wir unsere Expertise in die politische Debatte in Deutschland ein“, so charakterisiert der Leverkusener Multi Sinn und Zweck seiner Publikation, die sich an „politische Entscheider auf Bundes- und Landesebene sowie Wissenschaft, Wirtschaft und Medien“ wendet. Eine weitere Funktion der Veröffentlichung ist es, Personen mit einflussreichen Posten als AutorInnen zu gewinnen. So schreibt im neuesten Politikbrief mit Namen „re:source“ Achim Steiner vom Umweltprogramm der UN, dessen offizieller Partner BAYER ist, über den Klimagipfel von Kopenhagen. Hans-Jörg Bullinger, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft prophezeit: „In der Krise erneuert sich die Wirtschaft“ und Michael Vassiliadis von der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE unterbreitet den Lösungsvorschlag: „Mit Forschung und Sozialpartnerschaft aus der Krise“.
PROPAGANDA & MEDIEN
5,5 Mio. an Hämophilie-Verbände
Bluter-Verbände beschenkt BAYER reichlich, gilt es doch, vergessen zu machen, dass in den 90er Jahren Tausende Bluter an HIV-verseuchten Blutprodukten des Konzerns starben, weil das Unternehmen sein Präparat KOGENATE aus Kostengründen keiner Hitze-Behandlung unterzogen hatte. Von den 57 Millionen Euro, die der Leverkusener Multi 2010 für „wohltätige Zwecke“ ausgab, erhielten Hämophilie-Organisationen fast zehn Prozent: 5,5 Millionen Euro, wie BAYER-Chef Marijn Dekkers auf der Hauptversammlung im April 2011 bekannt gab.
Kraft zeichnet Baykomm aus
BAYER gehörte 2006 zu den Sponsoren der Kampagne „Land der Ideen“, welche die Fußball-Weltmeisterschaft dazu nutzte, um für den Industrie-Standort zu werben. Der PR-Betrieb hat die Ball-Treterei sogar überlebt und veranstaltet zum Beispiel noch den Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“. Als einen dieser Orte haben die InitiatorInnen nun mit dem Baykomm das Kommunikationszentrum des Leverkusener Multis ausgezeichnet - sie wissen offenbar, was sie ihren Geldgebern schuldig sind. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft überreichte die Auszeichnung und pries das Propaganda-Forum des Konzerns dafür, „Besucher jeglichen Alters mit Wissenschaft und Forschung vertraut zu machen“.
Dekkers kritisiert Sicherheitsdenken
BAYER-Chef Marijn Dekkers kritisiert das angeblich übertriebene Sicherheitsdenken in der Bundesrepublik. Die Reaktion auf die Atom-Katastrophe in Japan hält er für überzogen, und eine andere Risiko-Kultur, wie sie der BOSCH-Vorstandsvorsitzende Franz Fehrenbach gefordert hat, braucht es für die Chemie seiner Meinung nach nicht. Die Branche habe ihre Lektion seit Seveso und Bhopal gelernt, meint der Holländer - trotz der Großexplosion in BAYERs Bhopal-Referenzwerk Institute vom August 2008. Nur etwas kleinlaut räumte Dekkers ein: „Aber auch für uns gilt: Ein Restrisiko lässt sich leider niemals ganz ausschließen“. In der Gentechnik hat der Konzern damit schon Bekanntschaft machen müssen. Im Jahr 2006 suchte gentechnisch veränderter Langkorn-Reis des Gen-Giganten weltweit die Supermärkte heim. Trotzdem bekennt sich der Ober-BAYER weiterhin wacker zu dieser Technologie. „Weltweit haben Menschen inzwischen mehr als zwei Billionen Mahlzeiten mit gentechnisch veränderten Produkten verzehrt, ohne dass sie irgendwelche Schäden erlitten hätten“, so der Manager.
Dekkers für Forschungsförderung
Hatte schon der frühere BAYER-Chef Werner Wenning bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit für eine steuerliche Absetzbarkeit von Forschungsausgaben geworben, so erweist sich Marijn Dekkers als würdiger Nachfolger. In einem Handelsblatt-Beitrag forderte er die Politik angesichts der andernorts schon lange üblichen Forschungsförderung zum Handeln auf und sparte selbst mit Drohungen nicht: „Es liegt auf der Hand, dass solche Unterschiede auch bei Standort-Entscheidungen den Ausschlag geben können“. Umgekehrt wird für ihn kein Schuh draus: Dem Vorstoß der Bundesregierung, innerhalb der EU für einen Subventionsabbau auf diesem Sektor zu werben, kann Dekkers nichts abgewinnen.
BAYER „bester Apotheken-Partner“
Die Pharma-DrückerInnen des Leverkusener Multis leisten in den Pharmazien ganze Arbeit. Das sehen jedenfalls die ApothekerInnen so, die sich an der Umfrage des Branchenblattes PharmaRundschau beteiligten. Sie zeigten sich mit der persönlichen Betreuung durch die Außendienst-MitarbeiterInnen, dem Service und der Leistungsfähigkeit des Konzerns zufrieden und wählten den Pillen-Riesen in den Kategorien „Schmerzmittel“ und „Antipilzmittel“ zum „besten Apotheken-Partner“. Zweite Plätze gab es jeweils beim DiabetikerInnen-Bedarf, bei der Wund- und Brandversorgung sowie bei den Grippe- und Magen/Darmmitteln. Ein Grund für den innigen Bund dürften die hohen Preise der BAYER-Mittel sein, die den PharmazeutInnen hohe Margen versprechen. Im Fall von ASPIRIN hatten 11.000 von 21.000 bundesdeutschen Apotheken im Jahr 2007 sogar Kartell-Absprachen mit dem Pharma-Riesen getroffen und sich dazu verpflichtet, keine Billig-Angebote zu machen, wenn der Hersteller ihnen dafür im Gegenzug großzügige Rabatte gewährt. Darüber hinaus pflegt der Global Player die pharmazeutische Landschaft auch noch mit einem Schulungs- und Forschungszentrum.
BAYER VITAL stockt Werbeetat auf
BAYER VITAL, die für rezeptfreie Arzneien zuständige Abteilung des Leverkusener Multis, hat 2010 nach Angaben des Fachmagazins Healthcare Marketing allein in der Bundesrepublik mit 54,39 Millionen Euro bedeutend mehr für Reklame ausgegeben als im Vorjahr. Nur KLOSTERFRAU investierte mehr. TV-Werbung und Anzeigen in Publikumszeitschriften schluckten dabei den Löwen-Anteil des Etats, aber immerhin schon sieben Prozent der Aufwändungen flossen in den Online-Bereich.
GynäkologInnen preisen YASMIN
BAYER sponsert die kanadische GynäkologInnen-Gesellschaft großzügig. Zum Dank dafür griffen die MedizinerInnen beim Verfassen einer Aufklärungsschrift über Verhütungsmittel auf Werbematerial des Leverkusener Multis zurück. Sie übernahmen einzelne Passagen sogar wortwörtlich und priesen YASMIN & Co. als Mittel gegen Akne und Migräne. Über die Embolie-Gefahr, die von den Mitteln ausgeht - allein die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA registrierte in den letzten zehn Jahren 190 Sterbefälle - fand sich natürlich nichts in der Broschüre.
US-Star preist BEYAZ
Trotz zahlreicher Todesfälle setzt BAYER weiter auf Kontrazeptiva aus der YASMIN-Familie. Weil für die Präparate der Patentschutz ausläuft, bringt der Leverkusener Multi nun Varianten mit geringfügigen Abweichungen auf den Markt. So hat er in den USA für BEYAZ die Zulassung erhalten, das zusätzlich zu dem berühmt-berüchtigten YAZ-Wirkstoff Drospirenon noch Vitamine aus dem B-Komplex enthält, um einer angeblichen Unterversorgung bei späteren Schwangerschaften und daraus resultierenden Geburtsfehlern vorzubeugen. Für die Produkteinführungskampagne in den USA hat der Konzern die Schauspielerin und Moderatorin Vanessa Minnillo verpflichtet.
LoveGent wirbt für LEVITRA
Mit einem „Emag für den Gentleman 2.0“ wirbt BAYER im Internet für seine Potenz-Pille LEVITRA. Einschlägige Artikel auf LoveGent zu den Themen „Die schnelle Nummer“, „Männerspielzeug“ oder „Prostitution“ und der eingekaufte „Experten“-Rat von Prof. Dr. Frank Sommer sollen den Kundenstamm für sein Lifestyle-Präparat erweitern. Angaben zu den Risiken und Nebenwirkungen des Präparats wie temporärer Gedächtnisverlust, zeitweilige oder dauerhafte Hörschäden, Sehstörungen bis zum Sehverlust, Schwindel, Höhenangst, Kopfschmerzen, Nasenschleimhaut-Entzündungen, Grippe-Symptome sowie Gesichtsrötungen finden sich deshalb auf der Website nicht.
Etikettenschwindel mit „Was ist was“
Der vom Leverkusener Multi mitgegründete „Verband der Forschenden Arzneimittel-Hersteller“ nutzt die Popularität der Kindersachbuch-Reihe „Was ist was“, um Reklame für die Pharma-Riesen zu machen. „Was ist was - Wie entsteht ein Medikament?“ heißt das Machwerk ohne Risiken und Nebenwirkungen. In einer Auflage von 30.000 Exemplaren gedruckt, wollen BAYER & Co. damit vor allem Schulklassen beglücken; im offiziellen Buchhandel vertreibt es der TESSLOFF-Verlag nicht. „Die Pharma-Industrie ist sehr stark daran interessiert, eine wissensneutrale Marke wie Was ist was zu nutzen“, sagt die Verlagssprecherin zu dem Deal, der dem Haus durchaus „Bauchschmerzen“ bereitet habe.
Mehr Marketing, weniger Forschung
Aller Lippenbekenntnisse zur Wichtigkeit der Forschung zum Trotz erhöht der Leverkusener Multi die entsprechenden Ausgaben 2011 nicht. Er friert sie stattdessen bei 3,1 Milliarden Euro ein. Zudem nimmt der Konzern auch noch Umschichtungen im Etat vor und knappst mehr Geld für das Marketing ab. „Die neuen Produkte müssen schließlich auch verkauft werden“, so BAYER-Chef Marijn Dekkers. Die Westdeutsche Zeitung beschleichen da böse Ahnungen. „Bei der intensiveren Vermarktung von Medikamenten will er einen weiteren Schwerpunkt setzen. Das riecht nach Mauscheleien zwischen Pharma-Firmen, Ärzten und Apothekern. Davon sollte Dekkers lieber die Finger lassen“, schreibt das Blatt.
Mehr Arzneien für „Nutztiere“
„Während wir in der Vergangenheit den Hobbytieren größere Priorität eingeräumt haben, verstärken wir seit einigen Jahren wieder deutlich unser Engagement im Nutztier-Bereich“, sagt BAYERs Tiergesundheitschef Thomas Steffens. Zu diesem Behufe hat der Leverkusener Multi eine „Nutztier-Akademie“ gegründet mit Fortbildungsveranstaltungen für TierärztInnen und LandwirtInnen, ein neues Web-Portal aufgebaut und zu dem Podiumsgespräch „Gesunde Tiere, gesunde Lebensmittel“ mit „80 Meinungsbildnern aus Politik, Wissenschaft, Verbänden und Medien“ geladen.
Noch mehr „Global Compact“
Mit BAYER, DAIMLER/CHRYSLER, SHELL und 47 anderen Global Playern unterzeichnete der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan Ende Juli 2000 in New York den „Global Compact“, eine unverbindliche Vereinbarung zur Umsetzung internationaler Menschenrechts-, Sozial- und Umweltstandards (Ticker 4/00). Im Gegenzug berechtigt die Unterschrift BAYER & Co., mit dem UN-Emblem für Konzern-Produkte zu werben und so „Bluewashing“ zu betreiben. Mehrmals kritisierte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN die Zusammenarbeit des „Global Compact“ mit BAYER, aber die Organisation stieß sich weder an Kinderarbeit bei den indischen Zulieferern des Multis noch an seinem Katastrophen-Management nach der Explosion im Instituter Werk. Und weil eine so verstandene Nachhaltigkeit den Unternehmen richtig Spaß macht, beschlossen sie auf ihrem jährlichen Klassentreffen beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos eine Ausweitung ihrer Nichtaktivitäten und starteten im Beisein von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon die Initiative LEAD.
BMZ fördert Kontrazeptiva-Absatz
„Fünf gegen das Wachstum der Bevölkerung investierte Dollar sind wirksamer als hundert für das Wirtschaftswachstum investierte Dollar“, sagte einst der ehemalige US-Präsident Lyndon B. Johnson über seine Vorstellung von „Entwicklungshilfe“. Zur großen Befriedigung BAYERs erfreut sich diese Ansicht auch heute noch großer Beliebtheit, die „gigantischen Fruchtbarkeitsmärkte“ in den armen Ländern versprechen nämlich gute Absatzchancen für die Verhütungsmittel des Konzerns. Um die Geschäftsaussichten für YASMIN & Co. noch ein wenig zu verbessern, sponsert das Unternehmen seit geraumer Zeit die „Deutsche Stiftung Weltbevölkerung“. Diese öffnet im politischen Berlin nämlich Türen. So hat der Pharma-Riese gemeinsam mit der Stiftung einen parlamentarischen Abend veranstaltet, an dem Gudrun Kopp (FDP), parlamentarische Staatssekretärin im Entwicklungshilfe-Ministerium, teilnahm. Und die Liberale brachte gleich die frohe Kunde mit, dass die Regierungskoalition 400 Millionen Euro „vor allem für Vorhaben zur Förderung der Familienplanung und Frauengesundheit“ bereitstellen will. Internationale Geld-Töpfe kann das Unternehmen ebenfalls anzapfen: Die UN bestellte jüngst Pillen für 25 Millionen Dollar beim Pharma-Riesen (Ticker 4/10).
Deutschland-Stipendium mit BAYER
Die PolitikerInnen flankierten die Einführung von Studien-Gebühren mit der Versicherung, gemeinsam mit der Wirtschaft Modelle zur Studien-Förderung zu entwickeln. Löhnen dürfen die Studierenden zwar mittlerweile, wenn auch einige Bundesländer das Bezahlsystem wieder abgeschafft haben, aber mit dem Studier-Sponsoring hapert es noch gewaltig. So kommen an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität gerade einmal 70 von 42.790 Immatrikulierten in den Genuss des so genannten Deutschlandstipendiums. Mit dieser Private-Public-Partnership zwischen Bundesforschungsministerium und Wirtschaftsunternehmen wollte Ministerin Annette Schavan eine „neue Ära der Stipendienkultur“ begründen, viel mehr als eine PR-Maßnahme für die ihre Portokasse öffnenden Konzerne sprang allerdings nicht dabei heraus. Mit gerade einmal 9.000 Euro engagiert sich BAYER in München. Eine „subventionierte Werbekampagne“ nennt das Webportal telepolis das Deutschland-Stipendium deshalb.
Neue „Pro Industrie“-Kampagne
Die massenhafte Kritik an Großprojekten wie der Kohlenmonoxid-Pipeline und Kohlekraftwerken hat den Leverkusener Multi dazu bewogen, eine Gegen-Kampagne zu starten. Der Konzern gehört zu den Mitinitiatoren der „Knechtstedener Erklärung“, die dem schlechten Image von BAYER & Co. im Raum Neuss/Dormagen entgegentreten will. „Die Akzeptanz in der Bevölkerung für unsere Industrie zu stärken und auszubauen, stellt das gemeinsame Ziel aller Beteiligten dar, damit unser Wohlstand auch in Zukunft erhalten werden kann“, heißt es in dem Papier.
TIERE & ARZNEIEN
Bakterien im Fleisch
Die in der Massentierhaltung massenhaft verwendeten Antibiotika von BAYER & Co. lassen immer mehr Krankheitserreger immun gegen die Mittel werden. Darum breiten sich Bakterien-Stämme im Fleisch stark aus. In den USA fanden ForscherInnen Ableger des Staphylococcus aureus in fast der Hälfte aller Proben. In Holland stießen WissenschaftlerInnen in 40 Prozent der Ställe auf Infektionsträger. Besonders in Schweinen siedelten sie sich gerne an; 80 Prozent der Tiere beherbergten Keime. Auslauf fanden diese dann allzu oft im Organismus von LandwirtInnen und Stallpersonal. Aber auch über die Nahrungskette können sie in den menschlichen Körper gelangen. Und es fällt immer schwerer, Staphylococcus & Co. dort unschädlich zu machen, denn die Antibiotika-Wirkstoffe aus der Human-Medizin haben für sie schon in den Tierfabriken ihren Schrecken verloren.
BAYCOX für Schafe
Die Behörden haben BAYCOX, BAYERs Mittel zur Therapie der von Parasiten ausgelösten Krankheit Kokzidiose, jetzt auch zur Behandlung von Schafen zugelassen. Laut Aussage des Konzerns genügt das Schlucken einer einzigen Dosis, „um die Kokzidiose erfolgreich zu bekämpfen und wirtschaftliche Schäden zu beschränken“.
Forschung an Altem
Forschung bei BAYER hat nicht unbedingt den Zweck, Neues zu entwickeln. Wenn der Ablauf der Patent-Laufzeit von Arzneien und damit Konkurrenz von Nachahmer-Präparaten droht, bemüht sich der Leverkusener Multi stets mit großem Aufwand, kleine Veränderungen in der Rezeptur oder der Verabreichungsform vorzunehmen, um erneut den lukrativen Schutz des geistigen Eigentums reklamieren zu können. „Schon heute geben wir rund ein Drittel unseres Forschungs- und Entwicklungsbudgets dafür aus, unser bestehendes Sortiment zu verteidigen“, sagt BAYERs Tiergesundheitschef Thomas Steffens.
DRUGS & PILLS
Todesfälle durch CIPROBAY
BAYERs Antibiotikum CIPROBAY mit dem Wirkstoff Moxifloxacin, der zur Gruppe der Fluorchinolone gehört, kann tödlich wirken. Die US-Gesundheitsbehörde FDA registrierte in den letzten zehn Jahren 1.000 Sterbefälle und 14.000 schwere Nebenwirkungen durch Arzneien aus dieser Medikamenten-Gruppe. Ihr englisches Pendant weist von Januar 2000 bis März 2011 46 Tode aus. Am häufigsten treten Gesundheitsschäden im Bereich der Sehnen, Knorpel, Muskeln und Knochen auf. Auch Störungen des Zentralen Nervensystems, die sich in Psychosen, Angst-Attacken, Verwirrtheitszuständen, Schlaflosigkeit oder anderen psychiatrischen Krankheitsbildern manifestieren, beobachten die MedizinerInnen. Darüber hinaus sind CIPROBAY & Co. für Herzinfarkte, Unterzuckerungen, Hepatitis, Autoimmun-Krankheiten, Leber- oder Nierenversagen und andere Organ-Schädigungen verantwortlich. In den USA musste der Leverkusener Multi deshalb bereits im Jahr 2008 Warnhinweise auf den Packungen anbringen.
Neue Studien bestätigen YASMIN-Risiko
Gleich zwei neue Studien aus Neuseeland und den USA haben BAYERs Verhütungsmittel YASMIN und anderen drospirenon-haltigen Pillen ein erhöhtes Thrombose-Risiko bescheinigt und damit die Ergebnisse älterer Untersuchungen bestätigt. Bis um den Faktor drei steigt unter YASMIN im Vergleich zu älteren Präparaten die Wahrscheinlichkeit, sich einen Venen-Verschluss zuzuziehen, so die WissenschaftlerInnen, die nur die Daten von Frauen ohne Vorerkrankungen und Belastungsfaktoren wie Übergewicht ausgewertet haben. Der Leverkusener Multi bescheinigt ihrer Arbeit trotzdem „bedeutende Mängel“.
Neuer YASMIN-Beipackzettel
Alles, was vom YASMIN-Skandal mit seinen über 190 Toten allein in den USA übrig bleibt, ist ein neuer Beipackzettel. Nachdem das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-Produkte“ (BfARM) von BAYER verlangt hatte, in den Packungsbeilagen auf eine erhöhte Thrombose-Gefahr hinzuweisen, was der Pharma-Riese nach Informationen der SELBSTHILFEGRUPPE DROSPIRENON-GESCHÄDIGTER immer noch nicht umgesetzt hat, erhob nun auch die „Europäische Arzneimittelagentur“ (EMA) eine entsprechende Forderung. Die Auswertung zweier neuer Studien zu den Risiken und Nebenwirkungen (s. o.) von YASMIN & Co. hatte die Behörde dazu veranlasst.
XARELTO verursacht Blutungen
BAYERs ganze Hoffnungen in der Pharma-Sparte ruhen auf dem Medikament XARELTO (Wirkstoff: Rivaroxaban), das bisher EU-weit zur Thrombose-Vorbeugung bei schweren orthopädischen Operationen zugelassen ist. Wenn das Mittel zusätzlich noch Genehmigungen als allgemeines Therapeutikum gegen Venen-Thrombosen und als Mittel zur Schlaganfall-Prophylaxe bekommt, dann rechnet der Leverkusener Multi mit einem jährlichen Umsatz von mehr als zwei Milliarden Euro. Die Testergebnisse eröffnen allerdings keine allzu rosigen Zukunftsaussichten. Im Vergleich zur Thrombose-Standardmedikation schnitt das Mittel in puncto „Wirksamkeit“ nicht besser ab. Weniger Nebenwirkungen hatte es auch nicht. Einziger Vorteil: XARELTO „hat das Potenzial, für den Patienten angenehmer zu sein“ (O-Ton BAYER), weil es als Tablette verfügbar ist und nicht gespritzt werden muss. Schlaganfälle vermied das Präparat ebenfalls nicht häufiger als das Mittel der Wahl Warfarin, was dem BOEHRINGER-Konkurrenzprodukt PRADAXA sehr wohl gelang. Bei Hospital-PatientInnen mit internistischen Erkrankungen verursachte die Arznei mehr Blutungen als die Vergleichssubstanz Enoxaparin, weshalb der Pharma-Riese selbst einräumen musste: „kein konsistent positives Nutzen-Risiko-Profil“. Das Unternehmen will sich aber noch einmal über die Studien-Daten der KrankenhäuslerInnen beugen und die PatientInnen-Gruppen herausfiltern, bei denen XARELTO gut anschlug - um daraus doch noch einen neuen Absatzmarkt zu generieren.
Erica Mann leitet „Consumer Care“
Die Südafrikanerin Erica L. Mann leitet künftig BAYERs Gesundheitssparte „Consumer Care“, die Abteilung für rezeptfreie Medikamente. Mann kann sowohl auf einen Studienabschluss in Chemie als auch auf ein Diplom in Marketing-Management verweisen - eine Traumkombination für den Multi. Auch ihr Engagement bei Lobby-Organisationen wie dem südafrikanischen Verband der Pharma-Hersteller PMA oder dem „Internationalen Verband der Babynahrungs-Produzenten“ dürfte sie für höhere Aufgaben beim Pillen-Riesen empfohlen haben.
USA: GADOVIST-Zulassung erhalten
Der Leverkusener Multi hat für sein Röntgen-Kontrastmittel GADOVIST eine Zulassung in den USA erhalten. MedizinerInnen dürfen das Präparat künftig bei Magnetresonanz-Tomographien des zentralen Nervensystems einsetzen, obwohl die Anwendung mit Risiken behaftet ist. GADOVIST enthält nämlich - wie auch das andere BAYER-Kontrastmittel MAGNEVIST - Gadolinium, das bei Nierenkranken ein unkontrolliertes Wachstum des Bindegewebes mit Todesfolge auslösen kann. Mit 230 Klagen von Opfern oder deren Angehörigen (Stand: 1.2.11) sieht der Pharma-Riese sich deshalb konfrontiert. Auch die Aufsichtsbehörden haben das Gefährdungspotenzial bereits erkannt. So hat die Europäische Arzneimittel-Agentur EMEA jüngst strengere Auflagen für den Gebrauch solcher Medizinprodukte erlassen.
Pharma-Paradies Bundesrepublik
Während eine kleine Packung ASPIRIN in Griechenland nicht einmal einen Euro kostet, müssen VerbraucherInnen hierzulande dafür mehr als fünf Euro zahlen. „Der Hersteller BAYER orientiert sich an dem, was der Verbraucher bereit ist, dafür auszugeben - und schöpft natürlich das Maximum ab“, kritisiert der Gesundheitsökonom Gerd Glaeske die Preis-Politik des Pharma-Riesen, die sich nicht bloß auf seine Schmerzmittel beschränkt.
BAYERs Gesundheitsreform-Kosten
Noch immer erreicht kaum ein Wirtschaftszweig die Traum-Renditen der Pharma-Branche. Aber weltweit wird die Luft ein bisschen dünner, weil immer mehr Regierungen die Extra-Profite etwas beschneiden. Auf der Hauptversammlung im April 2011 bezifferte BAYER-Chef Marijn Dekkers die Verluste durch solche Maßnahmen im abgelaufenen Geschäftsjahr hierzulande auf 11 Millionen Euro und weltweit auf 165 Millionen. Für das laufende Jahr rechnet er mit Einbußen von 30 bzw. 300 Millionen Euro.
BAYER entwickelt Fett-Spritze
Der Leverkusener Multi will ein neues Lifestyle-Präparat auf den Markt bringen. Seine Tochtergesellschaft INTENDIS hat mit dem Unternehmen KYTHERA einen Vertrag zur Entwicklung einer Substanz geschlossen, die - unter die Haut gespritzt - kleinere Fettpolster auflösen soll.
Forschungskosten hochgerechnet
800 Millionen Dollar kostet die Entwicklung eines neuen Medikamentes laut Angaben der Pharma-Riesen. Diese Zahl, die das industrie-nahe „Tufts Center for the Study of Drug Development“ ermittelte, rechtfertigt nach Ansicht von BAYER & Co. die in der Branche üblichen hohen Umsatz-Renditen. Sie hat nur einen Schönheitsfehler: Sie stimmt nicht. Die US-ForscherInnen Rebecca Warburton und Donald Light haben einmal nachgerechnet und kommen nur auf 43,4 Millionen Dollar - eine um das 18fache niedrigere Summe. Das Tufts Center hat nämlich nur den eher seltenen Fall einer von der Grundlagen-Forschung bis zur Zulassung komplett von Big Pharma allein bewältigten Entwicklung zugrunde gelegt, mit einer viel zu hohen Zahl von Medikamenten-TesterInnen operiert und zu viele Test-Flops eingepreist. Und dann addierte das Institut auf den ermittelten Wert als „fiktive Kapitalkosten“ auch noch das hinzu, was die eingesetzten Millionen eingebracht hätten, wenn die Konzerne sie an der Börse investiert hätten statt in Arzneien.
Mehr Pharma-Kooperationen
Entgegen vollmundiger Bekundungen zur Stellung der Forschung im Unternehmen will BAYER-Chef Marijn Dekkers vermehrt Leistungen von außen zukaufen. „Wir wollen uns stärker als Partner für Pharma-Firmen positionieren, die ein Präparat in der späten Phase der klinischen Entwicklungen haben“, sagte er der Zeitschrift Capital.
PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE
Endosulfan-Verbot in Argentinien?
Jahrelang hatte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) den Leverkusener Multi aufgefordert, den in der Bundesrepublik schon längst verbotenen, besonders gefährlichen Pestizid-Wirkstoff Endosulfan auch in anderen Ländern nicht mehr zu vertreiben. Im vorletzten Jahr erklärte sich der Konzern endlich dazu bereit (SWB 3/09), nicht ohne jedoch noch einmal einen aggressiven Schlussverkauf zu veranstalten (siehe auch SWB 1/11). Jetzt aber scheinen die Stunden des Ultragifts endgültig gezählt. Die „Stockholmer Konvention“ hat sich nach harten Verhandlungen dazu durchgerungen, seinen 133 Mitgliedsstaaten eine Beschlussvorlage für einen weltweiten Bann vorzulegen. Und Argentinien hat bereits reagiert: Das Parlament muss sich mit einem Verbotsantrag beschäftigen.
Pestizide greifen Gehirn an
In einer Langzeitstudie haben französische WissenschaftlerInnen die Auswirkungen der Pestizide von BAYER & Co. auf neuronale Prozesse untersucht. Das Ergebnis ist schockierend: Bei dem Teil der 614 ProbandInnen, der über einen längeren Zeitraum hinweg Agro-Giften ausgesetzt war, ließen Gedächtnis- und Konzentrationsfähigkeit deutlich stärker nach als bei den in gesünderer Umgebung arbeitenden VersuchsteilnehmerInnen. „Frappierend“ nannte die Forscherin Isabelle Baldi diesen Befund.
EU lässt Carbendazim wieder zu
Im Jahr 2009 hatte die Europäische Union eine strengere Pestizid-Verordnung verabschiedet. Ab dem 14.6.11 sollten mit Glufosinat, Carbendazim, Mancozeb, Tebuconazole, Bifenthrin und Thiacloprid unter anderem sechs Wirkstoffe, die auch in BAYER-Mitteln enthalten sind, wegen ihrer besonderen Gefährlichkeit keine Zulassung mehr erhalten. Für Carbendazim, das der Leverkusener Multi unter dem Produktnamen DEROSAL vermarktet, macht Brüssel jetzt jedoch eine Ausnahme. Kurz vor Ablauf der Frist gewährte die EU-Kommission dem Ackergift eine Zulassungsverlängerung. Es gäbe „annehmbare Anwendungen“, erklärte sie und berief sich dabei ausgerechnet auf Studien der Agro-Riesen sowie auf eine Expertise der von Industrie-VertreterInnen durchsetzten „Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit“ (siehe auch TICKER 2/11).
GENE & KLONE
USA: BAYER kontrolliert sich selbst
In den USA dürfen BAYER & Co. die Umweltverträglichkeitsprüfungen für ihre Genpflanzen künftig selber durchführen. Das Landwirtschaftsministerium hat das zunächst auf zwei Jahre befristete Pilot-Projekt gestartet, weil es die Selbstkontrolle für „schneller, effizienter und kostengünstiger“ hält. Nur gar keine Tests wären noch ökonomischer.
Bt im menschlichen Körper
BAYER & Co. haben in viele ihrer Pflanzen-Arten mittels gentechnischer Verfahren den Bacillus thuringiensis (Bt) eingeschleust, um Schadinsekten abzutöten. Das Gift bleibt jedoch nicht in den Laborfrüchten. So wiesen ForscherInnen Rückstände im menschlichen Körper und sogar im Leib von Ungeborenen nach. Die Behauptung der Industrie, der Bazillus würde durch die Magensäfte zersetzt, entpuppte sich damit als Mär.
Genreis-Kooperation mit BASF
Der Genreis-Skandal von 2006 - damals tauchte eine nicht zugelassene Art weltweit in Supermarkt-Packungen von UNCLE BEN & Co. auf - hält BAYER nicht davon ab, weiterhin auf dieses Produkt zu setzen. Ende 2010 gab er eine Kooperation mit BASF bekannt. Die beiden Konzerne wollen aus BAYERs hybrider, also nicht für die Wiederaussaat geeigneter Sorte ARIZE und ertragssteigernden Genen made by BASF eine neue Reis-Pflanze kreieren.
Kooperation mit DUPONT
Schadinsekten gewöhnen sich zunehmend an die Pestizide, welche die Hersteller im Kombipack mit ihren gegen diese Wirkstoffe resistenten Genpflanzen verkaufen. Deshalb gehen BAYER & Co. nach der Devise „Doppelt hält besser“ immer mehr dazu über, ihre Sorten gleich gegen mehrere Agrochemikalien immun zu machen und gewähren sich gegenseitig Zugriff auf ihre Technologien. Nach Lizenzabkommen mit MONSANTO, SYNGENTA und DOW AGRO SCIENCES hat der Agro-Riese nun schon den zweiten Vertrag mit DUPONT geschlossen. Nach dieser Vereinbarung kann der zu PIONEER HI-BRED gehörende Konzern künftig BAYERs gegen das Herbizid Glufosinat resistente LIBERTY-LINK-Kreation nutzen und der Leverkusener Multi im Gegenzug bestimmte Raps-Zuchten von DUPONT.
Kooperation mit SYNGENTA
Nicht nur Schadinsekten (s. o.), sondern auch Unkräuter gewöhnen sich immer schneller an das Pestizid-Einerlei, mit dem die LandwirtInnen ihre Genpflanzen bearbeiten müssen. Darum strebt der Leverkusener Multi auf diesem Gebiet ebenfalls Kooperationen an. So will er mit SYNGENTA eine Soja-Art entwickeln, die gleichzeitig gegen die BAYER-Herbizide BALANCE (Wirkstoff: Isoxaflutole) und LAUDIS (Wirkstoffe: Isoxadifen-ethyl und Tembotrione) sowie gegen das SYNGENTA-Mittel CALLISTO immun ist. Mit dem neuen Präparat rechnen sich die beiden Agro-Riesen nun Chancen bei LandwirtInnen aus, „die zunehmend mit Problemen durch resistentes Unkraut konfrontiert sind“.
Gen-Baumwolle nicht zugelassen
Die AgrarministerInnen der Europäischen Union konnten sich nicht darauf verständigen, BAYERs gegen das Anti-Unkrautmittel Glyphosate resistenter Gentech-Baumwolle „GHB 614“ eine Import-Genehmigung zu erteilen. Eine endgültige Entscheidung fällt nun die EU-Kommission.
PFLANZEN & SAATEN
BAYER kauft HORNBECK
Der Leverkusener Multi hat das US-amerikanische Saatgut-Unternehmen HORNBECK erworben. Der Konzern stärkt damit nach eigener Aussage vor allem das Geschäft mit Soja-Bohnen weiter, denn HORNBECK hatte für diese Ackerfrucht ein eigenes Zuchtprogramm entwickelt.
Neues Saatgut-Labor in Singapur
Der Leverkusener Multi baut sein Saatgut-Geschäft kontinuierlich aus (s. o.). Im Zuge dieser Strategie hat er jetzt in Singapur ein neues Saatgut-Forschungslabor eröffnet. In dem 20 Millionen Euro teuren Bau will der Konzern an neuen Sorten basteln, die Schadinsekten sowie anderem Unbill besser trotzen, einen höheren Nährwert haben und sich leichter lagern und verarbeiten lassen.
WASSER, BODEN & LUFT
Genpflanzen-Gift im Wasser
Haben die LandwirtInnen ihre Mais-Felder abgeerntet, so landen viele Reste wie Stängel, Blätter oder Kolben in den Flüssen. Handelt es sich dabei um Gen-Mais, der mit dem Gift des Bacillus thuringiensis (Bt) bestückt ist, wie etwa BAYERs Sorte T25, dann kommt dabei auf die Gewässer viel Unbill zu. US-WissenschaftlerInnen untersuchten Wasser in der Nähe der Mais-Äcker und wiesen in 23 Prozent aller Proben die Bt-Substanz nach.
CO2 als Rohstoff?
Im Februar 2011 nahm BAYER eine Pilotanlage in Betrieb, die den Einsatz von Kohlendioxid als Rohstoff zur Kunststoff-Herstellung erprobt. Der Pharma-Riese feiert dieses gemeinsam mit RWE und der „Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen“ betriebene Projekt „Dream Production“ als eine Großaktion zur Rettung des Klimas. ExpertInnen beurteilen solche Versuche skeptischer. „Die stoffliche Nutzung kann keine riesigen Mengen binden, weil wir einfach viel, viel mehr Kohlendioxid freisetzen“, sagt etwa der Chemie-Ingenieur Arno Behr von der „Technischen Universität Dortmund“ (Ticker 1/10). Als der BAYER-Manager Peter Vanacker in einem Interview gefragt wurde, wieviel CO2 die „Dream Production“ dem Recycling denn zuführe, gab er sich dann auch kleinlaut: „Genaue Zahlen möchten wir nicht veröffentlichen“.
Neue Abwasser-Behandlungsanlage
Die größere Auslastung des Bergkamener BAYER-Werkes seit 2004 hat auch das Volumen der Produktionsrückstände erhöht. Das machte den Ausbau der Abwasser-Behandlungsanlage unvermeidlich. Nach Angaben des Konzerns wäscht sie so rein, dass das Unternehmen das Wasser anschließend direkt in die Lippe einleiten kann. Auch vor Lecks sollen die Becken durch die Verwendung massiverer Werkstoffe wie Beton und mehr Kontrollmöglichkeiten besser geschützt sein.
Quecksilber-Ausstoß: 11,5 kg
Seit einiger Zeit führt der Leverkusener Multi in seinen Nachhaltigkeitsberichten den Quecksilber-Ausstoß nicht mehr an und macht nur noch Angaben zu den Schwermetall-Emissionen insgesamt. Auf der Hauptversammlung im April 2011 nach den konkreten Zahlen gefragt, gab BAYER-Chef Marijn Dekkers die Menge des in die Gewässer eingeleiteten Ultragiftes mit 11,5 Kilogramm an.
PCB is coming home
BAYER gehörte lange zu den Hauptherstellern von Polychlorierten Biphenylen (PCB), einer Krebs erregenden Chlorverbindung. Erst 1983 hat der Konzern die Produktion des Ultragiftes eingestellt, das unter anderem als Weichmacher in Kunststoffen, Kühlmittel und Isoliermaterial Verwendung fand. Aber die gesundheitsschädlichen Folgen der Chemikalie machen sich immer noch bemerkbar. So ergab eine Untersuchung von Beschäftigten der Dortmunder Entsorgungsfirma ENVIO eine hochgradige PCB-Kontamination. 95 Prozent der Belegschaft wiesen Konzentrationen im Blut auf, die bis zum 25.000fachen über dem zulässigen Grenzwert lagen. Das ENVIO-PCB landete schließlich wieder beim Absender - in den Verbrennungsöfen des Leverkusener Multis, wie BAYER-Chef Marijn Dekkers auf der Hauptversammlung im April 2011 der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN bestätigte.
BAYER will mehr Müll verheizen
Der mehrheitlich BAYER gehörende Chemie„park“-Betreiber CURRENTA möchte am Standort Krefeld die Preise für die Energie-Gewinnung senken und plant deshalb, 16.000 Tonnen Müll anstelle von Steinkohle zu verheizen. Was das Unternehmen als Recycling-Maßnahme zur Schonung der Umwelt verkauft, erweckt den Zorn der städtischen Grünen. „Die von CURRENTA großmundig propagierte Linie, mit der Erhöhung der Müllverbrennung werde die Energie-Erzeugung im Unternehmen umweltfreundlicher, entbehrt bei genauem Hinsehen jeder Grundlage“, kritisiert der Ratsherr Rolf Rundmund angesichts des erhöhten Schadstoff-Ausstoßes durch die Reste-Verwertung.
Altlast in Newburgh
Von den 1950er bis 1970er Jahren lud die STAUFFER CHEMICAL COMPANY auf einer städtischen Deponie nahe Newburgh Fässer mit Polychlorierten Biphenylen, Chrom, Blei und anderen Giftstoffen ab. Lange schon halten viele Behältnisse den Chemikalien nicht mehr stand. Durch Lecks gelangten die Substanzen in den Boden. Die US-amerikanische Umweltbehörde EPA wies BAYER und DUPONT als Nachfolger von STAUFFER an, die Müllhalde zu sanieren. Anderthalb Jahre werden die Arbeiten mindestens in Anspruch nehmen.
NANO & CO.
Nano-Kooperation mit HYPERION
Nano-Teilchen können eine asbest-ähnliche Wirkung entfalten, zu den Zellkernen vordringen oder die Blut/Hirn-Schranke überwinden. Trotz dieser Risiken und Nebenwirkungen setzt der Leverkusener Multi auf die Technologie und geht auf internationaler Ebene Kooperationen ein, um seine BAYTUBES-Röhrchen auf den Weltmarkt zu bringen. So hat der Global Player eine Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Unternehmen HYPERION vereinbart. Da große Industrie-Zweige wie die Fahrzeug- und Flugzeug-Branche sich zu BAYERs Leidwesen den neuen Materialien gegenüber noch wenig aufgeschlossen zeigen (Ticker 2/11), will der Konzern mit seinem US-amerikanischen Partner nun künftig selber Produkte auf Basis von Nano-Röhrchen entwickeln, um mit den Prototypen das Geschäft anzukurbeln.
Nano-Teilchen töten Wasserflöhe
Immer mehr Alltagsprodukte enthalten Nano-Partikel, also mikroskopisch kleine Stoff-Komponenten. So befinden sich in Sonnenmilch Nano-Teilchen aus Titandioxid. Und diese Winzlinge können Mikro-Organismen schaden, deren Entwicklungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Das haben ForscherInnen des Institutes für Umweltwissenschaften der Universität Koblenz-Landau festgestellt. Sie gaben die Sonnenmilch ins Wasser und beobachteten, wie Wasserflöhe darauf reagieren. Das Ergebnis: „90 Prozent der Tiere starben“, so Studienleiter Ralf Schulz. Das Titandioxid setzte sich auf der Chinin-Hülle der Flöhe fest und verhinderte ihre Häutung. Welche Wirkung die in den Naturkreislauf eingespeisten Kleinstteilchen von BAYER & Co. auf andere Lebenwesen und Pflanzen haben, vermochten die WissenschaftlerInnen nicht zu sagen. „Hier besteht noch ein enormer Forschungsbedarf“, meint Schulz.
CO & CO.
Gericht stoppt CO-Pipeline
Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hat am 25. Mai 2011 die Inbetriebnahme von BAYERs Kohlenmonoxid-Pipeline wegen ihrer mangelnden Erdbeben-Sicherheit untersagt. Es erklärte den Planfeststellungsbeschluss zu der zwischen Dormagen und Krefeld verlaufenden Kohlenmonoxid-Pipeline für „rechtswidrig und vorerst nicht vollziehbar“. Die Anti-Pipeline-Initiativen werteten das Urteil als „Etappen-Sieg“. Am Ziel wähnen sie sich aber noch nicht. Die JuristInnen haben nämlich die Rechtmäßigkeit der Enteignungen entlang des Streckenverlaufes bestätigt, welche die staatlichen Stellen mit den höheren, dem Allgemeinwohl dienenden Zwecken des Leitungsverbundes begründet hatten. Zudem haben sie den Streckenverlauf trotz bestehender Alternativen abgesegnet und sich auch nicht an den teilweise schon rostenden Bau-Teilen gestört. Darum wollen die Anwohner, die gegen ihre Zwangsenteignung geklagt hatten, das Urteil nicht akzeptieren und in Berufung gehen.
PLASTE & ELASTE
Unsichere BMS-Zukunft
Obwohl BAYER-Chef Marijn Dekkers sich bei seinem Amtsantritt zur Kunststoff-Abteilung BAYER MATERIAL SCIENCE bekannt hatte, bleiben selbst führende ManagerInnen skeptisch. „Ich glaube nicht, dass ich meine Rente noch unter dem Namen BAYER beziehe“, vertraute eine führende BMS-Kraft der Financial Times Deutschland schon im letzten Herbst an. Dabei hatte Dekkers da noch gar keine Zweifel an seiner Treue zu „Plaste & Elaste“ aufkommen lassen. „Wenn aber für eine sehr große Akquisition ein bedeutender Geldbetrag aufgebracht werden muss, so wären wir bei dieser extremen Option bereit, eine Sparte zu veräußern“ - dieses Statement gab der Vorstandsvorsitzende erst ein paar Monate später ab.
Öl-Kosten steigen
Erdöl stellt für die Chemie-Konzerne die mit Abstand wichtigste Rohstoff-Quelle dar. Der Leverkusener Multi braucht das „Schwarze Gold“ vor allem für seine Kunststoff-Produktion. Die zunehmende Knappheit der Ressource und die Entwicklungen in Nordafrika haben zu einem kräftigen Preisanstieg geführt, dessen Folgen der Pharma-Riese genau beziffern kann: Steigen die Kosten für einen Barrel Öl um zehn Dollar, so schlägt das beim Global Player mit einer Mehrbelastung von 200 Millionen Euro zu Buche.
PRODUKTION & SICHERHEIT
Berufskrankheiten 2010: 13 Fälle
Seit langem macht der Leverkusener Multi in seinen Nachhaltigkeitsberichten keine Angaben mehr zu den von den Berufsgenossenschaften anerkannten Berufskrankheiten. Die letzten Informationen dazu stammen aus dem Jahr 2000. Damals waren es 130 Erkrankungen, die meisten von Asbest oder Lärm-Exposition ausgelöst. Auf der Hauptversammlung im April 2011 nach den aktuellen Zahlen gefragt, führte BAYER-Chef Marijn Dekkers drei Fälle in der Bundesrepublik und zehn im Rest der Welt an. So wenige dürften es jedoch kaum sein.
STANDORTE & PRODUKTION
Weniger Geld für Sport und Kultur
Im Zuge seines im November 2010 beschlossenen Rationalisierungsprogramms, das 4.500 Arbeitsplätze vernichtet (siehe auch SWB 2/11), will BAYER nach Informationen der Gewerkschaft IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE auch sein Sport- und Kultursponsoring reduzieren.
BAYER investiert in Wuppertal
Der Leverkusener Multi investiert 2011 in seinen Standort Wuppertal 95 Millionen Euro. Das Geld fließt in neue Forschungs- und Produktionsanlagen, ein Blockheizkraft-Werk und den Ausbau bereits existierender Fertigungsstätten. Die teuerste Einzelinvestition stellt mit einem Volumen von 35 Millionen Euro die Errichtung des Technikums „Zellbiologie“ dar, in dem der Pharma-Multi biologische Wirkstoffe für klinische Tests herstellen will.
BAYER baut in Dormagen
Der Chemie-Multi errichtet in Dormagen ein Technikum zur Erprobung neuer Verfahrensweisen bei der Produktion der Kunststoffe Toluylendiisocyanat (TDI) und Diphenylmethandiisocyanate (MDI). Alternativen zur ultra-gefährlichen Basis-Substanz Phosgen (siehe AKTION & KRITIK) sucht der Leverkusener Multi allerdings nicht.
Leverkusen in Finanznot
Im Frühjahr verkündete BAYER den größten Umsatz in der Firmen-Geschichte. An der Stadt Leverkusen geht dieser Geldregen allerdings vorbei. Sie muss einen Gewerbesteuer-Rückgang von über zehn Millionen Euro auf 72 Millionen Euro hinnehmen und sieht sich zu einem umfassenden Sparprogramm gezwungen.
Kooperation mit Duisburger Hafen
BAYERs Chemie-„Park“ in Uerdingen und die Duisburger Hafengesellschaft DUISPORT haben eine Zusammenarbeit vereinbart. Der Leverkusener Multi will künftig 50 Prozent der Kapazität des Container-Terminals nutzen, den DUISPORT in Hohenbudberg baut, und so mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern.
Neue Anlage in Ankleshwar
BAYER hat im indischen Ankleshwar eine neue Fertigungsstätte zur Produktion von Polyisocyanaten in Betrieb genommen, die als Basismaterial zur Herstellung von Lacken, Kleb- und Dichtstoffen dienen. Mit mehr als 5.000 Anlagen gehört die Stadt zu den größten Chemie-Clustern in ganz Asien. Das indische „Central Pollution Control Board“ stuft Ankleshwar deshalb als giftigste Region des ganzen Landes ein. Der Leverkusener Multi trägt nicht wenig dazu bei. Er betreibt an dem Ort nämlich auch noch sieben Pestizid-Fabriken. In einer von ihnen brach im letzten Jahr ein Feuer aus, was einen Ingenieur das Leben kostete (Ticker 2/10). Welches Sicherheitsrisiko diese Produktion darstellt, war schon vorher bekannt. So hatte das Umweltministerium der Region Gujarat bereits seit längerem eine Stilllegung gefordert.
IMPERIUM & WELTMACHT
Hilken neuer CURRENTA-Leiter
Günter Hilken hat von Klaus Schäfer die Leitung des Chemie„park“-Betreibers CURRENTA übernommen, der in Besitz des Leverkusener Multis und seiner Chemie-Abspaltung LANXESS ist.
BAYER übernimmt HORNBECK
BAYER hat das US-amerikanische Saatgut-Unternehmen HORNBECK gekauft (siehe auch PFLANZEN & SAATEN).
Chinas Fünfjahresplan lockt
China will mit seinem neuen Fünfjahresplan den Lebensstandard seiner Bevölkerung weiter anheben, um sozialen Unruhen vorzubeugen. Der Staat hat sich unter anderem die Erhöhung der Mindestlöhne, die Angleichung der Unterschiede zwischen Stadt und Land sowie Investitionen in den Umweltschutz vorgenommen. Und der Leverkusener Multi findet Gefallen an dieser Planwirtschaft. „Ob beim Ausbau der Infrastruktur oder der umweltfreundlichen Energie-Versorgung - BAYER hat die passenden Angebote“, frohlockt China-Chef Michael König.
ÖKONOMIE & PROFIT
- #
Steuerlast sinkt kontinuierlich
BAYER zahlt immer weniger Abgaben. Beliefen sich die Ertragssteuern zwischen 1997 und 2000 noch auf rund eine Milliarde Euro, so zahlte der Konzern für das Geschäftsjahr 2009 bloß noch 511 Millionen Euro und für 2010 gar nur noch 411 Millionen Euro. Dazwischen lag der Wechsel von BA
Prozess wg. Diskriminierung
„BAYER benachteiligt Frauen systematisch“
In den USA haben acht Frauen den Leverkusener Multi wegen Verstoßes gegen das Gleichberechtigungsgebot angeklagt.
„Der BAYER-Konzern hat sich der Nicht-Diskriminierung und der Gleichbehandlung aller Beschäftigten verpflichtet“, heißt es im neuesten Nachhaltigkeitsbericht des Konzerns. Die Realität sieht jedoch anders aus: In den USA haben acht weibliche Belegschaftsangehörige eine 100 Millionen Dollar schwere Sammelklage gegen den Konzern wegen Diskriminierung eingereicht. Sie werfen dem Unternehmen vor, Frauen nicht den gleichen Lohn wie Männern zu zahlen und sie nicht angemessen zu fördern. Zudem bezichtigen die acht den Multi, Beschwerden über sexuelle Belästigungen nicht nachgegangen zu sein.
„BAYER benachteiligt seine weiblichen Angestellten systematisch“, sagt die Anwältin Katherine Kimpel und führt zum Beweis firmen-interne Dokumente an. So heißt es in einem Memo der US-amerikanischen Führungsebene von BAYER HEALTH CARE: „Frauen mit Macht sind unberechenbar und fühlen sich oft von Kollegen bedroht“. Nach Ansicht des Managements würde das gesamte Personal lieber unter männlichen Chefs arbeiten, weil diese „seltener versteckte Ziele verfolgen, Stimmungsschwankungen ausgesetzt sind oder sich in bürointerne Konkurrenz-Kämpfe einmischen“. Auch für entscheidungsfreudiger hält die Chef-Etage die Herren der Schöpfung. Ein Manager empfahl sogar, dass „BAYER aufhören muss, Frauen im gebärfähigen Alter einzustellen“. Folgerichtig haben laut Kimpel besonders Schwangere und Mütter unter den Diskriminierungen zu leiden.
„Die Situation bei BAYER ist ein gutes Beispiel dafür, wie fest die unsichtbare Barriere, die Frauen am beruflichen Aufstieg hindert, auch im Jahr 2011 noch steht“, resümiert Kimpel. Der Pharma-Riese hingegen weist die Anschuldigungen zurück. „Wir wehren uns entschieden gegen diese Vorwürfe und werden uns verteidigen“, verlautet aus der Konzern-Zentrale. Wie groß jedoch der kleine Unterschied im Unternehmen ist, belegen allein schon die Zahlen. Beträgt der Anteil der weiblichen Beschäftigten insgesamt 35 Prozent, so schmilzt dieser bis zur ersten und zweiten Ebene unterhalb des Führungsgremiums auf 6,5 Prozent zusammen, um dann ganz oben im vierköpfigen Vorstand auf Null zu kommen. Und in die 20er-Runde des Aufsichtsrates haben sich gerade mal zwei Frauen verloren.
Von einer Frauenquote hält der Global Player deshalb selbstverständlich nichts. Wie immer, wenn gesellschaftlicher Druck Maßnahmen verlangt, zaubert der Multi das altbekannte Hausmittel „Freiwillige Selbstverpflichtung“ aus dem Hut. „So wollen wir den Anteil von Frauen in Führungspositionen bis 2015 konzern-weit in Richtung 30 Prozent entwickeln“, gelobte BAYER-Chef Marijn Dekkers auf der Hauptversammlung im April 2011. Er hat zwar in letzter Zeit zwei hohe Posten mit Frauen besetzt, aber das reicht noch lange nicht. Aus diesem Grund ist auf den erzieherischen Wert einer saftigen Strafe zu hoffen. Bislang haben die Gerichte allerdings noch nicht über die Zulassung einer Sammelklage im Fall „Barghout et al. v. BAYER“ entschieden.
Von Jan Pehrke
Geplante Kunststoff-Fabrik in Dormagen:
Coordination reicht Einwendungen ein
Der BAYER-Konzern will am Standort Dormagen eine neue Anlage zur Produktion von TDI bauen, wobei riesige Mengen des Giftgases Phosgen eingesetzt werden sollen. Der vorgeschriebene Abstand zur Wohnbevölkerung wird nicht eingehalten. Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) veröffentlichte eine Muster-Einwendung, die von zahlreichen Anwohnern und Umweltverbänden unterstützt wird. Um der Forderung nach einer phosgenfreien Kunststoff-Produktion Nachdruck zu verleihen, sammelte die CBG mehr als 12.000 Unterschriften.
von Philipp Mimkes
Die BAYER MATERIALSCIENCE AG will in den Werken Dormagen und Brunsbüttel die Herstellung von Toluylendiisocyanat (TDI) und Methyldiisocyanat (MDI) stark ausweiten. Die beiden Kunststoffe gehören zur Gruppe der Polyurethane. TDI ist ein Weichschaum, aus dem u.a. Fahrzeugsitze, Matratzen oder Bürostühle hergestellt werden. MDI wird vornehmlich für Dämmplatten verwendet. In beiden Fällen soll Phosgen als Zwischenprodukt eingesetzt werden; die Substanz, die bereits im Grammbereich tödlich wirken kann, wurde im 1. Weltkrieg als Kampfgas verwendet und gilt als eine der giftigsten Industrie-Chemikalien überhaupt.
Weit vorangeschritten ist die Planung in Dormagen, wo die TDI-Produktion von derzeit 60.000 auf 300.000 Jahrestonnen ausgeweitet werden soll. Der aus 24 Aktenordnern bestehende Genehmigungsantrag wurde im Frühjahr bei der Bezirksregierung Köln eingereicht und lag im Juni zur öffentlichen Einsichtnahme aus. Im Oktober findet in Dormagen der Erörterungstermin mit Beteiligung der Bevölkerung statt. 2014 soll die 150 Millionen Euro teure Anlage in Betrieb gehen.
Muster-Einwendung
Aus dem Desaster um die Kohlenmonoxid-Pipeline, die wegen der öffentlichen Proteste auch fünf Jahre nach Baubeginn nicht in Betrieb gegangen ist, hat BAYER offenbar gelernt. Der Konzern kommunizierte deutlich mehr Informationen als bei früheren Projekten, insbesondere zum Umfang der eingesetzten Chemikalien. Zudem kommt BAYER einer jahrzehntelangen Forderung der Umweltverbände nach: erstmals sollen die gefährlichsten Teile der Fabrik, die bislang im Freien standen, mit einer Schutzhülle versehen werden. Forderungen nach einer solchen Einhausung gibt es bereits seit den 80er Jahren. Der jetzt angekündigte Schritt stellt einen wichtigen Erfolg für die Umweltbewegung dar, denn auch künftige Anlagen werden hinter diese verbesserte Sicherheits-Technik kaum zurückfallen können.
Dennoch kritisiert die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) die Planungen. Angesichts einer Lebensdauer von bis zu 40 Jahren würde die TDI-Anlage über Jahrzehnte hinweg den risikoreichen Einsatz von Phosgen sowie die umweltschädliche Chlorchemie insgesamt zementieren. Zudem weist die Fabrik nicht den notwendigen Abstand zur Werksgrenze auf.
Die CBG veröffentlichte daher Anfang Juli eine sechsseitige Muster-Einwendung und rief die Bevölkerung zu weiteren Stellungnahmen auf. Die örtliche Presse berichtete umfangreich, zahlreiche Anfragen von Anwohnern gingen ein, und mehrfach wurden Vertreter der CBG zu Diskussionen eingeladen. Mindestens 50 Einzelpersonen reichten daraufhin eigene Einwendungen ein. Auch der Umweltverband BUND, die Grünen in Dormagen und in Monheim sowie die benachbarte Stadt Monheim beteiligten sich an dem Verfahren mit kritischen Stellungnahmen.
worst case-Szenarien fehlen
Kernpunkt der Kritik sind die Risiken hochgiftiger Chemikalien, die in riesigen Mengen zum Einsatz kommen sollen. Laut Antragsunterlagen werden sich in der Anlage zu jedem Zeitpunkt 60 Tonnen Phosgen, 25 Tonnen Ammoniak, 2.900 Tonnen TDI und mehr als Tausend Tonnen Dichlorbenzol befinden. Pro Jahr sollen 365.000 Tonnen Phosgen, 260.000 to Chlor und 105.000 to Kohlenmonoxid eingesetzt werden. Dennoch fehlen in den Antragsunterlagen jegliche worst case-Studien für den Fall eines Austritts größerer Mengen Chemikalien. Existierende Szenarien, die für Phosgen eine Gefährdung in einem Abstand von mehreren Kilometern errechnen, werden erst gar nicht erwähnt.
Wörtlich heißt es daher in der Stellungnahme der CBG: „In den Antragsunterlagen wird die Möglichkeit eines Austritts großer Mengen Phosgen oder TDI nicht berücksichtigt. Auch wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit eines solchen Vorfalls relativ gering ist, muss sie aufgrund der potentiell katastrophalen Auswirkungen unbedingt untersucht werden. Nicht nur der GAU von Fukushima, sondern auch die Störfälle bei Bayer Baytown (2006), Bayer Institute (2008) oder INEOS Dormagen (2008) zeigen, dass sich Störfälle nicht an vorhersehbare Abläufe halten. Daher muss auch für unwahrscheinliche Szenarien Vorsorge getroffen werden“.
Außerdem fordert die Coordination zusätzliche Schutzmaßnahmen für den Fall einer Beschädigung der Einhausung von außen oder im Fall einer Explosion innerhalb der Schutzhülle. Ein solcher Schutz wäre z.B. durch Einsprühen von Ammoniak-Dampf zu erreichen, womit sich Phosgen neutralisieren ließe. Bei bestehenden Anlagen sind Düsen angebracht, aus denen im Fall eines Phosgen-Austritts konzentrierte Ammoniaklösung herausschießt. BAYER verzichtet wegen der Einhausung auf diesen zusätzlichen Schutz. Wegen der extremen Gefährlichkeit von Phosgen fordert die CBG jedoch ein solches doppeltes Sicherheits-System. Notwendig sind zudem Phosgen-Detektoren in verschiedenen Abständen zur Anlage, die kontinuierlich in der Leitwarte überwacht werden, so dass notfalls die Bevölkerung gewarnt werden kann.
ungenügender Abstand
Rund 300 Meter von der Anlage entfernt liegt die Werksgrenze, an der sich u.a. eine Haltestelle der S-Bahn und eine viel befahrene Straße befinden. Die nächst gelegene Wohnbebauung liegt 1 km entfernt. Die jüngsten Empfehlungen der vom Bundesumweltministerium eingesetzten Kommission für Anlagensicherheit legen für Phosgenanlagen jedoch einen Mindestabstand von 1.500m zu bewohnten Gebieten fest. Viele Experten fordern sogar noch größere Entfernungen. Der Abstand von 1.500m muss daher dringend eingehalten werden.
Auch fehlt in den Antragsunterlagen jeglicher Hinweis auf vorhergehende Störfälle in der TDI-Produktion. Zwar heißt es in dem Antrag, dass BAYER „weltweit lange Betriebserfahrung mit Anlagen gleicher Art“ besitzt. Unerwähnt bleibt jedoch z.B. die schwere Explosion im September 2006 in einem texanischen BAYER-Werk, bei der ein mit TDI gefüllter Reaktor in die Luft flog und mehrere Tonnen giftiger Chemikalien austraten. Mehr als 20 Arbeiter wurden verletzt. Die beauftragten Gutachter stellten eine „grobe Fahrlässigkeit“ der Werksleitung fest, der Störfall hätte demnach verhindert werden können. Die CBG hat das Gutachten online gestellt und der Einwendung beigelegt.
1997 kam es in Dormagen zu einer schweren Explosion in der TDA-Produktion, als ein Reaktor explodierte und giftige Stoffe bis über die Werksgrenze spritzten. TDA ist ein Vorprodukt von TDI. Der Störfall von 1997 spielte eine wichtige Rolle in dem gescheiterten Genehmigungsverfahren für eine TDI-Anlage in Taiwan, die wegen Sicherheits-Bedenken letztlich nicht gebaut wurde.
Die Explosion von 2006 und die vorherigen Störfälle sind ein Beleg dafür, dass für größere Schäden innerhalb der Einhausung Vorsorge getroffen werden muss. Auch muss BAYER erläutern, wie Domino-Effekte mit benachbarten Anlagen oder Pipelines ausgeschlossen werden können. Ein solcher Domino-Effekt führte 2008 zu dem verheerenden Brand bei INEOS Dormagen (der früheren BAYER ERDÖLCHEMIE). Damals griff das Feuer einer defekten Pipeline auf einen Chemikalien-Tank über. Rund um die geplante TDI-Anlagen befinden sich ebenfalls zahlreiche Chemikalien-Lager, Rohrleitungen und störfallgefährdete Anlagen.
giftige Emissionen
Der Betrieb der Anlage würde zu direkten Emissionen in die Luft von 163 Tonnen Schwefeldioxid, 13 t Staub, 65t Kohlenmonoxid und 20t Salzsäure führen. Zudem entstehen in der Anlage jährlich 10.900 Tonnen Sondermüll. Diesen will BAYER in Kraftwerken als Brennstoff verfeuern, was zu deutlich höheren Emissionen führen würde als die Verbrennung in einer Sondermüllverbrennungsanlage.
Insgesamt ist die Produktion von TDI extrem energieaufwendig. Für jede Tonne TDI entstehen rund 5 Tonnen Kohlendioxid. Dennoch fehlt in den Antragsunterlagen eine Schadstoff- und Klima-Bilanz für den kompletten Herstellungsprozess.
Flugzeug-Abstürze werden in dem Antrag bewusst ausgeklammert. Dies ist angesichts der zahlreichen Flugbewegungen in der Rheinschiene nicht zu tolerieren. Für die Anlage müsste ein weiträumiges Überflugverbot gelten, oder aber die geplante Schutzhülle müsste dem Absturz eines Verkehrsflugzeugs oder eines militärischen Jets widerstehen.
getrennte Verfahren
Der BUND weist in seiner Einwendung auf eine Vielzahl weiterer Probleme hin, u.a. auf die geplante Einleitung von Salzen in den Rhein, die hohe Wasser-Entnahme und eine fehlende Energie-Bilanz. Insbesondere kritisiert der BUND die Splittung des Genehmigungsverfahrens: für die drastische Erweiterung der TDI-Herstellung müssen auch neue Anlagen zur Produktion gefährlicher Stoffe wie Salzsäure, TDA und Kohlenmonoxid gebaut werden. Dies führt zu weiteren Emissionen und Störfall-Risiken. Hierfür wurden eigene, z.T. zeitverschobene Genehmigungsverfahren angestrengt, was die Übersicht über die gesamte Umweltbelastung praktisch unmöglich macht. Nach Auffassung des BUND wird hierdurch die Arbeit von Einwendern und Umweltverbänden bewusst erschwert. Zudem verlangt die seit 2010 gültige EU-Richtlinie für Industrieemissionen (IED), dass alle Teilvorhaben größerer Anlagen gemeinsam untersucht werden.
Die Stadt Monheim nennt in ihrer Stellungnahme zahlreiche von der CBG monierte Probleme, insbesondere den mangelnden Abstand der Anlage zur Werksgrenze und fehlende worst case-Szenarien. Die Stadt fordert die Genehmigungsbehörden auf, angesichts der langen Laufzeit der Anlagen regelmäßig zu prüfen, ob phosgenfreie Verfahren zur TDI-Produktion vorliegen und ggfs. eine Umrüstung vorzuschreiben. Auch fordert die in Windrichtung gelegene Stadt den Bau von Hochleistungs-Sirenen zur Warnung der Bevölkerung.
öffentliche Erörterung
Grundsätzlich sollte der Einsatz hochgefährlicher Stoffe wie Phosgen möglichst vermieden werden. Wenn dies unter keinen Umständen möglich ist, so müssen zumindest maximale Sicherheitsvorkehrungen gelten. Dies ist bei den bisherigen Planungen nicht der Fall.
Die Chemie-Industrie ist zudem aufgefordert, risikolosere Produktionsmethoden zu entwickeln und energieintensive Produkte wie TDI und MDI mittelfristig durch ökologischere Stoffe zu substituieren. BAYER hat nach eigenen Angaben an alternativen Verfahren zur Produktion von Polyurethanen gearbeitet und hält hierzu eine Reihe von Patenten. Einen großtechnischen Einsatz phosgenfreier Verfahren bezeichnet das Unternehmen als zu aufwendig.
BAYER hat jüngst angekündigt, in Dormagen ein Forschungslabor für Kunststoffe zu bauen. Nach Auffassung der Coordination gegen BAYER-Gefahren sollte das Unternehmen alle Anstrengungen darauf konzentrieren, phosgenfreie Verfahren zur Serienreife zu bringen. Zur Bekräftigung dieser Forderung hat die CBG zusammen mit der Initiative RETTET DEN REGENWALD mehr als 12.400 Unterschriften gesammelt.
In der öffentlichen Erörterung am 5./6. Oktober wird die Coordination gemeinsam mit dem BUND sowohl die grundsätzliche Kritik an der Phosgen-Chemie als auch die speziellen Probleme der geplanten TDI-Anlage diskutieren. In der gegenwärtigen Form hält die CBG den Antrag von BAYER für nicht genehmigungsfähig.