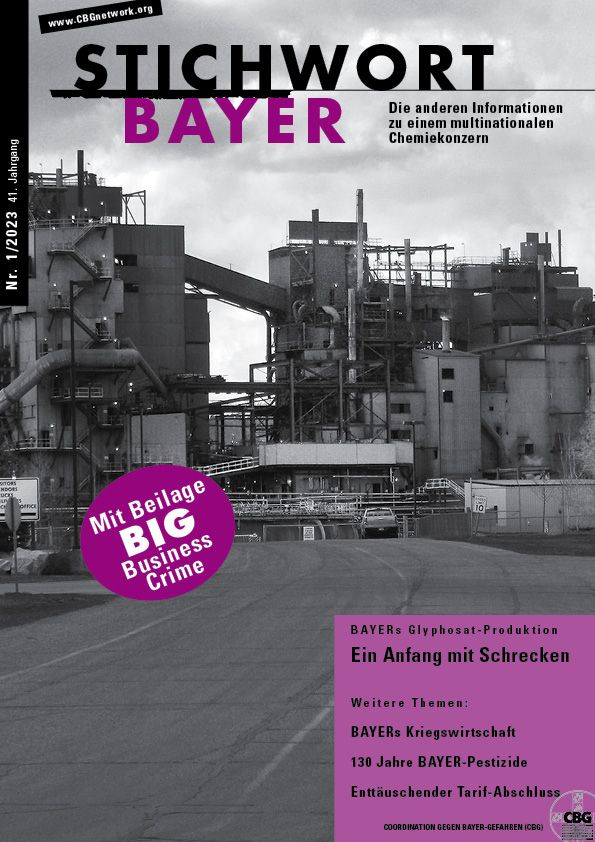Veröffentliche Beiträge von “CBG Redaktion”
Immer mehr Medikamente nicht erhältlich
BAYERs Lieferengpässe
Die Globalisierung der Wertschöpfungsketten im Pharma-Bereich gefährdet die Arzneimittel-Versorgung. Die Anzahl der Lieferengpässe steigt kontinuierlich. Auch BAYER-Medikamente fehlen den Apotheken immer wieder.Von Jan Pehrke
„BAYER stellt in der Arzneimittel-Herstellung hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit und unumstrittene Qualität seiner pharmazeutischen Produkte. Den ununterbrochenen Zugang von Patienten und Kunden zu unseren Produkten aufrechtzuerhalten, hat für uns oberste Priorität. Unser weltweites Produktionsnetzwerk ist hier nachweisbar sehr erfolgreich“, erklärte der Leverkusener Multi im Herbst letzten Jahres und ließ gleich ein „Aber“ folgen. „Dennoch können in einzelnen Fällen aus unterschiedlichen Gründen Lieferengpässe auftreten. Insbesondere im Rahmen der weltweiten Pandemie ergeben sich besondere Herausforderungen in der Beschaffung und Versorgung mit Roh- oder Hilfsstoffen sowie Personalmangel in der Produktion oder bei der Aufrechterhaltung von Lieferketten“, erklärte der Pharma-Riese. Auch eine erhöhte Nachfrage nach bestimmten Pharmazeutika und die aktuellen „politischen und wirtschaftlichen Spannungen“ nennt er als Gründe für „die angespannte Liefer-Situation“. 2023 betraf diese bisher ASPIRIN in den unterschiedlichen Darreichungsformen, das Herz/Kreislauf-Präparat NIMOTOP, das Magenmittel IBEROGAST und einige Kosmetika-Produkte. In den vergangenen Jahren standen der Gerinnungshemmer XARELTO, die Salben BEPANTHEN und ADVATAN, das Schmerz-Medikament ALKA SELTZER, die Malaria-Arznei RESOCHIN, das Krebs-Therapeutikum XOFIGO, das Kontrazeptivum YASMINELLE, das Bluthochdruck-Pharmazeutikum BAYOTENSIN sowie das pflanzliche Produkt LAIF zur Behandlung leichter bis mittelschwerer Depressionen zeitweise nicht mehr zur Verfügung. Bei den anderen Herstellern sieht es ähnlich aus. Über 400 Lieferengpässe meldete das „Bundesinstitut für Arzneien und Medizinprodukte“ im März 2023. „Wir haben eigentlich gar keine Medikamente mehr für Kinder“, schlug eine Apothekern kurz vor Weihnachten in der Rheinischen Post angesichts fehlender Fiebersäfte und Zäpfchen Alarm. Und die Präsidentin der „Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände“, Gabriele Regina Overwiening, bestätigte den Befund: „Lieferengpässe von lebenswichtigen Medikamenten – ob Blutdrucksenker, Magensäure-Blocker, Antibiotika oder Schmerzmittel – gehören leider seit Jahren zu den größten Ärgernissen und Herausforderungen im Apotheken-Alltag.“ Von den 100 Millionen Rezepten, welche Apotheken in Nordrhein-Westfalen jährlich erhalten, ist mittlerweile jedes zweite von einem Engpass betroffen, so Thomas Preis vom Apotheken-Verband Nordrhein. Vor „große Probleme“ stellt das nach den Worten von Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft, auch die Hospitäler. Ihnen mangelte es vor allem an Notfall-Medikamenten, Antibiotika und Krebspräparaten. Von einem „Armutszeugnis“ sprach angesichts dieser Lage der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und JugendärztInnen, Thomas Fischbach. Und die Rheinische Post resümierte in einem Kommentar: „Krankes Gesundheitssystem“. Pharma-Globalisierung „Derzeit sehen wir, was geschieht, wenn unsere Daseinsvorsorge globalisiert wird und in der Hand multinationaler Konzerne liegt“, konstatiert der Arzt Dr. med. Bernd Hontschik (siehe auch S. 6-7) in einem Kommentar für die taz. Dieser Prozess setzte 1994 mit der Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) ein. Schon ein Jahr später trat Indien bei und warb um die Pharma-Branche. BAYER erhörte den Ruf 1999. Als erster großer Pharmazeutika-Produzent schloss der Konzern in jenem Jahr mit einem indischen Unternehmen einen Vertrag ab. RANBAXY schaffte es, das Interesse des Leverkusener Multis für dessen eigenen – und wegen seiner zahlreichen Nebenwirkungen alles andere als unumstrittenen – Antibiotikum-Inhaltsstoff Ciprofloxacin in einer neuen Formulierung zu wecken. Ein Ciprofloxacin, von dem die PatientInnen nur einmal täglich eine Tablette zu nehmen brauchten – das war dem bundesdeutschen Konzern viel Geld wert. Für die weltweiten Vermarktungsrechte über einen Zeitraum von 20 Jahren zahlte er RANBAXY 65 Millionen Dollar. Und im selben Jahr kaufte die Firma seinem neuen Partner auch die BASICS GmbH, eine Tochter-Gesellschaft für Nachahmer-Produkte ab, um einen Brückenkopf nach Europa zu haben. Allerdings gelang der inzwischen von SUN PHARMACEUTICAL geschluckten Gesellschaft ein solcher Coup wie mit Ciprofloxacin seither nicht mehr. Darum musste sie sich weitgehend auf die Funktion des Zulieferers für Pharma-Konzerne aus den Industrie-Ländern beschränken, was auch für die anderen indischen Hersteller gilt. Zusammen mit Firmen aus China, das seit dem WTO-Beitritt im Jahr 2001 ebenfalls eine große Arznei-Fertigung aufgebaut hat, bilden sie die ersten Glieder in der globalen Wertschöpfungskette von Big Pharma. Mit Slogans wie „Maximale Förderung – minimale Kontrolle“ buhlten sie um Ansiedlungen und hatten Erfolg: Mittlerweile stammen 60 Prozent aller Hilfs- und Wirkstoffe von dort. Europäische Hersteller konnten dem Kostendruck oftmals nicht standhalten und schlossen reihenweise ihre Produktionen. BAYER beispielsweise besitzt nur noch fünf eigene Fabriken zur Herstellung von Arznei-Zwischenstoffen, drei in Deutschland, eine in Spanien und eine in Mexiko. Aber die konkurrenzlos billige Fertigung hat ihren Preis. Zahlen tun den Mensch, Tier und Umwelt. Besonders die Einleitung von antibiotika-haltigen Abwässern in die Flüsse und Seen entfaltet eine fatale Wirkung. Durch die permanente Zufuhr der Substanzen gewöhnen sich die Krankheitserreger nämlich an diese und bilden Resistenzen heraus. Solche „Superbugs“ verbreiten sich nirgendwo auf der Welt so stark wie in Indien. Allein im Jahr 2013 starben dort 58.000 Babys, weil sie sich mit Keimen infiziert hatten, gegen die kein Kraut mehr gewachsen war. Das höchste Risiko stellt dabei einer Untersuchung zufolge, die das Fachjournal The Lancet Planetary Health veröffentlichte, das von BAYER entwickelte Ciprofloxacin dar. Nicht nur das jedoch, was von den Fabriken nach außen dringt, stellt eine Bedrohung dar, auch das, was innen drin geschieht, gibt nicht selten Anlass zur Besorgnis. Immer wieder nämlich fallen die Fertigungsstätten durch fehlerhafte Produkte auf. So lieferte das Unternehmen ZHEJIANG HUAHAI 2018 Chargen des blutdruck-senkenden Wirkstoffs Valsartan aus, die mit der krebserregenden Sub-stanz Nitrosamin verunreinigt waren. Ursache der Kontamination: Die Umstellung auf ein kostengünstigeres, aber fehleranfälligeres Herstellungsverfahren, das die EU-Behörden abgesegnet hatten. In den letzten Monaten gerieten vor allem Husten- und Erkältungssäfte ins Zentrum der Aufmerksamkeit. In Indonesien starben 200 Kinder, in Gambia 70 und in Usbekistan 20 Mädchen und Jungen an akutem Nierenversagen, weil die von indischen oder indonesischen Herstellern stammenden Präparate giftiges Diethylenglykol und Ethylenglykol enthielten. Die Firmen mussten die Fertigung vorerst einstellen, was sofort Probleme nach sich zog. ZHEJIANG HUAHAI zum Beispiel belieferte allein in Deutschland 16 Unternehmen mit Valsartan, und andere Konzerne, die hätten einspringen können, existierten kaum. Bei anderen Medikamenten verhält es sich in solchen Situationen oder bei Produktionsstörungen ähnlich, denn die Globalisierung frisst auch ihre asiatischen Kinder und dünnt die Zahl der Anbieter immer weiter aus. So gab es bereits 2015 für 23 Antibiotika-Wirkstoffe nur noch einen einzigen Fabrikanten. Aber auch in Europa lichtete sich der Markt. Von den elf Herstellern etwa, die in Deutschland 2010 den Bedarf an Hustensäften auf Paracetamol-Basis deckten, blieb bis heute nur noch ein einziger übrig. Corona ließ die Warenströme dann noch mehr stocken, nicht nur weil die Produktion in chinesischen Werken länger stillstand. Sowohl das Reich der Mitte als auch Indien verhängten nämlich zeitweilig Export-Verbote, um die Arzneimittel-Versorgung ihrer eigenen Bevölkerung zu sichern. Die Unternehmen, die diese nicht patent-geschützten Standard-Medikamente – die sogenannten Nachahmer-Präparate oder Generika – vertreiben, machen die Rabattverträge der Krankenkassen für die Lage verantwortlich. Diese förderten einen ruinösen Wettbewerb entlang der gesamten Lieferkette, den immer mehr Firmen nicht mehr bestehen könnten, so das Lamento. „Die aktuellen Engpässe sind Folge eines jahrelangen Drucks auf Preise und Herstellungskosten bei Generika“, hält der Verband „Pro Generika“ fest. Allerdings klagt er auf hohem Niveau. STADA etwa konnte den Umsatz mit diesen Mitteln im Geschäftsjahr 2022 um acht Prozent auf 1,4 Milliarden Euro erhöhen. Angesichts dessen teilt auch die BUKO PHARMA-KAMPAGNE die Einschätzung der Lobby-Organisation nicht. Die Lieferengpässe beträfen längst nicht nur die Nachahmer-Arzneien, schon allein deshalb verfange der Vorwurf Richtung Krankenkassen nicht, so der BUKO. Zudem garantierten die langfristigen Vereinbarungen mit AOK & Co. den Herstellern kontinuierliche Einnahmen. „Trotzdem wird eher bei Generika als bei patentgeschützten Medikamenten an der Kostenschraube gedreht“, räumt der BUKO ein: „Mit neuen patentgeschützten Medikamenten lässt sich extrem viel Geld verdienen.“BAYERs Strategiewechsel
So verlangt BAYER in den USA für die Behandlung mit dem Krebsmittel VITRAKVI die Kleinigkeit von 32.800 Dollar im Monat – zum Vergleich: Der Paracetamol-Fiebersaft für Kinder trägt den Produzenten gerade einmal 1,32 Euro ein. In der Branche hat sich eine veritable Zwei-Klassen-Medizin herausgebildet. Auf der einen Seite stehen die Anbieter der gängigen Pharmazeutika, welche 80 Prozent der Grundversorgung leisten, dafür von den Krankenversicherungen aus ihrem Pillen-Etat aber nur sieben Prozent der Mittel erhalten, und auf der anderen Seite die Pillen-Riesen, die mit ihren – allzu oft nicht gerade Wundermittel-Eigenschaften aufweisenden – Erzeugnissen die restlichen 93 Prozent des Budgets auffressen. Wegen dieser Rendite-Aussichten konzentrieren sich BAYER & Co. mehr und mehr auf die besonders teuren Medikamente. SANOFI hat es sogar schon geschafft, die „Spezialmedizin“ zum umsatzstärksten Bereich des Unternehmens zu machen. Apotheke der Welt wollen die Pillen-Riesen schon lange nicht mehr sein. Einige von ihnen haben ihre Generika-Abteilungen bereits ganz abgestoßen. Auch an der Suche nach den so dringend benötigten neuen Antibiotika-Wirkstoffen haben die Konzerne kein gesteigertes Interesse. „Wir müssen Geld verdienen mit unseren Produkten. Das führt dazu, dass nicht alle Medikamente entwickelt werden, die wir brauchen“, mit diesen Worten umriss der ehemalige BAYER-Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers einmal die politische Ökonomie des Medikamenten-Geschäfts. Der Leverkusener Multi vollzog diesen Strategie-Wechsel hin zu den lukrativen „High priority“-Projekten Anfang der 2000er Jahre. Damals begann er, sich peu à peu von Gebieten wie Atemwegs- und Infektionskrankheiten, Asthma und Urologie zu trennen. Stattdessen legte das Unternehmen den Fokus auf Arzneien gegen Krebs oder seltene Krankheiten und behält den Kurs bis heute bei. „[T]endenziell werden sich die Prioritäten in Richtung hochspezialisierter Therapien verschieben“, sagte Pharma-Chef Stefan Oelrich 2022 dem Handelsblatt. Zu diesem Behufe baut der Global Player etwa in Berlin mit der Charité als Partner und Subventionen in Millionen-Höhe ein Zentrum für Gen- und Zelltherapie auf, das Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem Besuch im Februar 2023 dann auch noch als Beleg dafür feierte, dass Deutschland in Sachen „Technologie und Wissenschaft“ immer vorne mit dabei ist. Die Industrie sieht in diesem Rückzug erwartungsgemäß kein Problem. Sie befürchtet jedoch eine Umverteilungsdiskussion innerhalb der Branche. Sie geht deshalb in die Offensive und versucht krampfhaft, eine Verbindung zwischen den fehlenden Hustensäften und den Hightech-Präparaten zu stiften. Der von BAYER gegründete „Verband der forschenden Arzneimittel-Hersteller“ (VFA) erdreistet sich sogar, noch mehr staatliche Unterstützung für Rendite-Projekte wie BAYERs Zentrum für Gen- und Zelltherapie zu fordern. „Innovationskraft am Standort halten und ausbauen“ ist dem VFA zufolge das Gebot der Stunde. „Arzneimittel-Engpässe werden nur dauerhaft vermieden, wenn die Dynamik des Innovationskreislaufs in der Arzneimittel-Entwicklung besser als bisher genutzt wird. Denn: Was bei der Neuentwicklung und Produktion von innovativen Arzneimitteln und Therapien fehlt, wird nie der Regelversorgung mit Generika ankommen“, heißt es in dem 5-Punkte-Plan des Verbands. Und eine Rückabwicklung der globalisierten Pillen-Herstellung kommt für die Firmen auch nicht in Frage. „Vor einer Nationalisierung der Lieferketten kann ich nur warnen“, sagte BAYERs Vorstandsvorsitzender Werner Baumann in einem FAZ-Interview. Dem VFA schwebt eine andere Lösung vor. Es könnte „für Krisenfälle ein Mechanismus zur Bereitstellung von Reserve-Produktion etabliert werden“, deren Kosten natürlich die Bundesregierung trägt. Auch er rät dringend vom Aufbau einer Produktion in Deutschland für alle versorgungsrelevanten Wirkstoffe ab. Allenfalls auf EU-Ebene käme so etwas für die Lobby-Organisation in Frage.Und die Politik?
Die Lieferengpässe legen die ganze Disfunktionalität des Pharma-Marktes offen. Aber die Politik reagiert hilflos und will der Branche das Leben noch ein wenig leichter machen, obwohl das Arzneimittel-Gesetz den Pillen-Herstellern die Pflicht auferlegt, für „eine angemessene und kontinuierliche Bereitstellung“ ihrer Pharmazeutika zu sorgen. Das 2019 von dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf den Weg gebrachte „Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittel-Versorgung“ sah nur ein paar mehr Inspektionen vor Ort in Asien und strengere Transparenz-Regeln vor, was kaum einen Effekt hatte. Sein Nachfolger Karl Lauterbach (SPD) startete deshalb einen neuen Versuch, das Problem in den Griff zu bekommen. Mitte Februar präsentierte er den ReferentInnen-Entwurf eines Paragrafen-Werks „zur Bekämpfung von Liefer-Engpässen bei patentfreien Arzneimitteln und zur Verbesserung der Versorgung mit Kinder-Arzneimitteln“. Dieses nimmt Medikamente für Jungen und Mädchen von den Festbetragsregelungen aus. Bei anderen Präparaten gestattet der Gesetzgeber den pharmazeutischen Unternehmen, um bis zu 50 Prozent über den Festbetrag hinauszugehen. „[E]in beeindruckendes Weihnachtsgeschenk für die Pharma-Unternehmen“ nannte das der „Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung“, als die Pläne im letzten Dezember bekannt wurden. Dafür zahlen müssen die ärmeren Länder. Nach Ansicht des Gesundheitsökonomen Wolfgang Greiner droht diese Regelung nämlich einen „internationalen Überbietungswettbewerb“ loszutreten, aus dem Staaten mit weniger finanziellen Ressourcen schon frühzeitig aussteigen müssen. „Da wäre eine europäische Abstimmung gut gewesen“, sagt er deshalb. Derzeit leidet besonders Belgien unter dem Medikamenten-Mangel. So spricht Olivier Delaere vom Arznei-Großhändler FEBELCO von einer „künstlichen Verknappung“, weil die Hersteller bei ihren Lieferungen Nationen mit fetteren Pillen-Budgets bevorzugen würden. Mit weiteren Präsenten will die Ampelkoalition BAYER & Co. auch dazu bewegen, verstärkt nach den so dringend benötigten neuen Antibiotika zu forschen. Sie stellt ihnen in Aussicht, bei der Einführung dieser Mittel länger als sonst üblich Mondpreise verlangen zu dürfen. Und zur Gewährleistung von mehr Liefersicherheit bei den gängigen Substanzen wie Ciprofloxacin lockt der ReferentInnen-Entwurf bei einer Produktion in Europa mit Rabatten. Gleiches gilt für Krebs-Therapeutika. Zur Begründung führt das Schriftstück nicht mehr länger nur die Anfälligkeiten der sich über den halben Globus erstreckenden Wertschöpfungsketten an, sondern auch geopolitische Überlegungen. Von „strategischen Abhängigkeiten“ ist nun die Rede, die es abzubauen gelte. Etwas verklausuliert heißt es dazu: „Aufgrund globaler Krisen ist ein Umdenken, gerade auch im vergabe-rechtlichen Bereich unerlässlich, um eine Widerstandsfähigkeit der Arzneimittel-Versorgung mit lebensnotwendigen Arzneimitteln gegen solche Ereignisse herzustellen. So ist die Neuregelung mit Bezug zu solchen Staaten erforderlich, mit denen mehr als bloße wirtschaftliche Abkommen bestehen.“ Nämlich politische. Eine Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zu Partner-Nationen proklamiert das Dokument – „Friendshoring“ lautet der Fachbegriff. Ansonsten bleibt es bei Vorschriften zu einer längeren Lagerhaltung, einer Vereinfachung des Medikamenten-Austausches zwischen den einzelnen Apotheken und der Etablierung eines besseren Frühwarn-Systems. An das Grundproblem eines dysfunktionalen Pharma-Markts wagt sich Gesundheitsministerin Karl Lauterbach (SPD) nicht heran. Im Gegenteil: Er belohnt BAYER & Co. sogar noch für ihre Versäumnisse und macht Millionen-Subventionen locker. Allein die Kosten für die neuen Regelungen zu den Kinder-Arzneien beziffert der Gesetzes-Vorschlag mit rund 160 Millionen Euro. Und zu allem Überfluss ist es auch noch mehr als fraglich, ob das viele Geld helfen kann, die Pharmazeutika-Grundversorgung in Zukunft sicherzustellen.EU unter Einfluss
Lobby-Europameister BAYER
Der BAYER-Konzern lässt sich den Versuch, Entscheidungen der Europäischen Union in seinem Sinne zu beeinflussen, viel kosten. Rund sieben Millionen Euro wendete er im Jahr 2021 für Lobby-Aktivitäten in Brüssel auf. Kein anderes Unternehmen der Welt investierte mehr Geld in die Pflege dieser politischen Landschaft.Von Jan Pehrke
Mit einem Etat von 6,5 bis 7 Millionen Euro versuchte der BAYER-Konzern im Jahr 2021, auf Entscheidungen der Europäischen Union Einfluss zu nehmen. Damit steigerte der Global Player seine Ausgaben gegenüber 2020, als er rund 4,4 Millionen Euro investierte, noch einmal beträchtlich. Kein Unternehmen der Welt betrieb die Pflege der politischen Landschaft in Brüssel mit einem höheren finanziellen Aufwand, wie eine Recherche der beiden Initiativen CORPORATE EUROPE OBSERVATORY und LOBBYCONTROL im EU-Transparenzregister ergab. Der Leverkusener Multi kann sich also mit Fug und Recht Lobby-Europameister nennen. In Deutschland hingegen reichte es mit einem Aufwand von bis zu 1,99 Millionen Euro nicht zu einem Platz unter den ersten Zehn. In Brüssel steuert die Aktien-Gesellschaft die Aktivitäten von ihrem „Verbindungsbüro“ in der Rue Belliard aus. „Die Wirtschaft hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, sich in den politischen Entscheidungsprozess einzubringen“, sagte der der damalige BAYER-Chef Manfred Schneider bei der Eröffnung im Jahr 2000. 74 LobbyistInnen beschäftigt der Agro-Riese dort mittlerweile. 15 von ihnen haben exklusiven Zutritt zum Europäischen Parlament. Treffen mit den Abgeordneten oder ranghohen VertreterInnen der EU-Kommission bzw. den KommissarInnen selbst stehen deshalb ganz oben auf der Prioritäten-Liste. Aber auch Events für die „Brüsseler stakeholder“, das Verfassen von Eingaben, die Beteiligung an den Konsultationsprozessen im Rahmen neuer EU-Vorhaben, das Presse-Sponsoring, die (Co-)Finanzierung von Studien und das Engagieren von PR-Agenturen für Spezialaufgaben gehören zum Aufgaben-Gebiet der AntichambriererInnen. Ein Übriges tun dann die Industrie-Verbände Business Europe, Croplife Europe, Copa-Cogeca oder CEFIC, der Verband der Europäischen Chemischen Industrie. Allein im Jahr 2021 beackerten die Konzern-LobbyistInnen Themenfelder wie den Green Deal, die EU-Agrarstrategie, die Aktionspläne für eine Reform des Patentrechts und für eine Reduzierung der Verschmutzung von Wasser, Luft und Boden. Auch die Gentechnik-Regulierung, die Pestizid-Regulierung im Allgemeinen und die von Glyphosat im Besonderen sowie die Revision der Regulierung von Arzneien für seltene Krankheiten standen auf ihrer Agenda. Zudem brachten die Einfluss-ArbeiterInnen den BAYER-Standpunkt in Sachen „Wasserrahmen-Richtlinie“, „Trinkwasser-Richtlinie“ und „Chemikalien-Richtlinie“ zu Gehör. Und die Klima-Politik der EU sowie das geplante Abkommen mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay gehörten ebenfalls zu ihren Einsatz-Gebieten.Kein Nein-Sager
Als bloßer Nein-Sager betätigt sich das Unternehmen dabei nicht. Die Strategie besteht vielmehr immer darin, zuvörderst ein vollmundiges Bekenntnis zu den EU-Plänen abzulegen, um anschließend mit konkreten Vorschlägen zur Erreichung der Ziele aufzuwarten, was die Anmutung eines konstruktiven Beitrages hat, sich bei näherer Betrachtung aber als nett verpackte Obstruktionspolitik entpuppt. Ein Beispiel dafür ist der vom CORPORATE EUROPE OBSERVATORY (CEO) öffentlich gemachte Brief, den BAYERs damaliger Cropscience-Chef Liam Condon im Juli 2020 an den Kommissions-Vizepräsidenten Frans Timmermans schrieb. Während der Konzern in dem breit über die EU-Politik berichtenden Portal Politico, das er ebenso großzügig wie sein Pendant Euroactiv sponsert, Panikmeldungen zum Green Deal absetzte und vor einem Rückgang der Nahrungsmittel-Produktion in Europa und steigenden Weltmarkt-Preisen für landwirtschaftliche Güter warnte, hört sich dies in dem Schreiben ganz anders an. Dort dankt Condon dem Holländer bereits im ersten Satz überschwenglich für seine Pionier-Arbeit bei der Entwicklung des Green Deals und ruft ihm dann die letzten virtuellen Tête-à-Têtes in Erinnerung, die im Rahmen des Davoser „World Economic Forums“ stattgefunden haben. Anschließend präsentiert er das grüne Glaubensbekenntnis des Leverkusener Multis. „BAYER sieht sich in der Pflicht, neue Nachhaltigkeitsstandards für die Landwirtschaft und die Gesundheitsbranche zu setzen, und teilt die Ziele der Europäischen Kommission in Bezug auf Klimaneutralität, ein nachhaltigeres und resilenteres Ernährungssystem und die dringende Notwendigkeit, den Prozess des Biodiversitätsverlustes weltweit zu verlangsamen und – bald schon – umzukehren“, tut Condon kund. Dann kommt jedoch das „Aber“: „Wir sind allerdings auch der festen Überzeugung, dass der neue Green Deal nur dann erfolgreich sein wird, wenn dem Bedarf nach mehr Innovation zur Gewährleistung eines höheren Levels an Nachhaltigkeit Rechnung getragen wird.“ Und als eine solche Innovation sieht Condon die Gensoja-Pflanze mit der Laufnummer MON87708 x MON 89788 x A5547-127 an, aber leider warte BAYER bereits „länger, als es die gute Verwaltungspraxis gebietet“ auf die Import-Genehmigung der EU. Dabei kann die Laborfrucht in seinen Augen Regenwald retten, weil sie höhere Erträge pro Hektar verspricht und so dem Flächenverbrauch Einhalt gebietet. Dass die Markt-Einführung der Gen-Gewächse in Lateinamerika die Kahlschläge massiv befördert haben, lässt er dabei geflissentlich außer Acht. Auch als probates Mittel, um die durch die Corona-Pandemie angeblich gefährdete Nahrungsmittel-Sicherheit zu garantieren, bringt der Ire das Gen-Konstrukt ins Spiel. Darum bittet er den Vize-Präsidenten der EU-Kommission, bei der Import-Zulassung, die der Konzern 2016 beantragt hat, doch ein wenig auf die Tube zu drücken. Und siehe da: Noch nicht einmal drei Monate später gab es das Ja-Wort aus Brüssel zu dem Soja. Nach einem ähnlichen Muster verliefen die Interventionen zur Agrar-Strategie des Green Deals. Nach Ansicht der EU gibt diese „eine umfassende Antwort auf die Herausforderungen nachhaltiger Lebensmittel-Systeme und erkennt an, dass gesunde Menschen, gesunde Gesellschaften und ein gesunder Planet untrennbar miteinander verbunden sind“. Auf der „Vom Hof auf den Tisch“-Agenda steht unter anderem eine Verringerung des Pestizid-Einsatzes bis 2030 um 50 Prozent. BAYER-Chef Werner Baumann kritisierte das der FAZ gegenüber vehement. „Es wäre illusorisch zu glauben, wir könnten ohne Pflanzenschutzmittel die bald acht Milliarden Menschen auf der Erde ernähren, die Biodiversität schützen und zugleich keine weiteren Flächen für die Landwirtschaft erschließen“, sagte er in dem Interview. Bei einer Anhörung der Europäischen Union zu diesem Thema zeigte sich das Unternehmen hingegen dialogbereiter. „Anstatt über die Verringerung der Mengen zu sprechen, müssen wir uns auf die Verringerung der Umwelt-Auswirkungen konzentrieren“, forderte der Konzern in einer öffentlichen Anhörung. Und in einem Meeting mit der Generaldirektion Gesundheit bot er sich dann an, die schädlichen Effekte um 30 Prozent zu senken. Bei der Frage, wie der Konzern das genau erreichen will, mussten die UnternehmensvertreterInnen allerdings passen. „Das ist noch nicht klar“, lautete die Antwort. Für ein spezielles Pestizid legten sich die BAYER-LobbyistInnen besonders ins Zeug: Glyphosat, das profitträchtigste Ackergift des Konzerns. So mischten sie sich etwa in den Prozess der Überprüfung der bestehenden Grenzwerte für das Herbizid ein. Die größte Aufmerksamkeit widmete das Verbindungsbüro allerdings dem Bemühen, eine Zulassungsverlängerung zu erwirken. Dabei versicherte sich der Agro-Multi auch externer Zuarbeit und engagierte für schlappe 1,3 Millionen die RUD PEDERSEN GROUP, um in Brüssel gut Wetter für das umstrittene Mittel zu machen.Krieg als Vorwand
Hatte die Branche schon die Corona-Pandemie instrumentalisiert und wegen der dadurch angeblich gefährdeten Lebensmittel-Versorgung gegen Regulierungspläne gewettert und ihre neuen Risiko-Technologien als Problemlöser beworben, wie nicht nur der Condon-Brief an Timmermans zeigt, so wiederholte sich das Ganze beim Ukraine-Krieg. Auch den nahmen BAYER & Co. zum Anlass, gegen den Green Deal und dessen Pläne zur Pestizid-Reduktion zu opponieren und freie Fahrt für die Gentechnik 2.0 zu verlangen, ganz so, als ob dadurch mehr Weizen aus Russland und der Ukraine in den Globalen Süden gelangen würde. „Business Europe“, der Interessensverband der Multis auf europäischer Ebene, mahnte beispielsweise, neue Vorschriften nur zu erlassen, „wenn dies unbedingt erforderlich ist“. Der LandwirtInnen-Verband „COPA COGECA“ stimmte da nach Informationen des CORPORATE EUROPE OBSERVATORY mit ein. Bei einem Treffen mit Mihail Dumitru und Pierre Bascou von der Generaldirektion Gesundheit warnte ein Vertreter der Lobby-Organisation: „Der Landwirtschaftssektor kann keine neuen Schocks mehr verkraften.“ Als einen dieser Schocks, den die Bauern und Bäuerinnen nicht mehr verarbeiten könnten, nannte er dann die „Sustainable Use of Pesticides Regulation“ (SUR), mit der die EU das Ziel, den Gebrauch von Ackergiften bis zum Jahr 2030 um 50 Prozent zu senken, amtlich machen will. Kommissionsvize Timmermans zeigte sich erbost über diese Operationen. „Den Krieg in der Ukraine zu nutzen, um Vorschläge zu verwässern und den Europäern Angst zu machen, dass Nachhaltigkeit weniger Lebensmittel bedeutet, ist offen gesagt ziemlich unverantwortlich. Denn die Krise des Klimas und der biologischen Vielfalt springt uns ins Auge (...) Das ist es, was unsere langfristige Ernährungssicherheit bedroht“, stellte er klar. Und auf die Frage, warum verbindliche Ziele zur Senkung des Pestizid-Einsatzes nötig sind, sagte der Niederländer: „Nun, wir brauchen verbindliche Ziele, weil wir es bereits mit unverbindlichen Zielen versucht haben, die uns nicht weitergebracht haben.“ Damit spielte er auf die Richtlinie 1107/2009 an, nach der die Europäische Union bestimmte Pestizide als besonders gefährlich klassifizierte und die Mitgliedsstaaten anhielt, 53 besonders giftige möglichst schnell durch harmlosere zu ersetzen, was allerdings in keinem einzigen Fall geschah. Darum verteidigte der EU-Politiker das Vorgehen Brüssels: „Verbindliche Ziele geben der Industrie und dem Agrarsektor Sicherheit. Und außerdem drängen uns die Bürger dazu, dies zu tun. Die Einsicht, dass der Ökozid eine unmittelbare Bedrohung für uns ist, ist groß und wächst.“EU beugt sich
Aber es half alles nichts. Schlussendlich musste die EU sich dem Druck von BAYER & Co. beugen. Kurz vor Weihnachten 2022 schickte sie den Plan, den Pestizid-Gebrauch bis zum Jahr 2030 um die Hälfte zu senken, in die endlosen Weiten einer erneuten Folge-Abschätzung, weil die alte „auf Daten beruht, die vor dem Ausbruch des russischen Krieges in der Ukraine erhoben und analysiert wurden“ und deshalb nach Meinung der Mitgliedsländer dessen „langfristigen Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit des EU-Agrarsektors nicht berücksichtigt“. Auch verschwand das Vorhaben, die Ausfuhr von innerhalb der EU nicht zugelassenen Ackergiften in Drittländer zu verbieten, von der Agenda für das Jahr 2023. Darüber hinaus setzte die EU-Kommission einige Beschlüsse der „Gemeinsamen Agrarpolitik“ (GAP) aus. So erlaubte sie bei der Fruchtfolgen-Regelung Ausnahmen und setzte die Auflagen zur Flächenstilllegung aus, die dem Artenschutz dienen sollten. Andere umweltpolitische Maßnahmen wie eine schärfere Chemikalien-Regulierung mussten vorerst ebenfalls dran glauben oder deutliche Aufweichungen hinnehmen wie die Methan-Verordnung. Getreu der alten Maxime von Winston Churchill „Lass niemals eine Krise ungenutzt verstreichen“ gelang es den Konzernen also wieder einmal, die Brüsseler Politik in Schach zu halten. BAYERs Lobby-Millionen erwiesen sich deshalb als gut angelegtes Geld. Und 2023 könnte es sogar noch das eine oder andere Milliönchen mehr werden, denn da stehen für den Konzern gleich zwei wichtige Dinge auf der EU-Agenda: Die Entscheidung über die Regulierung von CRISPR/Cas und anderen neuen Gentechniken sowie diejenige über die Glyphosat-Zulassungsverlängerung.Die üblen Methoden der BAYER-Tochter MONSANTO
Die Hetzjagd
Der französische Molekularbiologe Gilles-Èric Séralini berichtet in seinem Buch „Die Affäre um die MONSANTO-Papers“ von den systematischen Versuchen von BAYERs jetziger Tochter-Gesellschaft MONSANTO, ihn als Wissenschaftler kaltzustellen. Er hatte nämlich im Jahr 2012 eine bahnbrechende Studie zur Toxizität des Pestizids ROUND-UP mit dem Wirkstoff Glyphosat veröffentlicht, die es aus der Welt zu schaffen galt. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN kennt solche Machenschaften aus eigener Erfahrungen und durfte zu Séralinis Werk deshalb das Nachwort schreiben.Von Marius Stelzmann
Professor Gilles-Éric Séralini ist seit 1990 an der Universität von Caen tätig und unterrichtet dort das Fach „Toxikologie“. Bereits mit 30 Jahren bestand er als einer der jüngsten KandidatInnen das Auswahlverfahren für UniversitätsprofessorInnen und zählt heute zu denjenigen ForscherInnen, die am häufigsten in Fachpublikationen zum Thema der Toxizität von gentechnisch veränderten Organismen (GMO) und Pestiziden auftauchen. Er selbst betrachtet sich als einen öffentlichen Forscher, also als einen, der sich der Allgemeinheit verpflichtet sieht. Wie er in seinem Buch ausführlich darstellt, ist sein Beweggrund neben dem Schutz von Mensch, Tier und Umwelt stets die Bewahrung der Unabhängigkeit der Wissenschaft gewesen. Und damit rief er MONSANTO auf den Plan. Der Konzern konnte nämlich ebenso wenig wie sein heutiger Besitzer BAYER zulassen, dass unabhängige wissenschaftliche Erkenntnisse zu Glyphosat die gigantische Profitquelle untergraben, die das Pestizid darstellt. Der Forscher selbst kommentiert das Vorgehen des Multis mit den folgenden Worten: „Das Unternehmen hat gezeigt, wie bestimmte Führungskräfte die Irreleitung von Wissenschaft, Medizin und Behörden organisierten und zugleich die Fähigkeit zum kritischen Hinterfragen und den Sinn für Ethik untergruben. Und dabei verfolgten sie kurzfristige wirtschaftliche Interessen, die unsere Ökosysteme, das Klima und die Weltgesundheit zerstören.“ Oder wie die die bekannte indische Gentech-Kritikerin Vandana Shiva in ihrem Vorwort zu dem Buch feststellt: „Diese gefährliche Kon-trolle über Ernährung und Landwirtschaft entwickelt sich zu einer massiven Einflussnahme auf die Grundlagen von Wissenschaft und Bildung“. Séralini schildert in „Die Affäre um die MONSANTO-Papers“ zunächst seine wissenschaftliche Arbeit zu Glyphosat und den Einfluss, welche diese auf die öffentliche Diskussion und auf die Prozesse von Glyphosat-Geschädigten vor US-amerikanischen Gerichten hatten. Dann widmet er sich dem Skandal der im Zuge dieser Verfahren ans Licht der Öffentlichkeit geratenen MONSANTO-Papers. Dabei handelt es sich um firmen-interne Dokumente, welche die AnwältInnen der KlägerInnen als Beweis-Material angefordert hatten. Und diesen Zweck erfüllten sie dann auch: Sie dokumentieren, wie MONSANTO systematisch die Risiken und Nebenwirkungen des Herbizids unter den Tisch kehrte und eine Schmutzkampagne gegen Glyphosat-KritikerInnen initiierte. Eine Studie aus dem Jahr 2012 hatte MONSANTO gegen Séralini aufgebracht. Diese wies in Tierversuchen – welche die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN ablehnt, weil sie nicht nötig sind, um die Schädlichkeit von bestimmten Substanzen zu erfassen – die von Glyphosat ausgehende Krebs-Gefahr nach. Oder genauer: die von ROUNDUP, dem handelsfertigen Produkt, ausgehende Krebs-Gefahr. Séralini zufolge ist dieses nämlich wegen seiner vielen Hilfs- und Zusatzstoffe noch einmal gefährlicher als Glyphosat „pur“. Séralini unterstreicht in seinem Buch auch die Bedeutung, die seine Studie allgemein für Forschung und Erkenntnisse über Gentech-Pflanzen und Pestizide hatte. Der Soziologe Francis Chateauraynaud, Studienleiter an der französischen Elite-Hochschule „École des hautes études en sciences sociales“, sagte bereits kurz nach der Veröffentlichung: „Es wird ein Vor und ein Nach Séralini geben“. In seiner Untersuchung belegte dieser nicht nur die schädliche Wirkung von ROUNDUP, sondern auch die von gentechnisch veränderten Organismen selbst. Der Grund: Die genetisch manipulierten Pflanzen speichern die verabreichten Giftstoffe, anstatt sie abzubauen. ROUNDUP war vorher noch nie langfristig gestestet worden. Ein Fakt, den die Pestizidlobby laut Séralini mit großem Aufwand zu rechtfertigen versuchte. Infolge der Publikation dieser Ergebnisse bricht ein beispielloser Verleumdungs- und Propagandasturm über den Molekularbiologen herein. Der von MONSANTO als Schreiber engagierte Journalist Henry Miller veröffentlicht über das in London ansässige Science Media Centre (SMC), das unter anderem von der Agrar-Branche alimentiert wird, einen diffamierenden Artikel über Séralinis Ergebnisse. Ab diesem Zeitpunkt wird Séralini von den Lügen und Angriffen der Industrie ständig begleitet. So legt er beispielsweise dar, wie ihm in offiziellen Ausschüssen bei weiterem unbotmäßigem Verhalten negative Konsequenzen für seine Karriere in Aussicht gestellt wurden. Nicht einmal vor der Androhung von Gewalt schrecken seine GegnerInnen zurück. Und selbst die Familie sparten sie dabei nicht aus. Eine Strategie der jetzigen BAYER-Tochter zielte darauf ab, Séralini in der wissenschaftlichen Community systematisch zu diskreditieren. Zu diesem Behuf verfasst etwa der Wissenschaftler Marcel Kuntz ein Buch mit dem Titel „Die Séralini-Affäre. Die Sackgasse einer militanten Wissenschaft“, das ParlamentarierInnen verschiedener Länder zugeht. Kuntz besitzt selber Patente auf genetische Transformationstechniken und verdient laut Séralini Geld damit. Insgesamt sieben Gerichtsverfahren muss der Wissenschaftler gegen Interessen- und Lobbygruppen von MONSANTO führen. Er gewinnt alle. Und die Veröffentlichung der MONSANTO-Papers erbringt schließlich konkrete Beweise für die Schmutzkampagne, die der Multi gegen den Forscher angezettelt hat. Nicht weniger als 55.952 Mal taucht der Name „Séralini“ in den MONSANTO-Dokumenten auf. Das Buch dokumentiert eindruckvoll, wie ein Weltkonzern, der seine Profite sichern will, gegen einen Konzern-Kritiker alle Register zieht. Umso stolzer ist die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) darauf, dass sie das Nachwort zu „Die Affäre um die MONSANTO-Papers“ hat beisteuern dürfen. Aus gegebenem Anlass: Die Coordination hat allzu oft am eigenen Leib gespürt, was es heißt, von einem Weltkonzern zum „Public Enemy No. 1“ erkoren zu werden. So musste sie nach einer Klage vom Leverkusener Multi bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen, um die Freiheit zu erstreiten, die BAYER-Machenschaften – ganz gemäß der Botschaft Séralinis – als Gefahr für die Demokratie bezeichnen zu können. Dass es sowohl der CBG damals wie Professor Séralini heute gelang, sich zu guter Letzt durchzusetzen, sollte alle KämpferInnen gegen Konzernmacht ein Fanal sein und Mut machen.Interview mit Alan Tygel über die Lage in Brasilien
„Konflikte sind zu erwarten“
Am 1. Januar des Jahres hat Luiz Inácio Lula da Silva offiziell den Rechtsextremen Jair Bolsonaro als Präsident von Brasilien abgelöst, hinter dem die versammelte Agro-Industrie des Staates stand. Stichwort BAYER sprach mit Alan Tygel von der PERMANENTEN KAMPAGNE GEGEN AGRAR-GIFTE UND FÜR DAS LEBEN über die Chancen für eine umweltverträglichere, auf eine kleinbäuerlichere Landwirtschaft setzende Agrar-Politik, das Mercosur-Abkommen und die allgemeine politische Lage in dem Land nach dem Regierungswechsel. Stichwort BAYER: Präsident Lula erklärte in seiner Antrittsrede, den energetischen und ökologischen Wandel hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft und einem nachhaltigen Bergbau, zu einer Stärkung der bäuerlichen Familienbetriebe und einer grüneren Industrie einleiten zu wollen. Glaubst Du an diesen Wandel? Alan Tygel: Präsident Lula wurde von einem breiten Spektrum politischer Kräfte gewählt, deren Hauptziel es war, Bolsonaro abzusetzen und die brasilianische Demokratie zu verteidigen. Trotz dieser breiten Allianz gewann Lula nur mit einem Vorsprung von weniger als zwei Prozent. Folglich muss er eine Regierung bilden, die dieses Bündnis in irgendeiner Weise widerspiegelt, da die Möglichkeiten der Regierung, das zu tun, was so dringend notwendig ist, sonst sehr gering sein werden. In diesem Zusammenhang sind Begriffe wie „nachhaltige Landwirtschaft und Bergbau“ oder „grünere Industrie“ völlig umstritten. Innerhalb der Regierung gibt es Fraktionen, die diese Konzepte auf eine unternehmerische Art und Weise verstehen und einen „grünen Kapitalismus“ unterstützen. Daneben gibt es andere, die uns näher stehen und zum Beispiel verstehen, dass eine nachhaltige Landwirtschaft nur durch eine tiefgreifende Agrarreform und einen Schutz indigenen Landes erreicht werden kann, sowie durch ein weitgehendes Verbot von Pestiziden, eine agrar-ökologische Ausrichtung der Landwirtschaft und eine starke staatliche Regulierung der Lebensmittelmärkte. Die größte Herausforderung, der wir als soziale Bewegungen uns in den nächsten vier Jahren gegenübersehen werden, besteht darin, die Regierung gegen die extreme Rechte zu verteidigen und sie gleichzeitig in Richtung unseres politischen Programms zu pushen. SWB: Hat die Regierung schon ein konkretes Programm für die Agrar-Politik verkündet? A. T.: Nein. Es gibt jedoch einige sehr positive Signale. Lula hat das „Ministerium für Agrar-Entwicklung und bäuerliche Familienbetriebe“ (MDA) neu geschaffen und die Behörde für die Nahrungsmittel-Versorgung (CONAB) sowie die „Agentur für Agrarreform“ (INCRA) in dieses Ministerium verlegt. Beide Behörden waren im Landwirtschaftsministerium angesiedelt, das sich völlig nach dem großen Agrobusiness ausgerichtet hat. Daher ist es sehr wichtig, ein weiteres Ministerium zu haben, das sich mit den bäuerlichen Familienbetrieben und der Agrarökologie befasst. Und die CONAB ist für die sehr erfolgreiche Lebensmittelankauf-Politik verantwortlich, die in den ersten Amtszeiten von Lula und Dilma etabliert wurde. Diese Politik garantiert den bäuerlichen Familienbetrieben, vor allem den agrar-ökologischen, dass ihre Produktion vom Staat aufgekauft und an Schulen, Krankenhäuser, Gefängnisse und andere öffentliche Einrichtungen verteilt wird. Ein weiteres sehr positives Signal war die Wiedereinsetzung des „Rates für Ernährungssicherheit und Souveränität“ (CONSEA), der sich mit Maßnahmen zur Beseitigung des Hungers in Brasilien befasst. Nachdem die Zahlen während der Amtszeiten von Lula und Dilma sehr niedrig waren, leiden jetzt rund 33 Millionen Menschen an Hunger und etwa 100 Millionen an Ernährungsunsicherheit. Wir sind recht optimistisch, was echte Fortschritte der Politik angeht, die Agrar-ökologie voranzutreiben. Allerdings ist die brasilianische Wirtschaft immer noch stark von der Primärproduktion der Agrarindustrie abhängig, z. B. von Soja, Mais, Baumwolle und Fleisch. Diese Abhängigkeit spiegelt sich in der großen politischen Macht dieses Sektors im Land wider, und diese Situation wird sich in nächster Zeit nicht ändern. SWB: Was müsste eurer Meinung nach als erstes geschehen? A. T.: Vorrangig geht es jetzt darum, Maßnahmen zur Bekämpfung der von der Regierung Bolsonaro hinterlassenen Hunger-Situation zu ergreifen. Die staatlichen Strukturen Brasiliens wurden in den letzten vier Jahren zerstört, einschließlich des gesamten Rahmens der sozialen Sicherheitssysteme. Lula hat bereits mehrere Maßnahmen zum Mindesteinkommen (Bolsa Família) und zur Wohnungspolitik für Menschen in größter Not angekündigt. Die nächsten Schritte müssten die landwirtschaftlichen Familienbetriebe in die Strategie zur Bekämpfung des Hungers einbeziehen, vor allem, indem die Regierung Lebensmittel aufkauft und an Bedürftige verteilt. SWB: Lula hat das Amt des Umweltministers erneut mit Marina Silva besetzt, die bereits seinen früheren beiden Kabinetten angehörte, aber im Zuge von Auseinandersetzungen um die Regenwald-Abholzungen zurücktrat. Dem neuen Landwirtschaftsminister Carlos Favaro werden dagegen Beziehungen zur Agro-Lobby nachgesagt. Ist da mit Konflikten zu rechnen? A. T.: Ohne Zweifel sind Konflikte zu erwarten, vor allem aus den bereits genannten Gründen. Im Falle von Ministerin Marina dürften die größten Konflikte in den Bereichen „Energie“, „Bergbau“ und „Infrastruktur“ auftreten. Es gibt zahlreiche laufende Projekte wie Kernkraftwerke, große Seehäfen, Eisenbahnen und Kalium-Abbau, die beispielsweise indigenes Land beeinträchtigen können. Andererseits: Wenn die brasilianische Wirtschaft in den nächsten Jahren nicht gut läuft, besteht die realistische Gefahr, dass die extreme Rechte die Wahlen gewinnt. Die Herausforderung, vor der Lula steht, ist also enorm, und wir werden sehr hart daran arbeiten, die Regierung erfolgreich zu machen. SWB: Hat die Agro-Lobby im Allgemeinen und BAYER im Besonderen geschlossen zu Bolsonaro gehalten? A. T.: Im Allgemeinen ist der Agrarsektor (Großbauern, Geschäftsleute in verwandten Bereichen usw.) sehr stark mit Bolsonaro assoziiert. Beide Lager verbindet, dass sie konservative Werte teilen und eine freigiebige Erteilung von Waffenlizenzen zur „Verteidigung ihres Privatbesitzes“ gegen landlose „Eindringlinge“ befürworten. Konkret begünstigte Bolsonaros Wirtschaftspolitik der Real-Abwertung die Agrarindustrie, da sie den Großteil ihrer Produktion exportiert und dieser Export bei einem höheren Dollarkurs profitabler wird. Im Inland verursachte die Maßnahme dagegen einen inflationären Anstieg des Sojaöl-Preises, obwohl Brasilien der größte Sojaproduzent der Welt ist. In den Regionen, in denen die Agrarindustrie stärker vertreten ist wie in den Bundesstaaten Mato Grosso und Paraná haben diese Faktoren deshalb dazu geführt, dass Bolsonaro recht massiv gewählt wurde. BAYER selbst nimmt keine klare Position ein. Die Verbände, denen BAYER angehört wie Croplife oder ABAG unterstützen jedoch Denkfabriken wie das Instituto Pensar Agro (IPA), das die Strategie der gesamten Agro-Lobby festlegt. Der derzeitige Vorsitzende der parlamentarischen Agribusiness-Front, Pedro Lupion, ist ein rigoroser Extremist und wird versuchen, der Regierung ernsthafte Schwierigkeiten zu bereiten. SWB: Stimmt es, dass die Agro-Lobby mit zu den Finanziers der Protest-Camps gehörte, die nach der Abwahl von Bolsonaro errichtet wurden? A. T.: Die Ermittlungen dauern noch an, aber einige Geschäftsleute, die mit der Agrarindustrie verbunden sind, wurden bereits als Finanziers mehrerer antidemokratischer Proteste identifiziert, darunter auch der Ausschreitungen vom 8. Januar. Am 23. Dezember 2022 platzierte George Washington De Oliveira Sousa eine Bombe in einem Tankwagen, der Treibstoff zum Flughafen von Brasília bringen sollte. Dank der Aufmerksamkeit des Fahrers wurde die Bombe entdeckt und ist nicht explodiert. George hatte enge Beziehungen zu Kongressabgeordneten der Agrarindustrie und ist Eigentümer eines Netzes von Tankstellen, Restaurants und Transportunternehmen in den Expansionsgebieten der Agrarindustrie in Pará. Wir sind sicher, dass mit dem Fortschreiten der Ermittlungen weitere Verbindungen zwischen den antidemokratischen Protesten und dem Agrobusiness aufgedeckt werden. SWB: Glaubst Du, dass es zu weiteren innenpolitischen Auseinandersetzungen kommen könnte mit der Gefahr einer Eskalation bis hin zum Bürgerkrieg oder hat sich die Lage inzwischen beruhigt? A. T.: Die Reaktion der Regierung auf die Unruhen vom 8. Januar erfolgte sehr schnell und war hart. Mehr als 3.000 Personen wurden verhaftet, und gegen mehrere andere wird bereits ermittelt. Das Finanzierungsnetz dieser Gruppen wurde schon geschwächt. Im Moment können wir also sagen, dass die Lage ruhig ist. Die Rechtsextremisten sind jedoch immer noch da, und die künftige Situation hängt stark vom Erfolg von Lulas Wirtschaftsstrategie ab, mit der Armut und Hunger bekämpft und den Menschen ihre Würde zurückgegeben werden soll. SWB: Welche Haltung hat die PERMANENTE KAMPAGNE GEGEN AGRARGIFTE UND FÜR DAS LEBEN zum Mercosur-Abkommen der EU mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay? A. T.: Das Abkommen in seiner jetzigen Form ist sehr gefährlich für die landwirtschaftlichen Familienbetriebe und für die Weiterentwicklung der Agrarökologie. Im Kern begünstigt es die Einfuhr von Industrieprodukten wie Pestiziden und die Ausfuhr von Agrar-Grundstoffen. Das ist genau das, was wir im Moment nicht brauchen, und Präsident Lula ist sich dieses Ungleichgewichts bereits bewusst. Ein Abkommen mit der EU könnte sehr positiv sein, um unsere Abhängigkeit von den USA und China zu verringern, aber es muss auf einer anderen Grundlage beruhen, einer, die eine nachhaltige Entwicklung unseres Blocks begünstigt.AKTION & KRITIK
CBG bei Friedensdemo
Um den Jahrestag des Ukraine-Krieges herum fanden in über 150 deutschen Städten Friedensdemonstrationen statt. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) ging in Köln auf die Straße, wo rund 1.500 Menschen dem Aufruf des KÖLNER FRIEDENSFORUMS: „Den Frieden gewinnen, nicht den Krieg – Waffenexporte stoppen, Waffenstillstand und Friedensverhandlungen jetzt!“ folgten. Zum Auftakt sprach Margot Käßmann, die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche. Darüber hinaus hielten unter anderem Karl-Wilhelm Koch von der UNABHÄNGIGEN GRÜNEN LINKEN, Matthias Engelke vom INTERNATIONALEN VERSÖHNUNGSBUND und Peter Köster von der IG BAU Reden. Zudem wurden Grußworte von russischen und ukrainischen KriegsgegnerInnen verlesen.CBG beim Klimastreik
Am 3. März 2023 beteiligte sich die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) in Leverkusen am Klimastreik, der dieses Mal mit dem ver.di-Streik der Bus- und BahnfahrerInnen fusionierte, um die Wichtigkeit einer Verkehrswende für die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen zu betonen. Die Blockade-Politik von Wissing & Co. stand deshalb auch im Mittelpunkt der meisten Reden, die unter anderem AktivistInnen von ver.di, BUND, FRIDAYS FOR FUTURE, der Partei „Die Linke“ und von PARENTS FOR FUTURE hielten. Aber CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann sorgte dann dafür, darüber den größten ortsansässigen Klimasünder – den BAYER-Konzern – nicht aus den Augen zu verlieren. Auf nicht weniger als drei Millionen Tonnen Treibhaus-Gase kam das Unternehmen im Jahr 2022. Auf diese Weise trug der Agro-Riese mit dazu bei, den von der Energie-Erzeugung verursachten globalen CO2-Ausstoß auf die neue Rekordmarke von 36,8 Milliarden Tonnen zu treiben, so Stelzmann. Die Folgen zeigten sich ihm zufolge 2023 schon ungewöhnlich früh mit Dürren in Frankreich und Italien durch den Schnee-Mangel in den Alpen. Alles andere als schöne Aussichten für den Sommer. Und eine Klimawende zeichnet sich weniger denn je ab. Stattdessen gibt es Rückschritte. Im Zuge des Ukraine-Krieges konnten Kohle und Gas ein Comeback feiern. Darum mahnte der CBGler am Ende seines Beitrages: „Die Klimabewegung muss auch eine Friedensbewegung sein!“In Sachen „Verschickungskinder“
Acht bis zwölf Millionen Kinder und Jugendliche gehörten von den 1950er bis 1970er Jahren zu den Verschickungskindern, die in Einrichtungen wie dem „Seehospiz ‚Kaiserin Friedrich’ Norderney“ Kuren absolvierten. Den Verschreibungen lagen konkrete medizinische Indikationen zugrunde oder aber auch nur vage Diagnosen wie Erholungsbedürftigkeit, Entwicklungsrückstände oder „Milieuschäden“. Fast alle Häuser unterwarfen ihre Schützlinge einem unerbittlichen Regime aus körperlicher und seelischer Gewalt. So wurden Untergewichtige zur Nahrungsaufnahme gezwungen, und wenn ihnen der Mageninhalt wieder hochkam, mussten sie auch noch ihr Erbrochenes essen. Die Verabreichung von sedierenden Medikamenten gehörte ebenfalls zum Reservoir. Dabei fanden nicht zuletzt BAYER-Mittel Verwendung. ATOSIL mussten schon Dreijährige schlucken, ungeachtet der Tatsache, dass die Zulassung nur für Erwachsene mit einer diagnostizierten neurologischen Störung galt. Sogar junge AsthmatikerInnen erhielten ATOSIL-Gaben, obwohl diese Erkrankung eigentlich ein Ausschluss-Kriterium für die Anwendung darstellt. Dementsprechend verursachte das Präparat bei nicht wenigen Verschickungskindern Langzeit-Schäden, die eine Frühverrentung unvermeidlich machten. Die Epilepsie-Arzneien LUMINAL und LUMINETTEN nutzten die Kurheime ebenfalls zu dem, was einige WissenschaftlerInnen „unsichtbare Fixierung“ nennen. Damit nicht genug, führten MedizinerInnen dort auch Pharma-Tests durch. So erprobte etwa Dr. Walter Goeters im Seehospiz von Norderney BAYERs Entwurmungsmittel UVILON an 42 jungen ProbandInnen. Die Praktiken in Norderney und anderswo ähnelten denen in Heimen und Kinder- und Jugendpsychiatrien, in die der Leverkusener Multi mit seinen Pharmazeutika ebenfalls involviert war. Die nordrhein-westfälischen CDU-Politikerinnen Christina Schulze Föcking und Charlotte Quik haben in der Sache nun einen Brief an die Bundesfamilienministerin Lisa Paus von der Grünen geschrieben und Handlungsbedarf angemahnt: „Wir fordern Sie auf, sich als Bund ihrer Verantwortung zu stellen, die Betroffenen zu unterstützen und sich einer politischen und wissenschaftlichen Aufarbeitung nicht zu verschließen.“Offener Brief: Kyriakides antwortet
Am 15. Dezember 2022 lief die Glyphosat-Genehmigung aus. Doch die Europäische Union schaffte es nicht, die für eine erneute Zulassung nötigen Risiko-Bewertungen fristgerecht vorzunehmen. Deshalb ließ sie das BAYER-Pestizid trotz nicht abgeschlossener Sicherheitsprüfung noch einmal eine einjährige Ehrenrunde drehen. „Technische Verlängerung“ hieß das Mittel der Wahl. Dieser Verstoß gegen den Leitsatz des vorbeugenden VerbraucherInnenschutzes löste eine Welle des Protests aus. So forderte das „Ban-Glyphosate“-Bündnis, dem die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN angehört, die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides in einem Offenen Brief auf, das Herbizid wegen seiner umfassend belegten Risiken und Nebenwirkungen für Mensch, Tier und Umwelt umgehend aus dem Verkehr zu ziehen. Dem verweigerte sich Kyriakides jedoch. In ihrem Antwort-Schreiben bedauerte sie zwar die Verzögerung, sah aber keinen Grund für einen sofortigen Bann. Dabei verwies die Zypriotin auf den „Ausschuss für Risiko-Bewertung“ (RAC) der europäischen Chemikalien-Agentur ECHA, der in dem laufenden Verfahren bereits sein Urteil abgegeben hat und laut Kyriakides zu dem Schluss kam, „dass Glyphosat auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse die Kriterien für eine Einstufung als krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend nicht erfüllt“. Und was die von „Ban-Glyphosate“ in dem Brief erwähnten neuen Studien zu den kanzerogenen Effekten des Herbizides anging, so versicherte die Gesundheitskommissarin, diese wären Teil des Prüfverfahrens.PAN kritisiert BfR
Das „Bundesinstitut für Risiko-Bewertung“ (BfR) unterstützt die Industrie bei ihrer Ablehnung der Chemikalien-Strategie der EU (siehe POLITIK & EINFLUSS). Nach Ansicht des BfR braucht es kein strengeres Regulationsregime, das vorhandene Instrumentarium reiche völlig aus. „Die ‚EU-Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit’ stellt die regulatorische Toxikologie, wie wir sie kennen, in Frage: Ist sie auf soliden wissenschaftlichen Erkenntnissen aufgebaut?“, überschrieben BfR-MitarbeiterInnen ihren in den Archives of Toxicology veröffentlichten Fachaufsatz und gaben eine eindeutige Antwort: Nein. Stattdessen singen sie ein Loblied auf die gängigen Verfahren. „Auch wenn dies von den Medien und der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird, hat die Umsetzung eines komplexen und voneinander abhängigen Systems von Vorschriften für chemische Stoffe, einschließlich Industriechemikalien, Pflanzenschutzmittel, Biozide oder Chemikalien in Lebens- und Futtermitteln, die toxikologischen Risiken minimiert und die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung in der EU kontinuierlich verbessert“, halten sie fest. Dem widersprechen Dr. Peter Clausing vom PESTIZID AKTIONS-NETZWERK (PAN) und Professor Erik Millstone von der Universität Sussex im European Journal of Risk Regulation vehement. Anders als die BfR-AutorInnen behaupten, habe die Zahl der Neugeborenen mit Anomalien zugenommen, so Millstone und Clausing. Zudem verweisen sie auf die abnehmende Fruchtbarkeit. Wegen solcher und anderer Phänomene besteht ihrer Meinung nach sehr wohl Handlungsbedarf im EU-Regelwerk zum Umgang mit chemischen Stoffen, vor allem was die Kombinationswirkungen sowie die Effekte auf das Hormonsystem und die Fortpflanzungsfähigkeit des Menschen angeht.KONZERN & VERGANGENHEIT
MEGAPHEN & Co. in LVR-Einrichtungen
Der Historiker Frank Sparing hat im Auftrag des Landesverbandes Rheinland (LVR) eine Studie zu Arznei-Verordnungen und Medikamententests in der Rheinischen Landesklinik für Jugendpsychia-trie Süchteln erstellt. Als Basis diente eine Stichprobe von 141 PatientInnen-Akten. Der Autor traf dabei auf „eine großzügige und wenig kritische Versorgungspraxis“, „die es lange Zeit für geboten hielt, verhaltensauffällige oder pflege-aufwendige Kinder mit Medikamenten ruhigzustellen“. Rund die Hälfte der PatientInnen erhielt regelmäßig Psychopharmaka. Dabei kamen Präparate des BAYER-Konzerns massenhaft zum Einsatz – wie in anderen bundesdeutschen Einrichtungen auch (SWB berichtete mehrfach). So standen die Hypnotika und Sedativa ADALIN (Wirkstoff: Carbromal), EVIPAN (Hexobarbital), LUMINAL (Phenobarbital) sowie die Neuroleptika AOLEPT (Periciacin), ATOSIL (Promethazin-HCI) und NEUROCIL (Laevomepromazin) auf der Verordnungsliste. Medikamenten-Tests widmete sich Sparing nur kurz. Er untersuchte lediglich zwei Erprobungen von Mitteln des Herstellers JANSSEN detaillierter. Genaueren Aufschluss darüber, welches Ausmaß die Arznei-Prüfungen in nordrhein-westfälischen Institutionen hatten und wie flächendeckend die Kinder- und Jugendpsychiatrien AOLEPT & Co. verabreichten, dürfte erst die für 2024 angekündigte Forschungsarbeit der Universität Düsseldorf unter Leitung von Heiner Fangerau geben.POLITIK & EINFLUSS
Abschied vom alten Kontinent
Der BAYER-Konzern kündigte an, den Schwerpunkt seines Arznei-Geschäfts künftig in die Vereinigten Staaten und nach China zu verlegen, weil dort bessere Profit-Aussichten locken. „Die europäischen Regierungen versuchen, Anreize für Forschungsinvestitionen zu schaffen, aber auf der kommerziellen Seite machen sie uns das Leben schwer“, sagte BAYERs Pharma-Chef Stefan Oelrich der Financial Times am Rande der „JP MORGAN Healthcare Conference“ in San Francisco. Dabei hatte er neben dem „Gesetz zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung“, das die Porto-Kasse des Konzerns unter anderem mit einer befristeten Erhöhung des Hersteller-Rabatts belastet, vor allem eine neue englische Regelung im Blick. Dort bittet der Staat Big Pharma traditionell zur Kasse, wenn die jährlichen Medikamenten-Ausgaben des „National Health Service“ um mehr als zwei Prozent steigen. Und im Jahr 2022 lagen die Aufwendungen in Folge der Corona-Pandemie deutlich über dieser Schwelle, weshalb BAYER & Co. Rabatte in Höhe von 26,5 Prozent einräumen mussten. „[S]ignifikante Einschnitte“ nannte Oelrich das. Darum kündigte er einen Abschied vom alten Europa an: „Wir verlagern unseren kommerziellen Fußabdruck und die Ressourcen für unseren kommerziellen Fußabdruck deutlich weg von Europa.“ In den USA sieht der Manager dagegen das Land mit den unbeschränkten Arzneipreis-Möglichkeiten, während er China für das gute Innovationsklima lobte. Allerdings führt auch das Gesundheitsministerium in Peking harte Verhandlungen um Kosten-Senkungen mit den Pillen-Riesen. Von einem „Preisdruck auf die Pharma-Industrie“ sprach deshalb BAYERs Ober-Lobbyist Matthias Berninger. Und der US-amerikanische „Inflation Reduction Act“ setzt den Rendite-Aussichten der Unternehmen ebenfalls Grenzen (s. u.).BAYER & Co. kritisieren Biden
In seiner am 7. Februar 2023 gehaltenen Rede zur Lage der Nation verteidigte US-Präsident Joe Biden noch einmal die mit dem „Inflation Reduction Act“ eingeleiteten Maßnahmen zur Reduktion der Arznei-Kosten. „Big Pharma hat den Menschen zu Unrecht Hunderte von Dollar abverlangt – und Rekord-Profite gemacht“, hielt Biden fest. „Jetzt nicht mehr“, fuhr er dann fort und legte dar, wie seine Regierung gegensteuert. So müssen Mitglieder von Medicare, der staatlichen Krankenversicherung für Senioren, jetzt für Insulin monatlich nur noch 35 Dollar zahlen und sich an den jährlichen Gesamtkosten für ihre Arznei-Versorgung bloß noch mit höchstens 2.000 Dollar beteiligen. Zudem berechtigt die Biden-Administration Medicare zu Verhandlungen mit den Pillen-Riesen über die Arznei-Preise und verlangt Rabatte, wenn diese schneller steigen als die Inflationsrate. Das US-Pendant zu dem von BAYER gegründeten „Verband der Forschenden Arzneimittel-Hersteller“, der „Pharmaceutical Research and Manufacturers of America“ (PhRMA), reagierte prompt. „Die staatlichen Preisfestsetzungsbestimmungen in dem Gesetz zwingen die Unternehmen zu schwierigen Entscheidungen, einschließlich der Verlagerung des Schwerpunkts weg von bestimmten Arten von Medikamenten und der Entmutigung der Forschung, die nach der Erstzulassung eines Medikaments stattfindet“, klagte der PhRMA.Scholz & Giffey bei BAYER
Im Vorfeld der Wahlen zum Berliner Abgeordneten-Haus besuchten die SPD-Kandidatin Franziska Giffey und Bundeskanzler Olaf Scholz den Berliner BAYER-Standort. Im Zuge dessen sicherten die beiden PolitikerInnen dem Leverkusener Multi ein schnelles Genehmigungsverfahren für das in Kooperation mit der Charité geplante Zentrum für Gen- und Zelltherapie zu. Als Beleg dafür, dass Deutschland in Sachen „Technologie und Wissenschaft“ immer vorne mit dabei ist, feierte es Scholz. Darum flossen auch schon reichlich Subventionen. Der Bund fördert den Bau mit 44 Millionen Euro und Berlin mit fünf Millionen. Pharma-Chef Stefan Oelrich zeigte sich über die Aussicht auf einen baldigen Beginn der Arbeiten hocherfreut. „Wenn es uns gelingen sollte, einen Spatenstich in diesem Jahr für dieses Zentrum zu setzen, dann wäre das sicherlich Deutschlandtempo“, frohlockte er und zog ein positives Resümée der Visite. Oelrich, der drei Wochen zuvor noch kein gutes Haar am Arznei-Standort Deutschland gelassen hatte (s. o.), ließ sich mit den Worten zitieren: „Wir haben uns sehr über den heutigen Besuch von Olaf Scholz zusammen mit Franziska Giffey und ihr Interesse an unserem Unternehmen gefreut. Die Pharma-Industrie befindet sich inmitten eines enormen Wandels. Bahnbrechende Innovationen haben das Potenzial, Leben zu verändern und zu retten. Um diese Innovationen schneller in Produkte umsetzen zu können, ist die gute Kooperation aller Beteiligter wie der Industrie, der regulatorischen Behörden und der Politik notwendig.“Scholz bekennt sich zur Chemie
Bundeskanzler Olaf Scholz hat BAYER & Co. seinen Beistand versichert. Wir wollen, dass Deutschland Chemie-Standort bleibt und dass wir gleichzeitig eine CO2-neutrale Zukunft haben“, sagte er. Und der Sozialdemokrat kündigte auch gleich ein neues Instrument zur Standort-Pflege an. „Wir werden dafür sorgen, dass es ein ganz spezielles Format gibt, wo wir über die Zukunft der chemischen Industrie sprechen “, so Scholz.Scholz bekennt sich zu Pharma
Bei einem Besuch des Marburger BIONTECH-Standortes versprach Bundeskanzler Olaf Scholz der ganzen Branche seine Unterstützung. „[S]chnellere Genehmigungsverfahren, das gilt für Fabriken, aber genauso für neue Medikamente, für Forschungsvorhaben, aber auch für die Nutzung von Daten, wenn es um Forschung geht“, stellte er in Aussicht. „Da wollen wir jetzt in ganz kurzer Zeit mit vielen sehr konkreten Gesetzes-Vorhaben dazu beitragen, dass die pharmazeutische Industrie, dass die Medizin-Industrie in Deutschland, dass die ganze Gesundheitsökonomie Fortschritte macht“, so der SPD-Politiker.BAYER & Co. gegen REACH-Verschärfung
Im Herbst 2020 stellte die Europäische Union als Teil des „Green Deals“ die Chemikalien-Strategie für Nachhaltigkeit vor, die beabsichtigt, „den Schutz von Mensch und Umwelt vor gefährlichen Chemikalien zu erhöhen“. Besonders im Blick hatte die EU dabei hormon-ähnlich wirkende Produkte – sogenannte endokrine Disruptoren – wie etwa bestimmte Pestizide des Leverkusener Multis, schwer abbaubare sowie krebserregende Stoffe. Im Zuge dessen kündigte Brüssel für Ende 2022 auch eine Verschärfung der REACH-Verordnung an, welche die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Anwendungsbeschränkungen von chemischen Substanzen regelt. Daraus wurde allerdings nichts. BAYER & Co. nutzten die Ungunst der Stunde und verwiesen auf die durch den Ukraine-Krieg entstandenen ökonomischen Turbulenzen, um auf eine Verschiebung des Vorhabens zu drängen. Dies erreichte die Industrie denn auch, womit sie sich jedoch nicht zufriedengibt. Die Unternehmen halten REACH in der jetzigen Form für völlig ausreichend und wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. „Europa hat mit REACH bereits das weltweit umfassendste und strengste Chemikalien-Reglement“, meint etwa Michael Lulei vom „Verband der Chemischen Industrie“. Und dessen europäisches Pendant CEFIC warnt vor Umsatz-Verlusten von mindestens zwölf Prozent und damit einhergehenden Arbeitsplatz-Vernichtungen durch ein REACH 2.0. Unterstützung erhielten die Konzerne bei ihren Lobby-Aktivitäten vom „Bundesinstitut für Risiko-Bewertung“ (BfR), das schon in Sachen „Glyphosat“ in Treue fest zu BAYER gehalten hatte. MitarbeiterInnen des BfR sprachen der Chemikalien-Strategie in einem Fachaufsatz die wissenschaftliche Grundlage ab und plädierten für ein einfaches „Weiter so“, was auf massive Kritik unter anderem des PESTIZID AKTIONS-NETZWERKS (PAN) stieß (siehe AKTION & KRITIK).Export-Verbot auf der langen Bank
Mit Verweis auf die ökonomischen Belastungen in Folge des Ukraine-Kriegs gelang es BAYER & Co., die Europäische Union dazu zu bewegen, viele Projekte zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt vorerst von der Agenda zu nehmen. So verschwand das Vorhaben, den Agro-Riesen die Ausfuhr von innerhalb der EU nicht zugelassenen Pestiziden zu untersagen, vom Arbeitsplan der EU-Kommission für das Jahr 2023. Die grüne EU-Parlamentarierin Grace O’Sullivan wollte von Umwelt-Kommissar Virginijus Sinkevičius nun wissen, wie es in der Causa weitergeht. Dieser versicherte, Brüssel sehe sich nach wie vor in der Pflicht, „sicherzustellen, dass gefährliche Chemikalien, die in der Europäischen Union verboten sind, nicht für den Export hergestellt werden“. Aber bis die EU dieser nachkommt, dürfte noch einige Zeit verstreichen. Sie will nämlich erst einmal eine Studie zum Ausfuhr-Bann in Auftrag geben und auf deren Basis dann eine Folgeabschätzung über die Vor- und Nachteile eines Verbots erstellen. Zudem plant die Union noch eine öffentliche Konsultation zu dem Thema.DRUGS & PILLS
XARELTO-Nebenwirkung Hautausschlag
BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO mit dem Wirkstoff Rivaroxaban hat gefährliche Nebenwirkungen wie z. B. Blutungen. Im Herbst 2022 hat die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA Hinweise auf einen weiteren unerwünschten Pharma-Effekt bekommen. ÄrztInnen meldeten bei XARELTO-PatientInnen Fälle von Pemphigoid, einer Autoimmun-Krankheit, die zu Blasen auf der Haut führt. Darum forderte der EMA-Ausschuss für Risiko-Bewertung den BAYER-Konzern auf, das Präparat mit Blick auf diese Gesundheitsstörung unter genauere Beobachtung zu stellen.Neue STIVARGA-Nebenwirkung?
BAYERs Krebsmedikament STIVARGA mit dem Wirkstoff Regorafenib kommt als Mittel der 2. Wahl zur Behandlung von fortgeschrittenem Darmkrebs sowie zur Therapie von GIST – einer bestimmten Art von Verdauungstrakt-Tumoren – zur Anwendung. Bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA gingen jetzt Meldungen über Fälle von thrombotischer Mikroangiopathie unter STIVARGA ein, eine Erkrankung, bei der es zu Blutgerinnseln in den kleinsten Blutgefäßen kommt. Dies kann zu massiven Durchblutungsstörungen und in der Folge zum Tod der PatientInnen führen. Der EMA-Ausschuss für Risiko-Bewertung hat BAYER deshalb dazu aufgefordert, genauere Informationen zu dieser Nebenwirkung zu liefern.Erweiterte KERENDIA-Zulassung
Die BAYER-Arznei KERENDIA (Wirkstoff: Finerenon) kommt bei schweren Nieren-Erkrankungen, die infolge einer Diabetes auftreten, zur Anwendung. Im Dezember 2022 hat die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA einen Einsatz auch bei leichteren Fällen empfohlen. Das industrie-unabhängige arznei-telegramm spricht sich gegen die Entscheidung aus. Das Fachblatt vermisst überzeugende Belege für positive Effekte auf die Nieren und das Herz/Kreislauf-System. Darüber hinaus verweist es darauf, dass die KDIGO – eine Fachorganisation für Nieren-Krankheiten – nur eine schwache Empfehlung für das Präparat ausgesprochen hat. Überdies macht die Publikation auf das Risiko eines erhöhten Kalium-Spiegels durch die Einnahme von KERENDIA aufmerksam.RESOCHIN erhöht das Suizid-Risiko
Das BAYER-Präparat RESOCHIN mit dem Wirkstoff Chloroquin ist zur Behandlung von Autoimmun-Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis sowie zur Malaria-Prophylaxe zugelassen. Eine Zeitlang galt es zudem als Wundermittel gegen Covid-19. Im Zuge dessen häuften sich die Anwendungen massiv – und entsprechend auch Nebenwirkungen. So traten psychische Störungen gehäuft auf. Darüber hinaus setzten sich die RESOCHIN-NutzerInnen einer erhöhten Suizid-Gefahr aus. Darum schritt der Ausschuss für Risiko-Bewertung der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA ein und verlangte vom Leverkusener Multi und den anderen Herstellern, auf den Packungsbeilagen verstärkt vor diesen unerwünschten Arznei-Effekten zu warnen.BAYER die deutsche Nr. 1
Im Jahr 2022 machte der BAYER-Konzern mit seiner Pharma-Sparte einen Umsatz von 20,7 Milliarden Dollar. Damit ist er die Nr. 1 in Deutschland vor BOEHRINGER INGENHEIM (19 Milliarden) und BIONTECH (17,6 Milliarden) und die Nr. 16 der ganzen Erde. Auf einen Weltmarkt-Anteil von 1,8 Prozent kommt der Pillen-Riese. Allerdings wächst der Abstand zur globalen Top 10. Betrug dieser zu Beginn des letzten Jahrzehnts noch sechs Milliarden Dollar, so beläuft er sich mittlerweile auf zwölf Milliarden.Deal mit TAVROS
Die BAYER-Tochter VIVIDION sucht mit Hilfe neuer Technolo-gien Proteine, die eine Rolle bei der Entstehung von Krankheiten spielen und deshalb als therapeutische Ansatz-Punkte in Frage kommen. Sie setzt beim Aufspüren dieser „Targets“ jedoch auch auf Kooperationen. So hat die Gesellschaft im Oktober 2022 einen Deal mit TAVROS vereinbart. Sie zahlt der US-Firma sofort 17,5 Millionen Dollar und noch einmal Erfolgsprämien von bis zu 430 Millionen Dollar, sollten aus der Kooperation vier marktreife Krebsmittel erwachsen. Überdies stellte VIVIDION für fünf weitere Tumor-Medikamente noch einmal bis zu 482 Millionen Dollar in Aussicht.AGRO & CHEMIE
Sterbehilfe wg. Glyphosat-Vergiftung
Gilberto Avila hatte als Angehöriger der kolumbianischen Anti-Drogenpolizei in den 1990er Jahr an Einsätzen teilgenommen, in denen Glyphosat von Flugzeugen aus auf Koka-Felder niederging, um die Ernten zu vernichten. Das blieb nicht ohne Folgen für seine Gesundheit. Er zog sich Parkinson als Berufskrankheit zu. Da dieses Leiden bei ihm zu einer fast vollständigen Lähmung führte, nahm der Beamte Sterbehilfe in Anspruch. Vorher aber forderte er noch in eindringlichen Worten, die Menschen besser vor dem Herbizid zu schützen: „Ich will nicht, dass Glyphosat weiter Leben wie das meine tötet.“Kein Glyphosat mehr auf Koka-Feldern
Als eine seiner ersten Amtshandlungen verkündete der neugewählte kolumbianische Präsident Gustavo Petro im August 2022 ein Ende des „War on Drugs“ und bereitete damit auch der Zerstörung von Koka-Felder durch das Besprühen mit Glyphosat ein Ende, das Mensch, Tier und Umwelt extremen Gift-Lasten ausgesetzt hatte (s. o.). Gleichzeitig leitete er eine Kehrtwende in der Drogen-Politik ein, die nicht mehr auf Gewalt und Kriminalisierung der Koka-PflanzerInnen gründet und ihnen stattdessen Alternativen zum Anbau dieser Gewächse bieten will.Glyphosat-Bann in Guernsey
Die britische Kanal-Insel Guernsey hat den Verkauf von Glyphosat-Produkten für den Privat-Gebrauch ab dem Januar 2023 untersagt, um die Tierwelt und die Wasser-Reservoirs zu schützen. Zu einem Total-Verbot konnten sich die PolitikerInnen allerdings aus Furcht, damit gegen Bestimmungen der Welthandelsorganisation (WTO) zu verstoßen, nicht entschließen.Glyphosat-Bann in Misiones?
Die argentinische Provinz Chubut hat bereits im Jahr 2019 einen Glyphosat-Stopp beschlossen. Jetzt versucht es ihr das im Nordosten des Landes gelegene Misiones gleichzutun. Dort aber spielt die Landwirtschaft wirtschaftlich eine größere Rolle, und viele Bauern und Bäuerinnen wenden sich gegen die Pläne des „Natural Ressource Commitees“. Deshalb ist der Ausgang ungewiss.Glyphosat schädigt das Nervensystem
Die spanischen WissenschaftlerInnen Carmen Costas-Ferreira und Rafael Durán von der Universidade de Vigo haben neue Studien zur Wirkung von Glyphosat auf das Nervensystem durchgearbeitet und bei ihrer Literatur-Recherche weitere Belege für das Gefährdungspotenzial des Herbizids gefunden. „Die vorliegenden Informationen deuten darauf hin, dass die Exposition gegenüber Glyphosat oder seinen kommerziellen Formulierungen mehrere neurotoxische Effekte hervorruft“, lautet das Resümée der beiden ForscherInnen. Eine besondere Gefahr stellt das Ferreira und Durán zufolge für Säuglinge, Kinder und Jugendliche dar, denn das Pestizid vermag die Zellentwicklung in frühen Lebensstadien empfindlich zu beeinträchtigen. So stört es beispielsweise die Signalwege der Neuronen, was zu Entzündungen von Nervengewebe und Zell-Schäden führen kann – und das alles schon in Dosen, die unter den derzeit gültigen Grenzwerten liegen.Fehlende Glyphosat-Studien zu DNT
Pestizide und andere Stoffe können das sich noch in der Entwicklung befindliche Nervensystem von Embryos, Babys und Kindern schädigen. Tests geben Aufschluss über diesen als Entwicklungsneurotoxizität (DNT) bezeichneten Effekt. Die Europäische Union verlangt bei ihren Genehmigungsverfahren von BAYER & Co. allerdings keine Informationen zu dieser potenziellen Nebenwirkung. Die beiden schwedischen WissenschaftlerInnen Axel Mie und Christina Ruden betrachten das in einem Aufsatz, der in dem Fachmagazin Environmental Health erschienen ist, als ein großes Manko. Deshalb fordern sie die EU auf, die Regulierungsbestimmungen entsprechend zu ändern und verweisen dabei explizit auch auf die Glyphosat-Studie von Carmen Costas-Ferreira und Rafael Durán (s. o.). Überdies plädieren sie dafür, künftig keine von der Industrie finanzierten Untersuchungen mehr in die Zulassungsprozesse einzubeziehen.Studie bekräftigt Krebs-Verdacht #1
Bei oxidativem Stress entstehen in den Zellen hochreaktive Moleküle, was die DNA schädigen und Krebs auslösen kann. Und eben diesen oxidativen Stress vermag Glyphosat hervorzurufen. Zwölf US-amerikanische WissentschaftlerInnen vom „National Institute of Health“ und den „Centers for Disease Control and Prevention“ fanden bei Menschen mit erhöhten Glyphosat-Werten im Urin vermehrt Indikatoren für diese Stoffwechsel-Störung. „Mit dieser Studie wachsen unsere Erkenntnisse darüber, dass Glyphosat das Potenzial hat, Krebs zu verursachen“, resümiert die Forscherin Linda Birnbaum. Den Auftrag zu der Arbeit, die Teil der größer angelegten „Agricultural Health Study“ über die Langzeit-Auswirkungen von Pestiziden auf die Gesundheit von LandwirtInnen ist, erhielten sie und ihre KollegInnen vom „National Cancer Institute“ und dem „National Institute of Environmental Health Sciences“. Auch die US-amerikanische Umweltbehörde EPA beteiligte sich. Nach Meinung der Zwölf sind die Resultate ihrer Untersuchung für die Zulassungsbehörden relevant. Die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA will diese dann auch im Rahmen der Entscheidung über die Glyphosat-Zulassungsverlängerung auswerten, wie sie gegenüber der britische Zeitung The Guardian erklärte. BAYER hingegen versucht, die Ergebnisse kleinzureden. „Der erhöhte oxidative Stress, der in der Studie festgestellt wurde, könnte durch eine beliebige Anzahl von Faktoren verursacht worden sein, die nicht mit Glyphosat in Verbindung stehen“, verlautete aus der Konzern-Zentrale. Darüber hinaus stieß der Global Player – wie immer, wenn ihm ein Ergebnis nicht passt – auf angebliche methodische Mängel.Studie bekräftigt Krebs-Verdacht #2
Durch genotoxische, also erbgut-schädigende Wirkungen von Pestiziden kann es zu einer unkontrollierten Zell-Vermehrung und in der Folge zu Tumor-Bildungen kommen. Hinweise auf diesen Effekt bei Glyphosat gingen Charles Benbrook, Robin Mesnage und William Sawyer nach. Sie sichteten Studien dazu und werteten die Untersuchungen aus. Ergebnis: 24 der 33 Arbeiten bescheinigten dem Herbizid Genotoxizität.BAYER: Glyphosat nicht neurotoxisch
In letzter Zeit erschienen immer mehr Untersuchungen, die Glyphosat eine das Nervensystem schädigende Wirkung bescheinigten (s. o.). Das machte BAYER & Co. im Hinblick auf die für 2023 anstehende Entscheidung der EU über die Zulassungsverlängerung nervös. Also beauftragte die „Glyphosate Renewal Group“ zwei WissenschaftlerInnen mit einer Entlastungsstudie. Virginia C Moser vertiefte sich mit drei KollegInnen in die Literatur und lieferte das bestellte Ergebnis ab: „Zusammengenommen zeigen diese Studien keine konsistenten Auswirkungen von Glyphosat auf die Struktur oder Funktion des Nervensystems von Säugetieren.“ Diejenigen Arbeiten, die das doch taten, hatten die willigen WissenschaftlerInnen vorher wohlweislich „aufgrund kritischer methodischer Mängel“ aussortiert.BAYERs neue Glyphosat-Studie
Das auf Umwelt- und Landwirtschaftsfragen spezialisierte Beratungsunternehmen RSK ADAS LTD. ist in Gestalt von Sarah Wynn stets zu Diensten, wenn es gilt, den Ruf von Glyphosat zu retten. Mit der Transparenz nimmt Wynn es dagegen nicht so genau. So verschwieg sie bei „Studien“ aus dem Jahr 2010 und 2014, die im Falle eines Verbots von Glyphosats schlimme Folgen für den Landwirtschaftssektor in Großbritannien prophezeiten, den Auftraggeber MONSANTO. Das erhöhte deren Gebrauchswert enorm: Die Agro-Lobby nutzte die Arbeiten 2017 im Vorfeld der EU-Entscheidung über die Zulassungsverlängerung für das Herbizid exzessiv. Ein solcher Entscheid steht für 2023 erneut an, und wieder ist Sarah Wynn im Einsatz. Diesmal offen von BAYER bezahlt und unterstützt von der „Glyphosate Renewal Group“, entwarf sie ein Horror-Szenario zu Europa ohne Glyphosat. Sie kam im Gewand einer „Folgeabschätzung über das Fehlen von Glyphosat innerhalb der EU“ daher und bediente sich zahlreicher Schock-effekte: Ernte-Ausfälle, Verschlechterung der Boden-Qualität, wachsender Kohlenstoffdioxid-Ausstoß, erhöhter Maschinen-Einsatz, Schädigung der Artenvielfalt und dergleichen mehr. Das dürfte seine Wirkung auch diesmal nicht verfehlen.Glyphosat in Haferflocken
Die Zeitschrift Öko-Test untersuchte im Oktober 2022 Haferflocken und fand in sechs von 29 Sorten Pestizid-Rückstände. Viermal stießen die WissenschaftlerInnen dabei auf Spuren von Glyphosat und zweimal auf solche von Chlormequat.Glyphosat in Nudeln
Das schweizerische Magazin K-tipp hat 18 italienische Nudel-Produkte auf Glyphosat-Spuren untersuchen lassen. Von den 13 konventionellen Sorten enthielten zehn – unter den aktuellen Grenzwerten bleibende – Rückstände des Pestizids. In den fünf Bio-Fabrikaten konnten die WissenschaftlerInnen keinerlei Glyphosat-Reste entdecken.Die AfD sorgt sich um Glyphosat
Ende 2023 steht die EU-Entscheidung über die Glyphosat-Zulassungsverlängerung an. Die Ampelkoalition hat überdies angekündigt, alle juristischen Möglichkeiten zu prüfen, um das Herbizid auch im Falle eines positiven Votums nicht mehr auf die hiesigen Äcker zu lassen. Deshalb sorgt sich die AfD um die Zukunft des Pestizids und gibt dem in einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung Ausdruck. Gestützt auf die Argumente von BAYER & Co. verweist die Partei dabei auf die angeblichen Qualitäten des Mittels. So will sie positive Auswirkungen auf die Boden-Qualität ausgemacht haben, weil Glyphosat das Pflügen ersetzt, was überdies den Kohlendioxid-Ausstoß senke. Die Ampel-Koalition teilte dieses Argument nicht. Sie blieb bei ihrer Haltung: „Nach Auffassung der Bundesregierung ist die mehrfache mechanische Bearbeitung des Bodens, soweit erforderlich, einer Anwendung eines glyphosat-haltigen Herbizids vorzuziehen.“ Auch das Argument, das Pestizid steigere den Wasser-Gehalt der Böden, lässt sie nicht gelten. Untersaaten und Zwischenfrüchte könnten eventuelle negative Effekte einer zu großen Durchmischung der Erde auffangen, heißt es in der Antwort. Und höhere Kosten durch den Wegfall von Glyphosat sehen SPD, Grüne und FDP ebenfalls nicht auf die LandwirtInnen zukommen.Pestizide stören Bestäubung
Zwischen Pflanzen und ihren Bestäubern bildet sich ein elektrisches Feld, weil die Gewächse leicht negativ und die Tiere leicht positiv geladen sind. Hummeln vermittelt die jeweilige Beschaffenheit des Feldes Informationen über den Bestäubungsstatus der Gewächse. Pestizide wie Imidacloprid (Wirkstoff u. a. von BAYERs im Jahr 2018 EU-weit verbotenem GAUCHO) aber stören diesen Prozess, wie WissenschaftlerInnen der „University of Bristol“ herausgefunden haben. „Blüten, bei denen das elektrische Feld verändert war, wurden von den Hummeln seltener besucht. Es ist das erste bekannte Beispiel dafür, dass menschliche Aktivitäten den Elektro-Sinn eines an Land lebenden Tieres beeinträchtigen“, so der Bristoler Forscher Sam England.BAYER umgeht Export-Verbot
Frankreich verbietet den Export von Pestiziden, die innerhalb der Europäischen Union wegen ihrer Risiken und Nebenwirkungen keine Zulassung (mehr) haben. BAYER & Co. können allerdings Ausnahme-Genehmigungen beantragen. Und das tun sie nicht zu knapp. 94 solcher Gesuche gingen bei den Behörden ein. Darum gelangten im Jahr 2022 von Frankreich aus noch 7.474 Tonnen inkriminierte Agro-Chemikalien nach Brasilien, Mexiko, Russland, Indien und in andere Länder, wie eine Recherche von PUBLIC EYE ergab. Darunter befanden sich mit Fenamidon, Imidacloprid und Clothianidin auch solche Wirkstoffe, die in Produkten des Leverkusener Multis enthalten sind. Zudem haben die Konzerne Wege gefunden, den Bann zu umgehen. Sie exportieren die Ackergifte in andere EU-Staaten und erst von dort aus in die große, weite Welt oder aber sie verlegen gleich die ganze Herstellung an andere Standorte. „Aus all diesen Gründen braucht es ein EU-weites Export-Verbot für verbotene Pestizide“, fordert PUBLIC EYE.Belgien plant Export-Verbot
Frankreich verbietet die Ausfuhr von Pestiziden, die innerhalb der Europäischen Union wegen ihrer Risiken und Nebenwirkungen keine Zulassung (mehr) haben (s. o.) Auch die Schweiz unterbindet den Export bestimmter besonders gefährlicher Stoffe. Hierzulande ist eine solche Regelung in Planung. Und nun trifft Belgien ebenfalls entsprechende Vorbereitungen. Allerdings gibt es Widerstände aus dem Agrar-Ministerium.PFLANZEN & SAATEN
BAYER investiert in ANDES
Der BAYER-Konzern unterstützt das US-amerikanische Start-Up ANDES finanziell. 15 Millionen Dollar hat er in das Unternehmen investiert, das daran forscht, synthetischen Dünger durch andere Technologien zu ersetzen. ANDES behandelt etwa Saatgut mit Mikroben, wodurch die Pflanzen dann später Stickstoff aus der Luft aufnehmen können, so jedenfalls der Plan. Zudem experimentiert ANDES mit Mikroben-Stämmen zur Bindung von klimaschädlichem Kohlendioxid im Boden.GENE & KLONE
Glyphosat-resistenter Wildraps
In Kanada hat glyphosat-resistenter Raps von BAYER auf andere Pflanzen übergegriffen und damit zu einer großen Plage auf Feldern mit ebenfalls glyphosat-resistenten Kulturpflanzen geführt. Mancherorts nahmen die Wildpflanzen mehr als die Hälfte der Fläche ein. Es entstanden sowohl wilder Gen-Raps als auch Gen-Rübchen sowie Kreuzungen zwischen diesen beiden Gewächsen, wie ein ForscherInnen-Team um Martin Laforest feststellte. Diese neue Art hielten die WissenschaftlerInnen eigentlich für hybrid, also kaum vermehrungsfähig. Durch erneute Rückkreuzungen hat sich diese Eigenschaft allerdings ausgeschlichen. Damit nicht genug, verband sich der genmanipulierte Raps auch noch mit dem Ackerrettich. Laforest & Co. mahnten deshalb, bei der Einführung eines fremden Gens in eine Pflanze darauf zu achten, ob diese Ähnlichkeiten mit Wildpflanzen aufweist und Hybride herausbilden kann. „Die vorliegende Studie zeigt erneut die Komplexität und Unvorhersehbarkeit ökologischer Vorgänge“, resümiert die Initiative TESTBIOTECH.Indien genehmigt Gentech-Baumwolle
Indien erlaubt es nicht, Saaten, Pflanzen oder Tiere zum geistigen Eigentum von Personen oder Unternehmen zu erklären. Deshalb sah sich die jetzige BAYER-Tochter MONSANTO dort in Sachen „Genpflanzen“ mit langjährigen gerichtlichen Auseinandersetzungen über Patente und Lizenz-Gebühren konfrontiert. Als Konsequenz daraus erklärte die Gesellschaft Ende 2016, in dem Land keine neuen Laborfrüchte mehr zu vermarkten und zog den Zulassungsantrag für eine Baumwolle mit der Bezeichnung „Bollgard II ROUNDUP READY Flex“ zurück. Andere Agro-Riesen schlossen sich dem Boykott an. Im Frühjahr 2021 jedoch endete ein Rechtsstreit des Unternehmens, das seit 2018 zum Leverkusener Multi gehört, mit einer indischen Firma in gütlichem Einvernehmen. Darum holte BAYER den alten Antrag für die gegen Glyphosat resistente und mit zwei Giftstoffen des Bacillus thuringienis bestückte Baumwolle wieder aus der Schublade. Im Oktober 2022 erhielt das Unternehmen dann einen positiven Bescheid vom „Genetic Enginneering Appraisal Commitee“ (GEAC).Lizenz-Vertrag mit YIELD10
Der BAYER-Konzern kooperiert bereits seit längerer Zeit mit dem Biotech-Unternehmen YIELD10. Der Leverkusener Multi hat mit der US-Firma einen Vertrag abgeschlossen, der ihm Zugriff auf eine Technologie zur Steigerung der Soja-Ernten verschafft. YIELD nutzt die neuen Genscheren-Verfahren, um an der Photosynthese zu schrauben und beispielsweise den Kohlenstoff-Kreislauf zu „optimieren“, was für einen besseren Ertrag sorgen soll.Kooperation mit RECODE THERAPEUTICS
Der BAYER-Konzern setzt sowohl im Pharma- als auch im Agro-Bereich stark auf das „Gene Editing“, also zum Beispiel auf Gen-Scheren wie CRISPR-Cas9, die das Erbgut angeblich genau an einer vorgegebenen Stelle auftrennen können, um es dann „umzuschreiben“ oder neue, im Labor hergestellte DNA-Stränge einzufügen. Ein neues Kooperationsabkommen in Sachen „Gene Editing“ hat jetzt seine Genmedizin-Tochter ASKBIO mit RECODE THERAPEUTICS abgeschlossen. Die beiden Partner wollen an einer Technologie arbeiten, „die das vollständige Einfügen von Genen ermöglicht, indem sowohl das Gene-Editing-Tool als auch die DNA als gemischte Ladung (...) präzise zu den gewünschten Zielen transportiert werden“. Als mögliche Anwendungsbereiche nennt der Leverkusener Multi Leber- und Lungenkrankheiten.WASSER, BODEN & LUFT
Treibhaus-Gase en masse
Im Geschäftsjahr 2022 stieß der BAYER-Konzern 3,03 Millionen Tonnen Treibhaus-Gase aus. Gegenüber 2021 sank der Wert um gerade einmal 140.000 Tonnen. Und wiederum gehen diese Emissionen zu einem Gutteil auf das Konto von Glyphosat, weil der gesamte Fertigungsprozess an den US-Standorten Soda Springs und Luling sehr viel Energie verschlingt. Eine Betriebstemperatur von 1500° Celsius braucht etwa der Ofen in Soda Springs, um aus Phosphorit das Glyphosat-Vorprodukt Phosphor herauszulösen. Darum musste es auch im neuesten Nachhaltigkeitsbericht des Leverkusener Multi wieder heißen: „Besonders energie-intensiv ist unsere Rohstoff-Gewinnung einschließlich Aufbereitung und Weiterverarbeitung für die Herstellung von Pflanzenschutzmittel-Vorprodukten von Crop Science.“ Dies machte der Konzern auch als hauptsächliche Ursache für den höheren Gesamtenergie-Einsatz aus, der 2022 von 34.835 Terrajoule auf 35.472 Terrajoule zulegte. „Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ist überwiegend durch Produktionssteigerungen an den Standorten Soda Springs und Luling, USA, bedingt“, so der Leverkusener Multi.BAYERs Treibhaus-Gase
Als klima-schädlicher Stoff steht zumeist das Kohlenstoffdioxid im Fokus, weil BAYER & Co. es in Massen emittieren. Die anderen Treibhaus-Gase sind jedoch auch nicht ohne. In der Summe richten fluorierte Kohlenwasserstoffe, Lachgas, Methan, Kohlenmonoxid und Ruß fast einen genauso großen Schaden an wie CO2, denn die Stoffe haben es in sich. So ist Methan 25-mal so wirksam wie CO2 und Lachgas sogar 125-mal. Und der Leverkusener Multi mischt auch auf diesem Feld kräftig mit. Er stieß im Geschäftsjahr 2022 39.000 Tonnen fluorierte Kohlenwasserstoffe, 7.000 Tonnen Lachgas, 3.000 Tonnen Methan und 2.620 Tonnen Kohlenmonoxid aus.Ein bisschen Emissionshandel
„Ein wirtschaftliches Instrument, mit dem man Umweltziele erreichen will“ – so beschrieb die FAZ einmal den 2005 EU-weit eingeführten Handel mit Kohlendioxid-Verschmutzungsrechten. Nach dessen Bestimmungen dürfen die Multis nur bis zu einer bestimmten Obergrenze Kohlendioxid ausstoßen, für darüber hinausgehende Kontingente müssen sie Verschmutzungsrechte hinzukaufen. Das sollte sie dazu animieren, sauberere Modelle der Energie-Versorgung zu etablieren. Die Lenkungswirkung hält sich dank des Extrem-Lobbyismus von BAYER & Co. aber arg in Grenzen. So bekamen die Konzerne jahrelang viel zu viele Zertifikate umsonst zugeteilt. Überdies fallen nur Kraft- und Heizwerke unter die Regelung, Fertigungsstätten bleiben indessen verschont. Darum braucht der Leverkusener Agro-Riese kaum Emssionshandel zu betreiben. Mit lediglich fünf Anlagen, deren Kohlendioxid-Ausstoß sich auf rund 290.000 Tonnen belief, war er im Geschäftsjahr 2022 dabei. Das sind noch nicht einmal zehn Prozent des CO2-Gesamtaufkommens.BAYER kauft Erneuerbare Energie
BAYER erzeugt selbst Strom, erwirbt aber auch großen Mengen dazu. Beim zugekauften, dem sogenannten sekundären Energie-Einsatz, tut sich ein bisschen was, weil der Konzern hier vermehrt auf Erneuerbare setzt. Ihr Anteil betrug im Geschäftsjahr 2022 32,6 Prozent.CO2-Kompensation statt -Reduktion
Eigentlich existiert nur ein Weg, um den Klimawandel einzudämmen: Reduktion des Stromverbrauchs und Umstieg auf erneuerbare Energie-Träger. BAYER & Co. ist aber noch etwas anderes eingefallen. Sie wollen ihre CO2-Emissionen nicht nur reduzieren, sondern auch kompensieren, also das, was sie so in die Luft blasen, an anderer Stelle wieder ausgleichen. Der Leverkusener Multi nimmt sich zwar vor, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden, die Senkung des Ausstoßes klimaschädlicher Gase soll dazu aber nur zu 42 Prozent beitragen. Für den Rest greift er zu Maßnahmen wie z. B. Investitionen in Waldschutz- und Wiederaufforstungsvorhaben. Deren Ertrag für seine Klima-Bilanz gibt der Global Player für 2022 mit 450.000 Tonnen CO2 an. An der Belastbarkeit dieser Zahl bestehen allerdings erhebliche Zweifel. Der Agro-Riese hat für einen Teil seiner Kompensationsgeschäfte nämlich Zertifikate der Firma Verra erworben, die nach Recherchen von Die Zeit und anderen Medien gar nicht von wirklichen Kohlendioxid-Einsparungen gedeckt, sondern „[e]in Haufen Schrott“ waren.Mehr ODS in der Luft
Für den Ausstoß von ozon-abbauenden Substanzen (ODS) ist bei BAYER seit Jahr und Tag hauptsächlich die alte Dreckschleuder im indischen Vapi zuständig. Der Konzern doktert zwar schon lange der Anlage herum und hat sogar Emissionsreduktionsmaßnahmen vorgenommen, aber so recht zu greifen scheint dies nicht. 2022 erhöhten sich die ODS-Emissionen gegenüber dem Vorjahr um 7,8 Prozent auf 4,2 Tonnen. „Eine Produktionssteigerung am Standort Vapi, Indien, führte zu einem vermehrten Einsatz von ODS als Rohstoff für die Produktion“, heißt es dazu im neuesten Nachhaltigkeitsbericht.Mehr VOC in der Luft
2022 stieg die Freisetzung von flüchtigen organischen Substanzen (VOC) aus BAYER-Schornsteinen von 430 auf 460 Tonnen. Neben „Produktionssteigerungen an verschiedenen US-Standorten“ trug auch hierzu wieder der Standort Vapi so einiges bei.Mehr Staub in der Luft
2022 erhöhte sich der Staub-Ausstoß des BAYER-Konzerns von 2.050 Tonnen auf 2.260 Tonnen. Als Grund führte der Agro-Riese „die Staub-Emissionen aus Saatgut-Prozessen an mehreren Standorten in Brasilien“ an.Mehr Schwefeloxide in der Luft
2022 stieg der Ausstoß von Schwefeloxiden aus den Anlagen des BAYER-Konzerns von 1.280 Tonnen auf 1.290 Tonnen an.Weniger Stickoxide in der Luft
2022 sanken die Emissionen von Stickoxiden aus Anlagen des BAYER-Konzerns gegenüber dem Vorjahr von 3.570 Tonnen auf 3.520 Tonnen.Enormer Wasserverbrauch
BAYERs Wasser-Verbrauch ging im Geschäftsjahr 2022 kaum zurück. Er belief sich auf 53 Millionen Kubikmeter (2021: 55 Millionen Kubikmeter). 21,3 Millionen Kubikmeter davon entstammt dem Grundwasser. Zu allem Übel erstreckt sich der enorme Durst des Agro-Riesen auch noch auf Gebiete, die unter Wasser-Mangel leiden. Drei Millionen Kubikmeter fördert er in solchen Regionen.24 Millionen Kubikmeter Abwasser
Im Jahr 2022 belief sich die Abwasser-Menge des BAYER-Konzerns auf 24 Millionen Kubikmeter (2021: 25 Millionen Kubikmeter).Höhere Phosphor-Werte
Im Jahr 2022 produzierte BAYER mehr phosphor-haltige Abwässer als 2021. Von 510 Tonnen auf 610 Tonnen stieg der Wert.Höhere Schwermetall-Werte
Im Jahr 2022 produzierte BAYER mehr schwermetall-haltige Abwässer als 2021. Von 3,2 Tonnen auf 3,5 Tonnen erhöhte sich die Menge.Mehr Anorganische Salze
Im Jahr 2022 enthielten die Abwässer des BAYER-Konzerns mehr Anorganische Salze als 2021. Das Aufkommen stieg von 172.000 Tonnen auf 176.000 Tonnen.Weniger Stickstoff im Abwasser
2022 enthielten die Abwässer des BAYER-Konzerns weniger Stickstoff als 2021. Die Menge reduzierte sich um 120 Tonnen auf 240 Tonnen.Weniger TOCs im Wasser
Im Jahr 2022 fielen bei BAYER weniger gebundene organische Kohlenstoffe (TOCs) im Abwasser an als 2021. Von 1.280 Tonnen auf 1.110 Tonnen sank der Wert.Neue Wasser-Grenzwerte für Glyphosat?
In ihrer neuen Wasserrahmen-Richtlinie will die Europäische Union auch neue Grenzwerte für Pestizide festlegen. Das „Scientific Committee on Health, Environment and Emerging Risks“ schlug dabei für Glyphosat in Süßwasser, das zur Trinkwasser-Gewinnung Verwendung findet, ein Limit von 0,1 Mikrogramm pro Liter vor. Damit zeigten sich BAYER & Co. gar nicht einverstanden. „Der nun vorgeschlagene Wert entbehrt nicht nur der notwendigen wissenschaftlichen Grundlage (...), sondern ignoriert auch die nachweislich hohe Entfernungseffizienz für Glyphosat bei der standardmäßigen europäischen Wasseraufbereitung“, hieß es in einer Stellungnahme der „Glyphosate Renewal Group“.Renaturierung der Wupper
Der BAYER-Konzern nutzt die Wupper als Abfluss-Kanal und als Reservoir für Wasser, das er zur Kühlung und für andere Zwecke braucht. Derzeit versucht die Stadt Wuppertal gemeinsam mit dem Wupper-Verband, den ökologischen Zustand des Gewässers zu verbessern, was ihr nicht gerade leicht fällt. „Die Rahmenbedingungen sind schwer!“, bekundet die Kommune und nennt als Schwierigkeiten bei den Renaturierungsmaßnahmen unter anderem „Altlasten/Altablagerungen“. Trotzdem beteiligt sich der Agro-Riese nicht an den Kosten des Unterfangens.Mehr Abfall
Im Geschäftsjahr 2022 produzierte BAYER mehr Abfall als 2021. Von 1,001 Millionen Tonnen auf 1, 038 Millionen Tonnen stieg das Aufkommen. Glyphosat bleibt im Boden Eine Studie der Universität Rostock sowie anderer Hochschulen und Forschungseinrichtungen ging der Frage nach, wie sich Glyphosat im Boden abbaut. Zu 97 Prozent tat es das schnell. Die WissenschaftlerInnen fanden auch nach einem Jahr noch Spuren des Herbizids sowie seines Abbauprodukts Aminomethylphosphon-Säure (AMP) im Oberboden. „Das deutet auf ein Akkumulationspotenzial von Glyphosat und eine erhöhte Persistenz des Abbauprodukts AMP hin“, konstatiert das Fachportal topagrar. Die Gefahr einer Auswaschung des Mittels in Gewässer schätzt das Medium trotzdem als gering ein. „Allerdings kann die Akkumulation im Boden das Risiko eines Eintrags in die Umwelt z. B. durch Erosion erhöhen“, gibt es zu bedenken.GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV
Neue PCB-Studie bleibt aus
Polychlorierte Biphenyle (PCB) gehören zu den giftigsten Hervorbringungen der Chlorchemie (SWB 1/14). Die vor allem von BAYER und MONSANTO in Umlauf gebrachten gefährlichen „Alleskönner“ kamen bis zu ihrem vollständigen Verbot 1989 in Elektrogeräten, Fugendichtungsmassen, Farben, Ölen, Lacken und Bodenbelägen zum Einsatz – und stellen immer noch ein beträchtliches Gesundheitsrisiko dar. Von den 1985 in der Bundesrepublik verkauften 72.000 Tonnen landete mehr als ein Sechstel im Bergbau, wo die schweren Gerätschaften viel Hydraulik-Öl brauchten. „Wir sind mit dem Zeug umgegangen, als wäre es Milch“, zitierte der Spiegel im Jahr 2015 einen Bergmann. Dementsprechend wies eine vom Bergbau-Konzern RAG schon in den 1990er Jahren initiierte Studie im Blut der Kumpel „signifikant erhöhte“ PCB-Konzentrationen nach, wie Dr. Thomas Kraus von der Aachener „Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule“ gegenüber den JournalistInnen des Nachrichtenmagazins ausführte. Und das hatte Folgen. Haut-, Leber- und Nierenerkrankungen stellten Kraus’ KollegInnen damals fest. Davon wollten jedoch Kraus und die RAG nichts mehr wissen. Sie führten im Jahr 2016 erneut eine Untersuchung durch. Wie zu erwarten war, hatten mehr als die Hälfte der 210 Kumpel auffällige PCB-Werte. Beim PCB 74 überschritten die gemessenen Rückstände diejenigen der sonstigen Bevölkerung um nicht weniger als das 20-Fache. Bei der Vorstellung der wissenschaftlichen Arbeit gab Thomas Kraus aber den Ahnungslosen. „Die Pilotstudie lässt auf eine länger zurückliegende erhöhte Belastung dieser Bergleute mit PCB schließen. Eine akute Gesundheitsgefährdung gemessen an heute gültigen Grenzwerten liegt nicht vor.“ Er und die RAG kündigten deshalb eine zweite Studie, diesmal mit mehreren Tausend TeilnehmerInnen, an, um zu klären, „[o]b ein Zusammenhang zwischen einer damaligen PCB-Belastung von Bergleuten und in der Folge eventuell auftretenden Erkrankungen besteht“. Dazu kam es allerdings nie, wie eine Gruppe von MedizinerInnen um Dr. Günther Bittel kritisiert. Die ÄrztInnen wandten sich an die RUHRKOHLE AG und fragten nach den Gründen, erhielten aber keine Antwort. Dabei beließen sie es allerdings nicht. Bittel & Co. machten sich selbst ans Werk und starteten eine Untersuchung zu den von PCB ausgehenden Gefahren (s. u.).Neue PCB-Studie
Gesundheitsschädliche Polychlorierte Biphenyle (PCB) kamen bis zu ihrem Verbot unter anderem im Bergbau großflächig zum Einsatz – mit entsprechenden Folgen für die Bergleute (s. o.). Eine neue Studie mit 124 ehemaligen Kumpeln, durchgeführt von einem Team um den Duisburger Mediziner Günther Bittel, förderte jetzt alarmierende Befunde zutage. 47,6 Prozent der TeilnehmerInnen hatten Herz/Kreislaufprobleme, 20,2 Prozent Lungenleiden, 20 Prozent Depressionen, 14,2 Prozent neurologische Erkrankungen und 10,5 Prozent Krebs. Verglichen mit dem Bevölkerungsdurchschnitt sind dies deutlich höhere Zahlen. Als Konsequenz aus ihrer Untersuchung forderten die ÄrztInnen einen regelmäßigen umweltmedizinischen Gesundheitscheck der GrubenarbeiterInnen auf Kosten der RUHRKOHLE AG, eine Beweislast-Umkehr in den Anerkennungsverfahren für Berufskrankheiten sowie eine Reinigung des abgepumpten PCB-haltigen Grubenwassers auf höchstem technischen Niveau. Zudem dringen sie auf eine Methode der Grenzwert-Festlegung, die auch die im Bergbau viel verwendeten PCB-Arten 74 und 114 umfasst und sich bewusst ist, „dass es für kanzerogene Substanzen keinen unbedenklichen Bereich gibt“.UNFÄLLE & KATASTROPHEN
Berkeley: Toter nach Brand
Am 17. Januar 2023 brach in BAYERs US-amerikanischer Niederlassung Berkeley ein Feuer aus. Zwei Beschäftige einer Fremd-firma erlitten dabei schwere Verbrennungen, einer von ihnen starb wenige Wochen später an den Folgen. Der Brand entstand bei Reparaturarbeiten in einem Labor mit Bio-Reaktoren zur Fermentation. Zur Ursache konnte der Leverkusener Multi am Tag des Vorfalls noch keine Angaben machen.Brand im CURRENTA-Abfallbunker
Nach der Explosion im Entsorgungszentrum des Leverkusener Chem„parks“, die im Juli 2021 sieben Beschäftigte das Leben kostete, gelobte die Betreiber-Gesellschaft CURRENTA Besserung. Aber allzu weit her ist es mit der Sicherheit immer noch nicht: Am 5. Januar 2023 brach in einem Abfallbunker ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte ihn zum Glück rasch löschen. „Es wurde niemand verletzt“, vermeldete die CURRENTA. Auch sei es durch das Feuer zu keinerlei Beeinträchtigungen benachbarter Siedlungen gekommen, so ein Unternehmenssprecher.Stoff-Austritt in Muscatine
Im September 2022 kam es am US-amerikanischen BAYER-Standort Muscatine zu einem Störfall. Aus einem Tank trat ein Methanol/Methylamin-Gemisch aus. Ursache der Freisetzung war eine defekte Dichtung.IMPERIUM & WELTMARKT
Pestizid-Markt: BAYER die Nr. 2
Im internationalen Pestizid-Geschäft ist BAYER nach einer Analyse der ETC GROUP auf Basis der Umsatz-Zahlen von 2020 mit einem Umsatz von 9,9 Milliarden Dollar die Nr. 2. CHEMCHINA als Nr. 1 setzte Mittel für 15 Milliarden ab. Die folgenden Plätze belegten die BASF und CORTEVA. Marktanteil der Top 4: 62,3 Prozent. Seit 2011 hat sich die Konzentration im Agrochemie-Segment damit nur unwesentlich weiter fortgesetzt. Damals kam das Spitzen-Quartett auf 62,1 Prozent.Saatgut-Markt: BAYER die Nr. 1
Im weltweiten Geschäft mit Saatgut und Pflanzen-Eigenschaften nimmt BAYER der ETC-GROUP zufolge (s. o.) den ersten Platz ein. Mit Einnahmen von 10,3 Milliarden Dollar kam der Leverkusener Multi im Jahr 2020 auf einen Markt-Anteil von 23 Prozent. CORTEVA als Nr. 2 verbuchte 7,7 Milliarden. Insgesamt gingen 51 Prozent aller Umsätze in diesem Segment auf das Konto des Spitzen-Quartetts. Zum Vergleich: 2011 waren es 58,2 Prozent.Biologika-Kooperation mit KIMITEC
Der BAYER-Konzern hat eine Forschungskooperation mit dem spanischen Unternehmen KIMITEC vereinbart, um sein Geschäft mit den nicht-chemischen Produkten gegen Schadinsekten und Wildkräuter sowie zur besseren Nährstoff-Versorgung von Pflanzen zu stärken. Er will deshalb jedoch seinen Agrogift-Schrank nicht gleich entsorgen – „best of both worlds“ lautet die Devise. „BAYER möchte Landwirten mit den Vorteilen biologischer Lösungen unterstützen und das als Teil eines integrierten Systems, das unsere führenden Pflanzen-Eigenschaften, Pflanzenschutz-Produkte und digitalen Lösungen miteinbezieht, so der Manager Dr. Robert Reiter. Branchen-KennerInnen rechnen bis 2028 mit einem Markt-Volumen für Biologika von bis zu 25 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Das Markt-Volumen für Pestizide belief sich 2022 auf 94,7 Milliarden Euro.RECHT& UNBILLIG
Freispruch in Sachen „IBEROGAST“
Im Jahr 2018 starb eine Frau, die BAYERs Magenmittel IBEROGAST eingenommen hatte. Sie hatte ihre Leber mit dem Schöllkraut-Extrakt so ruiniert, dass die ÄrztInnen eine Organ-Transplantation durchführen mussten, die nicht reibungslos verlief und der Patientin das Leben kostete. Da der Leverkusener Multi sich jahrelang weigerte, vor den die Leber schädigenden Effekten seines Pharmazeutikums zu warnen, nahm die Kölner Staatsanwaltschaft 2019 Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen zwei ehemalige Konzern-Beschäftigte auf. Auf Anfrage des Portals MedWatch teilte diese jetzt mit, die Causa ad acta gelegt zu haben. RechtsmedizinerInnen der Universität Köln konnten keinen Kausalzusammenhang zwischen dem Schlucken des Präparats und dem Todesfall feststellen, so die Justizbehörde. Zudem fanden sich ihr zufolge keine hinreichenden Beweise für eine Sorgfaltspflicht-Verletzung. „[W]enig nachvollziehbar“ nennt MedWatch diese Begründung und verweist auf die schon lang bekannte Nebenwirkung „Leberschaden“ sowie BAYERs Umgang mit diesem unerwünschten Arznei-Effekt. Bereits seit den 1990er Jahren nämlich warnen MedizinerInnen vor Gefahren für die Leber durch Schöllkraut-Präparate wie IBEROGAST. Im Jahr 2005 zogen die Behörden deshalb höher dosierte Produkte aus dem Verkehr und ordneten für die niedriger dosierten Warnhinweise an. Der damalige IBEROGAST-Lizenzinhaber STEIGERWALD legte beim „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) jedoch Widerspruch gegen die Entscheidung ein, den der Leverkusener Multi aufrechterhielt, als er STEIGERWALD 2013 aufkaufte. 2017 wies das BfArM den Einspruch gegen die verfügte Änderung der Packungsbeilage dann ab. Aber der Global Player gab sich noch immer nicht geschlagen. Er reichte vor dem Verwaltungsgericht Köln Klage gegen den Bescheid ein, die eine aufschiebende Wirkung hatte. Erst der Tod der Leber-Patientin im Sommer 2018 änderte die Sachlage. Da sah das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ dringenden Handlungsbedarf und drohte dem Pillen-Riesen mit dem „Sofort-Vollzug“ der Beipackzettel-Änderung. Und erst jetzt fügte sich der Global Player zähneknirschend. „Nach Aufforderung setzt BAYER VITAL die geforderten Hinweise in der Fach- und Gebrauchsinformation von IBEROGAST um“, verlautete aus der Konzern-Zentrale. Die Nachbemerkung „Wir stehen unverändert zu einem positiven Nutzen/Risiko-Verhältnis von IBEROGAST in den zugelassenen Indikationen“ durfte dabei natürlich nicht fehlen.Juristische Glyphosat-Winkelzüge
Der BAYER-Konzern scheut in Sachen „Glyphosat“ auch nicht vor den abstrusesten juristischen Winkelzügen zurück. So gab er einen schon gewonnenen Entschädigungsprozess im Nachhinein verloren und zahlte dem Kläger John Carson 100.000 Dollar, damit dieser in Berufung geht und der juristischen Auseinandersetzung so den weiteren Weg durch die Instanzen eröffnet. Hier spekuliert der Global Player dann auf einen Sieg, der ihn dazu berechtigen würde, den Supreme Court anzurufen. Einmal hatte er das schon getan, jedoch ohne Erfolg. Das Gericht lehnte es ab, sich mit dem Fall „Hardeman“ zu befassen und folgte damit einer Empfehlung der US-Generalstaatsanwältin Elisabeth Prelogar. Diese hatte die Argumentation des Leverkusener Multis, wonach es sich bei der Causa um eine Bundesangelegenheit handle, nicht gelten lassen. Auch wenn die zentrale Umweltbehörde EPA das Mittel der BAYER-Tochter MONSANTO zugelassen und Krebs-Warnungen auf den Produkten verboten habe, könne ein kalifornisches Gericht sehr wohl anderer Meinung sein und BAYER wg. unterlassener Gefahren-Hinweise zu Entschädigungszahlungen verurteilen, so Prelogar. Im Fall „Carson v. MONSANTO Co.“ verfolgt der Konzern jetzt eine andere Strategie. Er spekuliert darauf, in letzter Instanz ein Urteil in seinem Sinne zu erwirken, das anderen in der Glyphosat-Sache ergangenen widerspricht, um den Supreme Court zu einem Machtwort zu bewegen. Im Juli 2022 scheiterte der Agro-Riese mit diesem Ansinnen allerdings: Der „11th U.S. Circuit Court of Appeals“ sprach Carson Recht zu. Der Global Player legte umgehend Rechtsmittel ein und erzielte einen Erfolg. Im Dezember 2022 entschied ein Berufungsgericht im Sinne des Global Players und ordnete eine Überprüfung der Entscheidung des Court of Appeals an. „Eine der wichtigsten Entwicklungen in der 7-jährigen Geschichte dieses Rechtsstreits“ nannte BAYERs oberster Prozess-Beauftragter Bill Dodero dieses Votum.Glyphosat-Prozess: BAYER siegt
Am 21. Oktober 2022 begann vor dem „St. Louis County Circuit Court“ ein Entschädigungsprozess in Sachen „Glyphosat“. Stacey Moore machte das Herbizid für ihre Lymphdrüsenkrebs-Erkrankung – das Non-Hodgkin-Lymphom – verantwortlich, aber die RichterInnen wiesen ihre Klage am 13. November ab.Vergleich in Sachen QUIKPRO
Das BAYER-Herbizid QUIKPRO enthält Glyphosat in einer höheren Konzentration als ROUNDUP. Der Landschaftsgärtner Nathan Evans macht dieses Mittel für sein Non-Hodgkin-Lymphom – eine spezielle Art des Lymphdrüsen-Krebses – verantwortlich und reichte eine Klage ein. Das Verfahren endete mit einem Vergleich. Über die Höhe der vom Leverkusener Multi an Evans gezahlten Summe haben die Prozess-Parteien Stillschweigen vereinbart.Klage wg. Entschädigungsausschluss
Bisher zahlte der BAYER-Konzern im Rahmen von Glyphosat-Vergleichen lediglich US-AmerikanerInnen Entschädigungen. Dagegen lehnt sich die Mexikanerin Elvira Reyes-Hernandez auf. Sie war während ihrer Arbeit auf Baum-Plantagen in den USA permanent Glyphosat ausgesetzt, was nicht ohne Folgen blieb. „Non-Hodgkin-Lymphom“ (s. o.) lautete die Diagnose der ÄrztInnen. Jetzt wirft sie dem Leverkusener Multi und den RechtsanwältInnen-Büros vor, sie von den Vereinbarungen ausgeschlossen zu haben und reichte eine entsprechende Klage ein. Dabei erhält die 47-Jährige Unterstützung von der größten VerbraucherInnenschutz-Organisation der Vereinigten Staaten: PUBLIC CITIZEN, 1971 von Ralph Nader gegründet. Die Gruppe MIGRANT JUSTICE hatte das Fehlen einer Regelung für ArbeitsmigrantInnen bereits unmittelbar nach BAYERs Präsentation der „Vorschläge zur Güte“ kritisiert. Und dieses Manko zählte auch zu den Gründen, warum Vince Chhabria als zuständiger Richter für das Mediationsverfahren vom Global Player Nachbesserungen angemahnt hatte. Dieser Aufforderung kam der Agro-Riese allerdings nicht nach – er ließ die Verhandlungen im Jahr 2021 platzen.Gericht untersagt Phosphorit-Abbau
Die Gewinnung des Glyphosat-Vorprodukts Phosphorit aus den Tagebau-Minen rund um den US-amerikanischen BAYER-Standort Soda Springs belastet Mensch, Tier und Umwelt enorm (siehe auch SWB 1/23). Unter anderem gelangen dabei Schwermetalle und radioaktive Stoffe wie Uran, Radom, Radium und Selen ins Freie. Darum haben das CENTER FOR BIOLOGICAL DIVERSITY (CBD) und andere Verbände die Genehmigung zur Inbetriebnahme einer neuen Mine, die das „Bureau of Land Management“ dem Leverkusener Multi im Jahr 2019 erteilte, angefochten. Und im Januar 2023 gab ein US-Gericht ihrer Klage gegen die Behörde und den Agro-Riesen als „Streithelfer“ statt. Der „U.S. District Court for the District of Idaho“ bescheinigte dem „Bureau of Land Management“, bei seiner Entscheidung die weiteren Konsequenzen der Phosphorit-Förderung wie die damit über Jahrzehnte fortgeschriebene umweltschädliche Weiterverarbeitung in Soda Springs und die Gefährdung von Beifußhuhn-Populationen nicht beachtet zu haben. Als eindeutige Verstöße gegen den „National Environmental Policy Act“ wertete der Court diese Versäumnisse. „Dieses Urteil ist ein entscheidender Sieg für das Beifußhuhn und alle Menschen und Wildtiere, die auf dieses empfindliche, unersetzliche Ökosystem angewiesen sind“, freute sich Center-Aktivistin Hannah Connor. Erst Anfang März 2021 musste der Global Player für Schäden, welche die Phosphorit-Förderung aus der – inzwischen stillgelegten – Ballard-Mine in den 1950er und 1960er Jahre verursachte, teuer bezahlen (siehe Ticker 2/21). Der Prozess, den die US-amerikanische Umweltbehörde EPA, der Bundesstaat Idaho und eine im Umfeld der Mine lebende Gruppe von Indigenen angestrengt hatten, endete mit einem Vergleich, der den Konzern fast 2,5 Millionen Dollar kostete. Ähnliche Verfahren gab es in den Jahren 2011 und 2015.Protestprogramm BAYER HV 2023
HV-Aktion 2023
Best Of Kundgebungsreden
RednerInnen auf der Kundgebung
RednerInnen auf der Hauptversammlung
Gegenanträge
Presseerklärungen
Schriftliche Stellungnahmen
In diesem Jahr hat die am Freitag, den 28. April stattfindende AktionärInnenhauptversammlung von BAYER eine besondere Bedeutung. Denn nun steht endlich die 2022 verschobene Entscheidung an, ob Glyphosat vom europäischen Markt verschwindet. Ende 2023 wird EU-weit über eine mögliche Verlängerung der Zulassung des Agrargiftes Glyphosat entschieden. BAYER, der Hauptproduzent von Glyphosat, wirft nun sein ganzes Lobby-Gewicht in die Waagschale, um eine Zulassungsverlängerung zu erreichen.
BAYER steht zudem vor einer Zeitenwende: Erst kürzlich musste der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann seinen Hut nehmen. Der Architekt der MONSANTO-Übernahme steht wie kein anderer für die Verluste, die BAYER wegen seines gefährlichen Einkaufs und aufgrund des weltweiten Widerstandes gegen die fortgesetzte Glyphosat-Produktion hinnehmen musste. Gleichzeitig steht mit Bill Anderson aber auch ein neuer CEO in den Startlöchern, der nun als der Nachfolger Baumanns zusätzlich unter Druck steht, die Übernahme profitabel zu wenden und aus dem Konzern den letzten Tropfen Gewinn für die ihn unterstützenden GroßaktionärInnen zu pressen.
Anderson muss direkt zu seinem Antritt öffentlich mit den verheerenden Konsequenzen konfrontiert werden, die die fortgesetzte Produktion von glyphosathaltigen Pestiziden mit sich bringt. Wir wollen nicht zulassen, dass der Konzern den Wechsel an der Spitze für eine Imagekampagne missbraucht. BAYER wird die AktionärInnenhauptversammlung 2023 abermals virtuell stattfinden lassen. Deswegen haben wir auch dieses Jahr wieder ein breites Protestprogramm zusammengestellt, das wir mit Euch gemeinsam realisieren wollen!
WAS IST GEPLANT?
1) Den Vorstand konfrontieren!==
+++ CALL FOR: REDEBEITRÄGE +++
Vorgaben für Redebeiträge
In diesem Jahr gibt es erstmals die Möglichkeit, sich als kritischeR AktionärIn direkt in den HV-Livestream der HV zuzuschalten und sich als RednerIn zu Wort zu melden. Während und am Ende des Redebeitrages stellt man die Fragen, die der Vorstand beantworten muss. Damit man an der virtuellen HV teilnehmen kann, müssen die folgenden Schritte erfolgt sein:
• Meldet Euch bei uns als SprecherIn an. Meldet Euch mit vollem Namen, Adresse, Emailadresse und Telefonnummer an, unter der ihr am Tag der HV selber erreichbar seid. Je früher Ihr Euch anmeldet, desto leichter fällt uns die Bearbeitung. Die Frist für Anmeldungen ist der 19.4.2023.
• Ihr erhaltet von uns eine Mail mit Zugangsdaten, unter denen Ihr Euch beim AktionärInnenportal von BAYER anmelden könnt.
• Am Tag der Hauptversammlung selbst müsst Ihr Euch über Euren Rechner über das AktionärInnenportal in die HV zuschalten. Ihr braucht dazu ein internetfähiges Gerät mit Kamera und Mikrofon, auf die vom Browser aus zugegriffen werden kann, sowie eine stabile Internetverbindung.
• Im Redebeitrag muss ein formeller Bezug zur BAYER-Tagesordnung durch folgenden abschließenden Satz existieren:
„Ich bitte Sie, stimmen Sie mit der CBG gegen die Entlastung des BAYER-Vorstandes.“
Wenn Ihr Euch als SprecherInnen bei uns angemeldet habt, schicken wir Euch alle Daten, sowie genaue Infos zur Anmeldung im Portal zu! Fragen könnt Ihr uns dann jederzeit unter info@cbgnetwork.org oder 0211 33 39 11 stellen.
+++Anmeldungen für Redebeiträge bis 19.4.
2) Kundgebungen in Leverkusen und anderen BAYER-Standorten
+++Kundgebung an der BAYER-Konzernzentrale+++
28.4.2023
9:30 Uhr
BAYER-Konzernzentrale, Kaiser-Wilhelm-Allee 3, Leverkusen
Die diesjährige Hauptversammlung steht ganz im Zeichen des Abgangs des Architekten der BAYER/MONSANTO-Fusion: Werner Baumann. Wir wollen Herrn Baumann für seinen Beitrag zur Vergiftung von Mensch, Umwelt und Klima, den er durch das entschlossene Festhalten an Glyphosat geleistet hat, angemessen würdigen. Deshalb planen wir in Leverkusen an der BAYER-Zentrale die Übergabe eines goldenen Glyphosat-Kanisters als Preis für das Erheben von Profit über menschliche Gesundheit.
Doch nicht nur in Leverkusen selber wollen wir dem scheidenden BAYER-Chef ein Abschiedsgeschenk vor die Tür stellen. Wir wollen in möglichst vielen Städten Aktionen vor BAYER-Filialen veranstalten, bei denen dem BAYER-Chef ein Abschiedsgeschenk überreicht wird. Doch dafür brauchen wir EURE Hilfe! Ihr könnt Euch vorstellen, in Eurer Stadt eine Übergabe zu machen? Meldet Euch bei uns!
Oder Ihr wollt auf der Kundgebung in Leverkusen eine Rede halten oder in anderer Form teilnehmen? Wir freuen uns über Anmeldungen oder Unterstützung bei der Werbung. Bitte Nachricht an info@cbgnetwork.org.
HABT IHR FRAGEN?
info@CBGnetwork.org
0211 – 33 39 11##
AKTION & KRITIK
SchülerInnen fragen, CBG antwortet
Im Rahmen eines Projektes beschäftigten sich SchülerInnen des Henfling-Gymnasiums in Meiningen mit den Medikamenten-Versuchen, die BAYER während des Faschismus an KZ-Häftlingen vorgenommen hatte. Bei den Recherchen stießen sie auch auf die vielen Veröffentlichungen der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) zu diesem Thema und nahmen Kontakt auf. CBG-Vorstand Jan Pehrke stellte sich ihren Fragen und berichtete von den zahlreichen grausamen Experimenten ohne medizinischen Nutzen, die viele ZwangsprobandInnen das Leben kosteten. Auch informierte er über die finanzielle Unterstützung, die der Leverkusener Multi dem berühmt-berüchtigten Dr. Josef Mengele für seine abstruse Zwillingsforschung angedeihen ließ. Und schließlich zitierte Pehrke aus dem Briefwechsel zwischen dem Konzern und dem Auschwitz-Lagerkommandanten Rudolf Höß, um die ganze Menschenverachtung der Aktiengesellschaft zu dokumentieren. Sie „bestellt“ in dem Schriftstück für die Erprobung eines Schlafmittels 150 weibliche KZ-Gefangene, will dafür aber nicht das verlangte Geld zahlen. „Wir erhielten Ihre Antwort, jedoch erscheint uns der Preis von 200 RM pro Frau zu hoch. Wir schlagen vor, nicht mehr als 170 RM pro Kopf zu zahlen“, heißt es in dem Schreiben. Und nach Abschluss der Test-Reihen meldete sich der Pharma-Riese wieder: „Die Versuche wurden gemacht. Alle Personen starben. Wir werden uns bezüglich einer neuen Sendung bald mit Ihnen in Verbindung setzen.“ So konnte die Coordination den SchülerInnen für ihr Vorhaben schockierendes Anschauungsmaterial zu einer Profitjagd, die über Leichen geht, liefern.CBG beim Stadtgespräch
Im September 2021 hatte der Rundfunk-Sender WDR 5 sein Stadtgespräch der Explosion im Leverkusener Chemie„park“ der CURRENTA gewidmet, bei der sieben Menschen umkamen. Ein Jahr später kehrte die Sendung in die Stadt zurück, um im Scala-Club mit dem CURRENTA-Geschäftsführer Hans Gennen, Horst Büther von der Bezirksregierung Köln und Manfred Santen von GREENPEACE eine erste Bestandsaufnahme zu versuchen: „Was wurde aus der Katastrophe gelernt? Was läuft heute anders? Wie sicher können wir uns fühlen?“ Die Bilanz fiel ebenso ernüchternd aus wie der Publikumszuspruch. Büther beharrte darauf, alles richtig gemacht zu haben. Einen Anteil der Bezirksregierung an dem Desaster wegen der äußerst lückenhaften Kontrollen? „Nein, den sehe ich überhaupt nicht“, so der Behörden-Vertreter, es habe ja keine technischen Mängel, sondern organisatorische Mängel gegeben. Die Anlage war ihm zufolge in Ordnung, die Prüfungen an den Tanks sind ordnungsgemäß durchgeführt worden und haben nichts Besorgniserregendes zu Tage gefördert, der Abfall war erlaubt, ein technisches Problem hat es nicht gegeben – „aber der Abfall hat sich nicht so verhalten, wie es vorgesehen war“. Diesen Befund präsentierte er, was großes Gelächter im Saal hervorrief. Hans Gennen gab auch nichts Erhellenderes zu Protokoll. Die Frage, ob er solche Ereignisse wie das vom 27. Juli 2021 in Zukunft ausschließen könne, beantwortete Gennen auch nach mehrmaligem Nachhaken des Moderators Ralph Erdenberger nicht. „Wir setzen alles daran, dass Katastrophen ausgeschlossen werden“, war sein letztes Wort. Ansonsten blieb es bei Lippenbekenntnissen: „Sicherheit ist für uns das höchste Gebot.“ Zu heiklen Punkten wie dem, dass den Beschäftigen am Tag des Unglücks keine Angaben über die Gefährlichkeit der gelagerten Stoffe vorlagen, verweigerte Gennen mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen der Kölner Staatsanwaltschaft die Aussage. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN wollte von dem CURRENTA-Geschäftsführer wissen, ob das Unternehmen die Empfehlungen aus dem Gutachten schon umgesetzt habe. Konkret sprach sie eine verbesserte Kommunikation mit den ArbeiterInnen von Fremdfirmen, eine stärkere Präsenz von Führungskräften im Entsorgungszentrum sowie Maßnahmen zur Verhinderung einer Kettenreaktion im Falle eines Störfalls an. Gennen beantwortete nur die erste Frage, zu den beiden anderen schwieg er. Für die CURRENTA bestehe gar kein Unterschied zwischen Stammbelegschaft und externem Personal, hob der Manager an, um dann auf bessere, verständlichere Unterweisungen und einen „Sicherheitsdialog“ mit den Fremdfirmen zu verweisen. „Dialog“ war sowieso das Stichwort: Eine Ausstellung, ein BürgerInnen-Büro, einen Begleitkreis und eine Extra-Website brachte Gennen hier in Stellung. Was er an dem Abend nicht erwähnte: Der Entsorgungskonzern unterhält nicht nur ein Krisenkommunikationsteam, er hat nach Informationen von AKTION GEGEN ARBEITSUNRECHT zusätzlich sogar noch das ATELIER FÜR MEDIENGESTALTUNG angeheuert, um „das Vertrauen in das Unternehmen und dessen Akzeptanz zu sichern“. Die CURRENTA will nämlich so schnell wie möglich wieder alle Kapazitäten nutzen, denn nur so lassen sich Profite erwirtschaften. Das sagte der gute Mann natürlich nicht, sondern: „Unsere Kunden brauchen die Anlage im Vollbetrieb.“CBG bei den NATURFREUNDEN
Im Rahmen ihrer Ausstellung „Pestizide – Gefahr für Mensch und Umwelt“ hatte die Bochumer Ortsgruppe der NATURFREUNDE DEUTSCHLANDS die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) am 27. Oktober 2022 zu einem Vortrag über BAYERs Ackergifte eingeladen. Und so referierte CBG-Vorstand Jan Pehrke über die lange unheilvolle Tradition, auf die der Leverkusener Multi in diesem Bereich zurückblicken kann. Dabei spannte er einen weiten Bogen vom Jahr 1892, in dem der Konzern mit ANTINONNIN das erste Antiinsekten-Mittel auf chemischer Basis herausbrachte, bis zur Gegenwart – aus gegebenem Anlass unter besonderer Berücksichtigung von Glyphosat und dessen Risiken und Nebenwirkungen. Aber auch der Pflege der politischen Landschaft des Agro-Riesen zum Gedeih seiner Pestizid-Profite sowie der Ökonomie dieses Geschäfts widmete Pehrke sich. Das alles lieferte anregenden Stoff für die nachfolgende Diskussion.CBG bei Friedensdemo
„Schluss mit dem Krieg – Sofortiger Waffenstillstand – Verhandeln statt schießen – Keinen Euro für Krieg und Zerstörung, sondern Milliarden für eine weltweite soziale, gerechte und ökologische Friedenspolitik! – unter dieser Losung fanden sich am 1. Oktober in Köln rund 350 Menschen zu einer Friedensdemonstration zusammen. Ein breiter Kreis hatte sich auf dem Heumarkt versammelt: GewerkschaftlerInnen ergriffen ebenso das Wort wie Mitglieder der DEUTSCHEN FRIEDENSGESELLSCHAFT – VEREINIGTE KRIEGDIENSTGEGNERINNEN, AktivistInnen der christlichen Friedensbewegung und Mitglieder der SDAJ. Und auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) ging an diesem Tag wieder mit auf die Straße, denn der BAYER-Konzern rückte nicht davon ab, seine Profit-Interessen auch in Kriegszeiten unverdrossen weiterzuverfolgen. So begleitete BAYER-Chef Werner Baumann Wirtschaftsminister Robert Habeck bei seinen Shopping-Touren in Sachen „Energie“ und reiste mit nach Kanada und nach Katar. Und beim China-Trip von Bundeskanzler Olaf Scholz war der Vorstandsvorsitzende ebenfalls mit von der Partie. Zudem beschert die aktuelle Lage vor allem der Agro-Sparte gute Umsätze. Nahrungsmittel-Krise? Der Konzern nennt das anders, von „einem anhaltend positiven Marktumfeld“ spricht er. Die LandwirtInnen machen nämlich gute Geschäfte und ordern deshalb mehr Pestizide und Saatgut. Und damit nicht genug, nutzt der Agro-Riese die Knappheiten auch noch, um die Werbetrommel für die Gentechnik zu rühren.CBG beim Klimastreik
Im Sommer 2022 zeigte sich der Klimawandel in all seinen Facetten: Überschwemmungen in Pakistan mit über 1.000 Toten: dazu Dürren, Waldbrände, Hurrikans, Taifune und dahinschmelzende Gletscher in den verschiedensten Regionen unseres Planeten. Der BAYER-Konzern trug mit einem Treibhausgas-Ausstoß von zuletzt 3,17 Millionen Tonnen viel zu der beängstigenden Lage bei. Darum beteiligte sich die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) auch am 23. September 2022 wieder am Klimastreik. Die CBG-AktivistInnen gingen an dem Tag in Köln auf die Straße.CBG in ZDF-Doku
„Das Glyphosat-Debakel“ heißt ein vom ZDF produzierter Dokumentarfilm über die gesundheitlichen, rechtlichen und ökonomischen Nebenwirkungen des umstrittenen Herbizids, der nicht ohne die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) auskam. Die MacherInnen zeigen die Coordination bei den Vorbereitungen der Aktionen zur letzten BAYER-Hauptversammlung und lassen CBG-Vorstand Axel Köhler-Schnura zu Wort kommen: „BAYER hält an diesem Gift fest, obwohl weltweit Proteste dagegen existieren. Das wird im Zentrum unserer Kritik stehen.“ Seine Rede vor der Leverkusener Zentrale des Agro-Riesen sowie Bilder von der Demonstration und dem Prozessionszug von EXSTINCTION REBELLION fanden ebenfalls Aufnahme in das Werk.Vandana-Shiva-Film mit der CBG
Im Dezember 2022 kam der Film „Vandana Shiva – Ein Leben für die Erde“ in die Kinos. Er zeigt die frühen Jahre der bekannten indischen Kämpferin für eine Agrar-Wende, widmet sich den Wurzeln ihres Engagements und begleitet sie bei ihren jüngsten Aktivitäten rund um den Globus. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) durfte auf der Kölner Vorpremiere im Odeon-Kino die ZuschauerInnen begrüßen und einleitende Worte sprechen. Zudem konnte sie einige ihrer Mitglieder als Gäste mitbringen. Und auch zur Diskussion mit der Regisseurin Camilla Becket im Anschluss an die Vorführung wurde CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann wieder auf die Bühne gebeten, um Input aus der Sicht von AktivistInnen zu geben. Die Wege von Vandana Shiva und der Coordination haben sich nämlich so manches Mal gekreuzt, seit BAYER mit der Übernahme von MONSANTO zu einem der mächtigsten Vertreter des „Poison Cartels“ avancierte.Offener Brief an Stella Kyriakides
Am 15. Dezember 2022 lief die Glyphosat-Genehmigung aus. Aber die Europäische Union schaffte es nicht, die für eine erneute Zulassung nötigen Risiko-Bewertungen fristgerecht vorzunehmen. Deshalb ließ sie das BAYER-Pestizid trotz nicht abgeschlossener Sicherheitsprüfung noch einmal eine einjährige Ehrenrunde drehen. Eine „Technische Verlängerung“ war das Mittel der Wahl. Dieser Verstoß gegen den Leitsatz des vorbeugenden VerbraucherInnenschutzes löste eine Welle des Protests aus. So forderte das „Ban-Glyphosate“-Bündnis die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides in einem Offenen Brief auf, das Herbizid wegen seiner umfassend belegten Risiken und Nebenwirkungen für Mensch, Tier und Umwelt sofort aus dem Verkehr zu ziehen. „Die Frist um ein Jahr zu verlängern und Farm-ArbeiterInnen, in der Nähe der Felder lebende Menschen, EU-BürgerInnen und die Umwelt diesem gefährlichen Pestizid entsprechend länger auszusetzen, ist der Zivilgesellschaft unbegreiflich“, hieß es in dem Schreiben, zu dessen 28 Unterzeichner-Organisationen auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN gehörte.BAYER-Antiwerbung
Eine darnieder gestreckte Biene Maja und dazu der Slogan „Tschüss Biene – danke BAYER“ – ein solches Werbe-Plakat der etwas anderen Art platzierten die SYSTEMSPRENGERINNEN in der Bonner Innenstadt, um damit gegen das vom Leverkusener Multi mitverursachte Insektensterben zu protestieren.Chemie-Waffen in Nord- und Ostsee
1,6 Millionen Tonnen Munition, Bomben, Minen und chemische Kampfstoffe aus zwei Weltkriegen lagern auf dem Grund allein der zu Deutschland gehörenden Teile von Nord- und Ostsee, darunter auch die einst von BAYER entwickelten Substanzen Lost, Tabun und Sarin. Da die Metall-Umhüllung der Chemie-Waffen mittlerweile korrodiert, treten die Gifte aus. Das stellt nicht nur für aquatische Lebewesen, sondern auch für Menschen eine große Gefahr dar. Der Meeresbiologe Dr. Stefan Nehring hat die Vorfälle von Kriegsende 1945 bis Dezember 2015 genauer untersucht und bezifferte die Zahl der Toten auf 418 und die der Verletzten auf 720. Trotz dieses alarmierenden Befundes hat die Politik lange Zeit keinen Handlungsbedarf gesehen, nun aber reagiert sie. Die Ampelkoalition will für ein dreijähriges Sofort-Programm zur Bergung von Lost & Co. rund 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Aber SPD, Grüne und FDP streben aus Kosten-Gründen keine komplette Sicherung des maritimen Waffenarsenals an. „Nach Auffassung der Bundesregierung ist eine flächenhafte Beräumung und Vernichtung aller versenkten Munition nicht umsetzbar“, erklären die Regierungsparteien in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Partei „Die Linke“. Wegen der großen Gefahr, die von den Mitteln für Mensch, Tier und Umwelt ausgeht, fordert die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) jedoch eine solche Komplett-Räumung – und hält diese auch für finanzierbar. „Wenn dem Staat das Geld fehlt, alle chemischen Zeitbomben aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg unschädlich zu machen, dann müssen BAYER und all die anderen Firmen einen Beitrag leisten, die mit diesen Minen, Kampfstoffen und Bomben einst die Waffenarsenale der Militärs füllten“, hieß es in der Presseerklärung der Coordination.Gegen doppelte Pestizid-Standards
Über 300 Initiativen aus Europa, Afrika, Asien, Nord- und Südamerika haben die Europäische Union am 1. Dezember 2022 aufgefordert, keine Exporte von solchen Pestiziden mehr zuzulassen, die innerhalb der EU wegen ihres Sicherheitsprofils keine Zulassung (mehr) haben. Besonders für den Globalen Süden stellt diese Praxis der doppelten Standards nach Ansicht der Organisationen eine große Bedrohung dar. „In diesen Staaten können die gefährlichen, in der EU verbotenen Pestizide nicht sicher verwendet werden, was verheerende Auswirkungen sowohl auf die menschliche Gesundheit als auch auf die Umwelt hat“, heißt es in dem gemeinsamen Statement. Neben dem SYNGENTA-Ackergift Paraquat nennen die Gruppen, zu denen auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) gehört, als Beispiel für die inkriminierten Erzeugnisse das BAYER-Produkt Acetochlor, das die EU unter anderem wegen seines Gefährdungspotenzials für Chromosomen aus dem Verkehr gezogen hat. In ihrer Presseerklärung zur Veröffentlichung des „Joint Statement“ drang die CBG auf eine sofortige Reaktion der Europäischen Union. „Jedes Jahr kommt es zu 385 Millionen akuten Pestizid-Vergiftungen. Es besteht also dringender Handlungsbedarf. Trotzdem hat die EU das Thema „Export-Stopp“ aus ihrem Arbeitsprogramm für das Jahr 2023 genommen. Das ist völlig unverständlich. Die Ukraine-Krieg darf nicht als Vorwand dafür dienen, den Schutz von Mensch, Tier und Umwelt vor den Risiken und Nebenwirkungen der industriellen Landwirtschaft zurückzufahren“, hielt die Coordination fest.Kritik am Mercosur-Vertrag
Bereits im Juni 2019 gaben die EU und die MERCOSUR-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay den Abschluss ihrer Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen bekannt (siehe auch NORD & SÜD). Der Regenwald-Kahlschlag während der Präsidentschaft von Jair Bolsonaro bewog die Europäische Union jedoch dazu, vorerst keine weiteren Schritte zur Implementierung einzuleiten. Mit der Wahl Luiz Inácio Lula da Silva kommt jetzt allerdings wieder Bewegung in den Prozess. Darum veranstaltete die Grünen-Fraktion im Europa-Parlament zusammen mit FRIENDS OF THE EARTH EUROPE am 8. November in Brüssel die Konferenz „Pesticides and Ingenious Rights in Brazil – How the EU-Mercosur Trade Agreement would put Profit over People and Planet“. Dort warnten KritikerInnen vor einer Hauptfolge des Deals: einer nochmaligen Forcierung des agro-industriellen Modells. Der IndigenInnen-Vertreter Kretã Kaingang bezeichnete den Vertrag als „tödliche Übereinkunft“ und schilderte das Schicksal von 300 IndigenInnen, die bei den vom Agro-Business initiierten Vertreibungen zur Erschließung neuer Anbau-Flächen für ihre „cash crops“ das Leben verloren. Die brasilianische Geografie-Professorin Larissa Bombardi, die auf Einladung der Coordination gegen BAYER-Gefahren im April 2022 an den Protesten rund um die BAYER-Hauptversammlung teilgenommen hatte, ergänzte, dass bei diesen Landnahmen oftmals auch aus der Luft versprühte Pestizide als Chemie-Waffen zum Einsatz kämen. Zudem führte sie aus, wie stark ihre Landsleute schon jetzt unter Glyphosat & Co. leiden. Von zahllosen Vergiftungsfällen durch die Mittel, welche die Konzerne wegen deren Gefährlichkeit innerhalb der EU teilweise gar nicht mehr vermarkten dürfen, berichtete Lombardi und nannte das einen Angriff „auf das Recht zu leben“. Graciela Almeida von der Landlosen-Bewegung MST klagte über die Pestizid-Kontaminationen, unter denen kleine Öko-LandwirtInnen leiden und forderte, BAYER & Co. dafür zur Verantwortung zu ziehen. Paul De Clerck von FRIENDS OF THE EARTH EUROPE stellte die umfangreichen Lobby-Aktivitäten der Agro-Branche zum Push des Abkommens dar, die nicht ohne Wirkung blieben. So gelang es ihr, die EU-Kommission davon zu überzeugen, das Image des Handelsvertrags zu verbessern. Der EU-Handelskommissar Valdis Dombrovski übernahm dankbar den dafür gelieferten Textbaustein und sprach fortan von der Notwendigkeit, „zum Abkommen ein positiveres Narrativ zu entwickeln“. Den von BAYER zu diesem Behufe engagierten Thinktank „Ecipe“, der aus den brasilianischen Soja-Baronen und -Baronessen nach der Devise „small is beautiful“ so etwas wie bessere SchrebergärtnerInnen machen will, ließ De Clerck dabei nicht unerwähnt. Am Ende waren sich die AktivistInnen einig: Den verstärkten Anstrengungen der EU, das Mercosur-Abkommen unter Dach und Fach zu bringen, gilt es Widerstand entgegenzusetzen.Kritik am Mercosur-Splitting
Die Europäische Union will das Handelsabkommen mit den MERCOSUR-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay (s. o.), das während der Amtzeit von Jair Bolsonaro wegen dessen forcierten Regenwald-Rodungen auf Eis lag, mit seinem Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva nun möglichst schnell unter Dach und Fach bringen. Aus diesem Grund plant die EU ein beschleunigtes Verfahren (siehe auch NORD & SÜD). Sie will den Handelsteil des Vertragswerks, der nicht der Zustimmung der nationalen Parlamente bedarf, abkoppeln und unabhängig von den umstrittenen sozialen und ökologischen Fragen schon einmal zur Anwendung bringen. Gegen dieses perfide Manöver erhebt sich jedoch massiver Protest. So forderte ein breites Bündnis von Initiativen aus Europa und Lateinamerika Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf, sich auf dem Treffen der EU-HandelsministerInnen am 25 November 2022 gegen ein solches Splitting auszusprechen. „Der Schritt der Europäischen Kommission ist ein zynischer technischer Weg, um sicherzustellen, dass die von ihr ausgehandelten Handelsabkommen trotz ihrer Kontroversen über Abholzung, Klimawandel und Menschenrechtsverletzungen schnell in Kraft treten“, heißt es in der auch von der Coordination gegen BAYER-Gefahren unterzeichneten Erklärung.NORD & SÜD
MERCOSUR-Comeback
Der BAYER-Konzern erhofft sich viel von dem Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den MERCOSUR-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Brüssel gewährt den Agrar-Gütern dieser Länder nämlich einen erleichterten Zugang zum EU-Markt und erhält dafür im Gegenzug Einfuhrzoll-Senkungen unter anderem für Autos, Chemikalien und Pharmazeutika, die mit rund vier Milliarden Euro zu Buche schlagen. Der Leverkusener Multi profitiert von beidem, denn er exportiert viele Arzneien und Ackergifte nach Lateinamerika und kann obendrein noch mit einem gesteigerten Absatz von Glyphosat & Co. rechnen, wenn die brasilianische und argentinische Landwirtschaft besseren Geschäften auf dem alten Kontinent entgegensieht. Den Verlust durch die Forcierung des agro-industriellen Modells haben dagegen andere zu tragen: Die in der Nähe der Felder lebenden Menschen, deren Bedrohung durch Pestizid-Vergiftungen zunimmt, die Indigenen, die infolge der Ausweitung der Anbau-Flächen mit noch mehr Vertreibungen rechnen müssen und der Regenwald, der den Profit-Interessen zum Opfer fällt. Die zunehmenden Abholzungen in der Amtszeit des Präsidenten Jair Bolsonaro waren es dann auch, die das eigentlich schon ausverhandelte Übereinkommen erst einmal auf Eis legten. Die Abwahl des rechtsextremen Politikers bringt den Kontrakt jetzt jedoch wieder auf die Tagesordnung zurück. Der neue Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat schon die Bereitschaft signaliert, die Gespräche wieder aufzunehmen. Allerdings verlangt er Korrekturen. „Wir wollen einen gerechteren internationalen Handel. Wir wollen unsere Partnerschaften mit den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zu neuen Bedingungen wieder aufnehmen. Wir sind nicht an Handelsabkommen interessiert, die unser Land zur ewigen Rolle des Exporteurs von Rohstoffen verdammen“, sagte er in der Ansprache nach seinem Sieg. Die EU lehnt es bisher allerdings ab, das Paket wieder aufzuschnüren. Sie beabsichtigt, es bei einem Zusatz-Protokoll bewenden zu lassen. Neuverhandlungen würden die ganze komplexe Tektonik des Vertragswerks zum Einsturz bringen, sagte John Bazill von der Generaldirektion Handel der EU bei einer Konferenz in Brüssel. Wenn die EU mehr Umwelt-Regelungen im Abkommen haben wolle, müsse sie im Gegenzug der Agrar-Industrie der Mercosur-Staaten bessere Angebote machen, gab er zu bedenken. Brüssel strebt aber sogar eine Beschleunigung des ganzen Prozesses an greift deshalb zu einem taktischen Trick. Die Kommission plant, den Handelsteil des Vertragswerks, der nicht der Zustimmung der nationalen Parlamente bedarf, abzukoppeln und unabhängig von den umstrittenen sozialen und ökologischen Fragen schon einmal zur Anwendung zu bringen (siehe AKTION & KRITIK). Umwelt-AktivistInnen, VertreterInnen von indigenen Gruppen und WissenschaftlerInnen warnten bei der Veranstaltung massiv vor den Risiken und Nebenwirkungen des Abkommens (siehe AKTION & KRITIK). Trotzdem dürften die ersten Meetings in der Sache bald stattfinden – und BAYER & Co. mit einem entsprechenden Lobby-Einsatz am Start sein.Neuer Deal mit Bill Gates
„Verhütungsmittel können mit am besten zur Armutsbekämpfung beitragen“ konstatierte Melinda Gates einst in einem Beitrag für Die Welt. Weniger Menschen = weniger Armut, so lautete ihre Rechnung ganz nach der Devise des früheren US-Präsidenten Lyndon B. Johnson: „Fünf gegen das Wachstum der Bevölkerung investierte Dollar sind wirksamer als hundert für das Wirtschaftswachstum investierte Dollar.“ Dementsprechend ignorant zeigt sich die „Bill & Melinda Gates Foundation“ den ökonomischen Ursachen von Hunger und Mangelernährung gegenüber. Stattdessen sieht sie es als Entwicklungshilfe an, im Globalen Süden Kontrazeptiva an die Frau zu bringen. Gerne arbeitet die Stiftung dabei mit dem BAYER-Konzern zusammen, der aus nicht ganz uneigennützigen Motiven derselben Ansicht ist und zudem über viel Erfahrung in diesem Bereich verfügt. „BAYER unterstützt seit mehr als 50 Jahren Initiativen, die dazu beitragen, dass Frauen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen Zugang zu Familienplanung erhalten“, heißt es aus Leverkusen. Aus diesen Gründen arbeitet die „Bill & Melinda Gates Foundation“ seit Jahr und Tag auch mit der Pharma-Sparte des Global Players zusammen und kauft etwa große Stückzahlen des – nicht eben nebenwirkungsarmen und im reichen Norden überhaupt nicht erhältlichen – Langzeit-Kontrazeptivums JADELLE zu Sonderkonditionen auf. Und nun zeigt sich das Familienplanungsprogramm der Foundation an einem ohne Hormone auskommenden Verhütungsmittel interessiert, das der Leverkusener Multi entwickeln will. Die entsprechenden Forschungen sponsert die „Bill & Melinda Gates Foundation“ mit zwölf Millionen DollarPOLITIK & EINFLUSS
Lobby-Europameister BAYER
Mit einem Etat von 6,5 bis 7 Millionen Euro versuchte der BAYER-Konzern im Jahr 2021, auf Entscheidungen der Europäischen Union Einfluss zu nehmen. Nur noch APPLE pflegte die politische Landschaft in Brüssel ähnlich intensiv. Das ergab eine Recherche der beiden Initiativen CORPORATE EUROPE OBSERVATORY und LOBBYCONTROL im EU-Transparenzregister. 74 LobbyistInnen beschäftigt der Leverkusener Multi in seinem Brüsseler „Verbindungsbüro“ (siehe auch SWB 2/22). 15 von ihnen haben Zutritt zum Europäischen Parlament. Gemeinsam brachten sie es auf nicht weniger als 41 Treffen mit ranghohen VertreterInnen der EU-Kommission bzw. den KommissarInnen selbst. Einen Schwerpunkt der Aktivitäten bildete dabei das umstrittene Herbizid Glyphosat, denn die EU prüft gerade BAYERs Antrag auf eine Verlängerung der Zulassung. Zu den weiteren Einsatzgebieten gehörten die Pestizid-Regulierung im Allgemeinen, die geplante neue Trinkwasser-Richtlinie, der Aktionsplan der EU für eine Reform des Patentrechts und derjenige für eine Reduzierung der Verschmutzung von Wasser, Luft und Boden. Darüber hinaus bemühte sich das Unternehmen, die Chemikalien-Richtlinie REACH, den Umgang mit hormon-ähnlich wirkenden Substanzen, die Pharma-Strategie, die Biodiversitätsstrategie sowie die Agrarstrategie „From Farm to Fork“ in seinem Sinne zu gestalten. Damit nicht genug, intervenierte es ebenfalls in Sachen „Klimaschutz- und Agrarpolitik“, „Green Deal“ und „EU/Mercosur-Abkommen“. „Bei allen wichtigen Themen, welche die Europäischen Union verhandelt, redet der BAYER-Konzern mit, ohne ein demokratisch legitimiertes Mandat zu haben, nur weil seine wirtschaftliche Macht ihn dazu in die Lage versetzt. Das ist ein Skandal“, kritisierte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN das Gebaren des Global Players in einer Presseerklärung.Deutschland verfehlt Klima-Ziele
Der ExpertInnen-Rat der Bundesregierung sieht das Ziel Deutschlands, die Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 65 Prozent zu senken, in weiter Ferne. Darum forderte das Gremium kurz vor der Welt-Klimakonferenz in Sharm el-Scheikh, die Vorgaben des Klimaschutz-Gesetzes nachzuschärfen. „Im Industrie-Sektor wäre eine 10-fache und beim Verkehr sogar eine 14-fache Erhöhung der durchschnittlichen Minderungsmenge notwendig“, konstatiert Ratsmitglied Thomas Heimer. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) nahm in einer Presseerklärung zu dem Befund Stellung. „Die Politik hat es nicht gewagt, Druck auf die großen Unternehmen wie BAYER, BASF, VW und BMW auszuüben. Sie nahm es stattdessen sogar auf sich, im Rahmen des Emissionshandels der EU elf Millionen CO2-Verschmutzungszertifikate zu erwerben, um das überzogene Klima-Konto auszugleichen. Jetzt aber führt kein Weg daran vorbei, die Firmen zu drastischen Reduzierungsmaßnahmen zu verpflichten. Darum muss die Ampelkoalition die Empfehlungen des ExpertInnen-Rates schnell umsetzen“, hieß es darin.DRUGS & PILLS
Asundexian enttäuscht
Der BAYER-Konzern sucht einen Nachfolger für seinen Gerinnungshemmer XARELTO, läuft doch das Patent des Milliarden-Sellers bald aus. Er setzt dabei – ebenso wie seine Mitbewerber – große Hoffnungen auf die sogenannten Faktor-XI-Blocker, weil das Blutungsrisiko bei diesen Mitteln geringer ist als bei XARELTO. Die klinischen Tests der Phase 2 mit Asundexian enttäuschten allerdings. Der Wirkstoff erreichte die primären Endpunkte der Studie nicht. Er konnte weder die Zahl der Hirninfarkte noch die der ischämischen, also durch verstopfte Hirn-Arterien ausgelöste Schlaganfälle verringern. Trotzdem bricht der Pharma-Riese die Versuche nicht ab. Er kündigte an, mit der Substanz in die Phase 3 zu gehen.AGRO & CHEMIE
Doppelte Standards: neue Studie
BAYER & Co. exportieren massenweise Ackergifte, die innerhalb der EU keine Zulassung (mehr) haben, in Drittländer. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) und andere Gruppen kritisieren diese Geschäftspraxis der doppelten Standards seit Langem. Die Politik hat – endlich – auch Handlungsbedarf erkannt. „Es geht nicht an, dass wir nach wie vor Pestizide produzieren und exportieren, die wir bei uns im Hinblick auf die Gesundheit der Menschen zurecht verboten haben“, sagte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir im September 2022 und kündigte eine Verordnung gemäß Paragraf 25 des Pflanzenschutzgesetzes an. Allerdings gilt dieser Vorstoß nur Pestizid-Produkten, nicht aber den reinen Wirkstoffen. Diese aber machen den Löwen-Anteil der Ausfuhren aus, wie eine neue Untersuchung von PAN GERMANY, Heinrich-Böll-Stiftung und Rosa-Luxemburg-Stiftung zeigt. So lieferten BAYER & Co. 2021 37.525 Tonnen reine Substanzen in Länder aus, die nicht der EU angehören, Pestizid-Produkte aber „nur“ in einem Umfang von 8.499 Tonnen. Da sich bei dem Export-Verbot in der geplanten Form somit große Schutzlücken auftun, fordern die Studien-AutorInnen, das Pflanzenschutzgesetz zu ändern, um wirklich alle gefährlichen Stoffe zu erfassen. Das brächte dann auch den BAYER-Konzern stärker in die Bedrouille. Er exportiert nämlich ebenfalls mehr Wirkstoffe wie z. B. Probineb oder Imidacloprid als Produkte auf Basis dieser Stoffe.Glyphosat-Absatz steigt
In Deutschland legt der Glyphosat-Absatz weiter zu. Während im Jahr 2019 „nur“ 3.059 Tonnen auf den Feldern landeten, waren es 2020 3.773 Tonnen und 2021 sogar 4.100 Tonnen, obwohl am 8. September jenes Jahres Restriktionen in Kraft traten. So verbot das Insektenschutz-Gesetz ab diesem Zeitpunkt die Anwendung des Mittels im Haus- und Gartenbereich und auf öffentlichen Grünflächen. Und auch für den Einsatz in der Landwirtschaft gab es Einschränkungen. Die Bauern und Bäuerinnen dürfen das Breitband-Herbizid nicht mehr direkt vor der Ernte versprühen und ansonsten nur, „wenn es keine alternativen Möglichkeiten gibt“, wie die Bundesregierung erklärte.Freifahrtschein für 135 Pestizide
Am 15. Dezember 2022 lief die Glyphosat-Genehmigung aus. Doch die Europäische Union schaffte es nicht, die für eine erneute Autorisierung nötigen Risiko-Bewertungen fristgerecht vorzunehmen. So sprach sie einfach eine sogenannte technische Verlängerung aus – eine gängige Praxis. Nach Recherchen von FOODWATCH haben 135 der 455 in der EU vermarkteten Pestizide einen solchen Freifahrtschein bekommen, ohne nach ihrer einstmals erfolgten Zulassung jemals wieder den Beweis erbracht zu haben, dem jeweils neuesten Stand der Wissenschaft in Sachen „Unbedenklichkeit“ zu genügen. Unter den inkriminierten Ackergiften befinden sich nicht wenig Wirkstoffe, die auch in BAYER-Produkten enthalten sind, wie etwa Deltametrin, Flufenacet und Mecoprop. FOODWATCH forderte die EU auf, aus der Untersuchung Konsequenzen zu ziehen und alle ungeprüften Mittel sofort zu verbieten.WASSER, BODEN & LUFT
Kampfstoffe im Meer: neue Gefahren
1,6 Millionen Tonnen Munition, Bomben, Minen und chemische Kampfstoffe aus zwei Weltkriegen lagern auf dem Grund allein der zu Deutschland gehörenden Teile von Nord- und Ostsee, darunter auch die einst von BAYER entwickelten Substanzen Lost, Tabun und Sarin. Da die Metall-Umhüllung der Chemie-Waffen mittlerweile durchrostet, treten die Gifte aus. Das stellt nicht nur für aquatische Lebewesen, sondern auch für Menschen eine große Gefahr dar (siehe auch AKTION & KRITIK). Und im Zuge des Ukraine-Kriegs erhöht sich das Gefährdungspotenzial noch einmal. So warnte die Wissenschaftszeitschrift Nature vor den Folgen der Sprengungen an der Nordstream-Pipeline, die durch die Ostsee verläuft. „Die Nordstream-Explosionen lösen Besorgnis über Chemiewaffen-Vergiftung aus“, schrieb das Blatt. Eine der drei Detonationen ereignete sich nämlich in der Nähe eines Areals mit vielen dieser Kriegshinterlassenschaften und führte zu einem Aufstieben giftiger Sedimente. Noch mehr als einen Monat nach dem Vorfall hat der dänische Toxikologe Hans Sanderson die Wolke sehen können, weil die Wasser-Schichtungen in der Ostsee eine extreme Stabilität aufweisen. „Was einmal aufgewirbelt wurde, braucht sehr lange, bis es wieder absinkt“, so der Wissenschaftler. Er fürchtet nun ein Weiterziehen des toxischen Gemisches und infolgedessen eine Ausweitung des Sperrgebietes für die Fischerei. Die Errichtung von Flüssiggas-Terminals an Ostsee-Häfen erschwert das submarine Waffenlager ebenfalls. So musste in Lubmin vor Beginn der Arbeiten extra ein Minensuch-Boot der Bundeswehr in See stechen, um den Baugrund zu explorieren und gegebenenfalls Kampfstoffe zu bergen.Indien: BAYER muss Fabriken schließen
BAYER CROPSCIENCE muss die Pestizid-Produktion am indischen Standort Himatnagar auf Anweisung einer Behörde des Bundesstaates Gujarat vorerst stoppen. Das „Gujarat Pollution Control Board“ hatte bei einer Umwelt-Inspektion gravierende Mängel festgestellt und einen Weiterbetrieb der fünf Fertigungsstätten des Standortes bis auf Weiteres untersagt.UNFÄLLE & KATASTROPHEN
CURRENTA will wieder Gift mischen
Bereits ein Jahr nach der Leverkusener Explosionskatastrophe vom 27. Juli 2021, die sieben Menschen das Leben kostete, lief der Betrieb im „Entsorgungszentrum“ des Chemie„park“-Betreibers CURRENTA wieder an. Dabei hat die Staatsanwaltschaft Köln ihre Ermittlungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und auf fahrlässige Herbeiführung eines Sprengstoff-Unglücks noch gar nicht abgeschlossen. Auch liegen viele Gutachten wie etwa das zur Sicherheitskultur bei der CURRENTA noch nicht in einer finalen Fassung vor. Aber die Service-Gesellschaft gab bei Prof. Dr. Christian Jochum ein Gutachten in Auftrag, das eruierte, „unter welchen Bedingungen es verantwortet werden kann, die Sonderabfall-Verbrennungsanlage schrittweise wieder in Betrieb zu nehmen“. Die Expertise empfahl, in Leverkusen vorerst keine wärme-empfindlichen und andere besonders gefährliche Stoffe mehr zu entsorgen und sich auf Müll aus den CURRENTA-Chem„parks“ und dem regionalen Umfeld zu beschränken. Die Bezirksregierung segnete das ab und gab für das Anfahren von einer der vier Verbrennungslinien grünes Licht. 46 Substanzen darf die CURRENTA inzwischen wieder annehmen. Aber ihr reicht das nicht. Peu à peu will sie zum Status quo ante zurück und wieder alle Hinterlassenschaften von BAYER & Co. entsorgen. So möchte das Unternehmen unbedingt den Tank 8 in Betrieb nehmen. Dieser soll den Brennstoff für die Klärschlamm-Verbrennungsanlage liefern, damit das Unternehmen nicht zu dem teureren Heizöl greifen muss. Und zu diesem Behufe beabsichtigen die Abfall-ManagerInnen entgegen früherer Beteuerungen, in dem Tank auch wieder unterschiedliche Stoffe zusammenzuführen, obwohl dies das Risiko unbeabsichtigter chemischer Reaktionen erhöht.STANDORTE & PRODUKTION
Verkauf der BeamtInnen-Kolonie
An vielen seiner Standorte unterhielt der Leverkusener Multi einst nicht nur Produktionsstätten, sondern auch eine soziale Infrastruktur mit Schwimmbädern, Kaufhäusern, Bibliotheken, Breitensport-Vereinen, Werkskindergärten und Werkswohnungen. Diese Sozialpolitik sollte eine „BAYER-Familie“ begründen, die Beschäftigten an den Konzern binden und so davon abhalten, auf dumme, klassenkämpferische Gedanken zu kommen. Doch von dieser Strategie hat der Global Player sich schon lange abgewendet. Die Einrichtungen schloss er peu-à-peu, und auch seine Immobilien stieß er nach und nach ab. Im Jahr 2002 trennte die Aktien-Gesellschaft sich von ihren 9.600 Werkswohnungen, und jetzt vollzieht sie an ihrem Stammsitz den letzten Schritt. Der Agro-Riese veräußerte die BeamtInnen-Kolonie – die Siedlung für seine Besserverdienenden ganz in der Nähe der Konzern-Zentrale – an einen Investor. Die 149 Wohneinheiten sowie der alte Wiesdorfer Bahnhof, das alte Sparkassen-Gebäude und ein Hochbunker gingen an die Unternehmensgruppe EMIL’S aus Bergisch Gladbach. Wie immer in solchen Fällen betont BAYER, dass sich nichts ändere. „Der Verkauf erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadt Leverkusen und sichert den derzeitigen Wohnungsmietern weitreichende Bestandsgarantien zu.“ Eine Umwandlung in Eigentumswohnungen sei vertraglich ausgeschlossen, und die Siedlung bliebe auch den Chem„park“-Beschäftigten vorbehalten, versichert Ulrich Waschke von BAYER CORPORATE REAL ESTATE. Die Rheinische Post ließ sich davon nur wenig beeindrucken und resümierte: „Mit dem Verkauf endet eine BAYER-Ära.“POLITIK & ÖKONOMIE
BAYERs AktionärInnen-Struktur
Die Investment-Gesellschaft BLACKROCK hält mit 7,17 Prozent (Stand: Ende 2021) immer noch die meisten BAYER-Aktien. Danach folgen der Singapurer Staatsfonds TEMASEK mit 3,9 Prozent und HARRIS ASSOCIATES mit 3,02 Prozent. Rund 38 Prozent der Geschäftsanteile des Leverkusener Multis befinden sich in inländischem Besitz, 62 Prozent in ausländischem. Zum Vergleich: Im Jahr 2013 lag das Verhältnis bei 28 Prozent zu 72 Prozent.Recht & Unbillig
Glyphosat-Klage von AURELIA
Am 15. Dezember 2022 lief die Glyphosat-Genehmigung aus. Aber die Europäische Union schaffte es nicht, die für eine erneute Zulassung nötigen Risiko-Bewertungen fristgerecht vorzunehmen. Das bedeutete jedoch keineswegs das vorläufige Aus für das umstrittene BAYER-Herbizid. Trotz nicht abgeschlossener Sicherheitsprüfung darf der Leverkusener Multi das Mittel vorerst ein Jahr lang weiter vermarkten. Die EU-Kommission sprach nämlich eine „technische Verlängerung“ aus (siehe SWB 1/23). Die AURELIA-Stiftung beschloss daraufhin, eine Klage gegen den Beschluss einzureichen, denn die EU lässt Pestizide mit fehlenden Unbedenklichkeitsnachweisen immer wieder Ehrenrunden drehen.11.135 Euro für LASSO-Schäden
Der französische Landwirt Paul François hatte im Jahr 2004 durch das MONSANTO-Ackergift LASSO (Wirkstoff: Monochlorbenzol) massive gesundheitliche Beeinträchtigungen erlitten. „Mein Abwehrsystem ist so geschwächt, dass jede Infektion tödlich sein kann“, sagte er einmal in einem Interview. Dazu kamen noch neurologische Störungen, die zu Ohnmachtsanfällen, Gedächtnis-Verlusten und Kopfschmerzen führten. 2007 verklagte der Bauer das Unternehmen deshalb auf rund eine Million Euro Schadensersatz. Damit geriet er in einen langjährigen Rechtsstreit, dessen gegnerische Partei ab 2018 BAYER als neuer MONSANTO-Eigner wurde. Das Verfahren endete im Dezember 2022 mit einem Sieg von Paul François, der allerdings kleiner als erwartet ausfiel. Die RichterInnen setzten als Entschädigungssumme lediglich 50.000 Euro fest. Es habe sich nur um vorübergehende Beschwerden gehandelt, die sich nicht chronifizierten, argumentierten sie. Da François von der landwirtschaftlichen Sozialkasse und seiner Privatversicherung schon annähernd so viel erhalten hatte, musste BAYER nur noch die Differenz-Summe von 11.135 Euro als Strafe zahlen. Der Landwirt zeigte sich enttäuscht: „11.000 Euro für so viele Opfer.“ Aber immerhin hat er eine klare Verurteilung des Agro-Riesen erwirkt, was in juristischen Auseinandersetzungen dieser Art nicht allzu oft vorkommt. Meistens setzt ein Vergleich, der die Frage der Schuld offen lässt, den Schlusspunkt.698 Millionen Dollar für PCB-Schäden
Polychlorierte Biphenyle (PCB) gehören zu den giftigsten Hervorbringungen der Chlorchemie. Die vor allem von BAYER und MONSANTO in Umlauf gebrachten gefährlichen „Alleskönner“ kamen bis zu ihrem vollständigen Verbot (1989 in Deutschland) in Elektrogeräten, Fugendichtungsmassen, Farben, Ölen, Lacken und Bodenbelägen zum Einsatz – und stellen wegen ihrer stabilen chemischen Struktur immer noch ein beträchtliches Gesundheits- und Umweltrisiko dar. Darum ist der BAYER-Konzern mit einer Vielzahl von Klagen konfrontiert. So erheben in den USA zahlreiche Kommunen und Bundesstaaten Schadensersatz-Ansprüche gegen die jetzige BAYER-Tochter MONSANTO. Diese gründen sich unter anderem auf firmen-eigene Dokumente von MONSANTO, die selbst von Risiken wie „systemischen toxischen Effekten“ sprechen. Einen Produktionsstopp haben die ManagerInnen damals jedoch trotzdem abgelehnt, da es um „zu viel MONSANTO-Gewinn“ ging. Die Kläger machen Gewässer-Verunreinigungen geltend, welche die Bestände von Fischen, anderen aquatischen Lebewesen und Vögeln bedrohen. Kadaver von Schwertwalen an den Küsten mussten die Behörden sogar schon als Giftmüll klassifizieren und in speziellen Anlagen entsorgen. Und über die Nahrungskette kann auch der Mensch in Kontakt mit dem PCB kommen. Mit dem Staat Oregon hat der Leverkusener Multi den Rechtsstreit Mitte Dezember 2022 beigelegt. Im Rahmen eines Vergleiches zahlt er 698 Millionen Dollar für die Sanierung der Seen und Flüsse. Ähnliche Verträge hatte der Konzern vorher schon mit New Mexico, Washington und dem Columbia-Destrict geschlossen.BAYER & Co. müssen CO2-Ausstoß reduzieren!
Deutschland legt zur Welt-Klimakonferenz in Sharm el-Scheikh eine denkbar schlechte Klima-Bilanz vor. So sieht der ExpertInnen-Rat der Bundesregierung das Ziel, die Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 65 Prozent zu senken, ernsthaft bedroht. Darum fordert das Gremium, die Vorgaben des Klimaschutz-Gesetzes nachzuschärfen. „Im Industrie-Sektor wäre eine 10-fache und beim Verkehr sogar eine 14-fache Erhöhung der durchschnittlichen Minderungsmenge notwendig", konstatiert Ratsmitglied Thomas Heimer.
Provisorische Zulassungsverlängerung scheitert
Der EU-Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel lehnte am letzten Freitag eine provisorische Verlängerung der Glyphosat-Zulassung ab, die am 15. Dezember ausläuft. Einen entsprechenden Antrag, den zuständigen Gremien ein Jahr länger Zeit zu geben, die von dem Mittel für Mensch, Tier und Umwelt ausgehenden Gefahren abzuschätzen, hatte die EU-Kommission vorgelegt. Und auch BAYER sowie die anderen in der „Glyphosat Renewal Group" organisierten Hersteller des Herbizids forderten – allerdings gestützt „auf die überzeugenden wissenschaftlichen Argumente für eine Verlängerung der Glyphosat-Zulassung" – einen solchen Beschluss ein. Doch dafür kam keine qualifizierte Mehrheit zustande.
„Die Coordination gegen BAYER-Gefahren begrüßt das Votum. Völlig zu Recht empfanden es die Ausschuss-Mitglieder als unverantwortlich, Glyphosat ohne aktuelle Risikoprüfung weiter auf dem Markt zu lassen. Nicht von ungefähr zeigte sich die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides ‚zutiefst besorgt' über die sich in die Länge ziehende Bewertung des Herbizids. Umso peinlicher, dass das grün geführte deutsche Landwirtschaftsministerium die Entscheidung im Ausschuss nicht mittrug und sich stattdessen der Stimme enthielt", so CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann.
Die Bundesregierung sähe die Verzögerung im Verfahren zwar kritisch, wolle aber der Europäischen Kommission „bei der formal-administrativen Verlängerung um einen kurzen Zeitraum" nicht im Weg stehen, heißt es in einer Erklärung des „Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft". Solche „formal-administrativen Verlängerungen" ohne fundierte wissenschaftliche Basis gehören in Brüssel zur üblichen Praxis. „Die Wiedergenehmigungsverfahren auf EU-Ebene werden (...) oft über Jahre verzögert: Wenn das geschieht, wird die Genehmigung über die gesetzlichen Fristen hinaus immer wieder verlängert", kritisierte das Umweltbundesamt Anfang des Jahres. Als ein Beispiel nannte es dabei den unter anderem in BAYER-Produkten enthaltenen Wirkstoff Flufenacet, der bereits seit 18 Jahren in aller Ruhe Ehrenrunden dreht.
Einer immerhin einjährigen Ehrenrunde dürfte, trotz des negativen Bescheids vom Freitag, Glyphosat entgegensehen, dank des Berufungsausschusses oder aber der Kommission selbst, die in der Sache das letzte Wort hat. Der langerwartete Bericht der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA zu den Risiken und Nebenwirkungen des Pestizids ist jetzt für Juli 2023 angekündigt. Derjenige der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA liegt schon vor. Sie empfahl Anfang Juni die Wiederzulassung, ohne neuere Untersuchungen zu der von der Substanz ausgehenden Krebsgefahr oder zu den blinden Flecken der von BAYER & Co. vorgelegten Studien zur Kenntnis genommen zu haben. Das Urteil der EU über die Agro-Chemikalie erfolgt dann voraussichtlich im Dezember 2023. Selbst wenn dieses positiv ausfallen sollte, beabsichtigt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, an dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Glyphosat-Ausstieg festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung, ob das EU-Recht ein solches Vorgehen erlaube, stehe jedoch noch aus, schränkte er ein.
Für die CBG hätten die wissenschaftlichen Befunde zu dem Glyphosat-Gefährdungspotenzial schon im Jahr 2017 ausgereicht, um das Pestizid aus dem Verkehr zu ziehen. Und nicht nur das: „138.000 krebskranke KlägerInnen, die Entschädigungsansprüche an BAYER stellen, sprechen eine deutliche Sprache", konstatiert Marius Stelzmann abschließend.
Pressekontakt:
Marius Stelzmann 0211/33 39 11
Lobby-Europameister BAYER
Mit einem Etat von 6,5 bis 7 Millionen Euro versuchte der BAYER-Konzern im Jahr 2021, auf Entscheidungen der Europäischen Union Einfluss zu nehmen. Damit steigerte die Aktiengesellschaft ihre Ausgaben gegenüber 2020, wo sie die politische Landschaft in Brüssel mit 4,375 Millionen Euro pflegte, noch einmal beträchtlich. Einen ähnlichen Lobby-Aufwand betrieb einzig APPLE. Selbst die Tech-Giganten GOOGLE, FACEBOOK und MICROSOFT, die ihre Geschäfte durch den avisierten „Digital Markets Act“ bedroht sahen, investierten weniger. Das ergab eine Recherche der beiden Initiativen CORPORATE EUROPE OBSERVATORY und LOBBYCONTROL im EU-Transparenzregister.
74 LobbyistInnen beschäftigt der Global Player in seinem Brüsseler „Verbindungsbüro“. 15 von ihnen haben exklusiven Zutritt zum Europäischen Parlament. Gemeinsam brachten sie es auf nicht weniger als 41 Treffen mit ranghohen VertreterInnen der EU-Kommission bzw. den KommissarInnen selbst.
Einen Schwerpunkt der Aktivitäten bildete dabei das umstrittene Herbizid Glyphosat, denn die EU prüft gerade den Antrag des Agro-Riesen auf eine Verlängerung der Zulassung, die am 15. Dezember des Jahres ausläuft. Um die EntscheiderInnen in Brüssel von der Unbedenklichkeit des Pestizids zu überzeugen, standen allein der von BAYER angeheuerten PR-Agentur RUD PEDERSEN 1,3 Millionen Euro zur Verfügung. Der Leverkusener Multi antichambrierte in Sachen „Glyphosat“ jedoch auch selbst.
Zu den weiteren Einsatzgebieten gehörten die Pestizid-Regulierung im Allgemeinen, die geplante neue Trinkwasser-Richtlinie, der Aktionsplan der EU für eine Reform des Patentrechts und derjenige für eine Reduzierung der Verschmutzung von Wasser, Luft und Boden. Darüber hinaus bemühte sich das Unternehmen, die Chemikalien-Richtlinie REACH, den Umgang mit hormon-ähnlich wirkenden Substanzen, die Pharma-Strategie, die Biodiversitätsstrategie sowie die Agrarstrategie „From Farm to Fork“ in seinem Sinne zu gestalten. Damit nicht genug, intervenierte es ebenfalls in Sachen „Klimaschutz- und Agrarpolitik“, „Green Deal“ und „EU/Mercosur-Abkommen“.
„Bei allen wichtigen Themen, welche die Europäischen Union verhandelt, redet der BAYER-Konzern mit, ohne ein demokratisch legitimiertes Mandat zu haben, nur weil seine wirtschaftliche Macht ihn dazu in die Lage versetzt. Das ist ein Skandal“, kritisiert CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann.
Pressekontakt:
Marius Stelzmann 0211/33 39 11

In Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW
Giftige BAYER-Profite
Jahrestagung muss leider abgesagt werden
Liebe TeilnehmerInnen, liebe UnterstützerInnen,
es tut uns sehr leid, Euch mitteilen zu müssen: Nach mehreren krankheitsbedingten Ausfällen sowohl in unserem Team als auch bei den eingeladenen ReferentInnen müssen wir die diesjährige Tagung der CBG „Giftige BAYER-Profite- Glyphosat stoppen. Jetzt.“ leider absagen.
Wir haben für die Jahrestagung ein sehr kleines Team, das fast komplett aus Ehrenamtlichen besteht. Kurzfristige Ausfälle lassen sich dadurch nur schwer oder gar nicht kompensieren. Wir entschuldigen uns besonders bei allen, die ihre Anreise schon geplant haben.
Wir haben alle Mitglieder benachrichtigt, die sich bei uns angemeldet haben, sowie die Information auf unseren üblichen Öffentlichkeitskanälen verbreitet. Bitte habt Verständnis, dass wir Euch nicht gezielt ansprechen können, wenn Ihr Euch nicht angemeldet habt.
Wir danken allen, die unsere Tagung besuchen wollten, oder uns auf andere Weise unterstützt haben. Wir versichern Euch: Wir machen dennoch mit voller Energie weiter. Glyphosat und die Frage, ob es verbannt oder verlängert wird, bleibt für uns ein brandaktueller Kampf.
Solidarische Grüße
Euer CBG-Team
Glyphosat und kein Ende?
2022 und 2023 sind wichtige Jahre für die kleinbäuerliche Landwirtschaft, für die kritischen BAYER-AktionärInnen und alle anderen, die sich gegen die tödlichen Pestizid-Verbrechen der Agrar-Konzerne stellen. Die EU will entscheiden, ob die Zulassung von GLYPHOSAT verlängert wird. Bei BAYER läuft die
Lobby-Arbeit für eine Zulassungsverlängerung bereits auf Hochtouren. Eine Verlängerung jedoch würde weitere fünf Jahre Tod und Elend für die Menschen und Zerstörung und Vergiftung für die Umwelt der EU bedeuten. Die EU_Parlamentarierin Sarah Wiener wird uns erzählen, was in Brüssel hinter den Kulissen läuft.
Nahaufnahme
GLYPHOSAT belegt Platz 3 der profitabelsten Produkt des BAYER-Konzerns. Der Konzern wird alles tun, um die milliardenschweren Gift-Profite zu sichern. Dazu gehört die Vertuschung der bekanntesten Nebenwirkung von GLYPHOSAT: Lymphdrüsenkrebs.
Peter Clausing vom Pestizid Aktions-Netwerk (PAN) ist einer der versiertesten Pestizid-KritikerInnen Deutschland. Der Experte wird mit uns das BAYER-Gift unter die Lupe legen. Solidarität mit verfolgter GLYPHOSAT Kritikerin Larissa Bombardi ist Professorin an der Universität von São Paulo. Sie musste mit ihrer Familie aus Brasilien fliehen und lebt nun im Exil in Brüssel, weil sie wegen ihrer Pestizid-Forschungen mit dem Tod bedroht wurde.
Vergiftung des globalen Südens
Brasilien ist Weltmeister der Agrargifte. Seit 2010 werden in dem südamerikanischen Land mehr als eine Million Tonnen Pestizide jährlich in der Landwirtschaft versprüht. GLYPHOSAT stellt einen großen Teil dieser unfassbaren Menge. Die Menschen erkranken und sterben massenhaft an den Folgen von GLYPHOSAT-Vergiftungen.
Termin
Samstag, 08.10.2022
09.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr
Einlass ab 9.30 Uhr
Ort
Bürgerzentrum Bilk
Bachstr. 145
40217 Düsseldorf
Konzernwiderstand kostet Geld
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) und ihre
Mitglieder arbeiten anders als andere. Sie stellen den Chemie-
Giganten aus Leverkusen unter zivilgesellschaftliche Beobach-
tung Rund um den Globus. Rund um alle Themen. Antikapitalis-
tisch, konzernkritisch.
Egal, welches Konzernverbrechen BAYER begeht, die CBG
recherchiert und dokumentiert es. Deswegen brauchen wir Unter-
stützung. Die Tagung ist kostenlos, aber nicht gratis: Bitte leistet
mit einer Spende einen Beitrag dazu, dass sie stattfinden kann.
CBG bei Friedensdemo
„Schluss mit dem Krieg – Sofortiger Waffenstillstand – Verhandeln statt schießen – Keinen Euro für Krieg und Zerstörung, sondern Milliarden für eine weltweite soziale, gerechte und ökologische Friedenspolitik! – unter diesem Motto fanden sich am 1. Oktober in Köln rund 300 Menschen zu einer Friedensdemonstration ein. Sie forderten einen Ausstieg aus der Eskalationsspirale, die sich mit permanenten Waffenlieferungen, der Annektion besetzter Gebiete und der Zerstörung von Gas-Pipelines zu immer neuen Höhen aufschwingt und eine Kehrtwendung hin zum Frieden zunehmend schwieriger macht. Ein breiter Kreis hatte sich am Heumarkt versammelt, GewerkschaftlerInnen ergriffen ebenso das Wort wie Mitglieder der DEUTSCHEN FRIEDENSGESELLSCHAFT – VEREINIGTE KRIEGSDIENSTGEGNERINNEN, AktivistInnen der christlichen Friedensbewegung und Mitglieder der SDAJ.
Und auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN ging an diesem Tag mit auf die Straße, denn der Leverkusener Multi nutzt die desaströse Lage massiv für sich aus. Er bezeichnet sich als system-relevant und pocht auf einen einen privilegierten Zugang zu Energie, weshalb BAYER-Chef Werner Baumann Wirtschaftsminister Robert Habeck auch bei seinen Shopping-Touren in Sachen „Wasserstoff“ und „Flüssiggas“ begleitet hat. Zudem verdient der Global Player an der Nahrungsmittel-Krise, denn diese ließ die Preise für Glyphosat & Co. massiv steigen. Und damit nicht genug, nutzt der Global Player die Knappheiten auch noch, um die Werbetrommel für die Gentechnik zu rühren.