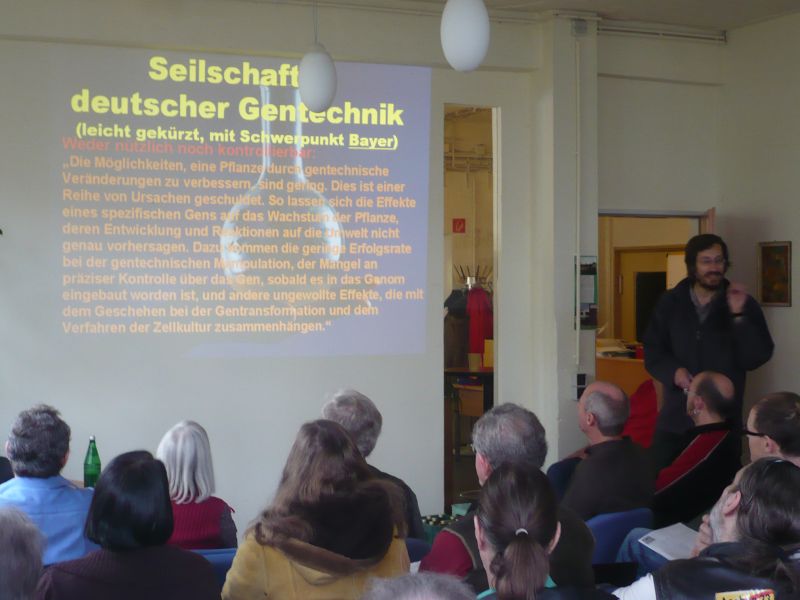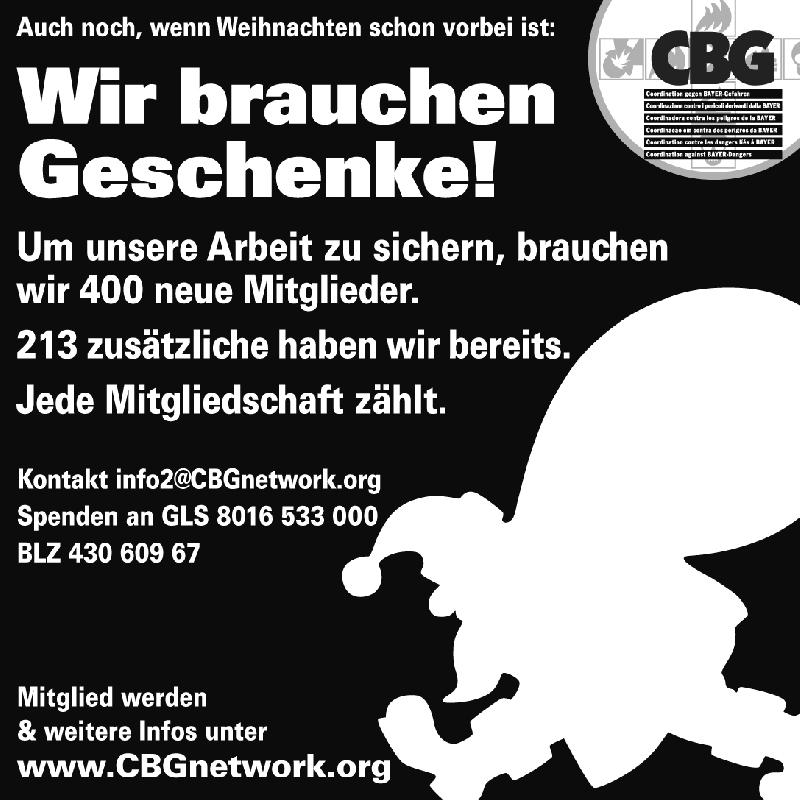AKTION & KRITIK
Preis für die CBG
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und ihr Gründungsmitglied Axel Köhler-Schnura erhielten am 24. September 2011 den „Henry-Mathews-Preis“ der KRITISCHEN AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE. In der Laudatio hieß es: „Eine beeindruckende Anzahl von Aktionen hat eure konzernkritische Arbeit begleitet. Zum Beispiel im Jahr 2000, als ihr auf dem jährlich stattfindenden Gedenktag Day of no Pesticides an die Bhopal-Opfer des Giftgasunfalls in Indien 1984 erinnert habt und mit Giftspritzen, Kreuzen und Transparenten vor BAYER aufgetreten seid (...) Neben den Hauptversammlungs-Auftritten und Aktionen begleitet Ihr BAYER mit kritischen Analysen. Daneben unterstützt ihr weltweit Bürgerinitiativen, wenn sie in euer Aufgabenfeld gehören.“ Axel Köhler-Schnura dankte mit den Worten: „Ich wurde geehrt mit dem Henry-Mathews-Preis. Wofür? Für etwas, das doch selbstverständlich ist: Aufzustehen gegen Unrecht und Verbrechen. Und zwar so, wie es einem möglich ist. Dieser Preis steht Unzähligen zu. Und so sehe ich mich stellvertretend für all diese namenlosen Unbekannten, die tagtäglich das Gleiche tun wie ich“.
TDI-Anlage in der Kritik
Auf den von der Bezirksregierung Köln in der ersten Oktober-Woche 2011 einberufenen Erörterungsterminen zur Toluylendiisocyanat-Anlage, die BAYER in Dormagen plant, mussten sich die Konzern-Emissäre viel Kritik anhören (siehe auch SWB 1/12). Die VertreterInnen von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN, dem BUND und der DORMAGENER AGENDA 21 beanstandeten die fehlenden Angaben zur Umweltbelastung, eine mangelhafte Störfall-Vorsorge und eine ungenügende, da nur mit Blech statt mit Beton vorgenommene Ummantelung der Produktionsstätte. Zudem verlangten sie den Einbau einer Schutzwand, die bei einer Explosion mit nachfolgendem Phosgen-Austritt neutralisierendes Ammoniak freisetzen könnte. Die Bezirksregierung ließ das nicht unbeeindruckt. Sie dürfte das Projekt aber trotzdem genehmigen und im günstigsten Fall einige Nachbesserungen einfordern.
Duisbergs 150. Geburtstag
Am 29. September 2011 jährte sich der Geburtstag des langjährigen BAYER-Generaldirektors Carl Duisberg zum 150. Mal. Er war im 1. Weltkrieg verantwortlich für den Einsatz von Giftgas und die Ausbeutung von Zwangsarbeitern. Zudem hatte er einen maßgeblichen Anteil an der Gründung des Mörderkonzerns IG FARBEN. Da dem Ex-Chef des Leverkusener Multis trotz alledem immer noch in Ehren gedacht wird, startete die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) eine Kampagne. Sie forderte anlässlich des Jahrestags die Umbenennung von Straßen und Schulen, die Duisbergs Namen tragen, sowie den Entzug der Leverkusener Ehrenbürgerschaft (siehe auch SWB 1/12).
Kritik an Kölner Universität
Der Politologe Thomas Kliche hat den Kooperationsvertrag der Universität Köln mit BAYER scharf kritisiert und als „korporative Korruption“ bezeichnet. „Forscher mit Geld von Unternehmen finden häufiger die gewünschten Wirkungen und interpretieren ihre Ergebnisse netter zugunsten der Pillen“, sagte Kliche in einem Interview mit der taz. Er monierte auch die immer stärkere Abhängigkeit der Hochschulen von Drittmitteln, weil das die Einrichtungen den Wünschen der Konzerne gegenüber gefügiger mache. Um Transparenz zu gewährleisten, forderte der Wissenschaftler deshalb die Offenlegung der Vereinbarung und ergänzte: „Aber damit kann es nicht getan sein, weil solche Abkommen ja oft bewusst unverfänglich formuliert werden. Auch die Rahmenbedingungen müssen sich ändern. Da könnten interessanterweise Arbeitnehmervertretungen in der Forschung helfen, denn sie stärken die unteren Ebenen gegen den sanften Erwartungsdruck von oben.“
Anfrage zu Kooperationsverträgen
Einen Kooperationsvertrag, wie ihn die Kölner Hochschule mit BAYER vereinbart hat (siehe oben), schließen immer mehr Universitäten mit Wirtschaftsunternehmen ab. Die Partei „Die Linke“ nahm die Zusammenarbeit der Berliner Humboldt-Universität mit der DEUTSCHEN BANK zum Anlass, eine Anfrage an die Bundesregierung zu stellen. Diese sieht die Freiheit von Wissenschaft und Lehre durch solche Partnerschaften allerdings nicht gefährdet. Darum will sie auch keinen Handlungsbedarf erkennen, und zwar gerade im Namen dieser Freiheit. „Die grundgesetzliche garantierte Freiheit von Forschung und Lehre begrenzt die staatliche Einflussmöglichkeit“, so die CDU/FDP-Koalition. Auch an der Geheimhaltungspolitik, wie sie beispielsweise BAYER und die Kölner Uni mit Vehemenz verfechten, stört sie sich nicht. „Angesichts der vielfältigen Formen der Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie der zahlreichen rechtlichen Implikationen, z. B. mit Blick auf den Schutz personenbezogener Daten, den Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen oder den Schutz geistigen Eigentums erachtet die Bundesregierung (...) eine generelle Pflicht zur Veröffentlichung von Kooperationsverträgen als rechtlich bedenklich“, heißt es in der Antwort.
Forscher warnt vor Glyphosat
Gentech-Pflanzen weisen Resistenzen gegenüber bestimmten Pestiziden auf und können auf den Feldern deshalb bis zum Abwinken mit ihnen besprüht werden. Das bekannteste Mittel ist Glyphosat, das hauptsächlich in Kombination mit MONSANTO-Genpflanzen der „ROUND UP“-Baureihe, aber auch mit BAYER-Produkten wie der Baumwolle „GHB 614“ zum Einsatz kommt. Der emeritierte US-Agrarwissenschaftler Don Huber hat den Präsidenten der Europäischen Kommission, Manuel Barroso, jetzt in einem Brief eindringlich vor Glyphosat gewarnt, da es seiner Meinung nach zahlreiche Risiken und Nebenwirkungen hat. So kann es zum Absterben von Soja-Gewächsen und zum Verwelken von Mais führen. Zudem senkt es Huber zufolge die pflanzen-eigenen Widerstandskräfte. Deshalb riet der Forscher der EU, keine Laborfrüchte zuzulassen, die den Gebrauch von Glyphosat nach sich ziehen.
Demo gegen Patente auf Pflanzen
BAYER & Co. betreiben die Privatisierung der Natur nicht nur vermittels der Gentechnik. Sie streben auch immer mehr Patente auf konventionell gezüchtete Pflanzen wie z. B. Brokkoli an. So hat das Europäische Patentamt BAYER unlängst geistiges Eigentum auf eine besser vor Mehltau geschützte Gurke sowie auf eine Ackerfrucht mit erhöhter Stress-Resistenz zugesprochen. Doch gegen das Vorgehen der Konzerne erhebt sich Widerstand. Am 26. Oktober 2011 kam es vor dem Europäischen Patentamt in München zu einer Demonstration gegen den botanischen Imperialismus der Agro-Multis.
Naturland ohne Nano
Die Nanotechnologie lässt Werkstoffe auf winzig kleine Größen schrumpfen. Dabei entwickeln BAYERs BAYTUBES und andere Nano-Produkte jedoch unbekannte und nicht selten gefährliche Eigenschaften. Wegen dieses Risiko-Profils hat sich der Ökoverband „Naturland“ entschieden, keine Lebensmittel, Kosmetika oder Verpackungsmaterialien auf Nano-Basis mit seinem Label zu versehen.
KAPITAL & ARBEIT
Erfolgreicher Arbeitskampf in Berkeley
Das BAYER-Werk in Berkeley gehört zu den wenigen US-Niederlassungen des Konzerns mit einer organisierten Arbeiterschaft. Darum gelang es in harten Tarifverhandlungen, die von Solidaritätsaktionen im ganzen Land begleitet waren, auch, deutliche Verbesserungen für die Beschäftigten zu erreichen. Die Gewerkschaft INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION (ILWU) vereinbarte mit der Betriebsleitung eine Entgelt-Steigerung von 3,1 Prozent über einen Zeitraum von vier Jahren, eine Begrenzung der Krankenversicherungskosten auf 18 Prozent des Gehalts sowie eine Sicherung der Arbeitsplätze. Donald Mahon von der ILWU sah den Erfolg als Bestätigung seiner Arbeit. „BAYER macht - so wie viele andere Unternehmen - Milliardenumsätze, aber damit sie den Arbeitern davon einen Teil abgeben, benötigt man gewerkschaftliche Organisation, Proteste sowie Druck von außerhalb und innerhalb der Werke“, so der Aktivist.
„Chemie Ost“ mit Entgelt-Angleichung
Im neuen Tarifvertrag für die ostdeutsche Chemie-Industrie ist es der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE gelungen, eine weitere Angleichung der Entgelte auf das West-Niveau zu erreichen. Gibt es bei den Eingangstarifen für verschiedene FacharbeiterInnen-Gruppen schon länger keine Unterschiede mehr, so soll nun auch die Differenz bei den vorgesehenen Erhöhungsstufen, die aktuell noch acht Prozent beträgt, schrumpfen. Zudem erweitert sich im Osten die Bemessungsgrundlage für die jährlichen Bonus-Zahlungen sukzessive, bis sie 2015 zum West-Wert von 95 Prozent des letzten Bruttogehaltes aufschließt.
IB BCE will Job-Garantie
Der Betriebsrat verhandelt mit der BAYER-Spitze über den Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen bis 2015. „Wegen massiver Umstrukturierungen, Ausgliederungen von Unternehmensteilen und angedrohtem Arbeitsplatz-Abbau benötigen die Beschäftigten klare Perspektiven und dauerhaft gesicherte Arbeit“, erklärte Gesamtbetriebsratschef Thomas de Win von der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE. Allerdings gestalten sich die Gespräche schwierig. Sie werden nicht wie eigentlich vorgesehen zum Jahresende 2011 enden, BAYER-Chef Marijn Dekkers kündigte eine Einigung erst für Mitte 2012 an. De Win indessen reicht die Job-Garantie nicht. Er forderte auch mehr Engagement für die Niederlassungen in der Bundesrepublik: „BAYER muss an allen deutschen Standorten investieren.“.
Lohnangleichung für LeiharbeiterInnen
Der Leverkusener Multi beschäftigt Hunderte von LeiharbeiterInnen. Ihre Lage dürfte sich bald bessern. Die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) erzielte mit dem „Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister“ nämlich eine Einigung über eine Lohnangleichung. Nach einem Zeitraum von drei Monaten sollen die ZeitarbeiterInnen sukzessive Zuschläge erhalten, bis ihr Entgelt dem der Stammbelegschaft entspricht, so die Regelung. Auch anderen Leiharbeitgebern will die IG BCE dieses Modell vorschlagen. Es tritt allerdings erst in Kraft, wenn es den anderen DBG-Gewerkschaften ebenfalls gelingt, das „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“-Prinzip durchzusetzen. Einigen von denen geht die Vereinbarung jedoch nicht weit genug. So lehnt etwa VER.DI die Stufenanpassung ab. „Da sich die Höhe des Lohns nach der Entleih-Dauer richtet, würden lediglich die Einkommensunterschiede zwischen Stammbelegschaft und Leiharbeitern zementiert“, konstatiert Jörg Wiedemuth von VERDIs tarifpolitischer Grundsatzabteilung. Zudem nimmt er es der IG BCE übel, den Leiharbeitsvorstoß nicht mit den anderen Gewerkschaften abgesprochen zu haben.
Auflösung der Diagnostika-Sparte
Seit dem 2006 erfolgten Aufkauf von SCHERING hat BAYER viele Arzneien des ehemaligen Berliner Pharma-Riesen ausgemustert. Der Konzern gab sich nämlich nicht dessen mit Umsatz-Erwartungen zufrieden. Während SCHERING neuen Produkten die Vorgabe von 100 Millionen Euro machte, erwartet der Leverkusener Multi 200 bis 300 Millionen. Neuester Coup: Der Konzern will die Sparte mit den ererbten Diagnostika-Produkten auflösen, die er schon länger vernachlässigt, weshalb bereits viele SCHERING-Ehemalige das Unternehmen verlassen haben. Das Geschäft mit den Röntgenkontrastmitteln MAGNEVIST und ULTRAVIST schlägt der Global Player seiner Tochterfirma MEDRAD zu; für sein noch nicht marktreifes Präparat zur Alzheimer-Früherkennung sucht er einen Käufer. Nach Angaben des Pillen-Herstellers stehen mit den avisierten Veränderungen 100 Arbeitsplätze zur Disposition.
Die letzten SCHERING-Mohikaner
Als der Leverkusener Multi 2006 SCHERING übernahm, stellte er den Beschäftigten Vorteile aus dem Zusammenschluss in Aussicht. Die Realität sah jedoch anders aus. 1.000 Belegschaftsangehörige mussten sofort gehen, und viele SCHERING-Präparate stampfte BAYER ein (s. o.). Mit dem neuen BAYER-Chef Marijn Dekkers brachen dann noch härtere Zeiten an. Er tilgte den Namen SCHERING und unterstellte die Pillen-Schmiede direkt dem Kommando des Pharma-Chefs Jörg Reinhardt. Zudem verabschiedete er sich vom Ausbau des Berliner Standortes und ließ die dortigen Beschäftigten besonders hart unter seinem Arbeitsplatzvernichtungsprogramm leiden. Dies alles hatte Konsequenzen. Von den 96 Personen, die bei SCHERING einst in höheren Positionen tätig waren, arbeiten heute nach einer Berechnung des Betriebsrats gerade noch einmal vier für den Global Player, wie die Financial Times Deutschland berichtete.
Das Ende des Standortes Mishawaka
Im Zuge seines Rationalisierungsprogramms, das 4.500 Jobs kostet, strukturiert BAYER auch das Pharma-Geschäft in den USA um. So stehen bei MEDRAD, der Tochter-Firma für Medizin-Produkte, 60 bis 70 Jobs zur Disposition. Zudem plant der Gen-Gigant an der Ostküste ein neues Pharma-Zentrum, was die Existenz der anderen sechs Standorte in der Region bedroht. Eines wickelt der Pharma-Riese bereits ab. Er kündigte an, seine Niederlassung in Mishawaka schließen zu wollen. Die 130 Belegschaftsangehörigen, die dort für SIEMENS Diagnostika-Geräte herstellten, können zum Münchner Unternehmen wechseln. Die restlichen 270 stehen vor einer ungewissen Zukunft. Der Leverkusener Multi machte ihnen zwar ein Weiterbeschäftigungsangebot, das allerdings fiel ziemlich vage aus.
BAYER verkauft VIVERSO
Der Leverkusener Multi hat seine Tochter-Gesellschaft VIVERSO für 75 Millionen Euro an die Firma NUPLEX verkauft. „Damit trennt sich BAYER MATERIAL SCIENCE von dem Geschäft mit bestimmten konventionellen Lackharzen, das nicht mehr zur aktuellen Strategie des Unternehmens passt“, verkündete der Global Player. Er vernichtet damit 165 Arbeitsplätze innerhalb des Konzerns. Die Beschäftigten müssen vorerst jedoch nicht um ihre Jobs fürchten. NUPLEX kündigte an, die komplette Belegschaft übernehmen zu wollen.
JENAPHARM: Nur noch Vertrieb
Bereits 2006 hatte der Leverkusener Multi die Forschungsabteilung seiner Tochter-Gesellschaft JENAPHARM dicht gemacht. Nun wickelt er auch noch die Entwicklungssparte ab und vernichtet so 40 Arbeitsplätze. Künftig kümmern sich die verbleibenenen 200 Beschäftigten nur noch um den Vertrieb von Kontrazeptiva, Testosteron-Präparaten und Mitteln gegen Hautkrankheiten.
DYNEVO am Ende
Im Jahr 2001 hatte BAYER die Werksdruckerei DYNEVO ausgegliedert. In der Folge reduzierte der Multi die Arbeitsplätze von 230 auf 150. Zuletzt wollte er die Gesellschaft an BERTELSMANN verkaufen. Aber die Verhandlungen scheiterten. Deshalb kündigte der Konzern jetzt an, den Betrieb dicht zu machen.
Frauenanteil: 17 Prozent
Aktuell beträgt der Anteil von Frauen in Führungspositionen bei BAYER 17 Prozent. Der Leverkusener Multi hat sich zum Ziel gesetzt, diesen bis zum Jahr 2015 auf 30 Prozent zu steigern. Er will sich dabei allerdings nicht von der Politik auf die Sprünge helfen lassen. Der Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers empfindet eine „gesetzliche Quote als nicht zielführend“.
Großverdiener Manfred Schneider
BAYERs Aufsichtsratschef Manfred Schneider bleibt König der Deutschland AG. Er sitzt nämlich nicht nur dem Kontrollgremium des Leverkusener Multis vor, sondern bekleidet diese Position auch bei LINDE und RWE. Einen einfachen Aufsichtsratssitz hat er zudem noch bei der ALLIANZ inne. Dafür streicht er insgesamt 1,1 Millionen Euro ein - so viel wie keiner seiner KollegInnen.
14,7 Millionen für Wenning
Der Leverkusener Multi sorgt für einen angenehmen Ruhestand seines Ex-Chefs Werner Wenning. 14,7 Millionen Euro hält er für dessen Lebensabend bereit - mehr haben nur MERCEDES und VW für ihre Ehemaligen übrig. Und Wennings Nachfolger Marijn Dekkers braucht sich ebenfalls keine Sorgen zu machen. Im letzten Jahr hat der Konzern schon über zwei Millionen Euro für seine Pension zurückgelegt, so viel wie kein anderes Dax-Unternehmen für seinen Vorstandsvorsitzenden.
ERSTE & DRITTE WELT
Indien: 138 Arzneitest-Tote
Von 2007 bis 2010 starben in Indien 138 Menschen bei der Klinischen Erprobung von BAYER-Medikamenten (siehe auch SWB 1/12). Insgesamt kamen bei den Pillen-Prüfungen von Big Pharma in dem Zeitraum 1.600 ProbandInnen ums Leben. Nach Ansicht der Multis haben jedoch zumeist nicht die Medikamente, sondern Vorerkrankungen wie Krebs zum Ableben der ProbandInnen geführt. Die amtlichen Stellen machen ebenfalls nicht die Pharmazeutika im Allgemeinen verantwortlich. Von den 668 Sterbefällen im Jahr 2010 schreiben sie 22 der direkten Einwirkung der getesteten Substanzen zu. Darunter befinden sich fünf BAYER-Opfer, allein vier Tote forderte das Präparat XARELTO. Die Tests mit diesem Blutverdünnungsmittel hatte bereits die US-Gesundheitsorganisation PUBLIC CITIZEN beanstandet, da ProbandInnen, welche die Konkurrenz-Substanz Warfarin bekamen, nicht die optimale Dosis erhielten und sich so einem erhöhten Schlaganfall-Risiko aussetzten. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hat in einem Offenen Brief an BAYER die Praxis des Konzerns scharf kritisiert, immer mehr Tests in ärmere Länder zu verlegen, weil dort unschlagbare Preise, schnellere Verfahren und eine mangelhafte Aufsicht locken, und eine umfassende Aufklärung über die Todesserie gefordert.
Kontrazeptiva-Kampagne in Afrika
Der Leverkusener Multi hat in Afrika eine Vermarktungsinitiative für seine Verhütungsmittel gestartet. Dazu ist er eine Partnerschaft mit der US-amerikanischen Entwicklungsbehörde USAID eingegangen, welche die Kosten für Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterial zu den Pillen übernimmt. Die gemeinsame „Contraceptive Security Initiative“ will allen Frauen „mit mittlerem Einkommen in vorerst elf subsaharischen Entwicklungsländern Zugang zu bezahlbaren oralen Kontrazeptiva“ verschaffen. Um die Armen geht es also nicht; und um besonders arme Länder auch nicht. Äthiopien hat BAYER als Ausgangspunkt der Kampagne gewählt, weil die Märkte des Landes relativ gut entwickelt sind und eine hohe Nachfrage nach YASMIN & Co. besteht. „Einen neuen strategischen Ansatz und einen innovativen Weg zur Erschließung der Märkte in Entwicklungsländern“ nennt der Pharma-Riese das Ganze.
Freude über hohe Agrar-Preise
Die durch Finanzmarkt-Spekulationen zusätzlich hochgetriebenen Agrar-Preise bedrohen die Ernährungslage der Menschen in der „Dritten Welt“. Der Leverkusener Multi hingegen freut sich über die Entwicklung, denn die Mehreinnahmen der großen landwirtschaftlichen Betriebe führen zu einem gesteigerten Saatgut- und Pestizidabsatz. „All das deutet auf einen recht positiven Branchenausblick für den Rest des Jahres hin“, sagte BAYER-CROPSCIENCE-Chefin Sandra Peterson deshalb im September 2011.
Unnütze BAYER-Pillen in Indien
Die BUKO-PHARMA-KAMPAGNE hat die Geschäftspolitik BAYERs und anderer Pillen-Multis in Indien untersucht und kam zu einem wenig schmeichelhaften Ergebnis. So bewertete die Initiative von den 39 Präparaten, die der Leverkusener Multi dort in 77 Dosierungs- und Formulierungsarten vertreibt, nur neun als unentbehrlich. 40 sah sie als rational und 28 als irrational an. Aber selbst bei den unentbehrlichen Medikamenten wie RESOCHIN mit dem Wirkstoff Chloroquin hapert es, denn als Malaria-Theapeutikum taugt es wegen vermehrt auftretender Resistenzen nur noch bedingt. Und bei den als rational eingestuften Arzneien bemängelt der BUKO den oft viel zu hohen Preis. Die Liste der irrationalen Pharmazeutika führt mit dem Kontrazeptivum DIANE 35 ein Produkt an, das in der Bundesrepublik seit 1994 keine Zulassung mehr hat, weil es in Verdacht steht, Krebs auszulösen. Wegen der Nebenwirkung „Thrombose“ folgt das Verhütungsmittel YASMIN. Das Diabetikum GLUCOBAY und der Blutdrucksenker XIRTAM finden sich wegen Zweifeln an ihrer Wirksamkeit in dieser Kategorie wieder. Die Vitamin-Trunks wie BAYERS TONIC, EDINOL oder SUPRADYN hält der BUKO hingegen nicht nur für völlig nutzlos, sondern auch für gefährlich, denn sie enthalten teilweise Alkohol und belasten darüber hinaus das ohnehin zumeist schmale Budget der Familien unnötig. Zu allem Überfluss greift BAYER bei der Reklame für diese heikle Produkt-Palette dann auch noch zu dubiosen Praktiken. Besonders kritisiert die Pharma-Kampagne die aggressive YASMIN-Vermarktung in indischen Privatkrankenhäusern und die Kontrazeptiva-Schleichwerbung im Internet.
KONZERN & VERGANGENHEIT
Im Verbund mit Autokraten
In welchem Maße die von BAYER mitgegründeten IG FARBEN den Faschismus unterstützt haben, ist allgemein bekannt. Aber auch noch nach 1945 hielt es der Leverkusener Multi mit autoritären Regimes. So vollzog er in Südafrika bereitwillig die Apartheid mit und richtete in seinen Niederlassungen getrennte Kantinen und Toiletten für Weiße und Schwarze ein. Und 1978 klagte ein brasilianischer Gewerkschaftler über die Kollaboration von BAYER & Co. mit dem Militär-Regime: „Aus der Bundesrepublik Deutschland sind da insbesondere VW, DAIMLER-BENZ, MANNESMANN, KRUPP, BAYER, HOECHST, SIEMENS, BASF, VOIGT u. a. zu nennen. Man könnte die Liste beliebig fortsetzen, zu der etwa 50 große westdeutsche Konzerne gehören, die in Brasilien die Privilegien genießen, die ihnen die Militärdiktatur einräumt.“ In Peru verstand sich der Konzern ebenfalls prächtig mit den Generälen, weil diese den Beschäftigten keinerlei Rechte zubilligten. 1977 schrieb deshalb die Gewerkschaft von BAYER INDUSTRIAL S.A. an ihre KollegInnen in der Bundesrepublik einen langen Brief. „Die geheiligten Rechte der Arbeiter werden von den Unternehmern verletzt, d. h. der 8-Stunden-Tag, das Streikrecht, die Vorlage von Lohnforderungen, das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht, Vollversammlungen durchzuführen und uns politisch zu organisieren. Wir bitten Sie, diese unsere Situation in Ihren Veröffentlichungen zu berücksichtigen und Ihren Protest zu erheben gegen diese Angriffe auf die Arbeiterschaft, gegen die Verfolgung von Sozialkämpfern und Gewerkschaftsführern, die verhaftet wurden und noch im Gefängnis sitzen, die deportiert wurden oder einfach verschwunden sind“, hieß es in dem Schreiben.
Die CUTTER-Impfkatastophe
1955 kam es in den USA zu einem folgenschweren Ereignis. Ein Impfstoff der BAYER-Tochter CUTTER gegen Kinderlähmung löste ebendiese aus, da er einen nicht sachgemäß deaktivierten Erreger enthielt. Neun Menschen starben, über 40.000 entwickelten Polio-Symptome. Als „CUTTER-incident“ ging der Fall in die Geschichtsbücher ein. Ein andere Version des Vakzins forderte in der Bundesrepublik zwei Todesopfer; 48 Menschen infizierten sich.
IG FARBEN & HEUTE
Börse ohne IG FARBEN
Auch nach 1945 bestand die IG FARBEN weiter. Der Zustand „in Auflösung“ hielt jahrzehntelang an. Immer wieder fand sich eine Gelegenheit, um alte Ansprüche wahren oder - etwa nach der Wiedervereinigung - neue formulieren zu können. In den 1990er Jahren hielten sich windige Investoren wie der CDU-Großspender Karl Ehlerding zudem gütlich am noch verbliebenen Grundkapital. Immer wieder vergeblich hatte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN gefordert, die IG FARBEN zu liquidieren und ihr Vermögen an die ZwangsarbeiterInnen auszuzahlen. Das langsame Sterben des Unternehmens läutete jedoch erst die finanzielle Schieflage der Beteiligungsgesellschaft WCM ein, die den von BAYER mitgegründeten Mörderkonzern zwang, Insolvenz zu beantragen. Und nun steht das entsprechende Verfahren vor dem Abschluss, weshalb die Insolvenz-Verwalterin Angelika Wimmer-Amend ein Ende der Börsen-Zulassung der IG FARBEN beantragte.
POLITIK & EINFLUSS
BAYER bespitzelt die CBG
Der Leverkusener Multi lässt die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) bespitzeln. Er beauftragte das Kölner Unternehmen UNICEPTA - nach eigener Aussage die „Nr. 1 in Medienbeobachtung, Issue-Management und Pressearbeit“ - damit, Materialien über die CBG zu sammeln. Beschäftigte mussten sich in den Email-Verteiler der Coordination eintragen und Informationen anfordern. Darüber hinaus wertete die Online-Analyse-Abteilung die Web-Aktivitäten der CBG aus.
Staatssekretär bei „invite“-Einweihung
Helmut Dockter, Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Forschungsministerium, wohnte der Eröffnung des Forschungszentrums „invite“ bei, das BAYER gemeinsam mit der Universität Dortmund betreibt. Die zu 70 Prozent aus Mitteln des Konjunkturpakets II finanzierte, 6,5 Millionen Euro teure Einrichtung soll Dockter zufolge helfen, den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu profitablen Produkten zu beschleunigen und so den trotz Konjunktur-Einbruch stabilen bundesdeutschen Industrie-Sektor weiter stärken. „Die Landesregierung will, dass diese Krisenfestigkeit erhalten bleibt“, so der Staatssekretär. Zu den Projekten von „invite“ zählt etwa die Entwicklung einer Produktionsstätte in modularer Form, deren einzelne Komponenten unabhängig voneinander ausgetauscht werden können. Sieben Chemie-Firmen gehören dabei zu den Kooperationspartnern, zahlen tut allerdings die EU. 30 Millionen Euro Fördergelder steuert sie bei.
Voigtsberger bei BAYER
Wo einst nur das BAYER-Werk seinen Sitz hatte, da befinden sich heute Niederlassungen von 38 Unternehmen. Und immer noch ist Platz im Leverkusener Chemie-„Park“ - zuviel Platz. Die Anwerbe-Politik des Konzerns verläuft nämlich nicht allzu erfolgreich, da sich die gesamte Chemie-Branche ähnlich wie der Multi „gesundschrumpft“. Er musste sogar schon mit Floristik-Studios als Mietern vorlieb nehmen. Da diese Klientel andere Bedürfnisse hat, veranstaltete der Global Player vor ein paar Jahren sogar einen Architektur-Wettbewerb zur Umgestaltung des Geländes (SWB 4/07). Jetzt hat sich das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium der Problematik angenommen, die sich an den anderen Standorten des Konzerns ähnlich darstellt. Es veranstaltete eine Konferenz zur Zukunft der Chemie-„Parks“. Diese fand Mitte November 2011 passender weise auch gleich am BAYER-Stammsitz statt. Der zuständige Minister Harry Voigtsberger (SPD) sprach dem Global Player in seiner Eröffnungsrede gleich Mut zu. „Chemie-Parks haben sich bewährt. Sie werden auch weiterhin ein Zukunftsmodell sein, wenn sie sich den aktuellen Herausforderungen wie Energie-Effizienz sowie nachhaltige Entwicklung stellen“, befand er.
BAYER sponsert Regierung
Auch im jüngsten Sponsoringbericht der CDU/FDP-Koalition ist BAYER wieder prominent vertreten. Mit insgesamt rund 65.000 Euro griff der Konzern den jeweiligen Bundesregierungen von Januar 2009 bis Dezember 2010 unter die Arme. Er sponserte unter anderem Weihnachtskonzerte, Empfänge zum Tag der deutschen Einheit und einen Saatgut-Kongress. Auch die Landesregierungen „unterstützt“ der Leverkusener Multi. So erhielt die „Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen beim Bund“ 8.000 Euro Zuschuss zum „Fest des Westens 2010“.
Dekkers VCI-Vize
Traditionell nehmen BAYER-Chefs Spitzenpositionen beim „Verband der Chemischen Industrie“ ein. Da macht auch der jetzige Vorstandsvorsitzende keine Ausnahme: Marijn Dekkers gehört neuerdings gemeinsam mit seinen Kollegen von MERCK und BASF zum Triumvirat der Vize-Präsidenten.
Dekkers im BDI-Präsidium
Der „Bundesverband der Deutschen Industrie“ (BDI) hat BAYER-Chef Marijn Dekkers in seinen erweiterten Präsidiumskreis gewählt.
Gutes China, schlechtes Deutschland
BAYER-Chef Marijn Dekkers nutzte die Einweihung eines neuen Kunststoffwerkes in Shanghai, um die chinesische Führung zu loben und Kritik am Investitionsklima in der Bundesrepublik zu üben. „Insgesamt hat es die chinesische Regierung bisher immer verstanden, das Wachstum zu managen“, sagte der Vorstandsvorsitzende. Die Bundesrepublik hingegen nutze ihr wirtschaftliches Potenzial nicht, da es Usus sei, „nur noch auf die Vermeidung kleinster Risiken zu pochen“, wie Dekkers im Hinblick auf die umstrittene Kohlenmonoxid-Pipeline formulierte (siehe auch IMPERIUM & WELTMARKT).
Obama stoppt CO2-Vorstoß der EPA
Die US-amerikanische Umweltbehörde EPA wollte ab 2013 schärfere Kohlendioxid-Grenzwerte erlassen. Das aber verhinderte Barack Obama nach politischem Druck von Seiten der Konzerne. Vorher war es BAYER & Co. mit Verweis auf die schlechte Wirtschaftslage bereits gelungen, den Präsidenten von der Einführung eines Handels mit CO2-Verschmutzungsrechten und sowie von dem Ziel einer ehrgeizigen Emissionsreduktion abzubringen (siehe Ticker 1/10).
BAYER & Co. für Beitragssenkungen
BAYER & Co. fordern eine Senkung der Rentenversicherungsbeiträge. Die „Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände“ tritt für eine stufenweise Reduzierung von 19,9 auf 19,1 Prozent ein. Das brächte der Wirtschaft eine Ersparnis von rund vier Milliarden Euro.
Keine Netzgebühren für BAYER & Co.
Das neue Energiewende-Gesetz befreit BAYER und andere energie-intensive Unternehmen rückwirkend ab Januar 2011 von den Netzgebühren. Es gehe darum, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu fördern und gleichzeitig Industrieland zu bleiben, so begründet Umweltminister Norbert Röttgen (CDU) laut stern die Subventionsmaßnahme. Zu zahlen haben das die Privathaushalte. Auf sie kommt nach einer Schätzung des „Bundes der Energieverbraucher“ eine Mehrbelastung von jährlich ca. einer Milliarde Euro zu. „Die Industrie massiv zu entlasten und allein die Kleinverbraucher die Zeche zahlen zu lassen, ist eine Dreistigkeit, die bisher ohne Beispiel ist“, protestiert deshalb Holger Krawinkel von der Verbraucherzentrale. Bleibt nur, auf ein Eingreifen der EU zu hoffen. Aber selbst dafür haben die Multis schon vorgesorgt. Sie fordern eine Ausgleichszahlung, falls Brüssel gegen die Ausnahmeregelung vorgehen sollte.
PROPAGANDA & MEDIEN
Die Dekkers-Inthronisierung
In der Fachzeitschrift prmagazin hat BAYERs Kommunikationschef Michael Schade aus dem Nähkästchen geplaudert. Er legte dar, wie umfassend die PR-Abteilung die Presse-Berichte über den neuen Konzern-Leiter Marijn Dekkers gelenkt hat. Als das Unternehmen die Nominierung bekannt gab und erste Artikel auftauchten, die das wenig schmeichelhafte Bild eines rücksichtslosen Sanierers zeichneten, ergriffen Schade & Co. sogleich Maßnahmen und diktierten 40 JournalistInnen eine nettere Story in den Schreibblock. Wenig später stellten sie den Schreiberlingen ihren Schützling bei einem Abendessen exklusiv vor. Das zweite Diner folgte dann kurz vor dem wirklichen Amtswechsel. Dekkers bekam dort die Gelegenheit, die ihm in den Mund gelegten Phrasen „Mehr Innovation, weniger Administration“ und „Evolution statt Revolution“ zu platzieren, die anschließend auch eine weite Verbreitung gefunden haben. Und momentan arbeitet Schade daran, seinem Chef trotz der verkündeten Vernichtung von 4.500 Arbeitsplätzen das Image eines Jobkillers zu nehmen und vermeldet schon erste Erfolge. „Die mediale Platzierung von Herrn Dekkers gelingt immer besser“, sagt er mit Verweis auf ein Interview in der Wirtschaftswoche und einen Beitrag im Handelsblatt. Die Financial Times Deutschland hingegen ließ sich nicht so leicht einspannen. Ihr Journalist Klaus Max Smolka wollte einmal Details über Stellenstreichungen veröffentlichen, die ihm ein BAYER-Beschäftigter zugespielt hatte, und verärgerte damit den Multi nachhaltig. Auch generell „nimmt er wahr, dass der Konzern die Zügel anziehe, um die Berichterstattung zu steuern“, gibt das prmagazin dessen Worte wieder.
Medialer Gen-Gau
Unermüdlich arbeitet EuropaBio daran, die Akzeptanz für die umstrittene Gentechnik zu erhöhen. Und für den Herbst 2011 hatte sich der Lobbyverband von BAYER & Co. einen besonderen Coup ausgedacht: Prominente „Pro-Gentechnik-Botschafter“ sollten für die Risiko-Technologie Reklame machen. Einem internen Papier zufolge hatten sich Bob Geldorf und Kofi Annan bereits „interessiert“ gezeigt. Die Genannten wussten von ihrem Gentech-Glück jedoch noch gar nichts. „Herr Annan ist kein Botschafter für EuropaBio und hat keine Absicht, den Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen zu fördern“, antwortete etwa ein Sprecher des ehemaligen UN-Generalsekretärs der englischen Zeitung The Guardian. Damit ging die PR-Offensive nach hinten los und entwickelte sich für EuropaBio zu einem medialen Gen-GAU.
Medialer Pipeline-GAU
Der Leverkusener Multi blickt neidvoll auf seinen Kölner Nachbarn SHELL. Der Öl-Konzern hatte es geschafft, ein mit der Gefährlichkeit von BAYERs zwischen Dormagen und Krefeld geplanter Kohlenmonoxid-Pipeline vergleichbares Projekt zu realisieren, ohne auf größeren Widerstand aus der Bevölkerung zu stoßen. Darum hat der Pharma-Riese die Leiterin der Abteilung „Corporate Policy and Advocacy“, Denise Rennmann, nebst anderen hochrangigen ManagerInnen zur Fortbildung in die Domstadt geschickt. „Wir haben mitgenommen, dass SHELL da sehr professionell kommuniziert hat“, resümierte BAYER-Sprecher Jochen Klüner. Der Global Player hatte nämlich frühzeitig das Gespräch mit AnwohnerInnen und Naturschutz-Initiativen gesucht, statt wie der Agro-Gigant allein auf Legislative und Judikative zu setzen. Bei ähnlich umstrittenen Vorhaben dürfte BAYER also zukünftig geschickter vorgehen. Darauf müssen sich alle Organisationen einstellen.
BAYERs EU-Lobbying
1,85 Millionen lässt sich der Leverkusener Multi seine Lobby-Aktivitäten bei der EU nach eigenen Angaben jährlich kosten. Was BAYER mit dem Geld so alles veranstaltet, darüber gibt der grüne EU-Abgeordnete Sven Giegold auf seiner Homepage einen kleinen Einblick. Der Parlamentarier dokumentiert dort nämlich sämtliche Annäherungsversuche. Und auf der langen Liste darf der Pharma-Riese natürlich nicht fehlen. So wollte er Giegold eine aus Unternehmenssicht verfasste „Studie“ zu den anstehenden Finanzmarkt-Reformen vorstellen. Der Global Player nutzt nämlich so umstrittene Instrumente wie Derivate - eine Art Wette auf Preissteigerungen oder -senkungen von Rohstoffen, Aktien, Währungen, Zinsen oder aber von Derivaten selber - und hat Angst vor Regulierungen. Zudem befürchtet der Pille-Riese, verschärfte Eigenkapital-Vorschriften für Banken könnten die Kreditvergabe erschweren. Auch die Meinung des Konzerns zum Grünbuch „Angemessene, nachhaltige und sichere europäische Pensions- und Rentensysteme“ sollte sich der Parlamentarier auf BAYERs Wunsch anhören. Und solche Avancen dürfte der Pharma-Riese auch den KollegInnen des Grünen-Politikers immer wieder machen.
EU will Werbeverbot lockern
Unter massivem Lobby-Einsatz versucht BAYER in Tateinheit mit der gesamten Branche seit geraumer Zeit, das EU-weite Werbe-Verbot für Medikamente zu kippen, um unter dem Siegel der „PatientInnen-Information“ mit seinem Milliarden-Etat noch ein wenig mehr Marketing betreiben zu können. Ganz ist ihm das nicht geglückt, denn explizite Reklame erlaubt der Gesetzesvorschlag weiterhin nicht. Dafür legt er den Begriff „Information“ recht weit aus. Darunter fallen beispielsweise auch Patientenschicksale und Krankengeschichten. „Dies wäre eine nachträgliche Legalisierung dessen, was Arzneimittel-Hersteller seit einigen Jahren praktizieren. So existieren z. B. zur Männergesundheit zahlreiche Seiten zum Thema Testosteronmangel oder der so genannten erektilen Dysfunktion, die dann in einem Atemzug auch auf entsprechende Arzneimittel zur Behebung des Mangels verweisen“, kritisiert die BUKO-PHARMAKAMPAGNE mit Verweis auf BAYERs Methoden zur Vermarktung von NEBIDO, TESTOGEL und LEVITRA. Studien, Gutachten und wissenschaftliche Veröffentlichungen gelten ebenfalls nicht als Werbung, weshalb der Pharmakologe Gerd Glaeske schon Böses ahnt. „Es gibt sehr viele Gefälligkeitsgutachten von Wissenschaftlern, die Wünsche der Pharma-Industrie erfüllen“, so der Forscher von der Universität Bremen. Und zu allem Überfluss dürfen MedizinerInnen und ApothekerInnen zudem bald Broschüren der Pillen-Riesen an die PatientInnen verteilen.
BAYER sponsort Weltverhütungstag
„Fünf gegen das Wachstum der Bevölkerung investierte Dollar sind wirksamer als hundert für das Wirtschaftswachstum investierte Dollar“, sagte einst der ehemalige US-Präsident Lyndon B. Johnson über seine Vorstellung von „Entwicklungshilfe“. Zum Behagen des Leverkusener Multis erfreut sich diese Ansicht sogar heute noch großer Beliebtheit, die „gigantischen Fruchtbarkeitsmärkte“ in den armen Ländern versprechen nämlich gute Absatzchancen für die Verhütungsmittel des Konzerns. Um die Geschäftsaussichten für YASMIN & Co. noch ein wenig zu verbessern, sponsert er darum auch 2011 wieder den Weltverhütungstag, der vor allem Jugendliche ansprechen soll.
BAYER sponsert Studierende
Der Leverkusener Multi umwirbt schon Studierende als zukünftige BAYER-KundInnen. So spendiert er beispielsweise StudentInnen der Tiermedizin Sezierbesteck, damit sie später auch schön seine Veterinär-Arzneien verschreiben.
BAYER will Forschungssubventionen
Unermüdlich fordert der Leverkusener Multi Steuererleichterungen für seine Forschungsanstrengungen. „In Europa fehlt dieses Instrument außer in Deutschland nur noch in Schweden, Solwenien, Rumänien und den baltischen Staaten“, klagte BAYERs Forschungsvorstand Wolfgang Plischke. In dem Interview mit dem Magazin GoingPublic drohte er in seiner damaligen Funktion als Vorstandsvorsitzender des vom Pharma-Riesen gegründeten „Verbandes der Forschenden Arzneimittelhersteller“ bei Nichtgewährung dieser Subvention sogleich mit Abwanderung. „Die Unternehmen können dieses Ungleichgewicht bei ihren Standort-Entscheidungen nicht ignorieren“, so Plischke.
200.000 Euro für Selbsthilfegruppen
BAYER sponsert Selbsthilfegruppen und PatientInnen-Organisationen in hohem Maße. Über 200.000 Euro verteilte der Leverkusener Multi 2010 allein an die bundesrepublikanischen Verbände. Aber natürlich nicht an alle. Zuwendungen erhalten hauptsächlich diejenigen, die der Konzern mit entsprechenden Medikamenten beglücken kann: Diabetes-, Krebs-, Bluter- und Multiple-Sklerose-Vereinigungen. Und das ist gut angelegtes Geld: „Wenn Firmen zehn Prozent mehr in Selbsthilfegruppen investieren, wächst ihr Umsatz um ein Prozent im Jahr“, hat der als Gesundheitsökonom an der Universität Bremen lehrende Dr. Gerd Glaeske einmal errechnet. International greift der Pharma-Riese noch tiefer in die Tasche. So bedachte er die Blutergesellschaften rund um den Globus 2010 mit über fünf Millionen Euro. Aber diese PR-Maßnahme ist auch bitter nötig. In den 1990er Jahren starben nämlich Tausende Bluter an HIV-verseuchten Blutprodukten des Pillen-Herstellers, weil er sein Präparat KOGENATE aus Kostengründen keiner sterilisierenden Hitze-Behandlung unterzogen hatte.
45.000 Euro an Krankenhaus
Im letzten Jahr hat der Leverkusener Multi 45.000 Euro an das Klinikum Bremen-Mitte gespendet, ein weiteres Krankenhaus der Stadt erhielt immerhin noch 5.000 Euro. Auch andere Multis zeigten sich großzügig. Die Gesundheitssenatorin Renate Jürgens-Pieper hätte diese Zahlen am liebsten unter Verschluss gehalten, die Veröffentlichung verdankt sich allein der Beharrlichkeit der HUMANISTISCHEN UNION. Für den Pillen-Multi dürfte sich die Investition lohnen. „Ein Pharma-Unternehmen wie BAYER zahlt das nicht aus gutem Willen zur Förderung eines guten Zwecks, die erwarten eine Gegenleistung“, kommentiert der Pharmakologe Peter Schönhöfer das Sponsoring.
45.000 Euro an „Arche“
BAYERs BEPANTHEN-Kinderförderung unterstützt seit längerem das Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“, das dem evangelikalen Verband „Deutsche Evangelische Allianz“ angehört, und investiert damit in das SozialarbeiterInnen-Image des Konzerns. Wie im letzten Jahr honorierte er die Rückgabe einer leeren und den Erwerb einer neuen Packung der BEPANTHEN-Wundsalbe mit einem Euro für „Die Arche“. 45.000 Euro kamen so zusammen. Für die Verbreitung des PR-Coups sorgte als Medienpartner dann das Blatt Frau im Spiegel.
Umweltschutz-Studien bei BAYER
Als „Bluewashing“ kritisieren die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) und andere Initiativen die Strategie der Konzerne, sich durch Kooperationen mit den Vereinten Nationen ein gutes Image zu verschaffen. Der Leverkusener Multi tut dies hauptsächlich durch ein Sponsoring der UNEP, des Umweltprogramms der UN. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit besuchten im Herbst 2011 50 Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika Leverkusen, um ausgerechnet bei BAYER Studien zum Thema „Nachhaltigkeit und Umweltschutz“ zu betreiben.
Pestizid-Entlastungsstudie
BAYER & Co. behagt das schlechte Image ihrer Ackergifte nicht. Deshalb hat ihr „Industrieverband Agrar“ (IVA) bei Professor Harald von Witzke von der Berliner Humboldt-Universität eine Entlastungsstudie bestellt. Und Witzke, der schon häufiger vom Leverkusener Multi und anderen Unternehmen gesponserte Expertisen durchgeführt hatte und auch bereits als Autor des BAYER-Magazins re:source hervortat, lieferte das gewünschte Ergebnis. „Studie belegt Wohlstandsgewinn durch moderne Landwirtschaft“, konnte der IVA vermelden. Die Agrochemikalien schalten Unkraut, Pilze und Schadinsekten aus und bescheren den konventionell arbeitenden LandwirtInnen so eine viel reichere Ernte als den Biobauern und -bäuerinnen, so das Resultat der Forschungsarbeit. Witzke hatte sogar eine Zahl parat: Auf vier Milliarden Euro bezifferte er den Pestizid-Mehrwert. „Diese Studie darf nicht folgenlos bleiben“, forderte IVA-Geschäftsführer Volker Koch-Achelpöhler daraufhin, „... Es wird Zeit, auch jene Risiken klar zu benennen, die durch den Verzicht auf den modernen Pflanzenschutz erwachsen“.
Tag der offenen Tür
Mit dem Image des Leverkusener Multis ist es wegen umstrittener Vorhaben wie der Kohlenmonoxid-Pipeline und anderer Großprojekte nicht zum Besten bestellt. Darum unternimmt er viele Anstrengungen zur Rettung seines Rufes. Eine Gelegenheit dazu bot der „Tag der offenen Tür“, den BAYER und andere Chemie-Konzerne im „Jahr der Chemie“ mit besonders großem Aufwand gestalteten. In Leverkusen schaute sogar der Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers persönlich vorbei, um „Chemie zum Anfassen“ zu präsentieren und Lust auf das „BAYER-Wissenschaftsabenteuerland“ zu wecken. Das größte Abenteuer boten dort Sängerinnen, welche die Forschungsphilosophie des Pharma-Riesen in Lied-Form vortrugen. Ansonsten gab es noch Chemie„park“-Führungen, Austellungen, Labor-Experimente, Hüpfburgen, Kakerlaken-Wettrennen, Flohzirkusse und TiermedizinerInnen-Sprechstunden.
TIERE & VERSUCHE
Mehr Tierversuche
Bei BAYER ist die Zahl der Tierversuche im Geschäftsjahr 2010 gegenüber 2009 von 171.251 auf 171.627 gestiegen. 92 Prozent davon unternahm der Leverkusener Multi mit Ratten und Mäusen, fünf Prozent mit Fischen und Vögeln und 0,6 Prozent mit Hunden, Katzen und Affen. Dazu kommen noch die Experimente, die der Konzern von externen Forschungszentren machen lässt. Sie wuchsen besonders stark an und erhöhten sich von 5.793 auf 19.785. „Der Anstieg ist durch die Tatsache zu erklären, dass wir mit einem Nutztier-Projekt in die finale Entwicklungsphase gekommen sind und gesetzlich geforderte Studien durchgeführt haben“, so das Unternehmen zur Begründung.
DRUGS & PILLS
YASMIN bleibt auf dem Markt
Auch in den USA sehen sich BAYERs Verhütungsmittel aus der YASMIN-Familie wegen ihrer Nebenwirkungen zunehmender Kritik ausgesetzt. Neuere Studien weisen ein bis um den Faktor 3,3 erhöhtes Risiko für Thromboembolien aus. 190 Todesfälle binnen der letzten zehn Jahren listet die US-Gesundheitsbehörde FDA auf. Darum hat sie sich Anfang Dezember mit dem Fall „YASMIN“ befasst. Mit 15 zu 11 Stimmen votierten die von der FDA berufenen ExpertInnen knapp dafür, das Mittel auf dem Markt zu lassen. Die Behörde dürfte den Leverkusener Multi nun lediglich auffordern, auf den Verpackungen dringlicher vor den Gesundheitsgefahren zu warnen. Ähnlich defensiv verfuhr bereits das hiesige „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“.
Erweiterte XARELTO-Indikation
Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das BAYER-Präparat XARELTO, bisher zur Thrombose-Vorbeugung nach schweren orthopädischen OPs im Einsatz, jetzt auch als Mittel zur Schlaganfall-Vorbeugung zugelassen. Sie setzte sich damit über viele, auch interne Bedenken hinweg. Eigene MitarbeiterInnen hatten sich noch Anfang September 2011 gegen die Genehmigung ausgesprochen, weil die von BAYER eingereichten Studien ihrer Meinung nach Fragen zu Herzinfarkt- und Blutungsrisiken aufwarfen. Zudem konnten sie im Vergleich zum bislang gebräuchlichen Wirkstoff Warfarin keinen therapeutischen Zusatznutzen entdecken. Aber die FDA setzte sich über diese Einwände hinweg. Nicht einmal Meldungen über Sterbefälle bei der Klinischen Erprobung des Mittels in Indien (siehe ERSTE & DRITTE WELT) konnten sie umstimmen. Der Institution waren derartige Zwischenfälle bekannt, wie sie der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN mitteilte: „Die Ärzte-Information führt Tod als mögliche Nebenwirkung auf, die während der Klinischen Tests mit XARELTO auftrat“. Bei Zulassungen gelte es immer, zwischen Wirksamkeit und Sicherheit eines Medikamentes abzuwägen, so die Behörde weiter. Dank dieser Abwägung zu Gunsten der Wirksamkeit und zu Lasten der Sicherheit kann der Leverkusener Multi mit einem XARELTO-Umsatz von zwei Milliarden Euro rechnen.
ALPHARADIN-Zulassung beantragt
Krebsmedikamente sind teuer, helfen zumeist wenig und haben allzuoft nur ein eingeschränktes Anwendungsgebiet. So auch das vom Leverkusener Multi gemeinsam mit dem norwegischen Unternehmen ALGETA entwickelte ALPHARADIN, das vermittels radioaktiver Strahlung das Wachstum von Prostatatumor-Zellen hemmen soll. Männern, bei denen eine Hormon-Behandlung erfolglos geblieben ist und sich zudem noch Metastasen im Knochen gebildet haben, verhalf es in einem Klinischen Test zu einem noch nicht einmal drei Monate längeren Leben. Trotzdem will BAYER für das Medikament im nächsten Jahr die Zulassung beantragen.
TRASYLOL-Wiederzulassung in Kanada
Im November 2007 musste BAYER das Medikament TRASYLOL, das MedizinerInnen bei OPs zur Blutstillung einsetzten, wegen der Nebenwirkung „Tod“ vom Markt nehmen. Mehrere Studien hatten die Gefährlichkeit des Medikamentes belegt. So analysierte der Harvard-Professor Alexander Walker die Unterlagen von 78.000 Krankenhaus-PatientInnen und konstatierte im Falle einer Behandlung mit TRASYLOL eine erhöhte Sterblichkeitsrate sowie ein größeres Risiko für Nierenversagen, Schlaganfälle und Herzerkrankungen. „2.653 Patienten mussten zur Dialyse und 2.613 Patienten starben“, hieß es in der Expertise. Trotz dieses Befundes hat Kanada der Arznei zur Versorgung von PatientInnen nach Bypass-Operationen eine Wiederzulassung erteilt. „Nach einer sorgsamen Überprüfung kam Health Canada (die staatliche Gesundheitsbehörde, Anm. Ticker) zu dem Schluss, dass der Nutzen von TRASYLOL die Risiken übersteigt“, hieß es zur Begründung. Zahlreiche MedizinerInnen mochten sich diese Meinung nicht anschließen und protestierten gegen die Entscheidung.
Lieber kein ASPIRIN COMPLEX
In unendlichen Variationen bietet der Leverkusener Multi seinen „Tausendsassa“ ASPIRIN mittlerweile an. So gibt es ASPIRIN COMPLEX zur Behandlung von Erkältungssymptomen seit Kurzem auch zum Anrühren mit heißem Wasser. Die unabhängige Fachzeitschrift arznei-telegramm rät von dem Mittel mit der Wirkstoff-Kombination Acetylsalicylsäure und Pseudoephedrin allerdings ab. Vor allem am Nutzen des Amphetamin-Abkömmlings Pseudoephedrin zweifelt das Magazin, weil es gegen eine verstopfte Nase nicht so gut wirkt wie andere Wirkstoffe und zudem noch mehr Nebenwirkungen hat. Als solche zählt die Zeitschrift Angstzustände, Schlaflosigkeit, Halluzinationen, Herzrasen und steigender Blutdruck auf. Sogar ein Herzinfarkt ist der Publikation zufolge belegt.
Keine Packungsbeschränkung für ASPIRIN
Immer mehr Menschen nehmen ASPIRIN ein, was vor allem der BAYER-Werbung geschuldet ist. Dem Konzern gelingt es mit seinen Kampagnen, das Präparat nicht mehr nur als Schmerztablette, sondern auch als Mittel zur Herzinfarkt-Prophylaxe zu vermarkten. Aber mit den Umsätzen (aktuell 776 Millionen Euro), steigen auch die Zwischenfälle. Dr. Friedrich Hagenmüller von der Hamburger Asklepios-Klinik schätzt die Zahl der Todesopfer durch die ASPIRIN-Nebenwirkung „Magenbluten“ allein in der Bundesrepublik auf 1.000 bis 5.000. Da er zudem den Nutzen des „Tausendsassas“ bei der Schmerzbehandlung anzweifelt, setzt er sich für eine Handelsbeschränkung ein. Die forderte das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) ebenfalls. Es trat dafür ein, die rezeptfrei abgegebenen Packungen von ASPIRIN und ähnlichen Produkten so zu verkleinern, dass sie nur noch für vier Tage reichen. Danach sollten die PatientInnen die Medikamente bloß noch auf Rezept bekommen. Dieser Vorschlag konnte vor dem auch mit Pharma-VertreterInnen besetzten „Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht“ allerdings nicht bestehen.
Doping mit ASPIRIN
ASPIRIN erfreut sich auch im Sport-Bereich zunehmender Beliebtheit. Besonders vor strapaziösen Marathonläufe greifen die TeilnehmerInnen gerne zu dem Tausendsassa oder zu anderen Schmerzmitteln. Nach einer Untersuchung des Pharmakologen Dr. Kay Brune nahmen beim Bonn-Marathon 2009 fast zwei Drittel der LäuferInnen ASPIRIN oder ähnliche Präparate ein. Unter der sportlichen Belastung steigt die Gefahr noch einmal stark an, dass die Nebenwirkungen durchschlagen, denn der Körper versorgt während dieser Zeit die für die Entgiftung zuständigen Nieren und den Magen/Darm-Trakt weniger mit Blut als üblicherweise. Die Folge: Nierenschäden und Magengeschwüre. „Manche Sportler müssen sogar unmittelbar nach der sportlichen Höchstleistung operiert werden und verlieren Teile ihrer inneren Organe“, so Brune.
LEGANTO neu auf dem Markt
BAYER bringt das bisher unter dem Namen NEUPRO bekannte Pflaster unter der Bezeichnung LEGANTO neu heraus. Eine entsprechende Kooperation mit dem NEUPRO-Hersteller UCB gab der Leverkusener Multi im Sommer 2011 bekannt. Das mit dem dopamin-ähnlich wirkenden Rotigotin versehene Pflaster ist zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms und zur Therapie von Parkinson im Frühstadium zugelassen. In einem späterem Stadium der Krankheit dürfen es die MedizinerInnen nur gemeinsam mit einem anderen Medikament verwenden. In Tests zeigte sich das Mittel bei dieser Indikation der Substanz Ropinirol unterlegen. Die „European Medicines Agency“ ließ das Medikament, zu dessen Nebenwirkungen Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerz und Übelkeit zählen, aber trotzdem zu.
VFA beklagt sinkende Pillen-Preise
Das 2010 erlassene „Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittel-Marktes“ hat die Pillen-Preise bis zum Jahr 2013 auf dem Stand von August 2009 eingefroren und den Hersteller-Rabatt für neue Medikamente von sechs auf 16 Prozent erhöht. Das hat nach Berechnungen des „Verbandes der Forschenden Arzneimittelhersteller“ (VFA), den BAYER gegründet hat, die Arzneien im Durchschnitt um drei Prozent billiger gemacht, was zu entsprechenden Mindereinnahmen bei den Pharma-Multis geführt hat. Allein das neue Rabatt-Reglement kostet die Konzerne 1,5 Milliarden Euro.
Personalisierte Medizin floppt
Die personalisierte Medizin, also die Entwicklung einer passgenauen, auf die jeweiligen Bedürfnisse der PatientInnen ausgerichteten Therapie-Form, erfüllt die in sie gesteckten Erwartungen nicht. „Die Sache ist komplizierter als gedacht“, räumt BAYERs Pharma-Forscher Jörg Müller ein. Besonders bei Herz/Kreislauf-Erkrankungen hapert es noch. „Kardiologische Erkrankungen sind auf molekularer Ebene viel weniger erforscht, als das bei Krebs-Indikationen der Fall ist“, stellt sein Kollege Helmut Haning fest. Zudem ist „Personalisierte Medizin“ oftmals nur ein Euphemismus für ein dem Großteil der PatientInnen nicht zumutbares Medikament. Wenn eine Arznei in einem Klinischen Test bei der Mehrheit der ProbandInnen keine positiven Effekte zeitigt, picken sich die Pharma-Multis die Minderheit heraus und deklarieren die Pille als maßgeschneidert für ebendiese Gruppe. Das hat auch der Leverkusener Multi vor. Da sein Pharmazeutikum XARELTO bei der Indikation „Thrombose“ in Tests nicht besser als die bisherige Standardmedikation abschnitt, will er sich nun diejenigen TeilnehmerInnen herausfiltern, bei denen es doch anschlug, um wenigstens ein personalisiertes XARELTO für dieses Anwendungsgebiet herausbringen zu können.
Neuer Anlauf für Positivliste?
Viele GesundheitsministerInnen haben sich schon bemüht, die unübersehbare Menge der auf dem Markt befindlichen Arzneimittel durch eine Positivliste zu beschränken. Allesamt scheiterten sie jedoch am Widerstand von BAYER & Co. Jetzt unternehmen CDU und FDP einen neuen Anlauf. Die Parteien wollen parallel zum LandärztInnen-Gesetz einen Modellversuch starten, der die MedizinerInnen auf die Verordnung bestimmter, in einem Katalog festgehaltener Arzneien verpflichtet. Warnungen vor einer „standardisierten Kochbuch-Medizin“ ließen da nicht lange auf sich warten, und allen bisherigen Erfahrungen nach zu urteilen, dürfte das Projekt keine großen Chancen haben.
PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE
Endosulfan-Verbot beschlossen
Jahrelang hatte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) den Leverkusener Multi aufgefordert, den in der Bundesrepublik schon längst verbotenen, besonders gefährlichen Pestizid-Wirkstoff Endosulfan in anderen Ländern ebenfalls nicht mehr zu vertreiben. Im vorletzten Jahr erklärte sich der Konzern endlich dazu bereit (SWB 3/09), nicht ohne jedoch noch einmal einen aggressiven Schlussverkauf zu veranstalten (siehe auch SWB 1/11). Und jetzt darf der Multi auch gar nicht mehr anders: Die 133 der „Stockholmer Konvention“ angeschlossenen Staaten haben sich zu einem weltweiten Bann entschlossen. Allerdings gestalteten sich die Verhandlungen schwierig, und Indien, China und Uganda stimmten der Einigung nur gegen die Gewährung von Ausnahmegenehmigungen zu. Ganz verschwindet das Ultragift damit also nicht.
PFLANZEN & SAATEN
Zugriff auf Hybridreis-Zucht
Ende September 2011 erwarb BAYER Zugriffsrechte auf das Hybridreis-Zuchtprogramm der brasilianischen Firma FAZENDA ANA PAULA. Bei Hybrid-Reis handelt es sich um solche Pflanzen, welche die LandwirtInnen nicht wiederaussäen können, was die Abhängigkeit von den Konzernen steigert (siehe auch SWB 1/10). Darum engagiert sich der Leverkusener Multi auch stark auf diesem Gebiet. Er hat in Ländern wie Indonesien, Brasilien, Burma, China, Thailand, den Philippinen und Vietnam Kooperationen mit den Regierungen vereinbart hat, um ARIZE und andere Sorten durchzusetzen. Bauern und Bäuerinnen haben mit ihnen denkbar schlechte Erfahrungen gemacht. So klagen etwa indonesische FarmerInnen über ARIZE, weil er hohe Produktionskosten verursacht, schlecht schmeckt und anfälliger gegenüber Schadinsekten ist. Da der Agro-Riese das Produkt zudem auf die industrielle Landwirtschaft zugeschnitten hat, warnt die Initiative ALLIANCE OF AGRARIAN REFORM MOVEMENT im Land bereits vor einem Bauernsterben durch ARIZE & Co.
Mehr Bioscience
BAYER entwickelt pro Jahr mehr als 100 neue Pflanzen- und Gemüsesorten. Und es sollen noch mehr werden. Der Konzern kündigte nämlich an, seine Forschungsausgaben in der Sparte „Bioscience“ bis 2015 auf 400 Millionen Euro zu verdoppeln. Und neben neuen Gentech-Arten (siehe GENE & KLONE) will der Agro-Multi mit diesem Geld auch mehr Saatgut und auf konventionellem Wege veränderte Ackerfrüchte entwickeln.
Weizen-Kooperation mit Uni
Der Leverkusener Multi hat mit der US-amerikanischen „South Dakota State University“ eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet „Weizen-Saatgut“ vereinbart. Nach dem Vertrag gewähren sich die Partner gegenseitig den Zugriff auf ihr Zuchtmaterial, was dem Konzern die Möglichkeit eröffnet, neue Sorten zu entwickeln. Das gewachsene Interesse des Global Players an der weltweit am häufigsten angebauten Kulturpflanze belegen auch neuere Kooperationen mit dem französischen Unternehmen RAGT, der australischen Forschungseinrichtung „Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation“ (CSIRO), mit dem israelischen Biotech-Betrieb EVOGENE und der Universität von Nebraska sowie der Erwerb zweier Zuchtprogramme von ukrainischen Gesellschaften. Der erste Weizen made by BAYER ist für das Jahr 2015 angekündigt.
Weizenzucht-Zentrum in Gatersleben
BAYER errichtet im Biotech„park“ Gatersleben ein Europäisches Weizenzucht-Zentrum und verstärkt damit sein Engagement auf diesem Gebiet (s.o.) weiter. Auf dem Gelände, auf dem sich auch das „Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzen-Forschung“ befindet, hat der Multi Großes im Sinn. „Unser Team im Europäischen Weizenzucht-Zentrum wird erstklassige, an europäische Bedingungen angepasste Sorten entwickeln. Mit diesen Sorten und unserem führenden Portfolio an Pflanzenschutz-Produkten werden wir in Zukunft Lösungen für eine nachhaltige Getreide-Produktion von der Aussaat bis zur Ernte anbieten können“, erklärte der Agro-Riese. Ähnliche Zentren wie das in Gatersleben plant er in den USA, in Australien, Asien und Lateinamerika. Und um auch den ganzen Nutzen aus der Wertschöpfungskette „Weizen“ ziehen und die LandwirtInnen in eine größere Abhängigkeit treiben zu können, fordert der Global Player auch für nicht per Gentechnik entwickelte Ackerfrüchte eine Patent-Regelung ein (siehe Ticker 4/11).
GENE & KLONE
BAYER testet Krebsmittel
Das Biotech-Unternehmen MORPHOSYS hat einen Antikörper zur Tumor-Behandlung entdeckt und will ihn gemeinsam mit BAYER bis zur Produktreife entwickeln. Die Klinischen Tests der Phase I haben im Herbst 2011 begonnen. Die bisherigen Erfahrungen machen allerdings skeptisch. Bislang ist es dem Leverkusener Multi noch nie gelungen, ein Krebspräparat auf den Markt zu bringen, welches das Leben der PatientInnen mehr als drei Monate verlängert.
BAYER-Gensoja nicht zugelassen
Ein ExpertInnen-Gremium der EU konnte sich nicht über die Zulassung von BAYERs Gensoja der BASTA-Produktreihe einigen. Deshalb muss sich jetzt eine höhere Instanz mit dem Fall beschäftigen. Die COORDINATON GEGEN BAYER-GEFAHREN tritt schon seit längerem für ein Importverbot ein. Die Pflanze ist nämlich durch eine auf gentechnischem Wege eingebaute Resistenz auf den Gebrauch des hochgefährlichen Herbizides Glufosinat abgestimmt, dessen Gebrauch die Europäische Union ab 2017 verboten hat.
Mehr Gentech-Forschung
BAYER will die Forschungsausgaben im Bereich „Bioscience“ bis zum Jahr 2015 auf 400 Millionen Euro verdoppeln. Da sich die Hälfte der Projekte in dieser Sparte mit der „grünen Gentechnik“ befasst, dürfte deshalb in Zukunft mit mehr Laborfrüchten made by BAYER zu rechnen sein.
Neues Gentech-Verfahren
Durch die Nutzung einer Technologie, die das US-Unternehmen PRECISION BIOSCIENCE entwickelt hat, ist es BAYER-ForscherInnen gelungen, eine neue Erbanlage in eine bereits gen-veränderte Pflanze einzubauen. „Durch die zielgenaue Integration vorteilhafter Pflanzen-Eigenschaften lässt sich die Produktentwicklung vereinfachen und die Zeit bis zur Marktreife verkürzen“, jubiliert der Konzern.
WASSER, BODEN & LUFT
„Map Ta Phut“-Gesetz scheitert vorerst
Im thailändischen Map Ta Phut liegt eine der größten Industriezonen der Welt. Sie sollte noch größer werden, aber den AnwohnerInnen reichten schon die bisherigen Umweltbelastungen. Sie klagten, und 2009 gab ein Gericht ihnen Recht. Es stoppte 76 Bauvorhaben, darunter zwei des Leverkusener Multis, der seine Bisphenol- und seine Polycarbonat-Produktion erweitern wollte (SWB 1/11). Inzwischen ist das Moratorium wieder aufgehoben. Die Regionalregierung versprach jedoch einen besseren Gesundheitsschutz. Eine unabhängige Kommission erarbeitete dann auch einen Gesetzesvorschlag. Der allerdings fand im September 2011 nicht die Gnade der Politik. Sie gab eine Überarbeitung in Auftrag, was die Initiative EASTERN PEOPLES NETWORK zu herber Kritik veranlasste.
Kooperation mit der Müll-Mafia
BAYER und andere bundesdeutsche Unternehmen haben in den 1960er bis 1980er Jahren die Dienste der Mafia in Anspruch genommen, um ihren Giftmüll zu entsorgen. Die Abfälle landeten zunächst in Afrika. Als es dort zu Protesten kam, versenkte die kriminelle Vereinigung die Produktionsreste mitsamt Schiffen einfach auf hoher See. Ca. 30 von ihnen schlummern heute noch auf dem Meeresgrund. „Es war ein weitverzweigtes Netzwerk. Ein internationales Netzwerk, bestehend aus Drecksarbeitern und Saubermännern, bis in höchste politische Ebenen vernetzt, mit Ausläufern auf dem ganzen Erdball“, sagt der Journalist Sandro Mattioli, der gemeinsam mit seinem Kollegen Andrea Palladino über diesen Fall das Buch „Die Müllmafia“ geschrieben hat. Ernsthafte Bemühungen, diesen Skandal aufzudecken, gab es nur in den 1990er Jahren - und der damalige Hauptermittler Natale de Grazia bezahlte das mit seinem Leben.
Dormagen: Aus für Müllkraftwerk
Der Leverkusener Multi hat Planungen für ein Müllkraftwerk in Dormagen aufgegeben, da das zu erwartende Abfall-Volumen nicht ausreicht, um es rentabel betreiben zu können. Auch in Brunsbüttel stocken die Vorbereitungen für einen solchen Ofen, der mehr Schadstoffe produziert als herkömmliche Rückstandsverbrennungsanlagen, weshalb die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN die Bau-Bestrebungen bereits seit längerem kritisiert (siehe SWB 1/08).
BAYER initiiert „CleantechNRW“
Unter Nachhaltigkeit versteht der Leverkusener Multi vor allem Ressourcen-Effizienz. Aber die Umwelt profitiert im Gegensatz zum Unternehmensetat nicht unbedingt von einem sparsamen Umgang mit den Rohstoffen. So lobt sich der Konzern zwar immer wieder selbst dafür, den Energie-Einsatz pro Produktionseinheit heruntergefahren zu haben, schweigt aber lieber über den trotzdem in absoluten Zahlen gestiegenen Kohlendioxid-Ausstoß. Da wundert es nicht, dass sich der auf BAYERs Initiative hin entstandene Verbund „CleantechNRW“ auch diesem Paradigma verschrieben hat. „Ich bin überzeugt, dass CleanTechNRW einen hervorragenden Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Standorts NRW leisten kann. Auch, weil es sich mutig und klar zu bestimmten Zukunftsthemen bekennt - wie dem Klimawandel und der Ressourcen-Effizienz“, sagt etwa BAYER-Chef Marijn Dekkers. Neben solchen Projekten will sich das Cluster vor allem der Entwicklung von Batterien für Elektroautos und der Gewinnung von Wasserstoff und Methan aus gasförmigen Abfallstoffen widmen.
BAYER sieht Energiewende skeptisch
Der Leverkusener Multi vermag dem Ausstieg aus der Atomkraft nichts Positives abgewinnen, weil er höhere Energiekosten befürchtet. Auf die Frage des Magazins Process: „Könnte die Energiewende im Hinblick auf eine energie-effiziente Produktion zum Antrieb werden?“ antwortete BAYER-Chef Marijn Dekkers: „Daran glaube ich nicht. Wäre es so, müssten sich alle Mitbewerber um deutsche Standorte reißen, um in den Genuss dieser Antriebskräfte zu kommen.“
Plan B zum Gaskraftwerk
Nach massiven Protesten musste TRIANEL darauf verzichten, auf dem Gelände von BAYERs Chemie„park“ in Krefeld ein klima-schädigendes Kohlekraftwerk zu errichten. Nun plant BAYER gemeinsam mit TRIANEL ein Gas- und Dampfkraftwerk. Aber so ganz in trockenen Tüchern ist das Vorhaben noch nicht. „Ob dieses Projekt wirtschaftlich umsetzbar ist, wird sich im Laufe der Projekt-Entwicklung zeigen“, heißt es von Seiten des Leverkusener Multis. Darum hält er sich auch die Alternative einer „Eigenlösung“ offen und hat bei der Bezirksregierung einen Genehmigungsantrag zum Bau einer gas-betriebenen Kessel-Anlage gestellt.
Emissionshandel ohne Effekt
Vor einigen Jahren hat die EU den Emissionshandel mit Kohlendioxid-Verschmutzungsrechten eingeführt. Er sieht vor, BAYER & Co. CO2-Emissionen nur in einem bestimmten Volumen zu gestatten. Alles, was über ein bestimmtes Limit hinausgeht, sollte den Konzernen teuer zu stehen kommen. Aber die disziplinarische Wirkung dieser Maßnahme hält sich in Grenzen. Die Unternehmen erhalten nämlich immer noch viel zu viel Gratis-Lizenzen zur Klimaschädigung. 1,97 Milliarden Tonnen Kohlendioxid dürfen sie 2013 ungestraft ausstoßen, nur geringfügig weniger als momentan (2,08 Milliarden Tonnen). So kann der Leverkusener Multi munter seinen CO2-Ausstoß steigern (aktuell 8,5 Millionen Tonnen), „ohne in größerem Umfang Zertifikate zukaufen zu müssen“, wie es im Nachhaltigkeitsbericht heißt.
GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV
BAYER drittgrößter Chlorproduzent
Chlor-Verbindungen gehören zu den gesundheitsschädlichsten und umweltbelastendsten Substanzen überhaupt. Trotzdem unternimmt BAYER kaum Anstrengungen, das Gas als Grundstoff für Chemie-Produkte wie etwa Polyurethan zu ersetzen. So stellen in Europa nur noch DOW CHEMICAL und SOLVAY mehr Chlor her als der Leverkusener Multi. Auf eine Jahres-Kapazitä