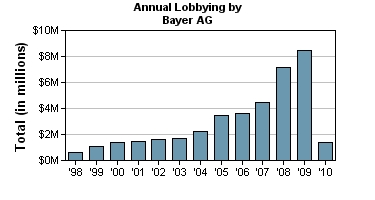Presse Information vom 2. Juni 2010
Coordination gegen BAYER-Gefahren
„Klimakiller“: Einwendung gegen Kohlekraftwerk Krefeld eingereicht
hoher CO2- und Schadstoff-Ausstoß in der Kritik / Einwendungen bis 28. Juni möglich
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) hat heute bei der Bezirksregierung Düsseldorf eine Einwendung gegen das geplante Steinkohlekraftwerk im Krefelder BAYER-Werk einge-reicht. Der Verein kritisiert insbesondere den hohen Ausstoß von Treibhausgasen und gesund-heitsschädlichen Stoffen wie Stickoxiden, Feinstaub und Schwermetallen. Vertreter der CBG hatten auch in der BAYER-Hauptversammlung Ende April einen Stopp des Projekts gefordert.
Philipp Mimkes vom CBG-Vorstand: „Viele der rund 1000 Fördermitglieder der Coordination gegen BAYER-Gefahren leben in Krefeld oder Duisburg. Diese sind von den gefährlichen Emis-sionen des geplanten Kraftwerks direkt betroffen. Wir müssen daher alles tun, diese Dreck-schleuder zu verhindern“. Die CBG ruft die Bevölkerung auf, eigene Einwendungen gegen den Genehmigungsantrag einzureichen. Aufgrund der überregionalen Auswirkungen des Kraftwerks sind auch Einwendungen von Einwohnern anderer Regionen möglich. Der BUND und der Nie-derrheinische Umweltschutzverein haben eine website eingerichtet, auf der individuelle Einwen-dungen erstellt werden können.
Wörtlich heißt es in dem heutigen Schreiben der CBG: „Der Weltklimarat IPCC fordert eine drastische Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen. In den Industrieländern ist laut IPCC bis zum Jahr 2050 eine Minderung des CO2-Ausstoßes um 80% bis 95% gegenüber 1990 nötig, um die dramatischsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern. Steinkohle ist jedoch nach der Braunkohle der umweltschädlichste Brennstoff. Das geplante Kohlekraftwerk würde den Kohlendioxid-Ausstoß Krefelds verdoppeln und damit den Klimawandel beschleunigen. Ein Erreichen der Vorgaben des IPCC würde unmöglich.“ Der Betrieb des Kraftwerks würde jähr-lich zu CO2-Emissionen von über 4,3 Millionen Tonnen führen.
Das Kraftwerk soll auf dem Gelände der BAYER AG errichtet werden; betrieben werden soll es von der BAYER-Tochterfirma Currenta. Der Chemie-Konzern will langfristig einen großen Teil der erzeugten Energie abnehmen. Wirksame Klimaschutzmaßnahmen bei BAYER zugunsten von Energieeinsparung und regenerativen Energien würden dadurch über Jahrzehnte hinweg blockiert. Die jährlichen Kohlendioxid-Emissionen des Konzerns liegen incl. der Energie-Zulieferer schon jetzt bei rund 9 Mio Tonnen. Da es sich bei dem geplanten Kraftwerk um ein Grundlastkraftwerk handelt, wäre kein flexibler Einsatz in Kombination mit erneuerbaren Ener-gien möglich.
Jan Pehrke von der CBG ergänzt: „Die Vorbelastung mit Schadstoffen in Krefeld und Duisburg ist bereits stark erhöht und erlaubt keine weiteren Belastungen. Allein der Ausstoß von Schwe-fel- und Stickoxiden würde mehrere Tausend Tonnen pro Jahr betragen. Empörend ist, dass die beantragten Filteranlagen nicht der besten zur Verfügung stehenden Technik entsprechen. Die entstehenden Gesundheitsgefahren sind also zum Teil vermeidbar.“
Weitere Informationen zum Kohlekraftwerk
Rheinische Post, 19.05.2010
Umweltschützer machen gegen Kohlekraftwerk mobil
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sowie weitere Umweltgruppen und Bürgerinitiativen haben am Mittwoch ihre Kampagne gegen das geplante Trianel-Steinkohlekraftwerk im Chempark in Krefeld-Uerdingen gestartet.
Man werde in den kommenden Tagen rund 60 000 Flugblätter vor allem in Krefeld und Duisburg verteilen, um möglichst viele Einwendungen gegen das Projekt zusammen zu bekommen, sagte der Geschäftsleiter des NRW-Landesverbandes des BUND, Dirk Jansen.
Die Einwendungen sollen dann der Bezirksregierung Düsseldorf vorgelegt werden, die über eine Genehmigung für das Kraftwerk entscheidet. Sollte die Behörde den Bau genehmigen, behalten sich die Kraftwerksgegner zudem eine Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf vor, betonte Jansen. Man richte sich auf einen „langen Kampf“ zur Verhinderung des Kraftwerks ein.
Nach Ansicht des BUND-Geschäftsleiters enthalten die für das Kraftwerksprojekt jetzt vorgelegten Unterlagen „eine Reihe von Rechtswidrigkeiten“. So werde das Emissionsschutzrecht nicht ausreichend berücksichtigt. Zudem gebe es Verstöße gegen den Natur- und Artenschutz.
Das geplante Kohlekraftwerk würde die Bevölkerung nach Angaben des BUND vor allem durch den Ausstoß von Feinstaub und Stickstoffdioxid belasten. Zudem ist das Kraftwerk nach Auffassung der Umweltschützer überflüssig und passt nicht in ein zukunftsfähiges Energiesystem. Weder die öffentliche Stromversorgung noch der Chempark Uerdingen benötigten die zusätzlichen Strom- und Dampfmengen durch das Großkraftwerk, hieß es.
Das Kraftwerk soll nach Angaben von Trianel eine Nettoleistung von 750 Megawatt haben. Die Investitionssumme liege bei über einer Milliarde Euro. Insgesamt 160 Arbeitsplätze sollen durch den Bau des Kraftwerks direkt oder indirekt entstehen. Die Bauzeit werde bei vier bis fünf Jahren liegen.
+++PRESSEinformation,19.05.2010+++
Trianel-Kohlekraftwerks-Projekt in Krefeld:
BUND und Bürgerinitiativen starten Anti-Kraftwerks-Kampagne
Der nordrhein-westfälische Landesverband des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ruft gemeinsam mit dem Niederrheinischen Umweltschutzverein (NUV) und der Bürgerinitiative Saubere Luft die Bürgerinnen und Bürger in Krefeld, Duisburg und Umgebung auf, jetzt ihre Einwände gegen den umstrittenen Bau eines Kohlekraftwerks in Krefeld-Uerdingen vorzubringen. Dazu hat das Widerstandsbündnis eine breit angelegte Kampagne gestartet. Noch bis zum Ende der Offenlegungsfrist am 28. Juni werden BUND und Bürgerinitiativen Unterschriften gegen den Kraftwerksbau sammeln und die Bürgerinnen und Bürger bei ihren Einsprüchen gegen das Projekt unterstützen. Ein Einwendungsgenerator der die verschiedenen Aspekte aus den nun offen gelegten Unterlagen kritisch beleuchtet, ist derzeit in Bearbeitung und wird nach ersten Prüfungen der Unterlagen online zur Verfügung gestellt werden.
Norbert Bömer, Sprecher der Duisburger Bürgerinitiative Saubere Luft: „Jetzt sind wir als Bürgerinnen und Bürger gefragt und gefordert, unseren Protest gegen die geplante unzumutbaren Zusatzbelastungen durch das Kraftwerk bei der Bezirksregierung einzureichen. Wer jetzt nichts unternimmt, kann sich später nicht mehr beschweren.“ Das Widerstandsbündnis werde deshalb in der nächsten Zeit 60.000 Broschüren in Duisburg und Krefeld verteilen und stehe mit Rat und Tat unterstützend zur Seite. Regelmäßige Termine von Info-Ständen zum Vorhaben und die Beratung der Bevölkerung, wie eine eigene Einwendung erstellt werden kann, hätten bereits begonnen.
„Dieses Kohlekraftwerk ist ebenso überflüssig wie schädlich“, sagte Dirk Jansen, Geschäftsleiter des BUND NRW. „Schon nach kursorischer Sichtung der Antragsunterlagen ist klar: Dieses Vorhaben ist nicht genehmigungsfähig.“ Auch vor dem Hintergrund des erfolgreichen BUND-Widerstandes gegen die geplanten Kohlekraftwerke in Düsseldorf, Datteln und Lünen rechnet Jansen mit guten Chancen, das Kohlekraftwerk noch stoppen zu können. Sollte die Bezirksregierung trotzdem eine Genehmigung erteilen, bereite sich der BUND mit Unterstützung der Bürgerinitiativen allerdings schon jetzt auf eine mögliche Klage vor.
Das geplante Trianel-Kohlekraftwerk mit einer Feuerungswärmeleistung von bis zu 1.705 Megawatt würde nach Angaben des Vorhabensträgers jährlich etwa 4,3 Millionen Tonnen des Klimakillers Kohlendioxid emittieren. Dazu würde die Bevölkerung gemäß Trianel durch den jährlichen Ausstoß von mindestens 124.000 Kilogramm des extrem gesundheitsschädlichen Feinstaubes, mehr als 1.700 Tonnen Stickstoffdioxid, 2.400 Tonnen Schwefeldioxid und einem krebsverursachendem Gemisch aus Arsen, Cadmium, Nickel, Benzo(a)pyren, Chrom (VI) und Kobalt sowie dem Nervengift Quecksilber gefährdet. Die Kraftwerksgegner halten das Vorhaben wegen der hohen Vorbelastung der Region und der gravierenden Umwelt und Gesundheitsbelastungen deshalb für nicht genehmigungsfähig.
„Wer in dieser Region bewusst lebt, ist weder Maschinenstürmer noch industriefeindlich. Jedoch muss sich durch Neuanlagen die Gesamtbelastung für die Bevölkerung insgesamt verringern und nicht, wie geplant, verschlechtern“, forderte Kerstin Ciesla, Vorsitzende der BUND-Kreisgruppe Duisburg. Auch wenn das Kraftwerk in Krefeld gebaut werde, liege der so genannte Aufpunkt der größten Schadstoffzusatzbelastung auf Duisburger Stadtgebiet.
Ulrich Grubert vom Niederrheinischen Umweltschutzverein ist optimistisch: “Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern wollen wir das Projekt zugunsten umweltfreundlicherer Alternativen verhindern. Bayer selbst hat die Alternative angekündigt: Die genehmigte und bereits gebaute Erdgaspipeline von Düsseldorf-Hubbelrath nach Uerdingen wurde u.a. mit dem Bau eines umweltverträglicheren Gas- und Dampf- Kraftwerks mit Kraft-Wärme-Kopplung begründet. Warum dann auf die schadstoffreiche Steinkohle zurückgreifen, einer überwunden geglaubten, überholten Technik?"
BUND, NUV und BI Saubere Luft appellierten an Trianel, sich von dem Vorhaben zu verabschieden und eine umweltfreundliche Alternativplanung zu realisieren. Weder die öffentliche Stromversorgung noch der CHEMPARK Uerdingen benötigten die zusätzlichen Strom- und Dampfmengen. Der angestrebte energetische Wirkungsgrad von 60 Prozent sei deshalb nicht mehr als ein „frommer Wunsch“. Im Übrigen erreichten moderne Gaskraftwerke mühelos energetische Wirkungsgrade von 80 bis 90 Prozent und seien nicht nur wesentlich weniger umweltschädlich und flexibel einsetzbar, sondern auch ökonomisch durchaus konkurrenzfähig. Als Ersatz für die alten Kohlekessel im Chemiepark aus den 60er Jahren mit einer Feuerungswärmeleistung von je 117 Megawatt reiche ein an die tatsächlichen Bedürfnisse angepasstes Gaskraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplung vollständig aus.
Mehr Infos zum Kraftwerk und der Kampagne von BUND und Bürgerinitiativen::
www.bund-nrw.de/themen_und_projekte/energie_klima/kohlekraftwerke/kraftwerksplanungen_nrw/krefeld/ und
http://nicht-verkohlen.de/