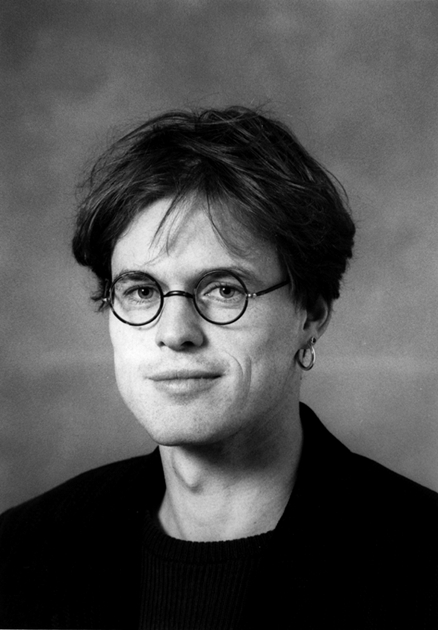Beim heutigen hearing der Landesregierung von Baden Württemberg zum aktuellen Bienensterben forderten betroffene Imker ein Verbot bienengefährlicher Pestizide. Weder die Imker noch Umweltverbände waren zu einem Redebeitrag eingeladen - im Gegensatz zur Bayer AG, dem weltgrößten Pestizidhersteller
(bitte klicken Sie auf die Bilder für eine höhere Auflösung)
Beiträge verschlagwortet als “Bienensterben”
Am 16. Mai forderten die Coordination und der Berufsimkerbund ein Verbot der Pestizide Gaucho (Imidacloprid) und Poncho (Clothianin), um weitere Bienensterben zu verhindern. Nur wenige Stunden später zog das Bundesamt für Verbraucherschutz die Notbremse und verbot die beiden Wirkstoffe zur Saatgutbehandlung. Die Coordination fordert ein Verbot von Gaucho seit 1999. Der Berufsimkerbund forderte 2006, Clothianidin keine Zulassung zu erteilen siehe Offenen Brief
Frankfurter Rundschau, 17. Mai 2008
Pflanzengift tötet Bienen
Zulassung ruht
Die Ursache für das rätselhafte Bienensterben in Südwestdeutschland ist gelöst: Das Pflanzenschutzmittel Chlothianidin sei eindeutig als Verursacher identifiziert, meldet das Julius-Kühn-Institut (JKI) in Braunschweig, das im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums seit Tagen Pflanzenproben und tote Bienen untersucht. 30 Prozent der Bienen in Deutschland hatten den Winter nicht überlebt. In Südbaden starben in den vergangenen Wochen zusätzlich täglich tausende.
Die Auswertungen hätten ergeben, dass die Bienen eindeutig mit Chlothianidin vergiftet seien. Bis auf eine Ausnahme sei bei allen 30 Bienenproben „eine Kontaktgiftwirkung nachgewiesen“ worden. Chemische Analysen auf Chlothianidin hätten einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Tod der Bienen und dem als Beizmittel für Maissaatgut verwendeten Wirkstoff bestätigt, so das JKI.
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) legte sofort die Zulassung für Pflanzenschutzmittel mit Chlothianidin auf Eis. Grund: Beim Einsatz bestimmter Sämaschinen würden die Bienen dem Gift weit mehr ausgesetzt, als im Zulassungsverfahren bekannt. Das BVL habe deshalb „das Ruhen der Zulassung mit sofortiger Vollziehung angeordnet“. Die betroffenen Mittel dürfen weder eingeführt, noch in Verkehr gebracht oder gar benutzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des BVL.
„Bisher gibt es keine Hinweise auf Schadensfälle in anderen Bundesländern als Bayern und Baden-Württemberg“, meldet das JKI. In einem Fachgespräch am Freitag sei der Verdacht aufgekommen, das Saatgut selbst könnte für den erhöhten Abrieb des Gifts gesorgt haben. So sei es möglich, dass die Beizung (Ummantelung) „nicht immer mit der erforderlichen Qualität erfolgt sein könnte“. Der Wind habe dann offenbar das Gift auf Nachbarfelder und die dort blühenden Pflanzen getragen. Ob Honig mit Chlothianidin belastet sein könnte, sei noch unklar. VON FRAUKE HAß
dpa
Pflanzenschutzmittel ist nach Überzeugung von Wissenschaftlern schuld am dramatischen Massensterben der Bienen in Baden-Württemberg
Aus den Auswertungen des Julius Kühn-Instituts könne «eindeutig» geschlossen werden, dass die Bienen durch Abrieb des Wirkstoffs Clothianidin vergiftet wurden, teilten die Experten am Freitag in Braunschweig mit. Bis auf eine Ausnahme sei bei allen 30 untersuchten Proben eine Kontaktgiftwirkung nachgewiesen worden. Damit stützen die Forscher die Vermutungen der Imker, die das Säen des mit Clothianidin behandelten Saatguts für den Tod der Bienen verantwortlich machen.
Maissaatgut wird seit längerem mit Pflanzenschutzmitteln gebeizt, das den für Menschen ungiftigen Wirkstoff Clothianidin enthält. Dadurch kann das Gut vor schädlichen Insekten wie Drahtwürmern und Fritfliegen geschützt werden. Während das Mittel nach Institutsangaben normalerweise nur auf kleineren Flächen genutzt wird, drillen die Baden-Württemberger und Bayern nach dem Auftreten des Maiswurzelbohrers die komplette Maisanbaufläche mit stärker gebeiztem Saatgut.
Die Analysen bestätigten «einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den gefundenen toten Bienen und dem Beizmittel», teilte das Institut am Abend mit. Die in Braunschweig untersuchten Proben stammen von Bienen und Pflanzen aus der Rheinebene in Baden- Württemberg, einige wenige auch aus dem Raum Passau (Bayern). «Bisher gibt es keine Hinweise auf Schadensfälle in anderen Bundesländern», teilte das Institut mit.
Die Wissenschaftler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass «die Beizung nicht immer mit der erforderlichen Qualität erfolgt sein könnte». Dadurch könne während der Aussaat ein erhöhter Abrieb aufgetreten sein, hieß es. Es sei zudem möglich, dass das Pflanzenschutzmittel durch Wind auch «weitaus stärker als bekannt» benachbarte blühende Pflanzen wie Löwenzahn, Raps oder Obst belastet hat. «Ob Honig mit dem Wirkstoff belastet worden sein kann, ist noch unklar», teilte das Institut mit. Dies werde derzeit in Baden- Württemberg untersucht.
17. MAI 2008, Südwestumschau
Spritzmittel schuld am Bienensterben
Nach dem Massensterben der Bienen vor allem am Rhein haben die Forscher den Schuldigen gefunden: Das Julius-Kühn-Institut ist sich sicher, dass ein Pflanzenschutzmittel für den Tod der Insekten verantwortlich ist. Aus den Auswertungen könne „eindeutig“ geschlossen werden, dass die Bienen durch Abrieb des Wirkstoffs Clothianidin vergiftet wurden, teilten die Experten in Braunschweig mit. Bis auf eine Ausnahme sei bei allen 30 untersuchten Proben eine Kontaktgiftwirkung nachgewiesen worden. Das Ergebnis bestätigt Warnungen der Imker: Diese hatten schon vor Wochen auf das mit Clothianidin behandelte Saatgut hingewiesen. Vor allem in Baden-Württemberg und in Bayern wird - im Gegensatz zu anderen Bundesländern - Saatgut auf kompletten Maisanbauflächen mit Pflanzenschutzmitteln gebeizt, das Clothianidin enthält.
Für Menschen ist die Chemikalie ungiftig und das Saatgut kann vor schädlichen Insekten wie Drahtwürmern und Fritfliegen geschützt werden. Der Befund scheint nun eindeutig: „Die Analysen bestätigten einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den gefundenen toten Bienen und dem Beizmittel“, teilte das Institut gestern mit. Die Experten hatten Proben von Bienen und Pflanzen unter die Lupe genommen. Sie gehen davon aus, dass „die Beizung nicht immer mit der erforderlichen Qualität erfolgt sein könnte“. Dadurch könne bei der Aussaat ein erhöhter Abrieb aufgetreten sein. Mit dem Wind könnte das Pflanzenschutzmittel „weitaus stärker als bekannt“ benachbarte blühende Pflanzen wie Löwenzahn, Raps oder Obst belastet haben. „Ob Honig mit dem Wirkstoff belastet worden sein kann, ist noch unklar“, hieß es.
Das Bundesamt für Verbraucherschutz hat jetzt vorläufig die Anwendung der acht Pflanzenschutzmittel Antarc, Chinook, Cruiser 350 FS, Cruiser OSR, Elado, Faibel, Mesurol flüssig und Poncho verboten. Lsw
Erscheinungsdatum: 16.05.2008
BVL ordnet das Ruhen der Zulassung für Saatgutbehandlungsmittel an
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat gestern, am 15. Mai 2008, nachdem sich aufgrund aktueller Berechnungen im Zulassungsverfahren neue Erkenntnisse ergeben haben, das Ruhen der Zulassung mit sofortiger Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO für die folgenden Saatgutbehandlungsmittel angeordnet:
Antarc (Cyfluthrin + Imidacloprid), Bayer, BVL Zulassungsnummer 4674-00
Chinook, (Cyfluthrin + Imidacloprid), Bayer, BVL Zulassungsnummer 4672-00
Cruiser 350 FS, (Thiamethoxam), Syngenta, BVL Zulassungsnummer 4914-00
Cruiser OSR, (Fludioxonil + Metalaxyl-M +Thiamethoxam), Syngenta, BVL Zulassungsnummer 4922-00
Elado, (Cyfluthrin + Clothianidin), Bayer, BVL Zulassungsnummer 5849-00
Faibel, (Methiocarb + Imidacloprid), Bayer, BVL Zulassungsnummer 4704-00
Mesurol flüssig, (Methiocarb), Bayer, BVL Zulassungsnummer 3599-00
Poncho, (Clothianidin), Bayer, BVL Zulassungsnummer 5272-00
Diese Entscheidung erfolgte nach eingehender Prüfung des aktuellen Sachstandes vor dem Hintergrund der in Südwestdeutschland aufgetretenen Schäden an Honigbienen. Für das BVL galt es zu prüfen, inwieweit ein Zusammenhang der berichteten Bienenvergiftungen mit der Ausbringung von mit Pflanzenschutzmitteln behandeltem Saatgut besteht. Diese Prüfung ergab, dass bei der Ausbringung von mit Insektiziden behandeltem Saatgut mit pneumatischen Sämaschinen eines bestimmten Konstruktionstyps eine höhere Exposition von Bienen verursacht wird, als im Zulassungsverfahren bislang bekannt.
Neue Risikobewertungen, die aufgrund der Bienenschäden veranlasst wurden und die diese erhöhte Exposition berücksichtigen, lassen es als wahrscheinlich erscheinen, dass als Folge dieser Exposition unvertretbare Auswirkungen auf Bienen nicht auszuschließen sind. In diesem Zusammenhang wird unter anderem auch die Gewährleistung des Schutzes des Anwenders im Rahmen der erwähnten Ausbringung überprüft werden.
Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse wird zur Vermeidung weiterer Bienenschäden und zur endgültigen Klärung der Zusammenhänge sowie möglicher weiterer Auswirkungen auf den Naturhaushalt aus Vorsorgegründen bis auf Weiteres ein Ruhen der Zulassung angeordnet.
Auch die in den Ländern für die Beratung der Landwirtschaft zuständigen Pflanzenschutz-dienststellen sind umgehend informiert worden, um die entsprechenden Informationen an die Anwender weiter zu geben.
Hintergrund zum Ruhen einer Zulassung
Mit der Anordnung des Ruhens der erwähnten Zulassungen sind weitere Einfuhren, das weitere Inverkehrbringen sowie die weitere Anwendung der betroffenen Pflanzenschutzmittel ausgeschlossen. Gleiches gilt nach Paragraf 16e Absatz 2 PflSchG auch für Pflanzenschutzmittel, für die eine Verkehrsfähigkeitsbescheinigung mit Referenz auf eine der oben genannten Zulassungen erteilt wurde.
Analysen des Julius Kühn-Instituts zu Bienenschäden durch Clothianidin
Braunschweig (10.06.2008) Nach Auffassung des Julius Kühn-Instituts (JKI) ist eindeutig davon auszugehen, dass Clothianidin hauptsächlich für den Tod der Bienen vor allem in Teilen Baden-Württembergs verantwortlich ist. Von den bisher 66 im Zusammenhang mit den Schadfällen „Maisaussaat“ untersuchten Bienenproben wiesen die chemischen Analysen des JKIs bis auf eine Ausnahme den Wirkstoff Clothianidin nach. Während 27 Proben zwischen 2 und 10 Mikrogramm Wirkstoff/kg Bienen enthielten, wiesen 32 Proben einen Wirkstoffgehalt zwischen 10 und 100 Mikrogramm/kg Bienen auf. Eine Probe enthielt 212 Mikrogramm Wirkstoff/kg Biene; die restlichen fünf Proben lagen unter 2 Mikrogramm. Die in den letzten Wochen durchgeführten Untersuchungen des JKIs bestätigen weiterhin die Vermutung, dass der Wirkstoff während der Aussaat des Maissaatgutes von diesem abgerieben wurde und die entstandenen Stäube über Verfrachtungen in der Luft auf blühende und von Bienen beflogene Pflanzen gelangt sind.
Speziell zu den in der Rheinebene in Baden-Württemberg und Bayern aufgetretenen Bienenvergiftungen mit Verdacht auf Schadursache „Maisaussaat“ erhielt die Untersuchungsstelle für Bienenvergiftungen des Julius Kühn-Instituts vom 30. April bis 3. Juni 156 Proben: 85 Bienenproben, 48 Pflanzenproben und 23 sonstige Proben (Pollen, Waben, Erde). 68 dieser Bienen-, 14 der Pflanzen- und 3 der sonstigen Proben stammen aus der Rheinebene in Baden-Württemberg, 14 Bienen-, 18 Pflanzen- und 2 sonstige Proben aus der Region Passau in Bayern. Wie bereits in unseren Presseinformationen vom 9.5.2008 und 16.5.2008 dargestellt, stammen die Einsendungen aus Gebieten, in denen Saatgut zur Bekämpfung des Maiswurzelbohrers mit dem Wirkstoff Clothianidin behandelt worden war. Aus allen anderen Regionen Deutschlands liegen derzeit lediglich 3 Bienen-, 2 Pflanzen- und 1 sonstige Probe vor, bei denen die Einsender als Schadursache „Maisaussaat“ vermuten.
Insgesamt erhielt das JKI im Jahr 2008 bisher 124 Bienenproben, 77 Pflanzenproben und 26 sonstige Proben (Wabenstücke, etc.) aus dem gesamten Bundesgebiet.
Die Untersuchung des Pollenspektrums aus dem Haarkleid der Bienen ergab in den bisherigen Proben, dass überwiegend sehr viel verschiedene Trachtpflanzen und nicht ausschließlich Massentrachten wie Raps oder Obst beflogen wurden. In einigen Proben überwog der Anteil an Rapspollen. Viele der bisherigen Pollenanalysen zeigen einen hohen Anteil an Löwenzahn- und Ahorn-Pollen, deren Blühzeitpunkt in den Schadregionen gleichzeitig mit der Aussaatzeit von Mais lag. Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass nicht Fehlanwendungen in einer einzelnen Kultur wie Raps oder Apfel als Schadursache in Frage kommen. Sie bekräftigten den Verdacht, dass die verschiedenen Trachtpflanzen mit Clothianidin kontaminiert waren.
Die Bienenschäden können nicht mit dem Auftreten von Bienenkrankheiten erklärt werden. Der Befall mit Nosema-Sporen war nur in 2 der untersuchten Proben hoch; in 17 Proben wurde ein mittlerer Befall, in 47 Proben ein geringer Befall festgestellt. Es wurden keine Anzeichen auf weitere Bienenkrankheiten bei diesen Bienenproben entdeckt.
Der eindeutige Nachweis der Herkunft des Clothianidins aus dem Abrieb des Saatguts wurde über den gleichzeitigen Nachweis des Wirkstoffs Methiocarb bestätigt. Methiocarb, das zur Verhinderung von Krähenfraß angewandt wird, wurde bei einigen Chargen des gebeizten Maissaatguts zusätzlich eingesetzt. Eine Auswahl der eingesandten Proben wird weiter gezielt auf das Vorhandensein von mehreren hundert Wirkstoffen analysiert, um mögliche Wechselwirkungen mit anderen Wirkstoffen oder andere Schadursachen zu erkennen. Allerdings ist ein Vergleich der Probenwerte mit den in Laborversuchen ermittelten Toxizitätsdaten wie z.B. der mittleren letalen Dosis (LD50) aufgrund der Probennahme nicht oder nur in wenigen Fällen direkt möglich.
Hintergrundinformationen zur Analyse der Bienenproben am Julius Kühn-Institut
Mit einem ersten biologischen Test mit den sehr empfindlichen Larven der Gelbfiebermücke, dem so genannten Aedes-Test, kann rasch eine grundsätzliche Bewertung vorgenommen werden, ob das Probenmaterial (tote Bienen oder Pflanzen) für Bienen giftige Stoffe enthält oder nicht. Vorausgegangen sind Analysen zum Gesundheitszustand der Bienen wie Nosema oder Parasiten. Ebenso wird der den toten Bienen anhaftende Pollen analysiert, um den Ort näher zu bestimmen, an dem sich die Bienen kurz vor ihrem Tod aufgehalten haben.
Nur wenn mit dem Aedes-Test eine Kontaktgiftwirkung bei den Bienen oder den Pflanzenproben nachgewiesen werden kann, klärt das JKI in einem zweiten, sehr aufwändigen Verfahren, ob ein Pflanzenschutzmittel in den Proben nachgewiesen werden kann und um welches Mittel es sich handelt. Für den Nachweis von Rückständen der sehr unterschiedlichen Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe in den Probenextrakten werden immer parallel LC/MS/MS- und GC/MS-Messungen durchgeführt.
Im Falle der jetzigen gravierenden Bienenschäden, bei denen der Verdacht schnell auf den Wirkstoff Clothianidin fiel, werden die chromatographischen Messergebnisse aller Proben zunächst mit Blick auf Clothianidin und Methiocarb ausgewertet, um rasch die erforderlichen Ergebnissen vorzulegen. Aus den eingesandten toten Bienen werden 200 Exemplare zufällig ausgesucht, zu einer Mischprobe verarbeitet und analysiert. Die ermittelten Werte der Analytik werden auf ein Kilogramm Bienen hochgerechnet (dies entspricht ca. 10.000 Bienen).
LD50: Gängige Messgröße, die ein Maß für die Giftigkeit (Toxizität) eines Stoffes darstellt. Die mittlere letale Dosis, LD50, bezeichnet die Dosis eines Stoffes, bei der 50 % der beobachteten Tiere sterben. Es handelt sich dabei um einen statistischen Wert aus Laborversuchen.
Julius Kühn-Institut - Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI)
Dr. Gerlinde Nachtigall - Pressereferentin -
Messeweg 11-12
38104 Braunschweig
Tel.: 0531 299-3204
Fax: 0531 299-3000
E-Mail: pressestelle@jki.bund.de
Presse Information vom 17. Mai 2008
Natur für Menschen – nicht fürs Business!
Protestaktion am Bayer-Werk Leverkusen
Rund 100 Umweltaktivisten aus aller Welt protestieren heute am Bayer-Werk Leverkusen gegen die Geschäftspolitik des Konzerns. Im Mittelpunkt der Kundgebung stehen die Produktion von Pestiziden und transgenen Pflanzen und die damit einhergende Bedrohung von Umwelt und Artenvielfalt, die Patentierung von Saatgut und das Lobbying multinationaler Unternehmen.
Die Kundgebung wird von dem Aktionsbündnis COP9 organisiert. Unter dem Motto “Natur für Menschen, nicht für´s Business! ruft das Bündnis aus UmweltaktivistInnen und sozialen Bewegungen zu Protesten gegen die Plünderung natürlicher Ressourcen im Interesse internationaler Konzerne auf. Die Teilnehmer der Kundgebung kommen u.a. aus Brasilien, Indien und Bangladesh.
Axel Köhler-Schnura von der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) sagte in einem Redebeitrag: „Produkte von Bayer sind für Todesfälle in aller Welt verantwortlich – von hochtoxischen Pestiziden bis hin zu gefährlichen Pharmaprodukten. Erst in der vergangenen Woche musste Bayer das Herzmittel Trasylol vom Markt nehmen, das für Tausende von Toten verantwortlich ist und dessen Risiken seit vielen Jahren bekannt waren.“ Die CBG fordert ein Verbot hochgiftiger Pestizide, weltweit freien Zugang zu Saatgut, einen Stopp der Agro-Gentechnik, die Förderung des ökologischen Landbaus sowie die Produktion von Nahrungsmitteln statt Agro-Sprit.
Vertreter des Bündnisses übergeben einen Offenen Brief an Bayer (s.u.).
Kontakt vor Ort unter: 0151-51806945
Offener Brief an den Bayer Konzern in Leverkusen
Sehr geehrte Vorstände des Bayer Konzerns,
bei internationalen Konferenzen versuchen Sie, der Bayer Konzern mit seinen Lobbyisten massiv in die Verhandlungen und die Ergebnisse einzugreifen. So auch jetzt wieder bei den derzeit in Bonn stattfindenden Vertragsstaatenkonferenzen zur Konvention über biologische Vielfalt (COP9) und dem Biosicherheits-Protokoll (MOP4). Dabei ist ihr Konzern um ein “grünes Image bemüht.
Letztes Jahr z.B. sponsorte Bayer den Jugendumweltkongress des United Nations Environment
Programme (UNEP). Dabei geht es Bayer um nichts anderes als eine “Greenwashing Kampagne. Denn ansonsten bekämpfen Lobbyisten ihres Konzerns fast alle Anstrengungen zum Umweltschutz - vom Kyoto-Protokoll, über das Verbot von FCKW bis hin zur neuen EU-Chemikaliengesetzgebung REACH.
Bayer produziert zudem zahlreiche hochgefährliche Produkte, emittiert große Mengen von Schadstoffen und Treibhausgasen, treibt den Anbau von gentechnisch veränderten Produkten voran und gehört somit zu einem der ganz großen Zerstörer biologischer Vielfalt.
Um nur einige Beispiele zu nennen:
Bayer ist verantwortlich für die schleichende Vergiftung von Böden und Gewässern, die Ausrottung nützlicher Pflanzen- und Tierarten, die Zunahme pestizidresistenter Schädlinge und die massive Schädigung des ökologischen Gleichgewichts durch Agro-Chemikalien.
Pestizide gelten als ein wesentlicher Verursacher des Artensterbens. Die Welternährungsorganisation FAO spricht von einer Umwelttragödie. Bayer ist weltweit der zweitgrößte Pestizid-Hersteller und im Bereich der hochgiftigen Insektizide Weltmarktführer. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO erleiden jährlich mehrere Millionen Menschen schwere Pestizid-Vergiftungen, bis zu 200.000 Fälle verlaufen tödlich.
Einer der jüngsten Vorfälle mit gefährlichen Chemikalien ereignete sich im amerikanischen Bayer-Werk Institute/West Virginia, als am 28. Dezember 2007 mehrere Fässer, die das Pestizid Thiodicarb enthielten, platzten. Dutzende Anwohner mussten wegen Kopfschmerzen und Atemwegsproblemen behandelt werden, mindestens ein Betroffener wurde stationär behandelt. Tatsächlich gehört Thiodicarb zu den gefährlichsten Agrogiften überhaupt.
In der EU wurde Thiodicarb verboten. Im vergangenen Jahr forderten 154 Organisationen aus 35 Ländern den Bayer-Konzern auf, den Verkauf aller Pestizide der obersten Gefahrenklasse, darunter Thiodicarb, einzustellen. Auch Ultragifte wie Phosgen, MIC und das Giftgases Phosgen, das im 1. Weltkrieg als Kampfgas verwendet wurde, werden in dem Werk gelagert.
Auch von dem Bayer-Herbizid Glufosinat drohen Verbrauchern, Anwendern und der Natur Gefahren. Nach einem Gutachten schwedischer Behörden, das von der European Food Safety Authority abgenommen wurde, empfiehlt Schweden Glufosinat zu verbieten. Fast alle gentechnisch veränderten Pflanzen im Sortiment von Bayer sind gegen Glufosinat resistent.
Die Genmanipulation von Pflanzen dient nicht – wie von Bayer häufig behauptet – der Bekämpfung des Hungers, sondern der Sicherung des Absatzes von Herbiziden. Der anhaltende Verkauf von Glufosinat ist aus ökologischen Gründen jedoch nicht länger zu verantworten.
Bayer ist verantwortlich für die massive Gefährdung der biologischen Vielfalt und der Umwelt durch transgene Pflanzen. Der Konzern gehört zu den wichtigsten Protagonisten der „grünen“ Gentechnik. Aktuell droht eine EU-Zulassung für herbizidresistenten Reis von Bayer (die gleiche Sorte sorgte vor zwei Jahren für den bislang größten Gentechnik- Skandal, als weltweit nicht-zugelassener Reis in den Handel gelangte). Der großflächige Anbau von gentechnischem Saatgut würde unweigerlich zur Kontamination und Verdrängung traditioneller Reis-Sorten führen, wodurch die Vielfalt der Nutzpflanzen zerstört und langfristig die Ernährungssicherheit gefährdet würde.
Weitere Beispiele sind: die Kontaminierung von Raps-Saatgut durch gentechnisch veränderten Raps, der in Deutschland nicht zugelassen ist. Diese Verunreinigung geht auf ein herbizidresistentes Produkt von Bayer CropScience zurück, das vor Jahren in Freilandversuchen getestet wurde. Bayer weigert sich, für den Schaden zu haften. Der Fall zeigt einmal mehr, dass Koexistenz ohne Kontamination von herkömmlichen Saatgut nicht möglich ist. Trotzdem drängt Bayer auf neue Märkte: In Australien soll Gen-Raps angebaut werden, bei der EU hat Bayer Import-Zulassungen für genmanipulierten Reis und Raps beantragt.
Bayer ist verantwortlich für Privatisierung und Monopolisierung von genetischen Ressourcen wie Saatgut und Heilpflanzen. Bayer gehört zu den größten transnationalen Konzernen in den Bereichen Pharma und Agrochemie., die den größten Teil der vergebenen Patente auf Leben unter sich aufteilen. Diese Versuche der Monopolisierung gehen zu Lasten von biologischer Vielfalt auf den Feldern und rauben indigenen Gemeinschaften ihre Heilpflanzen und ihr traditionelles Wissen.
Erst aufgrund jahrelanger massiver Einflußnahme von transnationalen Konzernen auf die internationale Gesetzgebung wurde im Rahmen der WTO das TRIPs-Abkommen (trade related intellectual property rights) unterzeichnet, das zur weltweiten Einführung von geistigen Eigentumsrechten wie Patenten auf biologisches und genetisches Material – auf Leben - verpflichtet. Bayer war auch daran beteiligt.
Ein besonders perfider Kontroll- und Machtmechanismus ist die sogenannte Terminator-Technologie, offiziell Genetic Use Restriction Technologies genannt. Diese Technologie produziert eine sterile Ernte, so dass diese nicht zur Wideraussaat verwendet werden kann. Die Terminator-Technologie wurde im Jahre 2000 im Rahmen der Konvention über biologische Vielfalt mit einem Moratorium belegt, da sie eine große Gefahr für die biologische Vielfalt bedeutet.
Auch der Bayer-Konzern ist an der Entwicklung von Terminator-Technologien beteiligt – ein halbes Dutzende Patente und Patentanmeldungen mit Titeln wie „Neuartige Gene zur konditionellen Zellablation“ oder „Verfahren zur Herstellung weiblich steriler Pflanzen“ belegen dies.
Laut Stellungnahme von Bayer CropScience besitzt das Unternehmen lediglich Terminator-Patente, die durch die Akquisition von Aventis Cropscience übernommen wurden. Damit sagt Bayer die Unwahrheit. In Wahrheit besitzt Bayer mindestens fünf Patente auf Saatgutsterilisierungs-Technologien. Das legt nahe, dass Bayer auch weiterhin an der Forschung von Terminator-Technologie und deren Anwendung interessiert ist. 2006 bei der COP 8 in Curritiba waren auch die Lobbyisten von Bayer an dem Versuch beteiligt, das Moratorium zu kippen.
Auch an der Entwicklung von Pharmapflanzen ist der Bayer-Konzern beteiligt und wird damit Umwelt und biologische Vielfalt gefährden.
Ganz neu ist die Information, dass die großen Agrar-Konzerne hunderte von Patenten auf gentechnisch veränderte Pflanzen anmelden, die entwickelt wurden, um besser mit Dürre und anderen Stressfaktoren umgehen zu können. Das ist Teil des Wettstreites um Dominanz in dem lukrativen Markt, der mit der Klimaerwärmung wächst. Und der Bayer-Konzern ist mit dabei.
Bayer ist verantwortlich für die Erwärmung des Klimas. Aktuell ist im Bayer-Werk Krefeld der Bau eines gigantischen Kohlekraftwerks, das jährlich 4,4 Millionen Tonnen Kohlendioxid und 4.000 Tonnen Stickoxide emittieren würde, geplant. Darüber ist Bayer zusätzlich für die Zerstörung von biologischer Vielfalt verantwortlich.
Bayer ist verantwortlich für die Verschmutzung von Gewässern mit jährlich über 700
Tonnen Phosphor, 2.700 Tonnen Stickstoff, 1,5 Mio Tonnen anorganischer Salze, 73
Tonnen Chlororganika und 28 Tonnen Schwermetalle. Bayer gehört somit zu den zehn
größten Wasserverschmutzern Deutschlands. Hinzu kommt der enorme Wasserverbrauch
des Konzerns mit täglich rund 2 Millionen Kubikmeter. Das Werk Leverkusen allein
verbraucht mehr Wasser als die benachbarte Millionenstadt Köln.
Bayer ist verantwortlich für den Anbau von Energiepflanzen für Agrarkraftstoffe, der in Konkurrenz zu Nahrungspflanzen erfolgt. Der Bayer-Konzern will sowohl aus Raps und aus der tropischen Pflanze Jatropa Agrosprit gewinnen. Dafür braucht es großflächige Monokulturen und einen hohen Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden. Ein großflächiger Jatropha-Anbau wird Naturlandschaften zerstören, Kleinbauern vertreiben und zu mehr Hungertoten führen. In Indien kam es bereits zu Vertreibung Landloser von angeblichem „Brachland. Dort will Bayer elf Millionen Hektar mit Energiepflanzen bebauen.
Bayer ist verantwortlich für den millionenfachen Tod in Bienenstöcken in Süddeutschland, wie die Berichterstattung der letzten Tage vermuten läßt. Der plötzliche Tod der Bienen setzte unvermittelt mit der Mais-Aussaat ein. Viele der Samenkörner waren zur Insekten-Bekämpfung mit dem Nervengift Clothianidin der Firma Bayer CropScience gebeizt. Das könnte der Killer sein, vermuten die Imker. Der Imker-Verband spricht vom schlimmsten Bienensterben in der Region „seit 30 Jahren“. Den Verdacht gegen das Nervengift aus dem Bayer-Konzern begründet der stellvertretende Verbandsvorsitzende Manfred Raff mit ähnlichen Erfahrungen italienischer Imker, bei denen die Mais-Aussaat schon vor einigen Wochen erfolgte. Dort fand sich in verendeten Bienen das Clothianidin. Es ist dem Verband zufolge Bestandteil des Agrargiftes Poncho Pro, welches für das Beizen des Mais-Saatgutes verwendet wird.
Bayer ist verantwortlich für den Hunger in der Welt. Während es in vielen Teilen der Erde mittlerweile zu Hunger-Aufständen kommt, heißt es im jüngsten Bayer-Geschäftsbericht: „Wir konnten an der positiven Entwicklung der Welt-Agrarmärkte partizipieren“. Das ist eine zynische Formulierung angesichts der drastischen Verteuerung von Grundnahrungsmitteln und der Zunahme des Hungers weltweit. Der Welternährungsrat sieht als eine wesentliche Ursache der Ernährungskrise die rückläufigen Ernten wegen der durch Agrarchemikalien geschädigten Ackerflächen. Als zweitgrößter Pestizid-Produzent hat Bayer einen entscheidenden Anteil daran.
Anläßlich der Verhandlungen zum Biosicherheits-Protokoll (MOP4) vom 12. bis 19. Mai in Bonn und den dort diskutierten Themen um Haftung und Versicherung bei Kontaminierung mit transgenem Material machte Bayer CropScience zusammen mit Monsanto, Syngenta, BASF, DowAgroSciences und Dupont/Pioneer - die sechs großen Biotech-Konzerne im Agrarbereich – einen Vorschlag, genannt „Compact“. Sie behaupten, dass sie Entschädigung zahlen wollen, wenn es durch ihre Produkte zu Schäden an der biologischen Vielfalt kommt. Das klingt zunächst sehr gut, allerdings bezieht sich der Vorschlag ausschließlich auf Schäden an der biologischen Vielfalt und Schädigungen an der menschlichen Gesundheit. Die Umwelt allgemein oder sozio-ökonomische und kulturelle Schäden sind davon ausgenommen.
Schäden an der biologischen Vielfalt werden, so der Vorschlag, auch nur berücksichtigt, wenn umfangreiches Informationsmaterial über diese Biodiversität vorliegt. In keinem Land sind bisher solche umfangreichen Kenntnisse über die Biodiversität gesammelt worden, um die Bedingungen für einen Entschädigungsfall bedienen zu können. Das Versprechen einer Entschädigung bleibt so ein leeres Versprechen! Außerdem wird Kontaminierung mit transgenem Material in dem Vorschlag ausdrücklich als keine Schädigung definiert.
Auch sollen nur Staaten als Kläger akzeptiert werden, geschädigten Individuen wird dadurch jede Möglichkeit auf Wiedergutmachung genommen. Alle Vorgänge sollen vertraulich behandelt
werden, also jegliche Transparenz soll, entsprechend dem Vorschlag, unterbunden werden.
Was wie ein Schritt in Richtung Konzern-Verantwortung präsentiert wird, ist letztlich ein geschickter Schachzug der Konzerne, um hunderte oder tausende Einzel- Klagen von vorneherein abzuwehren.
Wir kritisieren auf schärfste, dass die deutsche und europäische Politik Bayer wiederholt eine Plattform für ihr “Greenwashing-Programm bietet und die Industrieinteressen massiv unterstützt, trotz der Schäden für die Bevölkerung, die biologische Vielfalt und die Umwelt.
Weltweit wehren sich viele Menschen und Initiativen gegen Bayer-Produkte, deren gesundheits- und umweltschädliche Auswirkungen und die Bayer-Konzernpolitik. Wir erklären uns mit ihnen solidarisch und fordern den Bayer-Konzern auf, ihre Gift und Tod bringende Produktion zu
beenden.
Wir fordern Bayer auf, unverzüglich mit seiner umweltschädigenden Geschäftspraxis aufzuhören, nicht mehr die biologische Vielfalt zu zerstören, sie auch nicht zu privatisieren und monopolisieren, die Verantwortung für ihr bisheriges Handeln zu übernehmen und für die (Folge-)Schäden aufzukommen.
Solange der Konzern nicht maßgeblich seine Ausrichtung verändert, bleiben seine
Naturschutz-Ankündigungen hohl und eher bedrohlich.
Bayer – Finger weg von der biologischen Vielfalt,
Finger weg vom profit- und kontrollgetriebenen Naturschutz!
Für eine ökologische Landwirtschaft und Forstwirtschaft ohne Gentechnik und ohne Pestizide!
Für die Abschaffung von Patenten und anderen geistigen Eigentumsrechten auf Leben!
Für freien Zugang zu Saatgut weltweit!
Für ein endgültiges Verbot der Terminator-Technologie und ähnliche sterilmachende Techniken!
Natur für Menschen – nicht fürs Business!
UnterzeichnerInnen:
Aktionsnetzwerk globale Landwirtschaft, BUKO-Kampagne gegen Biopiraterie, La Via Campesina, Coordination gegen BAYER-Gefahren, Bonner AK gegen Gentechnologie, Aktionsbündnis COP 9, Verein fair-fish e.V., Indienhilfe e.V., Rettet den Regenwald e. V., Arbeitskreis Eine Welt Buchloe e.V., autofrei leben! e.V.
Presse-Erklärung vom 16. Mai 2008
Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund
Coordination gegen BAYER-Gefahren
Bienensterben: „Gefährlichkeit von Agrogiften seit langem bekannt“
Verbot der Pestizide Poncho und Gaucho gefordert
Der Deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund und die Coordination gegen BAYER-Gefahren fordern ein Verbot der Pestizide Poncho (Wirkstoff Clothianidin) und Gaucho (Wirkstoff Imidacloprid), um ein weiteres Bienensterben zu verhindern. Beide Pestizide sind stark bienengefährlich. Clothianidin steht in dringendem Verdacht, das aktuelle Bienensterben in Baden Württemberg verursacht zu haben.
„In allen 15 bisher untersuchten Proben verendeter Bienen ist Clothianidin gefunden worden - ein für Bienen und andere Insekten bereits in geringsten Mengen tödliches Nervengift“, so Manfred Hederer, Präsident des Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbunds. Schon im Juli 2006 hatte Hederer in einem Brief an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit scharfe Kritik an der Zulassung des Pestizids geäußert und vorausgesagt, „dass Clothianidin für unsere Bienen zu einer großen Gefahr werden wird“.
Beide Wirkstoffe werden vom Leverkusener Bayer-Konzern hergestellt. Imidacloprid wird vor allem im Raps-, Zuckerrüben- und Maisanbau eingesetzt. Clothianidin wird als Beizmittel für Maiskörner, die seit wenigen Wochen ausgesät werden, verwendet und ist auch zur Behandlung von Raps zugelassen.
Mit der Maisaussaat begann das Massensterben der Bienen am Oberrhein. Die Stäube, die bei der Aussaat entstehen, können auf blühende Pflanzen auf Nachbaräckern und Waldränder abdriften und werden dort von den Bienen aufgenommen und in den Bienenstock transportiert.
Philipp Mimkes von der Coordination gegen BAYER-Gefahren: „In Frankreich wurden Poncho und Gaucho wegen erwiesener Bienengefährlichkeit verboten. Aufgrund des starken Einflusses der Bayer AG blieben die deutschen Aufsichtsbehörden jedoch untätig“. In Frankreich wurde Gaucho schon 1999 verboten. Ein Antrag von Bayer auf Zulassung von Poncho wurde von französischen Behörden im Januar abgelehnt.
„Bayer hat im vergangenen Jahr mit Imidacloprid und Clothianidin fast 800 Millionen Euro umgesetzt. Hierin ist auch der Grund zu sehen, weswegen sich das Unternehmen trotz der gravierenden Umweltschäden mit Zähnen und Klauen gegen Anwendungsverbote wehrt“, so Mimkes weiter. Die beiden Insektizide sind chemisch eng miteinander verwandt.
Manfred Hederer, 0172 820 64 59, info@berufsimker.de
Lesen Sie hierzu auch:
=> Presse Info „Chemie-Firmen missbrauchen Bienen-Monitoring für Zulassungsverfahren“
=> Artikel „Das globale Bienensterben“
=> Ablehnung der Poncho-Zulassung in Frankreich
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren fordert ein präventives Verbot der von BAYER hergestellten Pestizide Gaucho und Poncho, um weitere Bienensterben zu verhindern. Lesen Sie hierzu auch eine Pressemitteilung des Deutschen Berufs- und Erwerbs-Imker Bunds DBIB
Exodus der Bienen
Sind Beiz-Staub und Pflanzenschutzmittel-verseuchter Boden Ursache für Bienensterben?
14. Mai 2008 -- „Die Ursache des aktuellen, massiven Bienensterbens entlang des Oberrheins soll noch unklar sein?“, staunt Manfred Hederer, Präsident des Deutschen Berufs- und Erwerbs-Imker-Bunds, der die erwerbsorientierten Imker Deutschlands vertritt, beim Lesen der Presseerklärung des Landwirtschaftsministeriums in Baden-Württemberg . „In allen 15 bisher untersuchten Proben der verendeten Bienen ist der Wirkstoff Clothianidin, ein für Bienen und andere Insekten bereits in geringsten Mengen tödliches Nervengift, gefunden worden!“, so Hederer. „Das ist, als ob man einer Leiche mit einem Messerstich ins Herz Tod durch einen Magen-Darm-Virus bescheinigt.“
Clothianidin wird als Beizmittel u. a. für Maiskörner, die seit wenigen Wochen am Oberrhein ausgesät werden, verwendet. Mit der Maisaussaat begann das Massensterben der Bienen. Die Stäube, die bei der Aussaat entstehen, können auf blühende Pflanzen auf Nachbaräckern und Waldränder abdriften und werden dort von den Bienen aufgenommen und in den Bienenstock transportiert. Die Trachtbiene nimmt dabei das Gift als erste auf.
Clothianidin bindet sich irreversibel an die Nervenzellen des Insekts, die Folge sind Krämpfe bis zum Tod. Schaufelweise müssen die badischen Imker derzeit diese Bienen vor den Fluglöchern ihrer Völker entsorgen.
Was dann an Gift noch im Bienenstock abgeliefert wird, wird an die Brut verfüttert. Das stellen die Imker gerade jetzt, zwei Wochen nach dem ersten Auftreten der Vergiftung, in den Völkern fest, die als erste massives Flugbienensterben hatten. „Wir finden tote Jungbienen, die es nicht mehr schafften, aus ihren Zellen zu schlüpfen. Wir finden abgestorbene Larven. Es ist aber definitiv keine Bienenkrankheit!“, so Imkermeister Klaus Waidele aus Zell am Hamersbach, der als einer der ersten auf das Bienensterben aufmerksam machte.
Neben den Beizstäuben tickt unter Umständen eine Zeitbombe im Boden selbst, vermuten die Berufsimker und fordern ein umfassendes Probenpaket vom Landwirtschaftsministerium Baden-Württemberg.
Bereits vor der Zulassung von Clothianidin in 2006 wies der Berufsimkerverband das für die Zulassung zuständige Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit darauf hin, dass Clothianidin ein Wirkstoff ist, der sich jahrelang im Boden in relativ hohen Konzentrationen halten kann. Dies haben internationale Studien belegt. Andere Länder haben daher die Zulassung von Clothianidin verweigert. Intensiver mehrjähriger Maisanbau auf den gleichen Flächen, ohne Fruchtwechsel, erfordert massiven Pflanzenschutzmittel-Einsatz. Clothianidin ist seit 2006 auf dem Markt für Mais, Raps und Rüben. Wieviel von diesem Gift sich seither in den badischen Äckern angesammelt hat, muss jetzt dringend geklärt werden. Nicht nur die Bienen sterben, auch Hummeln, Schmetterlinge und andere Insekten sollen betroffen sein.
Lesen Sie auch den Artikel Nervengift vom Feld könnte Bienen massenhaft töten
Pressekontakt:
Deutscher Berufs und Erwerbs Imker Bund e. V.
Manfred Hederer
Hofstattstr. 22 a
86919 Utting am Ammersee
Fon: 0049 (0) 172 820 64 59
Fax: 0049 (0) 88 06 / 92 23 21
E-Mail: info@berufsimker
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren fordert ein präventives Verbot der Pestizide Gaucho und Poncho, um weitere Bienensterben zu verhindern. Lesen Sie hierzu aktuelle Artikel:
Artikel von Franz Alt, 07.05.2008
Badische Imker verzeichnen ein massives Bienensterben nach der Maisaussaat
Derzeit verzeichnen die badischen Imker trotz schönsten Wetters massive Schwächungen, ja Zusammenbrüche ihrer Bienenvölker entlang der Rheinschiene.
Was auf den ersten Blick zusammenhanglos zu sein scheint, wird auf den zweiten Blick zu einer sehr ernst zu nehmenden Bedrohung für die Bienenvölker in verschiedenen Regionen Deutschlands. Nicht nur in der Geschäftsstelle des Badischen Imkerverbandes laufen die Telefone heiß. Traditionell überwintern über 50% der Imker Baden-Württembergs in den Auwäldern entlang des Rheins ihre Bienenvölker. Das milde Winterklima sowie eine gute Frühjahrsentwicklung aufgrund guter Versorgung mit Nektar und Pollen aus Weidenkätzchen, Wildkirschen und Bärlauch lassen die Bienenvölker bald eine gute Stärke erreichen, so daß die Völker schneller die notwendige Volksstärke erreichen.
Dieses Jahr ist das anders, so sieht der Berufsimker Christoph Koch seine Völker nicht wachsen, sondern dahinschmelzen wie Schnee in der Sonne. Aber auch der Landesvorsitzende der Badischen Imker Ekkehard Hülsmann meldet Alarmierendes und verfaßte einen Brandbrief an den baden-würtembergischen Landwirtschaftsminister, in dem er eilige Maßnahmen fordert, um weitere Verluste zu vermeiden.
Die Imker vermuten aufgrund ähnlicher Erfahrungen wie sie in Italien gemacht wurden, daß das mit dem hochtoxischen Nervengift Clothianidin gebeizte Mais-Saatgut für das Sterben der Bienenvölker verantwortlich sein soll. Hersteller des Agrargiftes ist die Firma BayerCropscience, aus deren Haus auch der verwandte Vorgängerwirkstoff Imidacloprid kam, der schon in Frankreich für das Massensterben der Bienen verantwortlich gemacht wurde. Im Vergleich zu Imidacloprid ist Clothianidin um ein Vielfaches giftiger. Es wird eingesetzt, um den Mais-Wurzelbohrer zu bekämpfen und Teile Baden-Würtembergs und Bayerns sind Mais-Wurzelbohrer-Gebiet.
Die italienischen Imker, bei denen die Aussat des Mais schon vor einigen Wochen erfolgte, konnten bei Untersuchungsproben aus verendeten Bienen den Wirkstoff Clothianidin nachweisen. Das Clothianidin ist Bestandteil des Agrargiftes Poncho Pro, welches für das Beizen des Mais-Saatgutes verwendet wird.
Vermutet wird nun, daß durch die Einsatz der Saatmaschinen aufgewirbelte Stäube beispielsweise auf blühende Rapsfelder und Blumenwiesen oder auch Wasserpfützen abdriften, die von den Bienen beflogen werden. Für wie gefährlich das Mittel eingeschätzt wird, zeigt auch eine Warnung der französischen Veterinärämter vom Beginn des Frühjahrs, die den Imkern eindringlich davon abraten, mit ihren Bienenvölkern in entsprechend behandelte Gebiete einzuwandern, ja diese Gebiete sogar für die nächsten Jahre zu meiden, denn Clothianidin baut sich nur sehr langsam im Boden ab bzw. die Abbauprodukte sind teilweise noch toxischer als das Clothianidin selber. Im Elsaß demonstrierten Imker bereits gegen die Anwendung von Clothianidin und fordern ein Verbot.
In seinem Schreiben an Minister Hauk fordert Christoph Koch ebenfalls schnellst mögliche Aufklärung. „Dies wollen wir hier vor allem auch deshalb, um eine mögliche Ausweitung der Problematik auf die anderen Bienenvölker in ganz Deutschland zu verhindern, denn wir befürchten jetzt schon eine sehr große Katastrophe!“
Ekkehard Hülsmann fordert die Einrichtung eines Krisenstabes im Ministerium, „der sich der sofortigen Klärung dieses Massensterbens unserer Bienenvölker annimmt und die Haftungs- und Schadenersatzfragen klärt. Gleichzeitig fordern wir Sie als Verbraucherminister auf, der Bevölkerung in der Todeszone das Ausmaß der entstandenen Vergiftungen offenzulegen.“
Mit ersten Untersuchungsergebnissen eingeschickter Proben rechnet die Biologische Bundesanstalt in Braunschweig etwa ab Mitte der Woche. Dann wird es sich zeigen, ob auch in Deutschland künftig No-Go-Areas für Imker und Bienen eingerichtet werden müssen.
Pressemitteilung Julius Kühn-Institut, 09.05.2008
Nationale Bienenuntersuchungsstelle am Julius Kühn-Institut untersucht Bienenproben aus Baden-Württemberg
Seit der vergangenen Woche beklagen Imker aus Baden-Württemberg große Verluste in ihren Bienenvölkern. Seit vergangenem Freitag sind an der Bienenuntersuchungsstelle am Julius Kühn-Institut - Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI) in Braunschweig 47 Proben mit toten Bienen eingegangen. Außerdem wurde Pflanzenmaterial eingesendet, von dem die Imker vermuten, dass ihre Bienen vor ihrem Tod Nektar und Pollen an den betreffenden Blüten gesammelt haben.
Erste Proben wurden auf die verschiedenen Mittel untersucht, die mit dem Bienensterben in Baden-Württemberg in Verbindung gebracht werden. Vor allem wird mit Chlothianidin behandeltes Maissaatgut verdächtigt. Der Wirkstoff wurde im besagten Zeitraum als Saatgutbeizmittel mit der Maisaussaat in den Boden gebracht. Saatgutbeizmittel sollen Samen und Pflanzen vor Krankheiten und Schädlingen schützen wie z. B. dem Maiswurzelbohrer, einem gefürchteten Quarantäneschädling, der im vergangenen Jahr erstmals in Deutschland auftrat.
In den ersten untersuchten Proben konnte der Wirkstoff Chlothianidin tatsächlich in Spuren nachgewiesen werden. Diese ersten Analysenergebnisse reichen jedoch nicht für eine abschließende Einschätzung aus, ob diese Dosis allein für den Tod der Bienen verantwortlich ist. Bisher ist ebenfalls unklar, wie die Bienen überhaupt in diesem Ausmaß mit dem Mittel in Kontakt kommen konnten.
Das JKI arbeitet mit Hochdruck an der endgültigen Aufklärung. Das Bundesforschungsinstitut ist ebenfalls an den Krisengesprächen des Landes Baden-Württemberg zum Thema beteiligt. Das erste hat gestern (8. Mai) stattgefunden.
Hintergrundinformationen zu Chlothianidin:
Der Wirkstoff ist in verschiedenen Pflanzenschutzmitteln, darunter auch Mittel zum Beizen von Saatgut, zugelassen. Pflanzenschutzmittel, die diesen Wirkstoff enthalten, sind grundsätzlich bienengefährlich, kommen aber - als Beizmittel angewendet - mit den Bienen nicht in direkten Kontakt. Daher wird in diesen Fällen bei der Zulassung der Hinweis erteilt, dass diese Mittel bei sachgerechter Anwendung Bienen nicht gefährden.
Alle in Deutschland zugelassenen Pflanzenschutzmittel werden aufgrund der Bienenschutzverordnung, die erstmals 1972 erlassen wurde, auf ihre Gefährlichkeit Bienen gegenüber untersucht. Entsprechende Hinweise und Auflagen finden sich in den Anwendungsbestimmungen der Pflanzenschutzmittel.
Dipl.-Biol. Stefanie Hahn, Pressestelle
Liebe Leserinnen und Leser,
immer wieder werden wir gefragt: „Lohnt sich denn der ganze Aufwand? Kann man gegen einen so großen Konzern wie BAYER überhaupt etwas ausrichten?“ Ja, man kann. Konzernkritik lohnt sich – wenn man sich von Rückschlägen nicht entmutigen lässt und einen langen Atem besitzt. Denn viele Kampagnen führen erst nach Jahren oder gar Jahrzehnten zum Erfolg.
So weisen wir seit Anfang der 90er Jahre auf hormonelle Risiken von Bisphenol A (BPA) hin. BAYER ist größter Hersteller dieser Chemikalie. Obwohl 90 Prozent aller unabhängigen Studien davor warnen, dass schon kleinste Mengen BPA schädlich sein können, wird die Chemikalie auch in Babyflaschen, Lebensmittelverpackungen und Spielzeug verwendet. Nun hat erstmals eine Regierung – die von Kanada - Bisphenol A als „gefährliche Substanz“ klassifiziert. Die größten Supermarkt-Ketten des Landes zogen BPA-haltige Verpackungen und Trinkflaschen sofort aus dem Verkehr. Verbote in weiteren Ländern sind wahrscheinlich. Ein wichtiger Erfolg der Umweltbewegung, der gegen anhaltenden Widerstand von BAYER und Co. erkämpft werden musste.
Ein anderes Beispiel: Zusammen mit Imkern in mehreren Ländern weisen wir seit zehn Jahren auf die Gefahren von Pestiziden für Bienen hin. Das BAYER-Pestizid Gaucho, eines der bestverkauften Agrogifte weltweit, wurde in Frankreich nach massiven Bienensterben verboten. Auch das Nachfolgeprodukt Poncho erhielt dort keine Zulassung. In Deutschland blieben beide Präparate auf dem Markt - zu groß war der Einfluss des Unternehmens. Im Mai kam es dann zu einem großen Bienensterben am Oberrhein. In allen untersuchten Bienen wurde Poncho nachgewiesen, obwohl BAYER stets beteuert hatte, die Bienen kämen mit dem Gift gar nicht in Kontakt. Der Einsatz von Gaucho und Poncho wurde bis auf weiteres untersagt. In mehreren Ländern, die mit ähnlichen Bienensterben konfrontiert sind, werden nun ebenfalls Verbote diskutiert.
Auch der Betrieb einer hochgefährlichen Kohlenmonoxid-Pipeline quer durch NRW konnte mit vereinten Kräften bislang verhindert werden. Ursprünglich wollte BAYER die Rohrleitung schon Anfang des Jahres einweihen. Damit wäre der bisherige Konsens aufgekündigt, tödliche Gase dort zu produzieren, wo sie verwendet werden, und keinesfalls durch dichtbesiedelte Gebiete zu leiten. Der Fortgang des Projekts steht mittlerweile in den Sternen: Das Oberverwaltungsgericht hat sich weite Teile unserer Kritik zu Eigen gemacht. Die Pipeline darf nicht vor Beendigung der Klageverfahren in Betrieb gehen; bei einer Verfahrensdauer von fünf und mehr Jahren bleibt abzuwarten, ob die Leitung dann ökonomisch noch Sinn macht. Ein Gerichtstermin Mitte Juni wurde gar abgesagt, weil BAYER die notwendigen Unterlagen nicht anbringen konnte.
Diese Beispiele machen Mut. Konzerne sind nicht unantastbar, Engagement wird belohnt. Dennoch ist die Existenz der Coordination gegen BAYER-Gefahren stark gefährdet. Seit jeher erhalten wir keine offizielle Förderung, und seit drei Jahren gehen unsere Spenden-Einnahmen kontinuierlich zurück. Trotz weitgehend ehrenamtlicher Arbeit können wir aber nicht ohne eine Grundfinanzierung arbeiten.
Wir möchten dem BAYER-Konzern nicht den Gefallen tun, unsere Arbeit nach 30 Jahren beenden zu müssen. Das kann aber passieren, wenn Sie uns nicht helfen. Dabei ist Konzernkritik, wie wir sie leisten, unabdingbar. Niemand hat einen so grundsätzlichen Ansatz wie wir. Lassen Sie es nicht zu, dass wir handlungsunfähig werden. Bitte helfen Sie mit, die Coordination gegen BAYER-Gefahren zu retten. Unterstützen Sie uns mit einer Spende oder mit Ihrer Mitgliedschaft. Wir vertrauen auf Ihre Hilfe.
Herzliche Grüße, Ihr
Philipp Mimkes
Philipp Mimkes, 41, ist Physiker und Vorstandsmitglied der Coordination gegen BAYER-Gefahren
Nach massivem Bienensterben:
PONCHO im einstweiligen Ruhestand
Der Tod kam mit der Mais-Aussaat: Kurz nachdem die LandwirtInnen ihr mit dem BAYER-Pestizid Clothianidin gebeiztes Saatgut ausgebracht hatten, setzte ein großes Bienensterben ein. Das „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit“ (BVL) reagierte zunächst abwartend, rang sich dann aber doch dazu durch, PONCHO und anderen Saatgutbehandlungsmitteln vorerst die Zulassung zu entziehen.
Von Jan Pehrke
„Dass Clothianidin für unsere Bienen zu einer großen Gefahr werden wird“, sagte Manfred Hederer schon im Juli 2006 voraus. Der Präsident des „Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbundes“ (DBIB) übte damals in einem Offenen Brief an Hans-Gerd Nolting vom „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit“ scharfe Kritik an der Zulassung, die seiner Ansicht nach auf fragwürdigen Studien zur Bienengefährlichkeit des Pestizides und falschen BAYER-Angaben zur Halbwertzeit beruhte. Aber die zuständigen Behörden ließen sich von ihrem Votum nicht abbringen. Clothianidin sei zwar im Prinzip Gift für Bienen, aber das Saatgut-Beizmittel bleibe ja unter der Erde und komme nicht direkt mit den Tieren in Kontakt, argumentierten die Verantwortlichen. Ihre französischen KollegInnen sahen das anders: Sie erteilten der unter dem Namen PONCHO vermarkteten chemischen Keule keine Genehmigung.
Eine weise Entscheidung, wie sich bald herausstellen sollte, denn hierzulande trat genau das ein, was Hederer befürchtet hatte. Unmittelbar nach der Mais-Aussaat setzte im Frühjahr 2008 ein großes Bienensterben ein. Da die LandwirtInnen auf Fruchtfolgen verzichten und nur auf schadinsekten-anfällige Mais-Monokulturen setzen, kam dieses Mal wegen des hohen Maiswurzelbohrer-Aufkommens eine Extraportion Clothianidin-Saatgutbeize zum Einsatz. Die Sämaschinen wirbelten gehörig Staub auf, und der Wind verwehte das Gift auf Rapsfelder, Blumenwiesen und Wasserpfützen, wo der direkte Kontakt mit den Insekten dann eben doch zustande kam. Dieser führte sogleich zu einem Massensterben. Millionen Bienen verendeten; die ZüchterInnen verloren ein Viertel ihrer Bestände. „Jeden Morgen liegen massenhaft Tote vor den Fluglöchern“, klagte etwa DBIB-Vize Christoph Koch. Wie Schnee in der Sonne sah er seine Völker dahinschmelzen, weshalb er von einem „imkerlichen Tschernobyl“ sprach.
In Italien, wo die Maisaussaat wegen des milderen Klimas schon einige Wochen vorher begann, trat der Super-GAU entsprechend früher ein. Und das elsässische Veterinäramt riet den BienenzüchterInnen schon zu Frühjahrsbeginn eindringlich, einen weiten Bogen um Maisfelder zu machen, da zahlreiche LandwirtInnen über den kleinen Grenzverkehr das verbotene PONCHO ins Land geschmuggelt hatten. Aber weder die Geschehnisse in Italien oder die Warnungen des elsässischen Veterinäramts noch die Demonstrationen der dortigen ImkerInnen bewogen die bundesdeutschen Behörden dazu, Vorsorgemaßnahmen zu treffen.
So traf die Sterbewelle die hiesigen BienenhalterInnen wie ein Schock. Bei den Verbandsorganisationen liefen die Telefone heiß. „Bei uns ist die Hölle los“, berichtete Manfred Hederer Stichwort BAYER. Auch die Politik kam langsam auf Touren. Landwirtschaftsminister Horst Seehofer ließ sich von DBIB-VertreterInnen das ganze Ausmaß der Katastrophe schildern, während sein baden-württembergischer Kollege Peter Haug Verantwortliche von BAYER und die Kulturpflanzen-WissenschaftlerInnen des „Julius-Kühn-Instituts“ zu einem Krisengespräch vorlud. Im Stuttgarter Landtag mussten Haug und seine RegierungskollegInnen die Anfrage der Grünen beantworten, wie die Landesregierung die von dem BAYER-Pestizid ausgehende Gefahr für die menschliche Gesundheit einschätze, warum sie nach den Vorgängen in Italien und Frankreich nicht schneller reagiert habe und wieviele Schadensersatz-Klagen den Gerichten bereits vorlägen.
Die Bundesgrünen traten indessen für einen unverzüglichen Verkaufsstopp von PONCHO ein, denn die Beweislast war erdrückend. „In allen 15 bisher untersuchten Proben verendeter Bienen ist Clothianidin gefunden worden“, so Manfred Hederer in der am 16.5. von DBIB und COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN gemeinsam veröffentlichten Presseerklärung. Aber das „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit“ (BVL) zeigte sich vorerst uneinsichtig. „Diese ersten Analyse-Ergebnisse reichen jedoch nicht für eine abschließende Beurteilung aus, ob die Bienenvölker durch die Kontamination mit Clothianidin geschädigt wurden“, teilte die Bundesbehörde GREENPEACE mit. Das BVL wollte noch die Untersuchungen des Julius-Kühn-Institutes abwarten, weshalb es sich mit seinen anempfohlenen Sofortmaßnahmen nur an die ImkerInnen und die LandwirtInnen wendete. Erstere sollten Maisäcker möglichst meiden und zweitere Sämaschinen verwenden, welche die Abluft in den Boden statt in die Luft leiten können. „Damit wird das Verursacherprinzip geradezu ad absurdum geführt, empörte sich der GREENPEACEler Manfred Krautter.
Aber er konnte sich bald wieder abregen. „Mit Clothianidin gebeiztes Saatgut ist nach Untersuchungen des Julius-Kühn-Instituts Ursache für aktuelle Bienenschäden in Baden-Würtemberg“, hieß es in der Pressemitteilung der Braunschweiger Forschungseinrichtung. Daraufhin ordnete das BVL das Ruhen der Zulassung für die BAYER-Beizen PONCHO, CHINOOK, FAIBEL, ELADO, MESUROL FLÜSSIG und ANTARC sowie zwei SYNGENTA-Saatgutbehandlungsmittel an. Dabei handelte es sich nicht nur um Chemikalien mit der Wirksubstanz Clothianidin, auch Mittel mit solchen Inhaltsstoffen wie Cyfluthrin, Imidacloprid und Methiocarb zogen die Verbraucherschützer bis auf Weiteres aus dem Verkehr. Nach einer fast schon zehn Jahre währenden Kritik an der Bienengefährlichkeit von PONCHO & Co., nach unzähligen Demonstrationen von ImkerInnen in ganz Europa, nach zahlreichen Studien zur verheerenden Wirkung der Gifte und nach Protestreden von BienenzüchterInnen auf den BAYER-Hauptversammlungen haben sich die zuständigen Stellen damit nun endlich zu einem konsequenten Handeln entschlossen.
Der Leverkusener Multi reagierte wie immer in solchen Fällen und stand in Treue fest zu seinen Produkten. Nicht etwa das Beizmittel an sich, sondern einige fehlerhaft behandelte Saatgut-Partien haben nach Ansicht des Konzerns nämlich in Tateinheit mit falsch konstruierten Sämaschinen, Trockenheit und starken Winden zu den „Bienenverlusten“ geführt. Deshalb ist für den Konzern alles halb so wild. „Anders als das Ministerium sind wir der Ansicht, dass es eine schnelle technische Lösung geben kann, ohne dass es einer Aussetzung der Zulassung bedurft hätte“, erklärte BAYER-CROPSCIENCE-Sprecher Utz Klage. Gemeinsam mit den Herstellern von Sämaschinen will BAYER eine solche erarbeiten. Zudem kündigte das Unternehmen an, ein Zertifizierungssystem zu schaffen, das für mehr Qualitätskontrolle bei der Produktion von PONCHO & Co. sorgt.
Das Julius-Kühn-Institut hat der Agro-Riese mit diesen Zusicherungen, mit denen er seine immensen Beizmittel-Gewinne - allein PONCHO kam 2007 weltweit auf einen Umsatz von 237 Millionen Euro - zu retten gedenkt, nicht von seiner Entscheidung abhalten können. Ob es die inkriminierten Saatgutbehandlungsmittel allerdings für immer auf die Schwarze Liste setzt, bleibt abzuwarten. Die Braunschweiger WissenschaftlerInnen betreiben nämlich selber keine Ursachenforschung. Deshalb besteht die Gefahr, dass sie der BAYER-Interpretation folgen, es habe sich bei dem Bienensterben um einen Ausnahmefall gehandelt, der im nächsten Jahr durch die angekündigten Vorsorgemaßnahmen zu verhindern wäre, zumal es in den betroffenen Regionen aufgrund des massiven Auftretens des Maiswurzelbohrers auch eine Ausnahmegenehmigung für ein besonders hoch dosiertes PONCHO gab. Mit PONCHO im Normalzustand und ein paar „technischen Lösungen“ würde dann die Maissaison 2009 beginnen - und für die Bienen der „Tod im Maisfeld“ weitergehen.
PONCHO & Co. können sich also berechtigte Hoffnungen auf einen „zweiten Frühling“ machen. Dabei müssten eigentlich nicht nur diese Saatgutbehandlungsmittel, sondern noch viele andere Agrochemikalien wie z. B. BAYERs berühmt-berüchtigtes GAUCHO für immer und ewig von den Feldern verschwinden, denn auch diese Agro-Gifte stellen für die Bienen eine tödliche Gefahr dar. Und nicht nur für sie: Ein ganzes Ökosystem droht mit Verschwinden der Immen aus dem Gleichgewicht zu geraten. Die Brummer bestäuben nämlich 80 Prozent aller Nutzpflanzen. In der Rheinebene tauchten sie diesmal zur Kirschblüte schon nicht mehr auf, auch Pflaumen und Zwetschgen warteten vergeblich auf ihren Besuch. „Katastrophale Aussichten für die entsprechenden Ernten“, kommentierte die Badische Zeitung.
Die Artgenossen der Bienen machten sich dagegen weitgehend unbemerkt vom Acker. „Andere Insekten sterben halt still“, weiß der Landesvorsitzende der badischen Imker, Ekkehard Hülsmann. Sogar Vögeln setzen die Ackergifte schwer zu. „Täglich erreichen uns fünf bis zehn Anrufe, dass Jungvögel apathisch an der Straße sitzen und nicht vor Autos flüchten“, sagte Monika Erlacher von der TIERHILFS- UND RETTUNGSORGANISATION der Mittelbadischen Presse, und andere Badener berichteten den JournalistInnen von Krähen, die „wie besoffen auf der Straße herumtorkeln“. Nicht einmal die menschliche Konstitution ist den Agrochemikalien gewachsen. Ein Imker, der seine eigenen Pollen vor dem Verkauf probierte, erlitt Darmblutungen und will nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung stellen. Er gehört damit zu den mindestens drei Millionen Vergiftungsopfern, welche die pestizid-bewehrte „grüne Revolution“ nach Berechnungen der Weltgesundheitsorganisation WHO alljährlich fordert.
Für Mensch, Tier und Umwelt gleichermaßen bedrohlich, wächst der Markt für Ackergifte gleichwohl beständig. Um sechs Prozent auf 5,8 Milliarden Euro stieg der BAYER-Umsatz mit den Chemikalien im Geschäftsjahr 2007 und der für PONCHO noch um mehr als ein paar Prozente mehr. „Den weltweiten Umsatz von PONCHO konnten wir nahezu verdoppeln“, jubiliert der letzte Geschäftsbericht. Da fällt es leicht, die Portokasse ein wenig zu öffnen, und den betroffenen ImkerInnen Geld für ihre Verluste anzubieten. Umso mehr, als BAYER damit kein Schuldeingeständnis verbunden sehen will. „Die unbürokratische Hilfe erfolgt auf freiwilliger Basis, während die Klärung des Sachverhaltes noch andauert“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.
Alle Infos zur Kampagne
Berufsimkerbund DBIB
Presse Info vom 29. Januar 2008
Agrar-Chemie-Giganten missbrauchen Deutsches Bienen-Monitoring für Zulassungsverfahren
Mitte Januar erhielt der DBIB über europäische Kontakte ein Gutachten der französischen Behörde AFSSA (entspricht dem BML) bezüglich des Zulassungsverfahrens für das Mais-Saatgutbeizmittel PONCHO (Wirkstoff: das Neonicotinoid Clothianidin) der Firma Bayer CropScience France.
Bayer beantragte am 12. Oktober 2007 eine Zulassung für Poncho. Wider Erwarten verweigerte die AFSSA im November 2007 die Zulassung. Die Behörde entschied, daß die von Bayer eingereichten Informationen nicht ausreichend waren, um die Unbedenklichkeit für Bienen zu belegen. Bayer CropScience France entschied nun, diese Ablehung durch das Nachreichen weiterer Daten zu überwinden.
Das dem DBIB vorliegende (und auf der Website http://berufsimker.de/?q=node/131 einsehbare) Gutachten der AFSSA vom 20.12.2007 beschreibt nun, welche Unterlagen eingereicht wurden:
Es waren ausschließlich die drei Jahresberichte 2004/2005, 2005/2006 und 2006/2007 aus dem deutschen Bienenmonitoring, die in Deutsch und mit beglaubigten Übersetzungen ins Englische bzw. Französische vorgelegt wurden. Damit steht fest, daß die Berichte nicht einfach „beigelegt“ wurden, sondern mit erheblichem Aufwand als entscheidende Dokumente zur Erlangung der Zulassung eingereicht wurden.
Die AFSSA prüfte die vorgelegten Berichte des Bienenmonitorings und traf am 19.12.2007 erneut eine Entscheidung, die mit dem Gutachten vom 20.12.2007 ausführlich begründet wird.
Zunächst drückte die Behörde Verwunderung über die in den Berichten dargestellte Eintracht der Bieneninstitute Celle, Freiburg, Halle, Hohenheim, Hohen-Neuendorf, Veitshöchheim, dem Deutschen Imkerbund (DIB), dem Deutschen Berufs und Erwerbs Imkerbund (DBIB), BASF und Syngenta aus. Man wunderte sich über die ermittelten Zahlen zu Völkerverlusten, da vor dem Monitoring viel höhere Verluste aus Deutschland gemeldet wurden. Dies stehe in einem seltsamen Kontrast zur Bienenrealität in anderen EU-Mitgliedsländern.
Danach wurden die vorgelegten Zahlen aus den Berichten ausgewertet und bewertet. Die Zahlen seien offensichtlich nicht repräsentativ und die Auswahl der beteiligten Imker nicht für statistische Zwecke geeignet. Die Zahlen seien unpräzise, voller Ungereimtheiten und deren Erhebung nicht für eine Zulassungsprüfung geeignet. Das eingereichte Material sei absolut unzureichend, um eine Zulassung zu rechtfertigen. Die im November 2007 erfolgte Ablehnung der Zulassung bleibt bestehen.
Die Fa. Bayer bemüht sich offensichtlich, wie dem DBIB von verschiedenen Seiten berichtet wurde, die „Sache“ mit Poncho als harmlosen Zwischenfall darzustellen. „Die öffentlich zugänglichen Berichte aus dem Monitoring seien anderen Zulassungsunterlagen beigelegt worden.“ Dem ist eindeutig nicht so, wie das Schreiben der AFSSA belegt.
Zur Pressekonferenz des Deutschen Bienenmonitorings auf der Grünen Woche am 22.01.2008 ist der Vertreter der Fa. Bayer erst gar nicht erschienen. Der Berufsimkerverband hat das Vorgehen von Bayer entschieden abgelehnt. „Es kann nicht angehen, daß dass unsere Imker, deren Bienen möglicherweise durch Agrargifte des Konzerns Bayer leiden, gleichzeitig dazu herangezogen werden, die nächste Generation von Pestiziden, die im Verdacht stehen, bienengefährlich zu sein, zu unterstützen“, so Präsident Manfred Hederer in Berlin.
Die Verwendung der Monitoring-Daten durch die Fa. Bayer erfolgte ohne die erforderliche vorherige Abstimmung im obersten Entscheidungsgremiums des Deutschen Bienen Monitoring, dem Projektrat. Der DBIB hat eine sofortige Sitzung des Projektrates gefordert, um über die Konsequenzen aus diesem Vorgang zu entscheiden.
Auch die Verwendung des Monitorings durch die Fa. Monsanto war ein Thema auf der Pressekonferenz des Deutschen Bienenmonitorings und der Podiumsdiskussion zum Thema „Gesunde Bienen - gesunde Umwelt“ am 22.01.2008.
Die Fa. Monsanto hatte das „Deutsche Bienen-Monitoring“ als Bestandteil ihres eigenen GVO-Monitorings angegeben, um die Wiederzulassung von MON810 zu erreichen. Alle Beteiligten teilten unsere Auffassung, daß das Bienenmonitoring nicht für die von Monsanto angegebenen Zwecke geeignet ist und daher nichts in dem Plan für MON810 zu suchen hat.
Nachdem uns ähnliche Probleme auch aus anderen Bereichen des Plans von Monsanto bekannt sind - z.B. wird auch das Tagfalter-Monitoring-Deutschland von entsprechenden Verbänden für völlig ungeeignet zum Monitoring von GVOs eingestuft - fragt sich der DBIB, wie das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz diesen Plan akzeptieren konnte. Wenn eine französische Behörde für die Zulassung ungeeignetes Material vorgelegt bekommt, wird es entsprechend bewertet und abgelehnt. Wenn das BMELV mit einer Fassade aus viel Papier konfrontiert wird, bestätigt man dort den Eingang und genehmigt den Vertrieb von MON810 offensichtlich ohne eigene Prüfung.
weitere Informationen:
=> „Verraten und Verkauft“ - Das deutsche Bienenmonitoring
=> Imker und Umweltverbände fordern Verbot des Pestizids Gaucho
=> Staatlicher Untersuchungsbericht macht BAYER-Pestizid GAUCHO für Bienensterben verantwortlich
13. August 2008
Pestizide und Bienensterben - Informationen zur Strafanzeige der Coordination gegen BAYER-Gefahren gegen den BAYER-Vorstand
Seit 1991 stellt der Leverkusener BAYER-Konzern das Insektizid Imidacloprid aus der Substanzklasse der Neonicotinoide her. Neonicotinoide sind synthetische Nikotinverbindungen, die als Nervengift wirken. In Deutschland ist Imidacloprid unter den Markennamen Gaucho, Confidor, Chinook und Imprimo unter anderem im Raps-, Zuckerrüben-, Tabak-, Wein- und Maisanbau zugelassen.
Der jährliche Imidacloprid-Absatz in Deutschland liegt zwischen 25 und 100 Tonnen, genauere Angaben sind öffentlich nicht zugänglich. Über 1.000 Tonnen exportiert BAYER in rund 120 Länder. Im vergangenen Jahr setzte der Konzern mit Imidacloprid 556 Millionen Euro um. Die Substanz ist damit das bestverkaufte Pestizid von BAYER und gehört zu den weitest verbreiteten Insektiziden weltweit.
Neonicotinoide werden vornehmlich als Beizmittel zur Behandlung von Saatgut verwendet. Hierdurch soll zum einen die Saat vor Insekten geschützt werden. Zum anderen steigt der Giftstoff in die Pflanze auf und ist später in allen Pflanzenteilen zu finden. Schadinsekten sterben, wenn sie von Blättern oder Blüten fressen. Der Wirkstoff wandert auch in den Pollen und in den Nektar und kann Nutzinsekten wie Bienen schädigen.
Da der Patentschutz von Imidacloprid in den meisten Ländern abgelaufen ist, brachte BAYER im Jahr 2003 das ähnlich wirkende Nachfolgeprodukt Clothianidin (Produktnamen: Elado, Poncho) auf den Markt. Der Clothianidin-Umsatz betrug im vergangenen Jahr 237 Mio Euro. Der Wirkstoff wird vor allem im Mais- und Rapsanbau verwendet.
Bienensterben
Der Beginn der Vermarktung von Neonicotinoiden fällt mit dem Auftreten großer Bienensterben zusammen. Verlustmeldungen gab es in den vergangenen 13 Jahren unter anderem aus Italien, Spanien, der Schweiz, Deutschland, Österreich, Polen, England, Slowenien, Griechenland, Belgien, Kanada, den USA und Brasilien. Dabei waren bis zu 70 Prozent aller Bienenstöcke betroffen. Allein in Frankreich starben innerhalb von zehn Jahren rund 90 Milliarden Bienen. Die Honigproduktion sank dadurch um bis zu 60%. Da Honigbienen außerdem den größten Teil der Blütenbestäubungen erbringen, gingen auch die Erträge von Äpfeln, Birnen und Raps zurück.
Die Bienengefährlichkeit von Imidacloprid und Clothianidin ist unstrittig. Im Imidacloprid-Datenblatt des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) ist vermerkt: „Das Mittel wird als bienengefährlich eingestuft (B1). Es darf nicht auf blühende oder von Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Unkräuter“.
Neonicotinoide können zudem wegen ihrer hohen Persistenz mehrere Jahren im Boden verbleiben. Für Clothianidin wurden Halbwertszeiten von bis zu fünf Jahren beobachtet. Selbst unbehandelte Pflanzen, auf deren Feldern in den Vorjahren Imidacloprid oder Clothianidin eingesetzt wurde, können den im Boden befindlichen Giftstoff über die Wurzeln aufnehmen und eine für Bienen gefährliche Konzentration enthalten.
Wegen der Gefährlichkeit für den Bienenbestand hat die französische Regierung im Jahr 1999 den Einsatz von Imidacloprid zur Saatgutbeizung von Sonnenblumen verboten. Die Zulassung des Wirkstoffs als Beizmittel von Mais wurde 2004 aufgehoben. Auch das Nachfolgeprodukt Clothianidin erhielt in Frankreich keine Zulassung. Im Jahr 2000 wurde in den Niederlanden ein Verbot der Ausbringung von Imidacloprid auf freien Flächen verfügt. In der Schweiz wurde der Wirkstoff zeitweise auf Maisfeldern verboten.
Zulassung von Clothianidin
Im Jahr 2003 brachte der BAYER-Konzern in Nordamerika das Beizmittel Clothianidin auf den Markt, ab 2006 auch in Deutschland.
In einem Offenen Brief an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) wies Manfred Hederer, Vorsitzender des Deutschen Berufs- und Erwerbs-Imkerbunds, schon 2006 darauf hin, dass die von BAYER behauptete Ungefährlichkeit von Clothianidin für Bienen auf einseitigen Studien beruhe („Die von BAYER CropScience veröffentlichten Informationen beruhigen uns als Imker in keinem Fall. Im Gegenteil, die (schlechte) Qualität der Studien schürt den Verdacht, dass Clothianidin für unsere Bienen zu einer großen Gefahr werden wird. Wir sehen in Clothianidin und Thiomethoxam eine große Gefahr für die Gesundheit und das Überleben unserer Bienenvölker“). (1) Der Berufsimkerbund forderte die Bundesbehörden auf, die Zulassung von Clothianidin zurückzuziehen.
Auch die kanadische Zulassungsbehörde Pest Management Regulatory Agency bezeichnete die von BAYER eingereichten Studien als „mangelhaft“, weswegen eine Gefährdung von Bienen befürchtet werde. Besonders hervorgehoben wurde die mehrjährige Verweildauer des Giftstoffes im Boden („All of the field/semi-field studies, however, were found to be deficient (=mangelhaft) in design and conduct of the studies. Given the foregoing, the risk that clothianidin seed treatment may pose to honey bees and other pollinators cannot be fully assessed, owing to the lack of sufficient information and data. Clothianidin may pose a risk to honey bees and other pollinators, if exposure occurs via pollen and nectar of crop plants grown from treated seeds“) (2).
Wie gefährlich Clothianidin eingeschätzt wird, zeigt auch eine Warnung der französischen Veterinärämter zu Frühjahrsbeginn: Darin rieten sie den Imkern eindringlich, mit ihren Bienenvölkern die Gebiete, in welchen das Gift eingesetzt wurde, für Jahre zu meiden. (3)
Bienensterben am Oberrhein
In Baden-Württemberg kam es im Frühjahr 2008 nach der Aussaat von Clothianidin-behandeltem Mais zum größten Bienensterben seit Jahrzehnten. Rund 700 Imker verloren ihre Bestände zum Teil oder ganz, insgesamt rund 11.500 Völker. Der Bestand wildlebender Insekten ging ebenfalls zurück. Nach Angaben des Landesverbandes Badischer Imker liegt der Verlust der betroffenen Imkers im Durchschnitt bei 17.000 Euro.
Nach Aussage des Bundesforschungsinstituts für Kulturpflanzen (Julius Kühn-Institut, JKI), das mit der Untersuchung des Bienensterbens betraut wurde, ist „eindeutig davon auszugehen, dass Clothianidin hauptsächlich für den Tod der Bienen vor allem in Teilen Baden-Württembergs verantwortlich ist“. (4) In 66 untersuchten Bienen wiesen die chemischen Analysen des JKIs in 65 Fällen den Wirkstoff Clothianidin nach. Die Bienenschäden können laut Julius Kühn-Institut „nicht mit dem Auftreten von Bienenkrankheiten erklärt werden“.
Zeugenaussage des betroffenen Imkers Fritz Hug
Fritz Hug aus Simonswald ist Nebenerwerbsimker. Seine 30 Bienenvölker im Auwald in Weisweil (Kreis Emmendingen) wurden direkt nach der Mais-Aussaat Ende April schwer geschädigt: Es leben fast keine Flugbienen mehr, die Flugbretter sind übersät mit toten Bienen. Auch die Brut hat keine Überlebenschance. Frisch verendete Bienen hatten den Rüssel ausgefahren, was ein sicheres Zeichen für eine Vergiftung ist.
Weitere 70 Bienenvölker von Herrn Hug wurden nach Beobachtung der ersten Schäden in andere Gebiete gebracht. Zu diesem Zeitpunkt waren rund 40-50% der Bienen verendet. Die Pollenwaben dieser Völker wurden vom Landwirtschaftsministerium eingesammelt und entsorgt.
Der monetäre Schaden von Herrn Hug beläuft sich auf mindestens 9000 Euro.
Alle Völker waren gut über den Winter gekommen, ein Milbenbefall kann für das Bienensterben nicht verantwortlich sein. Die Bienenstände befanden sich in der Nähe zahlreicher Mais-Äcker, die mit Clothianidin-gebeiztem Saatgut eingesät wurden. Das Julius Kühn-Institut is Braunschweig untersuchte tote Bienen von Herrn Hug und fand in diesen Clothianidin. Laut Aussage des Julius Kühn-Instituts kommt nur Clothianidin von BAYER für das Massensterben der Bienen in Frage.
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren und Fritz Hug legten gemeinsam Strafanzeige ein.
Verbot in Deutschland
Durch das großflächige Bienensterben in Baden-Württemberg wurde die von BAYER-Vertretern stets vorgebrachte Aussage, dass Beizmittel wie Clothianidin und Imidacloprid nicht direkt mit Bienen in Kontakt kämen, widerlegt.
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) reagierte und verbat am 16. Mai die Anwendung mehrerer Beizmittel, darunter Imidacloprid und Clothianidin, mit sofortiger Wirkung. Die betroffenen Mittel dürfen weder eingeführt, noch in Verkehr gebracht oder gar benutzt werden.
Auch in Italien und in Slowenien war es im Frühjahr nach der Aussaat von Mais zu großflächigen Bienensterben gekommen. In Slowenien wurde Clothianidin daher ebenfalls verboten. Auch in abgestorbenen Bienen in Italien wurde Clothianidin nachgewiesen.
Vertreter von BAYER versuchen, das Bienensterben als einmaligen Vorgang darzustellen, der auf einen fehlerhaften Abrieb der Wirkstoffe bei der Aussaat von Mais zurückzuführen sei. Dabei hatte Dr. Richard Schmuck von BAYER CropScience bei einem Expertengespräch des baden-württembergischen Landwirtschaftsministeriums am 8. Mai selbst eingeräumt, dass er auch bei einer ordnungsgemäßen Aussaat von Mais mit einem Abrieb von Clothianidin von 2g/Hektar rechne. (5)
Ein weiteres Problem stellt der im Sommer blühende Mais dar. Es ist zu befürchten, dass die Bienen durch den Clothianidin-haltigen Blütenpollen erneut geschädigt werden.
Studienergebnisse
Vertreter von BAYER argumentieren, „der Wirkstoff sei für Mensch, Tier und Natur völlig ungefährlich, wenn er sachgemäß verwendet werde“. (6) Die Konzentration von Imidacloprid oder Clothianidin sei zu niedrig, um Bienen zu schädigen oder den Tod von Bienen zu verursachen. Diese Aussagen stehen jedoch im Widerspruch zu zahlreichen Untersuchungen:
· Im Auftrag des französischen Landwirtschaftsministerium erstellte das Comité Scientifique et Technique (CST) gemeinsam mit den Universitäten Caen und Metz sowie dem Institut Pasteur einen 108-seitigen Untersuchungsbericht zum Bienensterben in Frankreich. Darin wird festgestellt, dass die Verwendung von Imidacloprid für den Tod Hunderttausender Bienenvölker mitverantwortlich ist. So heißt es in der Zusammenfassung der Studie: „Die Untersuchungsergebnisse zu den Risiken des Saatgutbehandlungsmittels Gaucho (Wirkstoff: Imidacloprid) sind beunruhigend. In Bezug auf Bienensterblichkeit und Orientierungsstörungen von Bienen stimmen die Ergebnisse der Studie mit den Beobachtungen zahlreicher Imker in Regionen intensiver Landwirtschaft (Mais- und Sonnenblumenanbau) überein. Die Saatgutbehandlung mit Gaucho stellt ein signifikantes Risiko für Bienen in verschiedenen Altersstufen dar.“ Und weiter: „Was die Behandlung von Mais-Saat mit Gaucho betrifft, so sind die Ergebnisse ebenso besorgniserregend wie bei Sonnenblumen. Der Verzehr von belasteten Pollen kann zu einer erhöhten Sterblichkeit von Pflegebienen führen, wodurch das anhaltende Bienensterben auch nach dem Verbot der Anwendung auf Sonnenblumen erklärt werden kann“ (7).
· Labor-Untersuchungen aus Frankreich belegen die schädigende Wirkung selbst geringster Dosen Imidacloprid auf Orientierungs- und Geruchssinn der Bienen. Selbst wenn eine Vergiftung nicht unmittelbar tödlich wirkt, können die Bienen derart geschädigt werden, dass sie nicht mehr zu ihrem Stock zurückfinden und den Fundort von Nektar nicht an andere Bienen weitergeben können. Französische Wissenschaftler bemängeln, dass die Empfindlichkeit von Bienen gegenüber Imidacloprid wesentlich (ca. 100 Mal) höher ist, als in deutschen Publikationen dargestellt wurde. Die in Deutschland vorgenommenen Untersuchungen wurden überwiegend von BAYER durchgeführt oder finanziert. (8)
· Untersuchungen fanden Spuren des Wirkstoffs in über 20% der untersuchten Blütenstaubproben - selbst in Pflanzen, die nicht behandelt worden waren und das Pestizid über den Boden aufgenommen hatten. Wurde Mais-Saatgut mit Imidacloprid behandelt, fand sich später in der Pflanze eine Pestizid-Konzentration von 5-12 ppb (parts per billion). Konzentrationen dieser Höhe können bei Bienen zu Orientierungs-Störungen führen.
· Im Jahr 2002 startete das Bieneninstitut Österreich gemeinsam mit dem Bieneninstitut Celle, der Biologischen Bundesanstalt (BBA) und der Firma BAYER einen Feldversuch. Zu Beginn der Rapsblüte wurden 10 Bienenvölker neben 60 Hektar Imidacloprid-gebeiztem Raps aufgestellt. 10 weitere Völker standen in 15 km Entfernung von 40 Hektar ungebeiztem Raps. Es wurde festgestellt, dass in den Imidacloprid-behandelten Feldern kein Rapspollen gesammelt wurde, bei den nicht-gebeizten Feldern hingegen in großem Ausmaß. Die Auswertung des Versuchs zeigte, dass es bei den Bienen unter Einfluss von Imidacloprid zu Orientierungsproblemen kam. Bienen, die mit einem gewissen Imidacloprid-Level belastet waren, waren nicht mehr im Stande, aus 500 m Entfernung in ihr Bienenvolk zurückzufinden. (9)
· Kanadische Studien zeigen, dass der Einsatz von Imidacloprid zu einer bedenklichen Grundwasserbelastung führt. (10) Im US-Bundesstaat New York wurde Clothianidin keine Zulassung erteilt, da eine Verunreinigung des Grundwassers durch das langlebige Pestizid befürchtet wird. (11)
Es besteht der dringende Verdacht, dass die verantwortlichen Manager der BAYER AG beim Verkauf giftiger Saatgutbeizmittel die Verluste an Bienenvölkern und den damit verbundenen wirtschaftlichen Schaden in Kauf genommen haben. Neben dem wirtschaftlichen Schaden liegt ein schwerer Fall von Umweltgefährdung vor. Die von BAYER bei den Zulassungsbehörden eingereichten Studien wurden offenbar derart angelegt, die Bienengefährlichkeit von Neonicotinoiden möglichst gering erscheinen zu lassen und Pestizid-Rückstände in gebeizten Pflanzen zu verharmlosen.
Anmerkungen
1 Siehe: http:www.cbgnetwork.org/2533.html
2 Siehe: http:www.pmra-arla.gc.ca/english/pdf/reg/reg2004-06-e.pdf
3 Clothianidin ist zwar in Frankreich nicht zugelassen, wurde aber von elsässischen Landwirten verwendet, die den Wirkstoff in Deutschland gekauft hatten
4 Presse Information des JKI: www.jki.bund.de/cln_045/nn_806762/DE/pressestelle/Presseinfos/2008/1006__AnalyseBienenschaeden.html
5 Die von BAYER empfohlene Menge beträgt 60g Clothianidin pro Hektar (http:xmedia.bayercropscience.de/pdf/200806171807173080799.PDF)
6 Siehe Artikel in der „Rheinischen Post“ http:www.rp-online.de/public/article/leverkusen/575425/BAYER-zahlt-wegen-Bienentod.html
7 Siehe den vollständigen Bericht unter http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/rapportfin.pdf
8 Siehe: Gesprächsprotokoll deutscher und französischer Bieneninstitute zum Thema „Imidacloprid und Bienenschutz“ in Straßburg am 28.01. 2004
9 „Pestizid-Problematik: Schadet Imidacloprid den Bienen?“ aus Schweizer Bienenzeitung 12/2003
10 CONTAMINATION DE L‚EAU SOUTERRAINE PAR LES PESTICIDES ET LES NITRATES DANS LES RÉGIONS EN CULTURE DE POMMES DE TERRE, Ministère de l‘Environnement, Gouvernement du Québec, 2003
11 Siehe EPA review „EFED Risk Assessment for the Seed Treatment of Clothianidin 600 FS on Corn and Canola“, February 20, 2003
Kurzmeldungen Ticker
AKTION & KRITIK
Pipeline-Demo in Erkrath
Der Protest gegen BAYERs umstrittene Kohlenmonoxid-Leitung reißt nicht ab. An zahlreichen Bauabschnitten halten die CO-GegnerInnen Mahnwachen ab, und am 13. März 2008 demonstrierten in Erkrath 500 Menschen gegen das Projekt. Der Protestmarsch, an dem LokalpolitikerInnen aller Parteien, Angehörige verschiedener Initiativen und natürlich auch VertreterInnen der COORDINATION gegen BAYER-Gefahren teilnahmen, führte von der Erkrather Innenstadt bis zur Pipeline-Baustelle, wo die TeilnehmerInnen 420 Holzkreuze mit Grablichtern aufstellten, um so auf die tödliche Gefahr durch den Röhren-Verbund aufmerksam zu machen.
CBG bei Pipeline-Veranstaltung
Ende Februar nahm CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes auf Einladung der DÜSSELDORFER BÜRGERINITIATIVE GEGEN DIE BAYER-GIFTGAS-LEITUNG gemeinsam mit VertreterInnen von anderen Gruppen und Parteien in Düsseldorf-Unterbach an einer Diskussionsveranstaltung zur umstrittenen BAYER-Pipeline teil.
Romy Quijano freigesprochen
Dr. Romy Quijano untersuchte in Kamukhaan auf den Philippinen die Risiken und Nebenwirkungen der auf einer Bananen-Plantage ausgebrachten Pestizide von BAYER und anderen Herstellern. Der Bananenbaron vom Unternehmen LADECO wollte den Wissenschaftler daraufhin mundtot machen und verklagte Quijano. Dabei schreckte der Plantagen-Besitzer nicht einmal davor zurück, DorfbewohnerInnen mit Bestechungsgeldern zu Aussagen gegen Romy Quijano zu veranlassen; es kam sogar zu Todesdrohungen. Im Jahr 2008 endete die juristische Auseinandersetzung nach sieben Jahren endlich mit einem Freispruch. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN, die sich seit Jahren an einer Solidaritätskampagne für den Umweltschützer beteiligt, gratulierte Romy Quijano umgehend zu seinem Erfolg.
Ter Meer ohne Grabschmuck
Alle Jahre wieder zu Allerheiligen schmückt BAYER das Grab des ehemaligen IG-FARBEN-Vorstandsmitglieds und Kriegsverbrechers Fritz ter Meer mit einem großen Kranz. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN protestiert seit Jahren gegen die Ehrung eines Mannes, den die Richter im Nürnberger IG-FARBEN-Prozess wegen seiner Verantwortung für Zwangsarbeit und Plünderungen zu sieben Jahren Haft verurteilt hatten. Das hat jetzt offensichtlich Wirkung gezeigt: Im letzten Jahr verzichtete der Leverkusener Multi zum ersten Mal auf diese Art der Traditonspflege.
CBG schreibt Gabriel
Das Bundesumweltamt unterhält zwar ein Störfall-Register, aber nähere Angaben zu den Betreibern der explosiven Anlagen finden sich darin nicht. Dieses kritisierte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) in einem Brief an Bundesumweltminister Sigmar Gabriel. „Mit dieser Art der Anonymisierung sind wir in keinster Weise einverstanden! Sie begünstigt in unangemessener Weise die Verursacher von Schäden gegenüber der Öffentlichkeit und den Betroffenen. Da die Unternehmen von sich aus kaum oder gar nicht über Unfälle berichten, haben Medien und Umweltverbände keine Möglichkeit, eine Störfall-Bilanz einzelner Firmen zu erstellen. Hierdurch könnte Druck auf die Unternehmen ausgeübt werden, ihre Sicherheitslage zu verbessern“, schrieb die CBG.
Genreis: CBG schreibt Bundesregierung
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN, das GEN-ETHISCHE NETZWERK, der BUND und andere Initiativen haben die Bundesregierung in einem Offenen Brief aufgefordert, sich auf EU-Ebene gegen eine Importzulassung von BAYERs Genreis auszusprechen, der - obwohl noch gar nicht zugelassen - im Jahr 2006 aus ungeklärter Ursache massenhaft in Haushaltsreis von ALDI und anderen Anbietern gelangt war. „Für über 2,5 Milliarden Menschen ist Reis das wichtigste Grundnahrungsmittel. Die Europäische Union darf sich nicht über die ökologischen und sozialen Risiken von LL RICE 62 in den potentiellen Anbau-Ländern hinwegsetzen. Wir fordern Sie auf, sich bei der EU gegen eine Import-Zulassung von LIBERTY LINK-Reis auszusprechen!“, heißt es in dem Schreiben wörtlich.
Kartelle: CBG schreibt Zypries
In Sachen „Kartelle“ entwickelt BAYER sich immer mehr zum Serientäter. Allein in den letzten Jahren haben die Behörden elf Fälle von illegalen Preisabsprachen entdeckt. Die hohen Bußgelder - der Konzern zahlte bislang ca. 500 Millionen Dollar - schrecken den Leverkusener Multi offenbar nicht ab. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) forderte Bundesjustiziministerin Brigitte Zypries deshalb in einem Offenen Brief auf, die ManagerInnen-Haftung einzuführen. „Es stellt unserer Meinung nach eine gesetzgeberische Fehlleistung ersten Ranges dar, dass Verstöße gegen Kartellvorschriften nur mit Bußgeldern und evtl. zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen belegt sind, nicht hingegen mit Strafen. Angesichts der Gemeinschädlichkeit derartiger Absprachen und des dadurch verursachten enormen Schadens stimmt es merkwürdig, dass nicht einmal in schweren Fällen Straftaten vorliegen. Wir fordern daher den Gesetzgeber auf, entsprechende Straftatbestände zu schaffen. Erst wenn die verantwortlichen Manager Gefängnisstrafen fürchten müssen, kann von einem abschreckenden Effekt ausgegangen werden“, stellt die CBG fest.
BAYER für „Public Eye Award“ nominiert
Alljährlich halten die Global Player im schweizerischen Davos ihr Klassentreffen ab. Die Schweizer Initiativen ERKLÄRUNG VON BERN und PRO NATURE nutzen die Gelegenheit, um als Spielverderber dem Unternehmen mit den fragwürdigsten Geschäftspraktiken den „Public Eye Award“ zu verleihen. Zu den Vorgeschlagenen zählte auch dieses Mal wieder: BAYER. Das FORUM FÜR UMWELT UND ENTWICKLUNG, das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK und die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN nominierten den Leverkusener Multi für seine Versuche, die Jatropha-Pflanze als Biotreibstoff-Reservoir zu nutzen und dazu auch gleich noch das passende Saatgut und die passenden Pestizide zu liefern. „Das Saatgut und die Pflanzenschutzmittel für Jatropha sollen die Pflanze für den Chemiekonzern und die Automobilindustrie profitabel machen. Verlierer sind einmal mehr die Bauern der südlichen Länder. Sie verlieren wertvolles, zur Nahrungsproduktion genutztes Land und tragen die Umweltbelastungen durch den intensiven Agrotreibstoff-Anbau. Zudem werden die Kleinbauern im Vertragsanbau abhängig gemacht von den teuren Agrochemie-Produkten“, heißt es in der Begründung der Gruppen.
CBG-Mitglied wg. Feldbesetzung verurteilt
Ein in Frankreich lebendes Mitglied der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hat an der Besetzung eines Genfeldes teilgenommen und kam dafür vor Gericht. Die Richterin verurteilte es zu einer Strafe von 1.000 Euro.
Prozess wg. Feldbesetzung
Im letzten Frühjahr führten Gentech-GegnerInnen die Besetzung eines Feldes durch, auf dem die Universität Gießen zu Versuchszwecken Gerste mit einer eingebauten Resistenz gegen Glufosinat ausgesät hatte, mit welcher BAYER auch die Pflanzen aus der LIBERTY-LINK-Serie versehen hat. Seit März 2008 haben sich die AktivistInnen dafür vor Gericht zu verantworten.
CBG bei „Dritte-Welt“-Diskussion
Philipp Mimkes nahm für die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) in Köln an einer Diskussionsveranstaltung zum Thema „Umweltschutz - Menschenrechte - soziale Standards: Wie sieht es aus mit der Unternehmensverantwortung?“ teil, die das DRITTE WELT JOURNALISTINNEN NETZ gemeinsam mit der Kölner MELANCHTON AKADEMIE initiiert hatte. Der CBG-Geschäftsführer sah, so weit es BAYER betrifft, schwarz für die Unternehmensverantwortung und zählte dem Publikum detailliert die doppelten Standards auf, deren sich der Leverkusener Chemie-Multi in Sachen Umweltschutz, Kinderarbeit, Produktionsbedingungen und Produktsicherheit befleißigt.
OECD kritisiert bundesdeutsche Justiz
Nach menschlichem Ermessen müsste der Exportweltmeister eigentlich auch Weltmeister im Bezahlen von Schmiergeldern sein. Und tatsächlich stützt nicht nur der Fall „SIEMENS“ diese Vermutungen. Auch BAYER hat nach Angaben eines ehemaligen Mitarbeiters im Iran und in Italien kräftig Bestechungsgelder gezahlt, um Bau-Vorhaben realisieren oder andere Konzern-Ziele durchsetzen zu können (siehe auch Ticker 2/03). Die bundesdeutschen Gerichte bleiben jedoch weitgehend untätig. Während US-RichterInnen seit 1998 70 Unternehmen wg. Korruption verurteilten, verhängten ihre deutschen KollegInnen nur vier Strafen. Diese Praxis hat jetzt die OECD, die gemeinsame Organisation der 30 größten Industrieländer, kritisiert. „Es gibt eine ganze Reihe von Fällen, die von den Staatsanwaltschaften nicht besonders aktiv verfolgt werden“, so der OECD-Korruptionsbeauftragte Mark Pieth. Der deutsche Richterbund wies die Vorwürfe umgehend zurück, räumte aber Mängel ein. „In den Wirtschaftsabteilungen der Staatsanwaltschaften haben wir generell ein großes Problem. Eigentlich bräuchten wir viel mehr Spezialisten“, gestand Richterbund-Präsident Christoph Frank.
Spärliche Auskünfte
Die OECD ist ein Zusammenschluss der weltweit größten Industriestaaten. Ihre Leitsätze verpflichten die Multis zu gesellschaftlich verantwortlichem Handeln. GERMAN WATCH wollte von den Global Playern jetzt einmal wissen, wie sie diese Anforderungen konkret umsetzen. BAYER zeigte sich dabei nicht sehr auskunftsfreudig. „Während einige der Unternehmen ausführliche Informationen zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie machten, gaben andere keine oder nur sehr unvollständige Antworten ab, z. B. BAYER und VOLKSWAGEN“, erklärte die Initiative.
IQWIG-Chef Sawicki droht
Das „Kölner Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWiG) führt Kosten/Nutzen-Analysen von Arzneimitteln durch, was eine Streichung von Medikamenten aus dem Erstattungskatalog der Krankenkassen zur Folge haben kann. Entsprechend nervös reagiert die Pharma-Industrie. Auf allen erdenklichen Wegen versucht sie, bei den Prüfungen ein Wörtchen mitzureden. Diese Bestrebungen haben den IQWIG-Leiter Peter Sawicki jetzt dazu gebracht, im Falle eines gesteigerten Einflusses von BAYER & Co. auf die Entscheidungen des Instituts seinen Rücktritt anzukündigen. „Wenn das geschehen sollte, bin ich nicht mehr da, wo ich jetzt bin“, sagte der Pharmakologe, woraufhin ihm Gesundheitsministerin Ulla Schmidt versprach, die „fürsorgliche Belagerung“ nicht zuzulassen.
Kritik an Gates-Stiftung
Nach dem Vorbild von MICROSOFT hat Bill Gates der von ihm gegründeten „Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung“, die auch Projekte von BAYER unterstützt (siehe ERSTE & DRITTE WELT) eine Monopolstellung bei der Malaria-Forschung verschafft. Daran nahm jetzt der Leiter des Malaria-Programms der Weltgesundheitsorganisation WHO, Arata Kochi, Anstoß. Er kritisierte die Dominanz der keiner öffentlichen Kontrolle unterworfenen Stiftung, die inzwischen alle maßgeblichen WissenschaftlerInnen an sich binde, und bezeichnete ihre bei der Malaria-Therapie eingeschlagenen Wege sogar als teilweise gefährlich.
KAPITAL & ARBEIT
Nur 1,3 Prozent über 60 Jahre
Von den 37.590 Beschäftigten der BAYER AG sind gerade einmal 1,3 Prozent über 60 Jahre alt.
Nur 905 Ausbildungsplätze
Die Zahl der Ausbildungsplätze bei BAYER ist in den letzten 17 Jahren um 700 zurückgegangen. Gab es 1990 in den Werken der BAYER AG noch 1.600 Lehrstellen, so strich sie der Konzern bis zum Herbst 2007 auf 905 zusammen. Nicht einmal der Kauf der SCHERING AG hat das Angebot nennenswert erweitert. Wieder einmal liegt der Multi damit unter der durchschnittlichen Lehrstellen-Quote der bundesdeutschen Wirtschaft von sieben Prozent der Belegschaft.
Wennings Tarifrunde: + 28,1 %
Für BAYER-Chef Werner Wenning hat sich die letzte Lohnrunde gelohnt. Er konnte sein Salär um 28,1 Prozent auf 4,444 Millionen Euro steigern. Das Sümmchen setzt sich aus einem „Grundgehalt“ von 3,294 Millionen und einer variablen, am Aktienkurs orientierten Komponente von 1,1 Millionen zusammen. „Die Manager sollten ihren Mitarbeitern einmal erklären, warum sie soviel Geld brauchen“, kommentierte der SPD-Politiker Joachim Poß die von der Welt am Sonntag vorgelegten Lohnstreifen von Wenning & Co.. Der Große Vorsitzende hat das in einem Interview mit der Wirtschaftswoche getan. Seiner Ansicht nach geht beim Leverkusener Chemie-Multi alles gerecht zu, nur Tätigkeit, Qualifikation, Erfahrung und Verantwortung entscheiden über die Bezahlung. „Dabei messen wir beim Top-Management wie bei den Tarif-Mitarbeitern mit der gleichen Elle“, so Wenning.
Betriebsräte verdienen 60.000 Euro
Die VW-Affäre hat die Frage aufkommen lassen, ob den Betriebsräten im Lande nicht eine allzu üppige Bezahlung das „Co-Management“ erleichtert. BAYER veröffentlichte deshalb Zahlen und bezifferte das Durchschnittsgehalt eines Konzern-Betriebsrats auf 60.000 Euro.
Brunsbüttel streicht 100 Stellen
BAYER heizt den konzern-internen Wettbewerb um Investitionen immer mehr an. Mit dem Projekt „Mustang“ verglich der Multi jetzt das Verhältnis von Anlagen-Kapazität und Personalstamm an jedem Standort und vergab schlechte Noten für Brunsbüttel. „Wir sind 15 - 20 Prozent schlechter in der Personaleffizienz“, mit diesen Worten akzeptierte der dortige Betriebsratsvorsitzende Hans-Joachim Möller die negative Beurteilung ohne Widerworte, die ein Rationalisierungsprogramm mit einer Vernichtung von 100 Arbeitsplätzen zur Folge hat. Möller wusste sich darin mit der Werksleitung einig. „Nur so können wir im Wettbewerb um eine neue Anlage mithalten“, verlautete aus der Zentrale der Niederlassung.
ERSTE & DRITTE WELT
Bill Gates sponsort BAYER
Im Jahr 1998 startete die Weltgesundheitsorganisation WHO in Kooperation mit der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung die Malaria-Initiative „Roll back Malaria“. Sie wollte 60 Prozent der Erkrankten sofort eine medizinische Versorgung ermöglichen und die Zahl der Malaria-Toten bis zum Jahr 2010 auf die Hälfte senken. Zu diesem Zweck unterstützte die Initiative auch das BAYER-Projekt, auf Basis des von der „Hongkong University of Science and Technology“ entdeckten Wirkstoffes Artemisone ein neues Medikament zu entwickeln. Um dieses Präparat ist es allerdings still geworden, und auch von anderen Erfolgen kann „Roll back Malaria“ kaum künden, so dass die medizinische Fachzeitschrift Lancet im Jahr 2005 eine ernüchterne Zwischenbilanz zog. Bill Gates glaubt aber immer noch an BAYER. Er stellte dem Leverkusener Multi 50,7 Millionen Dollar zur Verfügung, um mit dem Kooperationspartner „Innovative Vector Control Consortium“ nach einem neuen Pestizid gegen den Malaria-Erreger zu forschen und schon vorhandene Wirkstoffe zu verändern, da die Stechmücke als Überträger der Krankheit gegen die alten Substanzen Resistenzen herausgebildet hat.
Pesticides are coming home
In den vergangenen Jahrzehnten haben die Agro-Multis - gefördert von „Entwicklungshilfe“-Programmen - „Drittweltländer“ großzügig mit Ackergiften versorgt. Die Folge: Nach Schätzungen der Welternährungsorganisation der UN lagern dort über eine halbe Millionen Tonnen Alt-Pestizide, schlecht gesichert in lecken Behältern, zerrissenen Tüten und geplatzten Säcken. Altlasten made by BAYER sind nach GREENPEACE-Angaben in rund 20 Ländern vertreten. Ob die 75 Tonnen DDT aus Tansania, die der Konzern jetzt auf Kosten des Entwicklungshilfeministeriums in Dormagen verbrennen will, ganz, teilweise oder gar nicht aus eigenen Beständen stammen, ist hingegen nicht bekannt.
KONZERN & VERGANGENHEIT
VCI: Geschichtsaufarbeitung nicht erwünscht
Die bundesdeutsche Chemiebranche hat sich ihrer unheilvollen Vergangenheit immer noch nicht gestellt. Fragen nach den IG FARBEN, dem für Zwangsarbeit, eigene KZs und Kriegsvorbereitungen verantwortlichen Mörderkonzern, wiesen BAYER als IG-Initiator, BASF und HOECHST & Co. stets mit dem Verweis ab, sie hätten die Rechtsnachfolge des Chemie-Trusts nicht angetreten. Nur die BASF hat sich bisher diesem dunklen Kapitel in einer Unternehmensgeschichte gewidmet. Ob allerdings eine lückenlose Aufklärung erfolgte, steht in Frage, denn es halten sich Gerüchte über zurückgehaltene Dokumente und Knebelverträge die Veröffentlichungsrechte betreffend. Der „Verband der Chemischen Industrie“ erwog zwar einmal, den Historiker Michael Stürmer mit einer Aufarbeitung seiner Vergangenheit zu betrauen, aber die Verantwortlichen stoppten das Projekt. Und BAYER? Der Leverkusener Multi hat noch nicht einmal im Traum daran gedacht, einen Wissenschaftler zur Inventur seines Giftschrankes im Firmenarchiv zu verpflichten.
POLITIK & EINFLUSS
Der Leverkusener BAYER-Rat
Die partei-übergreifende BAYER-Fraktion im Leverkusener Stadtrat hat viele Mitglieder. Zahlreiche KommunalpolitikerInnen standen oder stehen noch in Diensten des Pharma-Riesen. Bei den Christdemokraten sind es Bernhard Apel (bis zu einer Pensionierung Diplom-Ingenieur bei BAYER und Betriebsleiter bei AGFA), der von 1957 bis 1999 bei AGFA als Chemie-Facharbeiter und Technischer Angestellter tätig gewesene Raimund Gietzen, der ehemalige BAYER-Industriekaufmann Dietrich (Dieter) Volberg und Ulrich Wokulat (Kaufmännischer Angestellter bis 1999). Die Sozialdemokraten zählen auf den als Industriemeister beim ehemals zu BAYER gehörenden Unternehmen DYSTAR arbeitenden Ferdinand Feller, den bei BAYERs Logistik-Ableger CHEMION unter Vertrag stehenden Wolfgang Oertel, den seine berufliche Karriere bei BAYER als Hochdruckrohr-Schlosser begonnen und bei der 2002 verkauften Wohnungsgesellschaft des Konzerns fortgesetzt habenden Dieter März sowie den seit 2006 im Ruhestand lebenden BAYER-Dreher Gerhard (Paul) Masurowski. Die Bürgerliste bietet den als Physiklaborant und Technischer Angestellter in BAYER-Diensten gestanden habenden Klaus-Peter Gehrtz und den CHEMION-Werker Stefan Manglitz auf. Die Grünen sind durch Georg Müller, der als Technischer Angestellter bei dem früher zu BAYER gehörenden Unternehmen LANXESS arbeitet, und Gerd (Gerhard) Wölwer, der von 1969 bis 1972 seine Lehre zum Chemielaboranten bei BAYER absolvierte, vertreten. Für die FDP sitzen der bis zu seinem Renteneintritt 2006 auf 40 Jahre BAYER-Erfahrung als Planungsingenieur, Organisationsberater, Betriebsleiter „Logistik“ und Vertragsmanager zurückblicken könnende Wolfgang Blümel und der einst in BAYERs Monheimer Pestizid-Produktion wirkende Chemiker Dr. Klaus Naumann im Stadtrat. Die Unabhängige Wählergruppe (UWG) schließlich schickte den CHEMION-Mann Reimund Vozelj in das Kommunalparlament. Bei dieser geballten Ladung BAYER hat der Chemie-Multi an seinem Stammsitz kaum noch politische Unbill zu befürchten.
Wenning wettert
BAYER-Chef Werner Wenning nutzte seine Abschiedsrede als Vorsitzender des „Verbandes der Chemischen Industrie“, um der Großen Koalition Hausaufgaben aufzugeben. So mahnte er weitere „Reformen“ an. „Was heute politisch opportun erscheint, darf nicht ausschlaggebend sein, wenn es um unsere Zukunft geht“, mahnte er. Auch ein bisschen weniger Klimaschutz hätte Wenning gern: „Bei allem Engagement für den Klimaschutz, den wir mit der Bundesregierung teilen, muss die Politik auch darauf achten, die Leistungsfähigkeit der Industrie nicht zu überfordern“. Im Bereich „Gentechnik“ hingegen sieht er die Seinen deutlich unterfordert. „Es wird höchste Zeit, dass die Bedingungen für die Forschung und den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen auch hier in Deutschland endlich verbessert werden“, forderte der Konzern-Lenker.
Wenning in Davos
Die alljährliche Hauptversammlung der Global Player im schweizerischen Davos gibt sich gerne einen idealistischen Anstrich. BAYER-Chef Werner Wenning strich da kräftig mit. Die Konferenzen, „die sich mit übergeordneten, uns alle betreffenden Fragestellungen befassen, wie zum Beispiel Klimaschutz“, machten für ihn den eigentlichen Wert des Forums aus. Wie materialistisch es aber in Wirklichkeit hinter diesen für die Weltöffentlichkeit aufgebauten Kulissen zuging, beschrieb der Filmregisseur Florian von Henckel Donnersmarck in einem Spiegel-online-Interview. Wer kaum mehr als fünf Milliarden Dollar Umsatz macht, gilt bei dem Klassentreffen nämlich schon als Unterschicht, welche die „feinen Unterschiede“ zu spüren bekommt. „Unternehmer zum Beispiel, die nur fünf Milliarden Dollar Umsatz machen und sich damit gerade mal für das Forum qualifizieren, werden weniger respektvoll behandelt, als solche, die sieben oder neun Milliarden machen“, so der Oscar-Preisträger.
Bund beschließt Gentechnik-Gesetz
Ende Januar 2008 hat der Bundestag das neue Gentechnik-Gesetz verabschiedet, das laut CDU/CSU die „Blockade“ bei der grünen Gentechnik beendet. Das Paragraphen-Werk legt mit 150 Meter Mindestabstände zwischen Genmais-Feldern und konventionell bzw. ökologisch bewirtschafteten Äckern fest, die teilweise weit unter denen in vielen anderen europäischen Ländern festgelegten bleiben. Zudem macht der Gesetzgeber diese zur Verhandlungssache, indem er Privatabsprachen zwischen Nachbarn zulässt. Auch die Haftungsbestimmungen sind völlig unzureichend, da das Verursacherprinzip nicht gilt und bestimmte Berufsgruppen wie ImkerInnen gar nicht erfasst sind. Zudem legt die neue Regelung eine äußerst knapp bemessene Einspruchsfrist fest. So kritisiert der BUND ÖKOLOGISCHER LEBENSMITTELWIRTSCHAFT (BÖWL) denn auch, dass „ein Großteil der zu erwartenden Schadensfälle durch die im Gesetz vorgesehene Haftung nicht abgedeckt“ ist. Nur bei der Etikettierung hat sich die Große Koalition zu einer Verschärfung durchgerungen. Wo „ohne Gentechnik“ drauf steht, darf jetzt kein 0,9-prozentiger Anteil von Futtermitteln aus Gentech-Produktion mehr drin sein. Dafür dürfen sich jetzt Medikamente und Vitamine, die GenköchInnen angerührt haben, unter dem Label wohlfühlen, wogegen prompt der „Hauptverband des deutschen Einzelhandels“ protestierte.
PROPAGANDA & MEDIEN
BAYER sponsort Pestizid-Symposion
Im Oktober 2007 hat der Leverkusener Multi ein internationales Symposion zum Thema „Grauschimmelfäule“ gesponsort, das im südafrikanischen Kapstadt stattfand. Veranstaltet vom zur Universität Stellenbosch gehörenden Institut für Wein-Biotechnologie, diente das Ganze laut Konzern als „Schaufenster für die neuesten Forschungsergebnisse“. Allerdings ließ die ausgestellte Produktvielfalt zu wünschen übrig: In der Auslage fanden sich nur BAYERs Antipilz-Wirkstoffe Fenhexamid und Pyrimethanil.
BAYER hetzt gegen die CBG
Ende August 2007 wollte BAYER als Ausrichter einer Konferenz der UN-Umweltbehörde UNEP, an der 150 junge UmweltschützerInnen aus aller Welt teilnahmen, weiter an seinem grünen Image feilen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) protestierte gegen die Alibi-Veranstaltung und präsentierte der Öffentlichkeit das Umweltsündenregister des Konzerns, was auf breite Resonanz stieß. So interviewte ein ungarischer Journalist CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes und konfrontierte den Leverkusener Multi anschließend mit den von der Coordination erhobenen Vorwürfen. In dem Antwortschreiben weist das Unternehmen die Kritik wie erwartet zurück. Man habe niemals Lobby-Aktivitäten gegen politische Vorhaben entfaltet und bemühe sich stets nach Kräften, „faire und effektive politische Rahmenbedingungen, welche den Wettbewerb nicht behindern“ zu erreichen, behauptet der Leverkusener Multi. Die CBG bezichtigt der Konzern hingegen einmal mehr, mit Halbwahrheiten und Falschinformationen zu operieren. Darüber hinaus bezeichnet das Unternehmen diese als Gruppe „einer extremen ideologischen Richtung“ - und auch diesmal fehlt der Verweis auf einen „teilweise kommunistischen Hintergrund“ nicht.
BAYERs Freund der Baum
Durch die Kooperation mit der UN-Umweltbehörde UNEP versucht sich BAYER ein grünes Image zu verleihen. So richtete der Pharma-Riese Ende August 2007 eine Konferenz in Leverkusen mit 150 jungen UmweltschützerInnen aus aller Welt aus. Neuester Greenwashing-Coup: Der Konzern pflanzt im Rahmen eines UNEP-Aufforstungsprogramms 300.000 Bäume, was angeblich den Kohlendioxid-Gehalt in der Luft um 7.500 Tonnen reduziert. Um allerdings das CO2 um einen solchen Wert zu senken, wie ihn die vom Unternehmen geplanten Kohlekraftwerke erhöhen, müsste er schon Milliarden von Bäumen aufbieten.
Lobby-Verband aufgeflogen
Seit Jahren versuchen BAYER & Co., das Reklame-Verbot für Arzneien aufzuheben, indem sie Werbung zu „Information“ umwidmen. Dabei bedienten sie sich auch der Mithilfe des Verbandes „Pro Patienteninformation“. Das Ziel der „Abschaffung des Informationsverbotes für verschreibungspflichtige Arzneimittel“ verfolgend, gab die Organisation vor, 55.000 PatientInnen sowie die Selbsthilfegruppen der Parkinson-, Osteoporose- und Morbus-Bechterew-Erkrankten zu vertreten. Diese wussten allerdings gar nichts von ihrem Glück. Das „IPAS Institut politische Analysen und Strategie“ hatte sie kurzerhand zu StatistInnen in seiner von der Pharma-Industrie finanzierten Lobby-Kampagne gemacht. Doch der Schwindel flog auf. Der „Deutsche Rat für Public Relations“ (DRPR) erteilte Jan Burdinski als Initiator der „allem Anschein nach virtuelle Koalition Pro-Patienteninformation“ eine Rüge. „Die Nichttransparenz sei als vorsätzlich und der Verstoß als schwerwiegend zu bewerten“, urteilte der DRPR.
Selbsthilfe zur BAYER-Hilfe
Die Unterstützung von Selbsthilfegruppen stellt für die Pillenriesen eine lohnende Investition dar. „Wenn Firmen zehn Prozent mehr in Selbsthilfegruppen investieren, wächst ihr Umsatz um ein Prozent im Jahr. Wenn sie zehn Prozent mehr in das Marketing bei Ärzten investieren, wächst ihr Umsatz nur zwischen 0,2 und 0,3 Prozent“, hat der als Gesundheitsökonom an der Universität Bremen lehrende Gerd Glaeske errechnet. Darum unterstützt der Leverkusener Multi Verbände wie die „Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft, die „International Diabetes Federation“, die „National Coalition for Cancer Survivorship“, die „Juvenile Diabetes Research Foundation“, die „National Hemophilia Foundation“ und die „American Heart Association“ finanziell. Darüber hinaus betrieb BAYER bis 2005 die Homepage „www.selbsthilfegruppen.de“. Um die Gruppen vor dem Ruch der Käuflichkeit zu bewahren, gab der Konzern die Pflege der Seite inzwischen an eine Leverkusener Agentur ab. Das Geld dürfte aber immer noch aus der Portokasse des Pharma-Riesen kommen.
100.000 Dollar für Bluterverband
Dem US-amerikanischen Bluterverband „National Hemophilia Foundation“ (s. o.) ist BAYER besonders gewogen, gilt es doch, vergessen zu machen, dass in den 90er Jahren Tausende Bluter an „HIV“-verseuchten Blutprodukten des Konzerns starben, weil das Unternehmen sein Präparat KOGENATE aus Kostengründen keiner Hitze-Behandlung unterzog. So überreichte der Multi der Organisation im Februar 2008 einen Scheck über 100.000 Dollar für ein Programm zur Förderung des Verbandsnachwuchses.
BAYERs DiabetikerInnen
- I
„Hilfe zur Selbsthilfe“ (s. o.) betreibt BAYER auf dem Feld „Diabetes“ besonders intensiv. So hat er mit der „International Diabetes Federation“ (IDF) die Kampagne „Unite for Diabetes“ ins Leben gerufen. Der IDF zeigte sich dankbar und nahm die Blutzucker-Selbstkontrolle in ihren Richtlinien-Katalog zur Diabetes-Therapie auf, was den Abverkauf von Diabetes-Diagnostika made by BAYER nicht unwesentlich ankurbeln dürfte. Als hilfreich erwies es sich auch, dass das IDF-Vorstandsmitglied Anne Marie Felton gleichzeitig der „Federation of European Nurses in Diabetes“ angehört. So konnte die Organisation sich gleich einmal in Leverkusen zu einem Diabetes-Symposion treffen. Der Pharma-Riese nutzte das, um weiter Netzwerk-Arbeit zu betreiben. Es gelang ihm, Professor Oliver Schnell vom „Institut für Diabetes-Forschung“ der Universität München und Dr. Xavier Cos vom Katalonischen Gesundheitszentrum als Redner zu gewinnen, die selbstredend beide die Bedeutung der Blutzucker-Selbstkontrolle betonten.
BAYERs DiabetikerInnen
- 2
Mit dem gestiegenen Lebensstandard werden in den Schwellenländern auch die Zivilisationskrankheiten zunehmen, spekuliert BAYER und pflegt deshalb in Indien schon einmal die gesundheitspolitische Landschaft. So gehört er gemeinsam mit ELI LILLY und BD zu den Sponsoren eines millionen-schweren Diabetes-Weiterbildungsprogramms für Angestellte des Gesundheitswesens. Damit wollen die Pharma-Riesen die westlichen Behandlungsmethoden in Indien implementieren. Ein wesentlicher Bestandteil dieser „Entwicklungshilfe“ ist es, die PatientInnen zu einem „Selbstmanagement“ ihrer Krankheit anzuleiten, wozu natürlich die entsprechenden Blutzuckermessgeräte von BAYER & Co. unabdingbar sind.
BAYERs DiabetikerInnen
- 3
BAYER gehört zu den Sponsoren des EU-Projektes „Image“, das einheitliche Richtlinien zur Früherkennung und Behandlung von Diabetes entwickeln will.
BAYERs ASPIRIN-Kampagne
Der Leverkusener Multi hat seine Anstrengungen, ASPIRIN als Mittel zur Vorbeugung von Herz/Kreislaufkrankheiten am Markt zu platzieren, noch einmal verstärkt. In den USA gelang es dem Konzern, das „American College of Preventive Medicine“ und die „Partnership für Prevention“ für eine Kampagne einzuspannen. Diese setzt sich zum Ziel, ÄrztInnen und andere AkteurInnen des Gesundheitswesens für die Wirkungen des „Tausendsassas“ zu sensibilisieren, welche längst nicht alle ExpertInnen als segensreich empfinden. So erhöht das Mittel nach einer Studie der Universität Oxford z. B. das Risiko für durch Blutungen im Gehirn ausgelöste Schlaganfälle, da es den Blutfluss anregt (Ticker 3/07).
BAYER startet „Tierarzt-TV“
Der Leverkusener Multi nutzt künftig VeterinärInnen-Praxen als Werbe-Plattform. Der Leverkusener Multi strahlt in Wartezimmern sein „Tierarzt-TV“ aus. Das Magazin bietet alles rund ums Tier - und das entsprechende BAYER-Angebot. „Tierärzte sind von jeher unsere wichtigsten Multiplikatoren. Das von uns kreierte Tierarzt-TV bietet die Möglichkeit, Tierhalter in den Praxen direkt anzusprechen“, erläuterte BAYER-Mann Christian Behm die PR-Strategie.
BAYER schult ApothekerInnen
Die traditionelle bundesdeutsche Pharmazie steht derzeit durch Internet-Apotheken und Forderungen nach Aufhebung des Fusionsverbotes unter Druck. In dieser Situation bietet BAYER „Hilfe“ an. Die vom Leverkusener Multi gegründete „Innovations-Akademie Deutscher Apotheker“ will den Pillen-VerkäuferInnen Marketing-Nachhilfe geben - und als Nebenwirkung natürlich noch besser mit ihnen ins Geschäft kommen.
BAYER wäscht weiter
BAYER setzt die Kooperation mit der Zeitschrift National Geographic Deutschland (NGD) und damit auch die diesbezüglichen Greenwashing-Aktivitäten fort (siehe auch SWB 3/05). Der Konzern unterstützt weiterhin den von dem Magazin initiierten „Global Exploration Fund“, der sich der Ressource „Wasser“ widmet. Das letzte Mal stellte die Publikation dem Unternehmen dafür in einer Wasser-Broschüre vier Seiten zur Eigenwerbung zur Verfügung. Hinzu kamen „lobende Erwähnungen“ in zahlreichen Medien-Veröffentlichungen zum Thema. Damit kann sich der Leverkusener Multi einmal mehr medienwirksam als Schutzpatron des kostbaren Stoffes in Szene setzen, dem er im wirklichen Leben als Einleiter von Chemikalien und Großverbraucher arg zusetzt.
Fonds & Co. macht BAYER-Werbung
Die Zeitschrift Fonds & Co. widmet sich Finanz-Anlagen. Dies ist ein recht trockenes Thema. Deshalb hat sich die Publikation dafür entschieden, eine Artikelreihe zu Private Equity-Investments mit Einblicken in BAYERs Forschungslabors aufzumachen und mit den entsprechenden Fotos auszuschmücken, obwohl der Zusammenhang mehr als vage ist. Das hört sich dann zum Beispiel so an: „Bioscience-Wissenschaftler können nicht genau genug prüfen, bevor sie ein neues Produkt in den Freiversuch entlassen (...) Nicht viel anders als den Forschern von BAYER im Genter Labor ergeht es Zeichnern und Emissionshäusern“. Ein anderes Mal spannt der Autor den Bogen von BAYERs gentechnisch veränderten Baumwollpflanzen, von denen die wenigsten den Sprung vom Labor auf den Acker schaffen, zu den Gepflogenheiten der Finanzbranche. „Die Größe der Population hängt also von der Zahl der Pflänzchen am Start ab. Das Gleiche gilt, wenn man sich einen Eindruck von den Private-Equity-Investments verschaffen will, die am besten performt haben“, heißt es in dem Text. Es wäre schon ein großer Zufall, wenn die Assoziationen der Fonds-JournalistInnen nur aus freien Stücken immer wieder gen Leverkusen strebten ...
Funk Uhr wirbt für LEVITRA
Die Fernsehzeitschrift Funk Uhr macht unverhüllt Werbung für BAYERs LEVITRA und andere Potenzmittel. Dabei schließt sie sich natürlich auch der von den Pharmariesen in Umlauf gebrachten Diagnose an, wonach die Ursache der „erektilen Dysfunktion“ in 80 Prozent der Fälle organischer Natur sei. Die Frage „Was hilft?“ ist dann schnell beantwortet. „VIAGRA, LEVITRA und CALIS helfen medikamentös auf die Sprünge“, heißt es in dem Blatt.
Verkappte Werbung im Internet
In der Bundesrepublik ist es untersagt, für rezeptpflichtige Arzneien zu werben. BAYER & Co. versuchen zurzeit alles, um dieses Verbot aufzuheben. Parallel dazu finden die Multis aber auch jetzt schon Mittel und Wege, ihre Produkte anzupreisen. Wer sich beispielsweise im Internet über Verhütungsmittel informieren will und bei GOOGLE den Begriff „Pille“ eintippt, landet als erstes auf www.pille-mit-herz.de. Nur im Kleingedruckten findet sich der Betreiber der Seite angegeben: die BAYER-Tochter JENAPHARM. Die Webpage gibt vor, allgemein in das Thema einzuführen, stellt die unterschiedlichen Verhütungsmethoden sowie einzelne Pillen-Arten vor. Nur ganz behutsam führt JENAPHARM die SurferInnen auf den „richtigen“ Weg. Mit dem Slogan „Mehr als verhüten - sanft verhüten“ preist die Firma mit Drospirenon den Wirkstoff der haus-eigenen niedrig dosierten Verhütungspillen an. Natürlich fehlt der Hinweis darauf, dass diese Substanz doppelt so oft die Nebenwirkung „Blutgerinnsel“ hat wie Levonorgestrel oder Norethisteron. Darüber hinaus will das Unternehmen seine Präparate als Lifestyle-Medikamente an die Frau bringen. „Die neueste Entwicklung ist, dass deine Pille jetzt sogar einen Beauty-Effekt hat“, verkündet JENAPHARM und verheißt positive Effekte auf Haut und Haar an.
DRUGS & PILLS
Arznei-Test mit Nebenwirkungen
Im Jahr 2005 kam es bei Arznei-Tests mit Parkinson-Kranken, die der nun zu BAYER gehörende Pharma-Multi SCHERING in Kooperation mit dem Unternehmen TITAN in den USA durchführte, zu ernsthaften Zwischenfällen. Die per gehirnchirugischem Eingriff implantierten Zellen zur Dopamin-Produktion verursachten bei den ProbandInnen Verwirrtheitszustände, Depressionen bis zu Selbsttötungsversuchen, Lähmungserscheinungen, Sprachausfälle, epileptische Anfälle, Hirnblutungen, Asthma und andere körperliche oder geistige Beeinträchtigungen. Die dauerhaft geschädigte Suzanne Davenport hat deshalb Klage gegen den Leverkusener Agro-Riesen eingereicht (siehe auch SWB 1/08).
Leberschäden durch ZETIA?
Seit Juni 2007 vermarktet BAYER den Cholesterinsenker ZETIA (Wirkstoff: Ezetimib) gemeinsam mit SCHERING-PLOUGH in Japan. Um die Geschäfte mit dem Milliarden-Seller nicht zu gefährden, hat SCHERING-PLOUGH als Hersteller jahrelang interne Untersuchungsergebnisse über die leberschädigende Wirkung des Präparates geheim gehalten. Nicht einmal die Aussortierung einiger PatientInnen mit besonders hohen Leberwerten konnte das Resultat verbessern. Auf die Frage, warum der Konzern die Öffentlichkeit nicht umgehend informiert habe, antwortete ein Verantwortlicher, man habe die ganze Sache nicht für relevant gehalten. Ebenso irrelevant scheint für das Unternehmen eine ZETIA-Studie zu sein, die im Jahr 2002 begann und noch immer keinen Abschluss gefunden hat. Erst nach erheblichem Druck von Seiten des US-Kongresses erklärte sich der Pharma-Riese bereit, die Daten im März 2008 zu publizieren.
Schlaganfälle durch ASPIRIN
Der Leverkusener Multi bewirbt sein Schmerzmittel ASPIRIN mit dem Wirkstoff Acetylsalicylsäure seit einiger Zeit aggressiv als Mittel zur Prophylaxe von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Dabei erhöht das Mittel das Risiko für Schlaganfälle, die nicht durch einen Gefäßverschluss, sondern durch eine Blutung im Gehirn entstehen, weil der „Tausendsassa“ den Blutfluss im Kopf anregt (Ticker 3/07). Eine neue, in der Fachzeitschrift Lancet (Band 370, S. 493) veröffentlichte Studie hat jetzt auch seine Unterlegenheit gegenüber dem Gerinnungshemmer Warfarin beim Schutz älterer Menschen mit Vorhofflimmern vor einem Gehirnschlag dokumentiert. Während in der Warfarin-Gruppe 21 ProbantInnen einen Schlaganfall erlitten, so waren es in der Acetylsalicylsäure-Gruppe 44.
ASPIRIN-Resistenzen nehmen zu
Durch jahrelange Arbeit hat BAYER es geschafft, ASPIRIN eine Herz/Kreislauf-Erkrankungen vorbeugende Wirkung anzudichten. So nehmen z. B. schon fünf Prozent aller SchweizerInnen das Schmerzmittel aus prophylaktischen Gründen ein. Seit einiger Zeit beobachten MedizinerInnen aber gerade bei den KonsumentInnen des „Tausendsassas“ einen Zuwachs von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Die ÄrztInnen erklären sich dieses Phänomen mit der zunehmenden Herausbildung von ASPIRIN-Resistenzen. Allein in Thailand zählen die Gesundheitsbehörden schon 65.000 Fälle.
YASMIN-Patent verloren
Die Verhütungspille YASMIN ist BAYERs lukrativstes Medizin-Produkt. Allein in den USA macht der Konzern damit jährlich einen Umsatz von 321 Millionen Euro. Und die weiteren Aussichten schienen glänzend, denn das Patent sollte eigentlich erst 2020 auslaufen. Doch es kam anders. Das US-amerikanische Pharma-Unternehmen BARR focht in den Vereinigten Staaten eines der drei Patente an, die der Leverkusener Multi auf die Antibabypille hält, und bekam Recht zugesprochen. Der zuständige Richter Peter Sheridan wies BAYERs Anspruch auf geistiges Eigentum für die Praxis, das Hormon Drospirenone in so kleine Portiönchen aufzuteilen, dass der Organismus es schnell aufnehmen kann, zurück. Das wäre ein in der Pharmazie übliches Vorgehen und keine BAYER-Erfindung, begründete Sheridan das Urteil, das der Konzern in einem Revisionsverfahren wieder kippen will. Während BARR nun mit einer Nachahmer-Version von YASMIN auf den Markt drängt, sieht der Pillenriese nach der Gerichtsentscheidung auch das Patent für das Verhütungsmittel YAZ bedroht. Die Börse reagierte prompt mit Kursabschlägen für die BAYER-Aktie, und der Vorstandsvorsitzende Werner Wenning musste die Gewinnerwartungen für den gesamten Pharma-Bereich nach unten korrigieren.
Neue Verhütungspille
Nicht zuletzt der langwierige und jetzt vorerst entschiedene Patentstreit um das Verhütungsmittel YASMIN (s. o.) hat den Leverkusener Multi dazu getrieben, rasch für Nachschub in dem Segment zu sorgen. So hat er nun in Europa die Zulassung für ein neues Präparat beantragt. Ob das Mittel mit den beiden Hormonen Estradiol und Dienogest als Wirksubstanzen die Leber aber tatsächlich weniger schädigt als vergleichbare Produkte, wie BAYER behauptet, dürfte erst der Praxis-Test zeigen.
Doppelte DIANE-Standards
BAYER darf DIANE-35 in Europa und Kanada wegen seiner Risiken und Nebenwirkungen nicht als Verhütungsmittel vermarkten; zugelassen ist es nur noch als Arznei zur Behandlung schwerer Hormonerkrankungen. Das hinderte den Pharma-Riesen jedoch nicht, das Produkt in Schwellenländern als Antibabypille auf den Markt zu bringen. So erhielt DIANE-35 2001 in Südkorea eine Zulassung. Erst als unabhängige Nichtregierungsgruppen diese doppelten Standards kritisierten, machte der Leverkusener Multi einen Rückzieher.
Teststreifen-Rückruf
In den USA musste der Leverkusener Multi eine Rückruf-Aktion für Diabetes-Teststreifen starten. Durch einen Produktionsfehler zeigten sie um bis zu 17 Prozent höhere Blutzucker-Werte an.
LEUKINE-Rückruf
BAYER musste das gentechnisch produzierte LEUKINE in der flüssigen Darreichungsform nach Meldungen über schwere Nebenwirkungen vom Markt nehmen. Der vor allem zur Stärkung des Immunsystems von Leukämie-Kranken und nach Knochenmarktransplantationen zum Einsatz kommende Wachstumsfaktor hatte bei den PatientInnen wiederholt zu Bewusstlosigkeit geführt. Der Leverkusener Multi machte den der Flüssigkeit als Stabilisator beigegebenen Stoff Ethylendiamintetraacetat dafür verantwortlich.
AVELOX schädigt Leber
Nach Meldungen über von BAYERs Antibiotikum AVELOX ausgelöste Leber- und Hautschädigungen forderte das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ den Pharma-Riesen auf, ÄrztInnen in einem Brief ausdrücklich auf diese Nebenwirkungen hinzuweisen.
Lungenkrebs: NEXAVAR hilft nicht
Als „Meilenstein im Kampf gegen Krebs“ feiert BAYER sein Mittel NEXAVAR. Es kommt bisher bei der Behandlung von Nieren- und Leberkrebs zum Einsatz und sollte auch bei Lungenkrebs Anwendung finden. Jetzt musste der Leverkusener Multi entsprechende Tests allerdings abbrechen. Das Präparat mit dem Wirkstoff Sorafenib half nicht nur nicht, es verkürzte sogar die Lebenserwartung der PatientInnen.
Bluthochdruck durch NEXAVAR
Nach einer in der medizinischen Fachzeitschrift LancetOncology veröffentlichten Studie erhöht BAYERs Krebsmedikament NEXAVAR das Bluthochdruck-Risiko, wodurch für die PatientInnen die Gefahr steigt, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden.
Zulassung für Thrombose-Mittel beantragt
BAYER hat die Zulassung für die Thrombose-Arznei Rivaroxaban beantragt. Der Leverkusener Multi hofft auf eine Genehmigung für den prophylaktischen Einsatz zur Verhinderung von Blutgerinnseln nach größeren orthopädischen Operationen und will das Präparat unter dem Namen XARELTO vermarkten.
Riesige Gewinnspannen
Der Pharma-Markt hält für BAYER & Co. riesige Gewinnspannen bereit. Von dem Geld, das Kranke für ein Medikament zahlen, fließen über 60 Prozent an die Pillen-Produzenten zurück, während für die Apotheke nur 15,2, den Staat 12,8, die Krankenkassen 7,5 und den Großhandel 3,7 Prozent bleiben.
Fast alles zulässig
„Die Alte Welt ist auf dem besten Weg, zum neuen Lieblingsmarkt der Pharma-Industrie zu werden. Die Konzerne haben hier weniger Probleme mit der Zulassung als in den USA“, zitiert die BUKO-PHARMA-KAMPAGNE die Financial Times Deutschland. Wenn diese Wirtschaftspostille die bundesdeutschen Genehmigungsbehörden lobpreist, dann muss es um den vorbeugenden Gesundheitsschutz im Lande wahrlich schlecht stehen.
JENAPHARM erfindet Krankheiten
Für die vielen auf dem Markt befindlichen Pillen gibt es viel zu wenig Gesundheitsstörungen. Deshalb zeigen sich die Pharma-Riesen erfindungsreich. BAYERs Tochtergesellschaft JENAPHARM beispielsweise will kleine Zipperlein vor der Monatsblutung dem eh nur mit Biegen und Brechen als Krankheit durchgehenden „Prä-Menstruellen Syndrom“ zuschlagen und dafür mit der Pille PETIBELLE auch gleich die passende pharmakologische Lösung liefern.
Forschung an Brustkrebs-Arznei
„Sexualhormone selbst verursachen keinen Brustkrebs, sie können aber das Wachstum bestehender Karzinome fördern“ - diese Erkenntnis führt den Leverkusener Multi keinesfalls dazu, in einem Akt der Selbstkritik seine umstrittenen Hormontherapien für Frauen in den Wechseljahren vom Markt zu nehmen. Sie dient vielmehr dazu, neue Forschungen zur Verlangsamung des Brustkrebs-Wachstums vorzustellen. Setzten die MedizinerInnen hier bislang vor allem Antihormone ein, welche die Östrogen-Aufnahme hemmten, so konzentrieren sich die Leverkusener PharmakologInnen jetzt auf das Progesteron und testen einen Progesteron-Blocker in einer Phase-II-Studie mit 70 PatientInnen. Wenn es sich wie im Fall NEXAVAR verhält, dürfte das Mittel die Lebenserwartung der Patientinnen um 2-3 Monate erhöhen und BAYER wieder dazu veranlassen, mit Schlagzeilen wie „Leberkrebs im Visier“ oder „Weiterer Meilenstein im Kampf gegen den Krebs“ den Eindruck zu erwecken, wirklich eine Arznei gegen die Krankheit gefunden zu haben, was nicht den Tatsachen entspricht.
GENE & KLONE
BAYERs Genmedizin-Partner
Der Leverkusener Pharma-Riese führt mit zahlreichen Biotech-Unternehmen genmedizinische Forschungsprojekte durch. Die Kooperation mit AFFIMETRIX widmet sich ebenso wie die mit INPHARMATICA, NEUROSCIENCES VICTORIA und der Universität von Monash der Suche nach Arznei-Wirkorten. Mit ARTEMIS prüft er diese nach Herz und Nieren. Mit CELERA entwickelt BAYER ein Therapeutikum für Autoimmunkrankheiten. Mit den Firmen CHEMDIV und COMGENEX betreibt der Pillen-Hersteller Wirkstoff-Synthese, mit GENEDATA Bioinformatik. In Zusammenarbeit mit MORPHOSYS und NOVARTIS forscht der Multi nach Antikörpern zur Behandlung von Krebs und mit WARNER CHILLCOTT nach solchen zur Behandlung von Hautkrankheiten.
BAYER setzt auf molekulare Diagnostika
Der Leverkusener Multi entwickelt derzeit gentechnische Diagnose-Verfahren, die erste Anzeichen einer Krankheit bereits auf zellulärer Ebene aufspüren sollen. Der Konzern hofft, so ein Instrument zur Früherkennung degenerativer Gesundheitsstörungen wie etwa Alzheimer, Krebs oder Herz/Kreislauf-Erkrankungen entwickeln zu können. Diese „molekularen Diagnostika“ befinden sich allerdings noch in der ersten Phase der Klinischen Tests. Ob die Mittel die in sie gesetzten Erwartungen auch erfüllen werden, steht lange noch nicht fest.
MABCAMPATH: erweiterte Zulassung
Bisher durften MedizinerInnen das von BAYER und GENZYME gemeinsam entwickelte Gentech-Medikament MABCAMPATH (Wirkstoff: Alemtuzumab) bei der chronisch-lymphatischen Leukämie nur einsetzen, wenn die PatientInnen bereits mit anderen Arzneien vorbehandelt waren oder eine Therapie mit Fludarabin nicht den gewünschten Erfolg erbracht hatte. Nach der US-amerikanischen Zulassungsbehörde erteilte dem Pharmariesen nun aber auch ihr europäisches Pendant die Genehmigung für den Ersteinsatz des monoklonalen Antikörpers, der sich gezielt an von Leukämie befallene Zellen binden und das Immunsystem so anregen soll, diese zu zerstören.
KOGENATE zur Vorbeugung?
BAYER will das Anwendungsspektrum seines gentechnisch hergestellten Blutgerinnungshemmers KOGENATE erweitern und hat eine Studie durchführen lassen, die den prophylaktischen Einsatz ab einem Alter von sechs Monaten empfiehlt. Das würde Gelenkeinblutungen vorbeugen und so die Gelenkfunktion länger erhalten, meinen die AuftragsforscherInnen.
LIBERTY-LINK-Zulassung vertagt
Über die von BAYER bei der EU beantragte Import-Zulassung für genmanipulierte Soja- und Baumwoll-Pflanzen aus der LIBERTY-LINK-Baureihe müssen jetzt die Agrar-MinisterInnen entscheiden. Ein Ausschuss hatte sich zuvor weder auf eine Ablehnung noch auf eine Genehmigung einigen können.
Brasilien genehmigt Gen-Mais
Um die Genehmigung für genmanipulierten BAYER-Mais tobte in Brasilien lange eine heftige Auseinandersetzung. Nachdem Präsident Lula da Silva kurzerhand die Zulassungsbedingungen gelockert hatte, gaben die Behörden zunächst grünes Licht für die Genpflanze mit der eingebauten Resistenz gegenüber dem Herbizid LIBERTY LINK. Ein Bundesrichter hob das Votum jedoch wieder auf. Die einheimischen Sorten bedürften des Schutzes, gab er zur Begründung an. Das Moratorium währte allerdings nicht allzu lange. Anfang 2008 erlaubten die zuständigen Stellen die Aussaat des Labor-Mais wieder.
Raps made by BAYER
Seit einiger Zeit macht sich der Leverkusener Multi daran, Lebensmittel zu „verbessern“. So hat er mittels biotechnologischer Verfahren die Raps-Sorte INVIGOR HEALTH entwickelt. Diese muss bei der Weiterverarbeitung kein Härtungsverfahren mehr durchlaufen und bildet deshalb angeblich keine Trans-Fettsäuren mehr, die nach BAYER-Angaben das Herz/Kreislaufsystem schädigen können.
Pflanzen made by BAYER
Bislang leuchteten kaum einem die Segnungen der „grünen Gentechnik“ ein. BAYER hat aus dem Akzeptanz-Problem gelernt und will nun in die Pflanzen besser vermarktbare Eigenschaften einbauen. Seine Gen-KöchInnen suchen jetzt angeblich nicht mehr nach „dem maximalen Ertrag“. „Der richtige Mix vieler günstiger Eigenschaften“ ist ihnen wichtiger. In der Genter Versuchsküche des Konzerns arbeiten die WissenschaftlerInnen daran, den Stoffwechsel der Ackerfrüchte anzuregen, ihre Abwehrkräfte zu stärken und die Ausschüttung von Stresshormonen zu reduzieren. Wenn sich diese Eigenschaften, die der Agro-Riese schon in zehn Jahren wie „Legosteine“ zu kombinieren hofft, auf der freien Wildbahn einmal an Wildpflanzen vererben, dann dürfte ein Flurschaden ungeheurer Ausmaße einstehen.
PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE
BAYER-Pestizide sind überall
Das nordrhein-westfälische Umweltministerium hat die Pestizid-Belastungen von Obst und Gemüse im Internet öffentlich zugänglich gemacht. Unter www.ilm.nrw.de/pestrep/pestshow1.html listet es detailliert die Ergebnisse der Lebensmitteluntersuchungen auf. Wie nicht anders zu erwarten, ist BAYER prominent vertreten. Bei Äpfeln beispielsweise stammen fünf der zehn am häufigsten in den Früchten nachgewiesenen Ackergifte vom Leverkusener Multi. Die PrüferInnen stießen auf den unter dem Namen SEVIN oder SEVIN XLR PLUS vermarkteten Wirkstoff Carbaryl, auf Trifloxystrobin (FLINT), auf Chlorpyrifos (BLATTANEX, PROFICID und RIDDER), auf Pyrimethanil (CLARINET, FLINT STAR, MYSTIC, MYTHOS, SCALA, SIGANEX, VISION und WALABI) sowie auf die in der Bundesrepublik jüngst mit einem Verbot belegte Substanz Tolylfluanid. Bei Birnen, Tomaten & Co. dürfte der Marktanteil des Leverkusener Multis an den Giftdosen kaum geringer ausfallen.
Keine Zulassung für PONCHO
Die französischen Behörden haben BAYERs Saatgutbehandlungsmittel PONCHO mit dem Wirkstoff Clothianidine wegen seiner Bienengefährlichkeit eine Zulassung verweigert. Sie werteten die vom Agro-Riesen vorgelegten Unterlagen als „unpräzise“, „voller Ungereimtheiten“ und „nicht für eine Zulassungsprüfung geeignet“. Ihre Pendants in der Bundesrepublik und in anderen europäischen Ländern hatten da weniger Probleme: Sie genehmigten PONCHO ohne viel Federlesens.
Neue Vermarktungsstrategie für Pestizide
In Brasilien hat der Leverkusener Chemie-Multi eine neue Vermarktungsstrategie entwickelt, um den Absatz seiner Ultragifte BAYSISTON und FOLICUR unter den Kaffee-AnbauerInnen zu fördern: Er lässt sich in Naturalien auszahlen. „Diese Initiative vereinfacht das Leben des Kaffeebauern, denn er bezahlt mit seiner Produktion, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen“, so BAYERs Marketing-Direktor Gerhard Bohne (sic!).
BIOSPRIT & PROFIT
Agrosprit aus Institute
Der Leverkusener Multi versucht verstärkt, Biodiesel-Betrieben mit dem Zauberwort „Synergie-Effekte“ eine Ansiedlung in seinen von Leerständen heimgesuchten Chemie-Parks schmackhaft zu machen. In den USA erlag die KANAWHA BIODIESEL LLC den Lockrufen des Konzerns und bezog auf dem BAYER-Areal in Institute Quartier.
WASSER, BODEN & LUFT
Zwei neue Müllkraftwerke
Der Leverkusener Chemiemulti setzt bei seiner Energie-Versorgung zunehmend auf billige und dementsprechend umweltschädliche Lösungen. Neben Kohlekraftwerken zählen Müllkraftwerke, beschönigend Ersatzbrennstoffkraftwerke genannt, zu seinen Favoriten. So plant er in Brunsbüttel und Dormagen den Bau solcher Dreckschleudern, die unter anderem Dioxin, chlor-, brom- und fluorhaltige Kohlenwasserstoffe, Chloride, Furane, Kohlendioxid, Schwermetalle wie Quecksilber und Feinstaub, Rost-, Filter- und Kesselasche produzieren (siehe auch SWB 1/08).
Aus für Krefelder Kohlekraftwerk?
In Krefeld hält einstweilen die Opposition gegen das im Chemiepark von BAYER geplante Steinkohle-Kraftwerk mit einem Jahresausstoß von 4,4 Millionen Tonnen CO2, obwohl die CDU-Landtagsfraktion viel Druck auf ihre ParteifreundInnen vor Ort ausübt. Nachdem der Regionalrat den Bau einer solchen Dreckschleuder in einem Industriegebiet für grundsätzlich zulässig erklärte, indem er den Gebietsentwicklungsplan „nachbesserte“, änderten CDU und Grüne kurzerhand den Bebauungsplan, so dass dieser nun kein Kraftwerk in dieser Dimension mehr erlaubt. Beim Leverkusener Multi herrschte daraufhin „große Verbitterung“. Er hat jetzt ein Prüfverfahren bei der traditionell sehr BAYER-freundlichen Bezirksregierung beantragt und hofft auf einen positiven Bescheid bis zum Ende des Jahres.
Schadinsekten mögen CO2
ExpertInnen rechnen bis zur Mitte des Jahrhunderts mit einem Anstieg der Kohlendioxid-Konzentration in der Luft von bisher 380 ppm (Teile pro Million) auf 550 ppm, wozu BAYER mit einem jährlichen Treibhausgas-Ausstoß von 3,8 Millionen Tonnen nicht wenig beiträgt. ForscherInnen der Universität Illinois haben jetzt untersucht, welche Auswirkungen das auf das Verhalten von Schadinsekten hat. Auf einem Sojabohnenfeld simulierten sie die CO2-Erhöhung und stellten beim Japankäfer einen beträchtlich gewachsenen Appetit fest. Der durch die erhöhten Kohlendioxid-Werte in der Luft gestiegene Zuckergehalt bei reduziertem Eiweiß-Anteil brachten ihn auf den Geschmack. Und da die Pflanzen durch die veränderten Bedingungen weniger Abwehrstoffe produzierten, wurde er bei der Mahlzeit kaum noch gestört.
NANO & CO.
Nano im Beton?
Der Leverkusener Multi erweitert seine Produktpalette im Bereich der Nanotechnologie beständig. Er entwickelte bisher spezielle Duftkapseln, Folien, Eishockeyschläger und die BAYTUBE-Kohlenstoffröhrchen. Diese will er jetzt nicht nur Kunststoffen zusetzen, sondern auch Beton, um den Baustoff zugleich leichter und härter zu machen. Ein entsprechendes Forschungsprogramm führt der Leverkusener Multi gemeinsam mit dem „Institut für Bau- und Werkstoffchemie“ der Universität Siegen durch. Der Konzern erwartet von der „Zukunftstechnologie“ Millionen-Umsätze, nur leider teilt diese die schlechten Eigenschaften vieler alter Technologien: Sie stellt ein Risiko für Mensch, Tier und Umwelt dar. Das räumen BAYER & Co. sogar selber ein. „Bei vielen unlöslichen Nanomaterialien ist derzeit nicht auszuschließen, dass die inhalative Aufnahme dieser besonders kleinen Partikel am Arbeitsplatz zu Gefährdungen führen kann“, heißt es in dem vom „Verband der Chemischen Industrie“ gemeinsam mit der „Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin“ herausgegebenen „Leitfaden für Tätigkeiten mit Nanomaterialien am Arbeitsplatz“.
Mehr Nano aus Laufenburg
So ganz hat BAYER die Bande zu HC STARCK noch nicht gekappt. Der Leverkusener Multi nahm auf dem Laufenberger Werksgelände seiner ehemaligen Tochtergesellschaft eine Anlage zur Herstellung von BAYTUBE-Kohlenstoffröhrchen, die aus Nano-Materialien bestehen, in Betrieb. Zusammen mit der ebenfalls auf dem Areal befindlichen BAYTUBE-Pilotanlage will der Konzern damit die Jahresproduktion auf über 60 Tonnen ausweiten.
Kooperation mit FUTURECARBON
BAYER hat eine Zusammenarbeit mit der Bayreuther Firma FUTURECARBON vereinbart. Das Unternehmen produziert für den Leverkusener Multi eine Version der BAYTUBE-Nanoröhrchen in flüssiger Form. So will der Konzern in Zukunft auch mit Herstellern von Batterien und Wasserstoffspeichern ins Geschäft zu kommen.
Nano-Wirkstoffhüllen
Auch auf medizinischem Gebiet finden BAYER & Co. Anwendungsbereiche für die Nano-Technik. Bereits 40 nanomedizinische Produkte gibt es mittlerweile. Der Leverkusener Multi forscht zur Zeit an Arznei-Umhüllungen aus Nano-Materialien. Die winzig kleinen Kunststoff-Mäntel sollen ihre Fracht zielgenauer zum Wirkort transportieren und noch feinstes Gewebe durchdringen können. Eine Gesundheitsgefährdung ist mit dem bisschen Plaste & Elaste im Körper nach Ansicht des Leverkusener Multis nicht verbunden. „Nanomedizinische Produkte werden wie alle Arzneimittel umfassend geprüft und erst dann für den Markt zugelassen, wenn eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung für die Patienten positiv ausgefallen ist“, lässt er den Nanomediziner Dr. Oliver Bujok vom „Verein Deutscher Ingenieure“ (sic) versichern, ganz so, als ob es die Skandale um LIPOBAY und TRASYLOL nie gegeben hätte.
POLITIK & ÖKONOMIE
BAYERs AktionärInnen-Struktur
Bei den bundesdeutschen DAX-Unternehmen hat sich die AktionärInnen-Struktur in den letzten Jahren stark verändert. Besaßen ausländische KapitalanlegerInnen im Jahr 2005 rund ein Drittel der Aktien von MERCEDES, SIEMENS & Co., so konnten sie diesen Anteil bis 2007 auf 53 Prozent steigern. In ihrer Beliebtheitsskala liegt BAYER auf dem dritten Platz, 78 Prozent der AktionärInnen des Leverkusener Multis leben nicht in der Bundesrepublik. Die größte Beteiligung hält mit 20 Prozent die US-amerikanische Investmentgesellschaft CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY.
STANDORTE & PRODUKTION
Platzverweis für Rechtsextreme
Der Rechtsextreme Hans-Ulrich Pieper organisiert seit 1991 „Dienstagsgespräche“. Bisher nutzte er dafür in Dormagen auch das von BAYER verpachtete Parkrestaurant „Kasino“. Am 2.10.07 aber mussten Pieper, Holger Apfel, der Vize-Vorsitzende der NPD, Markus Beisicht, der Chef von „Pro Köln“ und „Pro NRW“ und ihre Anhängerschar draußen bleiben: Der Chemie-Multi machte erstmals von seinem Hausrecht Gebrauch. „Die „Dienstagsgespräche“ finden ab sofort nicht mehr in unserem Hause statt“ - diesen Hinweis im Eingangsbereich hatten die Rechten zur Kenntnis zu nehmen.
BAYER-Kaufhaus dicht
Die viel beschworene BAYER-Familie wird immer mehr zur Chimäre, weil die „Sozialpolitik“ für den Leverkusener Multi nicht mehr zum Kerngeschäft gehört. Nach der Schließung von Bibliotheken, Schwimmbädern, Werkskindergärten und der Abwicklung von Sportvereinen beraubte der Konzern seiner BAYER-Familie jetzt auch noch der Einkaufsmöglichkeit im werkseigenen Kaufhaus. Die 1897 gegründete „Konsumanstalt der Farbenfabriken“ schloss kurz vor Weihnachten 2007 endgültig ihre Pforten und muss nun einem Einkaufscenter weichen.
BAYWOGE wieder verkauft
Anfang 2002 hat BAYER seine Wohnungsgesellschaft BAYWOGE, die in Leverkusen über 6.000 Wohneinheiten verfügte, an die ESSENER TREUHANDSTELLE (THS) verkauft. Für die MieterInnen werde sich nichts ändern, betonte der Konzern damals. Ob sich dies bewahrheitet, steht nun allerdings in Frage, denn der Bund trennte sich von seinen THS-Anteilen und veräußerte sie für 450 Millionen Euro an die beiden anderen Gesellschafter, die RUHRKOHLE AG und die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE. Da das für die beiden neuen Besitzer schwierig zu refinanzieren ist, befürchten der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach und der SPD-Kommunalpolitiker Jürgen Scharf Nachteile für die MieterInnen. Zu verkaufsbedingten Mieterhöhungen darf es nach dem Vertrag von 2002 zwar nicht kommen, aber Scharf rechnet mit Einsparungen bei der Instandsetzung und bei der Modernisierung.
Neues Werk in Köln-Knapsack
BAYER baut in Köln-Knapsack für 60 Millionen Euro eine neue Anlage zur Pestizid-Herstellung. Unter anderem will der Konzern dort Glufosinat produzieren. Dass die EU diesen Stoff, den der Konzern bevorzugt in Kombination mit seinen Glufosinat-resistenten Gentech-Pflanzen der LIBERTY-LINK-Serie vermarktet, wegen seiner Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt gerade einer Sicherheitsprüfung unterzieht, scheint den Agro-Riesen nicht abzuschrecken.
BAYER wirbt auf der „Expo Real“
Der Leerstand in seinen Chemieparks bewog den Leverkusener Multi dazu, auf der Münchener Immobilien-Messe „Expo Real“ offensiv um neue Mieter zu werben. Die Standkosten teilte sich der Konzern mit der „Wirtschaftsförderung Leverkusen“, die ihrerseits den Manforter Innovationspark und die „Neue Bahnstadt Opladen“ anpries.
BAYER-Kreuz bleibt
Nach vielen Protesten hat sich der Pharma-Riese entschieden, sein weit über Leverkusen hinaus sichtbares BAYER-Kreuz nicht abzureißen. Zu den Gründen der „Denkmalschutz-Initiative“ schreibt die Süddeutsche Zeitung: „Weil seit langem auch über Ausgliederungen von Geschäftsbereichen und Stellenabbau diskutiert wird, ist auch dem letzten Romantiker in der Stadt klar, dass BAYER kein Wohltäter ist, sondern eine Firma, die gut wirtschaften wird. Dennoch erschien manchem in Leverkusen der Abriss des Kreuzes als symbolischer Akt, als endgültiger Bruch mit der Tradition. Eine solche Stimmungslage kann der BAYER-Führung nicht recht sein. Mit der Entscheidung, das Kreuz stehen zu lassen, signalisiert der Konzern, dass er die Wünsche seiner Nachbarn ernst nimmt“.
Neue Nano-Anlage
BAYER hat in Laufenburg eine neue Anlage zur Herstellung von Nano-Röhrchen in Betrieb genommen (siehe NANO & CO.).
Kommt die Verbund-Feuerwehr?
Wie an allen anderen BAYER-Standorten ist auch die 40-köpfige Werksfeuerwehr in Brunsbüttel von Rationalisierungsmaßnahmen bedroht. „Wir müssen was machen, die Kosten treiben uns. Am Ende geben wir Stück für Stück an Sicherheit auf“, warnt der Betriebsratsvorsitzende Hans-Joachim Möller und machte den Vorschlag, eine von allen Unternehmen im Chemiepark getragene Verbund-Feuerwehr zu gründen.
IMPERIUM & WELTMARKT
Nano-Röhrchen mit FUTURECARBON
Der Leverkusener Multi hat auf dem Gebiet der Nanotechnik eine Zusammenarbeit mit dem Bayreuther Unternehmen FUTURECARBON begonnen (siehe NANO & CO.).
PRODUKTION & SICHERHEIT
Berufskrankheit „Asbestose“
Der lange Zeit vor allem in der Bau- und Chemieindustrie verbreitete Werkstoff Asbest ist zwar seit 1993 verboten, aber seine Wirkungen entfaltet er noch heute, da es bis zu 40 Jahren dauern kann, bis z. B. eine Asbestose ausbricht. So zählen durch Asbest ausgelöste Leiden mit einem Anteil von über 15 Prozent immer noch zu den häufigsten - und tödlichsten - Berufskrankheiten. Wieviele ehemalige BAYER-Beschäftigte davon betroffen sind, darüber schweigt sich der Pharma-Riese aus. Die letzten Angaben datieren aus dem Jahr 2000, wo der Konzern die Zahl der anerkannten Berufskrankheiten auf 130 bezifferte und kurz und knapp mitteilte: „Als Krankheitsauslöser waren bei uns vor allem Expositionen gegen Asbest und Lärm relevant“.
UNFÄLLE & KATASTROPHEN
Ammoniak-Austritt: 23 Verletzte
Im Wuppertaler BAYER-Werk kam es am 12.3.08 durch eine bei Reparaturarbeiten versehentlich geöffnete Leitung zu einem Austritt von Ammoniak. 23 Personen zogen sich eine Vergiftung zu und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Feuerwehr forderte die BewohnerInnen auf, die Fenster geschlossen zu halten und ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Die Schwebebahn stellte umgehend den Betrieb ein. Die WuppertalerInnen hatten dabei noch Glück im Unglück, denn das Sturmtief „Kirsten“ sorgte dafür, dass die gen Innenstadt ziehende Giftwolke rasch vom Winde verweht wurde. „Die Wetterlage hat uns in die Hände gespielt“, so ein Feuerwehr-Sprecher erleichtert.
Thiodicarb-Fässer geborsten
Am 28. Dezember 2007 barsten am US-amerikanischen BAYER-Standort Institute mehrere Fässer mit dem von der Weltgesundheitsorganisation WHO als „extrem gefährlich“ eingestuften Pestizid Thiodicarb. Mehrere AnwohnerInnen mussten sich daraufhin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Aufgrund der starken Geruchsbelästigung liefen bei den Behörden die Telefone heiß. Die zögerliche Informationspolitik des Konzerns rügte der zuständige Verwaltungschef als „bodenloses Verhalten“ (siehe auch SWB 1/08).
Sturz in den Tod
Am 15. November 2007 stürzte auf dem Gelände des Uerdinger Chemieparks ein Arbeiter einer Fremdfirma bei Abbrucharbeiten 25 Meter tief in einen Lichtschacht und kam dabei ums Leben.
Arbeiter verlor Bein
Am 29 Februar 2007 geriet ein Arbeiter des Baytowner BAYER-Werks unter einen Schienenwagen und verlor dabei ein Bein.
RECHT & UNBILLIG
Gericht contra Pipeline
Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Münster hat BAYER verboten, die momentan im Bau befindliche Kohlenmonoxid-Pipeline in Betrieb zu nehmen und entzog damit dem von allen Landtagsparteien im Schnellverfahren verabschiedeten Enteignungsgesetz die Rechtsgrundlage. „Es fehlt eine überzeugende Darstellung der Bedeutung, die die von der Firma BMS (BAYER MATERIAL SCIENCE, Anm. SWB), einem privaten Unternehmen, betriebene Rohrleitungsanlage für die Allgemeinheit hat, um den staatlichen Zugriff auf das Eigentum Dritter zu rechtfertigen. Es müssten konkrete Informationen gegeben werden, beispielsweise Angaben zur Zahl der entstehenden Arbeitsplätze“, urteilten die RichterInnen und schlossen sich damit der Argumentation der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und anderer Initiativen an. In zwei weiteren Verfahren verbot das OVG dem Chemie-Multi das Verlegen der Rohre auf den Grundstücken von Gemeinden, die gegen das Enteignungsgesetz geklagt hatten. „Eine Ohrfeige für den Landtag“, kommentierte die Rhein
Kurzmeldungen „Ticker“
AKTION & KRITIK
Proteste in Antwerpen
Der Leverkusener Multi will im Kunststoffbereich 1.500 Arbeitsplätze vernichten. Allein am Standort Antwerpen sollen mehr als 200 Stellen wegfallen (siehe auch KAPITAL & ARBEIT). Doch die Belegschaft wehrt sich. Gemeinsam mit den KollegInnen von BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS blockierten die Beschäftigten im Oktober und November 2007 die Werkseingänge, um gegen die „unsozialen Pläne“ zu protestieren (siehe auch SWB 4/07).
OECD-Klage erfolgreich
Im Jahr 2003 hat die philippinische BAYER-Niederlassung zwei Gewerkschaftler entlassen, die sich allzu stark für die Belange der Beschäftigten eingesetzt hatten (SWB 2/04). So hatte der Gewerkschaftsvorsitzende José Facundo unter anderem einen Streik mitorganisiert, in einem Arbeitrechtsprozess zu Gunsten eines Belegschaftsangehörigen ausgesagt und die Betriebsleitung kritisiert. Zudem warf Focundo dem Leverkusener Multi vor, widerrechtlich Gewerkschaftsbeiträge einbehalten zu haben. Aus Protest gegen seinen Rausschmiss reichte der Aktivist eine Klage bei dem Industrieländer-Zusammenschluss OECD ein, wobei ihn die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) unterstützte. Im letzten Jahr bekam er Recht zugesprochen, wie die CBG erst jetzt erfuhr. Der Rechtsauschuss bekräftigte die von BAYER angezweifelte Legitimität der Gewerkschaft und verurteilte den Multi dazu, der Beschäftigten-Vertretung das ihr zustehende Geld zu überweisen sowie Facundo eine Entschädigung zu zahlen.
UNEP-Jugendbeirat antwortet der CBG
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) setzt ihre Kampagne gegen BAYERs Greenwashing mit Hilfe des UN-Umweltprogrammes UNEP fort. Sie hat auch den neuen Jugendbeirat, der auf der Ende August 2007 beim Leverkusener Multi abgehaltenen „Internationalen Jugendumweltkonferenz“ gewählt wurde, aufgefordert, die Zusammenarbeit mit dem Agro-Riesen wg. dessen zahlreichen Umweltsünden und des Missbrauchs der UNEP zu reinen PR-Zwecken zu beenden. Aber das Gremium möchte an seinem Sponsor festhalten. „BAYER ist immerhin eines der Unternehmen, die durch ihre Kooperation mit der UNEP ihren Willen demonstrieren, ihre Haltung gegenüber der Umwelt zu ändern“, antwortete der Beirat auf den Brief der CBG.
Pipeline
- 1: Demo
Am 3.11.2007 fand in Düsseldorf die erste landesweite Demonstration gegen die von BAYER geplante Kohlenmonoxid-Pipeline statt. 4.500 Menschen zogen von der DGB-Zentrale am Hauptbahnhof quer durch die Innenstadt bis zum Rathaus-Vorplatz und warnten vor den Gefahren der Giftgas-Röhre. Mittenmang die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und ihr schon vielseitig zum Einsatz gekommener, vom Künstler Klaus Klinger gestalteter „Gevatter Tod“, der diesmal auf einem Traktor mitreiste. Die Pipeline-GegnerInnen hielten Holzkreuze in die Höhe, trugen Transparente oder kleine Schilder mit Aufschriften wie „Mafia am Rhein: BAYER regiert, Politik versagt, Bevölkerung kämpft“, riefen immer wieder im Chor: „No, no, no, Pipeline geht k.o.!“ und ließen zum Abschluss des Protestes unheilschwangere schwarze Luftballons gen Himmel steigen.
Pipeline
- 2: Klagen abgelehnt
Die „lex BAYER“ gestattet es dem Leverkusener Multi, durch „Besitzeinweisungsbescheide“ Grundstücke zu enteignen, die er für seine Pipeline braucht. Gegen diese Blankovollmacht haben die Städte Monheim, Ratingen, Hilden und Erkrath Klage erhoben. Die RichterInnen des Verwaltungsgerichts Düsseldorf gaben ihr jedoch nicht statt, weil die Giftröhre angeblich dem Allgemeinwohl diene, hinter dem Einzelinteressen von WohneigentümerInnen oder Kommunen zurückstehen müssten. Die Gemeinden wollen das Urteil jedoch nicht akzeptieren. „Damit haben wir gerechnet und direkt Beschwerde eingelegt. Die Aktenordner sind schon unterwegs“, sagte der Monheimer Bürgermeister Thomas Dünchheim.
Pipeline
- 3: Enteignungspanne
Am 18. Oktober 2007 hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf dem Leverkusener Multi vorerst grünes Licht dafür gegeben, die Enteignung von Grundstücken einzuleiten, falls der geplante Streckenverlauf der Giftröhren-Pipeline es erfordert (s. o.) Der Konzern machte sich auch gleich ans Werk, aber in Langenfeld unterlief ihm dabei eine Panne. Er wollte zuwenig von der Kommune und vergaß bei dem Enteignungsverfahren eine Parzelle. Die Stadt stellt sich nun stur und weigert sich, das Areal freiwillig herauszurücken. BAYER muss deshalb die Bauarbeiten an der Stelle unterbrechen und erneut vor Gericht ziehen.
Pipeline
- 4: Attentate befürchtet
Die Polizei sieht sich außer Stande, die von BAYER geplante Kohlenmonoxid-Pipeline vor eventuellen Terroranschlägen zu schützen. „Eine lückenlose Sicherheit für die Pipeline-Trasse gibt es nicht, selbst wenn Tausende Polizisten eingestellt würden“, sagte der Udo Kutsche von der DEUTSCHEN POLIZEI-GEWERKSCHAFT und sprach sich aus diesem Grund gegen das umstrittene Vorhaben aus.
Pipeline
- 5: Die Anhörung
Am 17.10.2007 fand im nordrhein-westfälischen Landtag auf Antrag der Grünen eine Anhörung zum Thema „Pipeline“ statt. Nachdem die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und andere Giftröhren-GegnerInnen mit einer Mahnwache auf die Gefährlichkeit des Projektes hingewiesen hatten, begann die Veranstaltung. Viele Fragen blieben jedoch ungeklärt, weil Innenminister Ingo Wolf (FDP) dem für das Plangenehmigungsverfahren verantwortlichen Regierungspräsident Jürgen Büssow die Teilnahme untersagt hatte. Auch die BAYER-Emissäre drückten sich vor Antworten. Als etwa der Jura-Professor Stefan Muckel vom Leverkusener Multi, der immer wieder auf die Wichtigkeit der Pipeline für die Arbeitsplätze in der Region verweist, schriftlich haben wollte, wieviele Jobs der Konzern denn in den nächsten Jahrzehnten zu garantieren gedenke, musste BAYERs Pipeline-Mann Werner Breuer passen. Ebenso wenig trug der TÜV zur Zerstreuung der Sicherheitsbedenken bei. Mit der Tatsache konfrontiert, dass die Messinstrumente kleinere Leckagen erst wenn es zu spät ist, nach ein bis zwei Tagen nämlich, anzeigen, bekannte der technische Überwacher achselzuckend: „Das ist das heute technisch Machbare“.
Pipeline
- 6: Deponie geöffnet
„Gift durch Gift“ - das passt gut“, dachte sich der Leverkusener Multi und verlegte seine Pipeline-Rohre in Hilden und Erkrath quer durch alte Giftmüll-Deponien. Die Bagger hoben die Gruben einfach aus und leiteten das verseuchte Grundwasser in einen Bach um. Dabei hatten die Behörden den Konzern vorher auf die Altlasten hingewiesen und ein abgestimmtes Vorgehen verlangt. Entsprechend verschnupft reagierten die Verantwortlichen. Die zuständigen Kreise legten die Baustellen still und verdonnerten den Pharma-Riesen zu Strafzahlungen. Zudem ermittelt nun der Staatsanwalt wegen umweltgefährdender Gewässerverunreinigung und illegaler Müllentsorgung.
Pipeline
- 7: CO-Produktion modernisiert
Der Leverkusener Multi hat die Notwendigkeit einer Kohlenmonoxid-Pipeline immer mit veralteten CO-Produktionsanlagen begründet. In Krefeld modernisiert der Multi nun aber für drei Millionen Euro seine Fertigungsstätte. Trotzdem will der Konzern an dem umstrittenen Projekt festhalten. Nur mit der Giftgasleitung sei das Unternehmen in der Lage, die weiterverarbeitende Industrie zuverlässig zu beliefern, verlautete aus der Zentrale.
Pipeline
- 8: Flurschaden
Ohne Rücksicht auf Verluste rollten die Bagger zur Aushebung der Pipeline-Schächte quer durch das Naturschutzgebiet Angertal, ohne dafür eine Genehmigung der Landschaftsbehörde einzuholen. Darum verfügte der Landrat Thomas Hendele Anfang September 2007 einen vorläufigen Baustopp.
Offener Brieg wg. Burma
BAYER betrachtet die Militärdiktatur in Burma als einen ganz normalen Absatzmarkt und testet dort Hybrid-Reis, eine nicht zur Wiederaussaat bestimmte Sorte (siehe auch SWB 3/07). Aus Protest gegen diese Geschäftspolitik schrieb die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN gemeinsam mit der BURMA-INITIATIVE ASIENHAUS und anderen Gruppen einen Offenen Brief an den Konzern-Chef Werner Wenning (siehe auch SWB 4/07).
CBG nimmt an TALCID-Wettbewerb teil
„Ein lebendiges, funktionierendes Gemeinwesen, bei dem niemand isoliert oder abseits steht, ist wichtig für das psycho-soziale Wohlergehen jedes Menschen. Ausgrenzung und Isolation können zu Erkrankungen wie Herz/Kreislaufkrankheiten oder Magen-Darm-Beschwerden beitragen. Eine aktive Teilhabe des Einzelnen wirkt sich gesundheitsfördernd aus - sowohl für den engagierten Menschen als auch für die Gesellschaft“, meint BAYER und rief gemeinsam mit der Stiftung „Bürger für Bürger“ den nach einem firmeneigenen Magenmittel benannten „TALCID-Förderpreis für Bürgerengagement“ ins Leben. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) fühlte sich gleich angesprochen, nominierte ihr Vorstandsmitglied Axel Köhler-Schnura für den Preis und begründete es zwingend: „Axel Köhler-Schnura hat den Verband, der weltweit mit 10.000 Partnern in mehr als 40 Ländern kooperiert, 1978 gegründet und hat in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche Verstöße des Konzerns gegen Gesetze und Selbstverpflichtungserklärungen publik gemacht. Gemeinsam mit den Betroffenen setzt er sich für sichere Produkte und Produktionsbedingungen bei BAYER, für Umweltschutz und finanzielle Wiedergutmachung von Geschädigten ein.“ Da die Coordination bei dem letzten BAYER-Wettbewerb, an dem sie zumindest mittelbar beteiligt war - dem für neue Chemiepark-Konzepte (siehe SWB 4/07) so eine gute Figur machte, stehen die Chancen bestimmt auch hier nicht schlecht.
EU deckt LobbyistInnen
In Brüssel treiben rund 15.000 LobbyistInnen ihr Unwesen. Einer ihrer größten Arbeitgeber ist CEFIC, der Europa-Verband der Chemie-Industrie: 140 MitarbeiterInnen beschäftigt die Dependance von BAYER & Co. Damit die AntichambriererInnen ihre Arbeit weiterhin ungestört im Dunkeln verrichten können, hat eine Generaldirektion der EU-Kommission ihre Namen auf allen verfügbaren Sitzungsunterlagen, Briefen und anderen Dokumenten geschwärzt. Dagegen hat die Initiative CORPORATE EUROPE OBSERVATORY (CEO) Beschwerde eingelegt.
BAYERs Blumen des Bösen
Der US-Amerikaner Robert T. OBrien hat einen Polit-Krimi über den Leverkusener Multi geschrieben. „Seeds of Evil“ (Die Blumen des Bösen) handelt von einer kleinen Pharma-Fabrik, die BAYERs Übernahmegelüste weckt. Der Firmeninhaber beginnt sich mit der unheilvollen Geschichte des Agro-Riesen auseinanderzusetzen und wehrt sich mit Händen und Füßen - und mit der Polizeichefin Kristi Christopher - gegen die Pläne. Dabei stoßen die beiden in ein ganzes Nest von Konzernkriminalität und vereiteln schließlich das Vorhaben des Pillen-Riesen.
BUND: Wo ist der Genraps?
Das Unternehmen DEUTSCHE SAATGUTVEREDELUNG säte auf einer Fläche von 1.500 Hektar Raps aus, der mit BAYERs gegen die Herbizide LIBERTY und BASTA resistenten Gentech-Sorten verunreinigt war (Ticker 3/07). Um solchen Gen-GAUs in Zukunft besser vorbeugen zu können, wollte die schleswig-holsteinische Sektion des BUND vom Landesumweltministerium wissen, wo überall zwischen Flensburg und Brunsbüttel Gentech-Raps auf den Feldern steht. Aber das Ministerium verweigerte mit dem Hinweis auf die Gefahr von Feldzerstörungen alle Angaben, obwohl es nach dem Umweltinformationsgesetz eigentlich auskunftspflichtig ist.
Offener Brief wg. Genraps
Die BÜRGERINITIATIVE GENTECHNIKFREIES SCHLESWIG-HOLSTEIN hat die Presse-Information der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) über Raps-Saatgut, das mit BAYERs gegen die Herbizide LIBERTY und BASTA resistenten Gentech-Sorten verunreinigt war, zum Anlass genommen, einen Offenen Brief an den Landwirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, seine Kollegin in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sowie an den Verbraucherschutzminister Horst Seehofer zu schreiben. Darin fordert die Gruppe ein Gentechnik-Moratorium, ein öffentlich zugängliches Register der derzeit laufenden Freisetzungsversuche, eine Haftpflicht des Herstellers BAYER sowie bessere Kontrollen.
KAPITAL & ARBEIT
BMS rationalisiert
BAYER MATERIAL SCIENCE (BMS) erwirtschaftet mit dem Verkauf von Plaste & Elaste eine Rendite von 16 Prozent. Das reicht der Konzern-Spitze jedoch nicht. Darum musste sich die Kunststoff-Sparte verpflichten, „eine angemessene Kapitalrendite zu erzielen und die Ebitda-Marge auf über 18 Prozent im günstigen Marktumfeld zu verbessern“, wie die Financial Times Deutschland den Top-Manager Axel Steiger-Bagel zitiert. Um diese Profit-Ziele zu erreichen, will BMS 300 Millionen Euro einsparen und dazu unter anderem weltweit 1.500 Arbeitsplätze vernichten - ein Zehntel aller Stellen (siehe auch Ticker 3/07). Die Äußerung von Steiger-Bagels Kollegen Tony Van Osselaers über die Produktion des Kunststoffes MDI: „Bis auf Europa ist MDI gut aufgestellt, in Europa haben wir Handlungsbedarf“ sowie Klagen über die teuren Transportwege zwischen den einzelnen Werken schüren zudem Ängste, BAYER könnte ganze Standorte wie z. B. Brunsbüttel schließen. So mancher Beschäftigte des Kunststoffbereichs fürchtet angesichts der Schwerpunkt-Verlagerung in Richtung „Pharma“ sogar einen Verkauf der gesamten Kunststoff-Abteilung.
Antwerpen: BMS streicht 200 Stellen
Am Standort Antwerpen vernichtet BAYER MATERIAL SCIENCE mehr als 200 Arbeitsplätze (siehe auch AKTION & KRITIK). Vor allem den Servicebereich mit Feuerwehr, Wachdienst, Laboren und HandwerkerInnen empfindet der Leverkusener Multi als Last auf dem Weg zu noch mehr Profit.
Lohnkürzungen bei CHEMION
BAYER will die Löhne bei der ausgegliederten Transport-Tochter CHEMION massiv kürzen. Nach Informationen des Betriebsrates sieht der Tarifvertrag für das Jahr 2008 durch eine Neueinteilung der Gehaltsstufen monatliche Einbußen von 458 bis 821 Euro vor. Bleibt die Frage, ob die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE das schluckt?
BIS heißt jetzt CURRENTA
Die innerhalb des BAYER-Konzerns für die Chemieparks zuständige BAYER INDUSTRY SERVICES (BIS) heißt jetzt CURRENTA. „Die Gesellschaft will weg vom Hausmeister-Image“, schreibt die Rheinische Post zu den Beweggründen und konstatiert: „Die Namensänderung ist der letzte Baustein einer für die Mitarbeiter mitunter knallharten Effizienzsteigerungsstrategie“. Seit 2006 vernichtete die BIS zehn Prozent der 5.500 Arbeitsplätze; 400 sollen bis 2009 noch folgen. Für die restlichen Belegschaftsangehörigen setzte das Management massive Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen durch. So erhöhte sich etwa die Wochenarbeitszeit - ohne Lohnausgleich - von 37,5 auf 40 Stunden, was eine Gehaltseinbuße von 6,7 Prozent bedeutet (siehe auch SWB 4/07 und Ticker 3/07).
Dicke Lohnerhöhungen für Aufsichtsräte
Während sich die Masse der Beschäftigten in diesem Jahr mit mageren Entgelt-Erhöhungen zufrieden geben musste, stiegen die Bezüge der Aufsichtsräte kräftig. Sie erhielten durchschnittlich acht Prozent mehr, die jeweiligen Vorsitzenden sogar elf Prozent. So kommt dann BAYERs Ober-Aufseher Manfred Schneider, der als die personifizierte Deutschland AG zusätzlich noch in den Kontrollorganen von DAIMLER, METRO, RWE, TUI , ALLIANZ und LINDE - hier sogar als Aufsichtsratsvorsitzender - sitzt, auf ein Jahressalär von 1.054.717 Euro.
Plansoll-Übererfüllung von LANXESS
BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS hatte sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2009 ebenso viel Profit zu erwirtschaften wie seine Mitbewerber. Der Konzern hat aber derart rabiat Rationalisierungsmaßnahmen durchgeführt, Unternehmensteile veräußert und Arbeitsplätze vernichtet, dass er schon für 2008 mit einer erwarteten Rendite von 12,5 Prozent Vollzug melden kann. Die Aktien-Börsen verbuchten das unter „schöpferischer Zerstörung“ und reagierten mit einer 1,5-prozentigen Kurssteigerung.
LANXESS verkauft BORCHERS
BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS spaltet sich unaufhaltsam weiter auf. Im September 2007 hat das Unternehmen seine auf Lackzusatzstoffe spezialisierte Tochtergesellschaft BORCHERS an den US-Konzern OM verkauft. „Wir haben erneut eine zukunftsfähige Lösung für ein Randgeschäft gefunden“, kommentierte das Vorstandsmitglied Werner Breuers den Deal. Zur Zukunft der 90 Beschäftigten äußerte er sich jedoch nicht.
AGFA im Sinkflug
Im Jahr 1999 trennte sich der Leverkusener Multi von der AGFA und setzte damit weitere Teilungsprozesse bei seiner ehemaligen Foto-Sparte in Gang. Diese vernichteten zwar zahlreiche Arbeitsplätze, konnten aber die Talfahrt nicht stoppen. Am 18. Oktober fiel die Aktie des Unternehmens mit 11,19 Euro auf den tiefsten Stand seit ihrer Notierung. „Das Unternehmen erschütterte 2007 damit zum dritten Mal die Börse“, kommentierte die Faz. Erschütterungen der Belegschaft dürften auf dem Fuße folgen.
IG BCE verliert Mitglieder
Die Mitgliederzahl der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE sank seit Ende 2006 um 15.000 auf 714.000. Davon stehen noch 58 Prozent im Arbeitsprozess. Acht Prozent der IG BCElerInnen sind arbeitslos und rund ein Drittel RentnerInnen.
KONZERN & VERGANGENHEIT
Kultur-Jubiläum mit Geschichtsklitterung
Mit großem Tamtam feiert BAYER in diesem Jahr den 100. Geburtstag seiner Kulturabteilung und will sich dabei von ihren dunklen Kapiteln nicht die Laune verderben lassen. „Nachdem Hugo Caspari 1934 die Leitung der Abteilung abgeben muss, übernimmt der Journalist Ferdinand Gerhardt seinen Posten. Laut BAYER-Geschichtsschreibung bemüht dieser sich um eine unabhängige Kultur- und Bildungsarbeit“, wie das Fono Forum schreibt. Die neue musikzeitung weiß da jedoch anderes zu berichten. „Ferdinand Gerhardt allerdings, der 1934 eingesetzte Mann für die Kultur, kann oder will keine eigenen Impulse setzen. Die Gleichschaltung erreicht auch die BAYER-Kultur“, heißt es dort. Nicht umsonst verboten die Alliierten Gerhardt nach 1945, seinen erlernten Beruf weiter auszuüben.
POLITIK & EINFLUSS
Wenning & Merkel in Indien
Zu dem Manager-Tross, der Angela Merkel im Herbst auf ihrer Indien-Reise begleitete, gehörte auch BAYER-Chef Werner Wenning. Der Leverkusener Multi plant nämlich, seinen Umsatz in dem Land bis zum Jahr 2015 auf eine Milliarde Euro zu verdreifachen. Im Pharma-Bereich hofft der Manager auf bessere Geschäfte durch die 2005 erfolgte Stärkung des Patentschutzes, die für höhere Preise sorgt - und damit für eine schlechtere Versorgung der Bedürftigen mit Medikamenten. Die größten Profite soll aber die Landwirtschaftssparte einfahren. Bereits jetzt Marktführer bei Pestiziden, will BAYER CROPSCIENCE den Staat in Zukunft noch verstärkt mit hybridem Reis beglücken, den die LandwirtInnen nicht wieder aussähen können und deshalb jedes Jahr neu kaufen müssen. Zudem plant der Agro-Riese die Vermarktung von genmanipulierter Baumwolle, obwohl bereits die Baumwolle made by MONSANTO viele indische FarmerInnen ins Unglück gestürzt hat.
Wenning gegen ALG-I-Verlängerung
BAYER-Chef Werner Wenning hat sich gegen eine Verlängerung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I ausgesprochen. „Es ist ein großer Irrtum, wenn man hier Teile der Agenda 2010 wieder zurückdreht“, sagte der 3,3 Millionen Euro im Jahr verdienende Vorstandsvorsitzende. „Das ist der absolut falsche Weg“, warnt er. Der richtige wäre seiner Meinung nach eine Senkung der Lohnnebenkosten. Und auf eben diesen hat sich die Große Koalition dann ja zusätzlich zur ALG-I-Reform auch begeben und dem Leverkusener Multi so zu einem netten Millionengeschenk verholfen.
BAYERs Kulturverständnis
Der Leverkusener Multi inszeniert sich gerne als großer Kulturförderer. Auch die Bundesrepublik setzt auf die „soft power“ der auswärtigen Kulturpolitik zur Öffnung der Märkte. In China wollte man zwar nicht so klotzen wie etwa Frankreich, das für 40 Millionen Euro einen „kulturellen Dialog“ mit dem Land führt, aber 400.000 Euro für ein „deutsch-chinesisches Kulturjahr 2009“ sollten schon drin sein. Flugs setzte die Bundesregierung sich mit der Wirtschaft zwecks finanzieller Unterstützung in Verbindung. Dabei taten sich dann allerdings unverhofft Probleme auf. Als es ans Bezahlen ging, mochten BAYER & Co. nämlich von repräsentativen Dichtern & Denkern und schönen Künsten nicht mehr viel wissen. Damit die Investition sich auch lohnt, sollte statt profit-ferner Geistesgrößen die Initiative „Deutschland - Land der Ideen“, der auch BAYER angehört, die Public-Relation-Arbeit übernehmen. Und so kam es dann auch. Jetzt steht die Standort-Werbung auf den drei Säulen „Kultur“, „Wirtschaft“ und „Wissenschaft“, und bei der Vorbereitung des Events schaut dem Goethe-Institut eine Vertretung der Wirtschaft und eine Agentur für „Nation-Branding“ auf die Finger.
Strom-Deal mit RWE
Die gestiegenen Strom-Kosten für Privathaushalte kümmern die Politik nicht groß. Die Klagen von BAYER & Co. über zu hohe Energiepreise hingegen bewogen die Verantwortlichen zum Handeln. So hat sich das Kartellamt mit RWE auf einen Deal geeinigt. Die Behörde zieht die Kartellklage wg. der Einpreisung der kostenlos zugeteilten Kohlendioxid-Verschmutzungsrechte zurück, und RWE versteigert dafür im Gegenzug Strom für BAYER & Co. auf einer Auktion. Das ergebe „hinreichende Preisvorteile für die Industriekunden“, meldete ein Kartellamtssprecher Vollzug.
Bund fördert Pharmaforschung
Die Bundesregierung kündigte an, die Pharmaforschung von BAYER & Co. bis zum Jahr 2011 mit 800 Millionen Euro zu subventionieren. Ein Schwerpunkt wollen die PolitikerInnen dabei auf die Genmedizin und die Grundlagenforschung legen. Die Förderung versteht sich zudem als strukturpolitische Maßnahme zur weiteren Annäherung von Wissenschaft und Wirtschaft. Geld sollen nämlich nach Angaben von Bundesforschungsministerin Annette Schavan nur Konsortien aus Konzernen und Universitäten bekommen, welche die gesamte Wertschöpfungskette eines Präparates, von den ersten Entwicklungsschritten bis hin zur klinischen Prüfung, im Auge hätten.
Konvent will mehr Steuer-Föderalismus
BAYERs Aufsichtsratschef Manfred Schneider betätigt sich zusätzlich zu seinem Leverkusener Job nicht bloß noch als Aufseher bei ALLIANZ, LINDE, DAIMLER, METRO, RWE und TUI, er gehört auch noch dem „Konvent für Deutschland“ an. Dort befindet er sich in der zweifelhaften Gesellschaft von Otto Graf Lambsdorff, Roman Herzog, Wolfgang Clement und Klaus von Dohnanyi. Ein besonderes Anliegen ist dem exklusiven Club die Förderalismusreform, da er in dem Vorhaben eine große Chance zur weiteren institutionellen Verankerung des Neoliberalismus sieht. „Wir brauchen mehr Wettbewerb unter den Ländern“, mahnte Wolfgang Clement im Namen des Konvents und forderte mehr Länderkompetenzen in der Steuerpolitik ein. Das weitere Auseinandergehen der Schere zwischen reichen und armen Bundesländern nehmen die KonventlerInnen dabei gerne in Kauf, weil das die föderale Standort-Konkurrenz anfacht. Die in der Verfassung festgeschriebenen „einheitlichen Lebensverhältnisse“ sähe Roman Herzog deshalb gerne zu „gleichwertigen“ herabgestuft, und den Länderfinanzausgleich wollen Schneider & Co. auch auf den Müllhaufen der Geschichte werfen.
Schnappauf neuer BDI-Geschäftsführer
Der „Bundesverband der Deutschen Industrie“ (BDI) hat den bayerischen Landesminister für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Werner Schnappauf, zum neuen Geschäftsführer ernannt. Der Industrie-Verband sieht im Zuge der Debatte um die Kohlendioxid-Emissionen offenbar härtere Zeiten auf sich zukommen und wappnet sich für die Diskussionen mit einem „der profiliertesten deutschen Politiker in der Klima-, Umwelt- und Energiepolitik“ (O-Ton BDI).
Plischke neuer VFA-Chef
Der BAYER-Manager Wolfgang Plischke steht seit neuestem dem vom Leverkusener Chemie-Multi mitgegründeten „Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller“ (VFA) vor. Der im Konzern-Vorstand für Innovation, Technik, Umweltschutz sowie für die Asien/Pazifik-Region zuständige Plischke will während seiner Amtszeit „eine Lanze brechen für den Pharma-Standort Deutschland“ im Allgemeinen und die BAYER-affine Rheinschiene im Besonderen sowie für (noch) mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen eintreten. Zudem kündigte er an, dem bei den Pillen-Produzenten äußerst unbeliebten „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWG) das Leben schwer zu machen und im Hinblick auf 2009 schon einmal den Wahlkampf der Pharma-Riesen vorzubeiten.
Große Entrup im ECONSENCE-Vorstand
Wolfgang Große Entrup steht dem BAYER-Stab „Politik und Umwelt“ vor und leitet die Umweltkommission beim CDU-Wirtschaftsrat. Da durfte er bei „econsense“, einer auf umweltpolitisches Lobbying spezialisierten Ausgründung des „Bundesverbandes der deutschen Industrie“, nicht fehlen. Die Organisation wählte ihn in den Vorstand.
Solaro leitet Verbindungsbüro
Im Oktober 2003 hatte der Leverkusener Chemie-Multi seine Berliner Repräsentanz am Pariser Platz in unmittelbarer Nähe zum Regierungsviertel bezogen. „Wir bei BAYER verstehen uns als Bestandteil der Gesellschaft und sehen es daher als unsere Pflicht, uns in die gesetzgeberischen Entscheidungsprozesse einzubringen“, sagte BAYER-Chef Werner Wenning in seiner Eröffnungsrede zum Sinn und Zweck des Verbindungsbüros. Seit Mai 2007 hat es mit Patricia Solaro eine neue Leiterin.
Agrarsubventionen für Bauer BAYER
Die EU machts möglich: Sie betrachtet BAYERs Experimente mit Zuckerrüben und Getreide auf dem Versuchsgut Laacher Hof als landwirtschaftliche Aktivität und überwies dem Global Player 100.000 Euro an Agrarsubventionen.
PROPAGANDA & MEDIEN
Virtueller Klimaschutz
Und immer wieder rettet BAYER das Klima - zumindest virtuell. Ende November 2007 kündigte der Leverkusener Multi großspurig an, eine Milliarde Euro in den Klimaschutz zu investieren und feierte sich darob gleich selbst als Umweltengel - und viele Medien feierten mit. Bei genauerem Hinsehen entpuppte sich das vom „Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung“ als „strategisch geschickt“ gelobte Brimborium allerdings als potemkinsches Dorf. Die 25 Prozent, um die der Konzern bis zum Jahr 2020 den Ausstoß von Kohlendioxid reduzieren will, verstand BAYER-Chef Werner Wenning nicht als absolute Zahl, er setzte sie vielmehr in Relation zur verkauften Produktmenge - was auch die CO2-Einsparungen relativiert. Und auch sonst blieb außer einem mehr oder weniger klima-relevanten Kessel Buntes - schadstoffarme Firmenwagen, ein Null-Emissionshaus in Indien, Biokraftstoff-Pflanzen und widerstandfähigere Ackerfrüchte - nicht viel übrig. Von den avisierten Umweltsünden wie dem - wohl Makulatur bleibenden (siehe WASSER, BODEN & LUFT) - Kohlekraftwerk in Krefeld und den auf den Antwerpener und Brunsbütteler Werksarealen geplanten Klimakillern redete der Ober-BAYER selbstverständlich nicht - aber die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN. „Eine Pressekonferenz zum Thema Klimaschutz, zu der Journalisten aus aller Welt eingeflogen werden, macht keinen Sinn, wenn das in Sachen Klimaschutz problematischste Projekt des Unternehmens mit keinem Wort erwähnt wird. Was ist das Gerede von „Klima-Check“ und „holistischem Ansatz“ wert, wenn dadurch der Einsatz einer solchen Dinosaurier-Technologie nicht verhindert wird? Bei einer Lebensdauer von 40-50 Jahren würde das Steinkohlekraftwerk bis zur Mitte des Jahrhunderts Klima und Umwelt schwer belasten“, erklärte die CBG in einer Presseveröffentlichung, die viele Zeitungen aufgriffen.
Springer hetzt
Ende August 2007 wollte BAYER als Ausrichter einer Konferenz der UN-Umweltbehörde UNEP, an der 150 junge UmweltschützerInnen aus aller Welt teilnahmen, weiter an seinem grünen Image feilen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) protestierte gegen die Alibi-Veranstaltung und präsentierte der Öffentlichkeit das Umweltsündenregister des Konzerns, was auf breite Resonanz stieß. Das bewog den Chemie-Multi jetzt, entgegen sonstiger Gepflogenheiten doch mal das böse C-Wort in den Mund zu nehmen und Gegenaufklärung zu betreiben. In der Propaganda-Postille direkt nahm sich BAYERs Chef-Kommunikator Heiner Springer der Coordination an. „Wenn wir sehen, wie eine Gruppe namens COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN gegen das Unternehmen agitiert - und das seit fast 30 Jahren, dann muss man sich die Frage stellen: Was ist das wirkliche Ziel dieser Menschen, die ja mit Aktien unseres Unternehmens ausgestattet sind. Dividende wird also kassiert ... Klar ist für mich: Sie sind gegen unser Gesellschaftssystem, gegen das so genannte Groß-Kapital“, schrieb er unter der Überschrift „Nur meckern ist einfach zu wenig“. Der Verweis auf die DKP-Mitgliedsschaft eines CBG-Vorstands durfte in seiner Suada natürlich auch nicht fehlen - der erfolgt immer, wenn der Konzern sich durch die CBG besonders in die Defensive gedrängt fühlt.
BAYER & Co. warnen vor Atomausstieg
Eine unter anderem vom „Verband der Chemischen Industrie“ (VCI) in Auftrag gegebene Studie prognostiziert für das Jahr 2030 Strompreis-Erhöhungen von bis zu 50 Prozent, falls die Bundesregierung weiterhin auf erneuerbare Energien setzt und am Atomausstieg festhält. Weil BAYER & Co. dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährdet sehen, wollen sie an AKWs als Standortfaktoren festhalten.
VFA lanciert Arzneimittel-Atlas
Der „Arzneimittelverordnungs-Report“ gibt alljährlich einen Überblick über den bundesdeutschen Pillen-Markt. Den Pharma-Riesen fällt dieser jedoch immer entschieden zu kritisch aus, weshalb der von BAYER mitgegründete „Verband der Forschenden Arzneimittel-Hersteller“ (VFA) zur Tat schritt und mit dem „Arzneimittel-Atlas“ ihr eigenes Kompendium lancierte. Bittere Pillen macht die Publikation kaum aus. Wundersam angestiegene Pharma-Umsätze sind ihr nicht etwa ein Zeichen von Überversorgung, sondern eines Vordringens der Arzneien zu bisher unbehandelten PatientInnen. Auch die mit bloß schein-innovativen Medikamenten gemachten Profite schätzt er mit 143,6 Millionen Euro weit geringer ein als der „Arzneimittelverordnungs-Report“, der auf 442 Millionen kommt. „Insgesamt muss der Arzneimittel-Atlas als ein nur allzu durchsichtiger Versuch der Pharma-Industrie bewertet werden, mit etwas wissenschaftlichem Brimborium Nebel über die immer noch in hohem Maße irrationale Arzneimittel-Therapie in Deutschland zu verbreiten“, lautet deshalb das Fazit der BUKO PHARMA-KAMPAGNE.
BAYERs Tag des Alltagsschmerzes
BAYER hat gemeinsam mit dem deutschen Apotheker-Verband und der Schmerzklinik Kiel einen Alltagsschmerz-Tag initiiert. Für den Leverkusener Multi gehört Schmerz nämlich zum Alltag. 91 Prozent der Menschen zählten zu den Betroffenen, behauptet er mit Berufung auf das Robert-Koch-Institut, und also auch zu den potenziellen ASPIRIN-Kunden. Dieses Marktsegment galt es mit dem Alltagsschmerztag zu erschließen.
„Das Schlechteste, was man tun kann, ist, den Schmerz nicht zu behandeln“, weiß deshalb der Herr Professor Hartmut Göbel und wird noch konkreter: „Die aktuelle Datenlage zeigt, dass IBUPROFEN, ASPIRIN oder PARACETAMOL als Einzelwirkstoffe vergleichbar gut verträglich sind“. Aber „vergleichbar“ ist immer relativ. Die dem Mediziner von der Kölner Schmerzklinik offenbar verborgen gebliebenen neueren Datenlagen dokumentieren nämlich einmal mehr die Gefährlichkeit von ASPIRIN. So erhöht das Mittel nach einer Studie der Universität Oxford das Risiko für durch Blutungen im Gehirn ausgelöste Schlaganfälle, da es den Blutfluss anregt (Ticker 3/07).
BAYER sponsort ESSM-Kongress
Beim 10. Kongress der „European Society of Sexual Medicine“ (ESSM), der standesgemäß im malerischen Lissabon standfand, trat BAYER als einer der Hauptsponsoren auf. Das war der Leverkusener Multi der ESSM und dessen Geschäftsführer John Dean aber auch schuldig. Die Gesellschaft half BAYER mit ihrer Studie „Sex and the Modern Woman“ nämlich gehörig, den Verkauf des Potenzstörungsmittels LEVITRA anzukurbeln. Die vom Leverkusener Multi finanzierte Untersuchung stellte nicht nur ein für alle Mal die Überlegenheit von LEVITRA gegenüber VIAGRA fest, sondern versuchte die Männer darüber hinaus auf eine perfide Art zum BAYER-Kunden zu machen: über die Frau. So betrachten angeblich 76 Prozent aller Frauen die „erektile Dysfunktion“ ihres Partners als eine Belastung, während sich 72 Prozent zufrieden über die pharmakologischen Behandlungsmöglichkeiten äußerten. Da es sich bei der „erektilen Dysfunktion“ aber in den meisten Fällen überhaupt nicht um ein Krankheitsbild, sondern um eine ganz normale Alterserscheinung handelt, hat der Report zur Umsatzsteigerung „ein neues Profil identifiziert“, das gleich auf 48 Prozent der Teilnehmerinnen zutraf: Die „vitalsexuelle Frau“ über 40. Diese legt auch im fortgeschrittenen Alter noch viel Wert auf ein spontanes Sexualleben und die Zufriedenheit des Partners. Solchen Ansprüchen, denen die vitalsexuelle Ex-Frau von Mick Jagger, Jerry Hall, bei der Vorstellung der Expertise leibhaftigen Ausdruck verlieh, soll mann dann mit LEVITRA genügen.
BAYER sponsort Verhütungstag
„Fünf gegen das Wachstum der Bevölkerung investierte Dollar sind wirksamer als hundert für das Wirtschaftswachstum investierte Dollar“, sagte einst der ehemalige US-Präsident Lyndon B. Johnson über seine Vorstellung von „Entwicklungshilfe“. Zur Freude des Leverkusener Multis erfreut sich diese Ansicht auch heute noch großer Beliebtheit, die „gigantischen Fruchtbarkeitsmärkte“ in den armen Ländern versprechen nämlich gute Absatzchancen für die Verhütungsmittel aus Leverkusen. Um die Geschäftsaussichten für YASMIN & Co. noch ein wenig zu verbessern, hat der Pharma-Riese jetzt gemeinsam mit der „European Society of Contraception“ und anderen Organisationen den 21. September medienwirksam zum „Weltverhütungstag“ erklärt und mit einer Großspende die Durchführung ermöglicht.
BAYERs Bevölkerungspolitik
Familienplanung sei ein Schlüssel für Nachhaltige Entwicklung, sagte der UNICEFler Ingar Brüggemann beim „6. internationalen Dialog über Bevölkerung und Nachhaltige Entwicklung“. Um solche Sätze zu hören, hat BAYER die Veranstaltung mitorganisiert. Der Leverkusener Multi verfügt nämlich mit YASMIN und anderen Kontrazeptiva über die geeigneten „Planungsinstrumente“, die - mit freundlicher Unterstützung des Entwicklungshilfeministeriums - auf Absatz in der „Dritten Welt“ hoffen. In der Berichterstattung über die Konferenz stieg der Pillen-Riese sogar selbst zum Entwicklungshelfer auf. „Der 6. Internationale Dialog, an dem 120 Politiker, Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen sowie Wissenschaftler aus rund 15 Ländern teilgenommen haben, wurde vom Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung gemeinsam mit der BAYER SCHERING PHARMA AG und anderen Entwicklungsorganisationen veranstaltet“, meldete die Nachrichtenagentur ddp.
SchülerInnen produzieren Löffel
Graue Theorie ohne praktischen Bezug nützt nichts, meint die an einem Erftstädter Gymnasium Chemie lehrende Julia Schneider, und schickte ihre Schüler zur Bewährung in die BAYER-Produktion. Dort mussten die ZwölfklässerInnen im Schülerlabor Eierlöffel herstellen und vom Design über die Fertigung bis zur Vermarktung alles selber in die Hand nehmen. „Chemie ist, wenn am Ende ein Produkt dabei herauskommt“, diese BAYER-Lektion dürften die Eleven also gelernt haben.
DRUGS & PILLS
Aus für TRASYLOL
Nachdem eine neuerliche Studie BAYERs zur Blutstillung bei Herz-OPs eingesetzter Arznei TRASYLOL wiederum tödliche Nebenwirkungen bescheinigt hatte, zog die US-Gesundheitsbehörde FDA endlich die Konsequenz und forderte den Leverkusener Pillen-Riesen zu einem Vermarktungsstopp auf (siehe auch SWB 4/07).
Aus für TOCOSOL
Der Leverkusener Multi und sein Kooperationspartner SONUS haben die Entwicklung des Brustkrebs-Medikamentes TOCOSOL in der dritten und letzten Phase der klinischen Erprobung gestoppt. Die Arznei, mit der BAYER einen Jahresumsatz von 250 Millionen Euro machen wollte, wirkte nicht besser als das Vergleichsmittel TAXOL und hatte darüber hinaus mehr Nebenwirkungen.
Nierentransplantation wg. ASPIRIN & Co.?
Sporttreiben ist allzu oft eine schmerzvolle Angelegenheit. Um das vergessen zu lassen, schlucken die AthletInnen ASPIRIN und andere Präparate in rauhen Mengen (Ticker berichtete mehrfach). Welche katastrophalen Folgen das haben kann, zeigte jetzt der Fall „Ivan Klasnic“. Der Fußballprofi von Werder Bremen musste sich unlängst einer Nierentransplantation unterziehen - vermutlicher Grund nach Ansicht des Bremer Professors Arno-Ekkehart Lison: jahrelanger Schmerzmittel-Missbrauch.
Rückschlag für BETAFERON
Für den meisten Profit in BAYERs Pharma-Sparte sorgt das Multiple-Sklerose-Mittel BETAFERON mit einem Jahresumsatz von einer Milliarde Euro. Allerdings dürften die besten Tage des Medikamentes gezählt sein, da das Patent bald ausläuft und die Präparate der Konkurrenz zunehmend Marktanteile gewinnen. Darum musste sich der Leverkusener Multi etwas einfallen lassen, um die Lebenserwartung seines Megasellers zu erhöhen. Im Zuge des „Life-Cycle-Managements“, wie der Fachausdruck in Pharmakreisen lautet, erprobte BAYER zwecks Erlangung eines neuen Patentes eine BETAFERON-Version mit doppelter Wirkstoffmenge. Die Ergebnisse enttäuschten jedoch. Weder gegenüber dem alten BETAFERON noch gegenüber den Arzneien der Mitbewerber ergaben sich Therapie-Vorteile, so dass der Pharma-Riese die Entwicklung einstellen musste.
Hörschäden durch LEVITRA
Die Einnahme von LEVITRA und anderen Mittel gegen „erektile Dysfunktion“ kann zu Hörschäden führen. MedizinerInnen meldeten bei der US-Gesundheitsbehörde FDA Fälle von plötzlicher Taubheit, Tinnitus, Schwindel und Höhenangst. Die FDA reagierte prompt und zwang BAYER & Co., ihre Beipackzettel mit entsprechenden Warnhinweisen zu versehen. Zu den weiteren Nebenwirkungen von LEVITRA zählen Blindheit, Kopfschmerzen, Nasenschleimhaut-Entzündungen, Grippe-Symptome sowie Gesichtsrötungen.
Black-Box-Warnung wg. MAGNEVIST
In den USA hat das Kontrastmittel MAGNEVIST 2004 den Tod eines Menschen verursacht. Der 24-jährige Trevor Drake verstarb während einer Tomographie kurz nach der Injektion des Mittels (siehe Ticker 2/07). Bei dem nierenkranken Patienten hat der Inhaltsstoff Gadolinium eine Fibrose - ein unkontrolliertes Wachstum des Bindegewebes - hervorgerufen, die zu einem Organversagen führte. Seine schwer geschädigten Nieren konnten MAGNEVIST nur so langsam abbauen, dass das hochgiftige Gadolinium aus seiner chemischen Umhüllung gedrungen ist und die Fibrose ausgelöst hat. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat deshalb unlängst die Anwendung von Gadolinium-haltigen Kontrastmitteln bei Nierenkranken untersagt und den Leverkusener Multi, zu dessen Produktpalette die Arznei seit dem Aufkauf von SCHERING gehört, sowie die anderen Hersteller dazu verpflichtet, auf den Beipackzetteln künftig deutlich vor dieser Komplikation zu warnen. Dies half aber offenbar wenig. Nachdem die FDA 250 neue Berichte über Komplikationen erhalten hatte, entschloss sich die Behörde, noch deutlicher zu werden. Sie zwang BAYER und drei andere Hersteller von Kontrastmitteln, „Black-Box-Warnungen“ auf den Packungen anzubringen - in den USA deutlichste Form, Risiken und Nebenwirkungen eines Medikamentes anzuzeigen.
Aus für BfArM-Reform
Laut Koalitionsvertrag sollte das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-Produkte“ (BfArM) „eine international konkurrenzfähige Zulassungsagentur werden“, statt den Risiken und Nebenwirkungen der Arzneien von BAYER & Co. wirklich auf die Spur zu kommen. Zu diesem Behufe wollte Gesundheitsministern Ulla Schmidt die Behörde, die schon jetzt Medikamente so schnell zulässt wie keine andere in Europa, von Geldern der Pharma-Industrie abhängig machen und die staatliche Unterstützung noch weiter zurückfahren. Dies ging aber selbst der CDU zu weit. „Der Schutz der Gesundheit der Patienten ist höherrangiger als das Interesse der Hersteller an der ungehinderten Vermarktung ihres Produktes“, belehrte deren Vize-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Zöller die Gesundheitsministerin. Das sorgte für erheblichen Streit in der Großen Koalition. Aber letztendlich musste Schmidt nachgeben und den Gesetzesentwurf zurückziehen, woraufhin sich auch Reinhard Kurth als BfArM-Chef zurückzog.
Arznei-Kosten: plus 7,7 Prozent
Und ewig steigen die Pillen-Preise: Von Januar bis September 2007 mussten die Krankenkassen für ärztliche Verordnungen 7,7 Prozent mehr ausgeben als im letzten Jahr. Die Pharma-Riesen machen dafür wider besseren Wissens die Mehrwertsteuer-Erhöhung verantwortlich, auf deren Konto lediglich 2,7 Prozent der Mehrkosten gehen. Besonders gern zücken die MedizinerInnen im Ostteil der Republik den Rezeptblock zugunsten von BAYER & Co.. 425 Euro verdienen die Pillen-Produzenten dort jährlich pro Kassenpatient, während sie im Westen „nur“ 370 Euro einstreichen. „Die Pharma-Vertreter haben im Osten seit der Wiedervereinigung einfach ganze Arbeit geleistet“, mit diesen Worten erklärt Leonhard Hansen von der „Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein“ die Schieflage.
Netzhaut-Präparat im Test
BAYER entwickelt gemeinsam mit dem Unternehmen REGENERON ein Medikament gegen die oft zu Blindheit führende Netzhaut-Erkrankung „Makula-Degeneration“. Das Präparat, welches das Absterben von Netzhautzellen unterbinden soll, befindet sich momentan in der dritten und letzten Phase der klinischen Erprobung. Der Leverkusener Multi rechnet mit einem Umsatz-Potenzial von 250 bis 500 Millionen Euro.
Neues Antibiotikum
Das US-Unternehmen NEKTAR THERAPEUTICS entwickelt für BAYER ein neues Antibiotikum zur Behandlung von Lungenentzündungen und erhält dafür vom Leverkusener Multi 175 Millionen Dollar.
Immer mehr Nebenwirkungen
Die Zahl der Behandlungsfälle wegen Arzneimittel-Nebenwirkungen hat in den USA stark zugenommen. Während die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA im Jahr 1998 „nur“ 35.000 Meldungen über unerwünschte Medikamenten-Effekte erhielt, erhöhte sich die Zahl bis 2005 auf fast 90.000. Die Todesfälle nahmen dabei fast um das Dreifache zu: 15.000 Menschen starben durch Pharmazeutika. Das „Institute of Social and Preventive Medicine ( ISPM) macht neben Opiaten und Diabetes-Präparaten auch biotechnologische Produkte wie BAYERs zur Behandlung von Multipler Sklerose eingesetztes BETAFERON für den alarmierenden Befund verantwortlich.
PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE
Endosulfan-Vergiftung in Brisbane
Im australischen Hafen Brisbane hatte ein Pestizid-Container mit dem Bestimmungsziel „BAYER“ ein Leck, durch das Endosulfan austrat. Ein Hafenarbeiter kam in Kontakt mit der Substanz und zog sich eine lebensgefährliche Chemikalien-Vergiftung zu.
Mehr Auflagen für Endosulfan
Der Pestizid-Wirkstoff Endosulfan, enthalten in den BAYER-Produkten MALIX, PHASER und THIODAN, ist in der Bundesrepublik wegen seiner Gefährlichkeit bereits verboten. Unter Auflagen darf ihn der Leverkusener Multi jedoch noch in Länder der „Dritten Welt“ exportieren. Im Juli 2007 hat sich die Europäische Kommission nun dafür ausgesprochen, das Mittel gemeinsam mit dem ebenfalls in BAYER-Mitteln enthaltenden Trifluralin (siehe WASSER, BODEN & LUFT) auf die Liste der Stockholmer Konvention für besonders giftige Substanzen zu setzen und damit sein Verschwinden von allen internationalen Märkten einzuleiten. „Wegen des Potenzials dieser Chemikalien zum weiträumigen Transport in die Umwelt kann ein hohes Schutzniveau für die Umwelt und die menschliche Gesundheit nicht allein durch Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedsstaaten oder der Gemeinschaft gewährleistet werden“, hieß es aus Brüssel zur Begründung.
Kombinationswirkung mit dem Klimawandel
Pestizide vermindern die Fähigkeit von Fischen, die Folgen des Klimawandels wie die Erwärmung des Wassers zu bewältigen. Zu diesem Schluss kommt eine australische Studie, welche die Zeitschrift Environmental Toxicology and Chemistry (Vol. 26, No. 7) veröffentlichte. Süßwasser-Fischarten, die den Wirkungen der Ackergifte Chlorpyrifos und Endosulfan (enthalten in den BAYER-Produkten BLATTANEX, PROFICID und RIDDER bzw. MALIX, PHASER und THIODAN) ausgesetzt waren, konnten sich deutlich schlechter an die gestiegenen Temperaturen ihres Lebensraumes anpassen als ihre von Agrochemikalien verschont gebliebenen Artgenossen.
Bienensterben durch IAPV?
In den USA verendeten seit 2006 über eine Million Bienenvölker; die Bestände dezimierten sich um 70 Prozent (siehe auch SWB 3/07). Die Ursache hatten die WissenschaftlerInnen bisher nicht ergründen können. Viele hatten aber das schon lange als „Bienenkiller“ in der Kritik stehende BAYER-Pestizid GAUCHO in Verdacht. Ian Lipkin und sein Forscherteam von der Columbia-Universität lieferten jetzt eine andere Erklärung. Sie machen das „Israeli Acute Paralysis Virus“ (IAPV) für das Massensterben verantwortlich, das in Israel viele Bienen getötet hat. Ein direkter Nachweis gelang ihnen jedoch bisher nicht. Nicht nur weil die US-amerikanischen Bienen nicht die gleichen Krankheitsymptome zeigten wie die israelischen, lässt die IAPV-Theorie noch viele Fragen offen.
ALS-Krankheit durch Pestizide?
In Italien erkranken immer mehr Menschen am „Lou-Gehrig-Syndrom“ (ALS). Da vor allem Fußballer und LandwirtInnen von der Nervenkrankheit betroffen sind, vermutet der in Doping-Sachen ermittelnde Staatsanwalt Raffaele Guariniello bei den Sportlern neben leistungsfördernden Medikamenten und Überbelastung auch Pestizide als Ursache, mit denen die Kicker auf den Fußballfeldern in Berührung kommen.
Frühgeburten durch Pestizide
Nach einer Studie US-amerikanischer ForscherInnen von der Universität Indiana können Pestizide Frühgeburten auslösen. Ihrer Untersuchung zufolge stieg zur Hauptzeit des Pestizid-Einsatzes im Mai und Juni auch regelmäßig die Zahl der vorzeitig zur Welt gekommenen Babys an.
PAN: Haushaltsgifte verbieten!
Pestizide für den Hausgebrauch wie z. B. das BAYER GARTEN GARTENSPRAY oder die BAYER GARTEN COMBISTÄBCHEN enthalten in gleicher Weise Imidacloprid und andere gefährliche Substanzen wie Ackergifte und können aus diesem Grund in gleicher Weise nicht nur Schadinsekten, sondern auch Bienen und Fische töten. Um das Biotop „Garten“ besser zu schützen, fordert das PESTIZID-AKTIONS-NETZWERK (PAN) deshalb eine Verschärfung der Zulassungsbedingungen für diese Chemikalien. „Die Gesetzgeber auf nationaler und europäischer Ebene müssen hier endlich Verantwortung übernehmen. Mittel mit negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt, die von Laien eingesetzt werden, müssen aus der Zulassung herausgenommen werden“, verlangt die PAN-Aktivistin Carina Weber.
GENE & KLONE
Neues Gensoja
Die „grüne Gentechnik“ hat zwar immer noch nicht so recht Fuß gefasst, stößt aber bereits an Grenzen. Die Schadinsekten und Unkräuter werden mit der Zeit nämlich genauso immun gegen bestimmte Pestizide, wie es die Ackerfrüchte dank der Gentechnik „von Geburt an“ sind, und trotzen deshalb ebenso wie diese den chemischen Keulen. Darum planen die Unternehmen, von den agrochemikalischen Monokulturen Abschied zu nehmen. So will BAYER gemeinsam mit MERTEC und M.S. TECHNOLOGIES eine Sojabohnen-Art entwickeln, die sowohl gegen Glyphosat (Wirkstoff von GLYPHOS und USTINEX G) als auch gegen Isoxaflutol (Wirkstoff von BALANCE) resistent ist. Das soll dann eine „flexiblere Unkrautbekämpfung“ ermöglichen.
Genreis im Bier
GREENPEACE hat in US-amerikanischem Bier Spuren von BAYERs Genreis der Sorte LL601 entdeckt, der im Jahr 2006 durch die Verunreinigung von konventionellem Supermarkt-Reis bereits einen Skandal ausgelöst hatte (siehe SWB 4/06). Fündig wurden die UmweltschützerInnen bei dem BUDWEISER herstellenden Unternehmen ANHEUSER-BUSCH, das zum Brauen Reis verwendet. Drei von vier Proben aus den Reis-Mühlen des Konzerns wiesen Spuren von LL601 auf. Gegen Gesetze verstößt der Konzern damit allerdings nicht - die US-Regierung hatte nach dem Gen-GAU nämlich nichts Eiligeres zu tun, als BAYERs Labor-Entwicklungen nachträglich die Genehmigung zu erteilen. Nur die Exportmärkte stehen dem gegen das Anti-Unkrautmittel LIBERTY resistenten Reis nicht offen. „ANHEUSER-BUSCH muss eine Erklärung über den Grad der genetischen Verunreinigung des zum Brauen von BUDWEISER verwendeten Reis abgeben und Auskunft über die Maßnahmen erteilen, die sicherstellen, dass das Bier nicht die Exportmärkte erreicht“, forderte die GREENPEACE-Sprecherin Doreen Stabinsky deshalb.
Australien will Genraps
Der australische Bundesstaat New South Wales hat Ende November 2007 bekannt gegeben, das Moratorium für Genraps auslaufen zu lassen und damit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Vor der Entscheidung hatten 250 Agrar-Betriebe den Ministerpräsidenten vergeblich aufgefordert, den Bann aufrechtzuerhalten. Nicht nur weil die LandwirtInnen jetzt mit einer Verunreinigung ihrer Ernte und infolgedessen einem Wegbrechen der Exportmärkte rechnen müssen, befürchten sie Einkommensverluste. Auf 143 Millionen Dollar jährlich bezifferte das NETWORK OF CONCERNED FARMERS (NCF) das zu erwartende Minus. „Hier geht es um Industrien, die Geld mit den LandwirtInnen machen wollen und nicht für sie“, stellte die NCF-Sprecherin Julie Newman fest.
Genreis-Schaden: 1,2 Milliarden
Im letzten Jahr fand sich genmanipulierter Reis von BAYER massenhaft in herkömmlicher Supermarkt-Ware. GREENPEACE hat jetzt eine erste Bilanz des Flurschadens gezogen, den dieser Gen-GAU angerichtet hat. Nach den Berechnungen der Umweltschutzgruppe belaufen sich die Kosten des Desasters auf 1,2 Milliarden Dollar. Die Lebenmittel-Rückrufe schlugen dabei mit 253 Millionen zu Buche, die Exportverluste für die US-amerikanischen Reis-FarmerInnen in der Saison 2006/07 mit 254 Millionen und die für 2007/08 zu erwartenden mit 445 Millionen. „Es ist sicherlich das einschneidenste Ereignis in der Geschichte der US-amerikanischen Reis-Industrie“, klagt der Verbandssprecher David Coia deshalb.
Genreis-GAU: Ursache unbekannt
Die Wege der Gentechnik sind unergründlich, wie Gentech-GegnerInnen schon seit langem wissen: 14 Monate lang untersuchten die US-Behörden, wie BAYERs Genreis LL601 in herkömmliche Sorten und damit in die Supermärkte gelangen konnte. Aber den ExpertInnen gelang es nicht, den Tatbestand aufzuklären, weshalb sie BAYER auch nicht als eindeutigen Täter überführen und zur Kasse für den angerichteten Schaden (s. o.) bitten mochten.
LL601 erreicht China
Nun also auch China: GREENPEACE hat in chinesischem Supermarkt-Reis Spuren von BAYERs genmanipulierter Sorte LL601 entdeckt, der im Jahr 2006 bereits in den USA und Europa für einen Lebensmittelskandal gesorgt hatte. Da China kaum Reis aus dem Westen importiert, gibt es bisher noch keine Erklärung für die Verunreinigung.
BAYERs Genmais in Österreich?
Die EU hatte den Import von BAYERs gentechnischen verändertem Mais „T25“ und der MONSANTO-Sorte „Mon 810“ genehmigt. Österreich hat die Zulassung jedoch nicht akzeptiert und sich dabei auf das Recht der EU-Staaten berufen, bei Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt Alleingänge vorzunehmen. Gegen dieses nationale Verbot reichten die USA, Kanada und Argentinien umgehend Klage bei der WTO ein. Daraufhin übernahm wieder die EU-Kommission. Aber gegen ihren Versuch, Zwangsmaßnahmen gegen Österreich einzuleiten, votierten zu viele Mitgliedsländer. Eine qualifizierte Mehrheit erreichten diese jedoch nicht, weshalb die Kommission nun das letzte Wort hat, das ein Machtwort sein dürfte. Andernfalls drohen nämlich WTO-Strafzölle.
Auftrieb für die Gentechnik?
Was jahrelang teure PR-Kampagnen nicht vermochten, soll jetzt die Verknappung wichtiger landwirtschaftlicher Güter schaffen: den Boden für einen flächendeckenden Einsatz der grünen Gentechnik bereiten. Der BAYER- CROPSCIENCE-Chef Friedrich Berschauer spricht bereits von einer „stillen Agrarrevolution“ und bezeichnet die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung als „eine der drängendsten Fragen der Zeit“. Und weil sich da für ihn natürlich die Gentechnik als Antwort aufdrängt, dürfe er sich noch eine Weile als Panikmacher betätigen.
Neue Testphase für Alemtuzumab
Im Rahmen der klinischen Erprobung des Multiple-Sklerose-Wirkstoffes Alemtuzumab, den BAYER gemeinsam mit GENZYME auf gentechnischer Basis entwickelte, haben Vergleichsstudien begonnen, anhand derer der Pharma-Multi die Überlegenheit seines Präparates gegenüber der Arznei REBIF beweisen will. Eine Marktzulassung strebt der Leverkusener Multi für das Jahr 2011 an.
WASSER, BODEN & LUFT
Schmoldt für Kohlekraftwerke
Trotz wohlfeiler Bekenntnisse zum Klimaschutz setzt BAYER zur Deckung seines Energiebedarfs auf die in großen Mengen Kohlendioxid ausstoßenden Kohlekraftwerke. Die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE trägt diese umweltschädigende Politik mit. „Wenn dem Kernkraft-Tabu nun die Stigmatisierung der Kohle folgt, wird Deutschland energie- und klimapolitisch handlungsunfähig“, so geht Ökologik à la Schmoldt.
Kein Kraftwerk in Krefeld?
Das Engagement der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und vieler anderer AktivistInnen gegen das geplante Kohlenkraftwerk auf dem Krefelder Werksgelände von BAYER scheint Erfolg zu haben. Während die SPD auf Druck der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE ihre ablehnende Haltung aufgab und sich bei dem dafür extra einberufenen Sonderparteitag sogar bundespolitischen Flankenschutz von Bundesumweltminister Sigmar Gabriel verschaffte, blieb die CDU nach einem partei-internen Diskussionsprozess bei ihrer Position und brachte damit das Projekt vorerst zu Fall.
Ein Kraftwerk in Antwerpen
Zur Deckung seines immensen Energie-Bedarfs will der Leverkusener Multi mehr und mehr auf klimaschädliche Steinkohlekraftwerke zurückgreifen. Sie liefern nämlich den billigsten Strom, und spätestens wenn es ums Geld geht, hört bei BAYER der Umweltschutz auf. So plant der EON-Konzern auf dem Antwerpener Werksgelände des Unternehmens eine 1100-Megawatt-Anlage mit einem CO2-Ausstoß von sechs Millionen Tonnen im Jahr, die den Agro-Riesen und andere Firmen versorgen soll. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) und der BUND verurteilten das Vorhaben in einer gemeinsamen Presseerklärung. „Erneut will sich der BAYER-Konzern am Bau eines Klima-Killers beteiligen. Damit konterkariert das Unternehmen sein vollmundiges Versprechen, im Klimaschutz neue Maßstäbe setzen zu wollen. Wie will BAYER zum Klimaschutz beitragen, wenn das Unternehmen bei seinen Zulieferern auf Steinzeit-Technologie setzt?“, kritisierte CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes.
Ein Kraftwerk in Brunsbüttel
Nicht nur in Antwerpen (s. o.), auch auf dem Gelände des Brunsbütteler Chemieparks ist ein klimaschädigendes Steinkohlekraftwerk geplant, das BAYER und andere Unternehmen mit Energie versorgen soll.
Rhein nur „mäßig belastet“?
Vor allem die Stilllegung vieler Betriebe hat die Wasserqualität des Rheins verbessert. Im grünen Bereich ist der Fluss jedoch noch lange nicht. Er gilt momentan als „mäßig belastet“. Schwermetalle finden die ExpertInnen nur noch selten in ihren Proben, „aber ein Problem mit chemischen Stoffen haben wir immer noch“, sagt Stefan Staas von der nordhein-westfälischen Rheinfischerei-Genossenschaft. Vor allem Dioxine und Pestizide tummeln sich weiterhin in dem Gewässer. Die nur „mäßige“ Belastung könnte jedoch auch der nur mäßigen Kontrolle geschuldet sein. Die privatisierten Wasserversorger wie RWE führen nur äußerst laxe Untersuchungen durch, und auch staatliche Stellen bauen entsprechend geschultes Personal ab. Die Wasser-KontrolleurInnen können zudem immer nur das finden, was sie auch suchen, weshalb so manche Chemikalie unentdeckt bleibt (s. u.). Der Nachweis von Perfluorierten Tensiden (PFT) gelang dem „Bonner Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit“ deshalb bloß durch Zufall. Der Skandal führte zu einer Diskussion um eine verbesserte Qualität der Wasseraufbereitung, aber die Industrie scheut teure Investitionen. Der Bonner Wissenschaftler Harald Färber allerdings sieht dringenden Handlungsbedarf: „Wenn wir immer nur die Mindeststandards erfüllen, trinken wir demnächst einen Chemie-Cocktail aus dem Wasserhahn“.
Tolylfluanid im Trinkwasser
Das „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit“ (BVL) hat BAYER die Zulassung für den Pestizid-Wirkstoff Tolylfluanid entzogen, den der Agro-Riese unter den Produkt-Namen EUPAREN M WG, FOLICUR EM und MELODY MULTI vermarktet (Ticker 2/07). Gelangt die Chemikalie in Flüsse, die zur Trinkwassergewinnung dienen, kann sein Abbauprodukt Diemethylsulfamid im Zuge der Aufbereitung nämlich das gesundheitsgefährdende Nitrosamin bilden, wenn die Wasserversorger zur Entkeimung Ozon einsetzen. Das Verbot hat einige schwäbische Städte veranlasst, ihre Gewässer gezielt nach Tolylfluanid-Rückständen zu untersuchen. Die Ergebnisse waren erschreckend: In mehreren Ortschaften überschritt das Pestizid die Grenzwerte um das Vierfache! Das veranlasste die Behörden aber nicht zum Eingreifen. Mit der Begründung, das Wasserwerk in Schussenthal verwende kein Ozon, erachtete das Kreisgesundheitsamt die Belastung als ungefährlich und erteilte eine bis zum 30. April 2010 geltende Ausnahmegenehmigung für Tolylfluanid-verseuchtes Wasser. „Nicht zumutbar“ sei das, urteilte der Ravensburger Arzt Dr. Friedhelm Struben und schrieb einen Offenen Brief an die KommunalpolitikerInnen. „Wasser ist ein Grundnahrungsmittel. Ich kann doch die Grenzwerte nicht einfach am grünen Tisch ändern, weil es so am bequemsten ist“, erboste er sich.
EU kippt Bodenschutzgesetz
EU-weit sind ca. 3,5 Millionen Grundstücke durch Chemikalien, Schwermetalle oder Dioxin verunreinigt. Die Kosten für die Sanierung dieser Böden beziffert die Brüsseler Kommission auf 38 Milliarden Euro. Darum wollte die Europäische Union ihre Anstrengungen zum Bodenschutz verstärken (Ticker 1/07). Nach einem neuen Richtlinien-Entwurf sollten BAYER & Co. beim Verkauf von Firmen-Arealen künftig Expertisen über die im Erdreich schlummernden Schadstoffe vorlegen müssen. Aber die Vorschläge fanden im Industrie- und Umweltausschuss keine Mehrheit, und die jetzt fälligen Nachbesserungen lassen vom Geist des Gesetzes nicht mehr viel übrig. „Nach dem überarbeiteten Regelungsentwurf würde sich für Deutschland kein Änderungsbedarf ergeben“, schreibt die Faz.
Jährlich 649.000 Tonnen Abfall
649.000 Tonnen Abfall fiel bei der BAYER-Produktion im Jahr 2006 an. Dank dieses hohen Aufkommens droht die Sondermüll-Deponie in Leverkusen-Bürrig in 40 Jahren zum neuen Wahrzeichen der Kommune zu werden. Da die Altlasten sich laut Gesetz noch zu einem 70 Meter hohen Berg auftürmen dürfen, reichen sie bis zum Jahr 2047 bis auf zweieinhalb Meter an den bisherigen Blickfang der Stadt, den Wasserturm, heran.
GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV
Bezahlte Bisphenol-Entlastungsstudien
BAYER zählt zu den größten Herstellern der Chemikalie Bisphenol A, die in Alltagsgegenständen wie Mineralwasser- und Babyflaschen sowie Konservendosen enthalten ist. Die Substanz wirkt hormon-ähnlich und stört so die Entwicklung des Gehirns, Stoffwechselprozesse und die Fortpflanzungsfähigkeit. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und andere Initiativen fordern deshalb seit langem ein Verbot. Aber BAYER & Co. halten dagegen und geben reihenweise Entlastungsgutachten in Auftrag. Für das letzte engagierten die Multis die Biologin Rochelle Tyl von der Beratungsfirma RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE. Früher selbst in Diensten der Chemie-Industrie, hatte sie sich durch mehrere industrie-freundliche Untersuchungen empfohlen und leistete auch diesmal wieder ganze Arbeit. Ihr Studien-Design lieferte das gewünschte verharmlosende Ergebnis, und die EU-Lebensmittelbehörde EFSA setzte umgehend einen neuen Bisphenol-Grenzwert fest, der den VerbraucherInnen das Fünffache der bisher gerade noch als verträglich angesehenen Bisphenol-Dosis zumutet.
BUND warnt vor Quecksilber-Belastung
Das Schwermetall Quecksilber, von dem BAYER im Jahr 2004 ca. 33 Kilogramm in die Gewässer leitete, gehört zu den gefährlichsten Substanzen auf der Welt. Sie vergiftet Mensch, Tier und Umwelt in immer größerem Maße. Nach einer vom BUND mit in Auftrag gegebenen Studie, die 250 Frauen aus 21 Ländern untersuchte, wiesen 15 Prozent der Testpersonen eine über dem Grenzwert liegende Quecksilber-Belastung auf.
NANO & CO.
BAYER & Co. blocken bei Nano-Gefahren
Nano ist das griechische Wort für Zwerg. Die Nano-Technologie beschäftigt sich folglich mit klitzekleinen Materialien. So entwickelten BAYER-ForscherInnen winzige Duftkapseln, die Chemie-Leder wieder den Originalgeruch verschaffen sollen. Eine andere Abteilung will Kunststoffen durch die Einarbeitung von Nanoröhrchen aus Kohlenstoff zu mehr Härte und Leitfähigkeit verhelfen. Und Folien made by BAYER halten jetzt dank luftabhaltender Nanopartikel industriell produzierte Lebensmittel länger frisch. Der Leverkusener Chemie-Multi erwartet von der „Zukunftstechnologie“ Millionen-Umsätze, nur leider teilt diese die schlechten Eigenschaften vieler alter Technologien: Sie stellt ein Risiko für Mensch, Tier und Umwelt dar. Das räumt sogar der Konzern selber ein. „Bei vielen unlöslichen Nanomaterialien ist derzeit nicht auszuschließen, dass die inhalative Aufnahme dieser besonders kleinen Partikel am Arbeitsplatz zu Gefährdungen führen kann“, heißt es in dem vom „Verband der Chemischen Industrie“ gemeinsam mit der „Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin“ herausgegebenen „Leitfaden für Tätigkeiten mit Nanomaterialien am Arbeitsplatz“. Einer besseren Vorsorge verweigern sich BAYER & Co. aber trotzdem. Die Ergänzung des Chemikaliengesetzes um die Substanzklasse „Nanochemikalien“, wie sie der BUND fordert, lehnen die Multis ab. Sie möchten die Stoffe weiterhin als ganz normale Chemikalien behandelt sehen, ohne gesonderte Genehmigungsverfahren, Kennzeichnungspflichten und Verbotsregelungen.
Nano-Eishockeyschläger
BAYER hat einen Eishockeyschläger entwickelt, den eine Schicht aus Nano-Röhrchen umgibt, was das Sportgerät angeblich haltbarer und treffsicherer macht.
CHEMIE & WAFFEN
15 Tote bei Chemiewaffen-Unfall
Bei der Entwicklung chemischer Kampfstoffe haben BAYER-Forscher eine bedeutende Rolle gespielt. Fritz Haber entwickelte während des Ersten Weltkrieges das Senfgas, 1936 synthetisierte Gerhard Schrader Sarin und das von US-WissenschaftlerInnen zusammengebraute Giftgas VX basierte auf einem Patent des Leverkusener Multis. Diese tödlichen Stoffe befinden sich immer noch in den Waffenarsenalen vieler Armeen. Zuletzt verwendete sie Saddam Hussein 1987 und 1988 bei seinen Attacken auf kurdische Dörfer; seinen auch „Chemie-Ali“ genannten willigen Vollstrecker Ali Hassan al Madschid hat ein irakisches Gericht deshalb in diesem Jahr zum Tode verurteilt. Im Juli kam es nun in Syrien zu einem verheerenden Chemiewaffen-Unfall. Bei einer iranisch-syrischen Truppenübung in Aleppo explodierte eine mit Sarin, Senfgas und VX ausgerüstete Scud-Rakete. 12 Soldaten und mehrere Ingenieure starben, zahlreiche Menschen wurden verletzt.
PRODUKTION & SICHERHEIT
Immer mehr Asbest-Tote
Die von der „Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin“ (BAuA) herausgegebene Statistik für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten weist immer mehr Todesfälle aus. Daran sind jedoch nicht die aktuellen Produktionsbedingungen schuld, sondern die früheren, deren Folgen sich erst jetzt so richtig zeigen. Für einen Großteil der tödlich verlaufenden Berufskrankheiten zeichnet der Umgang mit dem 1993 verbotenen Asbest verantwortlich. Da vom Zeitpunkt der Vergiftung bis zum Ausbruch von Asbestose, Lungen- oder Kehlkopfkrebs 40 Jahre vergehen können, kommt es immer noch zu Neuerkrankungen. Erst ab 2016 rechnen die ArbeitsmedizinerInnen mit einem Rückgang der Zahlen. Parallel zur Zunahme der Fälle wächst die Verschwiegenheit bei BAYER. Der Leverkusener Pharmariese verheimlicht nämlich die genauen Zahlen. Während es in einem früheren „Sustainable Development“-Bericht zu den 130 „anerkannten“ Berufskrankheiten des Jahres 2000 noch hieß: „Als Krankheitsauslöser waren bei uns vor allem Expositionen gegen Asbest und Lärm relevant“, fehlen ab 2005 alle Angaben zu Berufskrankheiten.
STANDORTE & PRODUKTION
Mehr Kunststoff aus Antwerpen
Der Leverkusener Multi hat sich entschieden, die neue Anlage zur Herstellung von Polymerpolyole-Kunststoffen, einem Vorprodukt für Weichschäume, in Antwerpen zu errichten (Ticker 3/07). Ende 2008 soll die Fertigun
BAYER-Pestizid mitverantwortlich
Das globale Bienensterben
Ein „mysteriöses Bienensterben“ macht seit dem Frühjahr Schlagzeilen. Allein in den USA dezimierten sich die Bestände um 70 Prozent - über eine Million Bienenvölker verendeten. Aber „mysteriös“ ist daran nicht allzu viel: Seit Jahren steht das BAYER-Pestizid GAUCHO als Bienenkiller in der Kritik.
Von Jan Pehrke
„Manchmal verschwinden die Bienen nicht einfach, sondern flattern umher und hängen in großen Trauben an den Blumen oder anderswo in der Nähe des Bienenstocks. Sie hören auf, Pollen zu sammeln, und der Bienenstock kommt so nur auf einen Bruchteil der sonst üblichen 60 bis 80 Kilogramm Honig - wenn die Produktion nicht ganz zusammenbricht (...) Einige Völker schwärmen umher, ohne die Zelle zur Aufzucht der Königin fertiggestellt zu haben. Viele Befruchtungen scheitern, manche Bienenstämme verlassen den Stock ohne ihre Königin“ - was die belgische Imkerin Janine Kievits hier an Krankheitssymptomen beschreibt, hat es sogar schon zu einem Eintrag bei Wikipedia gebracht: Colony Collapse Disorder (CCD), der Bienenvolk-Kollaps.
In den USA hat das CCD schon die Hälfte der 2,5 Millionen Bienenvölker zum Verschwinden gebracht; um ca. 70 Prozent dezimierten sich die Bestände. Aber auch aus einer Vielzahl anderer Länder wie Italien, Spanien, der Schweiz, Deutschland, Polen, England, Griechenland, Belgien, Kanada und Brasilien gibt es besorgniserregende Verlustmeldungen. Hierzulande hat es rund 25 Prozent der Bienen dahingerafft. Professionelle ImkerInnen, die in der Bundesrepublik nur eine Minderheit bilden, hat es sogar ähnlich hart getroffen wie ihre in den Vereinigten Staaten noch weit zahlreicher vertretenen KollegInnen. Manfred Hederer, der Präsident des „Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbundes“ hat 60 Prozent seiner Bienen verloren. „Der Todeskampf der Honigbiene und der Imkerei in Deutschland hat begonnen“, sagte er deshalb in einem Zeit-Interview.
Und dieser Todeskampf hat Folgen weit über die Imkerei hinaus, denn die Biene ist in ein komplexes Ökosystem eingebunden. Sie bestäubt unter anderem Obstbäume, Beeren, Raps und Sonnenblumen. Rund ein Drittel der Ernährung des Menschen hängt so am Honigtropf der Bienen. „Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr“, soll Albert Einstein 1949 deshalb einmal gesagt haben. Während die ExpertInnen noch über die Autorschaft des Zitats streiten, scheint es sich mehr und mehr als düstere Prophetie zu erweisen. Als „größte allgemeine Bedrohung unserer Lebensmittelversorgung“ hat Kevin Hackett vom US-amerikanischen Landwirtschaftsministerium die Sterbewelle unlängst bezeichnet, und für die Insektenforscherin May Berenbaum ist sie ein Menetekel: „Das Bienensterben könnte eine Warnung an uns sein, dass etwas sehr aus dem Gleichgewicht geraten ist“.
Ursachenforschung
Wie ist diese Schieflage entstanden? Einigen erscheint sie als ein großes Rätsel. „USA: Mysteriöses Bienensterben“, so lauteten die Überschriften vieler Zeitungen. Andere machen für das „Bienen-AIDS“ die wie Industriebetriebe geführten US-Imkereien verantwortlich. „Sie sind riesig, verfügen über mehrere Tausend Völker, und die Imker reisen zur Bestäubung von Plantagen mit ihren Bienen durchs Land“, so der Bienen-Experte Werner Mühlen. Nach Ansicht des Bienenkunde-Referenten der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen erhöht die „Massenbienenhaltung“ die Ansteckungsgefahr der Insekten, während die großen Touren quer durch die Vereinigten Staaten die flächendeckenden Verluste erklären. Manche schreiben sie hingegen der flurbereinigten Landwirtschaft zu, die den Tieren mit ihren Monokulturen und Wiesen schon vor der Blüte zu Leibe rückenden Mähdreschern die natürlichen Lebensgrundlagen raubt. Nicht wenige wiederum sehen in der Varroa-Milbe den Auslöser für die Todesfälle. Manfred Hederer lässt das nicht gelten. „Die Milbe ist es nicht“, sagte er in einem SWB-Interview, und sein Kollege Wolfgang Stöckmann pflichtet ihm bei: „Das ist die Erklärung der Bieneninstitute, die uns unsachgemäße Pflege unserer Völker vorwerfen. Wir Imker wissen, dass der Parasit nicht der eigentliche Grund ist“. Wie sollte er auch: Er treibt nämlich schon seit 1977 sein Unwesen, als ihn WissenschaftlerInnen des Bieneninstitutes Oberursel gemeinsam mit zu Forschungszwecken importierten asiatischen Honigbienen einschleppten, und der große Hunger kann die Varroa-Milbe nicht plötzlich über Nacht überkommen haben.
Wanted: GAUCHO
Stöckmann und Hederer haben einen ganz anderen Schuldigen ausgemacht, BAYERs Saatgutbehandlungsmittel GAUCHO mit dem Wirkstoff Imidacloprid. Und damit stehen die beiden nicht allein. „Der Hauptverdächtige ist nach Meinung vieler Wissenschaftler das am weitesten verbreitete Insektizid auf dem Planeten: Imidacloprid“, schreibt die US-amerikanische Zeitung Star-Ledger. Es ist nämlich der höchsteigene Bestimmungszweck von Insektiziden, Insekten zu töten, und zwischen „guten“ und „schlechten“ Exemplaren dieser Spezies können die Mittel nicht unterscheiden. Deshalb führt der GAUCHO-Beipackzettel unter Risiken und Nebenwirkung auch „bienengefährlich“ auf, was schon einer Selbstanzeige gleichkommt. Nicht zuletzt die von den ImkerInnen beobachteten Symptome wie Orientierungslosigkeit und unerklärliche Verhaltensänderungen sprechen für Agrochemikalien als Ursache von CCD, denn Pestizide sind Nervengifte. Und was selbst bei Menschen massive Gesundheitsstörungen hervorrufen kann, haut die beste Biene um, denn die Tiere reagieren äußerst empfindlich auf Schadstoffe. Ihr Immunsystem ist zur Abwehr von Toxinen deutlich schlechter ausgestattet als das vergleichbarer Insekten wie Mücken oder Fliegen, weshalb WissenschaftlerInnen sie sogar als Biodetektoren einsetzen, um Giftquellen aufzuspüren.
Aus all diesen Gründen laufen BienenzüchterInnen seit Jahren Sturm gegen BAYERs Pestizid. Erst im April diesen Jahres begaben sich ImkerInnen gemeinsam mit UmweltschützerInnen auf einen Trauermarsch für Bienen zum Brüsseler Hauptquartier des Leverkusener Multis. Auf Einladung der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hin haben BienenhalterInnen den Konzern auch schon auf den AktionärInnen-Versammlungen mit dem unheilvollen Wirken der Agrochemikalie konfrontiert. Am unerbittlichsten stritten französische BienenbesitzerInnen, die binnen zehn Jahren 90 Milliarden Bienen verloren hatten, wider den Leverkusener Multi. Und ihr Engagement hatte Erfolg: ab dem Jahr 1999 untersagte Frankreich die Ausbringung von GAUCHO auf Sonnenblumen- und Maisfeldern. Einen Präzedenz-Fall schufen die Behörden damit allerdings nicht; überall sonst auf der Welt darf das Pestizid weiter sein Unwesen treiben.
BAYER leugnet
Trotz der erdrückenden Beweislast für eine Mitverantwortung von Gaucho für das Bienensterben - und dem hauseigenen Warnhinweis „bienengefährlich“ - streitet BAYER alle Schuld ab und verweist zur Entlastung auf entsprechende Tests. An der wissenschaftlichen Aussagekraft dieser Untersuchungen, die jüngst auch wieder zur Zulassung des GAUCHO in seiner Bienengefährlichkeit kaum nachstehenden Wirkstoffes Clothiandin (Handelsnamen: ELADO, PROSPER und PONCHO) führten, bestehen jedoch erhebliche Zweifel. Sie sind nämlich „made by BAYER“ und ignorieren die GAUCHO-kritische Fachliteratur konsequent. Zudem gehen die Studien nur den unmittelbar tödlichen Effekten der Mittel nach, ihre Langzeitwirkung ziehen sie nicht in Betracht. Und obwohl die EU-Direktive 91/414/EEC für Pestizide, die wie das BAYER-Produkt eine bestimmte Konzentration pro Hektar überschreiten, Versuche an Bienenlarven vorschreibt, erwirkte der Leverkusener Multi eine Ausnahmegenehmigung. Das gebeizte Saatgut komme ja nicht direkt mit den Insekten in Kontakt, argumentierte der Konzern. Diese Entfernung überbrückt das Mittel allerdings durch sein „Sitzfleisch“. Während die LandwirtInnen Ackergifte nämlich nur zu bestimmten Perioden versprühen, „verstrahlen“ Beizen die Ackerfrüchte während der ganzen Blütezeit. Nicht umsonst wiesen ForscherInnen denn auch GAUCHO-Spuren im Pollen und Nektar der Bienen nach. Aber trotz des Protestes von über 20 Umweltschutz- und Imkerorganisationen setzte EU ihre Direktive nicht wieder in Kraft.
Wie systematisch BAYER das Studien-Design im Fall von Clothiandin frisierte, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten, hat der „Berufs- und Erwerbsimkerbund“ in einem Offenen Brief an das „Bundesamt für Verbraucherschutz“ dokumentiert. So hat der Konzern seine elf Feldversuche nicht ganz zufällig mit erst im Sommer erblühenden Kulturpflanzen wie Sonnenblumen und Mais durchgeführt. Wenn diese nämlich in voller Pracht stehen, dann haben die Bienen ihren Appetit längst an Winterraps und anderen Frühentwicklern gestillt und entsprechende Vorräte an Pollen und Nektar angelegt. Zudem haben die Insekten ihr Reservoir an unbelasteter Nahrung durch Ausflüge auf nicht zum Testgebiet gehörende Ackerflächen erhöht. Dies alles hielt die ELADO-Belastung in Grenzen und sorgte für wenig alarmierende Befunde bei den Rückstandsmessungen.
Todesfälle waren während des nur drei Wochen dauernden Versuches ebenfalls kaum zu beklagen: Auf dem vor dem Bienenstock ausgelegten weißen Tuch fanden sich nur wenige verendete Bienen. Das lag allerdings nicht an der Bekömmlichkeit von ELADO, sondern am Sozialverhalten der Insekten. Kranke Tiere verlassen nämlich zum Sterben ihren Stock, um ihr Volk keiner Ansteckungsgefahr auszusetzen. „Hierbei handelt es sich um imkerliches Grundwissen“ ereifert sich Manfred Hederer über die Leverkusener Verfahrenstechnik. Etwas „geirrt“ hat BAYER sich auch bei den Angaben zur Halbwertzeit von Clothianidin. Während der Konzern auf seiner Webpage 120 Tage angibt, zitiert Hederer mit 990 Tagen die weit höheren Zahlen der US-Umweltbehörde. Die Stadt New York konnte ihm zufolge nicht einmal eine Halbwertzeit ermitteln, da der Zahn der Zeit auch nach 25 Monaten noch kein bisschen an dem Mittel genagt hatte. „Die (schlechte) Qualität der Studien schürt den Verdacht, dass Clothianidin für unsere Bienen zu einer großen Gefahr werden wird“, lautet deshalb die Schlussfolgerung des Offenen Briefes, der zudem auf eine entsprechende Kritik der kanadischen Zulassungsbehörde an BAYER verweist. Als Konsequenz aus diesen Mängeln fordern die ImkerInnen, dem Mittel die Zulassung wieder zu entziehen, bis gesicherte Kenntnisse über seine Giftigkeit vorliegen.
Der Blick nach Frankreich zeigt, wie erfolgreich solche Maßnahmen sein können. Dort haben die Bienen nach den erlassenen Anwendungsbeschränkungen für GAUCHO zum ersten Mal nach 12 Jahren ihre Honigerträge gesteigert. Allerdings profitieren nicht alle Regionen in gleichem Maße von dem Bann, wie es andererseits in den USA auch Landstriche gibt, in denen der Bienenfleiß trotz GAUCHO nicht abnimmt. Als alleinige Ursache für CCD kommt das Produkt deshalb nicht in Frage. In dem Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren wie agrar-industrielle Flurbereinigungen, Massenbienenhaltung, Milbenbefall und Gift-Exposition nimmt das Pestizid jedoch eine bedeutende Rolle ein. Es versetzt das Immunsystem der Tiere in ständige Alarmbereitschaft, weshalb es zusätzlichen Belastungen nicht mehr standhalten kann. „Inzwischen sind die Völker (...) derart durch die Pestizide geschwächt, dass ihnen die Milbe den Rest gibt“, erläutet Wolfgang Stöckmann den Zusammenhang.
Durch die menschlichen Eingriffe im Zuge der industrialisierten Landwirtschaft geht es in der Natur also kaum mehr natürlich zu. In der Tat ist etwas sehr aus dem Gleichgewicht geraten, wenn Kulturpflanzen mit den Bienen ihre eigenen Lebensspender vernichten. Dieser paradoxalen Logik folgend, hat der französische Imkerverband UNAF vor zwei Jahren zu einem ungewöhnlichen Mittel gegriffen. Er startete mit einem Programm, die Tiere verstärkt in Städten anzusiedeln. Und wirklich scheint den Insekten ihr Exil in der pestizid-unbelasteten Zivilisation gut zu tun. Nach dem Willen der UNAF sollen jetzt alle europäischen Länder diesem Beispiel folgen.
AKTION & KRITIK
Mehr Kinderarbeit?
In der letzten Pflanzsaison arbeiteten 50-100 Jungen und Mädchen auf den Feldern der Zulieferer von BAYERs indischer Saatgut-Tochter PROAGRO. In der nächsten Aussaat-Perioden könnten es noch mehr werden, denn PROAGRO hat die Zahl der Anbauflächen erhöht. Darüber hinaus hat das Unternehmen neue Kooperationspartner wie die Saatgut-Firma RAASI, auf deren Anbauflächen es keine Kontrollen durchführt. Die Forderungen der KritikerInnen, die Abnahmepreise für das Saatgut anzuheben, um den Vertragspartnern zu erlauben, auch Erwachsene einzustellen, hat die Tochtergesellschaft des Leverkusener Multis nicht erfüllt. Stattdessen startete sie ein Programm zur Erhöhung der Produktivität, das allerdings kaum für die benötigten Mehreinnahmen sorgen dürfte.
Reis-AnbauerInnen für Freisetzungsstopp
BAYERs offiziell noch gar nicht zugelassene Genreis-Varietäten LL601, LL604 und LL62 sorgen durch Einkreuzungen für einen immer größeren Flurschaden in konventionell oder ökologisch angebauten Sorten (siehe GENE & KLONE). Darum haben die kalifornischen Reis-AnbauerInnen jetzt ein Ende der Freisetzungsversuche mit der Getreideart gefordert.
Trauermarsch der ImkerInnen
Noch immer lässt BAYERs Pestizid GAUCHO zahllose Bienenvölker dahinraffen. Aus diesem Grund haben sich am 21. April 2007 BienenzüchterInnen und UmweltschützerInnen auf einen Trauermarsch für Bienen zum Brüsseler Hauptquartier des Leverkusener Multis begeben und ein Verbot des Mittels gefordert, wie es Frankreich für einige Anwendungsbereiche schon vor Jahren erlassen hat.
ImkerInnen schreiben Verbraucherschutzamt
Das BAYER-Pestizid GAUCHO mit dem Wirkstoff Imidacloprid brachte Millionen Bienen den Tod, weshalb Frankreich im Jahr 2004 die Ausbringung auf Sonnenblumen- und Maisfeldern untersagte. Jetzt kommt eine weitere Bedrohung auf die Tiere zu: das BAYER-Insektizid ELADO mit dem Wirkstoff Clothianidin. Das in der Bundesrepublik seit letztem Jahr zugelassene Mittel ist ebenso bienengefährlich wie GAUCHO. Trotzdem hatten die bundesdeutschen Behörden bei ihrer Genehmigung weit weniger Bedenken als beispielsweise ihre KollegInnen in Kanada. Aus Protest gegen dieses Vorgehen schrieb der Berufs- und Erwerbimkerbund einen Offenen Brief an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Er schließt mit der Forderung, ELADO und ein weiteres für Bienen gefährliches Ackergift zurückzurufen.
Widerstand gegen Pestizid-Ausbringungen
Die massive Ausweitung des Soja-Anbaus in Südamerika führt zu einer entsprechenden Ausweitung der Pestizid-Ausbringung - und zu einer Ausweitung der Gesundheitsschädigungen. Seit dem Soja-Boom der späten 90er Jahre steigen in den Dörfern nahe der Felder die Fälle von Krebs und anderen Krankheiten massiv an. Viele Wirkstoffe, die auch in BAYER-Mitteln enthalten sind, haben daran einen Anteil, so etwa Glyphosate (GLYPHOS, USTINEX G), Chlorpyrifos (BLATTANEX, PROFICID und RIDDER), Endosulfan (MALIX, PHASER, THIODAN), Methamidophos (TAMARON) und Monocrotophos (BILPHOS). Eine zusätzliche Gefahr stellen die achtlos entsorgten Giftfässer dar. Aber die Betroffenen setzen sich zur Wehr. So haben sich etwa im argentinischen Ituzaingó Frauen zu den „Mothers of Ituzaingó“ zusammengeschlossen. Die Initiative schrieb zahlreiche Petitionen an die Regierung und forderte Untersuchungen ein. Im Jahr 2004 kam schließlich endlich eine Gruppe von Fachleuten in die Ortschaft - und erklärte das Dorf sogleich für unbewohnbar. Das Gesundheitsministerium akzeptierte das Urteil der ExpertInnen aber nicht und verbot den AktivistInnen bis auf weiteres jeglichen Kontakt mit den WissenschaftlerInnen. Daraufhin zogen die Mütter von Itazaingó protestierend und „Wir haben Krebs“ skandierend auf die Straße und erreichten den Aufbau eines kleinen Gesundheitszentrums. Inzwischen hat ihr Beispiel Schule gemacht. Im Bundesstaat Córdob gründeten Betroffene aus anderen Gemeinden die Dachorganisation PEOPLES ASSEMBLY OF SPRAYED AND EXPELLED COMUNITIES.
Pestizid-Kampagne: 2.600 Unterschriften
Seit Jahren appelliert die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN an den Leverkusener Multi, das im Geschäftsbericht des Jahres 1995 gegebene Versprechen einzulösen, Pestizide der höchsten Gefahrenklassen vom Markt zu nehmen, die vor allem in den Ländern der „Dritten Welt“ verheerenden Schaden anrichten. Auch andere Gruppen vertreten diese Forderung. So schrieb das EINE WELT NETZ NRW in dieser Sache einen Offenen Brief an den Vorstandsvorsitzenden Werner Wenning, den die CBG und 159 weitere Organisationen sowie über 2.000 Einzelpersonen unterzeichneten.
CBG im Landtag
Seiner Kritik an dem geplanten Export australischen Giftmülls zu den Verbrennungsöfen BAYERs und anderer Entsorger lässt der nordrhein-westfälische Umweltminister Eckhart Uhlenberg keine Taten folgen. Juristisch seien ihm die Hände gebunden, erklärt er bei jeder passenden Gelegenheit. Auf einer von den Grünen im Landtag einberufenen Pressekonferenz haben Vertreter von BUND und COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN dem CDU-Mann am 2. Mai ein wenig Rechtshilfe gewährt und ihm einen politischen Weg zur Annahme-Verweigerung der Chemie-Fracht aufgezeigt. Ein paar Wochen hat Uhlenberg diesen auch eingeschlagen. Er hat ein Rechtsgutachten zu den Möglichkeiten eines Importstopps in Auftrag gegeben.
Boykott-Initiative in Frankreich
Auch in Frankreich hat BAYER nicht den allerbesten Ruf. So erreichte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) das Schreiben einer Angestellten eines Telekommunikationsunternehmens, die eine Initiative zum Boykott des Leverkusener Multis gestartet hat. Sie erstellt nun im Auftrag der Geschäftsleitung ein kleines „Schwarzbuch BAYER“ und fand dafür viele Informationen auf der CBG-Homepage. „Ich möchte mich bei Ihnen für ihre Website bedanken, die mir enorm viel Material geliefert hat“, mailte sie deshalb der Coordination.
Diskussion zur BAYER-Pipeline
Der Leverkusener Chemie-Multi Bayer plant zwischen seinen Standorten Dormagen und Krefeld eine fast 70 Kilometer lange Kohlenmonoxid-Pipeline. Nach einem vom Kreis Mettmann in Auftrag gegebenen Gutachten wäre bei einem Vollbruch der Leitung das Leben von 143.000 Menschen gefährdet (siehe SWB 2/07). Entsprechend groß ist überall die Besorgnis - und das Engagement gegen das Projekt. In Monheim luden die Grünen zu einer Diskussion über die Gift-Röhre, an der auch Philipp Mimkes als Geschäftsführer der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN teilnahm.
Demo zur BAYER-Pipeline
Am 16. Juni führten GegnerInnen der geplanten BAYER-Pipeline in Hilden eine Demonstration durch und übergaben am Rathaus eine Unterschriftenliste, die 8.000 Menschen unterzeichnet hatten.
Demo in Leverkusen
Zur Realisierung der sich im Zuge der SCHERING-Übernahme ergebenden „Synergie-Effekte“ will BAYER am Standort Wuppertal 160 Arbeitsplätze vernichten. Es gab sogar Gerüchte über eine komplette Schließung, die der Leverkusener Multi allerdings dementierte. Am 27. Februar demonstrierten 250 Beschäftigte vor der Konzernzentrale gegen die Pläne des Unternehmens. „Nach drei abgeschlossenen Umstrukturierungsmaßnahmen mit erheblichen Einschnitten sind wir ein ranker, schlanker, innovativer und effizienter Entwicklungsstandort“, bekundeten die Beschäftigten und forderten ein Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen sowie eine Verlängerung der Standortsicherungsvereinbarung.
Warnstreiks in Siena
Auch im italienischen Siena bedroht BAYERs SCHERING-Übernahme viele Arbeitsplätze: Der Leverkusener Multi plant dort im Zuge der Umstrukturierung den BAYER-BIOLOGICALS-Standort zu schließen. Die Beschäftigten protestierten mit mehreren Warnstreiks gegen das Vorhaben.
BAYER alaaf!
Die politische Tradition des Karnevals lebt noch fort. Deshalb kam BAYER beim diesjährigen Kölner Straßenumzug auch nicht ungeschoren davon. Ein Wagen stellte den Arbeitsplatzabbau in der Region als „Fluch der Karibik“ dar. Die Bosse von BAYER, GERLING und der ALLIANZ firmierten dabei als Seeräuber, die sich der Originale Tünnes und Schäl kurzerhand über die „Abfindungsplanke“ entledigen und dann ihre Raubzüge fortsetzten.
Rachel Carson: Bedenkliches Gedenken
Mit ihrem „Der stumme Frühling“ betitelten Buch über die von Pestiziden ausgehenden Gefahren wurde die US-amerikanische Wissenschaftlerin Rachel Carson 1962 zu einer Mitbegründerin der Umweltbewegung. Al Gore verglich die Wirkung des Werkes jüngst mit „Onkel Toms Hütte“. Und ebenso vehement wie einst die Südstaaten gegen die Sklavenbefreiung wütete die Agro-Industrie gegen die Autorin. MONSANTO und andere Konzerne finanzierten sogar eine Kampagne gegen sie. „Wenn man den Lehren des Fräulein Carson folgen würde, würden wir ins Mittelalter zurückkehren, und Insekten und Seuchen und Ungeziefer würden wieder über die Welt herrschen“, hetzten die Unternehmen damals. Die das Andenken der 1964 verstorbenen Umweltaktivistin pflegende „Rachel Carson Association“ hat heute allerdings ihren Frieden mit den Chemie-Giganten gemacht. Aus Anlass des 100. Geburtstages von Rachel Carson hat die Vereinigung ausgerechnet den Leverkusener Chemie-Multi BAYER für sein Umweltengagement ausgezeichnet - vielleicht als Dankeschön für seine umfangreichen Spenden an die Organisation. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN nahm das zum Anlass, einen Offenen Brief an die Assoziation zu schreiben, der auf einige Resonanz stieß und zu weiteren Protesten gegen den industrie-freundlichen Kurs der „Rachel Carson Association“ führte.
Kritik an Bisphenol A wächst
In den USA und Kanada wächst die Kritik an der Chemikalie Bisphenol A, zu deren größten Herstellern BAYER zählt, da sie zu massiven Gesundheitsschäden führen kann. Die in Alltagsgegenständen wie Mineralwasser- und Babyflaschen und Konservendosen enthaltene Substanz wirkt nämlich hormon-ähnlich und stört so die Entwicklung des Gehirns, Stoffwechselprozesse sowie die Fortpflanzungsfähigkeit. Im März 2007 hat es deshalb in den USA erstmals eine Sammelklage gegen die Hersteller von Babyflaschen gegeben. Der Mediziner Dr. Frederick vom Saal sieht auf BAYER & Co. schon genau solch folgenschwere Schadensersatz-Prozesse zukommen wie auf die Tabak-Konzerne. In das kanadische Parlament hat derweil der liberale Politiker Francis Scarpaleggia einen Verbotsantrag eingebracht. Er stützt ihn auf mehr als 150 unabhängige Studien zu den von Bisphenol A ausgehenden Gefahren, die freilich zu ganz anderen Ergebnissen kommen als die von den Unternehmen finanzierten. „Nicht eine der 12 von der Chemie-Industrie geförderten Studien hat diese Resultate erbracht“, empört sich der Abgeordnete. „Die Menschen sind Bisphenol A nur in ganz geringen Dosen ausgesetzt, die weit unter den Grenzwerten liegen“, verharmlost etwa Steven Hentges vom Industrie-Verband „American Plastics Council“, dem auch der Leverkusener Multi angehört, die Risiken und Nebenwirkungen der chemischen Keule.
Dialog mit dem BUND
Mit dem „Dialog Wirtschaft und Umwelt“ hat der nordrhein-westfälische Umweltminister Eckhard Uhlenberg eine umweltpolitische Nebenregierung mit vielen Konzern-VertreterInnen etabliert. Den Arbeitskreis „Gewässerschutz“ leitet beispielsweise der BAYER-Mann Frank Andreas Schendel. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) und andere Gruppen kritisierten in der Vergangenheit die fehlende demokratische Legitimation des Gremiums im Allgemeinen und den Ausschluss von Umweltgruppen im Besonderen. Wohl nicht zuletzt deshalb duldeten die Wirtschafts-MonologistInnen bei einem Treffen zum Thema „Luftreinhaltung“ einen Vertreter des BUNDES FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DEUTSCHLAND als Zaungast. Die CBG muss aber immer noch draußen bleiben.
Deccan Herald erbittet Informationen
Die in Millionen-Auflage erscheinende indische Zeitung Deccan Herald wandte sich mit der Bitte um Informationen zu Störfällen bei BAYER an die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG). Geschäftsführer Philipp Mimkes sandte den RedakteurInnen reichhaltiges Material zu. Diese nutzten es, um zum Jahrestag der Bhopal-Katastrophe auf die nach wie vor bestehenden Gefahren durch die Chemie-Produktion aufmerksam zu machen.
KAPITAL & ARBEIT
BIS: Mehr Arbeit, weniger Lohn
Fünf Monate dauerten die Verhandlungen um den neuen Service-Tarifvertrag für die MitarbeiterInnen von BAYER INDUSTRY SERVICES (BIS) und BAYER BUSINESS SERVICES (BBS). Mit allen Mitteln versuchte der Konzern massive Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Ende April 2007 zog er sogar seine Zustimmung zu einem Abschluss wieder zurück, um der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) noch mehr Zugeständnisse abzutrotzen. Diese fielen dann auch nicht zu knapp aus. Im Rahmen der „Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung“ erhöht sich die Wochenarbeitszeit für die BISlerInnen von 37,5 auf 40 Stunden, was eine Gehaltseinbuße von 6,7 Prozent bedeutet. In den kommenden vier Jahren müssen 40 Prozent der Belegschaft zudem weitere 8,3 Prozent ihres Lohnes opfern, indem sie auf Tariferhöhungen - und wenn das nicht reicht - sogar zusätzlich auf ihr Weihnachtsgeld verzichten. Für zusätzliche Verluste sorgt ein neues Entgeltsystem. Zudem gründet BAYER für die „Technischen Dienste“ eine Tochtergesellschaft, welches der erste Schritt zu einer Ausgliederung sein könnte. Vorerst mochte ihn der Leverkusener Multi nicht gehen, dafür und für die Zusicherung, bis Ende 2008 auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten, nahm die IG BCE die Lohndrückereien in Kauf. Die BBS-Beschäftigten kamen etwas besser weg, sie arbeiten in Zukunft „nur“ für 3,3 Prozent weniger Geld und brauchen bis Ende 2009 keine betriebsbedingten Kündigungen zu fürchten. Trotz dieser Streichorgie gibt sich der Leverkusener Multi nicht zufrieden. 52 Millionen Euro Kosten will er im Service-Bereich noch einsparen. Bei BIS und BBS dürfte also noch keine Ruhe einkehren.
Wenning verdient 2,65 Millionen
Das Gehalt des BAYER-Chefs Werner Wenning belief sich im Geschäftsjahr 2006 auf schlappe 2,65 Millionen Euro.
105 Entlassungen in England
BAYER CROPSCIENCE hat ein Werk im englischen Widnes dichtgemacht und damit 105 Arbeitsplätze vernichtet. Als Grund führte der Direktor die gesunkene Nachfrage nach einem für andere Chemie-Firmen hergestellten Fungizid-Wirkstoff an. Die Produktion eines Pestizides für den Zuckerrüben-Anbau verlegte der Agro-Riese derweil nach Indien.
Billige MitarbeiterInnen-Ideen
Der Leverkusener Multi bedient sich recht unverschämt am Wissenspool seiner MitarbeiterInnen. Die 8.816 Verbesserungsvorschläge aus deren Reihen sparten dem Konzern allein im ersten Jahr ihrer Realisierung Kosten in Höhe von 6,4 Millionen Euro ein - an Prämien für die Ideen schüttete BAYER jedoch nur 2,1 Millionen Euro aus.
Vorerst keine Europa AG
Die BASF hat im Februar 2007 die Rechtsform einer europäischen Aktiengesellschaft (SE) angenommen und strebt auf diesem Weg die Reduzierung des Aufsichtsrates auf nur noch 12 statt bisher 20 Mitglieder an. BAYER will dem Unternehmen vorerst nicht nacheifern. „Wir verfolgen jedoch aufmerksam die Entwicklung“, hieß es aus der Konzern-Zentrale.
Deutschlands bester „Co-Manager“
„Heute kämpft er für die Kohle, morgen für die Kernenergie. Drohen neue Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen, stellt er sich schützend vor die Pharma-Industrie. Plant die EU-Kommission ein neues Gesetz für Registrierung, Evaluierung, und Autorisierung von Chemikalien (REACH), hält er, gemeinsam mit den Chemiekonzernen, in Brüssel dagegen. Sollten die Emissionsrechte der Energieversorger gekürzt werden, interveniert er beim Bundesumweltminister“, - wen mag die Faz da porträtiert haben, einen allgegenwärtigen Industrie-Lobbyisten etwa? Nein, die Zeitung beschrieb nur den Arbeitsalltag vom Vorsitzenden der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE, Hubertus Schmoldt.
Co-Management kostet Mitglieder
Der Schmusekurs der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (s. o.) führt zu Mitgliederverlusten. So trat die BAYER-Betriebsrätin Heike Bär, die innerhalb der Gewerkschaft für die BASIS-Gruppe aktiv war, aus der IG BCE aus. Zur Begründung ihres Schrittes sagte sie in der Rheinischen Post: „Ich bin nach 27 Jahren aktiver Gewerkschaftsarbeit aus der IG BCE ausgetreten. Mir war das zu viel Kungelei, zu wenig Mitbestimmung für die Mitglieder. Meinungen wurden da nicht abgefragt, sondern jeder vor vollendete Tatsachen gestellt. Wenn man sich kritisch äußerte, kam das nicht gut an. Mir ist das aber zu wenig, nur sozialverträglichen Personalabbau durchzusetzen, da fehlt mir das Kämpferische. Als wir auf Flugblättern über die neuen Servicetarifverträge unterrichtet worden sind, sind wir zu mehreren Kollegen geschlossen ausgetreten.“
ERSTE & DRITTE WELT
Versuchsfeld Costa Rica
Die Gewinnung von Saatgut für Nutzpflanzen ist eine aufwändige Prozedur, da die Kreuzungen per Hand erfolgen - oft per Kinderhand, wie bei den Zulieferern der BAYER-Tochter PROAGRO in Indien (Ticker berichtete mehrfach). Die Erzeugung von Saatgut für seine transgene Soja-Sorte LIBERTYLINK mit der eingebauten Resistenz gegenüber dem Pestizid BASTA hat der Leverkusener Multi nach Costa Rica ausgelagert, denn da stören keine lästigen Gentechnik-Gesetze und Kontrollen, weshalb der Anbau gentechnisch veränderter Organismen dort schon eine Fläche so groß wie Niedersachsen einnimmt. Mit verheerenden Folgen: Herbizid-Resistente Baumwolle, die sich auch in andere Pflanzen einkreuzt, sucht mittlerweile ganze Landstriche heim. „Wir sind Zeugen davon, wie die multinationalen Unternehmen und das Landwirtschaftsministerium die Region Guanacaste in ein riesiges Feld für einen unkontrollierten Freilandversuch verwandelt haben“, klagt deshalb die Bürgerrechtlerin Ana Julia Arana.
BAYER gegen Generika-Importe
Immer noch können sich die meisten AIDS-PatientInnen in der „Dritten Welt“ die nötigen Medikamente wie KALETRA nicht leisten, da sie patent-geschützt und entsprechend teuer sind. Die thailändische Regierung hat sich deshalb entschlossen, Nachahmerprodukte des Präparates zur Behandlung der ca. 500.000 Kranken einzuführen, nachdem Verhandlungen über Preissenkungen scheiterten. Dabei berief sie sich auf einen Passus der WTO-Regularien, die eine solche Praxis in medizinischen Notsituationen ausdrücklich erlauben. KALETRA-Hersteller ABBOTT wollte das aber nicht hinnehmen und kündigte an, neue Medikamente fortan in Thailand nicht mehr anzubieten. Und wie schon bei dem ähnlich gelagerten Konflikt „Südafrika vs. Big Pharma“ (siehe SWB 2/01) zeigt sich der Leverkusener Multi uneingeschränkt solidarisch. Das Unternehmen „unterstützt vollkommen ABBOTT“, verlautete aus der Konzern-Zentrale.
POLITIK & EINFLUSS
BAYER macht Klimapolitik
BAYER beteiligt sich an Gesprächsrunden der G-8-Länder zum Klimawandel. Dabei verbirgt der Konzern seine Absichten nicht. „Wenn wir in beratender Funktion die politischen Rahmenbedingungen mitgestalten können, wird uns das auch operativ nützen“, spricht Forschungsvorstand Wolfgang Plischke Klartext.
BAYER & Co. vs. Gabriel
Vor einigen Jahren hat die EU den Emissionshandel mit Kohlendioxid-Verschmutzungsrechten eingeführt. Er sieht vor, BAYER & Co. CO2-Emissionen nur in einer bestimmten Menge zu gestatten. Alles, was über ein bestimmtes Limit hinausgeht, sollte den Konzernen teuer zu stehen kommen, weil sie dafür Verschmutzungsrechte kaufen müssten. Damit wollte Brüssel Anreize zu Klimaschutz-Maßnahmen schaffen. Diese blieben allerdings weitgehend aus: Die Lizenzen zum CO2-Ausstoß waren so großzügig bemessen und überdies kostenlos, dass die Schornsteine der Industrie weiterhin nach Lust und Laune qualmen konnten. Kurz vor dem G8-Gipfel veröffentlichte Umweltminister Sigmar Gabriel Pläne, neun Prozent der Verschmutzungsrechte versteigern zu lassen, wie es andere europäischen Länder schon länger tun. Während BAYER & Co. weiterhin gratis Kohlendioxid emittieren dürfen, will Gabriel die Kraftwerksbetreiber künftig zur Kasse bitten. Die Konzerne hielten zunächst an sich, um die „Wir sind Klimaschutz“-Inszenierung von Angela Merkel in Heiligendamm nicht zu stören und legte erst in der Woche danach voll los. „Das ist eine Strafsteuer für das Produzieren in Deutschland“, ereiferte sich der „Bundesverband der Deutschen Industrie“, flankiert vom „Verband der Chemischen Industrie“ und den Gewerkschaften. Da die Chemie-Industrie zu den energie-intensivsten Branchen zählt, befürchten BAYER und die anderen Unternehmen nämlich höhere Stromkosten durch die Versteigerung von Verschmutzungsrechten - und wenn Klimaschutz nicht umsonst zu haben ist, dann verzichten die Konzerne nur allzu gerne darauf. Nordrhein-Westfalen haben die Klima-Killer schon als Bündnispartner gewonnen. Das Bundesland beantragte im Bundesrat, weit weniger Verschmutzungsrechte zu versteigern als vorgesehen. Der der dortigen CDU/FDP-Regierung zuarbeitende „Dialog Wirtschaft und Umwelt“, in dem auch ein Vertreter von BAYER sitzt, dürfte dabei ein Wörtchen mitgeredet haben.
5 Milliarden für BAYER & Co.
Die Gewinne der 30 Dax-Unternehmen erhöhten sich von 2001 bis 2005 von 32,8 Milliarden Euro auf 71,3 Milliarden. Die im gleichen Zeitraum gezahlten Abgaben stiegen jedoch nur von 10 Milliarden Euro auf 14,7 Milliarden. Damit fiel der real-kapitalistische Steuersatz, der nominell ca. 39 Prozent betragen müsste, dank der Rechenkünste der großen Konzerne im Durchschnitt von 33 Prozent auf 21 Prozent. BAYER lag im Jahr 2005 bei 25 Prozent; bei einem Ergebnis vor Steuern von 2,2 Milliarden zahlte der Chemie-Multi nach den von Lorenz Jarass und Gustav M. Obermair in „Unternehmenssteuerreform 2008“ veröffentlichten Berechnungen 540 Millionen an den Staat. Die Unternehmenssteuerreform hat sich jetzt vorgenommen, die Lücke zwischen Steuerrealität und Steuertraum ein wenig zu schließen und die Steuerbelastung von 39 auf 30 Prozent abgesenkt, was den Firmen ca. 30 Milliarden Euro einbringt. Zur Gegenfinanzierung schloss die Bundesregierung Steurschlupflöcher, verschärfte die Abschreibungsregeln und machte es für BAYER & Co. mit der „Zinsschranke“ schwieriger, die Zinszahlungen steuermindernd vom Umsatz abzuziehen, was dem Fiskus insgesamt ca. 25 Milliarden einbringt. Bleibt für die Unternehmen ein Reformgewinn von fünf Milliarden Euro - der DEUTSCHE GEWERKSCHAFTSBUND rechnet sogar mit 10 Milliarden.
Ausschuss für Rohstoffsicherung
BAYER & Co. haben zunehmend Schwierigkeiten, im Wettlauf um knapper werdende Ressourcen gegenüber ihrer Konkurrenz aus dem Ausland zu bestehen. Deshalb appellierten die Konzerne an die Politik, unterstützende Maßnahmen zu ergreifen. Angedacht sei aber „keine Planwirtschaft“, beeilte sich Vorsitzende des „Bundesverbandes der Industrie“ (BDI), Jürgen Thumann, zu versichern. Angela Merkel tat sofort, wie ihr geheißen, und erklärte die Sicherung der Rohstoffe zu einer politischen und nationalen Aufgabe. Wahrnehmen soll sie auf ziviler Ebene in Zukunft der interministerielle Ausschuss zur Rohstoffsicherung, dem auch VertreterInnen der Unternehmen angehören, unter anderem durch Investitionsgarantien und Kredite.
BAYER will „nationalen Sicherheitsrat“
Die Entwicklung hin zu einem autoritären Sicherheitsstaat bezieht auch die Wirtschaft mit ein. So gehört BAYER neben HENKEL und THYSSENKRUPP zu den Mitgliedern des „Verbandes für Sicherheit in der Wirtschaft Nordrhein-Westfalens“. Deren Bundesverband, die „Arbeitsgemeinschaft für Sicherheit in der Wirtschaft“ will nach Informationen von german-foreign-policy.com „die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Staat über das bisher Erreichte hinaus aktiv weiterentwickeln“ und plant dafür die Gründung eines „Nationalen Sicherheitsrates“. Die bereits seit April 2006 bestehende Kooperation der Konzerne mit dem Bundeskriminalamt und anderen staatlichen Organen, die unter anderem die Erschließung neuer Märkte sowie Produktions- und Entwicklungsstandorte“ durch Risiko-Analysen flankiert (Ticker 1/07) dürfte sich damit noch intensivieren.
Agrar-Subventionen für BAYER
Nicht nur LandwirtInnen bekommen Agrar-Subventionen. Auch BAYER profitiert von den EU-Töpfen. So griff der Konzern mehr als drei Millionen Euro aus Brüssel für die Verarbeitung von Zucker ab.
Konzerne sponsoren Regierung
Die bundesdeutschen Konzerne nehmen auch die Bundesregierung von ihren umfangreichen Sponsoring-Aktivitäten nicht aus. Über 55 Millionen Euro gaben sie nach einem Bericht des Bundesrechnungshofes von August 2003 bis Ende 2004 für die Pflege der politischen Landschaft aus. Am pflegebedürftigsten erwies sich dabei das Bundesgesundheitsministerium. Es kassierte 44,5 Millionen, mit denen Ulla Schmidt & Co. hauptsächlich Aufklärungsspots zu „AIDS“ finanzierten. Welche Unternehmen Geld gaben, erfuhr der Bundesrechnungshof nicht, weil „die Frage der Namensnennung von einigen Ressorts nach wie vor als problematisch angesehen werde“. In Zukunft müssen diese sich aber vielleicht dem Problem stellen. Die Bundesregierung erwägt nämlich eine Offenlegung ihrer „Gönner“. Ob wohl einer davon in Leverkusen zu Hause ist?
Schneider König von Deutschland
Manfred Schneider steht den Aufsichtsräten von BAYER und LINDE vor und hat Mandate bei DAIMLERCHRYSLER, METRO, RWE, TUI und der ALLIANZ. Zudem leitet er vier wichtige Gremien wie etwa den ALLIANZ-Prüfungsausschuss und hat Sitze in sieben weiteren. Deshalb stattete ihm die Zeit im Rahmen der Recherche für einen Artikel zum Thema „Die Welt der Bosse“ einen Hausbesuch ab und wähnte sich gleich im Machtzentrum der Republik. „Hier, auf dem Gelände des BAYER-Stammwerks, im Hochparterre des Verwaltungsgebäudes Q26, in diesem Büro mit seinen mehrere Meter hohen Wänden, ist das Geflecht der Deutschland AG mit Händen zu greifen“, schrieb das Blatt.
Aus für BfArM-Reform?
Laut Koalitionsvertrag sollte das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-Produkte“ (BfArM) „eine international konkurrenzfähige Zulassungsagentur werden“, statt den Risiken und Nebenwirkungen der Arzneien von BAYER & Co. wirklich auf die Spur zu kommen. Zu diesem Behufe wollte Gesundheitsministern Ulla Schmidt die Behörde, die schon jetzt Medikamente so schnell zulässt wie keine andere in Europa, von Geldern der Pharma-Industrie abhängig machen und die staatliche Unterstützung noch weiter zurückfahren. Dies ging aber selbst der CDU zu weit. Ihr Fraktionsvorstand stoppte den schon fertigen Gesetzesentwurf vorerst.
BAYER & Co. finanzieren FDA
Betrug der Anteil von BAYER & Co. am Etat der US-Gesundheitsbehörde FDA durch Zulassungsgebühren für Arzneien im Jahr 1993 nur sieben Prozent, so stieg er bis 2004 auf 40 Prozent, was nicht ohne Auswirkungen auf die Politik der Einrichtung blieb. So ermahnte die Führungsetage einen Mitarbeiter, der beharrlich auf schwere Nebenwirkungen eines Medikamentes aufmerksam machte, nicht zu vergessen, wer der Hauptkunde der Institution sei: die Pharma-Industrie nämlich. „Das ist seltsam, ich dachte, unsere Kunden seien die Bürger unseres Landes“, entgegnete der Pillen-Experte verduzt.
In der Kürze steckt die Fälschung
Nicht auszudenken, wenn die vom Bundesforschungsministerium in Auftrag gegebene Untersuchung „Sicherheitsforschung und Monitoring zum Anbau mit Bt-Mais 2001-2004“ wenig schmeichelhafte Ergebnisse für die „grüne Gentechnik“ zu Tage gefördert hätte. Also konnte nicht sein, was nicht sein durfte. Die beteiligten ForscherInnen fanden zwar mancherlei Besorgniserregendes heraus, aber in der Zusammenfassung als praktische Darreichungsform für den/die gestressten PolitikerIn stand davon nichts mehr. Hieß es in der Originalversion noch „Allerdings zeigten die wichtigsten Nützlingsgruppen (...) eine signifikante Reduktion in Bt-Maisbeständen“, so gab das Resümee flächendeckend Entwarnung: „Bei den meisten der im Bt-Mais und in den Kontrollflächen erfassten Nicht-Zielorganismen (...) ergaben sich keine oder nur geringe Effekte von Bt-Mais“.
Anhörung zum Stammzellen-Gesetz
In den letzten Monaten seiner Amtszeit als Vorsitzender der „Deutschen Forschungsgemeinschaft“ trat der BAYER-Aufsichtsrat Ernst-Ludwig Winnacker noch einmal vehement für für eine Änderung des Stammzell-Gesetzes von 2002 ein. Er möchte den ForscherInnen nicht nur den Zugriff auf bis zum Jahr 2002 gewonnenen Stammzellen ermöglichen, wie es der Gesetzgeber mit der Stichtagsregelung vorsah, da er BAYER & Co. nicht die Lizenz zum Töten geben wollte, sondern auch auf solche aus frisch abgetöteten Embryos. Und seine beharrliche Arbeit zeigt nun erste Erfolge, denn im Bundestag mehren sich die Stimmen für eine Revision des Paragraphen-Werkes. Die AnhängerInnen der uneingeschränkten Forschungsfreiheit initiierten am 9.5.07 eine Anhörung zu dem Thema, bei der sich wie erwartet die versammelte Wissenschaftsgemeinschaft für eine Abschaffung der Stichtagsregelung aussprach.
PROPAGANDA & MEDIEN
Soziale Verantwortung selbstmörderisch?
Wie andere Großunternehmen gibt sich auch BAYER gerne gutmenschlich und bekennt sich zur „Corporate Social Responsibility“ (CSR). Die aus der Portokasse finanzierten Projekte bringen dem Konzern einen nicht zu unterschätzenden Image-Gewinn ein. Aber jetzt wollte es die Financial Times Deutschland einmal genauer wissen und rechnete nach. CSR lohnt sich nicht, urteilte die Zeitung unter Berufung auf den in Harvard lehrenden Wirtschaftsethiker David Vogel. Aber noch aus einem anderen Grund bezeichnete das Blatt das Pseudo-Engagement von BAYER & Co. als einen „gefährlichen Irrweg“. „Die Kapitalisten gestehen damit der fundamentalen Kapitalismuskritik zu, jedenfalls teilweise berechtigt zu sein. Milton Friedman erkannte darin bereits vor Jahrzehnten einen selbstmörderischen Impuls“, so die Wirtschaftspostille. Sollte also am Ende eine rein virtuell bleibende Sozialarbeit das Ende des Kapitalismus einläuten?
BAYER intransparenter als ROCHE
Der Leverkusener Multi unterstützt genau diejenigen medizinischen Fachverbände oder Selbsthilfeorganisationen, von denen er sich eine Werbewirkung für seine Arzneiprodukte zur Behandlung von Krebs, Diabetes, Hämophilie und Herzkrankheiten verspricht. So erhielten in der Vergangenheit die US-Verbände „National Coalition for Cancer Survivorship“, „Juvenile Diabetes Research Foundation“, „National Hemophilia Foundation“ und „American Heart Association“ Schecks über je 100.000 Dollar. Solch eine Praxis ist in der Pharma-Branche üblich. Allerdings gehen andere Konzerne offener damit um als BAYER. ROCHE beispielsweise veröffentlicht im Internet eine Liste mit allen unterstützten Selbsthilfegruppen.
250.000 Euro als vertrauensbildene Maßnahme
In den achtziger Jahren hatte BAYER es aus Profit-Gründen unterlassen, seine Blutplasma-Produkte einer keimtötenden Hitze-Behandlung zu unterziehen, um das Risiko einer „AIDS“-Infektion zu senken. In der Folge starben Tausende Patienten durch die Ansteckung mit der Immunschwäche-Krankheit. Seither versucht der Leverkusener Chemiemulti das Vertrauen der Bluter über eine großzügige Unterstützung ihrer Verbände zurückzugewinnen. So hat das Unternehmen dem Weltbluterverband „World Federation of Hemophilia“ (WFH) anlässlich des Welthämophilie-Tages 250.000 Euro gespendet. Bei dem WFH-Präsidenten Mark W. Skinner löste der Betrag dann auch prompt Gedächtnisstörungen aus. „BAYER spielt eine wichtige Rolle dabei, die Öffentlichkeit auf die weltweiten Probleme der Hämophilie-Patienten aufmerksam zu machen und den Zugang zu einer besseren Therapie für alle Betroffenen zu ermöglichen“, bedankte er sich artig für das Schweigegeld.
BAYER im Klima-Roundtable
BAYER produziert jährlich 3,9 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Die Reduktionen der letzten Jahre basieren zu einem großen Teil nicht auf Umweltschutzmaßnahmen, sondern auf Betriebsschließungen, Verkäufen von Unternehmensteilen und einem Outsourcing der Energie-Produktion (Ticker berichtete mehrfach). Das Klimaschutz-Engagement des Konzerns ist also größtenteils virtuell - das aber gewaltig! Es vergeht kaum ein Monat ohne eine entsprechende Initiative. So unterzeichnete der Leverkusener Multi Ende Februar 2007 die Erklärung des „Global Roundtable on Climate Change“. „Der Global Roundtable hat unsere Experten überzeugt, weil er unvoreingenommen an das Thema herangeht“, sagt Forschungsvorstand Wolfgang Plischke. Unvoreingenommen - das heißt für ihn vor allem unverbindlich. Der Roundtable ist für Plischke nämlich deshalb eine runde Sache, weil er wie von führenden PR-Agenturen empfohlen auf technische Lösungen setzt und auf das Einfordern staatlicher Restriktionen verzichtet.
BAYER sorgt sich um Öko-Investoren
Die Bedeutung der Investmentfonds, die sich bei ihrem finanziellen Engagement auch von sozialen, ökologischen und/oder ethischen Maßstäben leiten lassen nimmt zu. „Das Thema ethische Anlage ist vom Nischen- zum Mainstream-Thema geworden“, konstatiert BAYERs Forschungsvorstand Wolfgang Plischke. Der Leverkusener Multi reagiert darauf mit einer forcierten Arbeit am Image. Im wirklichen Leben betreibt der Konzern weiterhin „Business as usual“.
Neuer JournalistInnen-Preis
BAYER lobt erstmals einen „Europäischen Journalistenpreis 2006“ aus. Der Pillen-Riese will nach eigenem Bekunden „sorgfältig recherchierte Beiträge, die sich zugleich kritisch, allgemeinverständlich und objektiv“ mit einem Pharma-Thema auseinandersetzen, prämieren. Einen kritischen Text hat der Leverkusener Multi allerdings in seiner langen Stiftungsgeschichte noch nie gewürdigt, und das dürfte auch dieses Mal nicht geschehen. Solche Auszeichnungen stellen für das Unternehmen nämlich reine PR-Maßnahmen zur Einbindung von JournalistInnen dar. Darum verbreitet auch die auf Pharma-Marketing spezialisierte Fachzeitschrift PM-Report die Kunde von dem Preis und nimmt der „Verband Deutscher Medizinjournalisten“ die Bewerbungen entgegen.
Ausstieg bei Mathe-Olympiade
Vor der Übernahme durch BAYER hatte SCHERING elf Jahre lang die in Berlin stattfindende Mathematik-Olympiade gesponsort. Der neue Dienstherr hat daran aber kein Interesse mehr. „BAYER-SCHERING-PHARMA konzentriert sich bei der Förderung von Projekten primär auf naturwissenschaftliche Projekte, Kultur und Soziales“, ließ der Konzern knapp verlauten. Daraufhin erhielt die Faz einen geharnischten Leserbrief. „Da werden Vorstandsgehälter in für mich unvorstellbarer Höhe gezahlt. Kinder aber, die sich dem Trend der Brot und Spiele entgegenstemmen, ihre Freizeit zum Lernen nützen, erhalten nicht einmal Peanuts“, empörte sich die Schreiberin.
BAYER sponsort Gentech-Konferenz
Vom 5. bis zum 7. Mai 2007 fand in Boston die Gentechnik-Konferenz „International Biotechnology Convention“ statt, deren Genfood-Sektion BAYER, MONSANTO und andere Gen-Giganten sponsorten.
Geisterhaus statt BAYER-Kreuz
Der Leverkusener Multi will sein altes Wahrzeichen, das BAYER-Kreuz, entsorgen und dafür das leer stehende alte Verwaltungshochhaus als landmark nutzen. 3,5 Millionen LED-Leuchten sollen die Fassade illuminieren und diese so zur weithin sichtbaren Werbefläche machen - bei 100KW Stromverbrauch pro Stunde nicht eben prima fürs Klima. „Das wird demontiert, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist“, kommentiert ein Unternehmenssprecher den Abriss. Und zeitgemäß ist es nach all den Umstrukturierungen der letzten Jahre auch wirklich nicht mehr. Das Kreuz steht nicht einmal mehr auf BAYER-Boden, sondern - wie so vieles inzwischen - auf dem Gelände der Konzern-Abspaltung LANXESS, der Pharma-Riese unterhält an seinem Stammsitz nämlich neben einigen Büros und Forschungseinrichtungen nur noch wenige Produktionsstätten.
Preis für Laser-Scanner
Der Leverkusener Multi hat mit Produkt-Piraten zu kämpfen, die etwa ASPIRIN-Kopien in Umlauf bringen. Um die Spurensuche zu erleichtern, hat er deshalb auf Basis eines von der Firma INGENIA TECHNOLOGY erfundenen Verfahrens eine Art Laser-Scanner entwickelt, der genau zwischen Original und Fälschung unterscheiden kann. Dafür erhielt der Konzern auf der diesjährigen Hannover-Messe den Hermes-Award.
Max-Planck-Institut vor BAYER-Karren
Das Max-Planck-Institut hat sich von BAYER & Co. einspannen lassen, um zu versuchen, den ziemlich verfahrenen Gentechnik-Karren aus dem Dreck zu ziehen. Auf einer einseitigen Zeitungsanzeige der Initiative mit dem bedrohlichen Namen „Chemie macht Zukunft“ wirbt Dr. Heinz Saedler vom Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung mit dem Satz „Gentechnologie macht die Erde zwar nicht größer, aber ertragreicher“ für die Risikotechnologie und versucht in dem folgenden Interview, Bedenken zu zerstreuen.
„Kölner Erklärung“ für Gentech
Ein BeraterInnen-Gremium von Bundeswirtschaftsminister Michael Glos sprach sich in der „Kölner Erklärung“ dafür aus, die grüne Gentechnik bis 2030 europa-weit zum Standard in der Landwirtschaft zu machen, ansonsten würde die steigende Nachfrage nach Bio-Treibstoff die Nahrungsmittel-Produktion gefährden. Bei den ExpertInnen, „die nach außen ein Höchstmaß an Verlässlichkeit und Seriösität ausstrahlen wollen“ (Faz), handelt es sich aber keinesfalls um unabhängige Fachleute, sondern um die üblichen Verdächtigen: ManagerInnen von BAYER & Co. sowie Max-Planck-ForscherInnen, von denen so mancher nicht einmal davor zurückschreckt, in Werbekampagnen der Gentechnik-Industrie aufzutauchen (s. o.).
Preis für UmweltbotschafterInnen-Programm
Das Public-Relation-Fachmagazin PR-Report hat BAYERs UmweltbotschafterInnen-Programm mit einem Preis bedacht. Es stellte damit in dankenswerter Offenheit noch einmal klar, wobei es sich bei der Kinderlandverschickung von Emissären aus den Entwicklungsländern zum ökologischen Bildungsurlaub nach Leverkusen wirklich handelt: Um Public Relation.
1. FC Deutschland 06 macht weiter
Im Herbst 2004 trafen sich Manager von BAYER und anderen Konzernen mit dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, um zu bereden, wie man die kommende Fußballweltmeisterschaft als Werbung für die Multis nutzen könnte. So ventilierten die ManagerInnen den „1. FC Deutschland 06“, der unter anderem mit der Kampagne zum „Land der Ideen“ hervortrat. Da die Unternehmen Gefallen an der Sache fanden, gingen sie in die Verlängerung und institutionalisierten den Werbeverein. Mit ständigem Sitz in Berlin versteht sich der „1. FC Deutschland 06 nun als internationale Standort-Initiative. Er warb mit Claudia-Schiffer-Plakaten für Investitionen, erklärte den zum G8-Gipfel angereisten JournalistInnen Deutschland und plant für den Herbst eine PR-Tour nach China.
TIERE & VERSUCHE
Wieder mehr Tierversuche
Die Zahl der Tierversuche hat sich 2005 gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent auf 2,4 Millionen erhöht. Nach einem kurzzeitigen Rückgang steigt die Zahl der Experimente mit Ratten, Mäusen, Hunden und Katzen seit einiger Zeit wieder stark an, wofür hauptsächlich die Gentechnik verantwortlich ist. Auch bei BAYER dürften die Labor-Quälereien nach der Übernahme des SCHERING-Konzerns zunehmen, zumal SPD und CDU ihrer im Koalitionsvertrag festgehaltenen Ankündigung, sich für alternative Testverfahren einzusetzen, bislang kaum Taten haben folgen lassen.
DRUGS & PILLS
Lebensgefährliches TRASYLOL
Eine im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie hatte dem vor allem zur Blutstillung bei Bypass-Operationen verwendeten BAYER-Mittel TRASYLOL lebensgefährliche Nebenwirkungen von Nierenversagen über Schlaganfälle bis hin zu Herzinfarkten attestiert (SWB 1/06). Die US-amerikanische Arzneiaufsicht FDA überprüfte das Medikament daraufhin, entschied sich aber gegen einen Entzug der Zulassung, weil dem Leverkusener Multi eine Irreführung der Behörden gelungen war. Der Pharma-Riese hatte der Institution eine selbst in Auftrag gegebene Untersuchung verschwiegen, die zu alarmierenden Befunden gekommen war, was einen großen Skandal auslöste (siehe SWB 4/06). Nun hat eine weitere Expertise die gesundheitsgefährdenden Effekte der Arznei nachgewiesen. ForscherInnen der „Ischemia Research and Education Foundation“ stellten ein im Vergleich zur Referenz-Gruppe um zwei Drittel höheres Sterblichkeitsrisiko fest; 21 Prozent der mit TRASYLOL behandelten PatientInnen kamen um. Schon vorher hatte die FDA das Anwendungsspektrum des Pharmazeutikums auf solche Operationen beschränkt, die den raschen Einsatz von Herz/Lungen-Maschinen ermöglichen. Da dies nur bei Eingriffen am Herzen der Fall ist, brach der Konzern Studien zur Gabe von TRASYLOL bei Wirbelsäulen-, Lungen-, Speiseröhren und Harnblasen-OPs ab.
ASPIRIN nach Herzinfarkten
Das von BAYER viel gescholtene „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWIG) hat eine Entscheidung zu Gunsten des Leverkusener Multis gefällt. Es riet den Krankenkassen, die Kosten für das bislang oft zur Blutverdünnung nach Herzinfarkten oder Schlaganfällen verordnete Clopidogrel nicht mehr zu erstatten und sprach sich statt dessen für das preiswertere ASPIRIN aus.
ASPIRIN: hohes Sterberisiko
Nach einer Studie des „Tufts-New-England-Medical-Centers“ erhöht die tägliche Einnahme von ASPIRIN, wie sie BAYER zur Prophylaxe von Herzinfarkten propagiert, das Sterberisiko. 10 Menschen auf 100.000 EinwohnerInnen fallen dem „Tausendsassa“ zum Opfer, haben die WissenschaftlerInnen errechnet. Damit ist das Schlucken von ASPIRIN fast so gefährlich wie das Autofahren, das laut Statistik 11 von 100.000 Menschen das Leben kostet.
ASPIRIN als Dopingmittel
- 1
„Es ist auch kein Geheimnis, dass in vielen Sportarten schon im Jugendbereich regelmäßig Schmerzmittel wie ASPIRIN und VOLTAREN verwendet werden“, sagt Hans Geyer, der Geschäftsführer des „Zentrums für präventive Dopingforschung“ und stellvertretende Leiter der Biochemie-Abteilung der Kölner Sporthochschule. Er sieht diese Praxis als Doping an, weil ASPIRIN & Co. der Leistungsverbesserung dienen. Auf die Frage, warum die Präparate dann nicht auf der Dopingliste stehen, antwortet er: „Möglicherweise gibt es Widerstände von verschiedenen Gruppen, von der Industrie selbst“ und führte anschließend die große Verbreitung der Mittel in der Bevölkerung als weitere Schwierigkeit an, weil dieses die Gefahr einer Überfülle an positiven Fällen und nachfolgend ebenso vieler Ausnahmegenehmigungen berge.
ASPIRIN als Dopingmittel
- 2
Der ehemaliger Radsportler Sascha Severin betrachtet ASPIRIN als Einstiegsdroge für das Doping. Schon bei den jugendlichen Radlern hätte es bestimmte Rituale gegeben, berichtete er der Faz, ein blitzsauber geputztes Rad, regelmäßige Übungszeiten - und das Schlucken von ASPIRIN vor den Wettkämpfen. Das unterdrückte den Schmerz und förderte die Durchblutung. „So kann eine Dopingkarriere mit einem vergleichsweise harmlosen Mittel beginnen“, resümiert die Zeitung.
BAYER goes East
Der Leverkusener Multi übernimmt den Vertrieb seiner Medikamente in Russland, Weißrussland, der Ukraine und Kasachstan künftig selbst und hat zu diesem Zweck seinen bisher für die Distribution zuständigen Kooperationspartner PHARMONYX aufgekauft.
Hausgemachtes BETAFERON
Seit 1993 produziert die US-amerikanische Firma CHIRON für die im letzten Jahr von BAYER übernommene SCHERING AG das Multiple-Sklerose-Medikament BETAFERON. Im Jahr 2006 kaufte NOVARTIS CHIRON. Im Falle eines solchen Falles sah der zwischen CHIRON und SCHERING geschlossene Vertrag eine Option auf den Kauf der US-amerikanischen Produktionsstätten vor. Um diesen Passus entbrannte nun aber ein Streit zwischen BAYER und NOVARTIS, den die Konzerne Ende März 2007 beilegten. Nach der nun getroffenen Vereinbarung geht die BETAFERON-Fertigung für 200 Millionen Dollar an den Leverkusener Multi, der NOVARTIS noch bis Oktober 2008 zu 12,5 Prozent an den Umsätzen mit der Arznei beteiligen muss. Ab 2009 will der Schweizer Pharma-Riese das Pharmazeutikum selber vermarkten, lässt dann aber gegen ein entsprechendes Entgeld bei BAYER produzieren.
NEXAVAR bei Leberkrebs?
BAYERs zur Behandlung von Nierenkrebs im fortgeschrittenen Stadium zugelassenes Gentech-Präparat NEXAVAR musste unlängst einige Rückschläge verkraften. Der Leverkusener Multi brach klinische Erprobungen zur Therapie von Haut- und Bauchspeicheldrüsenkrebs wegen Erfolgslosigkeit ab (Ticker 4/06). Jetzt strebt der Pharmariese eine Zulassung für die Indikation „fortgeschrittener Leberkrebs“ an und präsentierte erste Forschungsergebnisse, wonach das Mittel die Überlebenszeit der PatientInnen angeblich um ca. drei Monate verlängert.
Beteiligung an AICURIS
BAYER hat seine Anti-Infektiva-Abteilung an die Gebrüder Strüngmann verkauft, die das Geschäft unter dem Namen AICURIS weiterführen. An dem neu gegründeten Unternehmen hält der Leverkusener Multi allerdings noch eine Minderheitsbeteiligung.
Diabetes: BAYER bildet fort
BAYER bietet ArzthelferInnen eine kostenlose Fortbildung zum Thema „Diabetes“ an. Damit das sich lohnt, dürften bei den Seminaren die vom Konzern produzierten Diabetes-Meßgeräte ausgiebig zum Einsatz kommen, damit die TeilnehmerInnen die Geräte den PatientInnen weiterempfehlen können. Auch über die von vielen ExpertInnen bestrittenen Vorzüge des Konzern-Diabetikums GLUCOBAY werden die Arzthelferinnen wohl so einiges erfahren.
Neuer Cholesterinsenker
Der LIPOBAY-Skandal mit seinen über 100 Toten hält den Leverkusener Multi nicht davon ab, weiter Cholesterinsenker zu vermarkten - zu lukrativ erscheint offensichtlich diese Medikamenten-Gruppe. So hat BAYER im Juni 2007 gemeinsam mit dem Pharma-Riesen SCHERING-PLOUGH das Präparat ZETIA in Japan herausgebracht.
Keine Pille für den Mann
Im letzten Jahr haben BAYER und das US-amerikanische Pharma-Unternehmen ORGANON ihre Kooperation bei der Entwicklung einer „Pille für den Mann“ nach Abschluss der Phase II der klinischen Tests eingestellt. Im Juni 2007 verkündete der Pharma-Riese schließlich das Ende aller Forschungsanstrengungen auf diesem Gebiet.
Topseller BETAFERON
Mit einem Umsatz von 244 Millionen Euro war das „Multiple Sklerose“-Präparat BETAFERON BAYERs meistverkauftes Medikament im Geschäftsjahr 2006. Platz zwei nimmt die Anti-Baby-Pille YASMIN (240 Millionen) ein.
WASSER, BODEN & LUFT
Die Klimarechnung: 3,9 + 3,6 Mio. Tonnen
Auf der diesjährigen BAYER-Hauptversammlung hat der Vorstandsvorsitzende Werner Wenning erstmals genauere Angaben darüber gemacht, welche Kohlendioxid-Menge durch den von externen Anbietern bezogenen Strom noch auf die Klimarechnung BAYERs draufkommt: Es handelt sich nach seinen Angaben um 3,6 Millionen Tonnen. Mit den bislang offiziell angegebenen 3,9 Millionen Tonnen zusammen trägt der Konzern nun also Verantwortung für CO2-Emissionen in einer Größenordnung von 7,5 Millionen Tonnen.
Weniger CO2 in der Chlor-Produktion?
Mit einer Chlor-Produktion von 1,2 Millionen Tonnen gehört BAYER europa-weit zu den größten Anbietern der Substanz, die nicht nur zu den gefährlichsten Umweltgiften zählt, sondern in der Herstellung auch soviel Energie verschlingt wie kaum eine andere Chemikalie. Zumindest bei letzterem sinnt der Konzern auf Abhilfe. Mittels einer Sauerstoff-Verzehrkathode, dessen Entwicklung das Bundesforschungsministerium mit sechs Millionen Euro subventionierte, will er den Strombedarf bei der Gewinnung von Chlor um ein Drittel senken und damit seinen Kohlendioxid-Ausstoß um zwei Millionen Tonnen reduzieren, was jedoch allzu hochgegriffen erscheint.
Mittelohrentzündungen durch Stickstoffoxide
4.500 Tonnen Stickstoffoxide bliesen die BAYER-Werke im Jahr 2005 in die Luft. Diese Schadstoffe können die menschliche Gesundheit massiv schädigen. Nach einer Studie des Neuherberger „GSF-Forschungszentrums für Umwelt und Gesundheit“ sorgt schon eine um 10 Mikrogramm gestiegene Stickstoffdioxid-Belastung bei Kindern für ein um 14 Prozent höheres Risiko, an einer Mittelohrentzündung zu erkranken. Die Gefahrstoffe greifen die Flimmerhärchen in den oberen Atemwegen an, weshalb diese ihre Filterfunktion nur noch eingeschränkt ausfüllen und Infektionen entstehen, die wiederum häufig Mittelohrentzündungen nach sich ziehen.
PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE
Bienensterben in den USA
Von „einem mysteriösen Bienensterben in den USA“ berichteten im Frühjahr viele Medien. Rund die Hälfte der 2,5 Millionen Bienenvölker verendete. Nach und nach kam allerdings Licht ins Dunkel. „Der Hauptverdächtige ist nach Meinung vieler Wissenschaftler das am weitesten verbreitete Insektizid auf dem Planeten: Imidacloprid (Wirksubstanz von BAYERs GAUCHO, Anm. SWB) “, schrieb die Zeitung Star-Ledger. Immer mehr ExpertInnen messen der Ackergift-Ausbringung einen bedeutenen Anteil am Tod der Bienen zu, wenn auch nicht unbedingt im Sinne eines einfachen Ursache-Wirkung-Zusammenhanges. „Die Imidacloprid-haltigen Insektizide machen ganze Arbeit bei Termiten, Fliegen und Zecken, aber die Menschen vergessen, dass auch Bienen Insekten sind. Die Ignoranz, welche die Chemie-Unternehmen gegenüber guten Insekten zeigen - und zeigen dürfen - erstaunt mich“, sagt etwa Jerry Hayes, Insektenkundler und Präsident der US-amerikanischen Bienenzucht-InspektorInnen.
Aus für Tolylfluanid
Das „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit“ (BVL) hat BAYER die Zulassung für den Pestizid-Wirkstoff Tolylfluanid entzogen, den der Agro-Riese unter den Namen EUPAREN M WG, FOLICUR EM und MELODY MULTI vermarktet. Gelangt die Chemikalie in Flüsse, die zur Trinkwassergewinnung dienen, kann sein Abbauprodukt Diemethylsulfamid im Zuge der Aufbereitung nämlich das gesundheitsgefährdende Nitrosamin bilden, wenn die Wasserversorger zur Entkeimung Ozon einsetzen.
Pestizide in Lebensmitteln
Liegen die Pestizid-Rückstände in Lebensmitteln über der Akuten Reverenz-Dosis (ARfD), so stellen sie eine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar. GREENPEACE untersuchte jüngst Obst und Gemüse und wies zahlreiche solcher Überschreitungen nach. Drei auch von BAYER hergestellte Ackergifte waren dabei mit von der Partie: das in SUMICLEX WG enthaltene Procymidon, das unter anderem in MALIX, PHASER und THIODAN zu findende Endosulfan - beide in der Bundesrepublik gar nicht mehr zugelassen! - und das sich in LEBAYCID tummelnde Fenthion. Der Procymidon-Gehalt übertraf bei italienischen Tafeltrauben die ARfD um 254 Prozent. Endosulfan kam bei spanischer Paprika auf 244 Prozent und Fenthion erreichte bei von dort stammenden Pfirsichen die 184-Prozent-Marke.
Auflagen für Endosulfan
BAYER kann den in der Bundesrepublik wegen seiner Gefährlicheit seit geraumer Zeit nicht mehr zugelassenen Pestizidwirkstoff Endosulfan, enthalten in den Ackergiften MALIX, PHASER und THIODAN, künftig nur noch unter Auflagen in Länder der „Dritten Welt“ importieren. Das „Chemical Review Committee“ empfahl, den Stoff gemäß der Rotterdamer Konvention zu behandeln. Deshalb darf der Export nur noch erfolgen, wenn die staatlichen Stellen dem Geschäft ausdrücklich zustimmen und der Leverkusener Multi die KäuferInnen ausführlich über die Risiken und Nebenwirkungen der Substanz aufgeklärt hat.
Hormonspritzen für Obst
In Bangladesh behandeln LandwirtInnen ihre Früchte mit dem von BAYER importierten Hormonspray ETHREL 48 SL, um den Reifeprozess zu beschleunigen und das Obst länger frisch zu halten. Nach Ansicht des Physikers Dr. Abdul Hamid kann diese Extraportion Chemie bei den KonsumentInnen die Leber, die Nieren und die Fortpflanzungsorgane schädigen. Eine besondere Bedrohung stellen die mit ETHREL und anderen Produkten eingesprühten Lebensmittel seiner Meinung nach für die Gesundheit von Kindern dar.
Pestizide machen depressiv
Eine in der Fachzeitschrift Journal of Occupational and Environmental Medicine (Nr. 48) erschienene Fallkontrollstudie hat einen Zusammenhang zwischen Pestizid-Exposition und dem Entstehen von Depressionen nachgewiesen.
Pestizid-Boom dank Biosprit
BAYER setzt große Hoffnung auf die Gewinnung von Treibstoff aus nachwachsenden Rohstoffen wie Raps, weil der Konzern sich durch die blühenden Biokraftstoff-Landschaften einen größeren Pestizid-Absatz verspricht. Das sagt er natürlich nicht offen, in offiziellen Verlautbarungen führt er vornehmlich ökologische Gründe an. UmweltschützerInnen haben dagegen viele Zweifel am Raps im Tank. So ist die Energiebilanz mäßig. Ein Hektar Anbaufläche ergibt nur 1600 Liter Biodiesel; selbst wenn auf der Hälfte aller bundesdeutschen Äcker solche Pflanzen blühen würden, wäre der Bedarf nicht gedeckt. GREENPEACE warnt zudem vor einer weiteren Zerstörung der Regenwälder und anderer wichtiger Ökotope in den ärmeren Ländern, wenn Rodungen für Biosprit-Plantagen erfolgten. Auch auf die Ernährungslage könnte der Boom verheerende Folgen haben wie jüngst die Tortilla-Krise in Mexiko gezeigt hat, wo der zur Energiegewinnung in die USA exportierte Mais die Preise des Grundnahrungsmittels in für viele Menschen unerschwingliche Höhen getrieben hat. Und nicht zuletzt dürfte der Einsatz von Agrochemikalien bei nicht zum Verzehr bestimmten Ackerfrüchten (noch) gewissensloser erfolgen.
Comeback für Organophosphate
BAYER behauptet gerne, die Fortschritte in der Produktentwicklung erlaubten die Herstellung immer zielgenauerer und ungiftigerer Pestizide. In Wirklichkeit aber stellen sich immer mehr Schadinsekten auf die neue Substanzklasse der Pyrethroide ein, weshalb die alten Chemischen Keulen fröhliche Urständ feiern (siehe auch Ticker 3/06). So erlebt derzeit das in der Bundesrepublik wegen seiner Gefährlichkeit gar nicht mehr zugelassene Organophosphat Endosulfan, unter anderem Wirkstoff der BAYER-Produkte MALIX, PHASER, THIODAN, ein Comeback im afrikanischen Baumwollanbau.
Tod im Baumwollfeld
43 Pestizid-Tote unter Baumwoll-FarmerInnen in neun Dörfern der senegalesischen Velingara-Region registrierte eine im Februar 2003 durchgeführte Untersuchung des PESTIZID-AKTIONS-NETZWERKES/Afrika. Unter den Agrochemikalien, welche die LandwirtInnen verwendeten, befand sich auch das BAYER-Produkt TAMARON mit dem Wirkstoff Methamidophos.
EU schränkt Pestizid-Gebrauch ein
Die Europäische Union hat den Gebrauch von acht Pestiziden eingeschränkt bzw. verboten. Den Wirkstoff Azinphos-methyl, unter anderem in den BAYER-Produkten GUSATHION und GUTHION enthalten, zog die EU ganz aus dem Verkehr. Die Zulassung der Wirkstoffe Methamidophos (TAMARON) und Procymidone (SUMICLEX WG) befristete sie auf drei Jahre, zudem legte Brüssel Anwendungsbeschränkungen für diese Ackergifte fest. Das PESTIZID-AKTIONS-NETZWERK hatte ein Aus für alle acht Substanzen gefordert, betrachtet die Entscheidung aber trotzdem als einen Teilerfolg.
MOCAP weiterhin zugelassen
In der philippinischen Provinz Davao del Norte erlitten im letzten Jahr 79 Kinder eine durch die BAYER-Agrochemikalie MOCAP ausgelöste Pestizid-Vergiftung (Ticker 4/06). Als „extrem gefährlich“ rechnet die Weltgesundheitsorganisation WHO MOCAP (Wirkstoff: Ethroprophos) der höchsten Gefährdungsklasse Ia zu. Trotzdem hat die Europäische Union dessen Zulassung für Anwendungen im Kartoffelanbau verlängert.
Chlorpyrifos schädigt Kinder
Nach einer in der Fachzeitschrift Pediatrics, 118 (6) veröffentlichten Untersuchung schädigt der Pestizid-Wirkstoff Chlorpyrifos, enthalten unter anderem in den BAYER-Produkten BLATTANEX, PROFICID und RIDDER, die psycho-motorische Entwicklung von Kindern. Minderjährige, die einen höheren Chlorpyrifos-Anteil im Blut hatten, zeigten deutlich mehr Konzentrationsstörungen und andere Verhaltensauffälligkeiten als ihre AltersgenossInnen aus der Vergleichsgruppe.
USA schränkt Chlorpyrifos-Anwendungen ein
Der unter anderem in den BAYER-Produkten BLATTANEX, PROFICID und RIDDER enthaltene Wirkstoff Chlorpyrifos schädigt die menschliche Gesundheit massiv (s. o.). Deshalb darf er in den USA nicht mehr als Haushaltsinsektizid zum Einsatz kommen. Die europäischen und bundesdeutschen Behörden erlauben dies jedoch weiterhin.
Uruguay: krankmachende Pestizide
In der uruguayischen Region Bella Union nahe der Grenze zu Brasilien befinden sich zahlreiche landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Ausbringung der Pestizide auf den Feldern hat die Zahl der Atemwegs- und Krebserkrankungen ebenso steigen lassen wie diejenige der Frauen, die Kinder mit Geburtsfehlern zur Welt bringen. Zu den am häufigsten verwendeten Agrochemikalien gehören mit Glyphosate, Wirkstoff von GLYPHOS und USTINEX G, Endosulfan (MALIX, PHASER, THIODAN) und Chlorpyrifos (BLATTANEX, PROFICID, RIDDER) auch zahlreiche von BAYER vermarktete Inhaltsstoffe. Das PESTIZID-AKTIONS-NETZWERK (PAN), FRIENDS OF THE EARTH und die INTERNATIONAL AGRICULTURE WORKERS UNION hat diese Situation bewogen, in Bella Union aktiv zu werden und Vorschläge für einen besseren Gesundheitsschutz der Menschen auszuarbeiten.
Pestizide schädigen Ökosystem „Boden“
Während des Wachstumsprozesses bilden Kulturpflanzen im Boden Knöllchen. Dort siedeln sich Bakterien an und versorgen die Ackerfrüchte so mit dem lebensnotwendigen Stickstoff. Pestizide stören aber diesen Prozess, so dass die Ernteerträge oftmals unter den Erwartungen bleiben, wie ein Forscherteam um John McMachlan von der US-amerikanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften herausgefunden hat. Unter den größten Störenfrieden: der unter anderem im BAYER-Ackergift FOLIDOL enthaltene Wirkstoff Parathion Methyl.
GENE & KLONE
Brasilien genehmigt Gen-Mais
Die brasilianischen Behörden haben genmanipulierten BAYER-Mais mit einer eingebauten Resistenz gegenüber dem Herbizid LIBERTY LINK zugelassen, nachdem Präsident Lula da Silva kurz vorher die Zulassungsbedingungen gelockert hatte. Der Entscheidung lagen nur vom Agro-Multi eingebrachte Dokumente zugrunde, Informationen von Gentechnik-GegnerInnen würdigte das Gremium nicht. Auch führte die „National Technical Commission on Biosafety of Brazil“ im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens keine öffentliche Anhörung durch, was besonders die Organisation der landlosen Bauern und Bäuerinnen monierte. Die LandwirtInnen-Organisation VIA CAMPESINA BRASIL kritisierte die Entscheidung scharf. „Die Freigabe des Anbaus transgener Pflanzen zu kommerziellen Zwecken stellt eine Verantwortungslosigkeit gegenüber den brasilianischen Farmern, der Landwirtschaft und der Biodiversität dar“, kommentierte die Organisation.
Neuer Genreis-Fund in USA
Das US-amerikanische Landwirtschaftsministerium hat in der Reispflanze „Clearfield 31“ Spuren von BAYERs genmanipulierter Sorte LL604 gefunden. Es untersagte daraufhin einen weiteren Anbau und forderte die LandwirtInnen auf, ihre Clearfield-Felder zu zerstören. Nun hat nach LL601 und LL62 schon die dritte Laborfrucht BAYERs einen erheblichen gentechnischen Flurschaden angerichtet.
Mexiko hat Angst vor BAYER-Reis
Mexiko ist der US-amerikanische Reis nicht mehr geheuer. Das Land fürchtet Verunreinigungen durch BAYERs genmanipulierte LIBERTYLINK-Sorten und hat mehrere Lieferungen an der Grenze aufgehalten. Zudem hat der Staat Verhandlungen mit den USA über Gentech-Belastungsgrenzen bei der Getreideart aufgenommen.
Importgenehmigung für BAYER-Raps
Im letzten Jahr hatte der EU-Agrarrat BAYERs gentechnisch manipulierten Rapssorten Ms8, Rf3 und Ms8xRf3 eine Einfuhrerlaubnis verweigert (Ticker 4/06). Da die GenskeptikerInnen aber weniger als zwei Drittel der Stimmen auf sich vereinigen konnten, hatte die EU-Kommission das letzte Wort. Diese stimmte dem Antrag des Leverkusener Multis, den auch die Bundesregierung unterstützt hatte, zu, was den Gen-Giganten dazu bewog, die EU-Genehmigung für drei ältere Genraps-Varietäten auslaufen zu lassen. Einer „strengen Risikobewertung“ will die Kommission die für die Futtermittel-Produktion bestimmten Laborfrüchte unterzogen haben. Dabei muss ihnen allerdings so einiges entgangen sein, denn der gentechnisch gegen das Herbizid LIBERTYLINK immun gemachte Raps richtete schon so einigen Flurschaden an. So kreuzte sich auf australischen Feldern bereits in konventionellen Raps ein und fügte den LandwirtInnen so erheblichen finanziellen Schaden zu. Auch der LIBERTYLINK-Wirkstoff Glufosinat steht in der Kritik. Wegen seiner Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt nimmt die Europäische Union gerade eine Sicherheitsprüfung vor.
Mehr Gentech-Baumwolle
BAYER treibt das Geschäft mit gentechnisch verändertem Baumwoll-Saatgut unaufhaltsam voran. Bereits jetzt der zweitgrößte Anbieter auf dem US-Markt, kaufte der Leverkusener Multi nun für 230 Millionen Euro die entsprechende Saaten-Sparte des Unternehmens STONEVILLE auf.
BAYER & Co. forcieren weiße Gentechnik
BAYER & Co. verstärken ihre Anstrengungen auf dem Gebiet der weißen Gentechnik, dem Einsatz von Mikroorganismen in der Industrie-Produktion, beispielsweise bei der Herstellung von Waschmitteln, Nahrungsmitteln oder Medikamenten. Zu diesem Zweck hat der Leverkusener Multi gemeinsam mit BASF, HENKEL und anderen Unternehmen den „Industrieverbund Mikrobielle Genomforschung“ gegründet. Der Verband hat die Aufgabe, die Forschung in diesem Bereich zu intensivieren. Das Investieren allerdings teilt er sich mit dem Staat. Für erste Projekte gab das „Bundesministerium für Forschung und Bildung“ 21 Millionen Euro dazu.
BAYER will mehr Biotech
Die Bioscience-Sparte von BAYER CROPSCIENCE (BCS) will nach eigener Aussage „an der genetischen Verbesserung der Gemüseproduktion und -vermarktung mitwirken“. Die Methoden dazu reichen von direkter gentechnischer Manipulation bis zu einer auf gezielter Erbgut-Auswahl basierenden Saatgut-Entwicklung, dem so genannten Smart Breeding. Im Geschäftsjahr 2005 hatte die Konzern-Abteilung mit 328 Millionen Euro einen 5,5-prozentigen Anteil am gesamten CROPSCIENCE-Umsatz. Aber BCS-Chef Friedrich Berschauer strebt nach Höherem: „Unser Ziel ist es, das Bioscience-Geschäft langfristig auf eine Milliarde Euro auszubauen.“
LABOR & FRÜCHTE
BAYER erweitert Tomaten-Portfolio
Der Leverkusener Agro-Riese mag die herkömmlichen Tomaten nicht. Darum will der bislang nicht als Feinschmecker hervorgetretene Konzern sie mittels „Smart Breeding“ (Ticker 1/07) auf den Geschmack bringen. Seine niederländische Tochter-Gesellschaft NUNHEMS BV fahndet im Erbgut des Gemüses nach besonderen Sorten und entwickelt auf dieser Basis dann Saatgut exklusiv für den Nahrungsmittelmulti UNILEVER. „Wir erwarten, dass die Vereinbarung attraktive Wachstumschancen für unser weltweites Tomaten-Portfolio eröffnet“, so NUNHEM-Entwicklungschef Orlando de Ponti. Wem da nicht das Wasser im Munde zusammenläuft ...
Hybrid-Reis für China
BAYER hat in China ein Joint Venture zur Entwicklung und Vermarktung von Reis-Sorten gegründet. Dabei handelt es sich um so genannten Hyprid-Reis, der sich nicht gut zur Wiederaussaat eignet. Deshalb müssen die LandwirtInnen jedes Jahr neue Samen kaufen - ein einträgliches Geschäft für den Agro-Riesen.
STANDORTE & PRODUKTION
Mehr Kunststoff aus Fernost
BAYER will die Kunststoff-Herstellung in Indien und China ausbauen. 80 Millionen Euro steckt der Konzern in die Erweiterung der Makrolon-Produktion an den dortigen Standorten. Zudem erhöht das Unternehmen die Kapazität seines Weichschaum-Werkes in Shanghai von 160.000 auf 300.000 Tonnen im Jahr.
Baytown wieder am Netz
Am 26. September 2006 ereignete sich im Baytowner BAYER-Werk eine Explosion (siehe auch SWB 4/06). Mehr als 22 Beschäftigte kamen ins Krankenhaus. Zudem zerstörte die Detonation einen Großteil der TDI-Produktionsanlage. Im Januar 2007 nahm der Konzern die Kunststofffertigung wieder auf.
Monheim: Streit um Ausgleichsfläche
Der Leverkusener Multi macht sich am Standort Monheim nicht nur durch den geplanten Bau einer Kohlendioxid-Pipeline unbeliebt. Er sabotiert auch die Pläne der Stadt für die Ausweisung von Gewerbegebieten.
Der Konzern duldet nämlich keine Firmen neben sich und hat deshalb der Kommune ein für Ansiedelungen vorgesehenes Areal vor der Nase weggeschnappt. BAYER wollte der Verwaltung zwar eine Alternativ-Fläche zur Verfügung stellen, aber das Rathaus wartet bisher vergebens. Von „kaum zu überbietender Arroganz“ spricht deshalb Chefplaner Thomas Waters.
Grigat neuer Chemiepark-Leiter
Ernst Grigat tritt die Nachfolge von Heinz Bahnmüller als Leiter des Leverkusener Chemieparks an. Dessen Posten im Vorstand von BAYER INDUSTRY SERVICES erbte Grigat jedoch nicht. Der Leverkusener Multi nutzte den Stabswechsel, um das Gremium von drei auf zwei Sitze zu verkleinern.
IMPERIUM & WELTMARKT
Wall Street ohne BAYER SCHERING
Der mit großem Tamtam begleitete Gang an die New Yorker Börse hat für BAYER die Er
AKTION & KRITIK
CBG schreibt Angela Merkel
Im Dezember 2006 wandten sich BAYER-Chef Werner Wenning und andere Konzern-Bosse in einem Schreiben an Angela Merkel, in dem sie die Bundeskanzlerin aufforderten, sich in Brüssel für großzügiger bemessene Lizenzen zum Kohlendioxid-Ausstoß einzusetzen (siehe POLITIK & EINFLUSS). Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) nahm dies zum Anlass, die CDU-Politikerin in einem Offenen Brief auf das umfängliche Klimasünden-Register des Unternehmens hinzuweisen, das unter anderem aus geschönten Klimabilanzen besteht, aus denen die von externen Stromanbietern bezogene Energie herausrechnet ist(siehe auch SWB 1/07).
Umweltbundesamt meldet sich
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hat die Explosion in einer brasilianischen BAYER-Anlage (siehe auch UNFÄLLE & KATASTROPHEN) per Presse-Information publik gemacht. Als Reaktion auf die Veröffentlichung wandte sich ein Mitarbeiter des Umweltbundesamtes an die CBG. Er führt für die Störfall-Kommission über Unfälle Buch und bat darum, künftig von der Coordination über Ereignisse bei BAYER in Kenntnis gesetzt zu werden.
CBG veröffentlicht Unfallliste
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hat den jüngsten Störfall in einem BAYER-Werk, die Explosion am brasilianischen Standort Belford Roxo, zum Anlass genommen, eine Unfallliste zu veröffentlichten. Die Aufstellung beginnt 1992, führt 70 Vorfälle auf und dokumentiert somit den Normalfall „Störfall“.
Task Force für Firmenschließung
Die von dem Entsorgungsunternehmen PHILIPS SERVICES vorgenommene Reinigung von Behältern, in denen BAYER mit Propylmercaptan einen Bestandteil des Pestizides MOCAP herstellte, löste bei über 250 AnwohnerInnen in einem Umkreis von 50 Quadratmeilen Krankheitssymptome wie Kopfschmerzen, Brechreiz, allergische Reaktionen und Atemstörungen aus (Ticker 2/06). Die staatlichen Behörden überprüften die Firma, gaben ihr jedoch bald wieder eine Betriebserlaubnis. Die SOUTH FULTON/FAYETTE COMMUNITY TASK FORCE fordert jedoch eine Schließung, bis WissenschaftlerInnen die genaue Ursache der Gesundheitsstörungen herausgefunden haben. Der Kongressabgeordnete David Scott schloss sich diesem Begehr an und schrieb einen entsprechenden Brief an die US-Umweltbehörde EPA. Diese sah jedoch keinen Handlungsbedarf, woraufhin die Task Force ein Protestschreiben aufsetzte. „Wir sind sehr enttäuscht über die mangelnde Bereitschaft der EPA, die Gesundheit der BürgerInnen zu schützen“, heißt es darin.
Neue MedizinerInnen-Initiative
BAYER & Co. versuchen auf vielfältige Weise, das Verschreibungsverhalten der MedizinerInnen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. So hat der Leverkusener Multi in der Vergangenheit ÄrztInnen Reisen im Orientexpress spendiert und ihnen für so genannte Beobachtungsstudien viel Geld gezahlt. Die neue MedizinerInnen-Initiative MEIN ESSEN ZAHL ICH SELBST (MEZIS) geht jetzt auf Distanz zur Pharmaindustrie. Mitglieder von MEZIS empfangen keine PharmareferentInnen in ihren Praxen, nehmen keine Musterpackungen und Geschenke an, beteiligen sich nicht an Arznei-Anwendungsstudien und verzichten auf Praxissoftware, die von den Pillenriesen gesponsort ist.
BfArM wehrt sich
Beharrlich arbeitet Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt daran, das für Pillen-Zulassungen zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-Produkte (BfArM) industrie-freundlicher zu gestalten. Nachdem eine Arbeitsgruppe, in der auch Vertreter von BAYER saßen, dem Institut vorwarf, der „Arzneimittel-Zulassung als Wettbewerbs- und Standort-Faktor“ nicht genügend Beachtung zu schenken, schasste Schmidt im Jahr 2005 den Leiter Harald Schwelm und ersetzte ihn durch den „Reformator“ Reinhard Kurth. Anfang 2007 präsentierte sie schließlich einen Gesetzesentwurf zur Umwandlung des BfArM in eine rechtlich eigenständige Gesellschaft. Der Personalrat der Institution wandte sich jedoch scharf gegen die Pläne, die das Bundesinstitut „durch eine erhebliche Unterfinanzierung in eine höhere Abhängigkeit führen werden“. Perspektivisch soll es nämlich seine Kosten nur noch durch die von BAYER & Co. erhobenen Gebühren decken.
Grüne für Aufsichtsratsquoten
Die Aufsichtsräte der bundesdeutschen Unternehmen sind nur zu 7,5 Prozent mit Frauen besetzt und 80 Prozent dieser Glücklichen verdanken ihr Mandat nicht den Konzernen, sondern den Gewerkschaften. So sitzt im 21-köpfigen BAYER-Aufsichtsrat nur eine Frau: Petra Kronen, die Betriebsratsvorsitzende des Uerdinger Werkes. Um diesen Missstand zu ändern, haben die NRW-Grünen die Landesregierung in einem Antrag aufgefordert, sich auf Bundesebene für die Einführung einer Frauenquote von 40 Prozent nach norwegischem Vorbild einzusetzen.
Imkerverband kritisiert Bienen-Monitoring
Französische ImkerInnen machten das BAYER-Pestizid GAUCHO mit dem Wirkstoff Imidacloprid für den Tod von Milliarden Bienen mitverantwortlich, weshalb ihre Regierung 2004 die Ausbringung des Ackergiftes auf Sonnenblumen- und Maisfeldern untersagte. Auch in der Bundesrepublik kam es zu einem Bienensterben im großen Ausmaß. Auf Druck der BienenzüchterInnen initiierte Rot/Grün deshalb eine Untersuchung. Allerdings unterstützten BAYER & Co. das „Bienenmonitoring“ finanziell und nahmen auch selbst daran teil. Der Leverkusener Multi ließ es sich dann auch nicht nehmen, selbst die Bienengefährlichkeit von GAUCHO zu testen. Vorhersehbarer Befund: Kein Grund zur Beunruhigung. Der „Deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund“ gibt sich mit diesem Ergebnis jedoch nicht zufrieden und fordert Studien von nicht konzern-gebundenen WissenschaftlerInnen ein. In einer Presseerklärung kritisierte der Verband das Bienen-Monitoring als reine PR-Maßnahme und drohte mit dem Ausstieg.
Sonnleitner rät von Gentechnik ab
Der Bauernverbandspräsident Gerd Sonnleitner ist zwar kein Gentechnik-Gegner, hat sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber gegen die Aussaat von Pflanzen mit verändertem Erbgut ausgesprochen. „Wir müssen vom Anbau gentechnisch veränderten Saatguts abraten. Und genau das wollte die Bundesregierung. Ich kann doch den Landwirten nicht etwas empfehlen, was unabsehbare Risiken birgt. Zudem wollen die Verbraucher die Produkte auch nicht. Warum sollen wir etwas produzieren, was niemand will“, so Sonnleitner in einem Interview mit der Rheinischen Post.
UNEP-Direktor kritisiert BAYER & Co.
Der bundesdeutsche Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), Achim Steiner, hat den Widerspruch zwischen Worten und Taten kritisiert, den BAYER & Co. in Sachen „Klimaschutz“ an den Tag legen. „Was mich in den letzten Monaten überrascht hat, ist eine gewisse Doppelzüngigkeit der Industrie“, sagte Steiner im Hinblick auf Lippenbekenntnisse zur Kohlendioxid-Reduzierung bei internationalen Konferenzen und nachfolgender klimaschädigender Realpolitik der Unternehmensverbände.
KAPITAL & ARBEIT
3,9 Prozent mehr Lohn
Um 133 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro stieg der Gewinn von BAYER im Geschäftsjahr 2005. Die anderen Unternehmen der Branche verdienten fast ebenso gut. Deshalb mussten die Chemie-Firmen ihre Beschäftigten zumindest einen marginalen Anteil an den Zuwächsen gewähren. Die Tarifparteien einigten sich im Marz 2007 auf eine Lohnsteigerung von 3,6 Prozent. Zudem vereinbarten Arbeitgeber und die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE eine Einmalzahlung, die 0,7 Prozent eines Monatsentgelts multizipliert mit dem Faktor 13 ausmacht. Diese kann allerdings entfallen, wenn der Betriebsrat des zahlungsunwilligen Unternehmens seine Einwilligung gibt. Zudem stimmten die Gewerkschaften abermals dem Vorgehen der Konzerne zu, bei der Einstellung von Langzeitarbeitslosen und Berufsanfängern nur 90 bis 95 Prozent des Tariflohns zu zahlen. Die kapitalfreundliche Presse kritisierte indessen das Verhandlungsergebnis. „Niemand will den Arbeitnehmern einen ordentlichen Schluck aus der Pulle vorenthalten. Doch diesmal haben sie den Mund zu voll genommen. Daran könnte sich nicht nur die Chemie verschlucken“, schrieb die Faz im Hinblick auf die noch kommenden Tarifrunden in anderen Wirtschaftszweigen.
SCHERING-Übernahme kostet Jobs
Gleich nach dem Kauf des Pharma-Unternehmens SCHERING kündigte BAYER an, 6.000 Arbeitsplätze vernichten zu wollen. Im März 2007 konkretisierte der Leverkusener Multi seine Pläne. Er kündigte an, in der Bundesrepublik 1.500 Stellen zu streichen, mit 1.200 einen Großteil davon am Berliner Stammsitz der Neuerwerbung. Weder Proteste der Belegschaft noch Interventionen des Wirtschaftssenators Harald Wolf und des Bürgermeisters Klaus Wowereit - „Es kann nicht sein, dass durch die Übernahme Mitarbeitern die Zukunft genommen wird“ - konnten den Pharmariesen von seinem Tun abbringen. In Wuppertal stehen 160 Jobs zur Disposition, in Jena 140. Die restlichen Arbeitsplätze baut der Konzern im übrigen Europa (1.650), in den USA (1.000), in Lateinamerika und Kanada (1.200) und Asien (750) ab.
Unfreundliche SCHERING-Übernahme
In der Übernahme-Schlacht um SCHERING trat BAYER als „weißer Ritter“ auf, der den Berliner Pharma-Multi im letzten Moment aus den Klauen des „bösen“ MERCK-Konzerns befreit. Auch nach dem Kauf demonstrierten BAYER-Boss Werner Wenning und SCHERING-Chef Hubertus Ehlen stets Einvernehmlichkeit, und die Leverkusener Edelmänner ließen dem Traditionsunternehmen sogar den Namen. Das war aber auch alles. Bei weniger weichen Themen gab sich BAYER unerbittlich. Im fünfköpfigen Verstand des neu gegründeten Pharma-Riesen fanden sich zunächst nur zwei ehemalige SCHERING-Manager wieder. Und im Januar 2007 war es dann nur noch einer. Der für Forschung und Entwicklung zuständige Marc Rubin musste gehen. „Es ist eine mit aller Härte durchgesetzte Übernahme. Das bekommen jetzt die Mitarbeiter zu spüren“, kommentierte Malte Diesselhorst von der „Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz“ den Vorgang.
BAYER verkauft WOLFF WALSRODE
Die 17 Milliarden Euro teure SCHERING-Übernahme fordert einen weiteren Tribut. Nachdem BAYER im November 2007 HC STARCK verkauft hatte, stieß der Konzern im Monat darauf WOLFF WALSRODE ab. DOW CHEMICAL erwarb die Tochtergesellschaft. Den Preis schätzen MarktbeobachterInnen auf 400 bis 500 Millionen Euro. Bei den Beschäftigen beginnt nun das Zittern um ihre Arbeitsplätze.
LANXESS verkauft Textilchemikalien
Der arbeitsplatzvernichtende Spaltungsprozess von BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS geht munter weiter. Nachdem der Konzern im Mai 2006 das Geschäft mit dem Styrol-Kunststoff SAN an BASF veräußerte, verkaufte er im Januar 2007 die Textilchemikalien-Sparte. Den nordamerikanischen Geschäftsteil erwarb STARCHEM, der Rest ging an den niederländischen Finanzinvestor EGERIA im Verbund mit den ehemaligen ManagerInnen des Unternehmensteiles.
LANXESS: Aus für Langenfeld
BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS macht den Standort Langenfeld dicht. Das Unternehmen will alle Vertriebsaktivitäten künftig vom Stammsitz Leverkusen aus steuern. 121 Langenfelder wechseln dorthin, 30 gehen nach Dormagen oder Krefeld. Dem Rest bleibt nur die Arbeitslosigkeit. „Für die verbleibenden Mitarbeiter aus der Verwaltung, deren Arbeitsplätze dann entfallen, werden gegenwärtig in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat Lösungen gesucht“, umschreibt es die LANXESS-Presseinformation.
Schmoldt: „Lebenslüge Vollbeschäftigung“
Der BAYER-Aufsichtsrat und Vorsitzende der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE), Hubertus Schmoldt, hat die Ansicht, ein konjunktureller Aufschwung könne die Arbeitslosigkeit signifikant abbauen, als „Lebenslüge“ bezeichnet. Schmoldt empfahl dagegen, zur Schaffung von Arbeitsplätzen einen staatlich alimentierten Billiglohnsektor einzurichten. Das schmale Salär, das BAYER & Co. dann nur noch zu zahlen haben, soll die Bundesagentur für Arbeit dann um 20 Prozent aufstocken. Der Gewerkschaftsvorsitzende findet auch nichts dabei, wenn Beschäftige zwei Jobs annehmen müssen, um sich durchzuschlagen, da sei er sich des Dissenses mit seinen DGB-Kollegen durchaus bewusst, so der IG BCEler zur Faz.
Mitbestimmungskommission gescheitert
Der neoliberal entfesselte Kapitalismus setzt auch das bundesdeutsche Modell der Mitbestimmung unter Druck. Auf Vorschlag des BAYER-Aufsichtsrats und Vorsitzenden der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE), Hubertus Schmoldt, hatte der damalige Bundeskanzler Schröder deshalb eine Kommission ins Leben gerufen, die Empfehlungen zur Mitbestimmung „in Zeiten der Globalisierung“ vorlegen sollte. Dem unter der Leitung von Kurt Biedenkopf stehenden Gremium gehörten Gewerkschaftler, Unternehmer und Wissenschaftler an, die unterschiedliche Zielrichtungen verfolgten. BDI-Präsident Jürgen Thumann und seine Kollegen sahen die Runde als ein willkommenes Instrument an, die Mitbestimmung zu demonierten, was auf den Widerstand von DGB-Chef Michael Sommer stieß. Deshalb konnte Biedenkopf der Presse im Dezember 2006 keinen gemeinsamen Abschlussbericht präsentieren. Schmoldt, welcher der Kommission nicht angehörte, gab aber nicht auf und schlug Mindeststandards zur Mitbestimmungsreform wie einen 12-köpfigen, auch mit Arbeitnehmervertretern von ausländischen Niederlassungen besetzten Aufsichtsrat vor.
Keine Altersgrenze für ManagerInnen
Durch Regelungen zur Altersteilzeit und andere Instrumente hat der Leverkusener Multi ältere Beschäftigte konsequent aus dem Erwerbsleben gedrängt. Nur sich selbst hat der Vorstand vor dem Jugendwahn verschont, so dass die Konzern-Spitze auch die Spitze der BAYER-Alterspyramide bildet. Und dies soll nach Ansicht von BAYER-Chef Werner Wenning auch so bleiben. Da der 59-Jährige eigentlich mit dem 63. Lebensjahr ausscheiden müsste, betrieb er schon mal Arbeitsplatzsicherung in eigener Sache und brach eine Lanze für rüstige Senioren von seinem Schlage. „Ich halte nichts von starren Altersgrenzen“, vertraute er der Bild am Sonntag an, für den Vorstandsvorsitzenden ist das Karriere-Ende „keine Frage von jung oder alt, sondern eine Frage der Leistungsfähigkeit“.
BKK erhöht ihre Beiträge
Die bitter teuren Pillen des Leverkusener Multis bereiten auch der eigenen Betriebskrankenkasse BAYER BKK Kopfschmerzen. Um die ständig steigenden Ausgaben für Medikamente finanzieren zu können, musste diese ihren Betragssatz auf 13,5 Prozent anheben.
BKK fusioniert mit FORTISNOVA
Die hausgemachten Finanzprobleme (s. o.) haben BAYERs Betriebskrankenkasse zu einer Fusion mit der BKK FORTISNOVA bewogen. Der Zusammenschluss zur BKK NOVA - nunmehr eine der 10 größten Betriebskrankenkassen der Bundesrepublik - soll „Verwaltungskosten“, also Arbeitsplätze sparen. Betriebsbedingte Kündigungen schloss der Leverkusener Multi einstweilen allerdings aus.
Arbeitsplatzvernichter Nr. 3
Auf der Hitliste der Top-Arbeitsplatzvernichter des Jahres 2006 belegt BAYER mit dem Abbau von 6.000 Jobs Platz 3. Nur VOLKSWAGEN und ALLIANZ strichen mehr Stellen.
Mehr Profit, weniger Beschäftigte
1980 sorgten in der Chemiebranche 560.000 Beschäftigte für einen Umsatz von 70 Milliarden Euro. Im Jahr 2006 waren es nur noch ca. 430.000, während die Einnahmen auf 160 Milliarden stiegen. Da haben BAYER & Co. dank der gestiegenen Arbeitsproduktivität ihrer MitarbeiterInnen über die Jahre einen ganz schönen Schnitt gemacht.
Das Ende des Konsenses?
Rolf Nietzard, der inzwischen pensionierte ehemalige Betriebsratsvorsitzende von BAYER, sieht schwerere Zeiten auf den Leverkusener Multi zukommen. Vor seinem geistigen Auge erscheinen schon Kundgebungen mit mehreren tausend TeilnehmerInnen vor den Leverkusener Werkstoren. „Wenn die Leute Angst um ihren Arbeitsplatz haben, gibt es auch in der Chemie keinen Konsens“, so Nietzard in der Zeit.
Sparen, sparen, sparen
Die Übernahme von SCHERING durch BAYER führt nicht zu einer blühenden Forschungslandschaft mit den entsprechenden Erträgen. Im Gegenteil: Kahlschlag ist angesagt. „Sparen, sparen, sparen, heißt die Devise. Als Pharma-ManagerInnen beim „Integrationsteam“ nachfragten, ob auch eine Expansion und damit verbunden eine Erhöhung der Erlöse zu den künftigen Geschäftszielen von BAYER SCHERING PHARMA gehöre, beschieden die FusionistInnen ihnen kurz und knapp: „Sie werden daran gemessen, wie Sie Ihr Ziel, die Kosten zu senken, erreichen“. Als erste Maßnahme kündigte BAYERs neuer Pharma-Chef Arthur Higgins eine Großinventur aller in der Pipeline befindlichen Projekte mit dem Ziel einer Ausmusterung wenig aussichtsreicher Kandidaten an. Higgins will lieber externes Know-how zukaufen und weiterverarbeiten. Das dürfte in den Labors von BAYER SCHERING PHARMA so einige Jobs kosten.
POLITIK & EINFLUSS
Wenning & Co. schreiben Merkel
Vor einigen Jahren hat die EU den Emissionshandel mit Kohlendioxid-Verschmutzungsrechten eingeführt. Er sieht vor, BAYER & Co. CO2-Emissionen nur in einer bestimmten Menge zu gestatten. Alles, was über ein bestimmtes Limit hinausgeht, sollte den Konzernen teuer zu stehen kommen, weil sie dafür Verschmutzungsrechte kaufen müssten. Damit wollte Brüssel Anreize zu Klimaschutz-Maßnahmen schaffen. Diese blieben allerdings weitgehend aus: Die Lizenzen zum CO2-Ausstoß waren so großzügig bemessen und überdies kostenlos, dass die Schornsteine der Industrie weiterhin nach Lust und Laune qualmen konnten. „Noch nie war es so billig, die Umwelt zu belasten“, urteilt etwa die Faz. Und die Bundesregierung tat nichts, um für eine Preiserhöhung zu sorgen. Der neue Nationale Allokationsplan bezog zwar erstmals auch Chemie-Anlagen in den Emissionshandel ein, beantragte bei der Europäischen Union jedoch Verschmutzungsrechte in Höhe von 465 Millionen Tonnen. Der EU-Umweltkommissar Stavros Dimas lehnte das jedoch ab und drückte die Zahl auf 453 Millionen Tonnen. Da sahen BAYER & Co. mal wieder den Untergang des Abendlandes heranziehen. BAYER-Chef Werner Wenning und die Bosse anderer Unternehmen schrieben einen Brandbrief an Angela Merkel. „Damit drohen Konsequenzen nicht nur für die Versorgungssicherheit, sondern auch für Arbeit und Wertschöpfung am Standort Deutschland“, schrieben sie und forderten eine politische Intervention. Diese Dreistigkeit erboste sogar konservative Politiker. „Der BDI muss sich entscheiden, ob er sich ernsthaft für den Klimaschutz engagieren oder an der Realisierung der Klimakatastrophe arbeiten will“, meinte etwa der CDU-Politiker Günter Krings. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN nahm das Vorgehen der Manager zum Anlass, ebenfalls ein Schreiben an Angela Merkel aufzusetzen (siehe AKTION & KRITIK).
EU-Parlament verabschiedet REACH
Am 13.12.06 hat das EU-Parlament das Chemikaliengesetz REACH verabschiedet. Nur die Fraktionen der Linken und der Grünen stimmten dagegen. „Die Verordnung trägt klar die Handschrift der deutschen Chemiebranche“, sagte die Grünen-Abgeordnete Hiltrud Breyer zur Begründung der Ablehnung. BAYER & Co. müssen dank ihrer erfolgreichen Lobby-Arbeit jetzt nur noch 30.000 Chemikalien auf ihre gesundheitsschädliche Wirkung hin untersuchen. Für chemische Altlasten reicht es überdies, einen einfachen Grunddatensatz vorzulegen. Elf Jahre haben die Konzerne dafür Zeit. Auch besteht für sie nicht mehr - wie ursprünglich geplant - die Pflicht, gefährliche Stoffe vom Markt zu nehmen. Krebserregende Substanzen etwa, für die es keinen Ersatz gibt, darf die Industrie weiter vermarkten, wenn die Produktion in geschlossenen Kreisläufen verläuft oder die „Chemie im Alltag“ einen bestimmten Grenzwert nicht überschreitet. Gibt es eine Alternative, so können die Unternehmen erst einmal auf Zeit spielen und einen „Substitutionsplan“ erstellen.
Winnacker will mehr Stammzellen
In den letzten Monaten seiner Amtszeit als Vorsitzender der „Deutschen Forschungsgemeinschaft“ trat der BAYER-Aufsichtsrat Ernst-Ludwig Winnacker noch einmal vehement für für eine Änderung des Stammzell-Gesetzes von 2002 ein. Es erlaubt Forschungen mit Stammzellen aus zuvor getöteten Embryos, allerdings nur mit bis zum Jahr 2002 gewonnenen, da der Gesetzgeber BAYER & Co. nicht die Lizenz zum Töten geben wollte. Eben diese möchte Winnacker jetzt haben. Er forderte, die Stichtagsregelung ganz aufzuheben, und die FDP machte sich seinen Vorschlag zu Eigen. Der Bundestag lehnte einen entsprechenden Antrag der Partei am 1. Februar 2007 jedoch ab.
Neues Gentechnikgesetz
Das Bundeskabinett einigte sich Ende Februar 2007 auf Eckpunkte zum geplanten Gentechnik-Gesetz. Die Gentechnik biete „interessante Perspektiven“ für die Ernährung, Energie- und Rohstoffversorgung, heißt es dort forsch. Von Risiken und Nebenwirkungen ist dagegen nicht viel die Rede. Im Falle eines Falles will der Staat die Haftung übernehmen, etwa wenn den WissenschaftlerInnen von BAYER & Co. mal etwas daneben (auf die Felder mit konventionell oder ökologisch angebauten Ackerfrüchte) geht. Für GAUs im kommerziellen Anbau soll künftig ein Fonds der Biotech-Branche aufkommen. Zur Sicherung der friedlichen Koexistenz zwischen gentechnischer und traditioneller bzw. ökologischer Landwirtschaft sieht der Entwurf eine Abstandsregelung vor, die mit 150 Meter allerdings knapper als in vielen europäischen Ländern bemessen ist und auch kaum das probate Mittel gegen Auskreuzungen darstellt. Die Blütenpollen überallhin tragenden Bienen beispielsweise pflegen sich nicht an solche Regularien zu halten, weshalb Seehofer & Co. auch nicht die Absicht haben, ImkerInnen für etwaige Gen-Kontaminationen haftbar zu machen. Die Gentech-Lobby hat also wieder einmal ganze Arbeit geleistet.
BAYER & Co. kooperieren mit dem BKA
„Weltkrieg um Wohlstand“ und „Der neue kalte Krieg. Kampf um die Rohstoffe“ - so lauten die Titel zweier populärer Wirtschaftsbücher. Der martialische Tonfall zeugt von einer zunehmenden Aggressivität bei der Jagd nach Profiten. Im Zuge dieser Aufrüstung bauen BAYER & Co. zunehmend auf eine Kooperation mit den Geheimdiensten. Vereinbarten die Konzerne bereits im April 2006 einen verstärkten Informationsaustausch mit dem Bundeskriminalamt (Ticker 2/06), so kam es nach Informationen von www.german-foreign-policy.com nun zur Einrichtung einer „Zentralen Koordinierungsstelle zur Weitergabe von Sicherheitsinformationen zwischen Staat und Wirtschaft“. Das „Bereitstellen von Risikoanalysen durch staatliche Ressorts und Nachrichtendienste bei der Erschließung neuer Märkte sowie Produktions- und Entwicklungsstandorte“ sowie Unterstützung bei der Eindämmung der Produktpiraterie erwartet sich der „Bundesverband der Deutschen Industrie“ hauptsächlich von den Schlapphüten.
BAYER & Co. lassen spionieren
Der so genannte Krieg gegen den Terror lässt dem CIA und anderen Geheimdiensten noch genug Zeit, mit ihrer Schnüffelei auch etwas für den heimischen Standort zu tun und Wirtschaftsspionage zu betreiben. Die hiesigen Dienste zieren sich dabei noch ein wenig, obwohl Besserung naht (s. o.). Nach Aussage des Geheimdienst-Experten Udo Ulfkotte fragen BAYER & Co. solche Geheimdienstleistungen deshalb mit Vorliebe bei russischen SpionInnen oder speziellen Consulting-Agenturen nach.
Weichmacher-Entlastungsstudie erschienen
Weichmacher wie das von BAYER hergestellte Bisphenol A können wegen ihrer hormon-ähnlichen Wirkung die Hirnentwicklung stören sowie Krebs, Unfruchtbarkeit oder Erbgutschädigungen verursachen. Darum fordert die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN gemeinsam mit anderen Verbänden seit Jahren ein Verbot dieser Stoffe. Jetzt kommt der Brüsseler Think-Tank „Centre for the New Europe“, nach eigener Aussage „Europas führender freier Markt-Think-Tank in Brüssel“, den bedrängten Chemie-Multis zur Hilfe. Sein Umweltforumsleiter Edgar Gärtner veröffentlichte das Entwarnungsbuch „Vorsorge oder Willkür? - Kunststoff-Weichmacher im politischen Kreuzfeuer“. Seit Urzeiten haben sich die Weichmacher Gärtner zufolge als „Chemie im Alltag“ bewährt: „Selbst für die beeindruckenden Höhlenmalereien (...) brauchten die Steinzeitmenschen Weichmacher“. Ob der Autor mit solchen wissenschaftlich zweifelhaften Ausgrabungen allerdings sein Ziel erreicht, bleibt dahingestellt - selbst der unternehmerfreudlichen Faz war seine Argumentation zu primitiv.
Merkel bei BAYER
BAYER, SIEMENS, BERTELSMANN und die anderen „Partner für Innovation“ haben unter anderem die berühmt-berüchtigte „Wir sind Deutschland“-Kampagne verbrochen, die dann in das - angeblich so ganz spontane - weltmeisterliche Fahnenmeer mündete. Am 26. Oktober 2006 zog die Initiative am Berliner Sitz von BAYER SCHERING PHARMA Bilanz und konnte aus diesem unfeierlichen Anlass hohen Besuch begrüßen. Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel zählten auch Wirtschaftsminister Michael Glos und Kanzleramtsminister Dr. Thomas de Maizière zu den Gästen. In ihrer Rede dankte Angela Merkel BAYER & Co. für die Überdosis „Patriotismus“, „die aus meiner Sicht weit über den engen Innovationsbereich hinaus ein Stück Stolz und Selbstbewusstsein geformt hat, was ja die Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt vorankommt.“ Von den Antichambrierkünsten des BAYER-Aufsichtsrats Hubertus Erlen bei den Treffen mit den „Partnern für Innovation“ zeigte sich die Kanzlerin besonders angetan. „Deshalb, Herr Erlen wäre es fahrlässig von Ihnen gewesen, wenn Sie nicht etwas zu dem gesagt hätten, was aus Ihrer Sicht im Zusammenhang mit der pharmazeutischen Industrie noch verbesserungsnotwendig ist. Wir werden das in unseren Herzen bewegen und es noch einmal in den Anhörungen behandeln“, sprach die Kanzlerin, die sich mit einem „Wir bleiben in Kontakt“ von den Konzernchefs verabschiedete.
Wenning kritisiert Gesundheitspolitik
Trotz prächtiger Pillen-Profite kritisiert BAYER-Chef Werner Wenning die bundesdeutsche Gesundheitspolitik. „Auch unsere zentralen Kritikpunkte sind die geplante Einführung von Höchstbeträgen für Arzneimittel, die vorgesehene Methodik zu einer Kosten-Nutzen-Bewertung und die fehlenden Elemente zu mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen“, sagte er in einem Faz-Interview. Die nach oben hin offene Preisgestaltung der Pharma-Multis zu deckeln, hält Wenning für kommunistisch und mit dem für die Bundesregierung Kosten/Nutzen-Analysen von Medikamenten vornehmenden „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ hadert BAYER von Beginn an, weil der Konzern bei den Expertisen gern ein Wörtchen mitreden würde. Aber der Vorstandsvorsitzende sieht auch einen Silberstreif am Horizont, der noch schneller in die heiß ersehnte 2-Klassen-Medizin führen könnte. Werner Wenning wünscht sich grünes Licht für die Krankenkassen, um unterschiedliche Leistungsangebote zu unterschiedlichen Tarifen anzubieten und gibt sich hoffnungsfroh: „Erfreulicherweise gibt es dafür erste Hinweise im jetzt vorliegenden Entwurf zur Gesundheitsreform“, meint der Große Vorsitzende.
Höfs bei Konferenz der Holocaust-Leugner
Der bekennende - und bereits vorbestrafte - Neonazi Dr. Hans-Ulrich Höfs, der im Leverkusener BAYER-Werk als Abteilungsleiter arbeitet (Ticker berichtete mehrfach), nahm an der Konferenz der Holocaust-Leugner in Teheran teil. Höfs war Bundesvorsitzender des „Gesamtdeutschen Studentenverbandes“ und gründete 1989 in Krefeld die „Republikaner“. Seitdem er seine Mitwirkung dort einstellte, treibt er sein Unwesen im „Krefelder Gesprächskreis - Deutsche Politik“ und im „Krefelder Forum Freies Deutschland“, das neuerdings auch zum Trägerkreis der rechtsextremen Denkfabrik „Deutsche Akademie“ gehört. Selbst von einer 1996 wegen „Volksverhetzung“ erfolgten Verurteilung ließ sich Höfs nicht von seinem Tun abhalten. Und der Leverkusener Multi schert sich nicht darum, was sein Angestellter in seiner Freizeit tut. Eine Ermahnung erfolgte lediglich, als Höfs sich auch innerhalb des Betriebes rechtsextremistisch betätigen wollte. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hat sich in der Vergangenheit bereits mehrmals an Aktionen gegen den Neonazi in BAYER-Diensten beteiligt.
Israelischer Umweltminister in Leverkusen
Im Herbst 2006 besuchte der israelische Umweltminister Gideon Ezra die Leverkusener BAYER-Werke und informierte sich im Klärwerk Bürrig über die Entsorgungstechnik. Dass der Konzern allein an seinem Stammsitz im „Dritten Reich“ über 9.000 ZwangsarbeiterInnen zu Frondiensten zwang, hielt den Politiker offenbar nicht von seiner Reise ab.
Ökosteuer adé
Für BAYER und andere Energie-Großverbraucher hält die Ökosteuer großzügige Ausnahmeregelungen parat (Ticker 3/06). Nach dem jüngsten Subventionsbericht der Bundesregierung beträgt ihr Geldwert jährlich 5,4 Milliarden Euro. Aber der Großen Koalition reicht das noch nicht. Sie will bei der Ökosteuer so lange nachbessern, bis nichts mehr von ihr übrig bleibt. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Reinhard Schulz spricht das ganz offen aus. „Deswegen werden wir die Höhe der Energiesteuern für das Produzierende Gewerbe wieder auf den Stand von 1998 - also vor Einführung der Ökosteuer - zurückführen“, so der Politiker. Als Mittel dazu dient das „Biokraftstoff-Quotengesetz“, das BAYER & Co. nicht nur Abschläge auf die Ökosteuertarife, sondern auch auf andere Energiesteuern einräumt.
Steuernachlass für BAYER HEALTH CARE
Die in der Nähe New Yorks gelegene Niederlassung von BAYER HEALTH CARE erhielt von den staatlichen Stellen 375.000 Dollar Steuern erlassen.
USA: Kampf um mehr Gewerkschaftsrechte
Gewerkschaften haben in den USA nicht viele Rechte, weshalb die Wirkmächtigkeit und in der Folge auch der Organisationsgrad nicht groß sind. Für BAYER ein nicht zu unterschätzender Standortfaktor: Nur in wenigen seiner US-Niederlassungen muss der Konzern sich mit Gewerkschaften herumschlagen. Und wenn es an Werksschließungen geht, sucht sich der Leverkusener Multi mit Vorliebe solche mit ArbeiternehmerInnen-Vertretungen aus, wie zuletzt in Elkhart geschehen (Ticker 2/02). Anfang des Jahres brachten die Demokraten nun einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Gewerkschaftsrechte in den Kongress ein. Unter anderem will das Paragraphen-Werk die Strafe für Unternehmen erhöhen, die ihren Beschäftigten das Organisationsrecht streitig machen. Der „Employee Free Choice Act“ erhielt auch die erforderliche Stimmenmehrheit, aber George W. Bush kündigte bereits ein Veto ein. Er weiß halt, was er seinen Konzernen schuldig ist. Allein BAYER unterstützte seinen Wahlkampf mit 120.000 Dollar.
BAYER-Vorsitz für kanadischen VFA
Der vom Leverkusener Multi gegründete „Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller hat auch einen kanadischen Ableger. Da war es Ehrensache, dass BAYERs Kanada-Chef Philip Blake im Jahr 2006 den Vorsitz von „Canadas Research-Based Pharmaceutical Companies“ übernahm.
PROPAGANDA & MEDIEN
CO2: BAYER lügt weiter
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hatte BAYER beim Klimaschwindel ertappt und die vom Konzern stets mit stolzgeschwellter Brust vorgetragene Zahl von 60 Prozent weniger Kohlendioxid auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Wie die CBG nachwies, hatte der Multi die Reduzierung größtenteils nicht durch Investionen in den Umweltschutz erreicht, sondern durch Betriebsschließungen, Verkäufe von Unternehmensteilen und ein Outsourcing der Energie-Produktion. Aber BAYER ficht das nicht an. Der Global Player bezeichnet sich selber weiterhin unverdrossen als Klimaschützer. Jetzt sogar um 70 Prozent will er seinen C02-Ausstoß in den letzten 15 Jahren gesenkt haben. Und manche fallen nach wie vor auf die Klimalüge rein. Die Investorengruppe des „Carbon Disclosure Project“ zeichnete das Unternehmen auch im Jahr 2006 wieder als eines der weltweit führenden in Sachen „Klimaschutz“ aus.
BAYER sponsort BodybuilderInnen
Der Leverkusener Multi tritt als Sponsor des „Bodybuilding Szene Shops“ auf. Produkte des Konzerns erfreuen sich nämlich auch bei den Muskelmännern und -frauen äußerster Beliebtheit. Viele BodybuilderInnen machen eine spezielle Diät, in der sie auf Kohlehydrate verzichten, um den Körper zur Fettverbrennung anzuregen. Der Organismus wandelt das Fett dann in so genannte Ketone um und scheidet es aus. Und um zu prüfen, ob die nicht eben risikolose Operation gelungen ist, greifen die Bizeps-FetischistInnen zu den BAYER KETOSTIX-Teststreifen, die der „Bodybuilding Szene Shop“ natürlich auch im Angebot hat.
BAYER lädt JournalistInnen ein
Im Rahmen der „BAYER Innovationsperspektive 2006“ bot der Leverkusener Multi auch vier workshops für JournalistInnen an. Dort diktierte der Konzern den SchreiberInnen sein segenreiches Wirken auf den Gebieten „Gefäßkrankheiten“, „neue Kunststoffe“, „Agrochemikalien“ und „rationellere Wirkstofftests“ in die Feder.
BAYER sponsort JournalistInnen-Preis
Die irische BAYER-Niederlassung hat 2006 erstmals den seit 18 Jahren von der Tageszeitung Daily Telegraph für populärwissenschaftliche Zeitungsbeiträge gestifteten Preis gesponsort und sorgte so dafür, dass die Auszeichnung nicht in konzern-kritische Hände gerät. Den „Daily Telegraph and BAYER Science Writer Award 2006“ gewannen Leili Farzenah und Philip Broadwith. Farzenah erhielt die Auszeichnung für einen Artikel über Bakterien, die Ackerfrüchte wie etwa die von BAYER umfunktionierten Tabakpflanzen (siehe GENE & KLONE) zu Wirkstofffabrikanten machen. Broadwith prämierten die JurorInnen für ein Werk über die „Metathese“ genannte chemische Reaktion, die es den Chemie-Multis erlaubt, Naturstoffe im Reagenzglas nachzubauen.
USA: Pharmawerbung für 300 Mio. $
BAYERs Pillen-PR geht mächtig ins Geld. 300 Millionen Dollar gab allein die US-Division von BAYER HEALTH CARE in den ersten neun Monaten des Jahres für Anzeigen-Kampagnen aus, die Schmerzmittel wie ASPIRIN und ALEVE, das PatientInnen einem erhöhten Herzinfarktrisiko aussetzt (s. u.), sowie Vitaminpillen anpriesen.
Teure ÄrztInnen-Werbung
Um ihre Pillen an den Medizin-Mann und die Medizin-Frau zu bringen, geben BAYER & Co. jährlich 35.000 Euro pro Nase aus. Auf diese Summe beläuft sich der Etat für Pharma-VertreterInnen, Broschüren, Kongresse und „sonstige Zuwendungen“ laut einer Studie der Wissenschaftlerin Kirsten Schubert vom „Zentrum für Sozialpolitik“ der Universität Bremen.
TIERE & ARZNEIEN
Forum für Veterinärkrankheit gegründet
Manche tierische Gesundheitsstörung ist einfach zu unbekannt, um BAYER den massenhaften Absatz von Produkten zu ermöglichen. Leishmaniose zum Beispiel, die zu den so genannten Vektorkrankheiten zählt, weil Insekten den Erreger übertragen, kennt kein Schwein. Der Leverkusener Multi hat sich deshalb entschlossen, ein wenig PR für Vektorkrankheiten zu machen und hat das „Canine Vector-Borne-Deseases World Forum“ gegründet, das ihm das passende Werbeumfeld für sein angeblich vor Leishmaniose schützendes Antiparasitikum ADVANTIX bietet.
DRUGS & PILLS
Aus für Blutgerinnsel-Arznei
„Erfolg versprechendes Thrombose-Medikament in der Pipeline“, verkündete der BAYER-Geschäftsbericht 2005. Das Konzern-Magazin Research pries es schon einmal unter der Überschrift „Gentechnik gegen Blutgerinnsel“ an. Eine Anzeigen-Kampagne schließlich komplettierte die konzertierte Aktion: Sie stellte schon einmal ungedeckte Schecks auf die Zukunft aus und weckte Hoffnungen auf einen Einsatz als Mittel zur Schlaganfall-Prävention. In der dritten und letzten Testphase kam aber die Ernüchterung über die Arznei, der die US-Gesundheitsbehörde FDA wegen erfolgversprechender Zwischenergebnisse sogar ein beschleunigtes Zulassungsverfahren zugebilligt hatte. Das gentechnisch aus einem Schlangengift-Enzym hergestellte Präparat konnte PatientInnen mit verstopften Arterien im Bein weder einen gefäßchirurgischen Eingriff ersparen noch Blutgerinnsel auflösen. Jetzt fällt beim Leverkusener Multi wieder einmal viel Altpapier an.
Herzinfarktgefahr durch ALEVE
Schmerzmittel wie BAYERs ALEVE können Herz und Kreislauf schädigen. Nach einer im Herbst 2004 vom US-amerikanischen „National Institute of Aging“ veröffentlichten Studie steigerte BAYERs Schmerzmittel ALEVE mit dem Wirkstoff Naproxen für die ProbandInnen das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, um 50 Prozent (SWB 1/05). Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA zeigte sich alarmiert, überprüfte die Medikamentengruppe und gab im Jahr 2005 schließlich Entwarnung. Das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ zwang BAYER immerhin, im Kleingedruckten der Beipackzettel auf die „Nebenwirkung Herzinfarkt“ hinzuweisen. Jetzt lieferte eine weitere Untersuchung neues Belastungsmaterial. WissenschaftlerInnen der „John Hopkins University School of Public Health“ testeten ALEVE und das Schmerzmittel CELEBREX auf ihre Verträglichkeit. Während das Herzinfarkt-Risiko der Placebo-Gruppe bei 5,6 Prozent und das der CELEBREX-PatientInnen bei 5,5 lag, betrug es bei den ALEVE-ProbantInnen 8,25 Prozent.
ASPIRIN kein Tausendsassa
BAYER bewirbt ASPIRIN gerne als „Tausendsassa“. Die „Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände“ sieht in dem Präparat allerdings kein Allheilmittel. Sie riet von einer Anwendung als Einschlafhilfe und als einem Mittel gegen den Kater ab und warnte wegen der zahlreichen Nebenwirkungen vor einer allzu häufigen Einnahme.
Längerer Beipackzettel für ASPIRIN & Co.
Die BAYER-Schmerzmittel ASPIRIN und ALEVE sowie andere Präparate dieser Medikamentengruppe haben große Nebenwirkungen. Allein in den USA sterben daran jährlich 16.000 Menschen. Die Zahl der Krankenhaus-Einlieferungen beläuft sich auf 200.000 Fälle. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die Hersteller deshalb gezwungen, auf den Beipackzetteln der Arzneien künftig Risiken und Nebenwirkungen wie Magenbluten aufzuführen, wie in der Bundesrepublik schon länger üblich. Die Institution plant zudem, BAYER & Co. auch zu Warnungen vor Herz/Kreislauf-Erkrankungen zu verpflichten.
YAZ: Die Pille gegen Akne
Die US-Behörden haben BAYERs Verhütungsmittel YAZ auch als Mittel zur Behandlung von Akne zugelassen.
NEXAVAR bei Leberkrebs?
BAYERs zur Behandlung von Nierenkrebs im fortgeschrittenen Stadium zugelassenes Gentech-Präparat NEXAVAR musste unlängst einige Rückschläge verkraften. Der Leverkusener Multi brach klinische Erprobungen zur Therapie von Haut- und Bauchspeicheldrüsenkrebs wegen Erfolgslosigkeit ab (Ticker 4/06). Trotzdem versucht er unverdrossen, das Verschreibungsspektrum der Arznei mit einem Jahresumsatz von 127 Millionen Euro, die auf ihrem angestammten Anwendungsgebiet „Nierenkrebs“ nur als Mittel zweiter Wahl gegenüber dem PFIZER-Präparat SUTENT gilt, zu vergrößern. Der Pharmariese strebt jetzt eine Zulassung für die Indikation „fortgeschrittener Leberkrebs“ an.
Kein PTK bei Darmkrebs?
„Eine unserer vielversprechensten Entwicklungen ist PTK/ZK. Dies ist ein so genannter Angiogenese-Hemmer, den wir gemeinsam mit der Firma NOVARTIS zur Behandlung von metastasiertem Dickdarmkrebs entwickeln“, hieß es im Jahr 2004 auf der SCHERING-Hauptversammlung. Wie so oft in der Genmedizin, kam die Ernüchterung schon wenig später. „Wahrscheinlich lässt sich der primäre Endpunkt der Studie, ein Überlebensvorteil mit der Substanz, nicht erreichen“, musste der seit kurzem zu BAYER gehörende Pharma-Konzern 2005 verkünden. Aber aufgeben wollte er nicht. Mit einem bescheideneren Ziel - der Verhinderung einer Verschlimmerung der Krankheit - strebten die WissenschaftlerInnen nunmehr eine Zulassung an. Aber das erscheint dem Partner NOVARTIS jetzt nicht mehr aussichtsreich genug. „Aus meiner Sicht ist PTK halbtot“, urteilt der Vorstandsvorsitzende Daniel Vasella.
FDA in der Diskussion
Bei einer Nachprüfung des dringend einer Erhöhung des Herzinfarkt-Risikos verdächtigen BAYER-Mittels TRASYLOL täuschte der Leverkusener Multi die US-Gesundheitsbehörde FDA, indem er negative Studien-Ergebnisse unterschlug (SWB 4/06). Seither ist in den USA eine Diskussion um die Kompetenz der Behörde entbrannt, die Bevölkerung vor Risiken und Nebenwirkungen von Arzneien zu schützen. Deshalb forderte der Harvard-Professor Jerome Avorn in einem Artikel, den das Fachblatt New England Journal of Medicine veröffentlichte, mehr unabhängige Arznei-Untersuchungen. Die FDA will ihrerseits BAYER & Co. stärker zur Kasse bitten, um Pharma-GAUs besser verhindern zu können.
PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE
GAUCHO gegen Pflanzenstress
90 Milliarden Bienen raffte das BAYER-Pestizid GAUCHO mit dem Wirkstoff Imidacloprid innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren in Frankreich dahin, weshalb das Land im Jahr 2004 die Ausbringung auf Sonnenblumen- und Maisfeldern untersagte. Trotzdem sucht der Leverkusener Multi unbeirrt nach weiteren Anwendungsmöglichkeiten für den auch unter dem Namen CONFIDOR vermarkteten Wirkstoff und preist ihn neuerdings auch als „Wellnesskur für Pflanzen“, die unter Wassermangel oder zu großer Hitze leiden, an.
GAUCHO-Verbot nützt
Der französische Staat untersagte im Jahr 2004 die Ausbringung des bienengefährlichen BAYER-Insektizides GAUCHO auf bestimmten Kulturen (s. o.) Jetzt hat der französische Imkerverband UNAP eine erste positive Bilanz des Verbotes gezogen. „Es gibt kein massives Bienensterben mehr“, so der UNAP-Präsident Henri Clément.
Indien: 15.000 Selbstmorde unter LandwirtInnen
In Indien haben sich schon 15.000 LandwirtInnen getötet, weil sie sich von ihrer Arbeit nicht mehr ernähren konnten. Teures Gen-Saatgut und teure Pestizide, die ihre Baumwolle dann doch nicht vor Schadinsekten schützen konnten, haben sie zu der Verzweiflungstat getrieben. „Die großen Multis wie MONSANTO, MYKO oder BAYER locken die Bauern mit Versprechungen: Nimm das, und die Pflanzen werden resistent, die Ernte wird reichlich. Aber das ist nicht wahr, sie betrügen die Bauern nur“, empört sich deshalb ein indischer Samenhändler in einem Bericht des TV-Magazins Weltspiegel.
Obst und Gemüse belastbarer
Das Verbraucherschutzministerium hat BAYER & Co. die Lizenz zur verstärkten Vergiftung von Obst und Gemüse erteilt, womit sich die Lobby-Arbeit der Agroriesen mal wieder ausgezahlt hat. Die staatlichen VerbraucherschützerInnen änderten das noch verträgliche Maß für 404 Pestizide. 293 Mal korrigierten sie nach oben und nur 111 Mal nach unten. Durchschnittlich hoben die MinistrantInnen die Grenzwerte um das 33fache an! Bei Produkten wie Salate oder Beeren darf das Limit das bisher Erlaubte auch schon einmal um das 500fache überschreiten. „Es ist unglaublich. Die Verbraucherschützer aus dem Ministerium machen konsequent das Gegenteil von dem, was notwendig wäre, um die Gesundheit der Verbraucher und die Umwelt zu schützen“, empörte sich der GREENPEACE-Chemieexperte Manfred Krautter.
Vergiftungsgefahr: Kindergarten schließt
Auf schlechterem Grund kann man einen Kindergarten kaum bauen: Im australischen Carlisle entstand eine Betreuungseinrichtung für Kinder auf dem Gelände einer ehemaligen Pestizid-Fabrik von BAYER. Sofort nach Bekanntwerden dieses Skandals schlossen die Behörden den Hort und nahmen Untersuchungen vor. Das Risiko giftiger Hinterlassenschaften ist auch deshalb hoch, weil der Leverkusener Multi das Areal nicht gerade besenrein hinterlassen hat und die Sanierungsarbeiten erst nach erheblichem Druck von seiten der Umweltbehörde beendet hat. Zudem veranlasste der Vorfall die staatliche Stellen dazu, eine Überprüfung aller Kindergarten-Grundstücke im westlichen Teil Australiens anzuordnen.
GENE & KLONE
Genreis auf den Philippinen?
Die Philippinen sind das gentech-freundlichste Land in Südostasien. 20 Laborfrüchte von BAYER & Co. ließ der Staat schon zu. Darum rechnet BAYER auch mit einer Einfuhrgenehmigung für seinen Genreis LL62. Diese Sorte fand sich jüngst ebenso wie sein Bruderprodukt LL 601 in ganz normalem Supermarkt-Reis wieder - wenn auch in weniger besorgniserregenden Mengen (siehe SWB 4/06) - und sorgte so mit für den jüngsten Gen-Skandal. Aber nicht nur deshalb formiert sich breiter Widerstand gegen die drohende Zulassung. So wandte sich der Erzbischof Gaudencio Cardinal Rosales in einem Offenen Brief an die Staatspräsidentin Arroyo, um sich gegen das Genfood auszusprechen. „Als kirchliche Einrichtung haben wir die Pflicht, die Interessen der Gotteskinder und ihre angestammten Rechte auf gesundes Essen und eine gesunde Umwelt zu schützen“, hieß es in dem Schreiben. Auch GREENPEACE engagierte sich. „Eine Zulassung von BAYERs Gentech-Reis hätte desaströse Folgen für unser wichtigstes Nahrungsmittel (...) Sie bedroht die Artenvielfalt und gefährdet die Umwelt und die menschliche Gesundheit“, warnte der Aktivist Daniel Ocampo.
Reis-Industrie gegen Genfood
Der Gen-GAU um BAYERs Laborfrucht LL 601, die sich in diversen Supermarkt-Packungen wiederfand (s. o.) hat UNCLE BEN & Co. schweren wirtschaftlichen Schaden zugefügt. Auf 150 Millionen Dollar belaufen sich die Verluste der Branche. Deshalb haben sich die großen Exporteure auch konsequent gegen die Zulassung von genmanipulierten Sorten der Getreideart ausgesprochen, wie GREENPEACE Anfang Februar 2007 bekannt gab.
BAYER forscht in Potsdam
Seitdem BAYER 2002 die Agrosparte von AVENTIS kaufte, gehört auch PLANTTEC, eine Ausgründung des „Max-Planck-Instituts für molekulare Pflanzenphysiologie“, zum Konzern. Am Standort Potsdam genmanipulieren die einstigen Max-PlanckerInnen nun für den Leverkusener Multi an Reis, Raps und Kartoffeln herum. Die Knollenfrucht wollen sie durch eine Erhöhung des Stärkegehaltes als Produkt für die Klebstoff- und Papierindustrie interessanter machen. Entsprechende Versuche des Konkurrenten BASF beurteilt die verbraucherInnenpolitische Sprecherin der Grünen, Ulrike Höfken, äußerst skeptisch, da die Genkartoffel-Saaten nicht nur teurer als die herkömmlichen sind, sondern auch ertragsärmer. Die EU-PolitikerInnen teilten die Bedenken und lehnte einen Zulassungsantrag ab, aber die gentech-freundliche Brüsseler Kommission hat das letzte Wort darüber noch nicht gesprochen.
Pflanzen als Pharmafabriken
BAYER treibt die gentechnologische Umrüstung von Pflanzen zu Pillen-Produzenten unaufhaltsam voran. Der Gen-Gigant ging jetzt eine Kooperation mit dem Freiburger Unternehmen GREENOVATION ein. Die Firma hat den Stoffwechsel von Blattmoos angeblich so verändert, dass das Kraut sich als Reaktor von Arznei-Wirkstoffen eignet. Sollte auch diese BAYER-Kreation sich wie der Genreis LL601 eines Tages mal bei ALDI im Regal wiederfinden, wären die Folgen weit fataler.
BAYER setzt auf „Smart Breeding“
Gentechnische Methoden finden zunehmend Eingang in die Produktion von herkömmlichem Saatgut. So ermöglicht die genaue Analyse des Erbgutes beispielsweise das Aufspüren von besonders widerstandsfähigen Sorten. Auf Basis dieses „Smart Breeding“ hat BAYER bereits spezielle Gemüse-, Raps- und Reisarten gezüchtet. Gentechnik-GegnerInnen wie der GREENPEACE-Aktivist Christoph Then begrüßen diese neue Methode als Alternative zur Risikotechnologie. Das sieht der Gengigant allerdings anders, weil das „Smart Breeding“ art-übergreifende Veränderungen ausschließt. „Deshalb kann nicht das ganze Potenzial der Pflanzenbiotechnologie ausgeschöpft werden“, dämpfte ein BAYER-Sprecher die Hoffnungen auf einen Gentech-Ausstieg.
WASSER, BODEN & LUFT
Aus für Kohlekraftwerk
Steinkohlekraftwerke stehen wieder hoch im Kurs, obwohl sie doppelt so viel Kohlendioxid ausstoßen wie Gaskraftwerke und auch die Energie-Effizienz zu wünschen übrig lässt. Ausschlaggebend für den Boom ist die Wirtschaftlichkeit. Während ein Gaskraftwerk im Jahr ca. 285 Millionen Euro abwirft, bringt es ein Steinkohlewerk auf 610 Millionen Euro. Darum wollte der Stromanbieter TRIANEL auf dem Gelände des BAYER-Chemieparks in Krefeld auch eine solche Dreckschleuder errichten, die jährlich 4,4 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Betreiben sollte es später BAYER INDUSTRIAL SERVICE. Aber gegen dieses Vorhaben formierte sich Widerstand. Ein Krefelder Arzt sammelte in wenigen Tagen 80 Unterschriften von MedizinerInnen, die sich wg. der zusätzlichen Feinstaub-Belastung und anderen Gesundheitsgefahren gegen das Projekt aussprachen. Der Lehrer Ulrich Grubert hat wegen der Pläne für das Kraftwerk und für eine Erweiterung der städtischen Müllverbrennungsanlage sogar einen Hungerstreik durchgeführt. „Das ist ein Großangriff auf Flora, Fauna, Mensch und Klima“, sagte er zur Begründung. Dieser Stimmung mochte sich der Krefelder Stadtrat nicht verschließen. Er lehnte den Bau des Klimakillers ab.
Klimakiller China
Die wie Pilze aus dem Boden schießenden Großanlagen von BAYER & Co. im Reich der Mitte haben einen enormen Energie-Bedarf. China deckt ihn hauptsächlich mit Kohlekraftwerken ohne Filteranlagen, welche mehr als doppelt so viel Kohlendioxid emittieren wie Gaskraftwerke. Das macht den Staat hinter den USA zum weltgrößten Klima-Killer mit Aussicht auf den Spitzenplatz. Das chinesische Energieforschungsinstitut errechnete für das Jahr 2009 einen Kohle-Verbrauch in Höhe von 2,5 Milliarden Tonnen und damit einhergehend einen CO2-Ausstoß von 5,8 Milliarden Tonnen.
Sparen am Umweltschutz
Die drastischen Rationalisierungsmaßnahmen BAYERs gehen auch zu Lasten des Umweltschutzes. So gehört zum Gerätepark des Multis zwar noch ein Meßwagen für Schadstoff-Emissionen, er bleibt aber meistens in der Garage. Früher war er rund um die Uhr auf dem Werksgelände unterwegs, heutzutage kommt er höchstens mal für zwei Stunden raus. Noch dazu fährt er oftmals noch nicht einmal die richtigen Stellen an und steht bei Schadstoff-Austritten nicht dort, wo die genauesten Messungen erfolgen können, weil die Mannschaft nicht mehr wie früher aus qualifiziertem Personal besteht.
EU verbessert Bodenschutz
EU-weit sind ca. vier Millionen Grundstücke durch Chemikalien, Schwermetalle oder Dioxin verunreinigt. Die Kosten für die Sanierung dieser Böden beziffert die Brüsseler Kommission auf 38 Milliarden Euro. Darum verstärkt die Europäische Union ihre Anstrengungen zum Bodenschutz. Nach einem neuen Richtlinien-Entwurf müssen BAYER & Co. beim Verkauf von Firmen-Arealen künftig Expertisen über die im Erdreich schlummernden Schadstoffe vorlegen. Darüber hinaus fordert die Regelung die Mitgliedsstaaten auf, ein für Privatpersonen und Unternehmen einsehbares Belastungskataster anzulegen.
Biopirat BAYER
BAYER betrachtet die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen lediglich als Rohstoff-Reservoir und plündert sie ohne Rücksicht auf Verluste aus. So produziert der Pharmariese das Diabetes-Mittel GLUCOBAY mittels eines Bakteriums, das aus dem kenianischen Ruiru-See stammt, ohne dem ostafrikanischen Land auch nur einen Cent dafür zu bezahlen (siehe SWB 1/06). Der neueste Biopiraterie-Coup des Konzerns: Er schaut sich gemeinsam mit dem Unternehmen MAGELLAN BIOSCIENCE GRUPPE INC. in den Weltmeeren nach Mikroorganismen um, deren Abwehrstoffe sich zur Herstellung neuer Pestizide eignen.
Antibiotika in der Umwelt
In der Humanmedizin kommen BAYERs CIPROBAY und andere Antibiotika massenhaft zum Einsatz, ihr Verbrauch lag 2004 bei 1.600 Tonnen. Dazu addieren sich noch die Anwendungen in der Massentierhaltung. Diese Gemengelage sorgt nicht nur für die Entstehung von Resistenzen, welche die Mittel unbrauchbar bei der Behandlung von Infektion machen, sie hinterlässt auch in der Umwelt ihre Spuren. So tummeln sich Antibiotika schon im Grund- und Trinkwasser und gelangen über Klärschlamm und Gülle auch in den Boden. Dort setzen sie dann den Mikroorganismen zu, was das Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringt und die Erde unfruchtbarer macht.
GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV
Geschlechtsumwandlung durch Weichmacher
Weichmacher wie das von BAYER hergestellte Bisphenol A können wegen ihrer hormon-ähnlichen Wirkung beim Menschen die Hirnentwicklung stören sowie Krebs, Unfruchtbarkeit oder Erbgutschädigungen verursachen. Bei Tieren können sie sogar Geschlechtsumwandlungen bewirken. Bei 95 bis 100 Prozent aller männlichen Kaulquappen, die Chemikalien ausgesetzt waren, beobachteten ForscherInnen der schwedischen Universität Uppsala eine Transformation in Weibchen. Nach Meinung der WissenschaftlerInnen erklärt der Schadstoff-Eintrag in die Gewässer deshalb auch das Aussterben vieler Froscharten.
PLASTE & ELASTE
BAYER Nr. 1 bei Polycarbonaten
Nach der Inbetriebnahme des Shanghaier MAKROLON-Werkes ist BAYER der weltgrößte Polycarbonat-Produzent.
STANDORTE & PRODUKTION
Visionen für Leverkusen?
45. 000 Menschen arbeiteten einst in den Leverkusener BAYER-Anlagen. Heute sind es nur noch 14.000; dazu kommen noch 5.000 bei der Chemie-Abspaltung LANXESS Beschäftigte. Der Schrumpfungsprozess hat auf dem Werksgelände ziemliche Lücken entstehen lassen, die auch die Anwerbung von Fremdfirmen im Rahmen des Chemiepark-Konzeptes nicht hat füllen können, nicht zuletzt weil die Grundstruktur des Areals dem Transformationsprozess einige Steine in den Weg stellt. Jetzt hat der Konzern zu einer preiswerten Lösung der Probleme gefunden, die ihm überdies die Planungshoheit gewährt. Er hat seine Beziehungen zur BDI-Unterabteilung „Kulturkreis der deutschen Wirtschaft“ spielen lassen und einen mit 10.000 Euro dotierten Architekturpreis für das Projekt „Leverkusen: vom BAYER-Werk zum Chemiepark“ ausgeschrieben.
IMPERIUM & WELTMARKT
Neue Pestizid-Kooperation
BAYER und das russisch-amerikanische Unternehmen MAGELLAN BIOSCIENCE GRUPPE INC. haben eine Zusammenarbeit bei der Suche nach Pestizid-Wirkstoffen auf Basis von aquatischen Mikroorganismen beschlossen (WASSER, BODEN & LUFT).
ÖKONOMIE & PROFIT
Mehr Profit, weniger Arbeitsplätze
BAYER-Chef Werner Wenning konnte in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des „Verbands der Chemischen Industrie“ glänzende Geschäftszahlen für die Branche vorlegen. Der Umsatz von BAYER & Co. stieg im Jahr 2006 um sechs Prozent auf 162 Milliarden Euro. Den Beschäftigten kam das allerdings nicht zugute; die Zahl der Arbeitsplätze sank um ein Prozent.
UNFÄLLE & KATASTROPHEN
Drei Verletzte bei Explosion
Am 16. Januar 2007 hat eine Explosion in dem brasilianischen BAYER-Werk am Standort Belford Roxo drei MitarbeiterInnen verletzt. Zwei Personen erlitten Verbrennungen, ein Helfer brach sich bei Löscharbeiten ein Bein.
Das Unglück ereignete sich durch einen bislang ungeklärten Temperaturanstieg in dem Kessel einer Anlage zur Herstellung des Pestizid-Wirkstoffes Methamidophos. Der große Knall war in einem Umkreis von fünf Kilometern zu hören und die auflodernden Flammen weithin zu sehen. Der ausströmende Gasgeruch verursachte bei vielen AnwohnerInnen Übelkeit. Feuerwehr-Züge aus drei Gemeinden waren nötig, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Als Reaktion auf den Störfall kündigte das zuständige Umweltministerium schärfere Sicherheitsauflagen an. Zudem muss BAYER mit einer Strafzahlung rechnen (siehe auch AKTION & KRITIK).
RECHT & UNBILLIG
Anklage wg. „Organisierten Verbrechens“
BAYER, PFIZER, ROCHE und 27 andere Pharmafirmen haben der türkischen Regierung überhöhte Kosten für importierte Arzneien in Rechnung gestellt. Eigentlich sollten diese sich an den niedrigsten Preisen in Frankreich, Griechenland, Spanien und Italien orientieren, aber die Konzerne haben Zahlenkosmetik betrieben und sich dadurch Extra-Profite gesichert. „Wegen der Teilnahme an einer illegalen Organisation, die das Ziel hatte, Verbrechen zu begehen, die staatliche Autorität zu missachten, offizielle Dokumente zu fälschen und in offiziellen Dokumenten zu lügen“ hat die Istanbuler Staatsanwalt deshalb Ermittlungen gegen BAYER & Co. aufgenommen.
BAYER gelobt Rechtstreue
Der Leverkusener Multi hat ein „Programm für gesetzmäßiges und verantwortungsbewusstes Handeln“ verabschiedet. „Rechtsfragen spielen eine zunehmend wichtigere Rolle bei der Gestaltung unserer Geschäfte“, sagte BAYER-Chef Werner Wenning zur Begründung des Vorstoßes, „Es gibt kaum einen Tätigkeitsbereich, der nicht davon betroffen ist.“ Weniger verklausuliert formuliert: Wer so dem Profit hinterherjagt wie wir, der bewegt sich zwangsläufig am Rande der Illegalität. Aber jetzt gelobte der Konzern, „Rechtsrisiken zu vermeiden“ und wartet mit Neuigkeiten auf. „Die BAYER AG respektiert das geltende Recht“, heißt es im so genannten Corporate-Compliance-Programm. In Zukunft soll in Sachen „Kartellrecht“, „Umgang mit gefährlichen Stoffen“, „Arbeitsschutz“, „Anlagenschutz“, „Umweltschutz“, „Gentechnik“ und „Datenschutz“ alles mit rechten Dingen zugehen. Wie unernst der Pharma-Riese es mit diesem Bekenntnis meint, zeigt der jüngste Gesetzesbruch in der Türkei (s. o.).
Diätpillen-Werbung bestraft
Erneut muss der BAYER-Konzern in den USA ein Bußgeld wegen unlauterer Werbung zahlen. Der Leverkusener Multi hatte in einem TV-Spot für die Diät-Pille ONE-A-DAY WEIGHTSMART fälschlicherweise behauptet, das Präparat würde den Stoffwechsel anregen. Wegen „irreführender Versprechungen“ verhängte die US-Wettbewerbsbehörde „Federal Trade Commission“ (FTC) deshalb eine Buße von 3,2 Millionen Dollar gegen den Pharmariesen. Nach Angaben der FTC-Vorsitzenden Deborah Platt Majoras handelte es sich dabei die höchste jemals von der Behörde verhängte Zivilstrafe (siehe SWB 1/07).
Klage gegen BAYER-Mais
Die mangelnde Akzeptanz von Genfood in Europa hat BAYER dazu veranlasst, die Entwicklungsländer als Anbaugebiete zu nutzen. Aber auch dort stößt die Risikotechnologie zunehmend auf Kritik. So klagten in Brasilien mehrere Nichtregierungsorganisationen gegen die geplante Aussaat von gentechnisch gegen das Unkrautmittel LIBERTYLINK immun gemachten Mais, und errangen einen Teilerfolg. Das Gericht setzte das Genehmigungsverfahren erst einmal aus und zwang die Nationale Biosicherheitskommission, eine BürgerInnen-Anhörung anzuberaumen.
RichterInnen erleichtern Stilllegungen
BAYER & Co. können künftig noch leichter Standorte dichtmachen. Bislang mussten die Konzerne im Vorfeld einer Schließung einen Interessensausgleich mit dem Betriebsrat suchen und im Falle eines Scheiterns eine Einigungsstelle anrufen. Das nahm unter Umständen mehrere Monate in Anspruch, während derer die Unternehmensleitung keine Vorbereitungen zur Abwicklung etwa durch Kündigungen treffen durfte, wollte sie keine Klagen von Seiten des Betriebsrats provozieren. Jetzt erleichtert ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes BAYER & Co. die Arbeit. Nach dem Votum der RichterInnen brauchen Kündigungen kurz vor Toresschluss nämlich nicht unbedingt mit der Stilllegung in Zusammenhang zu stehen, weshalb die Firmen in Zukunft schon während der Verhandlungen mit den Gewerkschaften tüchtig loslegen und so eine Menge Zeit sparen können.
Kein Giftgas-Prozess gegen Hussein
Der irakische Diktator Saddam Hussein schwörte auf BAYER-Produkte. Bei seinen Attacken auf kurdische Dörfer zwischen 1987 und 1988, denen 50.000 bis 100.000 Menschen zum Opfer fielen, kam das vom BAYER-Forscher Fritz Haber während des Ersten Weltkrieges entwickelte Senfgas zum Einsatz. In einem gesonderten Prozess sollte Hussein sich auch dafür verantworten, aber durch das Todesurteil im Hauptverfahren kommt es nicht mehr dazu. Die jetzige Regierung hat allerdings ebenfalls keine Probleme mit BAYER. Auf dem deutsch-irakischen Wirtschaftskongress Anfang 20004 hob ein Wirtschaftspolitiker die guten Beziehungen des Landes zur bundesdeutschen Chemie-Industrie hervor und lud BAYER & Co. zu einer Verstärkung ihres Engagements im Irak ein. Das brachte ihm damals jedoch wütende Reaktionen von Teilen der irakischen KurdInnen ein, die für die Hinterbliebenen der in Halabja durch Giftgas made in Germany Getöteten Reparationsansprüche geltend machen.
Kein Patent für Brüstle
Das Bundespatentgericht hat dem Stammzellen-Forscher Oliver Brüstle von der BAYER in vielfältiger Weise verbundenen Universität Bonn (siehe SWB 2/02) ein Patent auf Produkte aus embryonalen Stammzellen verweigert. Es gab damit dem Kläger GREENPEACE Recht. Zur Begründung verwiesen die RichterInnen auf die Biopatentrichtlinie der EU, welche die Kommerzialisierung von Embryonen als sittenwidrig einstuft. Der Genforscher will Beschwerde gegen das Urteil einlegen, das es ihm bedeutend schwerer macht, Risikokapital für seine Hochschul-Ausgründung „Life and Brain“ aufzutreiben.
BAYER muss Uni säubern
Die STAUFFER CHEMICAL COMPANY betrieb ihre Fabrik von 1897 bis 1987 in unmittelbarer Nähe der Universität Berkeley und verunreinigte das Hochschulgelände mit giftigen Substanzen. Staatliche Stellen haben jetzt BAYER und ZENECA als Rechtsnachfolger der Firma aufgefordert, die Altlasten zu entsorgen.
EU stärkt AktionärInnen-Rechte
Die EU plant, die Auskunftsrechte von AktionärInnen zu stärken. Ein Richtlinien-Entwurf sieht vor, Fragen von Aktien-BesitzerInnen zur Geschäftspolitik auch schon vor der Hauptversammlung zuzulassen und die Konzerne zu verpflichten, die Antworten im Internet zugänglich zu machen. Dieser Vorstoß hat allerdings bereits den Ministerrat auf den Plan gerufen. In einem Kompromissvorschlag spricht er sich für einen engen zeitlichen Rahmen zur Einreichung der Informationsersuche aus. Zudem wollen die MinisterrätlerInnen BAYER & Co. die Möglichkeit einräumen, zur Abwehr unliebsamer KritikerInnen formlos auf bereits veröffentlichte allgemeine Informationen zu verweisen.
Kommt der Bilanzeid?
Die Bundesregierung plant im Zuge der Umsetzung der Brüsseler Transparenz-Richtlinie eine Reihe von Veränderungen im Aktienrecht. Wer mehr als drei Prozent der Aktien eines Unternehmens besitzt, muss dies in Zukunft öffentlich bekannt geben. Früher lag die Schwelle bei fünf Prozent. Die Große Koalition will angeblich so Risikokapital-Investoren besser auf die Spur kommen. Darüber hinaus können PrüferInnen bei einem Anfangsverdacht auf Betrug die Bilanzen von BAYER & Co. künftig auch zweimal im Jahr durchgehen. Schließlich sollen die Vorstände bald einen Eid auf die Korrektheit ihrer Bilanzen ablegen. Nicht nur weil dies BAYER-Chef Werner Wenning und seinen KollegInnen schwer fallen dürfte, hat der Bundesrat laut Faz „bereits etliche Bedenken angemeldet“.
BAYER verkauft HENNECKE
Der Leverkusener Multi will sich von seiner Tochtergesellschaft HENNECKE trennen. HENNECKE stellt Maschinen zur Kunststoff-Produktion her und steht im Mittelpunkt einer langwierigen juristischen Auseinandersetzung um Patentraub (Ticker berichtete mehrfach). Mitte der 60er Jahre hatte der Düsseldorfer Erfinder Heinz Süllhöfer BAYER/HENNECKE eine Maschine zur Herstellung von Isolierplatten aus Polyurethan-Hartschaum zum Kauf angeboten. Der Leverkusener Chemie-Multi lehnte ab - und baute die Süllhöfer-Erfindung nach. In der Folge warf die Apparatur für den Konzern Milliarden-Gewinne ab. Süllhöfer strengte einen Prozess wegen Patent-Verletzung an, der mit einem Vergleich endete. Der Konstrukteur überließ dem Unternehmen die Nutzung der Platten-Maschine und sollte dafür Lizenz-Gebühren erhalten. Davon sah er allerdings nie eine müde Mark. Der Multi mogelte sich um die fälligen Zahlungen herum, indem er Unter-Lizenzen an andere Firmen vergab und diese mit deren Bestellungen von BAYER-Rohstoffen verrechnete. Der Düsseldorfer Erfinder reichte deshalb erneut eine Klage ein. Diese bildete den Auftakt für einen Prozess-Marathon, dessen Ende auch heute noch nicht abzusehen ist.
FORSCHUNG & LEHRE
Kooperation mit der Stanford University
BAYER hat mit der Universität von Stanford eine Forschungszusammenarbeit vereinbart. Hochschule und Unternehmen wollen ein auf molekularer Bildgebung beruhendes Diagnose-Verfahren zur Erkennung von Tumoren entwicklen. Das Geschäftsfeld „Diagnostische Bildgebung“ gehörte zu den Schwerpunkten des im Jahr 2006 von BAYER geschluckten SCHERING-Konzerns. Mit AVID RADIOPHARMACEUTICALS und der Züricher „Eidgenössischen Technischen Hochschule laufen bereits Kooperationen auf diesem Gebiet.
BAYER spendet BAYER
„Sozial ist, wenn es trotzdem nützt“ - nach dieser Devise fördert BAYER gemeinsam mit der US-amerikanischen Universitätsstadt Berkeley aus sozialen oder ethnischen Gründen benachteiligte BiowissenschaftlerInnen. Die Armen kommen durch die „Biotech Partners“ unter anderem in den Genuss von Praktika beim Leverkusener Gen-Giganten und können sich für künftige Arbeiten in den Konzern-Laboren empfehlen. Die gemeinnützige „BAYER Foundation“ hat jetzt mit einer Spende von 150.000 Dollar den Etat der Organisation noch einmal ein wenig aufgestockt.
SPORT & MEDAILLEN
Freispruch für Calmund
Angeblich zum Erwerb von Kaufoptionen für Fußballer hatte Reiner Calmund in seiner Eigenschaft als Manager von BAYER Leverkusen dem Spielerberater Volker Graul 580.000 Euro in bar übergeben. Belege für solch einen Verwendun
22. Dezember 2006, Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund
„Verraten und Verkauft“ - Das deutsche Bienenmonitoring
Der Deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund informiert zur aktuellen Lage der Imkerei.
Das Bienensterben der letzten Jahre und laufende Untersuchungen. Industrielle Schaumschlägerei und nicht mehr.
Nach nunmehr 2 Jahren Mitarbeit ist der Deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund kurz davor sich vom Projekt Bienenmonitoring zu verabschieden. Ausschlaggebend dafür ist, dass trotz wiederholter Anläufe des DBIB es von der Industrie abgelehnt wird, die Untersuchungen in gleichwertigem Umfang auf die Pflanzenschutzmittel auszudehnen.
Nachdem einige Imkervertreter Verwunderung über dieses Vorgehen geäußert hatten, wurde die Sache dadurch gelöst, daß die Firma Bayer selbst einige Laboruntersuchungen vornahm - alles ohne Befund.
Im zweiten Jahr verzichtete man dann ganz auf Untersuchungen in dieser Richtung, weil die Untersuchungen zu teuer seien. Man hat stattdessen beschlossen die Proben einzufrieren und diese erst nach Bedarf auf Pflanzenschutzmittelrückstände zu untersuchen.
Damit war dieses Thema erst mal auf Eis gelegt. Stattdessen wurde im Projekthaushalt viel Geld für alle möglichen Untersuchungen auf verschiedene Bienenkrankheiten und Ähnliches eingestellt.
Einen Haushaltsposten für unabhängige Laboruntersuchungen auf Pflanzenschutzmittel gab es damit erst gar nicht!
Auch hat man sich nicht die Arbeit gemacht, zu recherchieren, welche PSM (Pflanzenschutzmittel) in der näheren Umgebung der Bienenvölker eingesetzt wurden. Somit ist es ein leichtes zu sagen, dass es nicht möglich ist zielgerichtet auf bestimmte PSM hin zu untersuchen.
Und so konnte man sich getrost auf den wichtigsten Teil des Projektes stürzen: die Pressearbeit.
Dort wurde wirklich gründliche Arbeit geleistet. Dort wurde nichts auf Eis gelegt. Die Türen der Bundespressekonferenz standen plötzlich offen.
Der Blätterwald rauschte.
Vorträge wurden gehalten. Der Deutschlandfunk berichtete schon während die Projektmitglieder noch tagten. Im Beitrag des Deutschlandfunks wurde sogar erzählt, dass das Monitoring gezeigt hätte, daß die Gentechnik keine Gefahr für die Imkerei sei. Dabei war dies überhaupt nicht Gegenstand der Untersuchungen.
Aber wenn man Geld in die Hand nimmt, um Ruhe an der Imkerfront zu bekommen, dann muss man natürlich versuchen den PR-Gewinn zu maximieren.
Wir haben versucht einen Mitschnitt der Sendung zu bekommen.
Der Deutschlandfunk behauptet er habe keinen, weil die Sendung extern im Auftrag des Bauernverbandes produziert worden sei. Beim Bauernverband behauptet man davon nichts zu wissen.
Der Mitschnitt ist bis heute verschollen!
Der DBIB hat am so genannten „Runden Tisch“ am 9. November nochmals seine Kritik-Punkte vorgebracht. Das Resultat war, dass diese in dem von Deutschen Bauernverband erstellten Protokoll nicht einmal erwähnt wurden.
Was man nicht haben will wird einfach tot geschwiegen.
All das hat unseren Argwohn geschürt und es liegt der Verdacht nahe, dass das Bienenmonitoring nur dem Ziel dient, die Imker ruhig zu stellen und der Industrie Zeit zu schaffen um weiterhin ungestört die Pflanzenschutzmittel die in der Kritik stehen, ausbringen zu können.
Und Gründe dafür gibt es genug.
Was die Industrie anbelangt so darf man erwarten, dass keine Gelder ausgegeben werden, die nicht in mittelbarer oder unmittelbarer Weise zum Gewinn des Unternehmens beitragen. Das Aktienrecht verbietet Konzernen ausdrücklich uneigennützige Wohltätigkeit. Die Aktionäre könnten in so einem Fall den Vorstand wegen Zweckentfremdung der Mittel verklagen. Aber mit der Finanzierung dieses Projektes herrscht für die Dauer des Projekts Ruhe an der Front. Jegliches Ansinnen, bienengefährliche Wirkstoffe so wie in Frankreich zu behandeln, kann mit dem Hinweis auf die laufenden Untersuchungen auf die lange Bank geschoben werden. Das sichert Millionenumsätze über Jahre. Da darf man ruhig schon mal in die Portokasse greifen.
Vor diesem Hintergrund wundert es auch nicht, wie durchsichtig das Ganze ist, wenn der Vertreter der Industrie die Presseerklärung für den runden Tisch bereits vor der Sitzung auf seinem Laptop vorbereitet hat und diese Presseerklärung eine Generalabsolution für die Geldgeber darstellt, viele andere mögliche Ursachen anführt, auf sehr gute Honigerträge in diesem Jahr verweist, ohne auch nur mit einem Wort die am „Runden Tisch“ geäußerten Bedenken der Imkervertreter zu erwähnen.
Beim Thema der neuen Wirkstoffe bei der Beizung von Rapssaatgut wurde ein weiteres Ziel des Runden Tisches klar.
Der Vertreter von Syngenta erregte sich sehr darüber, dass Imker in der Frage der fehlenden Zulassung von ELADO direkt bei verschiedenen Behörden aktiv geworden sind. Man müsse solche Sachen am „Runden Tisch“ klären. Sonst könne er in seiner Firma die Zurverfügungstellung der Mittel für das Monitoringprojekt nicht mehr rechtfertigen.
Was die Bieneninstitute anbelangt, stellt sich die Frage warum dort alles kritiklos hingenommen wird ?
Für die Institute bedeutet das Bienenmonitoring erst einmal, dass zusätzliche Gelder zur Verfügung stehen.
Natürlich ist der Verdacht, es handele sich bei diesem Projekt um eine rein industriefinanzierte Gefälligkeitsstudie, sehr kränkend für die beteiligten Institute.
Daher weist man auch darauf hin, dass das Monitoringprogramm nicht nur von der Industrie finanziert sei, sondern die Institute inzwischen auch noch etwa den gleichen Betrag durch Eigenleistung beisteuern.
Nun machen die Institute das nicht in ihrer Freizeit, sondern mit Mitarbeitern und Ressourcen, die eigentlich aus anderen Töpfen und zu anderen Zwecken finanziert werden.
Hier sei die Frage erlaubt welchen Anteil die Institute an den EU-Imkerfördergelder im Rahmen der EU VO 1221 bekommen und warum dieser nicht an die Imker geht? Und wenn schon die Imker die volle Einbeziehung der Pflanzenschutzmittel fordern, warum diese Gelder dann nicht dafür ausgegeben werden ?
Ein Kunstgriff der Industrie ist, dass die Mittel nicht zu Beginn des Projektes auf einmal gezahlt werden, sondern jährlich abgerechnet wird.
Damit könnte das Projekt jederzeit abgeblasen werden, so etwa auch wenn unerwünschte Ergebnisse zu Tage kommen sollten. Damit ergibt sich bei den beteiligten Instituten eine Interessenkonflikt: bei unerwünschtem Ergebnis ist eventuell das Geld weg. Was hier bleibt ist ein „Geschmäckle“.
Man hält es in den Reihen der Institute auch für normal, dass die nächsten Presseaktionen und Vortragsserien geradezu generalstabsmäßig vorbereitet werden, obwohl bei dem Projekt bisher kaum etwas herausgekommen ist, das einen solchen Rummel rechtfertigen könnte. Man muss aber wohl jedes Jahr eine neue Sau durchs Dorf treiben können, denn so ist die Ablenkung von der ursprünglichen Fragestellung perfekt.
Der Vorwurf an die Institute ist nicht, dass sie Ergebnisse manipulieren, sondern, dass sie sich nicht vehement an die Seite der Imker stellen und fordern, dass ausgewogen in alle Richtungen auch bei PSM untersucht wird.
Die Institute berichten voller Stolz, dass das deutsche Projekt in Europa große Beachtung finde. In Frankreich mit den dortigen Imkerverbänden sei so etwas nicht möglich, würden Kollegen aus den anderen Ländern sagen.
Aus unseren Gesprächen mit den französischen Imkern wissen wir aber, wie das Monitoring dort tatsächlich gesehen wird. Bei einem Treffen verschiedener europäischer Imkerverbände in Paris zum Thema Pflanzenschutzmitel, das die COPA verhindern wollte, wurde uns von unseren Kollegen höflich aber deutlich gesagt:
„Nur in Deutschland sind die Imkerverbände naiv genug, sich für diese PR-Strategie der Industrie herzugeben. Ihr macht euch damit nicht nur lächerlich. Ihr schwächt auch die Position der Imker in den anderen EU-Ländern.“
Die Sorgen unserer europäischen Kollegen sind berechtigt. Die Europäisierung des deutschen Bienenmonitorings wird bereits vorangetrieben, denn die Ergebnisse dieses Projekts sollen auch dazu verwendet werden, die Pflanzenschutzmittel in anderen Ländern aus der Schusslinie zu bekommen. Wir erweisen unseren europäischen Imkerkollegen einen Bärendienst, wenn wir uns als Feigenblatt für ein Projekt hergeben, bei dem eine unabhängige ergebnisoffene Forschung von seiner Struktur her nicht garantiert ist.
Natürlich sollten wir Imker daran interessiert sein, dass ein echtes Monitoring statt findet. Die Initiative dafür ging, wie oben erwähnt, eigentlich von unserem Verband aus. Wir müssen uns weiter für ein Projekt stark machen, das ausschließlich mit öffentlichen Mitteln so finanziert wird, dass glaubwürdige Ergebnisse möglich sind. Wir müssen dafür sorgen, dass die Bieneninstitute aus diesem schlimmen Interessenkonflikt befreit werden und unabhängig arbeiten können.
Unser Ziel ist es nicht, dieses oder jenes Pflanzenschutzmittel verboten zu bekommen. Unser Ziel muss es sein, zu lernen, was wir selbst in unserer Betriebsweise besser machen können und was diejenigen, die die Kulturlandschaft, in der unsere Bienen leben und überleben sollen, besser machen können, damit die vielen Faktoren, die unsere Bienen immer mehr schwächen, Schritt für Schritt positiv verändert werden können.
Dazu gehört nicht nur aber auch eine tief greifende Reform der Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln.
Das deutsche Bienenmonitoring in der jetzigen Form bringt uns auf diesem Wege nicht weiter, sondern ist dazu angelegt uns auszubremsen. Wir haben es uns zwei Jahre lang angeschaut. Viele Mitglieder unseres Verbandes waren daran beteiligt. Wir haben guten Willen gezeigt und einen großen Vertrauensvorschuss gegeben, indem wir trotz erheblicher Zweifel unsere Mitglieder zum Mitmachen aufgefordert haben. Was wir uns vielleicht selber vorwerfen können ist, so lange gewartet zu haben bis wir in dieser Weise unseren Standpunkt Nachdruck verleihen.
Leider ist es uns nicht gelungen, den überwältigenden Einfluss der Industrie in vertretbaren Grenzen zu halten. Im Interesse aller Imker müssen wir daher unseren Mitgliedern empfehlen, ihre Mitarbeit bei diesem Projekt einzustellen, falls unsere seit langem bekannten Forderungen nicht endlich umgesetzt werden.
Hier also noch einmal unser Forderungskatalog:
1. Bei der Ursachenforschung sind alle möglichen Faktoren gleich zu behandeln. Wenn wir Imker etwas falsch machen, wollen wir das wissen, damit wir unsere Betriebsweise verbessern können. Wenn es neue Krankheitserreger gibt, wollen wir sie finden und zu kontrollieren lernen.
Wenn Pflanzenschutzmittel unsere Bienen schwächen, wollen wir dies wissen und mit der Industrie, dem Bauernverband und den Behörden eine Strategie zur Schadensminimierung entwickeln. Wir sind uns dabei bewusst, dass Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft benötigt werden, weisen aber auch darauf hin, dass die ökologische Landwirtschaft zeigt, dass der Ansatz der chemischen Industrie nicht immer alternativlos ist.
2. Wenn es bei Bienenkrankheiten für sinnvoll erachtet wird, routinemäßig den Erregerdruck für das ganze Spektrum möglicher Krankheiten zu erfassen, dann hat dies auch für die Präsenz der wichtigsten Pflanzenschutzmittel zu geschehen.
3. Zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten haben gezeigt, dass eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Bienen bereits lange vor dem Tod der adulten Bienen eintritt. Ein Bienenvolk mit desorientierten Flugbienen ist in überlebenswichtigen Funktionen gestört. Die subletale Wirkung ist bereits bei Konzentrationen zu beobachten, bei denen das entsprechende Pflanzenschutzmittel zwar nachweisbar, aber nicht quantifizierbar ist. Bei den von Bayer durchgeführten Untersuchungen wurden Ergebnisse unter der Quantifizierungsgrenze nicht berücksichtigt. Es sind aber alle Ergebnisse, bei denen das Vorhandensein bestimmter Pflanzenschutzmittel nachgewiesen werden kann, bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
4. Die Untersuchungen haben mit den Analysemethoden zu erfolgen, die heute die niedrigsten möglichen Nachweis- und Quantifizierungsgrenzen haben.
5. Hersteller von Pflanzenschutzmitteln haben einen Interessenkonflikt und dürfen daher nicht wie ein unabhängiges Untersuchungslabor angesehen werden. Im Monitoringprojekt müssen ausreichend Mittel bereitgestellt werden, um Untersuchungen auf Pflanzenschutzmittel durch ein unabhängiges Labor unseres Vertrauens durchführen zu lassen.
6. Bei der Untersuchung der Völker ist auch das landwirtschaftliche Umfeld nach der Art der Kulturen und verwendeten Pflanzenschutzmassnahmen zu erheben.
7. Transparenz: Ein abgestimmter Bericht ist im Internet und der Fachpresse zu veröffentlichen. Eine darüber hinaus gehende offensive PR-Kampagne ist nur dann sinnvoll, wenn es gilt Ergebnisse zu kommunizieren, die in der Breite praktisch umgesetzt werden können. Dies war in der Vergangenheit nicht der Fall.
8. Die Tatsache, dass dieses Projekt durchgeführt wird, darf nicht zur verzögerten Umsetzung bereits bekannter Verbesserungsmöglichkeiten führen. Wenn, wie die Industrie gerne feststellt, die Varroa die Hauptursache für das Bienensterben ist, dann ist es unverständlich, warum:
a) wir keine Unterstützung bei der Zulassung von 85%iger Ameisensäure haben,
b) nach langem Ringen mit erheblicher Verspätung nur eine Methode der Oxalsäurebehandlung erlaubt ist,
c) immer noch der Einsatz von Varroaziden mit Rückstandsproblematik und Resistenzbildung gefördert wird,
d) bürokratische Auswüchse bei der Anwendung des europäischen Tierarzneimittelrechts auf die Imkerei nicht verhindert werden,
e) die Schulung der Imker durch die Fachberater sich auf veraltete Methoden beschränken muss, weil für die anderen die Zulassung fehlt.
Wenn die Industrie wirklich davon überzeugt ist, dass es sich hier um ein Varroa-Problem handelt, wäre es doch ratsam sich in der Frage der Varroabekämpfungsmittel im Sinne der Imker zu verwenden.
Auch in der Frage der Methodik bei den Untersuchungen auf Bienengefährlichkeit für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln hat es keine Fortschritte gegeben.
Die Statistiken der BBA über das Ausmaß von Bienenschäden in Deutschland scheinen nur deshalb zu sinken, weil die Dunkelziffer wächst.
Wie gesagt, die oben genannten Forderungen sind für die Organisatoren des Monitoringprojektes sicher nicht neu. Leider wurden die letzten zwei Jahre nicht genutzt, um sich Vertrauen in der Imkerschaft zu erarbeiten.
Gleichzeitig wurde bei den Fragen, die uns wirklich beschäftigen, viel Zeit verloren und Gelder in das Bienenmonitoring umgeleitet. Wir empfehlen daher es mit Erich Kästner zu halten:
„Was immer auch geschieht: Nie sollt Ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man Euch zieht, auch noch zu trinken!“
Pressekontakt: Schaubienenstand Honighaeuschen, Klaus Maresch 0177 9133175 oder Manfred Hederer 08806 922321
weitere Infos:
Bienensterben jetzt auch in Deutschland
Süddeutsche Zeitung: Insektizid ist Grund für Bienensterben
Presse-Information vom 23.7.2006
GLOBAL 2000 (Friends of the Earth Austria)
Bienenschädigendes-Pestizid darf nicht länger legal bleiben!
Die Umweltschutzorganisation Global 2000 hat das Pflanzenschutz-Gift Imidacloprid bei einer Bodenuntersuchung eines Maisfeldes in der Steiermark im Bezirk Deutschlandsberg nachgewiesen. „Es ist ein Skandal, dass Imidacloprid in Österreich immer noch eingesetzt wird - und noch dazu legal! Imidacloprid wirkt nachweislich als Nervengift auf Honigbienen“, warnt Lisa Kernegger, Pestizid-Expertin von GLOBAL 2000. „Schon seit zwei Jahren ist Imidacloprid in Frankreich im Maisanbau verboten.“ GLOBAL 2000 kritisiert scharf, dass sich Landwirtschaftsminister Josef Pröll weigert, die Anwendung von Imidacloprid endlich auch in Österreich zu verbieten. Damit nicht genug, Imidacloprid wird sogar im Rahmen des geförderten Umweltprogramms ÖPUL, das wörtlich für Österreichisches Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft steht, legal eingesetzt.
Eine in Österreich durchgeführte Studie kam bereits 2002 zu einem alarmierenden Ergebnis. Es wurde eine Reduktion der Brutaufzucht unmittelbar nach der Anwanderung des Bienenvolkes an die mit Imidacloprid gebeizten Rapsfelder beobachtet. Das hatte eine Schwächung des gesamten Bienenvolkes zur Folge. Seit einigen Jahren steht Imidacloprid im Verdacht für das Sterben von 90 Millionen Bienen in Frankreich innerhalb von 10 Jahren verantwortlich zu sein. Eine vom französischen Landwirtschaftsministerium in Auftrag gegebene Studie kam 2003 zu dem Ergebnis, dass Imidacloprid für das weiträumige Bienensterben mitverantwortlich ist. Daraufhin erließ Frankreich 2004 ein Verbot für Imidacloprid im Maisanbau. Dieses Verbot wurde im April dieses Jahres trotz heftiger Proteste der Erzeugerfirma Bayer erneuert. Mit einem Umsatz von über 500 Millionen Euro jährlich gehört der Wirkstoff zu den wichtigsten Bayer-Produkten (z.B. Gaucho).
GLOBAL 2000 fordert nun für Österreich dringend das Verbot aller Pestizide, die das Gift Imidacloprid enthalten. „Bienen leisten einen unschätzbaren Beitrag zu Bestäubung von Kultur- und Wildpflanzen. Dies darf nicht durch einzelne chemische Wirkstoffe gefährdet werden“, warnt Kernegger „Zudem besteht große Gefahr der vermehrten Verwendung von Imidacloprid durch die Zunahme des Rapsanbaus für die Biodiesel-Produktion. Davor warnen wir eindringlich. Zukünftige Probleme sind sonst vorprogrammiert. Österreich muss jetzt dem Beispiel Frankreich folgen und dieses für Bienen so gefährliche Pestizid Imidacloprid verbieten“, so Kernegger abschließend.
AKTION & KRITIK
GAUCHO-Kampagne in Kanada
BAYERs Saatgutbehandlungsmittel GAUCHO mit dem Wirkstoff Imidacloprid ist für ein Bienensterben in großem Ausmaß verantwortlich und deshalb in Frankreich schon mit Anwendungseinschränkungen belegt. Die COALITION FOR A HEALTHY OTTAWA hat jetzt wegen dieser „Risiken und Nebenwirkungen“ in Kanada eine Kampagne gegen das Pestizid gestartet.
GLOBAL 2000 für GAUCHO-Verbot
Frankreich untersagte im Jahr 2004 die Ausbringung des BAYER-Pestizids GAUCHO mit dem Wirkstoff Imidacloprid auf Sonnenblumen- und Maisfeldern, nachdem eine Studie die Agrochemikalie für den Tod von 90 Milliarden Bienen innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren verantwortlich gemacht hatte. Auch eine Untersuchung aus Österreich wies die Bienengefährlichkeit des Mittels nach. Deshalb fordert die alpenländische Umweltschutzgruppe GLOBAL 2000 nun ein Verbot des Ackergiftes. „Es ist ein Skandal, dass Imidacloprid in Österreich immer noch eingesetzt wird - und noch dazu legal! Imidacloprid wirkt nachweislich als Nervengift auf Honigbienen“, protestierte Lisa Kernegger im Namen der Initiative.
Kampagne gegen BAYERs Genreis
BAYER hat für den gentechnisch manipulierten Reis LL 601, der in den USA auf herkömmliche Sorten übergriff und deshalb Schlagzeilen machte (siehe GENE & KLONE), in Südafrika eine Importgenehmigung beantragt, obwohl das Land ein Gentech-Moratorium verhängt hat. Die Initiative AFRICAN CENTRE FOR BIOSAFETY fordert eine Ablehnung des BAYER-Begehrs und machte bei den Behörden eine entsprechende Eingabe.
SPD: Mehr ausbilden!
Lehrlinge stellen in bundesdeutschen Firmen durchschnittlich sieben Prozent der Belegschaft. BAYER erreicht diese Quote jedoch nicht und befindet sich damit in der schlechten Gesellschaft der anderen großen börsennotierten Unternehmen. Die SPD hat BAYER & Co. deshalb aufgefordert, mehr Lehrstellen bereitzustellen.
MedizinerInnen gegen Schein-Innovationen
„Die Pharmaindustrie schlägt in ihrer Preispolitik erbarmungslos zu und betreibt gewaltigen Marketingaufwand. Es ist unsere Aufgabe, gegenzusteuern“, sagt Leonhard Hansen, Leiter der „Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein“. Deshalb verpflichtete die Organisation ihre Mitglieder, höchstens noch zu 30 Prozent Originalpräparate zu verschreiben und ansonsten auf Nachahmerprodukte zurückzugreifen. Zudem veröffentlichte sie eine Aufstellung mit teuren Medikamenten, die lediglich alter Wein in neuen Schläuchen sind. Gegen diese „me-too-Liste“ gingen 17 Pharma-Unternehmen gerichtlich vor. Der Leverkusener Multi trägt die Klage nicht mit, obwohl sich unter den von der Kassenärztlichen Vereinigung inkriminierten Scheininnovationen auch sein als Herz/Kreislauf-Mittel eingesetzter Kalzium-Antagonist BAYMYCARD befindet.
EU gegen BAYER & Co.?
Die österreichische Politikerin Maria Rauch-Kallat hat in ihrer Funktion als Vorsitzende des EU-Rates der GesundheitsministerInnen scharfe Kritik an BAYER & Co. geübt. Sie warf den Pillenproduzenten vor, für die EU-weite Kostenexplosion im Gesundheitssektor verantwortlich zu sein und trat für eine Reduzierung des Medikamenten-Angebotes ein. „Es ist unverständlich, dass es die Solidarsysteme der 25 Mitgliedsstaaten bisher nicht schaffen, gemeinsam gegen die Arzneimittelindustrie aufzutreten“, sagte Rauch-Kallat in der Höhle des Löwen, auf einem Kongress des „Europäischen Verbandes der Arzneihersteller“. „Ihr Vorstoß wurde bei der Konferenz in Athen mit Befremden aufgenommen“, hieß es dann auch in der Faz. Ob den Herstellern künftig beim Europäischen Pharma-Forum, das sich mit den Pillen-Preisen beschäftigt, und anderen Gelegenheiten ein schärferer Wind aus Brüssel entgegenweht, wird die Zukunft zeigen.
CBG schreibt Leserbrief
Die englische Zeitung Economist hat BAYER als positives Beispiel im Ringen um die Reduktion von Kohlendioxid-Emissionen gerühmt. Da die 60- bis 70-prozentige CO2-Drosselung des Konzerns aber mitnichten auf Investitionen in den Umweltschutz zurückgeht, sondern auf Betriebsschließungen, Verkäufe von Unternehmensteilen und ein Outsourcing der Energie-Produktion, hat die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN einen Leserbrief geschrieben, den das Blatt allerdings nicht veröffentlichte.
Oels antwortet Loske
Die Kritik der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) an BAYERs trickreichem Armrechnen in Sachen Kohlendioxid-Ausstoß bewog das grüne Bundestagsmitglied Reinhard Loske, der das Unternehmen wegen der CO2-Senkungen schon mit grünen Weihen versehen hatte, dazu, den Konzern zu einer Stellungnahme aufzufordern. In seinem Antwortschreiben räumte Udo Oels, im Konzern-Vorstand bis vor kurzem noch für Umweltpolitik zuständig, dann auch ein, dass nur die Hälfte der 60- bis 70-prozentigen CO2-Reduzierung auf Umweltschutzmaßnahmen zurückgeht. Wieviel des bei BAYER weniger ausgestoßenen Kohlendioxids auf anderen Klimarechnungen wieder auftaucht, weil der Konzern immer mehr Energie von externen Anbietern bezieht, vermochte Oels nicht zu sagen.
BAYER „rat of the week“
Seit Mitte der 80er Jahre starben Tausende Bluter an AIDS-verseuchten Blutplasma-Produkten von BAYER, weil der Konzern sich aus Profit-Gründen weigerte, die Präparate einer Hitze-Behandlung zu unterziehen. Als die US-Behörden ein solches Verfahren zur Pflicht machten, exportierte der Leverkusener Multi alte Plasma-Chargen, die er keiner solchen Prozedur unterzogen hatte, einfach nach Asien und Südamerika, wo sich dann erneut Menschen infizierten. Für dieses „Kapitalverbrechen“ zeichnete ein US-amerikanischer TV-Sender den Konzern jetzt mit dem wenig schmeichelhaften Titel „rat of the week“ aus.
KAPITAL & ARBEIT
Kansas: 100 Arbeitsplätze weg
Im Rahmen des Rationalisierungsprogramms „project renaissance“ hat BAYER in seinem Pestizidwerk am Standort Kansas 100 der 550 Arbeitsplätze vernichtet.
BIS zum bitteren Ende?
Die BASIS BETRIEBSRÄTE, eine alternative Gewerkschaftsgruppe im Leverkusener BAYER-Werk, zitieren in ihrem September-Flugblatt folgenden Satz aus der Information für BAYER-Führungskräfte: „Bei dem Vorhaben offenbarte Wenning erstmals, wie gut er es versteht, sich bietende Chancen für seine Zwecke zu nutzen. Er entsorgte nicht allein das erlahmte Chemiegeschäft, sondern zugleich 1,5 Milliarden Euro Konzernschulden sowie 40 Prozent an der Servicegesellschaft BIS“. Die Sorgen haben jetzt die Entsorgten. Bei BAYER INDUSTRY SERVICES, an dem BAYERs Chemieabspaltung 40 Prozent der Anteile hält, jagt ein Rationalisierungsprogramm das nächste. Aus dem Unterhalt der Chemieparks und dem Anbieten von Handwerks-, Werksschutz- und Umweltschutzdiensten lässt sich nunmal nicht allzuviel Kapital schlagen. Als neueste Maßnahme schlägt der Leverkusener Multi alle Abteilungen, die direkt Aufgaben für BAYER übernehmen, wieder einzelnen Konzernbereichen zu. So wandert das Postbüro zur Logistik-Sparte CHEMION, das Archiv und der Fortbildungsbereich zu BAYER BUSINESS SERVICES. Die BASIS BETRIEBSRÄTE befürchten Einkommensverluste für die Betroffenen und kritisieren, dass der Leverkusener Multi den Teilgesellschaften kostenträchtige Dienstleistungen aufbürdet, die eigentlich die Holding übernehmen müsste.
SCHERING-MitarbeiterInnen in Angst
Bei der Übernahme von SCHERING kündigte BAYER-Chef Werner Wenning die Vernichtung von 6.000 Arbeitsplätzen an. Er ließ die Beschäftigten aber im Ungewissen darüber, wie das Management sich den Kahlschlag genau vorstellt. Entsprechend verunsichert ist die ehemalige SCHERING-Belegschaft. „Frust und Unmut sind groß. Bei vielen liegen die Nerven blank“, so der Betriebsratsvorsitzende Norbert Deutschmann. Auf einer Betriebsversammlung Ende Juni, an der 2.000 MitarbeiterInnen teilnahmen, forderte er BAYER deshalb auf, endlich Klartext zu sprechen. „Die Mitarbeiter brauchen noch vor den Sommerferien Sicherheit“, forderte er. Aber der Konzern gab sie ihnen nicht. Er schloss noch nicht einmal betriebsbedingte Kündigungen aus.
LANXESS rationalisiert weiter
In jedem Quartal beschließt BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS ein neues Sanierungsprogramm. Das mittlerweile vierte will 50 Millionen Euro einsparen - vor allem bei der Kundenbelieferung und anderen Service-Einheiten. Wenn BAYERs auch für LANXESS gültige „Standortsicherungsvereinbarung“ 2007 ausläuft, soll es in den Bereichen auch zu Arbeitsplatzvernichtung kommen.
LANXESS verkauft Kunststoff-Geschäft
Der Spaltungsprozess von BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS geht munter weiter. Im Mai verkaufte das Unternehmen das Geschäft mit dem Styrol-Kunststoff SAN an BASF. Der Ludwigshafener Konzern übernahm allerdings nur die Produktvorräte, die Lizenzen und die Kundenkartei, nicht aber die Produktionsanlagen und die Beschäftigten, weshalb diese unsicheren Zeiten entgegensehen.
AGFA spaltet sich weiter auf
Die ehemalige BAYER-Tochter AGFA schrumpft immer weiter. Im Jahr 2004 stieß diese die Fotosparte ab, die dann ein Jahr später Pleite ging. Jetzt kündigte die Chefetage eine Aufspaltung: Die Bereiche „Grafik“, „Gesundheit“ und „Materialien“ sollen in Zukunft wie selbstständige Unternehmen agieren. Wie das Beispiel BAYER/LANXESS zeigt, haben solche Operationen nur den einen Zweck, die Sparten leichter abstoßen zu können.
Arbeitsplatzvernichter Nr. 2
In der Hitparade der bundesrepublikanischen Arbeitsplatzvernichter nimmt BAYER mit der im Zuge der SCHERING-Übernahme angekündigten Streichung von 6.000 Jobs den zweiten Rang ein (Stand: Ende Juli). International reicht es damit zu Platz 12.
ERSTE & DRITTE WELT
BAYER in Kuba
BAYER macht auch mit dem kommunistischen Kuba Geschäfte. „Die Kubaner sind im Schnitt das bestausgebildeste Volk Südamerikas“, lobt BAYERs Mann in Havanna, Jürgen Selter. In Bereichen wie „Biotechnologie“ und „medizinische Dienstleistungen“ sieht er das Land bereits als international konkurrenzfähig an. Sollte es nach dem Ende der Castro-Ära zu einer „pragmatischen Öffnung“ kommen, erhofft er sich weitere Wettbewerbsvorteile für den Leverkusener Multi. „Kuba ist ein Zukunftsmarkt“, meint Selter.
Entwicklungshilfe für BAYER & Co.
Seit geraumer Zeit versuchen BAYER & Co., mehr Einfluss auf die Entwicklungshilfe-Politik zu gewinnen. So bestimmten die Konzerne etwa mit, welche Länder hauptsächlich von den Zahlungen profitieren sollten. Die Unternehmen wollen aber auch selber etwas Entwicklungshilfe bekommen. Die „Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft bedauern, dass derzeit nur gerade mal 0,6 Prozent des Entwicklungshilfe-Etats in Programme fließt, an denen die deutsche Wirtschaft beteiligt ist“, meldete die Faz. Zudem forderte die Samariter AG in ihrem Positionspapier, das der Ministerin Heide Wieczorek-Zeul zuging, schon frühzeitig in die Entwicklungsplanungen einbezogen zu werden. „Wir glauben, dass wir als Unternehmen vieles besser machen können als die herkömmliche Entwicklungshilfe, denn sobald unternehmerische Eigenverantwortung im Spiel ist, ist auch der Ehrgeiz da, nachhaltig erfolgreich zu wirtschaften“, sagte der entwicklungspolitische Sprecher der deutschen Wirtschaft, Karl Starzacher.
Weltbank in Diensten von BAYER & Co.
BAYER & Co. haben es geschafft, die Weltbank in den Dienst zu nehmen, um den Globus mit der grünen Gentechnik zu beglücken. Die Finanzinstitution leistet Entwicklungshilfe für genmanipulierte Nutzpflanzen und
hat acht afrikanische Länder dazu gedungen, Baumwolle und andere Laborfrüchte von BAYER & Co. versuchsweise anzubauen.
Merkel gegen Kinderarbeit
Am 12. Juni, dem Welttag gegen Kinderarbeit, setzte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel als beherzte Streiterin für die Rechte von Kindern in Szene. Die Bundesregierung arbeite auf „die weltweite Ächtung und effektive Bekämpfung von Kinderarbeit, nicht nur in ihren schlimmsten Formen, wie Prostitution oder militärischer Einsatz, sondern auch der ausbeuterischen Beschäftigung von Kindern in Wirtschaftsbetrieben“ hin, bekundete sie. Abgesehen von solchen Sonntagsreden hat Angela Merkel allerdings bisher kein Engagement in der Sache gezeigt und etwa dem BAYER-Konzern bzw. dessen indischer Saatguttochter PROAGRO die Leviten gelesen, deren Zulieferer in der letzten Pflanzsaison 500 KinderarbeiterInnen auf ihren Feldern beschäftigten.
Indien verschärft Kinderarbeitsverbot
Indien hat das Kinderarbeitsverbot verschärft. Das Land stellt fortan nicht nicht nur die Beschäftigung von Mädchen und Jungen an gefährlichen Arbeitsplätzen unter Strafe, sondern auch das Vergeben von Jobs in Restaurants oder im Haushalt an Minderjährige. Ob die Regierung allerdings in der Lage sein wird, dem Gesetzeswerk Geltung zu verschaffen, daran zweifeln ExpertInnen. Aufgrund der extemen Armut bleibt vielen Familien nämlich keine andere Wahl, als ihre Sprößlinge arbeiten zu lassen. So dürfte auch die Ausbeutung von Kindern bei den Zulieferern von BAYERs indischer Saatguttochter PROAGRO bis auf weiteres ungeahndet bleiben.
Weiterer Zulieferer für PROAGRO
BAYERs indische Saatguttochter PROAGRO bezieht jetzt nicht nur von Zulieferern in Andra Pradesh, sondern auch von solchen im Bundesstaat Karnataka Saatgut. Ob damit auch die Zahl der bei den Vertraghändlern beschäftigten Kinder steigt, die sich in der vorherigen Pflanzsaison auf 500 belief, bleibt abzuwarten.
GTZ entsorgt BAYER-Müll
Großzügig von internationalen Organisationen gefördert, haben die Agromultis „als Beitrag zur Entwicklungshilfe“ Millionen Tonnen Agrochemikalien an Länder der „Dritten Welt“ geliefert - weit mehr, als die Staaten brauchen konnten. So lagern jetzt weltweit ca. 500.000 Tonnen Alt-Pestizide ungenügend gesichert in irgendwelchen Erdkuhlen oder Verschlägen. Um die Entsorgung der Altlasten von BAYER & Co. kümmern sich wiederum EntwicklungshelferInnen. Allein die bundesdeutsche „Gesellschaft für technische Zusammenarbeit“ (GTZ) hat seit Anfang der 90er Jahre 4.000 Tonnen Chemie in BAYERs homeland zurückgebracht und Sondermüll-Verbrennungsanlagen zugeführt.
POLITIK & EINFLUSS
BDI will andere EU-Politik
Der „Bundesverband der Deutschen Industrie“ (BDI) hat Angela Merkel für die anstehende EU-Ratspräsidentschaft der Bundesrepublik schon mal Hausaufgaben aufgegeben. Nach Informationen von www.german-foreign-policy.com verlangen BAYER & Co. eine EU-Finanzreform, welche die Interessen der bundesdeutschen Konzerne noch besser berücksichtigt. Die Konzerne fordern unter anderem eine Kürzung der Subventionen für die Landwirtschaft. Ihnen zufolge belasten diese den EU-Haushalt über die Maßen und erschweren überdies den Handel mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten, denen an einer Öffnung des europäischen Agrarmarktes gelegen ist. Zudem tritt der Unternehmensverband für eine rasche Einbindung von Ländern wie Bulgarien, Rumänien oder der Türkei ein. Die Multis haben ein „hohes Interesse daran“, das „wirtschaftliche Potenzial der Beziehungen mit allen Nachbarländern (...) weiter zu erschließen“, heißt es in dem BDI-Papier. Auch höhere EU-Investitionen in Bildung und industrie-nahe Forschung mahnen die Kapitalgesellschaften an.
Diplomatische Wirtschaftsförderung
Für Außenminister Walter Steinmeier gehört die Außenwirtschaftsförderung zu den „Kernaufgaben der deutschen Außenpolitik“. Im Auswärtigen Amt kommt der Wirtschaftsabteilung die besondere Aufgabe zu, „der deutschen Wirtschaft den Weg auf die Auslandsmärkte“ zu erleichtern. Zu diesem Behufe brachte sie nach Informationen von www.german-foreign-policy.com am 5. September 2006 zum „Wirtschaftstag“ über 200 bundesdeutsche BotschafterInnen mit 800 VertreterInnen von BAYER & Co. zusammen. In sechs Regionalforen konnten sich die ManagerInnen an dem Tag darüber informieren, wie die Exportchancen in Asien, Afrika, den GUS-Staaten und anderswo so stehen.
Industriefreundliches Gentechnik-Gesetz
Die geplante Veränderung des Gentechnikgesetzes geschieht ganz im Sinne der Gen-Giganten. „Es werden, insbesondere bei der Haftungsregelung, Präzisierungen vorgenommen, mit denen den Befürchtungen der Industrie vor einer nicht gewollten ausweitenden Auslegung Rechnung getragen werden soll“, erklärte die Ministeriumssprecherin Marie-Luise Dittmar dem Internet-Magazin telepolis in aller Offenheit. Nach Protesten der Gentech-Industrie zogen die amtlichen VerbraucherschützerInnen das Konzept für einen von BAYER & Co. getragenen Haftungsfonds zurück, der für Schäden durch Auskreuzungen von Gentech-Pflanzen auf konventionell angebaute aufkommt. An seine Stelle tritt jetzt eine Vereinbarung der Unternehmen mit den Bauernverbänden über eventuelle Ausgleichszahlungen. Zudem gelang es den Konzernen, den justiziablen Grenzwert für Verunreinigungen auf 0,9 Prozent heraufzusetzen. LandwirtInnen nimmt das die Möglichkeit, ihre Produkte als „gentechnikfrei“ zu deklarieren, weil der Lebensmittelhandel dafür höchstens Genspuren in einer Größenordnung von 0,1 bis 0,3 Prozent akzeptiert. Die ARBEITSGEMEINSCHAFT BÄUERLICHE LANDWIRTSCHAFT (ABL) kritisierte die Pläne deshalb scharf: „0,9 Prozent sind nicht akzeptabel, da für Bäuerinnen und Bauern Vermarktungsschäden bereits unter 0,9 Prozent gegeben sind“.
BAYER macht Gentech-Gesetz
In den USA haben einige Gemeinden den Anbau gentechnisch manipulierter Pflanzen untersagt. Das konnten BAYER und die anderen Gentech-Multis nicht auf sich sitzen lassen. Sie brachten einen Gesetzesvorschlag auf den Weg, der Städten und Bezirken solch ein eigenmächtiges Handeln verbietet. Zwölf US-Bundesstaaten nahmen ihn an. Andere lehnten ihn nach Protesten von FarmerInnen, die eine Verunreinigung ihrer Ernten durch Gen-Pflanzen befürchten, ab.
Molnar im ACC-Vorstand
Der Chef von BAYER/USA, Attila Molnar, gehört seit diesem Jahr dem 10-köpfigen Vorstand des „American Chemical Council“ an, dem US-amerikanischen Gegenstück zum bundesdeutschen Lobbyclub „Verband der Chemischen Industrie“.
Schmoldt will stillhalten
Der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE-Vorsitzende und BAYER-Aufsichtsrat Hubertus Schmoldt hat Kritik an dem von den Gewerkschaften geplanten Aktionstag gegen den schwarz-roten Sozialabbau am 21. Oktober geübt. Es sei illusorisch zu glauben, die Gewerkschaften könnten die große Koalition durch Proteste aus den Angeln heben, gibt die Faz seine Worte wieder. Zudem warf er der IG METALL und VERDI vor, Politik zu Gunsten einer rot-roten Koalition zu machen und andere gesellschaftliche Gruppen als Bündnispartner gewinnen zu wollen. „Von der heimlichen Version einer anderen Politik‚ bis zum Verlust der Politikfähigkeit ist es ein kurzer Weg“, so Schmoldt. Mit anderen Worten: Politikfähig ist nur der, der dasselbe will wie das Kapital. Der IG BCE-Chef plädierte einmal mehr für Abwarten und Tee trinken. An der Rente mit 67 und der Lockerung des Kündigungsschutzes gäbe es nichts mehr zu rütteln, allenfalls 2008 oder 2010 könnte die Gewerkschaft die Maßnahmen nochmal auf den Prüfstand stellen.
Schmoldt gegen Mindestlöhne
Die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE macht ihrem Ruf, die konservativste Gewerkschaft der Bundesrepublik zu sein, mal wieder alle Ehre. Als einzige Arbeitnehmervertretung stimmte sie im DGB-Bundesvorstand gegen ein Mindestlohn-Konzept. Der IG BCE-Vorsitzender und BAYER-Aufsichtsrat Hubertus Schmoldt warnte, ein Mindestlohn würde zu Betriebsverlagerungen sowie zur Zunahme von Schwarzarbeit und staatlichem Einfluss führen und übernahm damit die Argumente des Unternehmerlagers.
Neue BDI-Forschungsinitiative
Der „Bundesverband der Deutschen Industrie“ (BDI) hat die Initiative „Innovationsstrategien und Wissensmanagement“ ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Vereinigung sollen Unternehmen künftig miteinander kooperieren und so nationale Champions bilden, um den Standort Deutschland gegen Konkurrenz aus dem Ausland zu verteidigen. Als ein Beispiel für dieses Vorgehen nannte Utz Claassen von ENBW als Vorsitzender des Innovationsvereins die Arbeitsgemeinschaft von BAYER, BOEHRINGER-INGELHEIM, MERCK und MERZ zur Erforschung von Krankheiten des Zentralen Nervensystems. Zu den „Innovationsstrategien“ des BDI-Ablegers gehört es dabei auch, den Emissionshandel mit Kohlendioxid abzulehnen und für eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten einzutreten.
Neue Schavan-Forschungsinitiative
In Berlin schießen die Forschungsallianzen zwischen Politik und Wirtschaft aus dem Boden, wobei natürlich gilt: „Keine Feier ohne BAYER“. BAYER-Chef Werner Wenning gehört Angela Merkels Beraterkreis „Rat für Innovation und Wachstum“ an (Ticker 2/06), und Helga Rübsamen-Waigmann, die Leiterin von BAYERs Antiinfektiva-Forschung, sitzt in der „Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft“. Dieses auf Initiative von Bundesforschungsministerin Andrea Schavan entstandene BeraterInnengremium will für BAYER & Co. den Umschlag von wissenschaftlichen Erkenntnissen in vermarktbare Produkte beschleunigen.
Ökosteuerreform
Ziel der Ökosteuer ist es, über den Strompreis die Gewinnung erneuerbarer Energien zu fördern. Allerdings kostet die Regelung die größten Stromfresser wie die Chemieindustrie dank ihres Extremlobbyismus‘ am wenigsten. Ab Juni 2006 können BAYER & Co. noch mehr sparen. Die rot-schwarze Koalition beschloss eine Entlastung in Höhe von 240 Millionen Euro, die sie künftig bei den Privathaushalten eintreiben will.
Günstiger Emissionshandel
Im Jahr 2005 bliesen die BAYER-Werke 3,9 Millionen Tonnen des klimaschädigenden Kohlendioxids in die Luft. In Technologie zur Reduktion des Ausstoßes braucht der Konzern künftig aber nicht zu investieren. Bundesumweltminister Sigmar Gabriel hat den Unternehmen im Rahmen des Emissionshandels nämlich großzügige Verschmutzungsrechte eingeräumt. Die bundesdeutsche Wirtschaft, die im Jahr 2005 insgesamt 474 Tonnen CO2 produziert hat, muss ihre Emissionen bis 2007 nur um zwei Millionen Tonnen senken und im Zeitraum von 2008 bis 2012 um 15 Millionen Tonnen. Zudem begünstigt der Nationale Allokationsplan die Industrie gegenüber den Energieerzeugern. Die rot-schwarze Koalition schreibt BAYER & Co. nur eine Kohlendioxid-Minderung von 1,25 Prozent vor. Darüber hinaus weigerte sich Gabriel, die Lizenzen zum CO2-Ausstoß zu versteigern, was die Preise für die Umweltverschmutzung in die Höhe getrieben hätte.
Merkel reduziert Reduktionsziele
Der rot-grüne Umweltminister Jürgen Trittin wollte den Kohlendioxid-Ausstoß in dem Zeitraum von 1990 bis 2020 um 40 Prozent senken, sofern die anderen EU-Länder ihre Emissionen um 30 Prozent reduzieren. Von diesem Ziel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel sich nun verabschiedet, weil BAYER & Co. dann beim Emissionshandel mehr für Verschmutzungsrechte ausgeben müssten. Auch eine EU-weite Förderung der Windenergie nach bundesdeutschen Vorbild will sie während ihrer EU-Ratspräsidentschaft verhindern.
Reach: USA & Co. machen Druck
Obwohl der Extremlobbyismus von BAYER & Co. die „Reach“ genannte EU-Regelung, die den Konzernen die Untersuchung von Chemikalien auf ihre gesundheitsgefährdende Wirkung hin vorschreibt, bis zur Unkenntlichkeit abschwächte, lassen die Unternehmen nicht locker. Was ihnen in Brüssel nicht vollständig gelang, soll jetzt via Washington, Rio de Janeiro und Tokio zum Erfolg führen. Die Regierungen der USA, Brasiliens, Japans sowie neun anderer Staaten intervenierten in Sachen „Reach“ bei der Europäischen Union. Sie sehen in dem Chemikaliengesetz eine Behinderung des freien Welthandels und drohen mit einer Klage bei der Welthandelsorganisation WTO. Die Brüsseler JuristInnen schätzen die Erfolgsaussichten eines solchen Vorgehens allerdings als gering ein.
CDUler bei BAYER CROPSCIENCE
Im Juli 2006 besuchten der CDU-Bundestagsabgeordnete Jochen-Konrad Fromme und der CDU-Kreistagsabgeordnete Manfred Koch das Wolfenbütteler Werk von BAYER CROPSCIENCE.
Uhlenberg bei BAYER
Umweltschutz ist für den nordrhein-westfälischen Umweltminister Eckhard Uhlenberg nur das, was BAYER & Co. nutzt. Deshalb ließ der CDU-Politiker es sich auch nicht nehmen, ein Grußwort zur Eröffnung des Symposions „Impulse 2006 - Zukunftsfähiger Umweltschutz mit Tradition“ zu sprechen, das BAYER gemeinsam mit dem Wupperverband zum unfeierlichen Anlass von „40 Jahre Gemeinschaftsklärwerk Leverkusen-Bürrig“ ausrichtete. Eigentlich sollte die Anlage ein so hohes Alter nämlich gar nicht erreichen, da industrielles Abwasser nach einer ganz anderen Aufbereitungstechnologie verlangt als kommunales. Aber dem Leverkusener Multi gelang es durch verschiedene politische Interventionen bei der rot-grünen Vorgängerregierung, eine Ausnahmegenehmigung bis 2011 zu erhalten.
BAYER dialogisiert mit NRW-Regierung
Der nordrhein-westfälische Umweltminister Eckhard Uhlenberg verfolgt einen Schmusekurs gegenüber BAYER & Co. und hat zu diesem Behufe einen „Dialog Wirtschaft und Umwelt“ ins Leben gerufen, bei dem BAYER ein gehöriges Wort mitredet. Den Arbeitskreis „Gewässerschutz“, der gemeinsam mit denen zu Immissionsschutz, Abfall/Bodenschutz und Ressourceneffizienz künftig wohl einen Gutteil der Landesumweltpolitik bestimmen wird, leitet nämlich der BAYER-Mann Frank Andreas Schendel. Uhlenberg machte damit den Bock zum Gärtner, denn allein das Leverkusener Werk verbraucht im Jahr soviel sauberes Wasser wie die Stadt Köln, und wieviel schmutziges Wasser es produziert, verschweigt die Zentrale beharrlich.
NRW dialogisiert mit dem Bund
Die in Umweltfragen eng mit den Konzernen kooperierende NRW-Landesregierung (s. o.) macht auf Bundesebene Druck in Sachen „Gentechnikgesetz“. Das Bundesland kündigte ein Bundesratsinitiative an, um laschere Haftungsregelungen durchzusetzen, wenn Gentechpflanzen auf Felder mit konventionell angebauten Ackerfrüchten übergreifen. Nach Ansicht des „Innovations“ministers Andreas Pinkwart (FDP) schreckt die geplante Lösung vor dem Einstieg in die grüne Gentechnik ab und schadet so dem Forschungsstandort Nordrhein-Westfalen.
BAYER & Co. starten Biotech-Initiative
BAYER & Co. wollen Nordrhein-Westfalen durch eine konzertierte Aktion von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zu einem führenden Biotech-Standort ausbauen. Auf einem Treffen, zu dem der „Verband der Chemischen Industrie“, das Innovationsministerium und verschiedene Biotech-Organisationen des Landes eingeladen hatten, beschlossen die TeilnehmerInnen die Zusammenführung aller Biotechnologie-Aktivitäten NRWs zu einem „Cluster“. Das Sagen bei dem Verbund haben BAYER, DEGUSSA und HENKEL. Diese Unternehmen haben die Aufgabe übernommen, die Forschungsschwerpunkte des „Clusters“ festzulegen, und zwar unter der Maßgabe, möglichst viel Fördergeld aus Brüssel und Berlin abgreifen zu können. Innovationsminister Andreas Pinkwart als Mitveranstalter äußerte sich zufrieden über das Meeting. „Kreativität freisetzen und Kräfte bündeln - dieser Ansatz unserer Innovationspolitik spiegelt sich hier beispielhaft wider“, so der FDP-Politiker.
Winnacker EU-Forschungsratschef
In der Forschungsförderung stellt die EU auf Selbstbedienung um. Sie machte den BAYER-Aufsichtsrat und Gentech-Lobbyisten Ernst-Ludwig Winnacker zum Generalsekretär des neu geschaffenen EU-Forschungsrats, der mit einem Etat von einer Milliarde Euro Projekte subventionieren kann.
BAYER & Co. wollen billigeren Strom
BAYER & Co. leiden unter den hohen Energiepreisen. Nach Angaben des „Verbandes der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft“ (VIK) ist der Preis für eine Megawattstunde seit Anfang 2005 um die Hälfte auf über 50 Euro gestiegen. VIK-Geschäftsführer Alfred Richmann warf dem aus RWE, EON, VATTENFALL und ENBW bestehenden Oligopol vor, die Ressource künstlich zu verknappen. Da es auf dem Markt keine freie Preisbildung gibt, forderte er die Bundesregierung auf, einen Strompool einzurichten, aus dem sich die energie-intensiven Branchen zu günstigeren Konditionen versorgen können.
PROPAGANDA & MEDIEN
PR-Offensive von BAYER & Co.
Die Sorge um ein gutes Image nimmt bei BAYER immer größere Ausmaße an. So präsentierte der Konzern seinen AktionärInnen auf der diesjährigen Hauptversammlung einen Film über die von dem Unternehmen in Zusammenarbeit mit der UN angeblich weltweit verbreiteten Wohltaten. Die homepage des Leverkusener Multis in Thailand schmückt sogar ein Porträt einer „engagierten Vertreterin des Umweltschutzes“, der WORLD WILDLIFE FUND (WWF)-Mitarbeiterin Tatirose Vijitpan, was die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) zu einem Offenen Brief an die Organisation veranlasste (SWB 3/06). Hinter solchen Aktionen steckt eine überlegte Strategie. „Für Unternehmen, die Probleme haben, spielt der Kontakt zu Nichtregierungsorganisationen eine Schlüsselrolle“, sagte Richard Edelman dem Spiegel. Sein PR-Unternehmen EDELMAN und die Mitbewerber können sich über mangelnde Aufträge nicht beklagen. So steht die Agentur BURSTON-MARSTELLER, die in der Vergangenheit bereits daran arbeitete, Nicolae Ceausescu, der argentinischen Militärjunta, dem für Bhopal verantwortlichen Unternehmen UNION CARBIDE und dem Konzern EXXON nach dem Tanker-Unglück mit der „EXXON-VALDEZ“ ein besseres Image zu verschaffen, in Diensten des Gentech-Lobbyclubs „EuropaBio“, dem auch BAYER angehört (siehe auch Ticker 4/99). Zudem versorgen EDELMAN und Konsorten die Medien mit Artikeln, die alles andere als unabhängig und überparteilich sind. Nach Schätzungen von ExpertInnen stammen bereits 40 Prozent des Inhalts einer Tageszeitung von PR-Agenturen oder ÖffentlichkeitarbeiterInnen von BAYER & Co. „Statt Propaganda aufzudecken, sind Medien der Kanal für Propaganda geworden“, zitiert der Spiegel John Stauber von der Initiative PR WATCH.
Umweltpreis von BAYER und UN
BAYERs Greenwashing-Aktivitäten im Rahmen der Kooperation mit der UN-Umweltorganisation UNEP treiben immer neue Blüten. In Malaysia verlieh der Konzern gemeinsam mit der UNEP einen Umweltpreis.
Malwettbewerb von BAYER und UN
Nicht einmal Afrika verschont der Leverkusener Multi mit seinen Greenwashing-Aktivitäten. In Kenia veranstaltete er in image-fördernder Kooperation mit der UN-Umweltorganisation UNEP einen Malwettbewerb für Kinder.
VFA kooperiert mit der Bunten
Die Pharmariesen begründen die hohen Arzneimittelpreise gern mit ihren hohen Forschungsaufwändungen, was nicht einmal die halbe Wahrheit ist, da die Konzerne die Vermarktungskosten mit hineinrechnen und oft Universitäten die Grundlagenarbeit machen lassen. Um die PharmakologInnen von BAYER & Co. aber image-fördernd als ebenso heroische wie selbstlose WissenschaftlerInnen in Szene zu setzen, veranstaltet der von BAYER gegründete „Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller“ (VFA) zusammen mit der Bunten einen Fotowettbewerb zum Thema „Bilder der Forschung“.
Unlautere LEVITRA-Werbung
- 1
BAYER lässt nichts unversucht, sein nicht den Umsatzerwartungen entsprechendes Potenzmittel LEVITRA an den Mann zu bringen. In Brasilien hat der Konzern es während der öffentlichen Übertragungen von der Fußball-Weltmeisterschaft umsonst an Zuschauer verteilt. Da das Präparat alles andere als harmlos ist und Gesundheitsstörungen wie Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme und Augenschäden bis hin zur Erblindung verursachen kann, untersagten die Gesundheitsbehörden die Aktion und leiteten ein Verfahren wg. unlauterer Werbung ein. Dem Leverkusener Pharmariesen droht nun eine Strafe von bis zu 600.000 Euro.
Unlautere LEVITRA-Werbung
- 2
In Australien versucht der Leverkusener Multi die Marktchancen seines Potenzmittels LEVITRA durch eine „Geld zurück“-Garantie, die MedizinerInnen den Patienten zusammen mit dem Rezept aushändigen, zu verbessern. GesundheitsexpertInnen haben dieses Vorgehen umgehend als „unethisch“ kritisiert, weil BAYER damit den Eindruck erweckt, bei dem Präparat handele es sich um einen ganz normalen Konsumartikel statt um eine Arznei mit Risiken und Nebenwirkungen.
Unlautere LEVITRA-Werbung
- 3
BAYER bereitet die Markteinführung seines Potenzmittels LEVITRA in China vor und hat vorsorglich schon einmal die Hälfte der dortigen Männer zu potenziellen Patienten erklärt: Nach einer von dem Pharmariesen vorgestellten „Studie“ leiden angeblich bis zu 50 Prozent der Chinesen an einer „erektilen Dysfunktion“.
BAYER & Co. kaufen Entlastungsstudie
Die Literatur zur Gefährlichkeit Polychlorierter Biphenyle (PCB) füllt ganze Bibliotheken. Die Chemikalie kann WissenschaftlerInnen zufolge das Nervensystem, die Immunabwehr, Leber und Nieren schädigen sowie zu Unfruchtbarkeit, Missbildungen bei Neugeborenen und Hirnschädigungen bei Kindern führen. Da stieß das Urteil der Fachzeitschrift Arch Toxicol, die entsprechenden Studien zu Entwicklungsstörungen bei Minderjährigen wiesen methodische Mängel auf, in der Fachwelt auf ziemliche Verwunderung. Diese legte sich aber schnell, denn unter dem Artikel hieß es „Wir danken Eurochlor, Brüssel, für die finanzielle Unterstützung“. Der Chemieverband, dem unter anderem auch BAYER angehört, hatte sich also wieder mal eine Meinung gekauft. Besonders pikant: Die Mitverfasserin Beate Ulbrich steht als Giftexpertin in Diensten des „Bundesinstituts für Risikobewertung“.
Makrolon als Marke
BAYER unternimmt verstärkte Anstrengungen, seinen Kunststoff Makrolon zu einer Marke wie etwa „ASPIRIN“ aufzubauen. Deshalb beorderte der Konzern den bisher für die Verkaufspflege des „Tausendsassas“ zuständigen Werbeprofi Jürgen Hohmann in die „Plaste & Elaste“-Abteilung. Auf UVEX-Sportbrillen und auf einigen CDs und DVDs prangt dank seinen Bemühungen jetzt schon ein Makrolon-Siegel. Aber Großabnehmer wie LEGO wollen nicht „untervermieten“ und dulden keine Marke neben sich, weshalb sich Hohmanns Geschäft als schwierig erweisen dürfte.
BAYER übernimmt SCHERING-Stiftung
Mit der Übernahme von SCHERING fiel auch die gleichnamige Stiftung in den Besitz von BAYER, die vor allem KünstlerInnen und junge WissenschaftlerInnen aus den Bereichen „Medizin“ und „Biologie“ gefördert hat. Der Leverkusener Multi kündigte an, die nicht nur uneigennützige Nachwuchspflege in die PR-Aktivitäten des Konzerns zu integrieren und erhöhte zudem das Kapital der Stiftung, die in Zukunft auch das Museum SCHERINGs und Teile der Kunstsammlung des Berliner Pharmariesen betreut, um 10 Millionen Euro.
„BayRad“ läuft weiter
BAYERs Gesundheitsaktionen dienen vornehmlich dem Zweck, Akteure des Gesundheitswesens enger an den Konzern zu binden. Da das bei der „BayRad“-Initiative offenbar gut geklappt hat, setzt der Konzern die 2005 gemeinsam mit der „Deutschen Herzstiftung“ und einigen Krankenkassen ins Leben gerufene Unternehmung, die zum gesundheitsfördernden In-die-Pedale-treten animieren will, auch 2006 fort.
BAYER unterstützt ApfelanbauerInnen
In den USA sponsort BAYER das Jahrestreffen der ApfelanbauerInnen - damit sie auch morgen noch kräftig in BAYER-Gifte beißen können!
BAYER unterstützt ErdnussfarmerInnen
Der Leverkusener Multi tritt als Sponsor des Jahrestreffens der US-amerikanischen ErdnussfarmerInnen auf.
BAYER macht Schule
Der Leverkusener Multi arbeitet seit Jahren beharrlich daran, die naturwissenschaftlichen Fächer in den Schulen zu stärken, um sich geeigneten Nachwuchs heranzuzüchten und Gentechnik & Co. mehr Akzeptanz zu verschaffen. Jüngst hat der Konzern in den USA wieder zwei Initiativen dieser Art gestartet.
DRUGS & PILLS
Nr. 1 in Deutschland
Mit der Übernahme des SCHERING-Konzerns ist BAYER zum größten Pharma-Unternehmen der Bundesrepublik geworden.
LEUKINE floppt bei Morbus Crohn
Den vom jetzt zu BAYER gehörigen SCHERING-Konzern hergestellten Wachstumsfaktor LEUKINE mit dem Wirkstoff Sargramostim verwenden MedizinerInnen in der Chemotherapie von älteren Leukämie-PatientInnen, um die Gefahr von Infektionen zu reduzieren. Der Pharmamulti wollte das Präparat jedoch auch zur Behandlung der Darmkrankheit Morbus Crohn einsetzen, es konnte aber in der Phase III der klinischen Tests keine überzeugenden Resultate erbringen.
Sehnenschäden durch CIPROBAY
BAYERs CIPROBAY und andere Antibiotika auf Fluorchinolon-Basis können Sehnenschäden verursachen. In dem Zeitraum von 1997 bis 2005 meldeten MedizinerInnen der US-Gesundheitsbehörde FDA 262 Fälle von Sehnenrissen. Die Gesundheitsinitiative PUBLIC CITIZEN hatte schon früher auf Risiken und Nebenwirkungen dieser Art aufmerksam gemacht, woraufhin BAYER & Co. entsprechende Hinweise auf den Packungen aufbringen mussten. Da infolge der zunehmenden Verbreitung der Antibiotika die Schadensmeldungen zunehmen, forderte PUBLIC CITIZEN die FDA in einer Petition auf, so genannte „black-box“-Warnungen - Warnungen der höchsten Dringlichkeitsstufe - auszusprechen.
ASPIRIN COMPLEX zu komplex
Der Markt mit freiverkäuflichen Arzneien boomt. Allein von BAYERs als Grippemittel vermarktetem ASPIRIN COMPLEX gehen jährlich 3,7 Millionen Packungen über den Ladentisch. Der Pharmakologe Gerd Glaeske hält die darin enthaltenen Substanzen Ephedrin und Acetylsalicylsäure jedoch nicht für geeignet, auf ein Krankheitsymptom wie Schnupfen einzuwirken.
KOGENATE gestreckt
Das gentechnisch hergestellte Bluterpräparat KOGENATE ist das umsatzstärkste Pharma-Produkt BAYERs. Deshalb baut der Konzern schon einmal für die Zeit vor, da es nicht mehr patentgeschützt ist und ergo auch nicht mehr so hochpreisig vermarktet werden kann. Er testet gerade eine länger wirksame Version, welche für die Bluter die Zahl der Infusionen pro Woche verringert. Erhält der Pharmariese dafür eine Zulassung, geht das Patentspiel wieder von vorn los.
Bittere Korruptionspillen
Im Pillengeschäft von BAYER & Co. läuft es immer noch wie geschmiert. Dabei bedienen sich die Konzerne vielfältiger Methoden zur medizinischen Landschaftspflege. So ist in den Honoraren, die sie ÄrztInnen für Anwendungsbeobachtungen neuer Arzneien zahlen, oftmals schon ein Betrag für die spätere Verordnung enthalten. Zudem müssen die MedizinerInnen, denen die Pillen-Produzenten in Krankenhäusern halbe Stellen finanzieren, ihren Sponsor bei der Aufstellung der Krankenhaus-Arzneimittelliste bedenken. Auch die Entlohnung für Vorträge und Beratung - in den USA bis zu 2000 Dollar am Tag - versteht sich mehr als Investition denn als Aufwandsentschädigung.
Bitterteure Pillen
Die Arzneimittelausgaben der Krankenkassen erreichten im Jahr 2005 einen neuen Höchststand. Sie beliefen sich auf 24,6 Milliarden Euro und stiegen damit gegenüber dem Vorjahr um 17,2 Prozent. BAYER & Co. gelingt es durch medizinische Landschaftspflege immer wieder, MedizinerInnen zum Verschreiben teurer Originalpräparate zu veranlassen, obwohl es billigere Alternativen mit gleicher pharmazeutischer Wirkung gibt. Nach einer Berechnung des Bremer Professors Gerd Glaeske kostet allein das die Kassen bis zu drei Milliarden Euro. Auch zucken die ÄrztInnen nach Ansicht des „Bundesverbandes der Betriebskrankenkassen“ zu oft den Rezeptblock; eine „nicht nachvollziehbare Mengenausweitung“ beobachtete der Verband. Darüber hinaus vergrößert die Absenkung des Zwangsrabattes, den die Konzerne AOK & Co. auf ihre Pillen gewähren müssen, die finanzielle Belastung der Krankenkassen. Diese angespannte Lage hat viele von ihnen bereits dazu bewogen, ihre Beiträge zu erhöhen, obwohl das neue Arzneimittel-Spargesetz (siehe Ticker 1/06) ihre Pillenausgaben im laufenden Jahr um 1,8 Prozent gesenkt hat.
Gekaufte WissenschaftlerInnen
In der Vergangenheit haben medizinische Fachzeitschriften immer wieder Artikel von WissenschaftlerInnen abgedruckt, deren Urteil über Arzneien von ihren Verbindungen zu den Herstellerfirmen getrübt waren. Als Reaktion darauf haben die Journale Statuten erlassen, nach denen die ForscherInnen verpflichtet sind, ihre Beziehungen zur Industrie offen zu legen. Aber die ExpertInnen schweigen sich trotzdem lieber aus. So veröffentlichte ein Team um Dr. Tobias Kurth im Journal of the American Medical Association eine Studie zum Zusammenhang von Migräne und Herzinfarkthäufigkeit bei Frauen, ohne anzugeben, dass die Mitglieder schon in Diensten von Firmen wie BAYER, MCNEIL oder WYETH standen, die als Anbieter von Kopfschmerz- oder Herz/Kreislaufmitteln von der Untersuchung profitieren könnten.
IG FARBEN & HEUTE
Rückgabe von Hagemanns „Kirchner“
Die jüdische Familie Hess schaffte 1933 ihre umfangreiche Gemäldesammlung in die Schweiz, darunter auch das Bild „Straßenszene, Berlin“ von Ernst-Ludwig Kirchner, und emigrierte später. Der Maler stand in Kontakt mit dem sich als Kunstsammler betätigenden IG-FARBEN-Manager Carl Hagemann und wies diesen auf die Transaktion hin. „Wahrscheinlich gehören die Bilder jüd. Leuten, die wegmüssen“, schrieb der Künstler Hagemann 1936. Dieser nahm den Einkauftip dankbar an und erstand die „Straßenszene“ für 3.000 Reichsmark. Nach seinem Tod landete es über einige Umwege im Berliner „Brücke-Museum“. In diesem Jahr forderten die Erben von Alfred Hess das Gemälde zurück, weil der Verkauf nicht freiwillig geschah. Der Senat willigte zähneknirschend ein und schlug das Angebot, es für 15 Millionen Euro zurückzukaufen, aus. Er hatte auch keine andere Möglichkeit. Das „Gesetz zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz“ hat nämlich die Beweislast umgekehrt. Es verlangt von den NeubesitzerInnen einen Nachweis darüber, dass die damals gezahlte Summe angemessen war und wirklich in den Händen des Verkäufers gelandet ist - und diesen konnte die Stadt Berlin nicht erbringen. Trotzdem brach ein Sturm der Entrüstung über die Rückgabe los. „Es werde gezielt Raubkunst ausfindig gemacht“, tobte etwa Martin Roth, der Leiter der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Die Zeit hingegen mahnte zur Besonnenheit und riet zum Rückkauf: „Der Staat müsste nur die nötige Summe aufbringen. Und auch die Nachfolger der IG FARBEN dürften sich gern an dieser Form der aktiven Vergangenheitsbewältigung beteiligen“.
GENE & KLONE
Gen-Gau in den USA
BAYERs gentechnisch manipulierter Reis LL 601 hat konventionelle Sorten verunreinigt. Wie das gegen das Antiunkrautmittel LIBERTY LINK resistente und in den USA nicht zugelassene Produkt in den Reis gelangen konnte, ist bislang ungeklärt, da BAYER behauptet, Freisetzungsversuche bereits 2001 beendet zu haben. Der Gen-GAU hat Japan sofort zu einem Einfuhrstopp bewogen. Auch die EU ließ vorerst keinen US-amerikanischen Langkorn-Reis mehr über die Grenzen und will von den Exporteuren künftig ein Unbedenklichkeitszertifikat verlangen. Da der Reispreis sofort in den Keller sank und Absatzmärkte wegzubrechen drohen, haben US-amerikanische LandwirtInnen den Leverkusener Multi auf Schadensersatz verklagt.
LL-62-Reis in Kanada zugelassen
BAYER hat für seinen umstrittenen Genreis LL 62, der die selbe Herbizid-Resistenz besitzt wie der in den USA auf konventionelle Sorten übergesprungene LL 601, in Kanada eine Importgenehmigung erhalten. In Brasilien laufen derzeit Freisetzungsversuche, nach GREENPEACE-Informationen will der Leverkusener Multi auch dort eine Anbau- oder Einfuhrgenehmigung beantragen.
LL-Baumwolle in Australien?
Der Leverkusener Multi hat in Australien einen Antrag auf Zulassung einer Baumwoll-Art beantragt, die gegen das Herbizid LIBERTY LINK resistent ist. Die Regionen im Norden des Landes haben sich gegen eine Genehmigung ausgesprochen, da sie eine Verunreinigung herkömmlicher Ackerpflanzen befürchten. Die Zentralregierung signalisierte hingegen Zustimmung zum BAYER-Antrag.
Neuer Gentech-Multi
Unter Federführung des SAP-Gründers Dietmar Hopp entsteht aus AXARON BIOSCIENCE und LION BIOSCIENCE der Gentech-Multi SYGNIS, an dem auch BAYER beteiligt ist. Vor der Fusion hielt der Leverkusener Multi 5,1 Prozent der SYGNIS-Anteile. Darüber hinaus besitzt der Konzern sieben Prozent der Aktien von LION.
Zulassungserweiterung für BETAFERON
BAYER hat für das Gentech-Medikament BETAFERON, das SCHERING als umsatzstärkstes Mittel mit in die neue Pharma-Ehe einbrachte, von der EU eine Zulassungserweiterung erhalten. Durften Mediziner es früher nur zur Behandlung von Multipler Sklerose in einem fortgeschrittenen Stadium anwenden, so ist jetzt auch ein früherer Einsatz möglich. Nach dieser Entscheidung hofft der Pharmariese auch auf eine entsprechende Genehmigung in den USA.
Mehr Pestizide durch Gentech
Auf lange Sicht senkt der Anbau von Gentech-Pflanzen nicht den Pestizid-Verbrauch. Das ist das Ergebnis einer Studie mit Bt-Baumwolle in China, die Per Pinstrup-Anderson von der Cornell University durchführte. Die Baumwolle mit dem gentechnisch eingebautem Gift vom bacillus thuringiensis konnte sich zwar in den ersten Jahren erfolgreich der Baumwollkapselraupe erwehren, war dem Ansturm anderer Schadinsekten bald aber nicht mehr gewachsen, so dass die LandwirtInnen mit weiteren Pestiziden arbeiten mussten. Das ging ins Geld, weshalb ihr Gewinn nach sieben Jahren um ca. acht Prozent unter denen ihrer KollegInnen lag, die konventionelle Sorten angebaut hatten. Pinstrup-Anderson führt den Gen-Gau allerdings nicht auf die Genpflanzen selber, sondern auf das Fehlen von Pufferzonen mit naturbelassener Baumwolle zurück, in denen das Ausbringen zusätzlicher Agrochemikalien die Insekten-Bestände dezimiert und so die Gentech-Baumwolle vor ihnen verschont. Wie die sich häufenden negeativen Untersuchungsergebnisse zur Pestizid-Reduzierung durch genmanipulierte Pflanzen zeigen, dürfte dies aber nicht die Lösung des Problems sein. Schlechte Geschäftsaussichten also für BAYERs Gentech-Baumwolle FIBERMAX.
Probleme mit Gensoja
MONSANTOs Gentech-Soja, der über eine eingebaute Resistenz gegen das Anti-Unkrautmittel Glyphosate verfügt, macht den LandwirtInnen in Argentinien mittlerweile das Leben schwer. Vielen Wildgräsern kann die Agrochemikalie nichts mehr anhaben, so dass einige Sorten stärker wuchern als je zuvor. Zudem hat der flächendeckende Anbau mit ROUNDUP-READY-Soja die Böden ausgelaugt und ihnen nach einer Studie der Universität Buenos Aires rund eine Million Tonnen Stickstoff und 227.000 Tonnen Phosphor entzogen.
Stotternder Jobmotor
BAYER & Co. preisen die Gentechnik unablässig als Jobmotor. Die „Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie“ kommt auf über 10.000 Stellen allein in der Pflanzenzüchtung und Saatgutproduktion. Der BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DEUTSCHLAND (BUND) hat diese Angaben einmal überprüfen lassen und ganz andere Zahlen zu Tage gefördert. Nach einer Untersuchung des Wirtschaftswissenschaftlers Thorsten Helmerichs von der Oldenburger Carl-von-Ossietzky-Universität arbeiten bei den Gentech-Unternehmen gerade mal 500 Angestellte in den Laboren.
WASSER, BODEN & LUFT
Neues Schadstoffregister
Die Bundesregierung will 2008 ein nationales Schadstoffregister einrichten, das - öffentlich zugänglich - alle Giftstoffe auflistet, mit denen BAYER & Co. die Umwelt belasten. Für die Metall-, Strom- und Chemieindustrie gilt darüber hinaus die Sonderregelung, jährlich Bericht über die genaue Höhe der Emissionen erstatten zu müssen.
GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV
Chemie macht unfruchtbar
- 1
Nach einer neuen GREENPEACE-Studie beträgt der Anteil der nicht fortpflanzungsfähigen Menschen an der Gesamtbevölkerung der Industrieländer mittlerweile 20 Prozent und hat sich damit seit den 60er Jahren verdoppelt. Die Umweltschutzorganisation macht dafür Chemikalien mitverantwortlich. Viele Substanzen, wie etwa das von BAYER hergestellte Bispenol A, wirken nämlich hormon-ähnlich und beinträchtigen die Spermien-Produktion im Körper des Mannes.
Chemie macht unfruchtbar
- 2
Die in der „Great Lakes“-Region zwischen Kanada und den USA ansässigen Chemie-Unternehmen gefährden die Gesundheit der AnwohnerInnen in einem erheblichen Maße (siehe Ticker 1/06). Allein die nun zu LANXESS gehörende ehemalige BAYER-Niederlassung emittiert jährlich zwei Millionen Kilogramm gefährlicher Stoffe. Viele von ihnen finden sich nach einer Untersuchung der Initiative TOXIC NATION im Blut der Bevölkerung wieder. Die Probe eines 66-jährigen Mannes wies 32 Chemikalien auf, darunter Polychlorierte Biphenyle und Pestizide. Das bleibt nicht ohne Auswirkungen. Viele der Substanzen haben einen hormon-ähnlichen Aufbau und stören deshalb den menschlichen Stoffwechsel, was besonders fatale Auswirkung auf die Fortpflanzungsfähigkeit hat. So haben die chemischen Keulen in Sarnia zu vielen Fehlgeburten geführt und das Verhältnis von weiblichen und männlichen Geburten durcheinander gebracht. Auf einen Jungen kommen mittlerweile zwei Mädchen. Zudem weisen 20 Prozent der Schulkinder Entwicklungsdefizite auf. Auch in der Tierwelt stießen die WissenschaftlerInnen auf Abnormitäten wie Fische mit weiblichen und männlichen Geschlechtsmerkmalen.
PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE
Pestizide in Cola
Getränke-Produzenten nutzen Wasser als Rohstoff. In Indien ist es jedoch so stark durch Pestizide verunreinigt, dass auch die Cola nicht mehr sauber bleibt. Das „Centre for Science and Environment“ (CSE) fand in COCA-COLA und PEPSI-COLA Spuren von fünf Agrochemikalien, darunter der unter anderem von BAYER vertriebene Wirkstoff Chlorpyrifos. „Die Ergebnisse waren wirklich schockierend. PEPSI-COLA wies Rückstände auf, die dreißig Mal höher waren als die vom “Bureau of Indian Standards„ genehmigten Werte, bei COCA-COLA liegen sie 27 Mal höher“, so CSE-Direktorin Sunita Narain.
EU: strengere Pestizidpolitik
Die EU plant ein strengeres Vorgehen gegen Pestizide. Die Brüsseler PolitikerInnen wollen die Anwendungen besser kontrollieren, das Ausbringen der Ackergifte per Flugzeug verbieten sowie Sperrbezirke für Pestizide schaffen.
Immer weniger Bienen
Nach einer Studie der Universität Leeds, die das Wissenschaftsmagazin Science veröffentlichte, hat sich die Zahl der Bienen in den letzten 25 Jahren stark reduziert. Das hat auch die Pflanzenwelt Auswirkungen: weniger Bienen, weniger Bestäubungen, weniger Blumen. Um 70 Prozent nahm die Verbreitung von Wildpflanzen allein in Großbritannien während des Untersuchungszeitsraums ab. Der Wissenschaftler Koos Biesmeijer war „schockiert“ über das Ergebnis seiner Forschungen. Eine Ursache für das Verschwinden der Bienen konnte er nicht angeben; GAUCHO und andere bienengefährliche Pestizide dürften aber ihren Teil zu dem Artensterben beigetragen haben.
Comeback für Organophosphate?
Der intensive Rapsanbau und die damit verbundene intensive Anwendung von Pestiziden macht den Rapsglanzkäfer zunehmend immun gegen die Giftdröhnungen. Besonders pyrethroid-haltige Insektizide wie etwa die BAYER-Produkte BAYTHROID und BULLDOCK versagen ihre Dienste. Deshalb hat die Biologische Bundesanstalt eine begrenzte Notzulassung für den Wirkstoff Thiacloprid, enthalten unter anderem in den Konzernmitteln ALANTO, BARIARD, CALYPSO und MONARCA, ausgesprochen. Aber auch eine Wiederzulassung von Ultragiften auf Organophosphat-Basis ist wieder im Gespräch. „Dass man nun wieder auf sie zurückgreift, kann als Offenbarungseid aufgefasst werden“, kommentierte die Faz.
5.000 Vergiftungen in Brasilien
Mit seinem Pestizidverbrauch liegt Brasilien weltweit auf Platz drei. Entsprechend hoch ist die Zahl der Vergiftungen. 5.000 Personen behandeln die MedizinerInnen jährlich. Das „Integrated Toxicological Vigilance Center“ des Gesundheitsministeriums hat die Region Mato Grosso do Sul genauer untersucht. In dem Zeitraum von 1992 bis 2000 gab es dort 1.355 Fälle, 506 Selbsttötungsversuche und 849 Unfälle, von denen 37 tödlich endeten. Die drei am häufigsten beteiligten Ackergift-Wirkstoffe Methamidophos, Carbofuran und Monocrotophos, allesamt den Gefahrenklassen I und II zugehörig, befinden sich auch in der BAYER-Produktpalette. Obwohl die Vereinten Nationen die Konzerne aufgefordert haben, solche Substanzen in der „Dritten Welt“ nicht mehr zu vermarkten, machen die Agromultis dort weiterhin Geschäfte mit ihnen.
785 Vergiftungen in Chile
Im Jahr 2005 kam es in Chile zu 785 Pestizid-Vergiftungen. Für die meisten war der auch von BAYER hergestellte Wirkstoff Methamidophos verantwortlich, für die drittmeisten die sich ebenfalls im Konzern-Angebot befindliche Substanz Chlorpyrifos. Auf den sechsten Platz der Schwarzen Liste gelangte Tetramethrin und auf den achten Azinphos-Methyl.
Pestizide verursachen Krebs
Pestizide und andere Chemikalien können Krebs auslösen. In einem Versuch mit Tumorzellen beobachteten WissenschaftlerInnen, wie eine Agrochemikalie ein zum Krebswachstum beitragendes Gen, ein so genanntes Onkogen, stimulierte.
Pestizidexporte steigen
Die Pestizidexporte bundesdeutscher Unternehmen steigen. Im Geschäftsjahr 2005 führten BAYER & Co. fast 94.000 Tonnen aus, was gegenüber 2004 eine Zunahme von zehn Prozent bedeutet. Davon gehen ca. 9.000 Tonnen nach Südamerika und ca. 3.000 nach Afrika, wo die Menschen aufgrund einer hohen AnalphabetInnenrate und einer ungenügenden Schulung im Umgang mit den Agrochemikalien einem besonders hohen Vergiftungsrisiko ausgesetzt sind.
Viele Suizide mit Pestiziden
Das Schlucken von Pestiziden ist einer Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge weltweit die verbreiteste Methode, sich selbst zu töten. In asiatischen Ländern wie China, Malaysia oder Sri Lanka gehen 60 bis 90 Prozent aller Suizide auf die Einnahme von Agrochemikalien zurück. Die WHO bereitet deshalb einen Aktionsplan vor. Sie will unter anderem das Gesundheitspersonal im Umgang mit Vergiftungen schulen und den Zugriff auf Pestizide erschweren.
BAYER die Nr. 1
Wie schon im Geschäftsjahr 2004 nimmt BAYER auch 2005 mit einem Umsatz von fast sieben Milliarden Dollar unter den weltgrößten Pestizidherstellern die Spitzenposition ein.
STANDORTE & PRODUKTION
Rhein-Anleger arbeitslos
Zwischen BAYERs Leverkusener Schiffsanleger, an dem Lastkähne mit Giftfracht festmachten, und dem für die Boote der KÖLN-DÜSSELDORFER SCHIFFFAHRTSGESELLSCHAFT lag immer ein Sicherheitsabstand. Da die den Leverkusener Multi anlaufenden Schlepper aber immer länger wurden, schmolz die Distanz. Deshalb führte im Jahr 2003 kein Weg an einer Verlegung der Station vorbei (Ticker 1/03). An den Kosten wollte der Konzern sich zunächst nicht beteiligen, erst nach langen Verhandlungen steuerte er 250.000 der erforderlichen 850.000 Euro bei. Jetzt allerdings erweist sich der Umzug als eine Fehlplanung. Am neuen Standort herrscht nämlich eine so starke Strömung, dass die Rheinkommission Wasserfahrzeugen ab 80 Meter Länge das Anlegen untersagte, weshalb die Schiffe ausbleiben.
Ärger mit dem Mieterverein
BAYERs Wohnungsgesellschaft BAYWOGE will Mieten künftig nicht mehr für den abgelaufenen Monat, sondern schon im Voraus kassieren, was den Mieterverein auf den Plan gerufen hat. Eine „Doppelzahlung der Miete muss nicht sein“, kritisiert Geschäftsführer Volker J. Ziaja und sieht im Handeln des Unternehmens einen Verstoß gegen viele der abgeschlossenen Mietverträge.
BAYER macht Portãna dicht
Der Leverkusener Multi schließt am brasilianischen Standort Portãna seine Pestizid-Produktion und konzentriert die Herstellung von Agrochemikalien auf den Standort Belford Roxo, wo er auch ein neues Vertriebszentrum errichtet. Wieviel Arbeitsplätze der Konzern durch diese Zentralisierung vernichtete, teilte er nicht mit.
Anlage in China eingeweiht
Die Lohnkosten in China belaufen sich auf ein Viertel der bundesrepublikanischen. Dieses Faktum und die dortigen Wachstumsraten veranlassen BAYER zu großen Investitionen in dem Land. Anfang September 2006 nahm der Konzern ein Makrolon-Werk in Caojing in Betrieb. Und so soll es weiter gehen. „Wir wollen bis 2009 jährlich eine Großanlage eröffnen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Werner Wenning bei der Einweihung. In drei Jahren soll schon ein Neuntel der Kunststoffproduktion aus dem Reich der Mitte kommen. Da auch die Konkurrenz in ähnlichem Tempo baut, besteht die Gefahr von Überkapazitäten. Aber selbst dann werde der Konzern in den kostengünstigen Großanlagen die vorgegebenen Mindestrenditen erzielen, meint Wenning. Die Caojinger Fertigungsstätte kam den Multi aufgrund eines neu entwickelten Produktionsverfahrens für den Kunststoff TDI nämlich 10 bis 20 Prozent billiger als vergleichbare Investitionen; zudem liegt der Energieverbrauch um ein Drittel unter dem älterer Werke. Deshalb sieht es im Falle einer Absatzflaute schlecht für Produktionen im alten Europa aus.
Mehr Lackrohstoffe aus China
BAYER baut die Lackrohstoff-Produktion am Standort Shanghai aus. Künftig will der Konzern dort 50.000 Tonnen pro Jahr herstellen.
IMPERIUM & WELTMARKT
BAYER dominiert SCHERING-Vorstand
Ganz wie erwartet geben BAYER-Vertreter im neuen Vorstand von BAYER-SCHERING den Ton an. Im fünfköpfigen Führungsteam, dessen Leitung Arthur Higgins von BAYER HEALTH CARE übernimmt, finden sich nur zwei SCHERING-Manager. Den ehemaligen SCHERING-Boss Hubertus Erlen fand der Leverkusener Multi mit einem gutdotierten Posten im Aufsichtsrat ab.
Thomas neuer Kunststoffchef
Der Brite Patrick W. Thomas folgt Hagen Noerenberg auf den Posten des Vorsitzenden von BAYER MATERIAL SCIENCE, der Kunststoff-Sparte von BAYER.
Kooperation mit DEUTSCHE POST
Die DEUTSCHE POST übernimmt künftig für BAYER Dienstleistungen auf dem Gebiet der Dokumentenverwaltung. Sie erledigt das Scannen und Auslesen von Rechnungsdaten, den Abgleich mit anderen digitalen Unterlagen und die Archivierung. Ob dem Deal Arbeitsplätze beim Multi selber zum Opfer fallen, teilte der Konzern nicht mit.
Verkauf der Diagnostiksparte
Zur Finanzierung der SCHERING-Übernahme hat der Leverkusener Pharmariese seine Diagnostiksparte für 4,2 Milliarden Euro an SIEMENS verkauft. Nur das Geschäft mit Kontrastmitteln und Blutzuckermessgeräten verbleibt im Unternehmen. Damit vernichtet BAYER innerhalb des Konzerns tausende Arbeitsplätze.
BAYER kauft METRIKA
BAYER hat das US-Unternehmen METRIKA gekauft. Die Firma, die 75 Angestellte hat, stellt ein Gerät zur Bestimmung des Langzeit-Blutzuckerwertes her.
Vietnam lockt
Die bundesdeutsche Außenwirtschaftspolitik hat Vietnam nach Informationen von www.german-foreign-policy.com zu einem ihrer „Schwerpunktländer“ erklärt und bereitet BAYER & Co. das Terrain für eine Expansion. Der Leverkusener Multi hat bereits Projekte auf Lager und plant deshalb gemeinsam mit der vietnamesischen Regierung und anderen Konzernen einen Investitionsworkshop.
Kooperation mit NUFARM
Der BAYER-Konzern liefert seinen Herbizid-Wirkstoff Diflufenican und Produkte auf Basis dieser Substanz zukünftig an den australischen Pestizidhersteller NUFARM, der sein Europa-Geschäft stärken will.
PRODUKTION & SICHERHEIT
Immer mehr Asbest-Tote
Die Zahl der durch Asbest ausgelösten Krebsleiden steigt immer weiter. Dieter Köhler von der „Deutschen Gesellschaft für Pneumomologie“ rechnet binnen der nächsten 15 Jahre mit 110.000 Neu-Erkrankungen. Ein großer Teil der Betroffenen war in der Bau- oder Chemie-Industrie beschäftigt. Der Werkstoff ist in der Bundesrepublik zwar seit 1993 verboten, aber bis er seine gefährliche Wirkung entfaltet, können bis zu 40 Jahre vergehen. Parallel zur Zunahme der Fälle wächst die Verschwiegenheit bei BAYER. Der Leverkusener Pharmariese verheimlicht nämlich die genauen Zahlen. Im vorvorletzten „Sustainable Development“-Bericht hieß es zu den 130 „anerkannten“ Berufskrankheiten des Jahres 2000: „Als Krankheitsauslöser waren bei uns vor allem Expositionen gegen Asbest und Lärm relevant“. Im „Nachhaltigkeitsbericht 2004“ fehlt selbst ein solcher diffuser Hinweis. Zum Thema „Berufskrankheiten“ findet sich dort bloß der Satz: „ ... so liegt die Zahl neuer Anerkennungsfälle derzeit konzern-weit bei etwa 100 pro Jahr“, ohne auf die Art der Gesundheitsschädigungen näher einzugehen. Und mit dem Nachhaltigkeitsbericht von 2005 fehlen gleich sämtliche Angaben zu Berufskrankheiten.
UNFÄLLE & KATASTROPHEN
Explosionen in Dormagen
Auf dem Gelände des BAYER-Chemieparks in Dormagen ereignete sich am 3. Juli 2006 ein Störfall. In einem Reaktor zur Produktion des Kunststoffes Polyethylen kam es zu mehreren Explosionen. Acht MitarbeiterInnen wurden dabei verletzt.
Jährlich 340.000 Tote durch Chemikalien
Die Arbeit mit Chemikalien fordert zahlreiche Todesopfer. Nach Angaben der „internationalen Arbeitsorganisation“ (ILO) sterben jährlich 340.000 Menschen durch Vergiftungen. Ein großer Teil der Todesfälle geht auf Pestizide zurück und ereignet sich in Ländern der „Dritten Welt“. Dort tragen viele ArbeiterInnen wg. der großen Hitze keine Schutzkleidung Zudem ist die Analphabetismus-Rate hoch, weshalb ein Großteil der in der Landwirtschaft Beschäftigten die Warnhinweise auf den Agrochemikalien nicht lesen kann. So haben vor einigen Jahren in Benin 30 Beschäftigte das Ausbringen des auch von BAYER hergestellten Pestizidwirkstoffs Endosulfan, enthalten unter anderem in den Produkten MALIX, PHASER und THIODAN, mit ihrem Leben bezahlt.
Gefährliche Pestizid-Entsorgung
Besonders komplizierte Entsorgungsfragen schafft sich der Leverkusener Multi vom Hals, indem er Spezialunternehmen damit beauftragt. So lieferte eine BAYER-Niederlassung aus Alabama regelmäßig Behälter, in denen mit Propylmercaptan ein Bestandteil des Pestizides MOCAP hergestellt wurde, zur Reinigung an die Firma PHILIPS SERVICES. Dies blieb nicht ohne Folgen. In einem Umkreis von 50 Quadratmeilen klagten 250 Menschen über Kopfschmerzen, Brechreiz, allergische Symptome und Atemprobleme. Über drei Wochen hing ein übler Geruch über der ganzen Gegend. Die US-Behörden entzogen PHILIPS SERVICES daraufhin erst einmal die Betriebserlaubnis, die das Unternehmen allerdings wiedererlangen kann, wenn es bestimmte Auflagen erfüllt.
35 Verletzte bei Chlormethylketon-Austritt
Am 24. Mai 2006 ereignete sich im Dormagener BAYER-Werk beim Umfüllen einer von einem LKW gelieferten Chemikalie ein Unfall. Es traten fünf Liter des Pestizid-Vorproduktes Chlormethylketon aus. Der Kontakt mit der Substanz verursachte bei 35 Personen so schwere Gesundheitsstörungen, dass sie sich in ärztliche Behandlung geben mussten.
Zyanid tritt aus
Am 24. Juli 2006 entstand in einem BAYER-Gefahrguttransporter ein Leck, woraus giftiges Zyanid entwich. Der Fahrer stoppte den LKW und fuhr den Parkplatz eines Einkaufszentrums im US-amerikanischen Moundsville an. Die eintreffende Feuerwehr ließ sofort alle dort parkenden Wagen abschleppen; ein Sicherheitsteam pumpte die Chemikalie ab. Wäre eine größere Menge ausgetreten und hätte der Wind ungünstiger gestanden, hätten die Verantwortlichen umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen einleiten müssen. So aber gab der Polizei-Chef Entwarnung: „Für niemanden bestand zu irgendeiner Zeit eine Gefahr.“
Mercaptan tritt aus
Sogar in Erdgas steckt Chemie. Der Duftstoff Mercaptan verhilft dem geruchslosen Erdgas zu dem charakteristischen Gasgeruch, damit man eventuelle Ausströmungen riechen kann. Im Wiesdorfer BAYER-Werk ereignete sich allerdings mit Mercaptan ein Störfall. Im Bereich der Erdgasübergabestation trat der Duftstoff aus und verursachte bei acht MitarbeiterInnen Übelkeit und Augenreizungen.
Kontrastmittel-Rückruf
Der von BAYER aufgekaufte Pharmahersteller SCHERING hat sein Röntgenkontrastmittel ULTRAVIST zurückgerufen, da in dem Medizinprodukt kleine Partikel zu Kristallen zusammengklumpt sind, was Arterien verstopfen und so Thrombosen auslösen könnte.
RECHT & UNBILLIG
CBG-Klage abgewiesen
Kurz vor der diesjährigen Hauptversammlung der BAYER AG am 28. April reichte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) bei der Kölner Staatsanwaltschaft eine Klage gegen den Konzern wegen unerlaubter Preisabsprachen ein. Anfang Juni wiesen die RichterInnen sie in der ersten Instanz ab. Sie sahen es nicht als Veruntreuung an, Rückstellungen in Höhe von 275 Millionen Euro für die zu erwartenden Strafen gebildet zu haben - im Gegenteil. „Bei lebensnaher Betrachtung (ist) davon auszugehen, dass ein weltweit agierender Konzern wie die BAYER AG letztlich durch Kartellabsprachen größere Gewinne erzielt, als wenn sie auf solche verzichten würde“, heißt es in der Urteilsbegründung. Das Profitstreben des Leverkusener Multis führt sie sogar noch als mildernden Umstand an: „Es ist in Anbetracht des Umstandes, dass viele namhafte Unternehmen an den Absprachen beteiligt waren, davon auszugehen, dass diese Vereinbarungen lediglich (!) in der Absicht einer sicheren Gewinnmaximierung getroffen wurden.“ Die CBG hat gegen die Entscheidung Beschwerde eingelegt (siehe auch SWB 3/06).
73 Millionen Dollar Kartellstrafe
In einem Verfahren wegen Preisabsprachen beim Kunststoff-Vorprodukt Polyol, in dessen Verlauf BAYER schon einmal 33 Millionen Dollar zahlen musste, erging ein erneuter Strafbefehl. Ein Gericht verurteilte die am Kartell beteiligten Unternehmen, auch die Plastikproduzenten zu entschädigen, denen sie das Polyol überteuert verkauft hatten. Das kostete die Konzerne noch einmal 73
EU Kommission
Generaldirektion SANCO
Director General Robert Madelin
Bienensterben in Süddeutschland
Sehr geehrter Herr Madelin,
in Baden-Württemberg und Bayern kam es im April/Mai 2008 nach der Aussaat von Clothianidin-behandeltem Mais zu einem großflächigen Bienensterben. Mindestens 700 Imker verloren ihre Bestände ganz oder teilweise, insgesamt rund 11.500 Völker. Der Bestand wildlebender Insekten ging ebenfalls stark zurück. Das Insektizid Clothianidin (Produktnamen: Elado, Poncho) wird von der Firma Bayer CropScience hergestellt. Der Wirkstoff wird vor allem im Mais- und Rapsanbau verwendet.
Nach Aussage des Bundesforschungsinstituts für Kulturpflanzen (Julius Kühn-Institut, JKI) ist „eindeutig davon auszugehen, dass Clothianidin hauptsächlich für den Tod der Bienen vor allem in Teilen Baden-Württembergs verantwortlich ist“. Das JKI untersuchte 66 tote Bienen und wies in 65 Fällen den Wirkstoff Clothianidin nach. In den 14 Bienenproben aus Bayer fand das JKI in sämtlichen Fällen Clothianidin. Die Bienenschäden können laut JKI „nicht mit dem Auftreten von Bienenkrankheiten erklärt werden“.
Durch das großflächige Bienensterben wurde die von Bayer-Vertretern stets vorgebrachte Aussage, dass Beizmittel wie Clothianidin und Imidacloprid nicht direkt mit Bienen in Kontakt kämen, widerlegt. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) reagierte und verbat am 16. Mai die Anwendung von acht Beizmitteln, darunter Imidacloprid und Clothianidin, mit sofortiger Wirkung.
Vertreter von Bayer versuchen, das Bienensterben als einmaligen Vorgang darzustellen, der auf einen fehlerhaften Abrieb der Wirkstoffe bei der Mais-Aussaat zurückzuführen sei. Dabei hatte Dr. Richard Schmuck von Bayer CropScience bei einem Expertengespräch des baden-württembergischen Landwirtschaftsministeriums am 8. Mai eingeräumt, dass auch bei einer ordnungsgemäßen Aussaat mit einem Clothianidin-Abrieb zu rechnen sei.
Schon im Jahr 2003 hatte ein Untersuchungsbericht der französischen Regierung festgestellt: „Was die Behandlung von Mais-Saat mit Imidacloprid betrifft, so sind die Ergebnisse ebenso besorgniserregend wie bei Sonnenblumen. Der Verzehr von belasteten Pollen kann zu einer erhöhten Sterblichkeit von Pflegebienen führen, wodurch das anhaltende Bienensterben auch nach dem Verbot der Anwendung auf Sonnenblumen erklärt werden kann“. Imidacloprid und Clothianidin gehören zur Substanzklasse der Neonicotinoide und sind chemisch verwandt. Beide Wirkstoffe wurden in Frankreich im Mais-Anbau verboten bzw. erhielten keine Zulassung.
Hierzu stellen wir folgende Fragen:
1. Clothianidin und Imidacloprid werden als „bienengefährlich“ eingestuft. Dennoch kam die EU im Zulassungsverfahren für Clothianidin zu dem Schluss, dass durch die Anwendung des Mittels keine Risiken für Bienen entstehen. Diese Aussage wurde spätestens durch das aktuelle Bienensterben widerlegt. Teilt die EU-Kommission die Meinung, dass die Zulassung für beide Wirkstoffe zurückgezogen werden muss?
2. Wurden die Ergebnisse des Untersuchungsberichts “Imidaclopride utilisé en enrobage de semences (Gaucho) et troubles des abeilles“ des Comité Scientifique et Technique (CST) bei der EU-Zulassung von Imidacloprid und Clothianidin berücksichtigt? Warum hat die EU nicht das französische Vorsorgeprinzip übernommen?
3. Aus Italien und Slowenien werden ebenfalls Bienensterben durch Clothianidin gemeldet, Slowenien hat die Verwendung des Wirkstoffs verboten. Gab es in den vergangenen fünf Jahren weitere Fälle von Bienensterben durch Neonicotinoide in EU-Mitgliedsländern?
4. Der Clothianidin-Umsatz betrug im vergangenen Jahr 237 Mio Euro, der von Imidacloprid über 500 Mio Euro. Der Hersteller will daher ein dauerhaftes Verbot unbedingt verhindern. In welcher Weise ist Bayer bei der EU vorstellig geworden?
Mit freundlichen Grüßen,
Philipp Mimkes
Coordination gegen BAYER-Gefahren
www.CBGnetwork.org
Tel 0211-333 911, Fax 0211-333 940
Beirat
Prof. Dr. Jürgen Rochlitz, Chemiker, ehem. MdB, Burgwald
Dr. Sigrid Müller, Pharmakologin, Bremen
Prof. Dr. Anton Schneider, Baubiologe, Neubeuern
Prof. Jürgen Junginger, Designer, Krefeld
Dr. Erika Abczynski, Kinderärztin, Dormagen
Eva Bulling-Schröter, MdB, Berlin
Dr. Janis Schmelzer, Historiker, Berlin
Wolfram Esche, Rechtsanwalt, Köln
Dorothee Sölle,Theologin, Hamburg (gest. 2003)
AKTION & KRITIK
CBG verklagt BAYER
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hat den Leverkusener Chemiemulti wegen seiner zahlreichen illegalen Preisabsprachen verklagt. Da die inzwischen aufgeflogenen Kartelle unmöglich ohne das Wissen der verantwortlichen Konzern-Manager entstanden sein können und sich die Rückstellungen für zu erwartende Strafzahlungen mittlerweile auf 275 Millionen Euro belaufen, sieht die CBG den Tatbestand der Veruntreuung als erfüllt an. „Die Verantwortlichen müssen persönlich in Haftung genommen werden“, forderte CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes in einer Presseerklärung zur Strafanzeige.
Klimaschwindel: Loske schreibt BAYER
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hatte BAYER beim Klimaschwindel ertappt und die vom Konzern stets mit stolzgeschwellter Brust vorgetragene Zahl von 60 Prozent weniger Kohlendioxid auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Wie die CBG nachwies, hatte der Multi die Reduzierung mitnichten durch Investionen in den Umweltschutz erreicht, sondern durch Betriebsschließungen, Verkäufe von Unternehmensteilen und ein Outsourcing der Energie-Produktion. Dies gab auch dem grünen Bundestagsmitglied Reinhard Loske zu denken, der das Unternehmen zuvor für seine Klimapolitik mit grünen Weihen ausgestattet hatte. Er forderte den Vorstand auf, zu den Tricksereien Stellung zu nehmen und kündigte an, sein Lob öffentlich zu widerrufen, sollte BAYER die Vorwürfe nicht entkräften können.
Anfrage wg. Kinderarbeit
Noch immer besteht die Belegschaft bei den Zulieferern von BAYERs indischer Saatgut-Tochter PROAGRO zu 20 Prozent aus Kindern. Darum hat die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) diesen Skandal in den Deutschen Bundestag eingebracht. Über die LINKSPARTEI stellte sie eine parlamentarische Anfrage zu dem Thema. Die Antwort spricht Bände. „Die Bundesregierung teilt die Auffassung, dass Kinderarbeit eine Menschenrechtsverletzung darstellt“, schreibt Rot-Schwarz, um dann ihre Ohnmacht hinsichtlich des Treibens von BAYER zu bekunden: „Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen ist freiwillig und daher nicht einklagbar“.
Monitor macht BAYER Beine
Der Bericht des TV-Magazins Monitor über Kinderarbeit bei den Zulieferern von BAYERs indischer Saatguttochter PROAGRO hat dem Konzern Beine gemacht. „BAYER war geschockt über die Monitor-Reportage“, meldete der Anti-Kinderarbeitsaktivist Dr. Davuluri Venkateswarlu der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN aus dem fernen Indien. PROAGRO-ManagerInnen haben ihn unmittelbar nach der Sendung kontaktiert, um mit ihm einen Aktionsplan für die nächste Pflanzsaison auszuarbeiten. Was aus dem Vorhaben wird, bleibt allerdings abzuwarten.
Vorläufiges Aus für Terminator-Technologie
Auf der UN-Konferenz im brasilianischen Curitiba haben BAYER & Co. eine empfindliche Niederlage erlitten. Es ist ihnen nicht gelungen, die DelegiertInnen zu einer Aufhebung des Moratoriums für Terminator-Saatgut zu bewegen. In dieser Technologie, Saaten mittels Gentechnik steril zu machen und so die LandwirtInnen daran zu hindern, sie in der nächsten Pflanzsaison wiederauszusähen, sahen die Agromultis ein wirksames Instrument zu einer Erweiterung der Kontrolle über die Nahrungsmittelkette (SWB 1/06). Aber das auch von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN unterstützte, breit angelegte Aktionsbündnis TERMINATOR-TECHNOLOGIE ÄCHTEN - FREIE SAAT STATT TOTE ERNTE machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. „Ohne den massiven politischen Druck für eine Beibehaltung des Moratoriums wäre den Saatgutmultis die Aufhebung gelungen“, meint Roland Röder von der AKTION 3.WELT SAAR. Jetzt versucht die Kampagne, das Terminator-Tabu ins bundesdeutsche Gentechnik-Gesetz einfließen zu lassen.
CBG auf Anti-Gentech-Konferenz
Im April 2006 trafen sich Gentech-GegnerInnen auf Kreta zu einer Konferenz, auf der auch die Arbeit der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) in einem Workshop vorgestellt wurde. Die Resonanz war positiv: „Es war eine gelungene Veranstaltung, viele Menschen wurden über Anti-Gentech-Aktivitäten informiert - und glaubt es mir! - vielen von ihnen war unbekannt, wie tief BAYER da drin steckt“, schrieb einer der Organisatoren der CBG.
GREENPEACE gegen BAYER-Studie
BAYER, BASF und andere Genmultis finanzieren über ihren Verband „CropLife“ ein Institut, dessen Untersuchungen den Geldgebern stets die erwünschten Ergebnisse liefern. So publizierten die WissenschaftlerInnen in Italien eine Untersuchung, welche die Gefahren von Kreuzungen gentechnisch veränderter Pflanzen mit konventionell oder ökologisch angebauten Sorten herunterspielt. Die Initiativen GREENPEACE und LEGAMBIENTE reagierten sofort und korregierten die Aussagen der AuftragsforscherInnen.
Italien: LandwirtInnen gegen Genreis
Der Leverkusener Chemie-Multi hatte bei der EU vor einiger Zeit einen Antrag auf Import-Genehmigung für eine gentechnisch gegen das Anti-Unkrautmittel LIBERTY LINK (Wirkstoff: Glufosinat) resistent gemachte Reis-Sorte gestellt (siehe GENE & KLONE). Der italienische LandwirtInnenverband „Confederazione italiana agricoltori“ hat sich streng dagegen ausgesprochen, diese Erlaubnis zu erteilen.
Protest gegen EU-Forschungspolitik
Die Europäische Kommission greift zur Beglückung von BAYER & Co. mal wieder tief in die Tasche. Die EU will Forschungen im Agrarbereich mit einem Schwerpunkt auf der Gentechnik von 2007 bis 2013 mit 2,5 Milliarden Euro fördern (siehe SWB 4/04), während sie Untersuchungen zum Umwelt- oder VerbraucherInnenschutz kein Geld zur Verfügung stellt. Aus Protest gegen diese Subventionspolitik haben das GENETHISCHE NETZWERK, GREENPEACE und andere Initiativen einen Offenen Brief an Europa- und Bundestagsabgeordnete geschrieben.
BIS-Proteste in Brunsbüttel
Im Herbst 2005 kam es am BAYER-Standort Brunsbüttel zu Protesten von 150 MitarbeiterInnen von BAYER INDUSTRY SERVICES (BIS), weil die Konzernzentrale sich Zeit dabei lässt, die Sparte in die Teilgesellschaft BAYER MATERIAL SCIENCE zu integrieren. Die BIS, die innerhalb des Konzernverbundes die Chemie„parks“ betreibt, steht seit geraumer Zeit wegen angeblich zu schlechter Geschäftszahlen unter Druck (siehe SWB 1/06), und die Beschäftigten sehen sich durch eine Zusammenlegung mit der Kunststoff-Abteilung besser vor einer drohenden Arbeitsplatzvernichtung geschützt. „Wir lassen keinen Keil zwischen BMS und BIS treiben“ und „Schluss mit der Hinhaltetaktik“ schrieben die Belegschaftsangehörigen deshalb auf ihre Demonstrationsschilder. Die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE bekommt sogar Rückendeckung vom Werksleiter Roland Stegmüller und will die Fusion notfalls vor Gericht erstreiten.
Proteste in Antwerpen
Im Antwerpener Werk von BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS will die Geschäftsleitung die Beschäftigten zu Mehrarbeit zwingen. In einem Interview schwärmte das Vorstandsmitglied Koemm von chinesischen Verhältnissen mit jährlichen Lohnkosten von 10 - 15.000 Euro für eine 48-Stunden-Woche und klagte insbesonders über die angeblich zu großzügigen Urlaubsregelungen in der belgischen Niederlassung. Die beiden Gewerkschaften ABVV und ACV reagierten sofort. Sie traten mit einem Flugblatt an die Öffentlichkeit und kündigten Widerstand an, falls LANXESS zur Tat schreiten sollte: „Wir werden zum richtigen Zeitpunkt hart reagieren“.
Bisphenol: Land wiegelte ab
Im letzten Jahr machte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN der Öffentlichkeit die Ergebnisse einer neuen Studie zu den hirnschädigenden Wirkungen der von BAYER in großen Mengen hergestellten Chemikalie BISPHENOL A zugängig. Auf der Basis dieser neuen Informationen fragten BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei der Landesregierung Nordrhein-Westfalen an, ob sie Handlungsbedarf sehe. Aber Rüttgers Club wiegelte ab. Die MinisterInnen verwiesen in ihrer Antwort auf eine ältere Studie des „Bundesinstitutes für Risikobewertung“, die der NRW-Regierung zufolge befand, „dass für Säuglinge und Kleinkinder aus der üblichen Verwendung von Polycarbonatflaschen kein gesundheitliches Risiko durch Bisphenol A resultiert“ Zudem stehe es den VerbraucherInnen ja frei, auf diese Flaschen zu verzichten und zu Glas zu greifen. Ansonsten wartet die CDU/FDP-Koalition die Resultate der zur Zeit auf europäischer Ebene vorgenommenen neuen Risiko-Bewertung ab. Das BISPHENOL A kann also in BAYERs Homeland einstweilen unbehelligt weiter seine gefährlichen Kreise ziehen.
CBG schreibt Bluterorganisationen
In den achtziger Jahren hatte BAYER es aus Profit-Gründen unterlassen, seine Blutplasma-Produkte einer keimtötenden Hitze-Behandlung zu unterziehen, um das Risiko einer „AIDS“-Infektion zu senken. Als die US-Gesundheitsbehörde FDA die Einführung des Verfahrens schließlich zur Pflicht machte und den Abverkauf der unbehandelten Chargen verbot, lieferte der Konzern die Altlasten einfach nach Asien. Insgesamt starben durch die Geschäftspraktiken von BAYER & Co. Tausende Bluter an AIDS. Seither versucht der Leverkusener Chemiemulti das Vertrauen der Bluter über eine großzügige Unterstützung der Patienten und ihrer Verbände zurückzugewinnen. So hat das Unternehmen erst jüngst 2,7 Millionen Dollar für Forschungen zur Bluterkrankheit gespendet und mit der US-Organisation „National Hemophilia Foundation“ ein Autorennen zu Gunsten von Blutern veranstaltet. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hat den Weltbluterverband „World Federation of Hemophilia“ in einem Offenen Brief deshalb aufgefordert, diese durchsichtige Strategie zu durchkreuzen und die Kooperationen mit dem Leverkusener Multi zu beenden.
GREENPEACE kritisiert Lebensmittelaufsicht
Im Herbst 2005 führte GREENPEACE eine Untersuchung zur Pestizid-Belastung von Obst und Gemüse durch und förderte hohe Giftwerte zu Tage (siehe SWB 1/06). Die Spitzenposition nahm dabei eine Substanz aus dem Hause BAYER ein: FOLICUR fand sich in 8,2 Prozent aller Proben. Das Ergebnis der Studie deutete auf ein eklatantes Versagen der den einzelnen Bundesländern unterstehenden Lebenmittelkontrollbehörden hin. Diesen hat GREENPEACE jetzt genauer auf den Zahn gefühlt und 16 von ihnen wegen zu seltener Überprüfungen und unzureichend ausgestatteter Labore die Note „mangelhaft“ erteilt.
Ärger im Pillenparadies
Nirgendwo auf der Welt verdienen BAYER & Co. mit ihren Pillen so viel Geld wie in den USA. Für die Rheuma-Arznei CELEBREX etwa müssen die US-AmerikanerInnen mit 222 Dollar fast doppelt so viel berappen wie ihre NachbarInnen in Kanada, wo die Pillen nur 135 Dollar kosten. Darum hat der Bürgermeister der Stadt Springfield, die für ihre kommunalen Angestellten eine eigene Krankenversicherung unterhält, die Mitglieder nun aufgefordert, ihre Medikamente per Internet in Kanada zu bestellen. So sparte die Gemeinde drei Millionen Dollar im Jahr und brachte Big Pharma auf die Palme. Die US-Gesundheitsbehörde gab den Pillenriesen dagegen Rückhalt und warnte vor Sicherheitsrisiken. „Das Einzige, was nicht mehr sicher ist, sind die Gewinne der Pharma-Industrie“, entgegnete daraufhin Isaac BenEzera als Sprecher einer SeniorInnen-Initiative und verwies auf die Zahl von jährlich 18.000 Menschen, die sterben müssen, weil sie sich dringend benötigte Medikamente nicht leisten können.
PAN schreibt Gabriel
Das PESTIZID-AKTIONS-NETZWERK (PAN) hat den Umweltminister Sigmar Gabriel und den Landwirtschaftsminister Horst Seehofer in einem Offenen Brief aufgefordert, mit der Umsetzung eines Beschlusses der AgrarministerInnen-Konferenz vom 4. März 2005 zu beginnen, der eine Reduzierung des Einsatzes der Pestizide von BAYER & Co. auf den Äckern um 15 Prozent bis 2015 vorsieht.
VDPP fordert Arznei-Bedarfsprüfung
Der VEREIN DEMOKRATISCHER PHARMAZEUTINNEN UND PHARMAZEUTEN (VDPP) hat gefordert, bei Zulassungsverfahren für Medikamente auch nach dem Kriterium zu entscheiden, ob die neue Arznei wirklich gebraucht werde. Eine solche Bedarfsprüfung als vierte Hürde wäre in den Augen des VDPP-Vorständlers Dr. Thomas Schulz ein wirksames Mittel gegen die Pillen- und Kostenflut im Gesundheitswesen.
Sicherheitsinitiative der ABVV
Am US-amerikanischen BAYER-Standort Baytown ereignete sich am 18.6.2005 ein tödlicher Unfall (Ticker 1/06). Die Arbeitssicherheitsbehörde Osha untersuchte den Fall und stellte massive Verfehlungen BAYERs fest. Sie wies „ernsthafte Verstöße“ gegen die Sicherheitsbestimmungen nach, weshalb eine „hohe Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Unfalls oder ernsthafter körperlicher Schäden“ bestanden hätte. Die Berichterstattung der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN über diesen Fall nahm die im Antwerpener BAYER-Werk aktive sozialistische Gewerkschaft ABVV zum Anlass, an die Firmenleitung eine Anfrage zur Sicherheitslage in ihrem Werk zu stellen, das mit der Baytowner Produktionsstätte nahezu baugleich ist. Die Antwort aus der Zentrale bezeichneten die ArbeiternehmervertreterInnen als „sehr unklar und nicht zufriedenstellend“.
Greenwashing-Aktivitäten in Vietnam
Auch in Vietnam stellt sich der Leverkusener Chemie-Multi mittlerweile unter Verweis auf seine Kooperationen mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen als grüner Musterschüler dar. Die staatliche Nachrichtenagentur des Landes hat sich in diese Greenwashing-Aktivitäten einspannen lassen. Deshalb hat die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN die Redaktion in einem Brief über das Umweltsündenregister des Konzerns aufgeklärt.
KAPITAL & ARBEIT
Betriebsratswahlen: Erfolge für Linke
Bei den letzten Betriebsratswahlen beim Leverkusener Multi errangen fortschrittliche Gruppen innerhalb der IG BERBBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) zum Teil große Erfolge. Die BELEGSCHAFTSLISTE des Wuppertaler BAYER-Werkes erreichte ihr bisher bestes Ergebnis und verfehlte mit 49,8 Prozent der Stimmen die Betriebsratsmehrheit nur knapp. Bei BAYER INDUSTRY SERVICES erreichten die BASISBETRIEBSRÄTE sieben Sitze und die KOLLEGEN UND KOLLEGINNEN FÜR EINE DURCHSCHAUBARE BETRIEBSRATSARBEIT einen. Die IG BCE kam dort auf 17 Sitze, VERDI auf vier. Im Leverkusener BAYER-Werk errangen die BASISBETRIEBSRÄTE vier Mandate und die DURCHSCHAUBAREN drei, während die IG BCE 28 und VERDI zwei gewann. Der größten Coup gelang alternativen Gewerkschaftsgruppen bei SCHERING. Die Angst vor Arbeitsplatzverlusten im Zuge der Fusion mit BAYER hat einer linken Gruppierung die Mehrheit im Betriebsrat verschafft.
17 % weniger Lohn für PersonalerInnen
Wenn die Konzerne drastische Einsparungen vornehmen, die traurige Botschaft aber nicht persönlich überbringen wollen, heuern sie zumeist externe Beratungsgesellschaften als Briefträger an. So auch BAYER. Der Konzern ließ die Unternehmensberatung HACKETT die Aufwändungen in Verwaltung und Personalwesen prüfen, und siehe da: HACKETT eruierte ein Einsparpotenzial von 200 Millionen Euro durch eine Konzentration der Aufgaben auf einen Standort. „Shared Services Center“ (SSC) heißt das neue Modewort. Vorher von den einzelnen Landesgesellschaften bearbeitete Bereiche wie Lohnabrechnung, Pensionierungsfragen und ähnliches will der Chemie-Multi nun bündeln. Um die Standortfrage für eine solche Ausgründung zu klären, inszenierte er dann schnell noch einen Unterbietungswettbewerb zwischen Barcelona und Leverkusen. Der Stammsitz trug den „Sieg“ davon. 17 Prozent weniger Lohn, die 40-Stunden-Woche und der Wegfall von 100 Stellen - dieses Angebot war nicht zu schlagen. „Unbestreitbar werden mit diesen Regelungen Arbeitsbedingungen für die betroffenen Arbeitsplätze mittel- und langfristig nicht verbessert. Auf der anderen Seite wären diese Arbeitsplätze in Deutschland nicht zu halten gewesen. Das Niveau der Arbeitsbedingungen in dem SSC wird nicht mehr das Niveau der Arbeitsbedingungen bei BAYER sein, aber es ist das Niveau vergleichbarer Arbeitsbedingungen in Deutschland/Leverkusen“, kommentierte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Thomas de Win das Verhandlungsergebnis. Auch in Asien und Nordamerika plant der Konzern jetzt solche Rationalisierungsmaßnahmen in den Personalabteilungen.
Vorstandsgehälter: + 9 Prozent
Die Bezüge von BAYERs Vorstandsriege erhöhten sich 2005 gegenüber dem vorigen Geschäftsjahr um neun Prozent. Würden die Gewerkschaften eine solche Forderung nach Lohnsteigerung stellen, bräche nicht nur in der Konzernzentrale des Pharmariesen ein Sturm der Entrüstung los.
Von BAYER zur IG-BCE-Spitze
Der designierte Nachfolger von Hubertus Schmoldt an der Spitze der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) ist ein BAYER-Mann. Bevor Michael Vassiliadis 1986 in den Apparat der Gewerkschaft wechselte, war er im Dormagener BAYER-Werk als Chemielaborant tätig. Auch unter seiner Ägide dürfte die IG BCE nicht von ihrem Kurs abweichen, den Beschäftigten die von BAYER & Co. auf die Agenda gesetzten Unzumutbarkeiten zumutbar zu machen. So hat Vassiliadis an der Verlängerung der Lebensarbeit an sich nichts auszusetzen. In bester Co-Management-Manier beschäftigt ihn lediglich die Frage, wie die GewerkschaftlerInnnen diesen Rückfall in die Steinzeit der Arbeitsbedingungen vor Ort am besten organisieren können.
Billiglohnland Bundesrepublik
Bei den Lohnstückkosten, also dem Quotienten aus Lohnkosten und Umsatz, nimmt die Bundesrepublik unter den sieben großen Industrieländern den vorletzen Platz ein. Nur in Japan war die Arbeit noch billiger. Dies ergab eine Studie der Volkswirtschaftsabteilung der DEUTSCHEN BANK.
Schmoldt für Kombilöhne
Der Vorsitzende der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE), Hubertus Schmoldt, der auch dem BAYER-Aufsichtsrat angehört, hat sich für die Einführung von Kombilöhnen ausgesprochen. Wie die Unternehmer hält der Gewerkschaftler die Höhe der Gehälter für eine Ursache der Arbeitslosigkeit. Deshalb möchte er Sonderangebote für BAYER & Co. einführen und entwarf ein Kombilohn-Modell. Nach seinen Vorstellungen soll die „Bundesagentur für Arbeit“ künftig für 20 Prozent des Entgeltes von gering Qualifizierten aufkommen und so für die Industrie einen neuen Niedriglohnsektor schaffen.
Das Chemie-Geschäft boomt
Bei der ersten Pressekonferenz in seiner Funktion als Präsident des „Verbandes der Chemischen Industrie“ konnte BAYER-Chef Werner Wenning mit guten Zahlen aufwarten. Die Produktion von BAYER & Co. erhöhte sich um sechs Prozent. Der Umsatz stieg um sieben Prozent, wobei sich das Umsatzwachstum gegenüber den Vorjahren sogar verdoppelte. Trotzdem vernichteten die Chemie-Unternehmen ein Prozent ihrer Arbeitsplätze. Nur noch 440.600 Beschäftigte zählt die Branche. Mit immer weniger Personalkosten erwirtschaften die Firmen also immer exorbitantere Gewinne. Für Wenning dürften sie aber gerne noch etwas exorbitanter sein. Er kritisierte die im Vergleich zu den USA und Großbritannien am Standort Deutschland um ein Drittel höheren Arbeitskosten und die um fünf Prozent niedrigere Umsatzrendite.
Weitere Arbeitsplatzvernichtung bei LANXESS
BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS läutet die dritte Sparrunde ein. Durch die Vernichtung von 250 Arbeitsplätzen - vor allem im Bereich der Herstellung von ABS-Kunststoffen - soll diese ab 2009 50 Millionen Euro erbringen. Dafür will Vorstandschef Axel Heitmann unter anderem eine Niederlassung in Brasilien schließen und Rationalisierungsmaßnahmen am US-Standort Addyston einleiten, wo das LANXESS-Werk zuletzt immer wieder durch Schadstoff-Austritte negative Schlagzeilen machte. Auch den Produktionen in Indien und Thailand drohen Einschnitte. Zur Begründung der Stellenstreichungen verwies Heitmann auf die zu große Anzahl von Geschäftsfeldern, die nicht seinen Rendite-Erwartungen entsprechen. „Immer noch rund 25 Prozent unseres Umsatzes sind nicht profitabel, weitere 30 Prozent sind nicht zufriedenstellend“, so der Verstandsvorsitzende. Es dürfte also noch das Arbeitsplatzabbau-Programm Nr. 4 folgen.
LANXESS-Ausverkauf geht weiter
BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS die Investmentbanken CREDIT SUISSE und LEHMAN BROTHERS beauftragt, Abnehmer für die Sparten „ABS-Kunststoffe“ und „Textilchemikalien“ zu finden. Sollte dies gelingen, würde der Konzern um ein Siebtel seiner Größe schrumpfen.
Dormagen: Werkschutz privatisiert
Der nach Meinung der Konzernleitung zu kostenintensiv arbeitende Chemie„park“-Betreiber BAYER INDUSTRY SERVICES (BIS) beginnt mit der Umsetzung seines Sparprogramms. In Dormagen hat er den Werkschutz an einem Tor bereits einer Fremdfirma übertragen (siehe auch SWB 1/06).
Weniger Verbesserungsvorschläge
Reichten die BAYER-Beschäftigten im Jahr 2004 noch 17.000 Verbesserungsvorschläge ein, so schrumpfte deren Zahl anno 2005 auf 9.600 - eine Nebenwirkung der innerhalb des Konzernverbundes vernichteten Arbeitsplätze. Nur BAYERs Undankbarkeit bleibt konstant. Der Konzern spart durch die Innovationen pro Jahr neun Millionen Euro ein, schüttet an Prämien jedoch nur einmalig 2,4 Millionen aus.
Mehr Sonderzahlungen
Der Leverkusener Chemie-Multi steigerte seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2005 um 134 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Da war dann auch ein höheres Almosen für die Beschäftigten drin: Der Konzern hob die jährlichen Sonderzahlungen um ein Drittel auf 59 Millionen Euro an. Das Unternehmen behielt sich allerdings vor, von dem Betrag 2,3 Prozent einzubehalten. Angeblich soll dieser Obulus dem Erhalt von 1.000 Arbeitsplätzen an den bundesdeutschen Standorten dienen.
ERSTE & DRITTE WELT
Zinnschlacke aus dem Kongo
Der Kongo ist eines der rohstoffreichsten Länder Afrikas. Die BAYER-Tochter HC STARCK hat in der Vergangenheit nicht einmal davor zurückgeschreckt, mit den Bürgerkriegsparteien Handel zu treiben, um in den Besitz von Coltan zu kommen (Ticker berichtete mehrfach). Aber das Interesse HC STARCKs beschränkte sich keinesfalls nur auf dieses seltene Metall. Nach Informationen von german-foreign-policy.com verhandelten FirmenvertreterInnen im Sommer 2003 auch über Zinnschlacke-Lieferungen mit zwielichtigen Geschäftspartnern. Darum begrüßt die BAYER-Gesellschaft selbstverständlich den Einsatz der Bundeswehr im Kongo als Maßnahme zur Herstellung der „Versorgungssicherheit“ mit Coltan & Co. (siehe auch SWB 2/06).
Bill Gates hilft BAYER
Die Pharmamultis haben die ärmeren Staaten nicht in ihrer Kundendatei. Deshalb müssen öffentliche oder private Institutionen einspringen, um Medikamenten-Entwicklungen für Krankheiten zu fördern, die besonders häufig in Entwicklungsländern auftreten. Eine solche Organisation ist die „Global Alliance for TB-Drug-Development“. Bill Gates, die Rockefeller Foundation, die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA und diverse andere Vereinigungen finanzieren im Rahmen des Verbundes die Suche nach neuen Tuberkulose-Behandlungsmethoden. So fließt auch Geld für die Erprobung einer Kombinationstherapie von Tbc-Arzneien mit BAYERs Antibiotikum AVALOX; speziell für diesen Forschungsansatz hat Bill Gates im Frühjahr 2006 noch einmal 100 Millionen Dollar locker gemacht. Das Präparat soll den Heilungsprozess beschleunigen, die Bildung Antibiotika-resistenter Bakterienstämme eindämmen und so die Überlebenschancen der PatientInnen erhöhen. In der Fachwelt ist das BAYER-Mittel allerdings umstritten. Der „Arzneimittelverordnungsreport ‚97“ zählt Antibiotika mit Wirkstoffen aus der Gruppe der Fluorchinole wie AVALOX aufgrund der vielen Nebenwirkungen zu den „nicht primär empfehlenswerten Substanzen“.
IG FARBEN & HEUTE
Britische SARIN-Experimente
1936 entwickelte der IG-FARBEN-Chemiker Gerhard Schrader das Giftgas SARIN, was dann auch im Namen zum Ausdruck kommt: S für Schrader und A für den Giftgas-Abteilungsleiter der von BAYER mitgegründeten IG FARBEN, Otto Ambros. Mit eben diesem Gas führte die britische Armee 1953 Experimente durch. In einer Militärklinik applizierten WissenschaftlerInnen SARIN auf die Haut von fünf Soldaten. Einer von ihnen, Ronald Maddison, starb eine Stunde später. Mehr als fünfzig Jahre nach seinem Tod entschuldigte sich die Regierung bei den Hinterbliebenen Maddisons und zahlte ihnen eine Entschädigung in Höhe von 146.000 Euro.
POLITIK & EINFLUSS
BAYER kooperiert mit dem BKA
Die Sicherheitsabteilungen der Konzerne im Ausland verfügen über mehr Personal als der Außendienst des Bundeskriminalamts. Deshalb sind die Multis nicht selten besser über die ETA in Spanien, das Organisierte Verbrechen in Russland oder islamistische Gefahren im Bilde als das BKA, bei dem viele der jetzigen Sicherheitsbeauftragen von BAYER & Co. ihre Karrieren begannen. Von diesem Wissensvorsprung will die Behörde jetzt profitieren und die Unternehmen im Gegenzug großzügiger mit Informationen versorgen. Zu diesem Behufe trafen sich im April 2006 ca. 70 WirtschaftsvertreterInnen mit den BKAlerInnen. „Es ist eine Tagung, wie es sie in dieser Form und Größenordnung noch nicht gegeben hat“, kommentierte die Hamburger Wochenzeitung Die Zeit den Schulterschluss zwischen den Executives und der Exekutive.
Wenning berät Merkel
BAYER-Chef Werner Wenning hat künftig einen ganz kurzen Dienstweg zu Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er gehört mit anderen Top-ManagerInnen dem vom ehemaligen Siemens-Chef Heinrich von Pierer geleiteten „Rat für Innovation und Wachstum“ an. Das Gremium will der Kanzlerin in nächster Zeit „to dos“ in Sachen „grüne Gentechnik“, „Unternehmenssteuerreform“ und „Forschungspolitik“ unterbreiten.
BAYER & Co. kritisieren Umweltpolitik
Der „Bundesverband der deutschen Industrie“ hat in Tateinheit mit der „Deutschen Industrie- und Handelskammer“ (DIHK) eine Kehrtwende in der Umweltpolitik gefordert. Die Lobbyvereine von BAYER & Co. kritisierten unter anderem die Vorschriften zur Luftreinhaltung, zum Deponierungsverbot von organischen Abfällen und zum Handel mit C02-Verschmutzungsrechten. Zudem nehmen die Verbände Anstoß an dem von der Bundesrepublik beschlossenen Kohlendioxid-Reduktionsziel von 40 Prozent bis zum Jahr 2020. „Diese Festlegung ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel“, so der DIHK-„Umweltexperte“ Hermann Hüwels.
Großzügige C02-Verschmutzungsrechte
Nach dem Gesetz der EU zum Emissionshandel dürfen BAYER & Co. nur bis zu einem bestimmten Oberwert CO2 ausstoßen, für darüber hinaus gehende Kontingente müssen sie Verschmutzungsrechte hinzukaufen. Dadurch hofften die PolitikerInnen Anreize für Investitionen in umweltschonender Technologie geschaffen zu haben, was die Wirtschaftslobby aber qua Durchsetzung großzügiger Bemessungsgrenzen zu verhindern wusste. In der ersten Runde teilte die Bundesregierung den Konzernen Verschmutzungsrechte zum Nulltarif zu. In der zweiten Zuteilung bekam die Stromwirtschaft nur 85 Prozent der benötigten Kohlendioxid-Zertifikate, die Industrie hingegen 98,5 Prozent. BAYER & Co. müssen also gerade mal Verschmutzungsrechte in der Größenordnung von 1,5 Prozent erwerben oder ihren CO2-Ausstoß entsprechend senken. Als Grund für die schonende Behandlung der Unternehmen gab die Bundesregierung an, deren Wettbewerbsfähigkeit nicht unnötig gefährden zu wollen. Das Erreichen der Klimaschutzziele rückt damit in weite Ferne.
Stromsubvention für BAYER & Co.
Wenn in der Bundesrepublik Branchen wie z. B. die Chemie-Industrie besonders viel Energie und Strom verbrauchen, so belohnt sie der Gesetzgeber. Er ersparte BAYER & Co. den vollen Ökosteuer-Satz und plant jetzt weitere Entlastungen. Die große Koalition will unter anderem die Chemie-, Metall- und Baustoff-Industrie von der Energie- und Stromsteuer befreien. Das Steuergeschenk kostet 20 Millionen im Jahr, und auch die Finanzierung geht zu Lasten der Umwelt. Finanzminister Peer Steinbrück besorgt das Geld nämlich durch eine Kürzung der Biokraftstoff-Förderung.
Zuviel Staat in China
Chinas Wirtschaft boomt. Eine Studie der DEUTSCHEN BANK prognostiziert für die Chemie-Industrie alle zwölf Monate Umsatzsteigerungen von zehn Prozent bis zur Marke „400 Milliarden Dollar“ im Jahr 2015. Aber BAYER und die anderen im Land vertretenen Global Player plagen auch Sorgen. So betätigen sich die in Staatsbesitz befindlichen Chemie-Unternehmen als Aufseher über ihre ausländische Konkurrenz. Zudem ist die Zulassung von neuen Produkten mit hohem bürokratischen Aufwand verbunden. Darum haben BAYER & Co. jetzt über die Europäische Handelskammer die Errichtung einer unabhängigen Regulierungsbehörde und einen Rückzug des chinesischen Staates aus dem Wirtschaftsleben gefordert.
BAYER reist mit Merkel nach China
Wenn ein(e) bundesdeutsche Kanzler(in) eine Reise tut, darf Begleitung von BAYER & Co. nicht fehlen. Die Deutschland AG bestimmte diesmal sogar die Planung des Trips und erreichte eine Vorverlegung des eigentlich erst für den Herbst geplanten Besuches. Den Bossen schien angesichts der Aktiviäten anderer Länder Eile geboten, konnte doch in der Vergangenheit die ausländische Konkurrenz „bei Auftragsvergaben viel häufiger (...) mit einem Regierungsvertreter aus der Heimat punkten“, wie die Bosse beklagten. Auch die Agenda Angela Merkels diktierten die Industrievertreter. So setzten sie der Bundeskanzlerin die immer wieder von chinesischen Unternehmen begangenen Patentverletzungen auf die Tagesordnung. Gegen diese ist der Leverkusener Multi Ende November 2005 sogar gerichtlich vorgegangen. Er verklagte 17 in China ansässige Unternehmen, die BAYERs patentgeschützten Pestizid-Wirkstoff Imidacloprid in Europa vertreiben wollten.
BAYER will Sawicki nicht
Schwarz-Rot plant, zur Begrenzung der steigenden Medikamentenkosten eine „Zweitmeinungspflicht“ einzuführen, nach der ÄrztInnen, die eine neue und daher teurere Arznei verschreiben wollen, dieses nicht ohne den Segen eines zweiten Mediziners bzw. Medizinerin tun können. Zudem soll nach dem Willen der Bundesregierung das Kölner „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWIG) bei ihren Expertisen zu einzelnen Medikamenten künftig das Preis/Leistungsverhältnis stärker in die Bewertung einfließen lassen. Nach längeren Verhandlungen stimmte der von BAYER gegründete „Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller“ dem Vorhaben zu. Im Gegenzug verlangte er aber die Ablösung des IQWIG-Chefs Dr. Peter Sawicki. Aus der Sicht BAYERs wundert das kaum. Sawicki hat sich nämlich in der Vergangenheit immer wieder kritisch über Wirkungen und Nebenwirkungen von BAYER-Arzneien wie GLUCOBAY, ADALAT und TRASYLOL geäußert.
Forschen ohne Haftung
Da haben die LobbyistInnen von BAYER & Co. mal wieder ganze Arbeit geleistet. Bundesforschungsministerin Annette Schavan kündigte an, die GenwerkInnen künftig unbeschwerter forschen zu lassen und ihnen eine Haftung für eventuelle Labor-GAUs zu ersparen. Ein entsprechendes Gesetz ist bereits in Vorbereitung.
EU: Gentech-Gesetz vertagt
Die sonst so regelungswütige EU lässt sich in Sachen „einheitliche Richtlinien für die grüne Gentechnik“ Zeit. Noch immer dürfen die Mitgliedsländer nach eigenem Gusto Lizenzen für Freisetzungsversuche an BAYER & Co. vergeben und Abstandsbestimmungen festlegen, weshalb vor allem Spanien zur Gentech-Spielwiese für die Agromultis mutiert. Als „unfähig“ bezeichnete die grüne EU-Parlamentarierin Hiltrud Breyer die EU-Kommission deshalb. Diese zeigte sich aber von der Kritik unbeeindruckt und sah auch im April 2006 auf einer Gentechnik-Konferenz in Wien keinen erhöhten Handlungsbedarf für eine einheitliche gesetzliche Lösung.
Verheugen gegen Gentechnik-Blockade
BAYER, BASF sowie andere europäische Gengiganten riefen, und EU-Kommissar Günter Verheugen kam und lieferte den Konzernen die gewünschte Rückendeckung in Sachen „grüne Gentechnik“. Auf einem Kongress des Lobbyclubs „EuropaBio“ im September 2005 bezeichnete er die Förderung von Gentech-Entwicklungen als wichtigstes Ziel seiner Amtszeit. „Neue Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft, höhere Ernteerträge, bessere Futter- und Lebensmittelqualität und erneuerbare Ressourcen“ - dies alles und noch viel mehr hält die Risikotechnologie seiner Meinung nach bereit. Nur noch ein Problem gibt es, die vielen EuropäerInnen, die sich dieser Meinung partout nicht anschließen mögen und Druck auf ihre ParlamentarierInnen ausüben. Genau da will Verheugen jetzt ansetzen. „Wir werden Gespräche mit den Mitgliedsstaaten führen müssen“, kündigte er zur Freude von BAYER & Co. an.
EPA-Bediensteter in Diensten von BAYER & Co.
Ein hochrangiger Angestellter der US-Umweltbehörde EPA hat die Seiten gewechselt und bei einer Rechtsanwaltskanzlei angeheuert, die vorrangig Chemiemultis vertritt. In Sachen „Pestizidversuche an Menschen“ legte James Aidala sich für seine neuen Herren schon einmal mächtig ins Zeug und focht bei einem Meeting mit der Bush-Administration engagiert dafür, BAYER & Co. auch noch zu erlauben, ihre Ackergifte an Kindern zu testen (s. u.).
Pestizidtests an Kindern?
Anfang des Jahres hat die US-Umweltbehörde EPA dem Druck von BAYER & Co. nachgegeben und Menschenversuche mit Pestiziden erlaubt. Die Konzerne spekulieren nämlich darauf, dass die Gifte im Inneren des homo sapiens längst nicht solchen Schaden anrichten, wie vom „Tiermodell“ aus hochgerechnet, und erwarten von den Erprobungen am Menschen eine Lockerung der Grenzwerte. Aber die Lösung geht ihnen noch nicht weit genug. Jean Reimers von BAYER CROPSCIENCE, andere Industrievertreter sowie der Lobbyist James Aidala (s. o.) forderten die Bush-Administration bei einem Meeting im Weißen Haus auf, auch Pestizidtests mit Kindern und schwangeren Frauen zu erlauben.
Emanzipation in Leverkusen?
Diese Klarstellung war anscheinend nötig: „Werner Wenning ist nicht der zweite Bürgermeister von Leverkusen“, betonte Ernst Küchler (SPD) als erster Bürgermeister der Stadt - „und man ahnt, dass es unter den Vorgängern schon mal anders war“, kommentierte die Zeit. Aber der zivilcouragierte OB zerrte an der Leine und wartete gar nicht erst auf das Plazet von BAYER zum geplanten Abriss des ehemaligen Konzern-Kaufhauses sowie des Rathauses. Er fasste sich ein Herz, klopfte selbst beim Oberbayer an und wurde doch tatsächlich mit einem gnädigen „Mach mal“ belohnt. Der erste Schritt in die Selbstständigkeit?
Pinkwart bei BAYER
Anfang Juni 2006 besuchte der NRW-Innovationsminister Andreas Pinkwart das Leverkusener BAYER-Werk, um eine vermeintliche Innovation in Augenschein zu nehmen: den mit Plaste & Elaste made by BAYER verfertigten neuen WM-Ball. Dieser ist jetzt nämlich dank der mittels BAYER-Kunststoffen zu Wege gebrachten Erhöhung der Schichtdicke des Obermaterials noch runder! Nur 1 Prozent fehlt noch zur physikalisch korrekten Kugel. Der Minister kriegte sich kaum wieder ein. „Dieser Ball und die darin steckende Materialforschung ist ein gutes Beispiel für die Innovationskraft des Landes“, lobte er.
MCS darf es nicht geben
Der an multipler Chemikalienunverträglichkeit (MCS) leidende Stefan Reiring kämpft seit langem für seine Rechte und hat es tatsächlich geschafft, dass die Rentenversicherung MCS bei ihm als Krankheit anerkennt. Im Zuge dieser Arbeit hat er minutiös dokumentiert, wie BAYER & Co. versuchen, diese Erkrankung als eine psychisch bedingte abzutun, um ungefährdet weiterhin gesundheitsschädliche Chemikalien produzieren zu können. Als ein Instrument hierfür gilt ihnen die „Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin“, der neben BAYER, BASF, SHELL, WACKER-CHEMIE, zahlreiche andere Konzerne sowie Berufsgenossenschaften und UniversitätsvertreterInnen angehören. Die Gesellschaft produziert dann auch Entlastungsgutachten auf Bestellung, wobei die der Einrichtung verbundenen WissenschaftlerInnen nicht mal vor Fälschungen zurückschrecken, um die Existenz der multiplen Chemikalienunverträglichkeit zu leugnen.
Bushs‘ Gesundheitsreform
Die Wahlkampf-Spenden des Leverkusener Chemie-Multis für George W. Bush in Höhe von 120.000 Dollar zahlen sich aus (siehe auch Ticker 2/03). Der US-Präsident brachte eine für die Pharmariesen äußerst lukrative Gesundheitsreform auf den Weg. Er führte eine Krankenversicherung mit Kopfpauschale ein, welche die MitgliederInnen monatlich 25 Dollar kostet, dazu kommen noch diverse Zuzahlungen. Zu den prominentesten Kritikern des so genannten Prescription Drug Plans zählt der demokratische Senator Edward Kennedy. Er zitierte Berechnungen, nach denen 61 Prozent des Krankenversicherungsgeldes als Profite bei BAYER & Co. landen.
PROPAGANDA & MEDIEN
Werbung für ASPIRIN als Herzmittel
Die herzinfarkt-vorbeugende Wirkung von ASPIRIN ist in der Fachwelt sehr umstritten (siehe auch DRUGS & PILLS). Trotzdem wirbt BAYER in großen Anzeigen für ASPIRIN als Mittel zur Stärkung des Herzens.
Neue VFA-Kampagne
Der von BAYER gegründete „Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller“ (VFA) hat eine neue Kampagne gestartet. Unter dem Motto „Forschung ist die beste Medizin“ wirbt der Lobby-Verein für die ach so innovativen Pharmariesen. Leider ist es mit ihrem Erfindungsreichtum nicht allzu weit her. So verbucht die US-Gesundheitsbehörde FDA nur knapp ein Viertel der 995 seit 1990 in den Vereinigten Staaten neu zugelassenen Medikamente unter der Rubrik „medizinischer Fortschritt“. Bei drei Viertel von ihnen handelt es sich dagegen um Schein-Innovationen, welche bloß die Funktion haben, ökonomische Fortschritte für BAYER & Co. einzuleiten. Zudem haben in sehr vielen Fällen staatliche Forschungseinrichtungen die Grundlage für bislang unbekannte Arznei-Therapien gelegt, und die Kreativität von BAYER & Co. bestand lediglich darin, dieses Wissen einzukaufen.
TIERE & VERSUCHE
Wieder mehr Tierversuche
Seit 1997 steigt die Zahl der Versuchstiere wieder kontinuierlich. Verendeten in jenem Jahr „nur“ 1,5 Millionen Kreaturen in den Laboren von BAYER & Co., so starben 2004 bereits 2,2 Millionen einen grausamen Tod. Tatsächlich dürften es noch eine halbe Million mehr sein, denn neuerdings finden die vor allem in der Grundlagenforschung vorgenommenen Tötungen zu wissenschaftlichen Zwecken keine Aufnahme in die Statistiken mehr.
DRUGS & PILLS
Pillen-Paradies USA
In den USA betragen die Gesundheitskosten 14 Prozent des Bruttosozialproduktes. Einen großen Anteil daran haben die exorbitant hohen Pillenpreise, welche die Vereinigten Staaten zu einem Profit-Paradies von Big Pharma machen. Die Pro-Kopf-Ausgaben für Medikamente belaufen sich auf jährlich 728 Dollar - zum Vergleich: In der Bundesrepublik sind es „nur“ 393 Dollar. Als Folge davon stehen staatliche Einrichtungen wie „Medicaid“, die für sozial Schwache die Arznei-Kosten übernehmen, vor dem Finanzkollaps. Auf 14 Milliarden beläuft sich allein in Florida ihr jährlicher Etat. Die bisherigen Steigerungsraten zugrunde gelegt, müsste der Bundesstaat 2015 bereits 60 Prozent seines gesamten Haushaltes für „Medicaid“ aufwänden.
Patentschutz ist Profitschutz
Über die Apotheken-Theken gehen in der Bundesrepublik zu 53 Prozent Nachahmerpräparate, zu 27 Prozent patentgeschützte Arzneien und zu 20 Prozent Originalmedikamente, deren Patent abgelaufen ist. Aber der Umsatz-Anteil der patentgeschützten Pillen beträgt 61 Prozent. Darum versucht BAYER mittels Scheininnovationen wie etwa CIPROBAY zum Inhalieren die Lizenz zum Gelddrucken möglichst lange zu behalten.
Pillen im Praxistest
Unbedarfte ZeitgenossInnen halten es für den Zweck von Arzneimitteltests, den Risiken und Nebenwirkungen der Präparate auf die Spur zu kommen. Weit gefehlt. Die von BAYER & Co. durchgeführten Untersuchungen sollen vor allem die Wirksamkeit der getesteten Substanz belegen und werden auch so gestaltet. Bei dem so genannten „Studien-Design“ arbeiten die PharmakologInnen mit viel Fingerspitzengefühl daran, gerade so viele Testpersonen zu haben, um den pharmazeutischen Effekt belegen zu können. Sie wissen nämlich genau, dass eine Ausweitung der Testzone auch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Nebenwirkungen erhöht und so die Zulassung gefährdet. So stellen sich bei 20 bis 25 Prozent aller neu auf den Markt gekommenen Medikamente unerwünschte Arzneieffekte ein, welche die Pharma-ForscherInnen während der klinischen Erprobungen „übersehen“ hatten. Großbritannien hat darauf jetzt reagiert und BAYER & Co. verpflichtet, auf den Packungen der Neuheiten als Warnhinweis ein schwarzes Dreieck anzubringen. Auch erstatten ihnen die Krankenkassen in der „Bewährungszeit“ ebenso wenig den vollen Preis für die Arznei wie sie es in den meisten anderen Ländern tun - die Bundesrepublik bildet da eine unlöbliche Ausnahme.
Pharma-DrückerInnen im Krankenhaus
BAYER & Co. nutzen massiv Krankenhäuser als Startrampen zur Einführung neuer Arzneien. Die Pharma-Riesen gewähren den Kliniken großzügige Rabatte für die Pillen und spekulieren dann darauf, dass die HausärztInnen der PatientInnen die Medikation zu normalen Marktkonditionen fortführen, was diese allzuoft auch tun.
Pharma-DrückerInnen in Praxen
An 170 Tagen im Jahr erhält eine bundesdeutsche MedizinerInnen-Praxis durchschnittlich Besuch von einem der 15.500 Pillen-ReferentInnen in Diensten von BAYER & Co.
ASPIRIN: Kein Herzinfarkt-Schutz
Die vorbeugende Einnahme von ASPIRIN schützt Frauen nicht vor Herzinfarkten. Dies ergab eine Untersuchung mit 40.000 weiblichen Probandinnen, welche ein WissenschaftlerInnen-Team um Paul Ridger von der Harvard Medical School vorgenommen hat. Bei Schlaganfällen stellten die ForscherInnen indes einen geringen prophylaktischen Effekt fest. Die Nebenwirkungen überwogen allerdings die von BAYER eifrig beworbenen Wirkungen: Bei den Testpersonen kam es teilweise zu schweren Blutungen.
Streit um ASPIRIN-Resistenz
In den USA gelang es BAYER mit einem großem Werbe-Aufwand, ASPIRIN als herzinfarkt-vorbeugendes Medikament zu etablieren, obwohl diese Wirkung in der Fachwelt umstritten ist (s. o.). Jetzt aber droht die Kampagne ein Opfer ihres Erfolges zu werden. In den medizinischen Zeitschriften mehren sich die Artikel über eine ASPIRIN-Resistenz. Allerdings haben viele AutorInnen Verbindungen zu Pharma-Konzernen, die ASPIRIN-Tests oder Alternativ-Produkte herstellen. WissenschaftlerInnen mit - nicht immer offen gelegten - Verbindungen zu BAYER wiederum schreiben fleißig Entwarnungsaufsätze, so dass sich die Medienmanipulationen gegenseitig neutralisieren und unbeteiligte BeobachterInnen gar nicht mehr wissen, was nun eigentlich Sache ist.
Asthma durch CIPROBAY & Co.
Mit Antibiotika wie BAYERs CIPROBAY behandelte Kleinkinder tragen ein höheres Risiko, im späteren Leben an Asthma zu erkranken. Dies ergab eine Studie eines WissenschaftlerInnen-Teams unter Leitung von Fawziah Marra, die an der Universität von British Columbia in Vancouver durchgeführt wurde. Marra kritisierte deshalb die gängige Verschreibungspraxis der MedizinerInnen, die sogar Antibiotika-Rezepte ausstellen, wenn CIPROBAY & Co. - wie im Fall von Virus-Infektionen - gar nichts ausrichten können.
Höheres Infarkt-Risiko durch ADALAT
Nach einer bereits 1995 von Dr. Bruce Psaty im Journal of the American Medical Association (JAMA) veröffentlichten Studie senken BAYERs ADALAT und andere zur Bluthochdruck-Behandlung eingesetzte Kalzium-Antagonisten das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko der PatientInnen nicht in dem Maße wie die - weit billigeren - Entwässerungstabletten (Diuretika). Der Hersteller PFIZER reagierte sofort und machte Psatys Universitätsleitung Druck. Auch der Leverkusener Pharmariese entfaltete Aktivitäten. Er ließ einen eingekauften Experten „Arztbriefe“ schreiben, in denen er versuchte, Entwarnung in Sachen „ADALAT“ zu geben. Aber das ging nach hinten los. „PFIZER hat mehr zur Bekanntheit unserer unerwünschten Studie beigetragen, als ich allein es je vermocht hätte. Und BAYER vielleicht auch“, sagte der Mediziner. Die US-Gesundheitsbehörde FDA änderte im Jahr 2003 aufgrund der Erkenntnisse von Psaty ihre Behandlungsrichtlinien für Bluthochdruck und empfahl Diuretika statt Kalzium-Antagonisten. BAYER & Co. interventierten umgehend und hatten nach langer Arbeit 2006 schließlich Erfolg. Die FDA berief 12 ExpertInnen zur Ausarbeitung neuer Therapieregeln, von denen acht Verbindungen zur Pharma-Industrie hatten, unter ihnen William R. Hiatt, der im Auftrag BAYERs die segensreiche Wirkung von ADALAT bei infarktgefährdeten DiabetikerInnen entdeckte. Und so bekam die Behörde, was sie bestellte. „Eine Vielzahl von Arzneien unterschiedlicher Medikamentenklassen, deren einzige Gemeinsamkeit es ist, den Bluthochdruck zu senken, können das Herzinfarktrisiko reduzieren“, stellte das abhängige Gremium fest und rehabilierte ADALAT & Co. damit wieder.
Vitamine senken Cholesterinspiegel nicht
Nach einer an der Universität Köln von Dr. Heiner Berthold durchgeführten Studie ist BAYERs Vitamin-Präparat ONE-A-DAY-CHOLESTEROL PLUS ebenso wenig wie vergleichbare Mittel geeignet, den Cholesterinspiegel zu senken. Die Cholesterin-Werte der pillenschluckenden Testpersonen unterschieden sich von den aus der Plazebogruppe nicht. Damit dokumentierten die WissenschaftlerInnen die Wirkungslosigkeit des ONE-A-DAY-CHOLESTEROL PLUS-Inhaltstoffes Policosanol, eines alkoholischen Zuckerrohr-Exstraktes.
GENE & KLONE
Gentech stillt Hunger nicht
BAYER-ManagerInnen preisen gentechnisch veränderte Pflanzen gerne als Mittel zur Lösung des Hungerproblems an. Dieses Argument findet jedoch immer weniger FürsprecherInnen. So erklärte der Generalsekretär der Welternährungsorganisation FAO, Jacques Diouf, 2005 auf einer Konferenz in Kopenhagen: „Bei dem Ziel, die Halbierung der Zahl der Hunger leidenden Menschen bis 2015 zu erreichen, hat der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen keine Priorität“. Dazu wären nach Meinung des Wissenschaftlers Harald Witt vielmehr Maßnahmen wie die Züchtung dürreresistenter Pflanzen, eine Verbesserung der Bewässerung und Investitionen in die Infrastruktur nötig.
Kritik an EU-Lebensmittelbehörde
Die innerhalb der EU für die Genehmigung von Gentech-Pflanzen zuständige Lebensmittelbehörde EFSA sieht sich wachsender Kritik ausgesetzt. Die Institution entscheidet nämlich stets nach der Aktenlage der Konzerne. Ohne eigene Untersuchungen zu Risiken und Nebenwirkungen der Laborfrüchte durchzuführen, bilden alleine die Unterlagen von BAYER & Co. die Grundlage für ihre Urteile, die infolgedessen auch allzu oft positiv ausfallen. Umweltkommissar Stavros Dimas räumte auf einer Konferenz in Wien dann auch Handlungsbedarf ein. „Viele Mitgliedsstaaten fordern, mögliche Langzeiteffekte auf die Umwelt stärker zu berücksichtigen“, so Dimas. Er sicherte deshalb zu, die Arbeitsweise der EFSA zu überprüfen. Aber eine Reform dürfte sich gegenüber der sehr industrie-freundlichen EU-Kommission nur sehr schwer durchsetzen lassen.
Genreis-Sicherheitsstudie fehlt
Der Leverkusener Chemie-Multi hatte bei der EU vor einiger Zeit einen Antrag auf Import-Genehmigung für eine gentechnisch gegen das Anti-Unkrautmittel LIBERTY LINK (Wirkstoff: Glufosinat) resistent gemachte Reis-Sorte gestellt. Die zuständigen Stellen verlangten von BAYER jedoch zusätzliche Sicherheitsstudien. Da der Konzern diese nicht rechtzeitig beibringen konnte, verzögert sich die Entscheidung weiter.
Genreis in Südamerika
In Europa wagte es BAYER gar nicht erst, eine Anbaugenehmigung für genmanipulierten Reis zu beantragen, schon das Verfahren zur Erlaubnis des Genreis-Importes stellt den Konzern vor einige Probleme (s. o.). Deshalb hält das Unternehmen nach Ländern, die das alles nicht so eng sehen (können), Ausschau und versucht jetzt in Südafrika und Brasilien grünes Licht zum Anpflanzen des Labor-Reis' zu bekommen.
Tabakpflanzen gehen in Betrieb
Noch in diesem Jahr will BAYER den Startschuss zur Produktion von Proteinen mit Hilfe von Tabakpflanzen geben. Eine entsprechende Pilotanlage geht 2007 in Betrieb. Als „extrem preisgünstig“ rühmt der Konzern diese Herstellungsart und demonstriert damit einmal mehr, um was es sich bei der Gentechnologie vorrangig handelt: um ein Verfahren zur Kostensenkung.
SCHERINGs Gentech-Erbe
Mit dem Kauf von SCHERING gelangen neben KOGENATE und NEXAVAR mit BETAFERON und LEUKINE weitere Gentech-Medikamente in die Produktpalette von BAYER. Den Wachstumsfaktor LEUKINE mit dem Wirkstoff Sargramostim setzen MedizinerInnen in der Chemotherapie von älteren Leukämie-PatientInnen ein, um die Gefahr von Infektionen zu reduzieren. Bei dem Multiple-Sklerose-Präparat BETAFERON handelt es sich um alten Wein in neuen Schläuchen. Der Wirkstoff Interferon ist nämlich altbekannt, lediglich die Produktionsweise bedient sich gentechnischer Verfahren.
PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE
Totgeburten durch Pestizide
In den Gebieten um die mexikanischen Städte Villa Guerrero und Tenancingo, wo es sehr viele kleine BlumenzüchterInnen gibt, kommt es auffallend häufig zu Tot- und Missgeburten. Nach Meinung von WissenschaftlerInnen spielt dabei der Einsatz von hochgiften Pestizidwirkstoffen wie Monocrotophos und Methamidophos, die auch in BAYER-Ackergiften enthalten sind, eine große Rolle. Die zuständigen Behörden haben diese Agrochemikalien schon vor längerer Zeit verboten, aber da die Mittel weniger kosten als neue, bieten Händler sie den ZüchterInnen immer noch an. Aus dem gleichen Grund treibt Monocrotophos auch in Indien noch sein Unwesen (siehe auch SWB 2/06).
Biozidrückstände in Kartoffeln
Auch nach der Ernte bleiben viele Ackerfrüchte nicht vor Pestiziden verschont. Um beispielsweise das Auskeimen von Kartoffeln zu verhindern, behandeln die LandwirtInnen sie mit Chemikalien wie Chlorpropham oder Thiabendazol, wie sie auch BAYER anbietet. Diese Substanzen lassen sich dann auch in den Knollen nachweisen. So hat das Lebensmittelinstitut Oldenburg in 39 Prozent aller untersuchten Proben Rückstände von Chlorpropham gefunden, die aber glücklicherweise alle unter der gesetzlich festgelegten Höchstgrenze lagen.
Chlorpyrifos schädigt den Organismus
Chlorpyrifos, Wirkstoff der BAYER-Insektenmittel BLATTANEX, PROFICID und RIDDER, greift schon in geringsten Dosen das Nervensystem an. Nach einem von J. E. Aldridge und anderen ForscherInnen in der Zeitschrift Environmental Health Perspectives veröffentlichten Aufsatz steigert es den Ausstoß des Botenstoffes Serotonin, was zu Depressionen und Verhaltensstörungen führen kann. Einer in dem Fachorgan Epidemiology publizierten Untersuchung zufolge senkt Chlorpyrifos zudem den Testosteron-Spiegel im Körper und wirkt sich so schädigend auf die Fruchtbarkeit aus. Trotz zahlreicher ähnlicher Befunde über neurotoxologische Risiken und Nebenwirkungen von Chlorpyrifos hat die EU HobbygärtnerInnen und LandwirtInnen die Anwendung des Organophosphates weiterhin erlaubt. Die Zulassung als Haushaltsinsektizid unterzieht Brüssel gerade einer Überprüfung.
Obst und Gemüse voller Pestizide
Die EU fahndete in 60.000 im Jahr 2004 genommenen Lebensmittelproben nach Pestiziden und wurde fast jedes zweite Mal fündig. 47 Prozent des Obstes und Gemüses wiesen Spuren von Agrochemikalien auf - so viel wie nie seit den 1996 begonnenen Tests. Zu allem Unglück tummelten sich in mehr als einem Fünftel der Proben gleich mehrere Ackergifte von BAYER & Co.. „Die Lage ist inzwischen ernst“, kommentierte der GREENPEACE-Chemieexperte Manfred Krautter die Untersuchungsergebnisse, „doch während Chemieindustrie und Landwirte immer mehr Gifte auf Äckern und Obstplantagen spritzen, greifen weder EU-Kommission noch die Verbraucher- und Landwirtschaftsminister der Länder gegen die steigende Giftbelastung ein“.
Sichere Lebensmittel durch BAYER?
„Lebensmittel waren noch nie so sicher wie heute. Damit dies auch so bleibt, hat BAYER CROPSCIENCE (BCS) ein “Food Chain Team„ eingerichtet, das in Zukunft Obst- und Gemüsebauern, Lebensmittelproduzenten, Importeure und Händler weltweit in allen Belangen der Produktionen unterstützen will“, vermeldet das Propagandaorgan BAYER report. Es verhält sich wohl eher so: Die ständigen Meldungen über Pestizid-Rückstände in Lebensmitteln drohen sich mittlerweile geschäftsschädigend auszuwirken, so dass der Konzern sich zumindest zu symbolischen Aktionen zur Herauslösung der Pestizidkette aus der Nahrungskette veranlasst sah.
Bienensterben geht weiter
Die Meldungen über das Sterben von Bienenvölkern, die Agrochemikalien zum Opfer fallen, reißen nicht ab. Im Frühjahr wandten sich ein spanischer und ein serbischer Imker mit der Bitte um Informationen zum BAYER-Pestizid GAUCHO, das in Frankreich wegen seiner bienenschädlichen Wirkung für einige Anwendungen bereits verboten ist, an die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (siehe auch RECHT & UNBILLIG).
WASSER, BODEN & LUFT
Weitere Chrom-Untersuchungen
Das Grundwasser in der Umgebung des im südafrikanischen Durban gelegenen BAYER-Werks ist stark durch Krebs erregende Chrom-Verbindungen belastet (siehe auch SWB 4/04). Auf Druck der Initiative SOUTH DURBAN ENVIRONMENTAL ALLIANCE haben die ManagerInnen der jetzt zu LANXESS gehörenden Niederlassung mit der Sanierung begonnen und einen Austausch der Wasserrohre veranlasst. Aber kooperationswillig zeigt sich die Chefetage nur bedingt. So hat sich LANXESS nicht an die Zusage gehalten, gemeinsam mit den UmweltschützerInnen entnommene Wasserproben auch im Labor zu analysieren.
GIFTIG & ÄTZEND & EXPLOSIV
PCBs beeinflussen weiblichen Zyklus
Polychlorierte Biphenyle (PCB) verändern den Menstruationszyklus. Das haben WissenschaftlerInnen des „National Institute of Health“ herausgefunden. Sie untersuchten 2.300 Frauen und stellten einen Zusammenhang zwischen einer erhöhten PCB-Menge im Blut und einem verlängerten Zyklus fest. Bis zu ihrem Verbot 1985 gehörte der Leverkusener Multi zu den Hauptanbietern der hauptsächlich als Weichmacher, Kühlmittel oder Isoliermaterial verwendeten Substanz, die sich nur äußerst langsam abbaut und deshalb immer noch ihre gesundheitsschädliche Wirkung entfaltet.
Bisphenol bis zum bitteren Ende
Die EU zeigt sich von neueren Untersuchungen zur Gefährlichkeit von Bisphenol A (siehe Ticker 1/06) unbeeindruckt. Nach Ansicht der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit hat Biphenol A, das unter anderem in Innenbeschichtungen von Konservendosen Verwendung findet, weder eine Krebs erregende noch eine Erbgut schädigende Wirkung, wenn die Aufnahmemenge 0,15 Milligramm pro Kilo Körpergewicht nicht übersteigt. BAYER braucht sich um den Absatz der Chemikalie also vorerst keine Sorgen zu machen.
Giftige Gerbstoffe in Schuhen
Nach einer Stichproben-Untersuchung der WDR-Sendung markt befinden sich in vielen Schuhen giftige Chemikalien. Jedes dritte der 20 getesteten Sandalen-Paare wies eine Chrom-(VI)-Konzentration auf, die über dem zulässigen Grenzwert lag. Das Metall kann Allergien und in höheren Konzentrationen auch Krebs auslösen. Den Anfang der Produktionskette von Chrom (VI) fand das TV-Team in einer Gerberei: ein dicker Sack mit BAYERs CHROMOSOL. Dabei handelt es sich um einen Stoff zum Gerben des Leders. Immer wenn nach dem Gerbprozess Chromverbindungen im Leder verbleiben, können sie mit Sauerstoff reagieren, woraus dann die gefährliche Chrom (VI)-Verbindung entsteht.
PLASTE & ELASTE
BAYER investiert 700 Millionen
BAYER MATERIAL SCIENCE will bis 2008 die Summe von 700 Millionen Euro investieren. Einen Großteil der Summe steckt der Teilkonzern in Errichtung bzw. Ausbau von Fertigungsstätten in China. Ein weitere Teil geht ins US-amerikanische Baytown, wo das Unternehmen die gefährliche Chlorchemie vorantreiben will. Der Rest bleibt für den Umbau der MATERIAL SCIENCE-Zentrale in Leverkusen übrig.
NANO & CO.
BAYER entwickelt Nanoröhrchen
Die Nanotechnik arbeitet mit mikroskopisch kleinen Werkstoffen. BAYER hat nach diesem Verfahren jetzt winzige Kohlenstoff-Röhrchen entwickelt, die andere Materialien leitfähiger machen oder elektromagnetisch abschirmen. Aber aus medizinischer Sicht gilt das „small is beautiful“ nicht. UmweltschützerInnen warnen vor der Nanotechnologie, weil bei der Fertigung der feinen Substanzen ebenso feine Stäube entstehen, die alle Filteranlagen passierend in die Luft gelangen - und von dort auch in den menschlichen Organismus, wo sie Atemwegserkrankungen auslösen können. Auch zur Produktsicherheit von Waren mit Nanoteilchen bestehen noch viele Fragen.
BAYER macht bei „Nanocare“ mit
Wer wäre geeigneter, die Gefährlichkeit der Nanotechnologie (s. o.) zu untersuchen, als die Konzerne, die mit dieser viel Geld verdienen wollen, dachte sich die Bundesregierung und unterstützt einen Forschungsverbund von BAYER und anderen Konzernen, Universitäten und Forschungseinrichtungen mit fünf Millionen Euro. 2,6 Millionen gibt die Industrie dazu, damit sie an Ergebnissen auch tatsächlich das bekommt, was sie haben will.
STANDORTE & PRODUKTION
Pipeline für BAYER & Co.
Seit 1998 plant das Land Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit BAYER & Co. ein Pipeline-System zum Transport des Kunststoff-Vorproduktes Propylen, das die Hafenstädte Rotterdam und Antwerpen mit den Chemie-Standorten der Region verbindet. Als ein Zeichen dafür, „dass wir die chemische Grundversorgung erstmals als eine öffentliche Infrastruktur-Aufgabe sehen“, wollte der ehemalige Landesvater Wolfgang Clement das Röhrenwerk verstanden wissen. Im Januar 2006 bewilligte die EU das Vorhaben und sicherte auch finanzielle Unterstützung zu. Zu den Kosten von 200 Millionen Euro steuert Brüssel nicht weniger als 22 Millionen bei, das Land NRW überweist 18,7 Millionen, und für den Rest kommt ein von BAYER & Co. gegründetes Konsortium auf. Wirtschaftsministerin Christa Thoben begründete die angesichts der Kassenlage unerwartete Spendabilität der Landesregierung arbeitsmarktpolitisch: „Das Projekt sichert 10.000 Arbeitsplätze in NRW“, so die CDU-Politikerin.
Aus für Feuerwehr in Wolfenbüttel
Schon seit geraumer Zeit versucht BAYER, die Werksfeuerwehren überall, wo es geht, aufzulösen. Nachdem der Konzern die BrandlöscherInnen in Wuppertal abwickelte (Ticker 1/06), mussten jetzt die Wolfenbütteler KollegInnen dran glauben. Da der Agromulti an diesem Standort die Pestizidwirkstoff-Produktion aufgab, entfiel auch die gesetzliche Pflicht, eine eigene Feuerwehrtruppe zu unterhalten, was das Unternehmen sich nicht zweimal sagen ließ. So sparte es einmal mehr auf Kosten der Sicherheit.
IMPERIUM & WELTMARKT
BAYER verkauft Infektiva-Sparte
Der Leverkusener Multi zählt Medikamente zur Behandlung von Infektionskrankheiten nicht länger zu seinem „Kerngeschäft“ und verkaufte die Sparte an die SANTO HOLDING AG.
BAYER verkauft Impfstoff-Werk
Der Leverkusener Multi hat ein Werk in Köln, das Impfstoffe gegen die Maul- und Klauenseuche herstellte, an AKZO-NOBEL verkauft. Wieviele Arbeitsplätze der Deal kosten wird, teilten die Unternehmen nicht mit.
BAYER big in Japan
Der Leverkusener Multi will in den nächsten zwei Jahren 130 Millionen Euro in Japan investieren, wobei Aufwändungen für die Instandhaltung der Produktionsanlagen und für Informationstechnik den Schwerpunkt bilden.
Chinas Gesundheitsmarkt wächst
Die chinesische Regierung plant, in die medizinische Versorgung zu investieren, das Krankenversicherungssystem auszubauen und privat betriebene Apotheken und Krankenhäuser zuzulassen. Unter den Pharmamultis hat dies eine Goldgräberstimmung ausgelöst. Mit einem Umsatz von 250 Millionen Dollar siebtgrößter Pillenproduzent im Land, erwartet BAYER nun kräftige Ertragssteigerungen. Binnen weniger Jahre will es der Leverkusener Multi in dem Land zudem in die Top 3 der Pillenriesen schaffen.
POLITIK & ÖKONOMIE
BAYER die Nr. 57
In der Rangliste der weltweit größten Industrie-Unternehmen nimmt BAYER Platz 57 ein. In der Bundesrepublik ist der Konzern die Nummer 10.
PRODUKTION & SICHERHEIT
Mehr Krebs in Addyston
In Addyston, dem US-amerikanischen Standort von BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS im Bundesstaat Ohio, gehören Störfalle zum Normalfall. Seit der Leverkusener Multi das Werk 1996 von MONSANTO übernahm, ereigneten sich dort 66 Unfälle. Im Herbst 2004 traten zweimal in kurzen Abständen die Krebs erregenden Chemikalien Acrylonitril und Butadien aus. Nach diesen GAUs hat die US-Umweltbehörde EPA eine Untersuchung über die Häufigkeit von Krebs in Addyston angeordnet. Das Ergebnis war erschreckend. Die Erkrankungsrate lag 76 Prozent über dem Landesdurchschnitt.
EU lehnt Phosgen-Beschwerde ab
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hatte im Jahr 2004 gemeinsam mit dem BUND bei der EU eine Beschwerde zur Erweiterung der Phosgen-Produktion im Uerdinger BAYER-Werk eingereicht. Die Gefährlichkeit des Gases im Allgemeinen und das Fehlen einer Umweltverträglichkeitsprüfung im Besonderen hatten die beiden Initiativen zu diesem Schritt veranlasst. Zwei Jahre später (!) kam nun die Antwort. Weder an der von BAYER über die Phosgen-Produktion verhängten Nachrichtensperre noch an dem ausbleibenden Sicherheitscheck nahm die Europäische Union Anstoß.
RECHT & UNBILLIG
Privatklage wg. Kunststoff-Kartell
Kartelle sind Vereinbarungen von Großkonzernen zu Lasten dritter: der VerbraucherInnen. Sie müssen nämlich die erhöhten Preise, auf die sich die Multis geeinigt haben, zahlen. Aus diesem Grund hat im Mai 2006 die Kanadierin Anne Johnson BAYER, BASF und andere Firmen verklagt. Sie will nicht hinnehmen, wegen der von BAYER & Co. vorgenommenen Preisabsprachen im Kunststoffgeschäft ungebührlich viel für Autositze, Möbel, Hockeyschläger oder Isoliermaterial aus Schaumstoff auf den Tisch gelegt zu haben und verlangt von den Unternehmen eine Entschädigung in Höhe von 15 Millionen Dollar.
CIPROBAY-Freispruch aufgehoben
Im Jahr 1997 hatte BAYER einen Patentstreit mit dem Pharma-Unternehmen BARR beigelegt. Gegen die Zahlung von 400 Millionen Dollar willigte BARR ein, keine CIPROBAY-Nachahmerversion auf den Markt zu bringen, ehe der Patentschutz für das Antibiotikum ausläuft. Betroffene PatientInnen, die sich durch diese Einigung um ein preiswertes CIPROBAY-Generikum gebracht sahen, reichten wegen Verstoßes gegen das Kartellgesetz daraufhin eine Sammelklage ein. Im April 2005 wies ein Bundesgericht diese zurück. Knapp ein Jahr später jedoch hob eine höhere Instanz dieses Urteil auf, weshalb der Rechtsstreit „PatientInnen gegen BAYER“ in die nächste Runde gehen kann.
Süllhöfer gibt nicht auf
Seit nunmehr 35 Jahren prozessiert der Düsseldorfer Heinz Süllhöfer gegen BAYER, weil der Leverkusener Chemie-Multi sich seine Erfindung einer Kunststoffplatten-Maschine widerrechtlich angeeignet hat (Ticker berichtete mehrfach). Mittlerweile haben die juristischen Auseinandersetzungen seine finanziellen Mittel erschöpft. Deshalb beantragte er Prozesskosten-Beihilfe, um weiter für sein Recht streiten zu können. Das Gericht lehnte dieses jedoch ab, weil es bisher nicht zu einer strafrechtlichen Verurteilung von BAYER gekommen ist. Um diese herbeizuführen, reichte Süllhöfer unter Berufung auf einen ähnlich gelagerten Fall wiederum Klage ein, der die RichterInnen wiederum nicht stattgaben. Gegen das Urteil legte der ehemalige Hotelier Beschwerde ein. Eine Antwort steht noch aus.
Frankreich: GAUCHO bleibt verboten
Im Jahr 2004 untersagte der französische Staat die Ausbringung des BAYER-Pestizides GAUCHO auf Maisfeldern, da das Ackergift den Tod tausender Bienenvölker verursacht hatte. Der Leverkusener Multi legte gegen die Entscheidung Widerspruch ein, konnte sich aber nicht durchsetzen. Ende April 2006 bestätigten die zuständigen Stellen das Verbot.
Klage gegen AGFA GEVAERT
Ende 2004 hat die ehemalige BAYER-Tochter AGFA GEVAERT ihre Fotosparte an den Unternehmer Hartmut Emans veräußert. Ein halbes Jahr später war diese pleite. Emans gibt AFGA GEVAERT die Schuld an der Insolvenz und hat den belgischen Konzern vor einem Schiedsgericht auf eine Entschädigung in dreistelliger Millionen-Höhe verklagt. Emans wirft der AGFA-Muttergesellschaft vor, ihm durch den Entzug der Rechte an der Marke „AGFA“ eine erfolgreiche Geschäftspolitik unmöglich gemacht zu haben und ihn bei den Verhandlungen über die Ertragsaussichten von AGFA-PHOTO getäuscht zu haben. Bezifferte das AGFA GEVAERT-Management in dem Verkaufsprospekt die von 2005 bis 2007 zu erwartenden Gewinne auf 446 Millionen, so kam eine interne Vorstandsvorlage auf ein Minus von 477 Millionen. Zudem hat die Geschäftsleitung Einnahmen nicht an AGFA-PHOTO weitergeleitet.
AGFA-Beschäftigte erfolgreich
Auch nach Meinung des Solinger Arbeitsgerichtes ging es bei dem Verkauf von AGFA-PHOTO (s. o.) nicht mit rechten Dingen zu, weshalb noch Ansprüche ehemaliger Beschäftigter gegen die Muttergesellschaft AGFA GEVAERT bestehen. Mit ihrem Urteil gab sie einer Klage einstiger AGFA-PHOTO-WerkInnen statt, die noch ausstehende Zahlungen aus Vorruhestands- oder Altersteilzeit-Vereinbarungen eingeklagt hatten. Nach Meinung ihres Rechtsanwaltes könnte dieses Beispiel Schule machen und die AGFA GEVAERT Millionen kosten.
FORSCHUNG & LEHRE
Pittsburgh: BAYER stiftet Professu