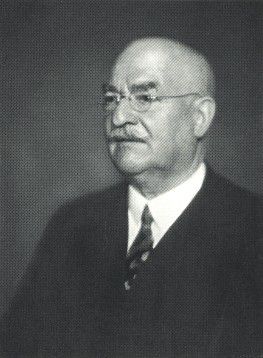AKTION & KRITIK
Erfolgreiche Jahrestagung
2014 fand die Jahrestagung der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) zum Thema „No Taxes – Die Steuerflucht großer Konzerne“ in einem etwas anderen Rahmen als gewohnt statt. Der Coordination war es nämlich gelungen, Sahra Wagenknecht von der Partei „Die Linke“ als Gastrednerin zu gewinnen, weshalb die CBG die Veranstaltung in den Bürgersaal der Düsseldorfer Arcaden verlegte. Und die Bundestagsabgeordnete enttäuschte die Erwartungen der 160 BesucherInnen nicht. Imposant schilderte sie die ganz legalen Steuertricks der Global Player, denen es gelingt, sich vornehmlich durch interne Geschäfte mit Waren, Krediten und Lizenzen so arm zu rechnen, dass – wie im Fall von IKEA – für den Fiskus gerade mal fünf Prozent vom Gewinn übrig bleiben. Axel Köhler-Schnura vom Vorstand der CBG skizzierte im Anschluss den größeren politischen Rahmen, der dieses Treiben überhaupt erst ermöglicht, und illustrierte schließlich am konkreten Beispiel „BAYER“ die gängigen Steuervermeidungsstrategien wie etwa diejenige, die BAYERs Finanz-Vorstand Werner Baumann „eine veränderte regionale Ergebnis-Verteilung“ nennt. Nach den Vorträgen entwickelte sich dann noch eine lebhafte Diskussion, so dass die BesucherInnen am Ende angeregt, ein bisschen klüger und hoffentlich motiviert zu einem Engagement gegen die Machenschaften von BAYER & Co. ihre Heimreise antraten.
CBG-Vortrag in Tutzing
Im August 2014 hatte die „Politische Akademie Tutzing“ die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) zu einem Vortrag eingeladen. CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes referierte im Rahmen des Seminars „Werte-Bildung im Chemie-Unterricht“ vor größtenteils promovierten ChemikerInnen zum Thema „Bewertung der Risiken der chemischen Industrie“. Über drei Stunden berichtete Mimkes über die Gefährdungspotenziale bei BAYER & Co. Aber auch danach erlahmte das Interesse nicht, so dass sich im Anschluss an den Beitrag noch eine intensive Diskussion entspann. Die Seminar-Leitung freute sich über den ganzen Input und bot der Coordination an, sie bei passender Gelegenheit wieder nach Tutzing zu holen.
Nobelpreis für Kailash Satyarthi
In diesem Jahr erhielt Kailash Satyarthi, der langjährige Vorsitzende des GLOBAL MARCH AGAINST CHILD LABOUR, für sein Engagement gegen die Kinderarbeit den Friedensnobelpreis. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) lernte den Inder 2003 durch eine Kooperation kennen. Sie gab in diesem Jahr gemeinsam mit dem GLOBAL MARCH und dem INDIA COMMITTEE OF THE NETHERLANDS eine Studie heraus, welche unter anderem das große Ausmaß von Kinderarbeit auf den Feldern eines Zulieferers von BAYER CROPSCIENCE dokumentierte. Auch den Offenen Brief an den damaligen BAYER-Chef Werner Wenning mit der Forderung, diese Praxis nicht länger zu dulden, unterschrieb die indische Initiative mit. So trug sie mit dazu bei, durch politischen Druck eine deutliche Verbesserung der Situation zu erreichen. Deshalb freute sich die CBG sehr über die Stockholmer Entscheidung und sandte Kailash Satyarthi herzliche Glückwünsche.
BUKO-Veranstaltung zu Uganda
Die BUKO Pharma Kampagne hat eine neue Studie zur Geschäftspraxis der drei Pharma-Riesen BAYER, BOEHRINGER und BAXTER in Uganda herausgegeben. Im Spätsommer 2014 kam mit Denis Kibira ein Mitwirkender an der Untersuchung aus Afrika nach Deutschland, um persönlich ein Bild von der Situation vor Ort zu geben. Am 6. September machte der Apotheker und Geschäftsführer der Initiative COALITION FOR HEALTH PROMOTION AND SOCIAL DEVELOPMENT in der Kölner Alten Feuerwache Station, und die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) trat aus gegebenem Anlass als Mitveranstalter auf. Von BAYER wusste Kibira nur wenig Gutes zu berichten. Der Leverkusener Multi bietet für die in Uganda am weitesten verbreiteten Gesundheitsstörungen kaum Arzneien an, weil er sich in Forschung & Entwicklung lieber auf die mehr Rendite versprechenden Mittel gegen westliche Zivilisationskrankheiten konzentriert. Zudem vermarktet der Konzern in dem Land viele umstrittene und deshalb als irrational eingestufte Pharmazeutika: 21 von 49 Medikamenten fallen unter diese Kategorie. Zu den als unentbehrlich erachteten Mitteln des Global Players hingegen hat die Bevölkerung wegen der hohen Preise kaum Zugang; sie finden sich zumeist nur in Privatkliniken und Privat-Apotheken.
ESSURE-Kampagne zeigt Wirkung
Bei ESSURE, BAYERs ohne Hormone auskommendes Mittel zur Sterilisation, handelt es sich um eine kleine Spirale, deren Kunststoff-Fasern für ein so großes Wachstum des Bindegewebes sorgen sollen, dass sich die Eileiter verschließen. Allzu oft jedoch bleibt die Spirale nicht an dem vorgesehenen Ort, sondern wandert im Körper umher und verursacht Risse an den Wänden innerer Organe, was zu lebensgefährlichen inneren Blutungen führen kann. Auch Hautausschläge, Kopfschmerzen, Übelkeit und Allergien zählen zu den Nebenwirkungen Darum zieht ESSURE viel Kritik auf sich. So hat in den USA die Aktivistin Erin Brockovich, die durch einen Hollywood-Film über ihr Umwelt-Engagement zu großer Popularität gelangte, eine Kampagne gegen das Medizin-Produkt initiiert. Ihre Landsmännin Michelle Garcia setzte das Thema sogar auf die Tagesordnung der letzten Hauptversammlung des Leverkusener Multis. Auch im Internet verbreitet sich der Protest. Die FACEBOOK-Gruppe „Essure Problems“ hat aktuell über 11.000 Mitglieder. Das alles zeigt Wirkung – die Umsätze entwickeln sich nicht so wie erhofft. Die genauen Zahlen wollte der Konzern dem Internet-Portal Fierce Medical Devices wohlweislich nicht nennen. Selbst bei der Investoren-Konferenz im Juli 2014 musste das Unternehmen eingestehen: „Es gibt ein paar Klagen in den sozialen Medien, aber die Dinge bessern sich.“
Protest gegen „Food Partnership“
Die bundesdeutsche Entwicklungshilfe-Politik setzt auf Kooperationen mit der Privatwirtschaft. So hat das „Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (BMZ) mit dem Leverkusener Multi, BASF, SYNGENTA und ca. 30 weiteren Konzernen die „German Food Partnership“ (GFP) gegründet (SWB 4/13). Staatliche Mittel fließen unter anderem in zwei Projekte mit BAYER-Beteiligung, die „Better Rice Initiative in Asia“ (BRIA) und die „Competitive African Rice Initiative“ (CARE). Diese dienen dem Agro-Riesen als Vehikel, um seinen nach einer agro-industriellen Produktionsweise verlangenden, nicht zur Wiederaussaat geeigneten Hybrid-Reis zu vermarkten. Am 15. Oktober 2014, dem Welternährungstag, protestierten die Initiativen OXFAM und FIAN gegen die GFP. Um die fatalen Auswirkungen des Joint Ventures zu illustrieren, ließen die Organisationen Doubles von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Entwicklungshilfe-Minister Gerd Müller mit einer Riesen-Kugel, auf der die Namen von BAYER, BASF und MONSANTO prangten, Kleinbauern und Kleinbäuerinnen wegkegeln. „Mehr als die Hälfte aller weltweit Hungernden sind Kleinbäuerinnen und -bauern. Mit ihnen sollte die Bundesregierung gezielt zusammenarbeiten. Konzerne mit Steuergeldern zu fördern, ob direkt oder indirekt, macht niemanden satt außer die Konzerne selbst“, so David Hachfeld von OXFAM.
Mehr unabhängige Arznei-Forschung!
Der an der Universität Mainz tätige Mediziner Peter Galle hat in der Faz die zu große Abhängigkeit seiner Zunft von BAYER & Co. beklagt. So sei das Mitwirken von ÄrztInnen bei Arznei-Tests „von Abhängigkeiten und Vorbedingungen belastet, die einer objektiven Wissensvermehrung im Wege stehen können“, schreibt Galle und nennt als Beispiel die „Anpassung des Studien-Designs auf eine Effekt-Maximierung“. Zudem verhindert die Ausrichtung der Konzerne auf profitable Medikamente seiner Meinung nach die Entwicklung von Präparaten für kleinere PatientInnen-Gruppen. Angesichts der zu geringen Ausstattung der Universitätskliniken und zu kleiner Fördersummen der „Deutschen Forschungsgemeinschaft“ fordert er die Politik zu mehr Investitionen in unabhängige Pharma-Forschung auf. Und auch den Pillen-Riesen verlangt er einen Obolus zu dieser ab.
DUOGYNON: Kritik an BAYER
Der hormonelle Schwangerschaftstest DUOGYNON der heute zu BAYER gehörenden Firma SCHERING hat ab den 1950er Jahren zu tausenden Todgeburten geführt. Darüber hinaus kamen unzählige Kinder mit schweren Missbildungen zur Welt. Der Lehrer Andre Sommer forderte den Leverkusener Multi deshalb stellvertretend für andere Betroffene auf, ihm Einblick in die DUOGYNON-Akten zu gewähren. So wollte er feststellen, welche Kenntnis der Konzern von der verheerenden Wirkung des Mittels hatte, um dann Schadensersatz-Ansprüche prüfen zu können. Der Pharma-Riese weigerte sich allerdings, und auch per Klage erreichte Sommer keine Öffnung der Archive. Der Leiter des „Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte“, Walter Schwerdtfeger, kritisiert die Haltung des Unternehmens. Auf die Frage der WirtschaftsWoche: „Ist es nachvollziehbar, dass BAYER die Akten zu einem Hormon-Präparat nicht herausrückt, das etliche Patienten geschädigt haben soll?“, gibt der Biologe eine klare Antwort. „Es dürfte für BAYER schwer werden, die Akten dauerhaft zurückzuhalten. Grundsätzlich müssen die Unternehmen anerkennen, dass die Öffentlichkeit einen Anspruch auf solche Daten hat“, so Schwerdtfeger.
KAPITAL & ARBEIT
BAYER stößt Kunststoff-Sparte ab
Jahrelang hatten die Finanzmärkte den Leverkusener Multi mit der Forderung konfrontiert, sich von seiner Kunststoff-Sparte BAYER MATERIAL SCIENCE (BMS) zu trennen und auch konkrete Maßnahmen ergriffen, um den Konzern zum Verkauf zu bewegen. So belegten sie Aktien von Mischkonzernen wie BAYER mit einem Konglomeratsabschlag. Aber erst jetzt, da der Einfluss von Finanzinvestoren wie BLACKROCK auf den Global Player so groß ist wie nie, gab er dem Druck nach und kündigte an, BMS an die Börse bringen zu wollen (siehe SWB 4/14). Die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE versuchte, dagegen vorzugehen, musste sich aber geschlagen geben. „Die durch uns kritisierte Abkehr von der Drei-Säulen-Strategie ist durch die Arbeitnehmer-Vertreter im Aufsichtsrat, trotz intensivster Beratungen, nicht zu verhindern gewesen“, erklärten die GewerkschaftsvertreterInnen. Das Management hatte angekündigt, den Bereich sonst finanziell auszuhungern. Ein klarer Fall von Erpressung also. Dabei hatte die Belegschaft in der Vergangenheit viele Opfer gebracht, um das Geschäftsfeld im Unternehmensverbund halten zu können. Über 2.000 Beschäftigte verloren ihren Arbeitsplatz, der Rest musste eine untertarifliche Bezahlung, das Streichen von Bonus-Zahlungen und immer neue Rationalisierungsprogramme über sich ergehen lassen. Alles umsonst, wie sich jetzt herausstellt.
BLACKROCK schreibt BAYER & Co.
BLACKROCK ist der weltweit größte Finanzinvestor und besitzt von fast allen Global Playern Aktien (siehe SWB 4/14). An BAYER hält er rund 30 Prozent der Geschäftsanteile. Seine Einfluss macht BLACKROCK-Chef Laurence Fink unter anderem durch an die Vorstandschefs „seiner“ Unternehmen adressierte Briefe geltend. Im März 2014 erhielten der Leverkusener Multi und die anderen Konzerne ein Schreiben, in dem Fink gnädigerweise konzedierte, auf schnelles Geld durch kurzfristrige Anlage-Strategien verzichten zu wollen. Aktien-Rückkäufe und Verschuldungen zwecks Dividenden-Erhöhungen anstelle von Investitionen in die Zukunft seien deshalb nicht in seinem Sinne, bedeutete der US-Amerikaner den ManagerInnen. Im Gegenzug verlangte er von den Bossen aber, ihm für eine mehr auf längerfristiges Wachstum angelegte Firmen-Politik gut ausgearbeitete Business-Pläne mit überprüfbaren Zielvorgaben vorzulegen, „um das geduldige Kapital anzuziehen, das sie haben wollen“.
4,83 Millionen für Dekkers
Im Geschäftsjahr 2013 strich BAYER-Chef Marijn Dekkers ein Salär von 4,83 Millionen Euro ein. Dazu kommen noch Pensionszusagen in Höhe von 677.000 Euro. Seine drei Vorstandskollegen verdienten zusammen 8,7 Millionen Euro und ein „Ruhegeld“ von 594.000 Euro.
BAYER kann nicht forschen
„BAYER ist ein Innovationsunternehmen von Weltrang“ tönte der Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers 2013 auf der Hauptversammlung des Konzerns. Tatsächlich aber hat das Unternehmen mit der Forschung so seine liebe Mühe. „Wir sind gut in der Entwicklung, aber nicht so gut in der Forschung“, gesteht Forschungsvorstand Kemal Malik ein. Darum arbeitet der Global Player seit einigen Jahren verstärkt mit Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen. 2012 existierten allein im Pharma-Bereich 326 solcher Kooperationen.
Ein Kind der Großchemie
Seit Januar 2014 hat Frank Löllgen den Vorsitz des Nordrhein-Bezirkes der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) inne und ist damit auch für BAYER zuständig. Löllgen kennt den Leverkusener Multi sehr gut. Er hat dort eine Ausbildung zum Chemie-Laboranten gemacht und seinen Förderer, den heutigen IG-BCE-Vorsitzenden Michael Vassiliadis, kennengelernt. Eine besonders kritische Haltung hat der 52-Jährige zum Global Player nicht. Zu seiner 2011 erfolgten Berufung zum Leverkusener Bezirksleiter der Chemie-Gewerkschaft sagt er rückblickend: „Ich bin ein Kind der Großchemie. Dieses Gebiet mit BAYER zu übernehmen, war eine Auszeichnung.“
Betriebsrat muss putzen
Zwischen der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) und alternativen Gewerkschaftsgruppen wie dem BELEGSCHAFTSTEAM gab es in der Vergangenheit öfters Konflikte. „Wir brauchen in der Opposition keine Opposition“, meinte etwa der heutige Betriebsratsvorsitzende des Leverkusener BAYER-Werkes, Oliver Zühlke, als das BELEGSCHAFTSTEAM und die KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN FÜR EINE DURCHSCHAUBARE BETRIEBSRATSARBEIT bei den Betriebsratswahlen 2010 einer Personen- statt Gruppenliste nicht zustimmen mochten, weil die Organisationen befürchteten, dabei ihre Kenntlichkeit zu verlieren. Diese Animositäten könnten jetzt zu einer Auseinandersetzung beigetragen haben, die bis vor das Arbeitsgericht ging. Ein BELEGSCHAFTSTEAM-Betriebsratsmitglied hatte dort gegen BAYER und den Betriebsrat geklagt, weil er nach der Wahl seinen Status als freigestellter Beschäftigten-Vertreter verloren hatte und trotz 40-jähriger Betriebszugehörigkeit plötzlich „als bestbezahlte Putzfrau bei BAYER“ arbeiten musste. Zühlke gab zwar formale Fehler bei der Personalausschuss-Entscheidung auf Aberkennung der Freistellung zu, erklärte sie aber trotzdem für rechtmäßig. Die Richterin forderte die drei Parteien auf, eine außergerichtliche Einigung bei einem Streitschlichtungsgremium zu suchen.
IG BCE vs. VAA
In der Chemie-Industrie wächst der Anteil der Beschäftigten mit hohen Bildungsabschlüssen, während der Anteil der weniger gut qualifizierten Betriebsangehörigen sinkt. Deshalb machen sich die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) und der „Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter in der chemischen Industrie“ (VAA) zunehmend Konkurrenz. Die IG BCE versucht, in die Domäne des eher rechts von ihr stehenden VAA einzudringen. So machte sich ihr Vorsitzender Michael Vassiliadis jüngst die sonst vornehmlich in bürgerlichen Kreisen kursierende Forderung nach Abschaffung der kalten Progression, also des möglichen Auffressens einer Lohn-Erhöhung durch eine steuerliche Mehrbelastung, zu Eigen, was ihm allerdings Kritik von vielen GewerkschaftskollegInnen eintrug. DGB-Chef und BAYER-Aufsichtsrat Reiner Hoffmann trägt diese Strategie jedoch mit und betont: „Wir wollen nicht mehr nur mit Mindestlohn und Prekariat identifiziert werden.“ Der VAA indes hat es auch nicht mehr nur auf Belegschaftsmitglieder aus den Top-Etagen abgesehen und sammelt eifrig Betriebsratssitze. So haben VAAlerInnen an den BAYER-Standorten Berlin, Frankfurt und Bergkamen Mandate errungen. Vasiliadis kritisierte das Vorgehen des Verbandes in einem Brief an VAA-Hauptgeschäftsführer Gerhard Kronisch scharf. „Für uns ist irritierend, in welchem Umfang der VAA mit eigenen Listen bei den zurückliegenden Betriebsratswahlen außerhalb seiner Stamm-Klientel angetreten ist“, ereiferte er sich.
ERSTE & DRITTE WELT
Bienenkiller in kleinen Dosen
BAYERs Insektizid THUNDER enthält den für das weltweite Bienensterben mitverantwortlichen Wirkstoff Imidacloprid. In Afrika will der Konzern dieses Mittel jetzt für weniger als einen Dollar auch in Mini-Packungen anbieten, um sich den Markt für Kleinbauern und -bäuerinnen besser zu erschließen. Für die bedrohte Insekten-Art bedeutet das nichts Gutes.
IG FARBEN & HEUTE
Gedenkort für Euthanasie-Opfer
Die vom Leverkusener Multi mitgegründeten IG FARBEN haben nicht nur das Zyklon B für die Vergasung der Juden im „Dritten Reich“ geliefert. Der Mörder-Konzern hatte auch für die Euthanasie, der mehr als 100.000 behinderte oder psychisch kranke Menschen zum Opfer fielen, den passenden Rohstoff im Angebot. Er stellte für die „Aktion T4“ – benannt nach der Berliner Adresse des Planungszentrums für den Massenmord, das sich in der Tiergartenstr. 4 befand – das Kohlenmonoxid zur Verfügung. Im November 2011 entschied der Bundestag, in würdigerer Form als bisher an die „Aktion T4“-Toten zu erinnern und einen Gedenk- und Informationsort an der Tiergartenstraße zu errichten. Am 2. September 2014 fand die feierliche Eröffnung im Beisein des Berliner Bürgermeisters Klaus Wowereit und der Kulturstaatsministerin Monika Grütters statt.
Platz nach Norbert Wollheim benannt
Im Jahr 2001 ging das Frankfurter IG-FARBEN-Haus in den Besitz der „Johann Wolfgang von Goethe-Universität“ über. Seit dieser Zeit traten Studierende und Lehrende dafür ein, die mahnende Erinnerung an den von BAYER mitgegründeten Mörderkonzern wachzuhalten, indem die Hochschule den ehemaligen IG-Zwangsarbeiter Norbert Wollheim ehrt. Die Leitung wehrte sich aber erfolgreich dagegen, den zentralen Platz auf dem Gelände nach dem Mann zu benennen, der durch seinen 1951 begonnenen Musterprozess Entschädigungszahlungen für die SklavenarbeiterInnen den Weg ebnete. Stattdessen errichtete sie mit dem „Norbert Wollheim Memorial“ eine Gedenkstätte für ihn (siehe SWB 1/09). Die Studenten und Studentilannen erhielten ihre Forderung jedoch aufrecht und gaben der Alma Mater etwa 2009 im Zuge des damaligen Bildungsstreits symbolisch den Namen „Norbert Wollheim Universität“. Und ihre Beharrlichkeit zahlte sich aus. Überlebenden-Gruppen, das „Fritz-Bauer-Institut“ und die „Jewish Claim Conference schlossen sich den Studierenden an, und 2014 gab die Universitätsleitung schließlich nach: Sie entschied sich, als Adresse fortan nicht mehr „Grüneburg-Platz 1“, sondern „Norbert-Wollheim-Platz 1“ zu führen.
POLITIK & EINFLUSS
TTIP: BAYER antichambriert
Bei den Verhandlungen zum Freihandelsabkommen der EU mit den USA diktieren die Multis den PolitikerInnen die Agenda. Allein von Anfang 2012 bis April 2013 fanden 130 Treffen der VerhandlerInnen mit Konzern-VertreterInnen oder Unternehmensverbänden in Sachen „TTIP“ statt. Diejenigen Lobby-Organisationen, denen BAYER angehört, sprachen nach Recherchen des CORPORATE EUROPE OBSERVATORY besonders oft vor. „Business Europe“, der europäische Chemie-Verband CEFIC, der „US Chamber of Commerce“ und der „Bundesverband der deutschen Industrie“ – diese Lobby-Vereinigungen hatten die meisten Gesprächstermine mit der „Generaldirektion Handel“ der EU. Dabei dürften auch solche „Handelshemmnisse“ auf der Tagesordnung gestanden haben, die dem Leverkusener Multi besonders im Wege stehen wie etwa strenge Sicherheitsauflagen für Genpflanzen, Pestizide und andere Chemikalien.
BAYER sponsert RepublikanerInnen
Im Jahr der Wahlen zum US-Kongress spendete BAYER bis zum Oktober 2014 über 325.000 Dollar an PolitikerInnen. RepublikanerInnen, die für das Repräsentantenhaus kandidierten, erhielten 158.000 Dollar vom Konzern, ihre demokratischen KonkurrentInnen 55.000 Dollar. Republikanische SenatsaspirantInnen bedachte der Pharma-Riese mit 53.000 Dollar, ihre demokratischen Pendants mit 33.000 Dollar.
Auf der Bilderberg-Gästeliste
Bei der jährlich stattfindenden Bilderberg-Konferenz handelt es sich um eine Zusammenkunft hochrangiger PolitikerInnen und WirtschaftsmanagerInnen aus den Industrie-Nationen. 1980 stand der damalige BAYER-Chef Herbert Grunewald auf der Gästeliste und 2004 das ehemalige BAYER-Aufsichtsratsmitglied Jürgen Weber.
Gentech-Kampagne in Argentinien
Argentinien ist das Land mit der weltweit drittgrößten Anbaufläche für Genpflanzen. Um das Reservoir noch ein wenig besser ausschöpfen zu können, ist ein neues Gesetz in Planung, „das von der Industrie entwickelt und vom Landwirtschaftsminister akzeptiert wurde“, wie das „U.S. Department of Agriculture“ mit bemerkenswerter Offenheit festhält. BAYER und den anderen in der „Argentine Seed Association“ organisierten Unternehmen geht es dabei vordringlich darum, die Zulassungsverfahren zu beschleunigen. Umweltgruppen haben jedoch eine Kampagne gegen das Vorhaben organisiert. Darum sah sich der US-amerikanische „Foreign Agriculture Service“ (FAS), der vor Ort in Buenos Aires ein Büro unterhält, gezwungen, ebenfalls Aktivitäten zu entfalten. Unter anderem plant der FAS PR-Maßnahmen für die Risiko-Technologie wie Workshops, Konferenzen mit argentinischen MinisterInnen, WissenschaftlerInnen und Medien-VertreterInnen sowie Kooperationen mit Universitäten und VerbraucherInnen-Organisationen.
BAYER-freundliche EEG-„Reform“
Immer wieder hatten BAYER & Co. in der Vergangenheit über die hohen Strom-Kosten geklagt, die ihnen das „Erneuerbare-Energien-Gesetzes“ (EEG) durch die Förderung von Windkraft & Co. angeblich beschert. Dabei gewährte das Paragraphen-Werk energie-intensiven Betrieben großzügige Rabatte, für welche die Privathaushalte aufzukommen hatten. Für diese stieg die Strom-Rechnung seit 2008 um 38 Prozent, während diejenige der Konzerne in dem Zeitraum sogar um ein Prozent niedriger ausfiel. Die ungleiche Lasten-Verteilung brachte das ganze EEG in Verruf, weshalb schon Schwarz-Gelb eine „Reform“ begann, welche die Große Koalition unter der Ägide von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) dann abschloss. Der Vize-Kanzler drosselte den Ausbau der Erneuerbaren Energien und schaffte es gleichzeitig, die von Brüssel als unerlaubte Subventionen angesehenen Industrie-Privilegien größtenteils beizubehalten. Nur ein kleines Entgegenkommen forderte er dafür von den Unternehmen. Der Sozialdemokrat plante, ihnen auch für die Energie, die sie in ihren eigenen Kraftwerken produzieren, einen Beitrag zur Ökostrom-Förderung abzuverlangen. Aber sofort brach ein Sturm der Entrüstung los. Der Leverkusener Multi, der fast 60 Prozent seines Energie-Bedarfs selber deckt, warnte: „Unsere KWK (Kraft/Wärme-Koppelung, Anm. SWB)-Anlagen würden sich, sollten diese Pläne umgesetzt werden, nicht mehr wirtschaftlich betreiben lassen, sowohl die bestehenden als auch die neuen.“ Pflichtschuldig machte sich Gabriel sogleich ans „Nachbessern“. Das Gesetz, das am 1. August 2014 in Kraft trat, lässt – vorerst bis 2017 – Altanlagen verschont und macht nur neu errichtete abgabepflichtig, wobei es BAYER & Co. dafür aber noch Ausgleichszahlungen gewährt. Sogar die Faz musste sich über diese Zugeständnisse wundern: „Noch vor Wochen hätte niemand damit gerechnet, dass Betriebe bei der Ökosteuer-Reform fast ungeschoren davonkommen.“
Ordnungsruf von Dekkers
BAYER-Chef Marijn Dekkers hat mal wieder das angeblich innovationsfeindliche Klima in der Bundesrepublik kritisiert. „Unsere industrielle Basis beginnt zu bröckeln“, warnte er in der Faz. Zu geringe Forschungsausgaben, zu hohe Energie-Kosten, zu wenig naturwissenschaftlicher Unterricht in den Schulen und eine angeblich nicht immer sachgerechte Bewertung neuer Produkte durch die Politik – all das gefährdet seiner Meinung nach die Zukunft des Standortes Deutschland.
Ordnungsruf von Wenning
Kaum ein Monat vergeht ohne ein Lamento des Leverkusener Multis über die hohen Energie-Kosten (s. o.), obwohl die Politik dem Unternehmen viel niedrigere Tarife als den Privathaushalten beschert hat. Der BAYER-Aufsichtsratschef Werner Wenning ging jetzt sogar so weit, eine neue Hartz-Runde zu fordern, um die angeblich so horrenden Strom-Rechnungen der Konzerne volkswirtschaftlich zu kompensieren. „Ich mache mir große Sorgen, dass wir bald an einem Punkt angelangt sind, wo wir eine Agenda 2025 brauchen, also harte Einschnitte, damit wir im internationalen Wettbewerb nicht zurückfallen“, so Wenning.
Blesner weiht BAYER-Center ein
Im September 2014 reiste Peter Bleser, Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, nach China, um „neue Export-Möglichkeiten für deutsche Agrar-Produkte auszuloten“. Während seines Aufenthalts weihte er gemeinsam mit dem stellvertretenden chinesischen Landwirtschaftsminister Niu Dun auch ein BAYER-Schulungscenter in der Nähe von Nanking ein, in dem der Leverkusener Multi bei den FarmerInnen künftig für sein Saatgut und seine Pestizide werben will. „Ich sehe in dem neuen Informationszentrum eine große Chance, das vorhandene Fachwissen über eine erfolgreiche und nachhaltige Erzeugung an die chinesische Landwirte weiterzugeben“, sagte Bleser zur Eröffnung.
Duin spricht Grußwort
Zu der Veranstaltung „Standpunkt am Standort: Motor und Partner für Innovation – Pharma-Industrie in NRW“, welche die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE am 31.10.2014 in Monheim mit dem von BAYER gegründeten „Verband der Forschenden Arzneimittel-Hersteller“ und der Biotech-Firma UCB co-managte, sprach der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) ein Grußwort.
Gabriel für BAYER & Co. in China
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) betätigte sich im April 2014 auf seiner China-Reise als Chef-Lobbyist von BAYER & Co. So forderte er seine Gesprächspartner in Peking auf, den Unternehmen einen besseren Rechtsrahmen im Allgemeinen und einen besseren Patentschutz im Besonderen zu gewähren. Auch bei den Ausschreibungen mahnte er Veränderungen im Sinne bundesdeutscher Firmen an. Zudem stufte er den Technologie-Transfer als Zugangsvoraussetzung für den chinesischen Markt ebenso sehr als Handelshemmnis ein wie die in manchen Branchen bestehende Auflage für ausländische Konzerne, mit einheimischen Partnern Joint Ventures eingehen zu müssen.
Neues Gesetz für IT-Sicherheit
Der Leverkusener Multi registriert des öfteren Attacken auf sein Computer-Netz. 2012 etwa gab es einen Hacker-Angriff aus China mit dem Ziel, Industrie-Spionage zu betreiben. Zuvor schon musste er sich des Computer-Virus’ Stuxnet erwehren. Auch die politische HackerInnen-Gruppe „Anonymus“ störte schon die digitalen Betriebsabläufe. Anderen Konzernen ergeht es ähnlich. Deshalb plant die Bundesregierung ein IT-Sicherheitsgesetz. Sie will eine Meldepflicht für die Opfer von Cybercrimes einführen und dem Bundeskriminalamt mehr Kompetenzen verleihen. Zudem plant die Große Koalition, die entsprechenden Abteilungen von BKA, Verfassungsschutz und „Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik“ mit mehr Personal auszustatten.
Dekkers neuer VCI-Präsident
BAYER-Chef Marijn Dekkers ist neuer Vorsitzender des „Verbandes der Chemischen Industrie“ (VCI). Im September 2014 hat er das Amt für die nächsten zwei Jahre übernommen.
Dekkers reist nach Russland
BAYER & Co. machten vor der Ukraine-Krise gute Geschäfte in Russland. Auf 750 Millionen Euro belief sich 2013 der Umsatz des Leverkusener Multis, wozu vor allem die Pharma-Sparte beitrug. Weil der Konzern auf dem Pillen-Markt mit jährlichen Steigerungsraten von acht bis neun Prozent und bis 2017 mit Gesamterträgen auf dem russischen Markt in Höhe von 1,3 Milliarden Euro rechnete, baute er seine Präsenz in dem Land stark aus. Die Diskussion um Wirtschaftssanktionen im Frühjahr 2014 alarmierte das Unternehmen deshalb. „Ich hoffe, dass die Situation diplomatisch gelöst werden kann“, ließ sich der Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers damals vernehmen. Seine Hoffnung erfüllte sich nicht, die Strafmaßnahmen kamen. Ob er jetzt auch zu den Firmen-Bossen gehört, die Angela Merkel laut Spiegel mittels ständiger Anrufe drängen, für eine Lockerung der Handelsbeschränkungen einzutreten, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall gehörte Dekkers aber der Wirtschaftsdelegation an, die im Oktober 2014 auf Einladung des russischen Premierministers Dmitri Medwedew zu einer Zusammenkunft ausländischer Investoren geflogen war. Das Kanzleramt war über diese Reise-Diplomatie not amused. „Was wir am wenigsten brauchen, ist eine Nebenaußenpolitik der Konzerne“, so ein Berliner Spitzen-Beamter.
Eine neue „Lex BAYER“
Über die marode Leverkusener Autobahn-Brücke dürfen keine schweren LKWs mehr fahren. Zum BAYER-Gelände müssen sie deshalb einen Umweg von ca. 20 Kilometern in Kauf nehmen. Ernst Grigat, bei der 60-prozentigen BAYER-Tochter CURRENTA für die Chem-„Parks“ in Leverkusen und Dormagen verantwortlich, verfällt aus diesem Grund schon in Weltuntergangsstimmung. „Wenn nicht schnellstmöglich Abhilfe geschaffen wird, fürchten wir, dass die Industrie verlagert wird. Damit ist das langsame Sterben der chemischen Industrie in Deutschland vorprogrammiert.“ Und die apokalyptischen Töne zeigen Wirkung. Der nordrhein-westfälische Bauminister Michael Groschek (SPD) kündigte einen Neubau an. Und damit alles ganz schnell geht, will der Sozialdemokrat sogar das Fernstraßen-Gesetz ändern und durch eine sogenannte „Lex Leverkusen“ den BürgerInnen-Willen außen vor halten. Nach den Plänen des Politikers sollen etwaige Einsprüche in die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts fallen und damit nur noch über eine Instanz gehen. Einen Zeitgewinn von bis zu anderthalb Jahren verspricht sich der Minister davon. „Wir können es uns nicht leisten, durch Klagewellen das Risiko einer Vollsperrung einzugehen“, so Groschek.
Kritik an EU-Aktienrechtreform
Die EU plant in einer neuen Richtlinie umfangreiche Aktienrechtsveränderungen. Sie will künftig die AktionärInnen alle drei Jahre über die ManagerInnen-Gehälter abstimmen lassen und dabei die Verhältnismäßigkeit in Bezug auf die sonst in den Unternehmen gezahlten Entgelte gewahrt wissen. Zudem beabsichtigt Brüssel, den AnteilseignerInnen ein Mitsprache-Recht zu verschaffen, wenn ein Konzern mit seinen eigenen Teil-Gesellschaften oder seinen GroßaktionärInnen Geschäfte abzuschließen gedenkt. Darüber hinaus sieht der Entwurf vor, Pensionsfonds und anderen institutionellen Anleger ebenso zu mehr Transparenz zu verpflichten wie die manchmal von ihnen angeheuerten StimmrechtsberaterInnen. Erwartungsgemäß laufen BAYER & Co. Sturm gegen das Vorhaben.
Juncker rudert zurück
Der Leverkusener Multi betrachtet Medikamente als ganz normale Wirtschaftsgüter. Dem wollte der neue EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker folgen. Beim Zuschnitt der neuen Kommissionen plante er, dem Gesundheitskommissar die Zuständigkeit für die Zulassung von Arzneien und Medizinprodukten zu entziehen und den Bereich unter die Verantwortung der neuen Industrie-Kommissarin Elzbieta Bienkowska zu stellen. Erst nach massiven Protesten ließ der Luxemburger von seinem Vorhaben ab. Dagegen gelang es ihm, das bisher eigenständige Klima-Ressort aufzulösen und es mit dem Energie-Ressort zu verbinden – schlechte Aussichten also für eine engagierte Politik zur Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes.
PROPAGANDA & MEDIEN
COLOSS betet Bienen gesund
Der Leverkusener Multi weigert sich weiterhin beharrlich, die Mitverantwortung seiner Pestizide GAUCHO und PONCHO am weltweiten Bienensterben einzuräumen. Ja, der Konzern weigert sich sogar, den Fakt als solchen anzuerkennen. „Europäische Honigbienen sind gesünder, als in vielen Medienberichten behauptet“, vermeldete das Unternehmen jüngst und berief sich dabei auf „das unabhängige Honigbienen-Forschungsnetzwerk COLOSS“. Mit der Unabhängigkeit des Forschungskolosses ist es allerdings nicht so weit her. Er zählt BAYER nämlich zu seinen „Event Partnern“ und scheint unter Wissenschaft auch primär Krisen-Kommunikation zu verstehen. So befasste sich eine „training school“, an welcher auch Manuel Trischler vom „Bee Care Center“ des Pharma-Riesen teilnahm, hauptsächlich mit der Frage, wie angeblich unangemessenen Beiträgen von ForscherInnen zum Bienensterben zu begegnen sei. Das der Universität Bern angegliederte Institut machte bei den Unternehmen Defizite im PR-Bereich aus und empfahl ihnen Nachhilfe-Stunden in Öffentlichkeitsarbeit.
Bienen-Kümmerer BAYER
Der Leverkusener Multi steht wegen seiner bienenschädigenden Pestizide GAUCHO und PONCHO, welche die EU bis vorerst 2015 aus dem Verkehr gezogen hat, in der Kritik. Darum verstärkt der Konzern seine PR-Aktivitäten (s. o.) Wo das Unternehmen nicht schlicht versucht, die Fakten abzustreiten, da inszeniert es sich als Bienenkümmerer. Der Global Player fördert nicht nur das Anlegen von Ackerrand-Streifen mit pollen-reichen Blütenpflanzen sowie von Bienenweiden und gründet „Bee Care Center“, sondern unterstützt auch Forschungsvorhaben zum Erhalt der Bienengesundheit. So spendet er der kanadischen „University of Guelph“ 750.000 Dollar für den Aufbau eines Insekten-Gesundheitszentrums.
Neue Gentech-Kampagne
Im Februar 2014 haben BAYER & Co. eine neue PR-Kampagne für die grüne Gentechnik gestartet. „Growing Voices“ lautet der Markenname der Unternehmung, denn sie will den „lauter werdenden Stimmen, die ein Umdenken der EU in puncto ‚Gen-Pflanzen’ anmahnen“, Ausdruck verleihen. Die Auftakt-Veranstaltung fand im Brüsseler Hotel „Renaissance“ statt und brachte „Gesundes Essen – die unerzählte Geschichte der Gen-Pflanzen“ zu Gehör. Den „Science Fiction“-Stoff führten sich unter anderem damalige Angehörige der Europäischen Kommission und des EU-Parlaments, EU-BeamtInnen, UmweltpolitikerInnen, EmissärInnen von Forschungseinrichtungen – und natürlich Abgesandte der Agro-Multis zu Gemüte. Allein von BAYER waren neun VertreterInnen anwesend.
Wissenschaftliche Gentech-PR
Mit vereinten Kräften wollen die „Bill & Melinda Gates Foundation“ und BAYER, MONSANTO & Co. die Gentechnik-Debatte „entpolarisieren“. Zu diesem Behufe hat die Stiftung der Cornell Universität nicht weniger als 5,6 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Als Partner der PR-Kampagne mit wissenschaftlichem Antlitz namens „Alliance for Science“ fungiert der vom Leverkusener Multi und anderen Agro-Riesen unterstützte Lobby-Verein „International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications“ (ISAAA).
Gentech-Studie: CRIIGEN steigt aus
Im Juli 2013 hat das französische Gesundheitsministerium eine Studie über Gentech-Risiken in Auftrag gegeben. Ihr ist allerdings ein „Dialog-Forum“ angeschlossen, in dem VertreterInnen von BAYER, MONSANTO und LIMAGRAIN sitzen. Darum hat die unabhängige Wissenschaftsorganisation CRIIGEN ihren Ausstieg aus dem Projekt verkündet. „Wir können nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die Lobbying-Taktiken benutzen, um ihre Produkte zu vermarkten und deren Akzeptanz zu erhöhen, ohne jene genauer zu untersuchen und ohne Transparenz walten zu lassen“, heißt es in der Begründung.
BAYER sponsert den „Weltthrombose-Tag“
Die „International Society on Thrombosis and Haemostasis“ hat den 13. Oktober zum „Weltthrombose-Tag“ erklärt, um stärker auf die mit den Blutgefäß-Verschlüssen einhergehenden Lebensgefahren aufmerksam zu machen. Der Leverkusener Multi gehört zu den Sponsoren der Veranstaltung, womit der Bock zum Gärtner wird. Thrombo-Embolien gehören nämlich zu den häufigsten Nebenwirkungen seiner Verhütungspillen aus der YASMIN-Familie. Allein die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA registrierte bisher 190 Sterbefälle.
BAYER erklärt Nebenwirkungen
XARELTO, YASMIN, BETAFERON, MIRENA, ESSURE – die Liste der BAYER-Medikamente, die wegen ihrer Risiken und Nebenwirkungen in der Kritik stehen, wird immer länger. Das bleibt auch in der Belegschaft nicht unbemerkt, weshalb sich der Leverkusener Multi in seiner Beschäftigten-Zeitung direkt gezwungen sah, auf die Problematik einzugehen. Da der Konzern es auch als Aufgabe seiner Angestellten erachtet, „zu Themen Stellung zu nehmen, die in der Gesellschaft kontrovers diskutiert werden“, will direkt ihnen künftig in einer Serie Argumente für solche Gelegenheiten an die Hand geben. Nach dem Motto „Jedes Ding hat zwei Seiten“ erklärt der Leverkusener Multi Nebenwirkungen erst einmal zu einer Naturgegebenheit. Aber natürlich hat er nach eigenen Aussage im Sinne seiner Mission „Science For A Better Life“ ein Interesse daran, diese in – natürlich ganz unabhängigen – Studien aufzuspüren und setzt angeblich auch seinen halben Forschungsetat dafür ein. Fortbildungsveranstaltungen für MedizinerInnen und Hotlines dienen ebenfalls bloß diesem Zweck – die Märchenstunde will gar kein Ende nehmen.
BAYER kauft Museum
Am Standort Lubbock hat der Leverkusener Multi das „American Museum of Agriculture“ in Beschlag genommen. Es benannte sich zu Ehren des neuen Sponsors nicht nur in „BAYER Museum of Agriculture“ um, sondern veränderte auch den Charakter seiner Dauerausstellung. Die Schau widmet sich jetzt nicht mehr so stark der Geschichte der Landwirtschaft und verlagert den Schwerpunkt stattdessen auf die Zukunft. Zur Freude des Konzern-Sprechers Lee Rivenbark illustrieren viele Exponate den BAYER-Slogan „Science for A Better Life“. Und das ganze Haus gilt ihm nun als „Leuchtturm für Wissenschaft und Innovation auf dem Gebiet ‚Landwirtschaft’“, denn: „Innovation ist das, worum es BAYER geht“.
TIERE & ARZNEIEN
Mehr BAYTRIL in den Tierställen
Der massenhafte Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung führt zur Entwicklung resistenter Krankheitserreger. Gelangen diese in den menschlichen Organismus, so können MedizinerInnen oftmals nichts mehr gegen die Keime ausrichten. Im Fall von BAYERs BAYTRIL ist diese Gefahr besonders groß. Der Leverkusener Multi bietet nämlich für den Humanmedizin-Bereich mit CIPROBAY ebenfalls ein Medikament aus der Gruppe der Fluorchinolone an, das sogar den Status eines Reserve-Antibiotikas für besonders schwierig zu behandelnde Infektionen besitzt. Und die Gefährdung nimmt zu: 2013 stieg – bei insgesamt fallenden Zahlen (1.452 gegenüber 1.619 Tonnen) – die Menge der verschriebenen Fluorchinolone von zehn auf 13 Tonnen (siehe auch SWB 4/14). Und was wie eine kleine Umschichtung bei insgesamt rückläufiger Tendenz anmutet, bedeutet wegen unterschiedlicher Dosierungsvorschriften in Wirklichkeit jedoch eine Ausweitung der Antibiotika-Zone. Während eine Tonne des Alt-Antibiotikums Tetracyclin gerade einmal für 39.000 Mastschweine langt, vermögen die LandwirtInnen mit einer Tonne BAYTRIL nämlich 2,2 Millionen Tiere zu versorgen! Das Verbraucherschutzministerium verschleiert diesen Tatbestand allerdings bewusst und verkauft „Gesamtmenge im Jahr 2013 weiter gesunken“ als Erfolgsmeldung.
TIERE & VERSUCHE
Zweifel an Tierversuchen
172.287 Tierversuche hat der Leverkusener Multi 2013 durchgeführt bzw. durchführen lassen – 1.690 mehr als 2012. Eine neue Studie der WissenschaftlerInnen Pandora Pound und Michael B. Bracken bewertet die Sinnhaftigkeit solcher Tests kritisch. Angesichts hunderter am „Tier-Modell“ erprobter Medikamente, die am „Mensch-Modell“ versagten, zweifelt ihre im British Medical Journal veröffentlichte Untersuchung die Übertragbarkeit der Ergebnisse an. Zudem bescheinigt die Expertise den mit Ratten, Mäusen und anderen Lebewesen unternommenen Experimenten eine mangelhafte Qualität, was die ProbandInnen der nachfolgenden klinischen Prüfungen unnötigen Risiken aussetze. „Die aktuelle Studie zeigt erneut, dass der von manchen Kreisen gebetsmühlenartig behauptete Nutzen von Tierversuchen keinerlei Fundament hat“, konstatiert Silke Bitz von ÄRZTE GEGEN TIERVERSUCHE.
DRUGS & PILLS
USA: Alarmierende XARELTO-Zahlen
Auch in den Vereinigten Staaten wächst die Besorgnis über die Risiken und Nebenwirkungen, die von BAYERs neuem Gerinnungshemmer XARELTO ausgehen. 680 Meldungen über unerwünschte Effekte des Präparats mit dem Wirkstoff Rivaroxaban erhielt die Gesundheitsbehörde FDA allein im ersten Quartal 2013 – 152 mehr als zu dem Konkurrenz-Medikament PRADAXA.
Nierenerkrankungen durch BETAFERON
BAYERs „Multiple Sklerose“-Präparat BETAFERON kann Nierenschädigungen hervorrufen. Eine entsprechende Warnung veröffentlichte das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) im August 2014 (siehe auch SWB 4/14). Damit erschöpfen sich die Gegen-Anzeigen des Gentech-Präparats allerdings bei Weitem nicht. 186 Meldungen über „unerwünschte Arznei-Effekte“ hat das BfArM allein im Jahr 2013 erhalten. Dazu zählen unter anderem temporäre Spastiken, Schmerz-Attacken, Verstopfung und Müdigkeit. Und im Gegensatz zu den Nebenwirkungen bleiben die Wirkungen des Mittels spärlich. Dem MS-Ratgeber der „Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf“ zufolge sind BETAFERON und andere Substanzen auf Interferon-Basis nur bei 16 Prozent der frisch Erkrankten imstande, einen zweiten Schub zu verhindern, bei fünf von sechs PatientInnen hingegen zeigen sie keinen Nutzen.
ASPIRIN gegen Krebs?
Immer wieder erscheinen Studien, die BAYERs ASPIRIN eine vorbeugende Wirkung gegen Krebs bescheinigen. Diese weisen jedoch meist Mängel auf. Entweder können die WissenschaftlerInnen sich nur auf äußerst beschränktes Daten-Material stützen oder sie haben Kontakte zum BAYER-Konzern. Dies ist auch bei der Arbeit von Jack Cuzick und seinem Team der Fall, die zahlreiche Untersuchungen zum Thema ausgewertet haben und dem „Tausendsassa“ einen prophylaktischen Effekt bescheinigen. Cuzick gehört nämlich zum Beraterstab des Pharma-Riesen, und auch viele seiner MitarbeiterInnen standen oder stehen noch auf der Gehaltsliste des Unternehmens.
BAYERs Endometriose-Coup
Bei der Endometriose handelt es sich um eine gutartige Wucherung der Gebärmutter-Schleimhaut. Besonders während des Monatszyklusses verursacht das sich außerhalb der Gebärmutter-Höhle befindliche Gewebe Schmerzen. Zu deren Behandlung haben Frauen-ÄrztInnen früher die Verhütungspillen VALETTE oder CHLORMADINON der BAYER-Tochter JENAPHARM verschrieben. 2010 aber brachte der Leverkusener Multi mit VISANNE ein speziell für diese Krankheit zugelassenes Präparat auf den Markt. Die Produktion der beiden anderen Mittel stellte er ein, damit sie der Neuheit keine Konkurrenz machen – das Unternehmen verlangt für VISANNE nämlich rund das Fünffache des Preises von CHLORMADINON. Den höheren Kosten entspricht noch nicht einmal keine höhere Wirksamkeit. Die Arznei konzentriert sich lediglich auf die Symptom-Linderung. Zudem basiert die Zulassung auf einer dünnen Daten-Lage, die Kohorte bei der Sicherheitsanalyse umfasste nur 300 Frauen. Darum betrachten das industrie-unabhängige arznei-telegramm und das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ VISANNE auch bloß als Mittel der 2. Wahl. Ähnlich wie bei VISANNE war der Pharma-Riese in Tateinheit mit SANOFI jüngst auch im Fall von Alemtuzumab vorgegangen. Als die Konzerne die Zulassung für die Indikation „Multiple Sklerose“ erhielten, zogen sie die Arznei umgehend als Mittel zur Behandlung der chronisch-lymphatischen Leukämie“ vom Markt zurück, weil das neue Anwendungsgebiet mehr Profite verspricht (SWB 1/14).
Frankreich: MELIANE-Umsatz sinkt
2006 hatte die Französin Marion Larat nach der Einnahme des BAYER-Verhütungsmittels MELIANE einen Schlaganfall erlitten. Sechs Jahre später entschloss sie sich, den Pharma-Riesen auf Schadensersatz zu verklagen. Das damit verbundene Medien-Echo machte die Öffentlichkeit erstmals auf die mit den Kontrazeptiva der dritten und vierten Generation verbundenen Risiken aufmerksam. Die damalige Gesundheitsministerin Marisol Touraine reagierte umgehend. Sie wies die Krankenkassen an, die Kosten für MELIANE & Co. nicht mehr zu übernehmen. Und das zunehmend kritische Klima hatte Folgen: Bis Ende 2013 büßten die Mittel 60 Prozent ihres Umsatzes ein.
Kein NEXAVAR bei Brustkrebs
BAYERs NEXAVAR mit dem Wirkstoff Sorafenib hat bislang eine Zulassung bei den Indikationen „fortgeschrittener Nierenkrebs“ und „fortgeschrittener Leberkrebs“. Der Leverkusener Multi setzt jedoch alles daran, das Anwendungsspektrum zu erweitern. Ein Versuch, das Mittel zusammen mit Capecitabin bei solchen Patientinnen mit fortgeschrittenen Brustkrebs-Arten zur Anwendung zu bringen, bei denen andere Medikamente versagt hatten, scheiterte jetzt allerdings. „Wir sind enttäuscht, dass die Studie keine Verbesserung des progressionsfreien Überlebens bei Patienten mit fortgeschrittenem Brustkrebs zeigen konnte“, sagte der BAYER-Manager Jörg Möller. Zuvor war schon ein anderer Ansatz zur Therapie von Brustkrebs ohne Erfolg geblieben. Auch bei einer bestimmten Art von Leber-, bei Haut- und Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte NEXAVAR bereits versagt.
NICE nicht nice zu XOFIGO
Das britische „National Institute for Health and Care Excellence“ (NICE) hat eine Kosten/Nutzen-Analyse von BAYERs Strahlentherapie-Medikament XOFIGO (siehe auch PRODUKTION & SICHERHEIT) durchgeführt und der Arznei kein gutes Zeugnis ausgestellt. Deshalb finanziert der „National Health Service“ die Behandlung mit dem Pharmazeutikum nicht, das bei der Prostatakrebs-Art CRPC zum Einsatz kommt, wenn eine Hormon-Behandlung erfolglos geblieben ist und sich zudem noch Metastasen im Knochen gebildet haben. Der Leverkusener Multi habe zu dem Mittel keine Dokumente vorgelegt, die seine Überlegenheit gegenüber vergleichbaren Arznei-Therapien demonstrieren könnten, so die Behörde. „Wir müssen zuversichtlich sein, dass die Vorteile die beträchtlichen Kosten rechtfertigen“, sagte NICE-Chef Andrew Dillon angesichts des Preises von 30.000 Euro für eine einzige Anwendung des Präparats, das den PatientInnen bei den Klinischen Tests nur zu einem ca. drei Monate längeren Leben verhalf.
Weitere Zulassungen für ADEMPAS
Bei der Arznei ADEMPAS handelt es sich um ein Mittel zur Behandlung der beiden Lungenhochdruck-Krankheiten CTEPH und PAH. Der Wirkstoff Riociguat soll in der Lunge die Bildung eines Enzyms stimulieren, das für eine Erweiterung der Blutgefäße sorgt und so die Sauerstoff-Aufnahme verbessert. Nachdem BAYER in den USA bereits die Zulassung für das Medikament erhalten hat, erteilte dem Präparat nun auch die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA grünes Licht. Japan hat bisher nur eine Genehmigung für das Anwendungsgebiet „CTEPH“ erteilt, ein Antrag für die Indikation „PAH“ ist noch in Bearbeitung. Wie üblich, hat der Leverkusener Multi jedoch noch viele weitere Therapie-Felder wie z. B. „die Nieren-Protektion und die Herz-Insuffizienz“ im Auge und will Millionen mit ADEMPAS machen. Das industrie-unabhängige Fach-Magazin Arzneimittelbrief hingegen kann die Euphorie des Pharma-Riesen nicht ganz teilen. Obwohl es sich bei Riociguat um eine „innovative Substanz“ handle, deren therapeutischer Mechanismus „neu und interessant“ erscheine, seien die in der Literatur beschriebenen Effekte nur „marginal“, dämpft die Publikation die Erwartungen, die BAYER nicht zuletzt durch das Öffnen der „Marketing-Schleuse“ geschürt habe.
Test the East
Die Pillen-Riesen lagern immer mehr Arznei-Tests in ärmere Länder aus. Dort winken günstigere Preise, ein großes Reservoir an ProbandInnen und eine mangelhafte Aufsicht. Die Folge: Immer wieder kommt es zu Todesfällen. So starben 2011 in Indien 20 Menschen bei Erprobungen von BAYER-Medikamenten. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN machte diesen Skandal öffentlich, und der Leverkusener Multi reagierte – er schaute sich nach anderen Nationen um. Neben China hat es ihm momentan besonders Russland angetan. 90 – teils noch laufende, teils schon abgeschlossene – Medikamenten-Erprobungen des Global Players in dem Staat weist die Datenbank „ClinicalTrials“ aus. Das CLINICIAL TRIALS CENTER oder andere Auftragsfirmen prüften für den Konzern dort unter anderem die Spirale MIRENA, das Krebsmittel NEXAVAR, den Gerinnungshemmer XARELTO und das „Multiple Sklerose“-Präparat BETAFERON. Nach einem Bericht der Zeit bietet das Land unschlagbare Standort-Vorteile. ProbandInnen bemühen sich selbstständig um eine Teilnahme an den Tests, weil ihnen die Medikamente sonst nicht zur Verfügung stehen, und bleiben auch bei der Stange. Dass ihnen das Recht zusteht, einen Medikamenten-Versuch abzubrechen, erfahren sie oft nicht, und eine Ethik-Kommission, welche über alles wacht, existiert ebenfalls nur selten. „Die besteht in Russland häufig nur auf dem Papier“, sagt Alexander Globenko vom CLINICIAL TRIALS CENTER und berichtet zudem von MedizinerInnen, die Nebenwirkungen nicht protokollieren. Sogar die Existenz von Phantom-Studien mit erfundenen TeilnehmerInnen räumt er ein. Das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) weiß um diese Zustände. „Auffällig glatt“ erscheinen einer BfArM-Mitarbeiterin laut Zeit die Ergebnisse bisweilen. Selbst der von BAYER gegründete „Verband der forschenden Arzneimittel-Hersteller“ hält die russischen Verhältnisse der Zeitung zufolge für besorgniserregend. Das dürfte den Leverkusener Multi jedoch vorerst nicht von seinem Tun abhalten.
Zweifelhafte Testosteron-Studie
Mit großer Anstrengung arbeitet der Leverkusener Multi daran, die „Männergesundheit“ als neues Geschäftsfeld zu etablieren und seinen Potenzpillen und Hormon-Präparaten neue und nur selten zweckdienliche Anwendungsmöglichkeiten zu erschließen. Zu diesem Behufe hat der Pharma-Riese die Krankheit „Testosteron-Mangel“ erfunden und sie zu „männlichen Wechseljahresstörungen“ erhoben, um NEBIDO und andere Hormone an den Mann bringen zu können. Die passenden Studien liefert BAYER dazu auch. So präsentierte der Pharma-Riese in Sofia auf einem medizinischen Kongress zum Thema „Fettleibigkeit“ eine Untersuchung, wonach eine Testosteronersatz-Therapie zu Gewichtsverlusten inklusive besserer Blutzucker- und Blutdruck-Werte führt. Allerdings hält die Expertise wissenschaftlichen Kriterien kaum stand: Sie stützt sich auf gerade einmal 46 Probanden. Richtige Studien kommen zu ganz anderen Ergebnissen. So fand eine ForscherInnen-Gruppe um Jared L. Moss von der Universität Knoxville heraus, dass die Testosteron-Spritzen die Zeugungsfähigkeit beeinträchtigen. Zudem beobachteten die WissenschaftlerInnen Schrumpfungen des Hodengewebes und Samenzellen-Missbildungen. Damit fügten sie der langen Liste von Risiken und Nebenwirkungen der Mittel wie Herzinfarkt, Prostata-Krebs, Harntrakt-Schädigungen, Brust-Wachstum, Bluthochdruck, Ödeme, Blutverdickung und Leberschäden noch einige weitere Einträge hinzu.
Arznei-Ausgaben steigen um 3,2 Prozent
Im Jahr 2013 erhöhten sich die Ausgaben der Krankenkassen für Medikamente im Vergleich zu 2012 um 3,2 Prozent auf 32,1 Milliarden Euro. Das geht aus den Zahlen des „Arzneiverordnungsreports 2014“ hervor. Der Herausgeber, der Pharmakologe Ulrich Schwabe, macht dafür die hohen Preise für Pharmazeutika im Allgemeinen und für patentgeschützte Medikamente im Besonderen verantwortlich. Der Leverkusener Multi hat daran einen gehörigen Anteil. So verlangt er für sein nicht eben wirkungsvolles Krebsmittel NEXAVAR über 58.000 Euro im Jahr. Eigentlich sollte das Arzneimittel-Neuverordnungsgesetz (AMNOG) von 2011 hier Abhilfe schaffen, denn nach diesem Paragrafen-Werk müssen die Pharma-Firmen mit ihren Arzneien ein Verfahren durchlaufen, das Kosten und Nutzen der Präparate bewertet, und sich anschließend mit den Krankenkassen auf einen Erstattungsbetrag einigen. Jährliche Einsparungen in Höhe von zwei Milliarden Euro erwarteten die PolitikerInnen von der Regelung. Die Hoffnung trog jedoch; 2013 wurden es lediglich 150 Millionen Euro. Die schwarz-gelbe Koalition war nämlich von ihren Plänen abgerückt, alle Medikamente einer Revision zu unterziehen und beschränkte sich auf neue Präparate. Zudem fallen die Abschläge äußerst mager aus. Für BAYERs Gentech-Präparat EYLEA zur Behandlung der feuchten Makula-Degeneration – einer Augenerkrankung, die zur Blindheit führen kann – betrugen sie trotz des Prüfurteils „Kein Zusatznutzen“ gerade mal 7,6 Prozent. Von 1.136 auf 1.050 Euro hatte der Pharma-Riese den Apotheken-Verkaufspreis zu senken.
PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE
CDU und SPD verharmlosen GAUCHO
BAYERs Pestizide GAUCHO (Wirkstoff: Imidacloprid) und PONCHO (Wirkstoff: Clothianidin) sind mitverantwortlich für das weltweite Bienensterben. Deshalb hat die EU ihnen 2013 für vorerst zwei Jahre die Zulassung entzogen. Die Bundesregierung jedoch verharmlost die Gefahr dieser zur Gruppe der Neonicotinoide zählenden Ackergifte. In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen bezweifelt sie die Aussagekraft der meisten Untersuchungen zur Gefährlichkeit dieser Mittel und beruft sich dabei auf das bundeseigene Julius-Kühn-Institut. So bezeichnen Merkel & Co. etwa das Studien-Design als mangelhaft. Zudem zweifeln sie die Übertragbarkeit der Labor-Ergebnisse auf Freiland-Bedingungen an. Darum hält die Große Koalition es im Einklang mit BAYER & Co. auch für richtig, sich bei der Suche nach den Ursachen für die Dezimierung der Bienenvölker weiter hauptsächlich auf die Varroa-Milbe zu konzentrieren.
GAUCHO-Alternative SIVANTO?
Ab 2015 will BAYER das Pestizid Flupyradifuron (Produktname: SIVANTO) als Alternative zu Imidacloprid (GAUCHO) vermarkten, dem die EU wegen seiner bienenschädigenden Wirkung 2013 für vorerst zwei Jahre die Zulassung entzogen hat. Flupyradifuron gehört zwar nicht wie Imidacloprid zur Gruppe der Neonicotinoide, sondern zu den Butenoliden, es ähnelt den Neonicotinoiden aber in seiner Funktionsweise. Wie diese wirkt das Flupyradifuron systemisch, also gegen eine Vielzahl von Schadinsekten, und wie diese blockiert es bei den Tieren die Reiz-Weiterleitung an den Nervenbahnen. Deshalb bestehen Zweifel daran, ob der Stoff wirklich so „bienenfreundlich“ ist, wie der Leverkusener Multi behauptet.
Brasilien: Verbot von GLYPHOS?
Wie El Salvador (siehe Ticker 3/14) plant nun auch Brasilien das Verbot von besonders gesundheitsschädlichen Pestiziden. Auf der Schwarzen Liste befinden sich mit Parathion-Methyl und Glyphosat auch zwei Wirkstoffe, die BAYER im Angebot hat. Parathion-Methyl kommt in ME 605 Spritzpulver zum Einsatz, und Glyphosat in GLYPHOS und USTINEX G. Zudem verkauft der Leverkusener Multi Glyphosat noch in Kombination mit CREDENZ und anderen gegen das Ackergift immun gemachten Genpflanzen.
Protest gegen Öko-Verordnung der EU
Die EU plant, strengere Pestizid-Grenzwerte für den ökologischen Landbau zu erlassen. Die betreffenden LandwirtInnen wenden sich allerdings gegen die Regelung. Da durch angrenzende Felder von Bauern und Bäuerinnen, die mit konventionellen Methoden arbeiten, auch Chemikalien auf ihre Äcker gelangen, fürchten sie, die neuen Limits nicht einhalten zu können.
BAYER erwirbt Herbizide
Der Leverkusener Multi hat von DUPONT Herbizide erworben, die im „Land-Management“, also nicht auf Äckern, sondern in Wäldern, auf Weide-Flächen, Industrie-Arealen oder Bahn-Gleisen zum Einsatz kommen (siehe auch PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE). Rund 30 Anti-Unkrautmittel umfasst das DUPONT-Sortiment. Dazu gehören Produkte wie PERSPECTIVE (Wirkstoffe: Aminocyclopyrachlor und Chlorsulfuron), ESPLANADE (Wirkstoff: Indaziflam), STREAMLINE (Wirkstoffe: Aminocyclopyrachlor und Metsulfuronmethyl), ESCORT (Wirkstoff: Metsulfuronmethyl) und Oust (Wirkstoff: Sulfometuronmethyl).
PFLANZEN & SAATEN
BAYER kauft GRANAR
BAYER hat das Sojasaatgut-Geschäft des paraguayischen Unternehmens GRANAR erworben (siehe auch IMPERIUM & WELTMACHT).
Feldversuche mit Zuckerrübe
Der Leverkusener Multi und KWS kündigen Feldversuche mit einer gemeinsam entwickelten Zuckerrüben-Art an, deren Erbgut eine natürliche und durch Züchtung verstärkte Enzym-Veränderung aufweist. Auf diese Weise übersteht die Labor-Frucht eine Behandlung mit solchen Anti-Unkrautmitteln, welche die Acetolactat-Synthese stören, unbeschadet. Allerdings überstehen auch immer mehr Wildpflanzen die Behandlung mit diesen so genannten ALS-Hemmern wie BAYERs ATTRIBUT (Wirkstoff: Propoxycarbazone) unbeschadet, weshalb die neue Rübe schon bald ziemlich alt aussehen könnte.
GENE & KLONE
Immer mehr Bt-Resistenzen
BAYER & Co. bauen in ihre Laborfrüchte gern das Gift-Gen des Bacillus thuringiensis (Bt) ein, um Schadinsekten zu töten. Der Leverkusener Multi setzt besonders bei SURPASS und anderen Baumwoll-Pflanzen auf den Bazillus. Die Schadinsekten können sich jedoch immer besser auf ihn einstellen. In einer von Juliano Ricardo Farias und seinem Team durchgeführten Untersuchung gelang es dem Heerwurm schon binnen dreier Jahre, eine Resistenz gegen den Bt herauszubilden. Zudem trotzen vielerorts bereits der Baumwollkapselbohrer, die Baumwollkapseleule, die Kohlschabe, die Aschgraue Höckereule, der Eulenfalter und die „Busseola fusca“-Raupe der Substanz.
Import-Zulassung für Gentech-Mais?
Die EU-Gremien befinden zur Zeit über eine Import-Zulassung für BAYERs Gentech-Mais T25. Die Lebensmittelbehörde EFSA hat der Laborfrucht bereits eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt, obwohl sie gentechnisch auf eine Behandlung mit dem gesundheitsgefährdenden Pestizid Glufosinat geeicht ist. Darum konnte sich das „Standing Committee on the Food Chain and Animal Health“ auch nicht auf ein positives Votums einigen. Zweimal kam es zum Patt, wobei die Bundesrepublik sich jeweils der Stimme enthielt. Jetzt obliegt der Europäischen Kommission die Entscheidung. Die Pflanze reiste derweil schon mal illegal ein. 2011 entdeckte das niedersächsische Umweltministerium bei einer Untersuchung Spuren von T25 in konventionellem Mais-Saatgut aus Ungarn.
Kennzeichnungspflicht in Vermont
Seit einiger Zeit gibt es in US-amerikanischen Bundesstaaten Initiativen zur Einführung einer Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel. BAYER & Co. investieren viel Geld, um diese Vorhaben zu Fall zu bringen und können leider schon Erfolge verbuchen. In Washington und Kalifornien scheiterte ein BürgerInnen-Begehren bereits. In Vermont allerdings muss die Gentech-Industrie Farbe bekennen. Der Bundesstaat erließ ein Kennzeichnungsgesetz, das jedoch einige Lücken aufweist, wie KritikerInnen monieren. Maine und Connecticut taten es Vermont gleich, wollen das Paragrafen-Werk jedoch erst in Kraft setzen, wenn mindestens vier weitere Staaten folgen.
Stammzellen: Der Hype ist vorbei
„Die Möglichkeiten sind grenzenlos“, schwärmte im Jahr 2001 BAYERs damaliger Chef-Pharmazeut Wolfgang Hartwig über die Stammzellen. Aus ihnen wollten die GenforscherInnen des Konzerns zahlreiche Zelltypen oder Gewebe-Arten entwickeln. 2008 haben sie in Japan ein Patent (siehe Ticker 3/08) für eine Technik zur Produktion von „Induzierten Pluripotenten Stammzellen“ (IPS) angemeldet, eine Stammzellen-Art, welche die ForscherInnen durch eine „Rückprogrammierung“ normaler Körperzellen erzeugen, was die Abtötung von Embryos erspart. Aber die Möglichkeiten dieser Gentechnik sind rasch an Grenzen gestoßen. Deshalb hat sich Ernüchterung eingestellt. „BAYER ist auf dem Gebiet der Stammzell-Forschung derzeit nicht aktiv“, heißt es jetzt lapidar. Thomas Eschenhagen, der Direktor des Instituts für Experimentelle Pharmakologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, bezeichnet den Wirbel um die Stammzellen im Nachhinein als Beispiel für „kurzfristige Sensationsforschung“. „Die waren vor 15 Jahren der große Hype. Alle sind auf diese Welle aufgesprungen, aber viele dieser Versprechen haben sich als falsch oder übertrieben herausgestellt. Also ist die Forscher-Karawane weitergezogen“, sagte er in einem taz-Interview. Eschenhagen hingegen forscht weiter an der Herstellung von künstlichem Herz-Gewebe aus Stammzellen.
Neue EYLEA-Zulassung
Wann immer die Aufsichtsbehörden einer Arznei des Leverkusener Multis für ein bestimmtes Anwendungsgebiet die Genehmigung erteilen, versucht dieser, grünes Licht für weitere Indikationen zu erhalten. So verfährt er auch im Falle des Gentech-Augenpräparats EYLEA. Zunächst nur zur Behandlung der altersbedingten feuchten Makula-Degeneration – einer Augenerkrankung, die zur Blindheit führen kann – zugelassen, können es MedizinerInnen seit einiger Zeit auch zur Behandlung der Folgen eines Zentralvenen-Verschlusses der Netzhaut verschreiben. Und jetzt dürfen sie es zusätzlich zur Therapie der von der Zuckerkrankheit hervorgerufenen Makula-Degeneration einsetzen. Zudem stimmten die japanischen Aufsichtsbehörden bereits einer Verwendung bei der „choroidalen Neovaskularisation“, einer Gewebe-Wucherung am Seh-Organ, zu. Als Augen-Allheilmittel kommt der gemeinsam mit der Firma REGENERON entwickelte EYLEA-Wirkstoff Aflibercept aber nicht in Betracht. In den Tests, die zur ersten Zulassung führten, demonstrierte er nämlich lediglich seine Nicht-Unterlegenheit gegenüber Ranibizumab. Überdies traten während der Erprobungen zahlreiche Nebenwirkungen wie Bindehaut-Blutungen, grauer Star, Augenschmerzen, Glaskörper-Trübungen und Erhöhung des Augeninnendrucks auf.
EYLEA: Es geht auch billiger
Nach einer Untersuchung der Cochrane Collaboration, einem Netzwerk von ÄrztInnen, WissenschaftlerInnen und PatientInnen-VertreterInnen, wirkt das ROCHE-Krebsmedikament AVASTIN genauso gut zur Behandlung der feuchten Makula-Degeneration – einer Augenerkrankung, die zur Blindheit führen kann – wie ROCHEs LUCENTIS und BAYERs Gentech-Präparat EYLEA. Es hat nur einen Nachteil: Es ist zu billig, weshalb der Schweizer Konzern sich nicht selbst Konkurrenz machen will. Während eine Injektion mit LUCENTIS 900 Euro kostet und eine mit BAYERs Gentech-Präparat 1.050 Euro, schlägt AVASTIN nur mit 30 Euro zu Buche.
Hämophilie-Gentherapie
Das Unternehmen DIMENSION THERAPEUTICS entwickelt für BAYER eine neue Methode zur Behandlung der Bluter-Krankheit Hämophilie A. Dabei wollen die WissenschaftlerInnen ein Gen, das den Gerinnungsfaktor VIII produziert, direkt in die Leber einführen. Bis zu 240 Millionen Dollar an Zahlungen hat die US-amerikanische Biotech-Firma zu erwarten, sollte es ihr gelingen, das Verfahren bis zur Marktreife zu entwickeln.
WASSER, BODEN & LUFT
GAUCHO & Co. belasten Gewässer
Die Bundesländer überprüfen die Belastung der Gewässer mit BAYERs bienenschädlichen (siehe PESTIZIDE und HAUSHALTSGIFTE) Pestizid-Wirkstoffen Imidacloprid (GAUCHO) und Clothianidin (PONCHO) nicht systematisch. Es liegen nur Stichproben vor. Diese geben jedoch Anlass zur Sorge, denn sowohl Clothianidin als auch Imidacloprid überschritten teilweise die Grenzwerte. Besonders Imidacloprid tat sich dabei hervor. „Das deutet darauf hin, dass Imidacloprid ein für die Erfüllung der Anforderungen der EU-Wasserrahmen-Richtlinie relevanter Schadstoff in Oberflächen-Gewässern ist“, hält die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen zu GAUCHO & Co. fest.
Lubbock: BAYER & Co. in der Kritik
Im texanischen Bezirk Lubbock befinden sich neben dem Leverkusener Multi noch viele andere Chemie-Unternehmen. 390 Tonnen teils hochgefährlicher Stoffe lagern auf den Firmen-Arealen, oft in bedenklicher Nähe zu Siedlungen. Als es im Mai vergangenen Jahres auf dem BAYER-Gelände zu einem Austritt von Chlorwasserstoff kam, mussten deshalb die EinwohnerInnen eines ganzen Stadtteils von Guadalupe ihre Häuser verlassen. Besonders der geringe Abstand der Fabriken zu Schulen beunruhigt die LubbockerInnen. So liegen nach einer Studie des „Center for Effective Government“ 27 Bildungseinrichtungen mit insgesamt 9.500 SchülerInnen im „Einzugsgebiet“ von BAYER & Co. Die BürgerInnen verlangten aus diesem Grund genauere Information über die Substanzen, aber die Verantwortlichen des Regierungsbezirkes verweigerten die Auskunft.
Das Aus für Mikroplastik?
BAYER & Co. drängen mit ihrer Plaste & Elaste auf den Kosmetika-Markt. So finden sich in Zahnpasten, Dusch-Peelings und Kontaktlinsen-Reinigern viele Kunststoff-Produkte. Der Leverkusener Multi produziert beispielsweise Polyurethane zur Verstärkung der Haftkraft von Wimperntusche und Make-Ups. Diese Mikroplastik-Teilchen können nicht nur Gesundheitsstörungen verursachen, sondern auch die Umwelt schädigen, denn sie passieren die Kläranlagen unbehelligt. In den Gewässern bilden die Substanzen dann den besten Nährboden für andere Giftstoffe und potenzieren so ihre Gefährlichkeit noch einm