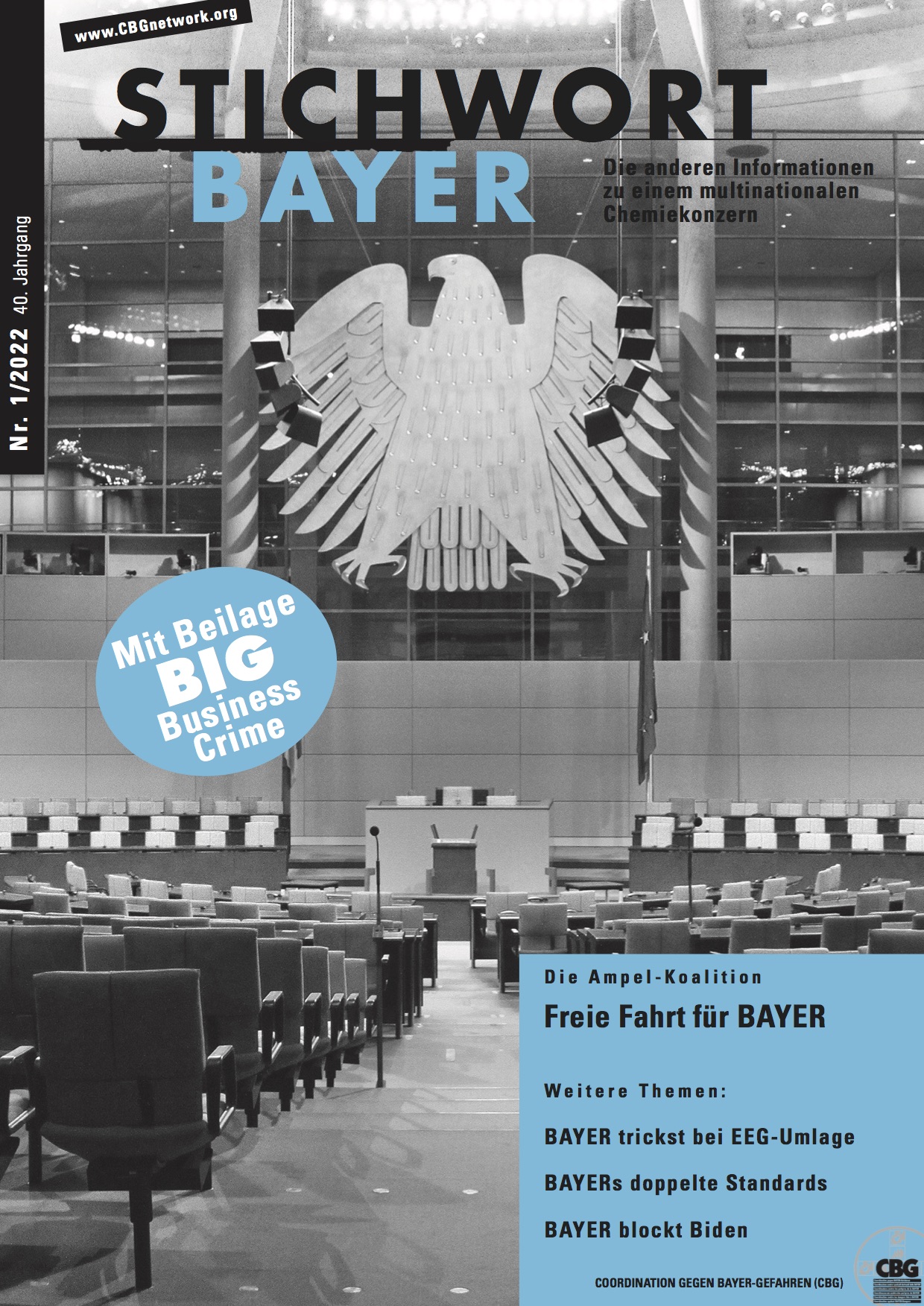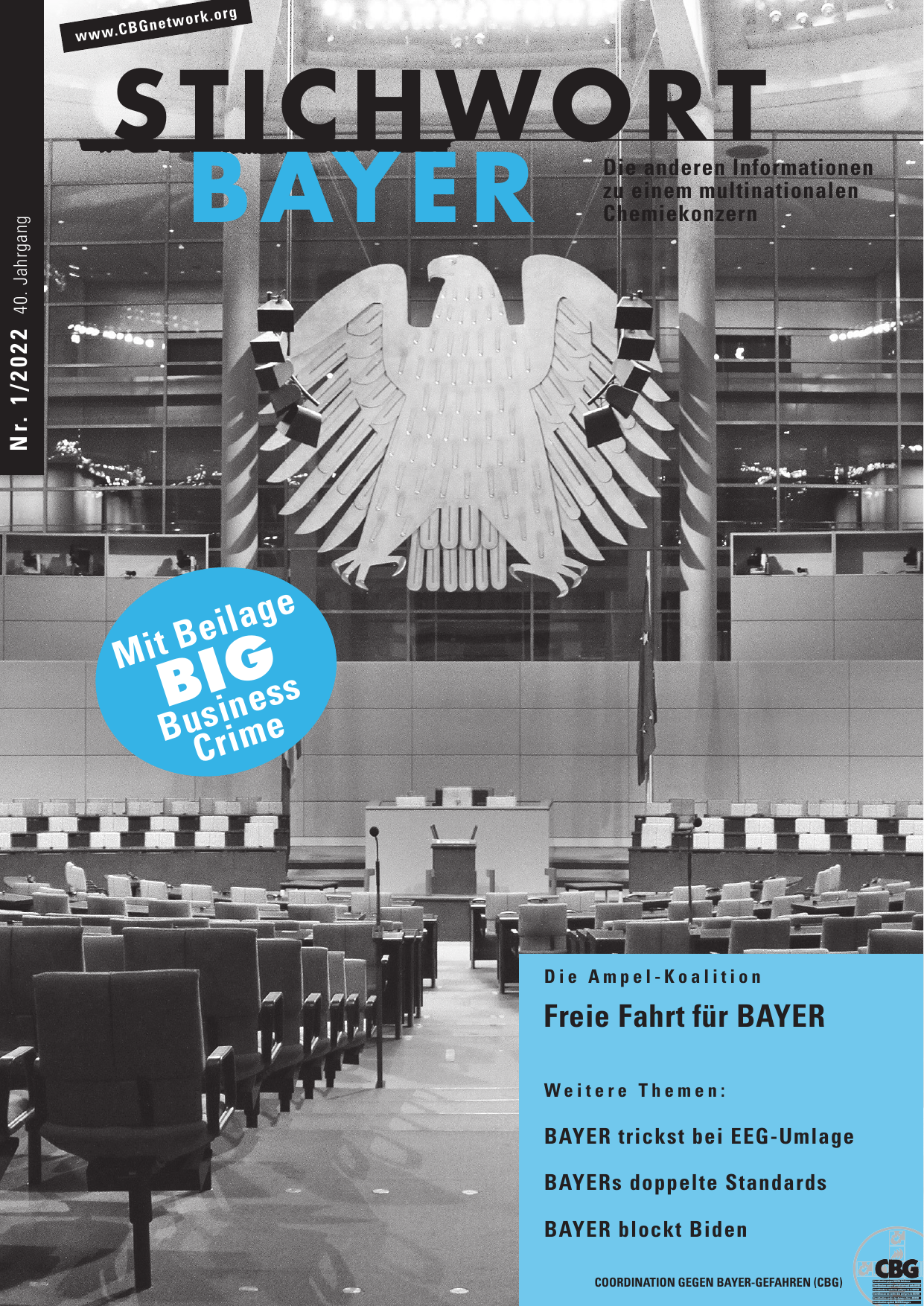Kurzmeldungen zu einem multinationalen Chemiekonzern
AKTION & KRITIK
CBG-Jahrestagung 2021
„Profit für wenige oder Gesundheit für alle? – Corona & Big Pharma“ – so lautete 2021 das Thema der Jahrestagung der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG). Max Klein von der BUKO PHARMA-KAMPAGNE widmete sich in seinem Eingangsvortrag der Schlüsselfunktion, die bei dieser Frage den Patenten zukommt. Sie sichern den Pillen-Riesen exorbitante Gewinne, während sie gleichzeitig den Bedürftigen den Zugang zu erschwinglichen Arzneimitteln verwehren. Der BUKO-Aktivist machte dies am Beispiel der Kontroverse um BAYERs Krebs-Präparat NEXAVAR in Indien deutlich. Da die meisten PatientInnen dort nicht genug Geld für das Medikament haben, erhielt NATCO PHARMA per Zwangslizenz die Erlaubnis, eine preisgünstige Version des Präparats herzustellen, wogegen der Leverkusener Multi sofort – und vergeblich – klagte. Klein zitierte zur Veranschaulichung des Zynismus, mit dem die Pillen-Produzenten agieren, den damaligen BAYER-Chef Marijn Dekkers. „Wir haben diese Arznei nicht für Inder entwickelt (...) Wir haben sie für westliche Patienten entwickelt, die sie sich auch leisten können“, hatte er freimütig erklärt. An dieser Politik hielten BAYER & Co. auch in Zeiten von COVID-19 fest und fanden in der Bundesregierung einen mächtigen Verbündeten zum Schutz des geistigen Eigentums. Vehement stemmt sich diese zurzeit bei der Welthandelsorganisation dagegen, die Patente für Impfstoffe und andere Medizin-Produkte zur Bekämpfung der Pandemie aufzuheben. Standort-Politik für die mRNA-Impfstoffe made in Germany heißt stattdessen das Gebot der Stunde. „Wir wollen gerne mRNA-Hub werden auch für die Welt und für Europa“, zitierte Max Klein den ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn. Diese mRNA-Impfstoffe schaute sich dann Isabelle Bartram vom GEN-ETHISCHEN NETZWERK ein wenig genauer an. Sie schilderte die Geschichte ihrer Entwicklung, ihre Wirkungsweise, bewertete ihre Risiken und Nebenwirkungen und plädierte schließlich für Impfungen – „bei allen großen Fragezeichen“. Anschließend gab es einen Einblick in die praktischen Bemühungen, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Matthias Grzegorczyk berichtete von der Arbeit der VOLKSINITIATIVE KRANKENHAUS NRW, die in Kooperation mit ver.di dafür streitet, die Arbeitsbedingungen für die KrankenpflegerInnen zu verbessern und sich gegen die immer stärkere Durchökonomisierung dieses Bereichs zu wehren. Dafür unterstützt sie beispielsweise die Arbeitskämpfe in den Kliniken. Zudem sammeln Grzegorczyk und seine MitstreiterInnen Unterschriften, um die katastrophale Situation in den Hospitälern auf die Tagesordnung des nordrhein-westfälischen Landtags zu setzen. Und tatsächlich führten die gemeinsamen Anstrengungen zu einigen Erfolgen. So gelang es bereits, 17 „Tarifverträge Entlastung“ durchzusetzen und damit die Krankenhaus-Träger in ihre Schranken zu verweisen, welche die Arbeitsorganisation stets als ihr alleiniges Recht betrachteten. CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann beleuchtete schließlich die Rolle, die BAYER in der Corona-Pandemie spielt bzw. nicht spielt. Wie viele andere Pharma-Riesen zeigte der Konzern sich nämlich laut Stelzmann gar nicht mehr in der Lage, schnell auf den Virus zu reagieren, denn er hatte die für die Entwicklung von Pharmazeutika gegen COVID-19 relevanten Gebiete „Infektionskrankheiten und „Atemwegserkrankungen“ längst aufgegeben. Stattdessen konzentrierte sich das Unternehmen im Zuge eines Strategiewechsels auf nur noch wenige besonders lukrative Felder wie Krebs-Therapeutika. So blieb in Sachen „SARS-CoV-2“ nur die Kooperation mit anderen Herstellern. Der Leverkusener Multi stellte sich CURE-VAC als verlängerte Werkbank zur Produktion des Impfstoffes CVnCoV zur Verfügung. Aber selbst das zerschlug sich nach den enttäuschenden Test-Ergebnissen des Vakzins. Zu sämtlichen Vorträgen entwickelten sich lebendige und teils auch kontroversen Diskussionen über die Pandemie, den politischen und medizinischen Umgang damit und über die sozialen und kulturellen Nebenwirkungen. Aber laut wurde es nicht, denn es gab einen Grund-Konsens: Bei BAYER & Co. ist die gegenwärtige gesundheitliche Krise nicht in guten Händen.
CBG-Statement zur Gentech-Regulierung
Die Europäische Union will die neuen Verfahren zur Manipulation des Erbguts nicht mehr nach Maßgabe der Richtlinie für gentechnisch veränderte Organismen regulieren. Stattdessen kündigte sie an, bis 2023 für Genscheren wie CRISPR/Cas und vergleichbare Methoden einen Rechtsrahmen mit lascheren Schutzbestimmungen zu schaffen. Im Zuge dieses Prozesses rief die EU BürgerInnen und Organisationen dazu auf, Stellungnahmen zu dem Vorhaben abzugeben. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) nahm das wahr und kritisierte die Pläne in einer Eingabe. Insgesamt gingen in Brüssel 70.894 Statements zu den „Rechtsvorschriften für Pflanzen, die mithilfe bestimmter neuer genomischer Verfahren gewonnen werden“, ein.
Patente: CBG unterschreibt Petition
BAYER & Co. melden immer mehr Patente auch auf solche Pflanzen an, die nicht mit Hilfe der Gentechnik, sondern mittels konventioneller Verfahren entstanden sind, obwohl die Gesetze das eigentlich verbieten. So macht der Leverkusener Multi unter anderem geistiges Eigentum auf eine herbizid-resistente Mais-Art, auf Pflanzen mit einer erhöhten Stress-Resistenz und auf eine Methode zur Erhöhung des Zucker-Gehaltes von Zuckerrohr geltend. Zudem reichte er beim Europäischen Patentamt (EPA) Anträge auf Gewährung von Schutzrechten für Tomaten, Gurken, Melonen, Salat und Kohlgewächse ein. Dadurch droht die Kon-trolle über die gesamte Lebensmittel-Produktion in die Hände der Agro-Riesen zu fallen. Das Netzwerk KEINE PATENTE AUF SAATGUT fordert die Politik deshalb zum Handeln auf. „Die Minister-Innen der Vertragsstaaten des EPA sollen sich binnen eines Jahres treffen und wirksame Maßnahmen gegen Patente aus konventioneller Zucht von Pflanzen und Tieren ergreifen“, heißt es in dem Aufruf, den die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN mitunterzeichnete.
Petition an FAO-Direktor übergeben
Die Vereinten Nationen und ihre Unter-Organisationen geraten immer mehr unter den Einfluss der Konzerne. So vereinbarte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO eine Partnerschaft mit „Croplife International“, dem weltweit agierenden Lobby-Verband von BAYER & Co. Aus Protest dagegen hatte das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK (PAN) im Februar 2021 einen Offenen Brief initiiert, den mehr als 350 Organisationen, darunter auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN CBG), unterschrieben haben. Aus diesem sowie aus einem weiteren Schreiben ging dann eine Petition hervor, die mehrere Initiativen am 3. Dezember dem FAO-Generaldirektor Qu Dongyu übergaben. Dabei wählten sie das Datum bewusst. Es handelte sich nämlich um den International Day of No Pesticide Use“ – den alljährlichen Gedenktag an die Bhopal-Katastrophe vom 3.12.1984.
Explosion: Kritik eines BAYER-Werkers
Im September 2021 war der Rundfunk-Sender WDR 5 vor Ort in Leverkusen und widmete sein „Stadtgespräch“ der Explosion vom 27. Juli. Und da bekamen CURRENTAs Chem„park“-Leiter Lars Friedrich und die NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) ganz schön was zu hören. Eine katastrophale Informationspolitik, eine unzureichende Anlagen-Kontrolle, Mängel bei den Schadstoff-Messungen nach der Explosion – so nur einige der Vorwürfe. Auch ein Vertreter der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) meldete sich zu Wort und fragte Friedrich, ob die CURRENTA trotz der verheerenden Auswirkungen der Detonation weiterhin aus Profit-Gründen Müll aus aller Herren Länder zur Entsorgung annehmen wolle. Antwort: Der Anteil des Abfalls, der nicht vom Gelände selbst stammt, betrage doch „nur“ 30 Prozent. Besonders schwer wog an dem Abend die Kritik eines ehemaligen BAYER-Werkers. Peter Odenthal hatte in der Abteilung für Umweltanalytik gearbeitet und pflichtete dem CBGler bei. Für solche grenzüberschreitenden Abfall-Geschäfte wären die Vorrichtungen des Entsorgungszentrums gar nicht ausgelegt gewesen, so Odenthal. Vor allem aber warf er dem obersten Chemparker Verharmlosung vor. „Die Straße war mit Tropfen übersät, und meine Haut hat gebrannt“ berichtete er. „Bei uns in der Nachbarschaft sind die Dächer kaputt, die Regenrinnen sind kaputt, die Autos sind beschädigt (...), die Pflanzen sind beschädigt, und dann reden Sie mir nicht davon, dass keine Gefahr besteht. In diesem Bereich war unmittelbar eine enorme Belastung“, führte der Ex-BAYER weiter aus. Er hatte sogar seine Hilfe angeboten und selbst Proben gesammelt. Vergeblich aber wartete der Pensionär auf einen Rückruf aus der Analytik-Abteilung von CURRENTA. „Zynisch bis zum letzten Tag“ nannte Odenthal den Umgang des Managers mit der Explosion und schloss: „Wir glauben Ihnen in Summe kein Wort mehr.“
KAPITAL & ARBEIT
BAYER schließt Arznei-Anlage
Der Pharma-Multi fertigt in Leverkusen keine Flüssig-Arzneien mehr; er stellt die sogenannten Parenteralia bloß noch am Standort Berlin her. Anfang August 2021 gab der Konzern die Schließung der Anlage an seinem Stammsitz bekannt. Viele ZeitarbeiterInnen, die dort langjährig tätig waren, ohne vom Pillen-Riesen übernommen zu werden, verloren dadurch ihre Jobs.
WUXI kauft BAYER-Anlagen
Die Risiken und Nebenwirkungen des MONSANTO-Deals wie z. B. die Schadensersatz-Ansprüche von Glyphosat-Geschädigten zwangen BAYER Ende 2018 zu einem Spar-Programm, das 12.000 Arbeitsplätze vernichtete. Im Zuge dessen stellte er in Wuppertal auch die in einer neu errichteten Anlage gerade erst angelaufene Fertigung des Bluter-Präparats KOVALTRY ein. Der Pharma-Riese verkaufte die Produktionsstätte Ende 2020 an das chinesische Unternehmen WUXI BIOLOGICS. Dieses hatte zuvor schon den für KOVALTRY in Leverkusen vorgesehenen Weiterverarbeitungsbetrieb übernommen.
NORD & SÜD
Mehr MIRENA für den globalen Süden
„Fünf gegen das Wachstum der Bevölkerung investierte Dollar sind wirksamer als hundert für das Wirtschaftswachstum investierte Dollar“, sagte einst der ehemalige US-Präsident Lyndon B. Johnson über seine Vorstellung von „Entwicklungshilfe“. Zur großen Befriedigung BAYERs erfreut sich diese Art von Bevölkerungspolitik auch heute noch großer Beliebtheit. Die „gigantischen Fruchtbarkeitsmärkte“ in den armen Ländern versprechen nämlich gute Absatz-Chancen für die Verhütungsmittel des Konzerns. Bevorzugt arbeitet er bei der Vermarktung mit staatlichen oder privaten Entwicklungshilfe-Organisationen zusammen, die – gegen Preis-Nachlass – langfristige Lieferverträge garantieren. Im Juli 2021 konnte der Pharma-Riese zwei Geschäfte dieser Art abschließen. Die US-amerikanische Entwicklungsagentur „United States Agency for International Development“ (USAID) und der „United Nations Population Fund“ nahmen das Langzeit-Verhütungsmittel MIRENA in ihren Produkt-Katalog auf. Der von dem Millionär John Rockefeller III 1952 ins Leben gerufene „Population Council“ (PC) hatte diese Hormon-Spirale kreiert und ihre Entwicklung gemeinsam mit der jetzigen BAYER-Tochter SCHERING vorangetrieben. Das sogenannte hormonelle Intrauterin-System hat erhebliche Nebenwirkungen wie Brustkrebs, nächtliche Schweißausbrüche, Herzrasen und Unruhe. Auch Schlaflosigkeit, Bauchkrämpfe, Oberbauchschmerzen und Gebärmutter-Verletzungen zählen dazu. Fast 3.000 Klagen von Geschädigten erhielt der Leverkusener Multi deshalb bereits. Das allerdings ficht BAYERs obersten Öffentlichkeitsarbeiter Matthias Berninger nicht an. „‚Der United Nations Population Fund’ und die ‚United States Agency for International Development’ haben vor kurzem ein hormonelles Intrauterin-System von BAYER in ihre jeweiligen Produkt-Kataloge aufgenommen. Dies ist ein großer Fortschritt bei der Bereitstellung von zusätzlichen Verhütungsoptionen für Frauen und Familien in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommensniveau“. Nicht die bettelarmen Staaten will der Leverkusener Multi also beglücken, sondern „Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommensniveau“. Die ManagerInnen reden da auch gerne von den „Low-Income Markets“. Und die versprechen durchaus einträgliche Geschäfte. Die vom Pillen-Riesen SANOFI gesponserte und vom „Bundeswirtschaftsministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“herausgegebene Expertise „Bringing Medicines to Low-income Markets“, an der Annette Wiedenbach von BAYER als eine der ExpertInnen mitwirkte, frohlockte bereits im Jahr 2012: „Diesen Markt haben sich die Pharma-Firmen noch kaum erschlossen.“ Daran macht sich der Global Player nun. Um die gesteigerte Nachfrage zu bewältigen, investiert er rund 400 Millionen Euro in die Errichtung einer neuen Fabrik in Costa Rica und den Ausbau der Produktionskapazitäten am finnischen Standort Turku.
POLITIK & EINFLUSS
Glyphosat-Studie im EPA-Giftschrank
Die US-amerikanische Umweltbehörde EPA hat vor einigen Jahren eine Expertise, die den Zusammenhang zwischen Glyphosat und bestimmten Arten von Lymphdrüsen-Krebs untersuchte, im Giftschrank verschwinden lassen. Das deckte die Journalistin Sharon Lerner auf, die das Ergebnis ihrer Recherchen in dem Internet-Magazin The Intercept veröffentlichte. „Die verfügbaren epidemiologischen Studien liefern überzeugende Belege für einen Zusammenhang zwischen einer Glyphosat-Exposition und einem erhöhten Risiko für Non-Hodgkin-Lymphome“, heißt es in dem Behörden-Dokument. In die abschließende Beurteilung des Herbizids floss diese Auswertung von 14 Studien jedoch nicht ein. Die „Environment Protection Agency“ behandelte die Arbeit damals als geheime Verschlusssache. Lerner zufolge vermochte es die Umweltschutz-Agentur nicht, „sich gegen den Druck der mächtigen agro-chemischen Unternehmen, die jährlich Dutzende von Millionen von Dollar für Lobbyarbeit ausgeben und viele ehemalige EPA-Wissenschaftler beschäftigen“ zu stellen. Die jetzige US-Regierung hat nun mit Michael S. Regan jedoch einen neuen Direktor eingesetzt, der Besserung gelobt. Tatsächlich begannen auch interne Revisionen. So räumte die Agency bereits gravierende Mängel bei der Zulassung des Pestizids Dicamba ein, das unter anderem von BAYER und der BASF vertrieben wird. Auch kündigte sie an, mögliche schädliche Auswirkungen von Glyphosat auf bestimmte Schmetterlingspopulationen neu zu prüfen und die Gefahr detaillierter zu analysieren, die bei der Ausbringung des Herbizids durch Verwehungen auf teilweise weit entfernte Ackerflächen droht. Zugleich hält die EPA jedoch an ihrer Einstufung des Mittels als gesundheitlich unbedenklich fest.
EU will Gentech 2.0 deregulieren
Im Juli 2018 hatte der Europäische Gerichtshof die neue Gentechnik den alten gentechnisch veränderten Organismen (GVO) gleichgestellt. Die RichterInnen kamen in einem Grundsatz-Urteil zu dem Schluss, „dass sich die mit dem Einsatz dieser neuen Mutagenese-Verfahren verbundenen Risiken als vergleichbar mit den bei der Erzeugung und Verbreitung von GVO im Wege der Transgenese auftretenden Risiken erweisen könnten“. Deshalb lehnten sie es ab, Genscheren wie CRISPR/Cas und anderen Verfahren Sonderregelungen einzuräumen. „Durch Mutagenese gewonnene Organismen sind gentechnisch veränderte Organismen (GVO) und unterliegen grundsätzlich den in der GVO-Richtlinie vorgesehenen Verpflichtungen“, lautete ihr Votum. Dagegen liefen BAYER und die anderen Agro-Riesen Sturm, was bei der Europäischen Union nicht ohne Folgen blieb. Sie gab eine Studie zu dem Thema in Auftrag, um wieder Handlungsspielraum zu bekommen. Und wie erwartet machte die im April 2021 vorgelegte Untersuchung dann Wettbewerbsnachteile für europäische Unternehmen durch eine allzu strenge Regulierung aus und plädierte für einen lockereren Umgang mit den neuen Technologien. „Jede weitere politische Maßnahme sollte darauf abzielen, die Vorteile der Innovation zu nutzen und gleichzeitig auf Bedenken einzugehen. Eine rein sicherheitsbasierte Risiko-Bewertung reicht möglicherweise nicht aus (...)“, heißt es in der Zusammenfassung. Das lieferte der Europäischen Union die erwünschte Vorlage dafür, bis zum Jahr 2023 einen neuen Rechtsrahmen für die Gentechnik 2.0 zu schaffen. Im Zuge dieses Prozesses rief sie BürgerInnen und Organisationen dazu auf, ihre Meinung zu dem Vorhaben kundzutun, was die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN auch nutzte (siehe AKTION & KRITIK).
Kein Geld mehr für die RAGA
Der BAYER-Konzern hatte den Sturm auf das Washingtoner Kapitol vom 6. Januar 2021 nach Recherchen der taz durch Spenden an den „Verband der republikanischen Generalstaatsanwälte“ (RAGA) mitfinanziert (Ticker 2/21). 50.000 Dollar zahlte seine Tochter-Gesellschaft MONSANTO 2020 der RAGA, dessen Unterorganisation „Rule of Law Defense Fund“ massiv zu Aktionen an dem Tag mobilisierte. Nach dieser Enthüllung stoppte der Leverkusener Multi die Überweisungen nicht etwa sofort, er erklärte stattdessen, eine weitere Förderung von einer internen Untersuchung der RAGA zu den Vorgängen abhängig zu machen. Im Mai gab der Agro-Riese dann per Twitter seine Entscheidung bekannt: „Bei der RAGA fehlt eine kritische Aufarbeitung der Rolle des mit ihr verbundenen „Rule of Law Defense Fund“ beim Sturm auf das Kapitol. Daraus ziehen wir die Konsequenz.“
Online-HV: BAYER noch unentschieden
Schon lange vor Corona hatten BAYER & Co. mit der Abkehr von Präsenz-Hauptversammlungen geliebäugelt, um sich kritische AktionärInnen besser vom Leib halten zu können. Die Pandemie gab ihnen dann die passende Gelegenheit dazu, was BAYER als erster DAX-Konzern nutzte. Im September 2021 erteilte der Gesetzgeber den Unternehmen nun das Recht, auch im nächsten Jahr wieder ins Virtuelle zu flüchten. Es blieb bei einer Mahnung, dabei besonnen vorzugehen: „Auch wenn die Erleichterungen somit noch bis einschließlich 31. August zur Verfügung stehen, sollte von diesem Instrument im Einzelfall nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn dies unter Berücksichtigung des konkreten Pandemie-Geschehens und im Hinblick auf die Teilnehmer-Zahl der jeweiligen Versammlung erforderlich erscheint.“ Unmittelbar nach dem Beschluss erklärte der Global Player auf Anfrage des Leverkusener Anzeigers, es stehe noch nicht fest, ob er sich für eine Online-HV entscheiden werde.
CORONA & CO.
Aus für CUREVAC-Impfstoff
Der Corona-Impfstoff des BAYER-Partners CUREVAC erreichte bei den Tests nur eine Wirksamkeit von 48 Prozent. Offensichtlich reichte bei CVnCoV die Dosierung nicht aus. Eine stärkere Konzentration konnte das Tübinger Unternehmen jedoch nicht vornehmen, ohne heftige Nebenwirkungen zu provozieren. Anders als MODERNA und BIONTECH hatte CUREVAC den Wirkstoff nämlich nicht chemisch verändert, um ihn ungefährlicher zu machen. Besonders bei Älteren schlug das Vakzin nicht in gewünschter Form an. Zunächst wollte die Tübinger Firma nach der Devise „Was nicht passt, wird passend gemacht“ vorgehen und Studien – etwa durch die Einbeziehung besonders junger Proband-Innen – neu konzipieren, Mitte Oktober entschied das Management sich jedoch um. Es verkündete das Aus für das Pharmazeutikum und gab bekannt, zukünftig allein auf seinen Impfstoff der zweiten Generation zu setzen, für den die Firma sich GLAXOSMITHKLINE als Partner auserkoren hat. Die Lieferverträge mit der Europäischen Union fallen jetzt flach. Die Vorabzahlungen der EU in Höhe von 450 Millionen Euro muss CUREVAC aber ebenso wenig zurückzahlen wie die 196 Millionen Euro aus dem Fördertopf des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Kooperation mit BAYER liegt jetzt ebenfalls auf Eis. Ursprünglich hatte die Aktien-Gesellschaft vor, 160 Millionen Dosen CVnCoV herzustellen. 30 Beschäftigte stellte sie dafür ein. Aber nun heißt es aus der Unternehmenszentrale: „Es gibt keinen Gegenstand mehr, auf den sich die Partnerschaft beziehen könnte.“ Die Anlage für die Corona-Arznei hatte der Konzern noch gar nicht gebaut, weshalb sich die Unkosten in Grenzen halten und eine Fertigung für andere Vakzin-Anbieter nicht in Frage kommt. Entsprechende Hoffnungen der nordrhein-westfälischen Landesregierung enttäuschte der Pharma-Riese. Ursprünglich hatte Ex-Ministerpräsident Armin Laschet noch ganz andere Pläne und bei der Bekanntgabe der Zusammenarbeit frohlockt: „Der Einstieg der BAYER AG in die Impfstoff-Produktion ist ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf gegen das Virus. NRW will zu einem Zentrum der mRNA-Technologie werden.“ Beim Leverkusener Multi heißt es jetzt lediglich unverbindlich: „Wir schauen uns die mRNA-Technologie grundsätzlich weiter an, setzen aber vor allem auf die Gen- und Zelltherapie.“ Und für die 30 Neueingestellten hat er bereits andere Aufgaben gefunden.
CUREVAC forcierte Staatsbeteiligung
Im Juni 2020 erwarb der Bund 23 Prozent der Anteile an BAYERs zeitweiligem Impfstoff-Partner CUREVAC (s. o.). Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) begründete diesen Schritt mit der Notwendigkeit, „elementare Schlüsselindustrien am Standort zu erhalten und zu stärken“ und die industrielle Souveränität Deutschlands zu wahren. „Deutschland steht nicht zum Verkauf“, so Altmaier. Vorher hatte es Gerüchte um einen Börsengang von CUREVAC in den USA sowie um das Bemühen Donald Trumps gegeben, die Firma ganz in die USA zu locken. Diese Gerüchte hat CUREVAC bewusst geschürt, um staatliche Gelder zu erhalten. Das hat die Initiative FRAG DEN STAAT enthüllt, die eine Anfrage auf Basis des Informationsfreiheitsgesetzes stellte und so Einsicht in den Briefverkehr des Unternehmens mit der Bundesregierung erhielt. „Ich möchte gerne den Technologie-Transfer unserer proprietären Produktion in die USA und den Abzug der Impfdosen aus Tübingen verhindern, deswegen wende ich mich nochmals an Sie“, so unterlegte das Management die Bitten um Geld. Auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Bündnis 90/Die Grünen) lobbyierte für die finanzielle Unterstützung CUREVACs. Er wandte sich in einer E-Mail persönlich an den damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und warnte ebenfalls vor einer Abwanderung der Firma in die USA, falls die Euros ausblieben.
BAYER prüft Impfpflicht in US-Werken
Der BAYER-Konzern prüft, in seinen US-amerikanischen Niederlassungen eine Impfpflicht zu erlassen. „Es wird auch bei uns in den USA darüber diskutiert, es gibt aber derzeit keine Entscheidung in dieser Richtung“, bekundete ein Sprecher des Unternehmens.
Geimpfte und Nicht-Geimpfte getrennt
Der BAYER-Konzern trennt in seinen Kantinen Geimpfte und Nicht-Geimpfte voneinander und betritt damit eine rechtliche Grauzone. Unternehmen ist es nämlich nicht gestattet, sich nach dem Impf-Status der Beschäftigten zu erkundigen, denn Gesundheitsdaten unterliegen einem besonderen Schutz. Nur für Krankenhäuser, Pflege-Einrichtungen, Schulen und Kita gelten laut Infektionsschutz-Gesetz Ausnahme-Bestimmungen. Der Leverkusener Multi betont allerdings, die Regelung „in enger Absprache mit den Betriebsräten“ getroffen zu haben. Und der Agro-Riese hat noch einen Dreh gefunden, die Vorschriften zu unterlaufen: Er überlässt die Angelegenheit einfach den Belegschaftsangehörigen. „Selbstorganisierte Gruppen, zum Beispiel in Mehrpersonen- oder Großraumbüros, in Laboren oder Teilbereichen der Produktion, können unter freiwilliger Anwendung der 2G-Regel ohne Abstand und Maske zusammenarbeiten oder Arbeitsmeetings in Präsenz durchführen“, erklärt der Global Player.
BAFIN prüft InsiderInnen -Geschäfte
Mitte Juni gab die Biotech-Schmiede CUREVAC, mit der BAYER in Sachen „Corona-Impfstoff“ einen Kooperationsvertrag abgeschlossen hatte, enttäuschende Test-Ergebnisse für seinen Vakzin-Kandidaten bekannt. Unmittelbar danach stürzten die Aktien des Unternehmens ab. Das rief die Finanzaufsicht BAFIN auf den Plan. Die Behörde leitete ein Prüfverfahren ein, um zu eruieren, ob ManagerInnen der beiden Konzerne ihr InsiderInnen-Wissen nutzten und kurz vor Schluss noch einmal Kasse machten. Die Tübinger Firma stritt das jedoch vehement ab und verwies auf einen schon weit vorher festgelegten Verkaufstermin: „Es besteht daher keine logische Kausalität zwischen den beschriebenen Transaktionen und aktuellen Firmen-Entwicklungen bei CUREVAC.“
BAYERs Patent-Lobbyismus
Nur 0,5 Prozent der verfügbaren Impfstoffe gegen COVID-19 landeten in den ärmeren Ländern, wie Max Klein von der BUKO PHARMA-KAMPAGNE auf der letzten CBG-Jahrestagung Anfang Oktober darlegte. Um eine gerechtere Verteilung der Vakzine zu gewährleisten, fordern diese Staaten deshalb eine Aufhebung der Patente. Dagegen sträuben sich die Pharma-Unternehmen – unterstützt von der Bundesregierung – jedoch vehement. So bekundete BAYERs Pharma-Chef Stefan Oelrich auf der letzten Hauptversammlung des Leverkusener Multis: „Bei der Bekämpfung einer solchen Pandemie geht es in erster Linie darum, den Menschen so schnell wie möglich und auch unbürokratisch zu helfen. Dabei stehen Fragen des Patentschutzes zunächst nicht im Vordergrund. Davon unabhängig gilt, dass der Schutz des geistigen Eigentums als Anreiz für die Entwicklung neuer Arzneimittel unverzichtbar ist. Dies ist die Basis dafür, dass es heute mit Hilfe neuer Technologien in Rekordzeit entwickelte Impfstoffe überhaupt gibt. Ohne Rechte an geistigem Eigentum würden die Impfstoffe gegen Covid-19 nämlich nicht existieren.“ Und solchen Worten folgen auch Taten, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Partei „Die Linke“ hervorgeht. So nahm Oelrich in Sachen „Patente“ an einer Videokonferenz des Bundeskanzleramts teil, und auch in einer zweiten zum Thema war ein Emissär des Konzerns vertreten. Bei einem „Zukunftsdialog“ zu der Frage, den das Bundeswirtschaftsministerium initiierte, durfte der Pharma-Riese selbstverständlich ebenfalls nicht fehlen. Überdies gab es telefonische Kontakte mit dem Staatssekretär Andreas Feicht. Und am 23. Juni kam es sogar zu einem persönlichen Treffen von BAYER-ManagerInnen mit Kanzleramtschef Helge Braun.
BAYER & Co. wollen „Studienreform“
Für die klinische Erprobung der verschiedenen Impfstoffe und Medikamente gegen Corona gab es beschleunigte Verfahren. Beispielsweise wurden die verschiedenen Phasen der Prüfungen zusammengelegt. Infolgedessen kamen in der praktischen Anwendung viele Nebenwirkungen zum Vorschein, die in den Tests unbemerkt blieben. So ging die Europäische Arzneimittel-Agentur unter anderen Hinweisen auf vermehrt auftretene Fälle von Herzmuskel-Entzündungen, Herzbeutel-Entzündungen, Embolien, Thrombosen, Blutungsstörungen, Nierenstörungen und Augenleiden nach. BAYER & Co. aber wollen trotzdem die Ungunst der Stunde nutzen, um generell weniger Auflagen für Pharma-Tests durchzusetzen. „Für klinische Studien ist es wichtig, dass die Politik Rahmenbedingungen schafft, dass es von der Planung bis zur Studie schneller losgehen kann“, sagt etwa BAYER-Managerin Heike Prinz. Und der vom Leverkusener Multi gegründete „Verband der forschenden Arzneimittel-Hersteller“ sekundiert: „Die Vielzahl der nötigen Genehmigungen und Zustimmungen, insbesondere bei Datenschutz und Ethik, macht alles sehr bürokratisch, aufwendig und manchmal auch langsam.“
Kein Antikörper-Impfstoff mit BAYER
Der BAYER-Konzern hatte sich an einer Kooperation zur Entwicklung eines Antikörper-Vakzins gegen Corona beteiligt. Gemeinsam mit CORAT THERAPEUTICS und dem „Fraunhofer-Institut für Toxikologie und experimentelle Medizin“ wollte er ein Vakzin auf Antikörper-Basis entwickeln, das als sogenannter Passiv-Impfstoff die Ausbreitung der Krankheit bei schon Infizierten eindämmt. Der Beitrag des Leverkusener Multis zum Verbund bestand darin, CORAT Zugriff auf seine Prozessentwicklungsplattform zu gewähren. Im März 2021 aber kündigte das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit den beiden Partnern auf. Offenbar hatte es sich damals entschieden, ganz auf die Impfstoff-Liason mit CUREVAC zu setzen.
Zweite Karriere für BAYER-Mittel?
Zu schweren Verläufen von Corona kommt es zumeist durch eine Überreaktion des Immunsystems, die auch zu einer Schädigung gesunder Zellen führt. Bei Versuchen, dies zu verhindern, stießen WissenschaftlerInnen des „Berlin Institute of Health“ auf eine alte BAYER-Substanz. Als Mittel gegen chronische Entzündungskrankheiten scheiterte das Präparat, das Chemokine – Botenstoffe des Immunsystems – blockiert, einst. Nun hoffen die ForscherInnen auf bessere Resultate bei COVID-19. Die vom Bundesforschungsministerium mit 3,5 Millionen Euro geförderte klinische Studie beginnt direkt mit der zweiten Phase; die Herstellung der Prüfsubstanz hat der Leverkusener Multi übernommen.
DRUGS & PILLS
BAYER setzt auf Krebsmittel
Therapeutika gegen Krebs werfen im Arznei-Bereich mit am meisten Geld ab, obwohl diese Pharmazeutika die Überlebenszeit der PatientInnen zumeist nur um wenige Monate verlängern. So kostet etwa eine Behandlung mit BAYERs Tumor-Präparat VITRAKVI schlappe 32.800 Dollar pro Monat. Solche Profit-Aussichten veranlassen den Konzern nun, die Sparte auszubauen. „Es ist unser Ziel und unser Anspruch, dass wir in diesem Feld bis 2030 zu den „Top-Ton“-Pharmaunternehmen gehören“, verkündete BAYERs Forschungsleiter Christian Rommel. Momentan nimmt der Global Player Rang 14 ein. Aus eigener Kraft will er den Aufstieg allerdings nicht bewerkstelligen. Der Leverkusener Multi setzt dabei auf externe Kooperationen.
AGRO & CHEMIE
Glyphosat-Absatz wächst
In Deutschland legt der Glyphosat-Absatz wieder zu. Während die Zahlen zwischen 2015 und 2019 von 4.315 Tonnen auf 3.059 Tonnen sanken, stiegen sie im Jahr 2020 auf 3.773 Tonnen an – eine Steigerung um fast 25 Prozent.
Glyphosat verseucht Nudeln
In vielen Teigwaren finden sich Glyphosat-Spuren. Das Magazin Ökotest untersuchte 19 Spaghetti-Marken und spürte in elf von ihnen Reste des Pestizids auf. Während keines der fünf untersuchten Bio-Fabrikate mit dem umstrittenen Herbizid verunreinigt war, galt das nur für drei der konventionell hergestellten Produkte.
Glyphosat verseucht Wälder
Der Einsatz von BAYERs Glyphosat in der Forstwirtschaft Kanadas verursacht weitreichende Schäden. Hatte ein ForscherInnen-Team um Nicole Botten von der „University of Northern British Columbia“ noch ein Jahr nach der Ausbringung Rückstände des Herbizids in Himbeeren und Heidelbeeren nachgewiesen (Ticker 4/21), so machten ihre KollegInnen Alexandra R. Golt und Lisa J. Wood nun negative Effekte auf Unterholz-Sträucher wie Stachel-Rosen aus. Laut der Studie hemmte das Pestizid die Verbreitung der Pflanze, sorgte für eine verminderte Größe der Pollen und schränkte deren Überlebensfähigkeit ein. Das gefährdet nach Ansicht der beiden WissenschaftlerInnen die gesamte Artenvielfalt des Waldes. Der BAYER-Konzern hingegen will von all dem nichts wissen. „Unsere glyphosat-basierten Produkte wurden von den Zulassungsbehörden in Kanada und weltweit gründlich geprüft, um sicherzustellen, dass alle zugelassenen Anwendungen der Produkte die Umwelt schützen, einschließlich der Nicht-Zielpflanzen“, bekundete Konzern-Sprecher Utz Klages. Dabei verwies er auch auf eine Untersuchung der Forstbehörde, die ihm zufolge zu dem Schluss kam, „dass Glyphosat, wie es in der kanadischen Forstwirtschaft verwendet wird, kein inakzeptables Risiko für natürliche Lebensräume, Wildtiere oder die Umwelt darstellt“.
Glyphosat-Regelungen in Kraft
Im September 2021 trat ein Gesetzes-Paket zum Insektenschutz in Kraft, das auch Maßnahmen zur Einschränkung des Pestizid-Gebrauchs umfasst. Für Glyphosat sehen die Bestimmungen ein Verbot nur für die Anwendung im Privatbereich und auf öffentlichen Grünflächen vor, die mengenmäßig kaum ins Gewicht fällt. Für das Ausbringen auf Äckern lassen Merkel & Co. hingegen zahlreiche Ausnahmen zu. So darf das Mittel gegen nicht wenige Wildkräuter nach wie vor zum Einsatz kommen. Auch wenn das Pflügen, die Wahl einer geeigneten Fruchtfolge oder eines geeigneten Aussaat-Zeitpunkts nicht möglich ist, bleibt das von der Weltgesundheitsorganisation als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestufte Herbizid bis 2023 erlaubt. Erst dann erfolgt das Aus – und das auch nur unter Vorbehalt. Wenn die EU Glyphosat bis dahin nämlich nicht aus dem Verkehr zieht, wackelt auch der Beschluss der Bundesregierung. „Sollten sich in diesem Zusammenhang Änderungen der Dauer der Wirkstoff-Genehmigung ergeben, ist das Datum des vollständigen Anwendungsverbots gegebenenfalls anzupassen“, hält die „Pflanzenschutzanwendungsverordnung“ fest. Die anderen Vorgaben zur Handhabung der Ackergifte erweisen sich ebenfalls als unzureichend. Sie beschränken sich auf Maßnahmen zur Eindämmung des Insektensterbens in bestimmten Schutzgebieten. Überdies gibt es viele Ausnahme-Tatbestände.
Merkel & Co. antworten Bundesrat
Der Bundesrat hatte dem Gesetzes-Paket zum Insektenschutz (s. o.) zwar zugestimmt, aber noch Änderungen erwirkt. Einerseits beschloss er einen Bestandsschutz für Länder-Regelungen zur Einschränkung des Pestizid-Gebrauchs, die über das Bundesrecht hinausgehen, andererseits schuf das Länder-Gremium einen weiteren Ausnahme-Passus. So wollte es den Einsatz von Glyphosat & Co. zur „Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Schienen-Wegen“ weiterhin erlaubt sehen. Insgesamt erachtete der Bundesrat das Paragrafen-Werk jedoch als nicht ausreichend. Deshalb bat er die Bundesregierung in einer Entschließung, „weitere Vorschläge zum Schutz und zur Stärkung der Artenvielfalt zu erarbeiten“. Drei Monate später kam die Antwort. Handlungsbedarf konnte die Große Koalition allerdings nicht erkennen. Sie verwies auf die zusätzlich zu den neuen Paragrafen-Werken noch durch das „Aktionsprogramm Insektenschutz“ sowie die EU-Landwirtschaftspolitik initiierten Maßnahmen und führte einige vom Bund unterstützte Forschungsprojekte zu weniger schädlichen Pestiziden oder nicht chemischen Verfahren auf.
PFLANZEN & SAATEN
Saatgut: Biden will regulieren
Auf den meisten Agrar-Märkten haben sich oligopolhafte Strukturen gebildet. Die Biden-Administration sieht deshalb den Wettbewerb gefährdet und die LandwirtInnen einem immer höheren Preisdruck ausgesetzt. Darum will sie die einzelnen Sektoren prüfen. Als erste Sparte hat sich Landwirtschaftsminister Tom Vilsack den Saatgut-Bereich vorgenommen, in dem BAYER, CORTEVA, LIMAGRAIN und CHEMCHINA/SYNGENTA 52 Prozent aller Geschäfte abwickeln. Und einen Ansatzpunkt hat der Politiker schon identifiziert: „Man fragt sich, ob diese langen Patente Sinn machen.“
BITS & BYTES
Immer mehr digitale Landwirtschaft
Die Digitale Landwirtschaft sammelt mit Hilfe von Drohnen, Sensoren und Satelliten-Bildern Informationen über das Wetter, die Bodenbeschaffenheit, Pflanzenkrankheiten und Schadinsekten. BAYER hat dazu die Plattform „FieldView“ im Angebot und preist es den FarmerInnen mit einigem Erfolg als probates Mittel an, um „Risiken aktiv zu managen, die Produktivität zu steigern und Betriebsabläufe zu vereinfachen“. Kam das Erzeugnis der Digital-Tochter CLIMATE CORPORATION im Jahr 2018 auf einer Fläche von 24 Millionen Hektar zum Einsatz, so sind es nunmehr bereits 73 Millionen Hektar. Und allen Beteuerungen des Leverkusener Multis zum Trotz, das Tool offen für andere Anbieter von Pestiziden, Saatgut und anderen Input-Gütern zu halten, steigert es ganz im Sinne des Erfinders doch den Absatz der eigenen Hervorbringungen. „Zudem ist der Umsatz mit Produkten des Unternehmens bei den Nutzern von ‚FieldView’ gestiegen“, hält der Global Player zufrieden fest.
WASSER, BODEN & LUFT
BAYERs Treibhaus-Gase
Als klima-schädlicher Stoff steht zumeist das Kohlendioxid im Mittelpunkt der Diskussion, weil BAYER & Co. es in Massen emittieren. Die anderen Treibhaus-Gase sind jedoch auch nicht ohne. In der Summe richten fluorierte Kohlenwasserstoffe, Lachgas, Methan, Kohlenmonoxid und Ruß fast einen genauso großen Schaden an wie CO2, denn die Stoffe haben es in sich. So ist Methan 25-mal so wirksam wie CO2 und Lachgas sogar 125-mal. Und der Leverkusener Multi mischt auch auf diesem Feld kräftig mit. Er stieß im Geschäftsjahr 2020 22.000 Tonnen fluorierte Kohlenwasserstoffe, 8.000 Tonnen Lachgas, 3.000 Tonnen Methan und 1.160 Tonnen Kohlenmonoxid aus.
Methan im Fokus
Die Klima-Politik nimmt neben Kohlendioxid endlich auch andere Treibhaus-Gase (s. o.) in den Fokus. So hat die EU eine Methan-Strategie verabschiedet und gemeinsam mit den USA eine Reduktionsinitiative an den Start gebracht. Die 30 Länder, die sich ihr angeschlossen haben, verpflichten sich, den Ausstoß dieses Gases bis 2030 um 30 Prozent gegenüber dem Jahr 2020 zu senken.
Schmutzige Glyphosat-Produktion
Im US-Bundesstaat Louisiana stößt kaum eine Produktionsstätte mehr chemische Stoffe aus als BAYERs Glyphosat-Fabrik in Luling. 2020 setzte sie nach Angaben der US-amerikanischen Umweltbehörde EPA rund 7.700 Tonnen an Cobalt, Kupfer, Nickel, Ammonium, Methanol, Formaldehyd, Phosphor und anderen Substanzen frei. Aber auch die Anlage in Soda Springs, wo der Leverkusener Multi das Glyphosat-Vorprodukt Phosphor herstellt, ist eine veritable Dreckschleuder. Auf ca. 2.270 Tonnen Cobalt & Co. kommt der Standort.
Keine Grundwasser-Schäden in der Ville?
Die NRW-Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen erkundigten sich nach etwaigen Grundwasser-Verunreinigungen durch Sonderabfall-Deponien (SAD). „Bei Gruben-Deponien kann es zu einem marginalen Eintrag von Grundwasser durch das Dichtungssystem in den Ablagerungsbereich kommen“, räumte die Landesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage ein. Im Falle von Hilgenberg und Ochtrup sei das auch wirklich geschehen, räumt die schwarze-gelbe Koalition ein. Die Sonderabfall-Deponie des Chemie„parks“ Hürth-Knapsack, in dem BAYER ein Pestizid-Werk betreibt, hält ihr zufolge aber dicht: „Grundwasser-Schäden durch die SAD Knapsack sind hier nicht bekannt.“
Altlasten-Standort Leverkusen
Unter dem Pflaster Leverkusens liegt alles andere als der Strand. Der Boden des Stadtgebiets ist großflächig mit industriellen Altlasten kontaminiert. Ein nicht geringer Teil davon dürfte made by BAYER sein. Insgesamt 39 Abfall-Konglomerationen befinden sich unter der Grasnarbe. Bei dreizehn davon haben die Aufsichtsbehörden die Gefährdungsabschätzung abgeschlossen; dreizehn weitere überwachen sie dauerhaft. Bei neun der Hinterlassenschaften haben die ExpertInnen noch keine Maßnahmen festgelegt. Einer Sanierung unterzogen oder bereits saniert sind vier Altlasten. Das ergab eine Kleine Anfrage der NRW-Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen.
Mehr Giftmüll in die Ville
Die Sonderabfall-Deponie des Chemie„parks“ Hürth-Knapsack, in dem BAYER ein Pestizid-Werk unterhält, liegt im ehemaligen Braunkohle-Tagebaugebiet „Vereinigte Ville“. Die giftigen Hinterlassenschaften der Konzerne landen in den verwaisten Braunkohle-Gruben. „Deponien sind schon seit Langem ein fester Bestandteil einer funktionierenden Kreislauf-Wirtschaft. Trotz aller Bemühungen zur Vermeidung, zur Wiederverwendung oder anderweitigen Nutzung von Abfällen bleiben auch zukünftig nennenswerte Anteile an Abfällen übrig, die aufgrund ihres Gehaltes an Schadstoffen gesichert deponiert werden müssen“, so die Betreiber ABFALLENTSORGUNGS- UND VERWERTUNGSGESELLSCHAFT KÖLN, RWE und REMONDIS. Und zwar so nennenswerte Anteile, dass die Deponie an ihre Grenzen stößt. Darum möchten die Eigentümer die Kapazität um 35 Millionen Kubikmeter erweitern und haben ein entsprechendes Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Dabei liegt die „Vereinigte Ville“ in unmittelbarer Nähe eines tektonischen Risses, des „Kierberger Sprungs“. Die NRW-Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen wollte deshalb von der Landesregierung wissen, ob die Erdbeben-Gefahr beim Genehmigungsprozess Berücksichtigung findet. Die schwarz-gelbe Regierungskoalition bejahte das mit dem Verweis auf ein in Auftrag gegebenes hydro-geologisches Standort-Gutachten. „Es ist Grundlage für den Abwägungsprozess im Planfeststellungsverfahren und für Vorgaben im Bescheid“, heißt es in der Antwort auf die Kleine Anfrage.
UNFÄLLE & KATASTROPHEN
Ida legt Glyphosat-Produktion lahm
Der BAYER-Konzern ist nicht nur Klimawandel-Täter mit einem CO2-Ausstoß von 3,58 Millionen Tonnen im letzten Jahr, sondern auch Klimawandel-Opfer. Er leidet selbst unter den zunehmenden Extremwetter-Ereignissen, die der Treibhausgas-Ausstoß verursacht. So legte der Hurrikan Ida Ende August 2021 seine Glyphosat-Produktion am US-amerikanischen Standort Luling lahm. Mehr als sechs Wochen dauerte es, bis der Agro-Riese die Strom-Versorgung wieder sicherstellen und neues Glyphosat herstellen konnte. Da es bereits im Frühjahr Lieferengpässe gab und auch China wegen Energie-Mangels weniger von dem Herbizid fertigte als üblich, zogen die Preise für das umstrittene Mittel kräftig an.
Die Zukunft des Entsorgungszentrums
Am 27. Juli 2021 ereignete sich auf dem Gelände des Leverkusener Chem„parks“ eine Explosion. Der Störfall im Tanklager des Entsorgungszentrums forderte sieben Todesopfer. 31 Menschen trugen zum Teil schwere Verletzungen davon. Anfang November wollten die nordrhein-westfälischen Grünen von der Landesregierung wissen, wie diese sich die Zukunft der Sondermüll-Verbrennungsanlage und der anderen Vorrichtungen auf dem Areal vorstellt, die sich laut CURRENTA momentan im „Winterschlaf“ befinden. „Eine Wiederinbetriebnahme bzw. ein Wiederaufbau der Anlage ist erst nach eindeutiger Klärung des Ereignis-Hergangs und vorbehaltlich eventuell erforderlicher organisatorischer und/oder technischer Änderungen möglich“, erklärten CDU und FDP in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage. Auch „Änderungsbedarfe an dem bestehenden Regelwerk“ schlossen die Parteien nicht aus. Bei einer Anhörung im Leverkusener Stadtrat nannte Dr. Horst Büther von der Bezirksregierung einige konkrete Punkte. Je nach Ergebnis des Sachverständigen-Gutachtens könnten beispielsweise bestimmte Abfall-Gruppen aus der Genehmigung genommen sowie die Überwachung verschärft werden, so Büther. Gleichzeitig drängt die Landesregierung jedoch auf Eile, denn seit der Detonation im Tanklager besteht in Nordrhein-Westfalen ein Entsorgungsnotstand. Einzelne Firmen wie etwa die ehemalige BAYER-Tochter LANXESS waren schon gezwungen, ihre Produktion zu drosseln. „Die aufgrund des Explosions- und Brandereignisses im Chem‚park’ Leverkusen am 22(sic!).07.2021 beschädigte Rückstands- und Abfallverbrennungsanlage der CURRENTA GmbH & Co. OHL muss zeitnah wieder in Stand gesetzt werden“, erklärt Schwarz-Gelb deshalb. Welche Hürden zur Wiederaufnahme des Betriebs zu nehmen sind, hängt von den Plänen des Unternehmens ab, wie Horst Büther im NRW-Umweltausschuss erläuterte. „Soll dieses Tankfeld wieder genauso aufgebaut werden, wie es war, oder sollen Änderungen vorgenommen werden? Und je nachdem, welche Änderungen vorgenommen werden sollen, muss eine entsprechende Änderungsgenehmigung beantragt werden bei uns, bei der Bezirksregierung. Und im Rahmen dieser Änderungsgenehmigung werden wir gucken: Was müssen wir für Anforderungen stellen an die Wiederinbetriebnahme des Betriebes? Wenn tatsächlich 1:1 aufgebaut werden sollte, wären die Anforderungen gering, andererseits sind sie höher“, so Büther. Nach Ansicht der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) muss es ein komplett neues Tanklager geben, weil das alte den Sicherheitsanforderungen nicht entsprach, und ergo auch ein komplett neues Genehmigungsverfahren mit BürgerInnen-Beteiligung.
Kläranlagen bald wetterfester?
Der Starkregen, der Mitte Juli 2021 Deutschland, Holland, Belgien und die Schweiz heimsuchte, hatte katastrophale Folgen. Auch der Chemie„park“ Knapsack, in dem BAYER ein Pestizid-Werk betreibt, spürte die Auswirkungen. Die Abwasser-Behandlungsanlage lief über, was zum „Abfluss erheblicher Mengen Niederschlagswassers sowie Abwassers“ führte. Die Stadt Hürth setzte daraufhin eine Warnmeldung ab, die das „Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe“ aufgriff und weiterverbreitete. „Innerhalb des Stadtgebietes Hürth ist es im Bereich Alt-Hürth und Teilen von Hermülheim zu einem größeren Schadensereignis gekommen. Dabei werden Schadstoffe freigesetzt, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Hautreizungen führen können“, so der Wortlaut. Die „Entfesselungspolitik“ der nordrhein-westfälischen Landesregierung, im Zuge derer sie auch das Landeswasserrecht reformierte, hatte sich als fatal erwiesen. Schwarz-Gelb veränderte bei der Neufassung des Landeswasser-Gesetzes nämlich den Paragrafen, der vorschrieb, neue Abwasser-Anlagen hochwassersicher zu bauen und ältere bis Ende 2021 umzurüsten. Bis 2027 gaben die Parteien den Betreibern nun Zeit – zu lange, wie sich im Juli zeigte. Jetzt aber erkennt die Landesregierung Handelsbedarf. Sie plant, „weitergehende Regelungen – zum Hochwasserschutz bei Abwasser-Anlagen auf der Basis von einzuführenden, allgemein anerkannten Regeln der Technik – zu erlassen“, wie es in ihrer Antwort auf eine entsprechende Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen hieß. Zudem gelte es, „einzelfall-bezogen zu prüfen, inwieweit weitergehende Rückhalte-Maßnahmen für künftige Starkregen-Ereignisse erforderlich und umzusetzen sind“, so CDU und FDP.
STANDORTE & PRODUKTION
Der Berkeley-Deal
Anfang der 1990er Jahre plante BAYER eine große Erweiterung seines Pharma-Werks in Berkeley. Dagegen erhob sich allerdings ein breiter Protest. Die CITIZENS OPPOSING POLLUTED ENVIRONMENT fürchteten sich vor allem vor den Risiken und Nebenwirkungen der Gentechnik. Aber auch die Produktion von Impfstoffen gegen die Pest und andere Erreger für das Pentagon stieß auf Kritik, weil es dabei zu einer Infektion von mehreren Beschäftigten kam. Der Leverkusener Multi startete eine große Öffentlichkeitskampagne, die vor allem auf die vielen in Aussicht stehenden neuen Arbeitsplätze verwies, und hatte damit schließlich Erfolg. Allerdings musste er sich auf ein Development Agreement mit der Stadt einlassen und Geld für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stellen. Nun will der Konzern, der sich mittlerweile zum größten Unternehmen Berkeleys entwickelt hat, weiter wachsen und Produktionsstätten bis zu einer Höhe von 24 Metern errichten. Und abermals macht sich unter den Anwohner-Innen Skepsis breit. Deshalb steht auch ein neues Development Agreement an. In den nächsten 30 Jahren beabsichtigt der Global Player dafür 30 Millionen Dollar bereitzustellen. 60 Prozent des Etats sieht er dabei für Bildungsprogramme vor, bei denen – als ein nicht ganz unbeabsichtigter Nebeneffekt – auch wissenschaftlicher Nachwuchs für seine Labore abfällt. 20 Prozent des Geldes sollen der lokalen Wirtschaft zugutekommen, und weitere 20 Prozent fließen in ein kommunales Wohnungsprogramm. Auch für Sozialarbeit bleibt ein bisschen was übrig. Das alles reicht dem Bürgermeister Jesse Arreguin allerdings nicht. „Ich glaube, sie können mehr tun“, sagt er. Konzern-Sprecherin Cathy Keck schaltete jedoch auf stur und brachte flugs andere Standorte ins Spiel, die ihr als Interessenten für „BAYERs globale Infrastruktur-Dollars“ einfielen. Aber nach zähen Verhandlungen einigten sich beide Parteien schließlich doch. Der Agro-Riese stimmte zu, bis zum Jahr 2052 33 Millionen Dollar zu zahlen.
IMPERIUM & WELTMARKT
Deal mit MICROSOFT
Die digitale Landwirtschaft sammelt mit Hilfe von Drohnen, Sensoren und Satelliten-Bildern Informationen über das Wetter, die Bodenbeschaffenheit, Pflanzenkrankheiten und Schadinsekten. BAYER hat dazu die Plattform „FieldView“ im Angebot und preist sie den FarmerInnen mit einigem Erfolg als probates Mittel an. Auf 73 Millionen Hektar kommt dieses Erzeugnis der Digital-Tochter CLIMATE CORPORATION bereits zum Einsatz. Dem Konzern reicht das jedoch noch nicht. Ihm zufolge „besteht weiterhin großer Bedarf an Lösungen, um die gesamte Wertschöpfungskette für Nahrungs- und Futtermittel sowie Kraftstoffe und Textilfasern zu optimieren“. Deshalb hat das Unternehmen im November 2021 eine umfassende Kooperation mit MICROSOFT vereinbart. „BAYER und MICROSOFT schließen strategische Partnerschaft, um die Digitalisierung der Wertschöpfungskette für Lebensmittel voranzubringen“ ist die entsprechende Pressemitteilung überschrieben. „Die Partnerschaft basiert auf einer langjährigen Geschäftsbeziehung zwischen BAYER und MICROSOFT und dem gemeinsamen Engagement für Datenschutz, Cybersicherheit und Kundenvertrauen“, heißt es weiter. Der Global Player will jetzt sein „FieldView“-Tool in die neue Infrastruktur überführen und gemeinsam mit der US-Firma „die erforderlichen Data-Science-Kapazitäten“ entwickeln. Die fertige Plattform soll dann auch anderen – „von Start-ups bis zu globalen Konzernen“ – zur Verfügung stehen. Wie die bisherigen Erfahrungen mit AMAZON, APPLE, FACEBOOK & Co. zeigen, präferieren diese digitalen Instrumente aber stets die Gründer und monopolisieren die Märkte. Auch der BAYER-Konzern nutzt diese in seinem Sinne (s. Bits & Bytes). Zudem ist eine neue Daten-Krake das letzte, was die Welternährung braucht. Darum fordert die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) die EU auf, im Rahmen des geplanten Gesetzes für digitale Märkte auch dem Landwirtschaftsbereich strenge Auflagen zu machen und ein umfassendes Kontrollsystem zu etablieren.
In Treue fest zu MONSANTO
Mehrere Finanz-AnalystInnen und InvestorInnen forderten BAYER zur Rückabwicklung des MONSANTO-Kaufs auf. Aber Konzern-Chef Werner Baumann antwortete auf die Frage des Wirtschaftsmagazins Capital, ob das für ihn eine Option sei: „Natürlich nicht“. Der Große Vorsitzende steht nach wie vor in Treue fest zu dem von ihm eingefädelten Deal. „Kein Unternehmen kann einen so großen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft leisten“, fabulierte Baumann.
Verkauf von SCHERING DO BRASIL
Während der BAYER-Konzern seine Anstrengungen verstärkt, die Armutsregionen mit seinem Langzeit-Verhütungsmittel MIRENA zu beglücken (siehe NORD & SÜD), stößt er seine Tochter-Gesellschaft SCHERING DO BRASIL ab, die Kontrazeptiva und Hormon-Präparate wie MICROVLAR, MIRANOVA, NEOVLAR, FEMIANE, CLIMENE, PRIMOLUT NOR vor allem für den lateinamerikanischen Markt hergestellt. Der Leverkusener Multi verkaufte die Niederlassung für 112 Millionen Dollar an die GRUPO UNIÃO QUÍMICA. Einzelne Produkte verbleiben jedoch noch bis zu fünf Jahren im Sortiment des Global Players.
ÖKONOMIE & PROFIT
Der „CURRENTA-Moment“
Im Jahr 2019 haben BAYER und LANXESS ihre Beteiligungen an dem Chemie„park“-Betreiber CURRENTA an die australische Investmentbank MACQUARIE veräußert, genauer: an MIRA, den Infrastruktur-Fonds des Geldhauses. Der Leverkusener Multi drängte zum Verkauf. Er brauchte wegen der Millionen-Klagen in Sachen „Glyphosat“ Geld. LANXESS hingegen zögerte. Das Unternehmen hatte mehr Werke auf dem CURRENTA-Areal als der Agro-Riese und traute MACQUARIE das Management inklusive der sachkundigen Weiterentwicklung der Infrastruktur der „Parks“ nicht so recht zu. Aber schließlich stimmten beide Partner dem Deal zu, denn das Geld lockte. 3,5 Milliarden Euro zahlten die Australier – das Zwölffache des CURRENTA-Jahresgewinns. Dies ließ die Branche aufhorchen. Von einem „CURRENTA-Moment“ sprechen BeobachterInnen. Und den erhofft sich nun auch das Unternehmen INTRASERV HÖCHST, das einen – unter anderem mit einem Pestizid-Werk von BAYER bestückten – Chemie-Komplex in Frankfurt unterhält. Nachdem Gespräche über einen Verkauf vor rund 20 Jahren an Zweifeln ob der Kompetenz möglicher Investoren scheiterten, unternimmt INTRASERV nun einen neuen Anlauf. Zu den Interessenten soll der FAZ zufolge auch MACQUARIE gehört haben. „Ein Kenner der Materie wies allerdings darauf hin, dass die Gesellschaft noch mit dem schweren Unfall in Leverkusen zu kämpfen hat“, so die Zeitung (siehe auch UNFÄLLE & KATASTROPHEN). Solche Unwägbarkeiten waren es auch, welche die Verhandlungen von DOW mit MACQUARIE und zwei anderen Bietern platzen ließen. „Unklarheit über Haftungsfragen bei Umweltschäden“ nennt das Blatt als Grund.
RECHT & UNBILLIG
Explosion: drei Tatverdächtige
Am 27. Juli 2021 ereignete sich auf dem Gelände des Leverkusener Chem„parks“ eine Explosion (siehe SWB 4/21). Der Störfall im Tanklager des Entsorgungszentrums forderte sieben Todesopfer. 31 Menschen trugen zum Teil schwere Verletzungen davon. Abermals zeigte die Katastrophe die lebensgefährlichen Risiken einer dem Profit-Prinzip folgenden Wirtschaftsweise auf. Die bürgerliche Justiz aber muss Schuld individualisieren. Bereits am ersten Tag nach der Detonation leitete die Staatsanwaltschaft Köln Ermittlungen gegen unbekannt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und auf fahrlässige Herbeiführung einer Sprengstoff-Explosion ein. Im Oktober 2021 gab sie dann bekannt, sich dabei konkret auf drei Personen zu fokussieren. Verletzung der Sorgfaltspflichten lautet der Vorwurf. Die Staatsanwaltschaft legt den Beschäftigten zur Last, eine Chemikalie über der zulässigen Temperatur gelagert zu haben, was zu einem Druckanstieg und schließlich zur Explosion führte. Zur Beweissicherung nahmen die Behörden bei den Beschuldigten sowie bei der CURRENTA Hausdurchsuchungen vor und stellten Datenträger, Handys und Dokumente sicher. Mit diesem Vorgehen bricht die Staatsanwaltschaft Organisationsversagen auf menschliches Versagen herunter. Es war aber eine komplexe Gemengelage, die den großen Knall und ein solches Ausmaß an Folgen überhaupt erst möglich gemacht hat. Zum einen handelt sich um ein uraltes, noch von BAYER errichtetes Entsorgungszentrum mit Tanks, die so dicht nebeneinander standen, dass am 27. Juli ein Domino-Effekt eintrat. Zudem verlief über das Gelände eine Starkstrom-Leitung, die zerbarst und erst umständlich vom Netz genommen und geerdet werden musste, was die Lösch-Arbeiten verzögerte. Überdies hat die CURRENTA die Müll-Entsorgung als rendite-orientierten Geschäftszweig betrieben und Abfall aus aller Herren Länder akquiriert – aus Dänemark stammte derjenige, der bei der Detonation hochgegangen ist. Darüber hinaus müssten die Betriebsabläufe mit einer systematischen Risiko- und Gefahrenanalyse eigentlich so durchformalisiert sein, dass ein persönliches Fehlverhalten ohne gravierende Folgen bleibt. Auch haben die Behörden die Anlagen-Überwachung nicht ernst genommen. So schauten KontrolleurInnen der Bezirksregierung zuletzt im Jahr 2018 mal im Chem„park“ vorbei. Und die Politik beugte sich immer wieder dem Druck der Konzerne und unterließ es, strengere Sicherheitsregelungen einzuführen. Über all dies müsste zu Gericht gesessen werden, dafür fehlen aber die Instrumente. Darum fordert die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN bereits seit Jahren die Einführung eines Unternehmensstrafrechts.
BAYER gewinnt Glyphosat-Prozess
Der Leverkusener Multi hat vor einem US-amerikanischen Gericht einen Schadensersatz-Prozess in Sachen „Glyphosat“ gewonnen. Der „Superior Court of the State of California“ in Los Angeles wies am 5. Oktober 2021 die Klage von Destiny Clark ab, die das Herbizid der jetzigen BAYER-Tochter MONSANTO für die Lungenkrebs-Erkrankung ihres 10-jährigen Sohnes Ezra verantwortlich gemacht hatte. Obwohl die Clarks die Agro-Chemikalie über Jahre hinweg in ihrem Garten versprüht hatten, konnten die Geschworenen keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Ausbringung und Ezras „Non-Hodgkin-Lymphom“-Diagnose im Alter von vier Jahren erkennen. Zuvor musste der Konzern in drei Verfahren Niederlagen einstecken. Ein viertes verlor er freiwillig, um die Möglichkeit zu haben, in einer höheren Instanz ein Grundsatz-Urteil zu erwirken. Mit ausschlaggebend für das Votum des Superior Courts dürfte gewesen sein, dass interne Firmen-Unterlagen über manipulierte Studien, die Beeinflussung von Zulassungsbehörden und MONSANTO-eigene Erkenntnisse zu den Gesundheitsgefahren des Mittels nicht zur Beweisfindung zugelassen waren. Ob die Familie den Richter-Spruch anfechten will, steht zurzeit noch nicht fest. Sofort nach Bekanntgabe der Entscheidung stieg der Aktien-Kurs des Global Players kurzzeitig um bis zu 2,7 Prozent. Der Finanzmarkt erachtete den Freispruch offensichtlich als gutes Omen für die künftigen juristischen Auseinandersetzungen und sah die Position des Unternehmens in den noch ausstehenden Vergleichsverhandlungen gestärkt. BAYER zeigte sich ebenfalls hocherfreut. „Das Urteil der Geschworenen zur Frage der Kausalität zu unseren Gunsten beendet das Gerichtsverfahren und entspricht sowohl der Einschätzung der zuständigen Regulierungsbehörden weltweit als auch den umfangreichen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus vier Jahrzehnten“, ließ die Aktien-Gesellschaft wider besseren Wissens verlauten. Einige Staaten haben Glyphosat nämlich bereits verboten, und selbst die vom Agro-Riesen immer wieder als Kronzeugin für die gesundheitliche Unbedenklichkeit des Mittels angeführte US-Umweltbehörde EPA beurteilte das Pestizid in internen Expertisen als krebserregend (siehe POLITIK & EINFLUSS).
BAYER gewinnt Glyphosat-Prozess
Der BAYER-Konzern hat im Dezember 2021 einen weiteren Schadensersatz-Prozess in Sachen „Glyphosat“ gewonnen. Ein Gericht im US-amerikanischen San Bernadino wies die Klage der 71-jährigen Donnetta Stephens ab, die das Mittel über 30 Jahre lang verwendete und für ihr Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) – eine spezielle Art des Lymphdrüsen-Krebses – verantwortlich machte. Damit verlor der Rechtsanwalt Fletch Trammel, der rund 4.000 Glyphosat-Geschädigte vertritt, nach dem Fall „Clark“ (s. o.) schon seinen zweiten Prozess gegen den Leverkusener Multi. Er kündigte jedoch an, in Berufung zu gehen.
BAYER verliert Glyphosat-Prozess
Die Glyphosat-Geschädigten Alberta und Alva Pilliod haben den Prozess gegen die BAYER-Tochter MONSANTO endgültig gewonnen. Am 17. November 2021 wies der „California Supreme Court“ den Einspruch des Leverkusener Multis gegen das Urteil des Berufungsgerichts ab. Der „Court of Appeal“ hatte den Anspruch der beiden RentnerInnen auf Schadensersatz am 9. August für berechtigt erklärt und dem Unternehmen „eine rücksichtslose Missachtung der Gesundheit und Sicherheit der vielen ahnungslosen Verbraucher“ attestiert (Ticker 4/21). Auch der neuen Strategie des Konzerns, die Justiz der Einzelstaaten in Sachen „Glyphosat“ für unzuständig zu erklären, weil es sich um eine vor den Obersten Gerichtshof gehörende Bundesangelegenheit handele, erteilte der Court damals eine Abfuhr. Der Global Player muss den Pilliods nun 86,7 Millionen Dollar an Strafe und Schmerzensgeld zahlen. Sie hatten auf ihren Grundstücken über 30 Jahre lang das unter dem Produktnamen ROUNDUP vermarktete Glyphosat genutzt. 2011 erkrankte Alva am Non-Hodgkin-Lymphom (NHL), einer speziellen Art des Lymphdrüsen-Krebses, 2015 seine Frau. Zwei Jahre später reichte das Ehepaar Klage ein. Erstinstanzlich bekam es 2019 zwei Milliarden Dollar zugesprochen. Später reduzierte der „Alameda County Superior Court“ die Summe auf die jetzt letztinstanzlich bestätigten 86,7 Millionen Dollar. Aber trotz der juristischen Schlappe lässt der Agro-Riese immer noch nichts auf das Pestizid kommen. „Wir stehen weiterhin fest hinter der Sicherheit von ROUNDUP, eine Position, die sowohl von den Regulierungsexperten weltweit als auch von dem überwältigenden Gewicht von vier Dekaden umfangreicher Forschung gestützt wird“, erklärte die Aktien-Gesellschaft nach der Entscheidung.
Glyphosat: Vergleich und Verzicht
125.000 KlägerInnen haben die Risiken und Nebenwirkungen des Pestizids Glyphosat, das die jetzige BAYER-Tochter MONSANTO unter dem Namen ROUNDUP vermarktet, in den USA auf den Plan gerufen. Diese machen das Ackergift für ihr Non-Hodgkin-Lymphom, eine spezielle Art des Lymphdrüsen-Krebses, verantwortlich. Mit Kanzleien, die 98.000 der Betroffenen vertreten und zu den größten der Branche zählen, hat der Leverkusener Multi sich mittlerweile auf Entschädigungen verständigt (Stand 22. Oktober 2021). Im Rahmen dieser Vereinbarungen verpflichteten die Rechtsanwaltsbüros sich auch, keine neuen Fälle mehr anzunehmen. Die Rechtsfirma, welche die Interessen von Alberta und Alva Pilliod wahrnahm (s. o.), zählt ebenfalls dazu. In der Presseveröffentlichung, die den Sieg des Ehepaars in Sachen „Glyphosat“ verkündete, hieß es deshalb: „BAUM HEDLUND ARISTEI & GOLDMAN nimmt keine ROUNDUP-Fälle mehr an. Nichts in dieser Mitteilung zielt darauf ab, weitere Rechtsstreitigkeiten gegen MONSANTO zu fördern oder zu unterstützen im Zusammenhang mit ROUNDUP und dem Non-Hodgkin-Lymphom.“ Neuerkrankte haben es deshalb inzwischen schwer, juristischen Beistand zu finden.
Mexiko: Glyphosat-Bann bleibt
Im Jahr 2020 hatte die mexikanische Regierung Glyphosat verboten, was auf massiven Druck von Landwirtschaftsorganisationen, Umwelt- und VerbraucherschützerInnen zurückging. Der BAYER-Konzern leitete gemeinsam mit anderen Unternehmen gerichtliche Schritte ein, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Im Oktober 2021 lehnte der Supreme Court des Landes die Klagen der Konzerne endgültig ab.
BAYER verliert zweiten PCB-Prozess
Polychlorierte Biphenyle (PCB) gehören zu den giftigsten Hervorbringungen der Chlorchemie. Die vor allem von BAYER und MONSANTO in Umlauf gebrachten gefährlichen „Alleskönner“ kamen bis zu ihrem vollständigen Verbot 1989 in Elektrogeräten, Fugendichtungsmassen, Farben, Ölen, Lacken und Bodenbelägen zum Einsatz – und stellen immer noch ein beträchtliches Gesundheits- und Umweltrisiko dar. Darum ist der Konzern mit einer Vielzahl von Schadensersatz-Ansprüchen konfrontiert. Im Juli 2021 gab ein Gericht in Seattle drei LehrerInnen des Sky Valley Education Centers in Monroe recht, die ihre Leiden auf das PCB-kontaminierte Schulgebäude zurückführten. „So viele Schüler und Lehrer mussten Sky Valley verlassen, weil sie einfach zu krank wurden“, sagte etwa Michelle Leahy, eine der PädagogInnen. Strafe und Schmerzensgeld in Höhe von insgesamt 185 Millionen Dollar kostete das den Leverkusener Multi. Im November 2021 verlor er auch den zweiten Prozess in dieser Sache. Dieses Mal sprachen die RichterInnen den Betroffenen 62 Millionen Dollar zu. Der Agro-Riese legte – wie schon nach dem ersten Urteil – Berufung ein. Er hält das von seiner jetzigen Tochter-Firma MONSANTO stammende PCB nicht für den Auslöser von Krebs, Hormonstörungen oder neurologischen Erkrankungen. Nach der Entscheidung vom Juli hatte BAYER erklärt: „Die Beweislage in diesem Fall stützt nicht die Schlussfolgerung, dass die Kläger im Sky Valley Education Center gefährlichen PCB-Werten ausgesetzt waren oder dass eine Exposition ihre Gesundheitsstörungen hervorgerufen haben könnte“. Nur „extrem niedrige PCB-Werte“ seien in der Schule gemessen worden, so der Global Player. Ob er damit die Gerichte in den weiteren Verfahren – allein von Betroffenen aus dem Sky Valley Education Center liegen noch rund 200 Klagen vor – überzeugen kann, ist zu bezweifeln.
BAYER verklagt DR. REDDY’S
Routinemäßig geht der Leverkusener Multi rechtlich gegen Unternehmen vor, die sich anschicken, nach Ablauf der Patentlaufzeit seiner Medikamente Nachahmer-Versionen von diesen herauszubringen. Damit verfolgt der der Pharma-Riese die Absicht, das Inverkehrbringen der Generika zu verzögern, damit er noch möglichst lange Monopol-Profite einstreichen kann. In Sachen „NEXAVAR“ – ein zusammen mit ONYX PHARMACEUTICALS entwickeltes Krebsmittel, das pro Tablette rund 180 Dollar kostet – führte BAYER schon unzählige Prozesse. Die jüngste Klage reichte der Global Player gegen die indische Gesellschaft DR. REDDY’S ein, die in den USA eine Zulassung für das Präparat beantragte. Zuvor hatte es MYLAN und NATCO PHARMA getroffen.
BAYER verklagt APOTEX
Das Unternehmen MEDA erhielt 2009 von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für das Allergie-Spray ASTEPRO ALLERGY. Der BAYER-Konzern erwarb später die Lizenz zum Vertrieb des Präparats, dessen Patent im Jahr 2028 ausläuft. Ab Juni 2021 konnte er dann die Ausweitung der Vermarktungszone betreiben: Die FDA hob die Rezeptpflicht auf. Nun aber droht Konkurrenz. APOTEX stellte den Antrag auf Genehmigung einer Nachahmer-Version des ohne Steroide auskommenden Mittels und begründete das mit zu Unrecht erteilten Schutzrechten. Dagegen schreiten BAYER und MEDA jedoch ein. Sie verklagten APOTEX umgehend.