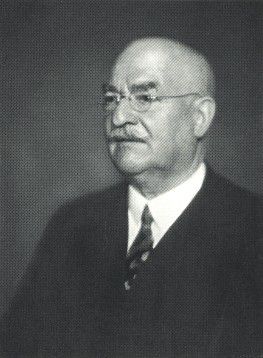Veröffentliche Beiträge von “CBG Redaktion”
Presse Information vom 12. Dezember 2014
Ausgliederung von BAYER MaterialScience:
Belegschaft in Antwerpen fordert Gleichbehandlung
Die Belegschaft von BAYER MaterialScience im belgischen Antwerpen fordert eine Gleichstellung mit den deutschen Beschäftigten. Die von der Gewerkschaft ausgehandelte Arbeitsplatz-Garantie bis 2020 gilt bislang nur für die deutschen Mitarbeiter/innen. Deswegen beteiligen sich die Antwerpener Mitarbeiter an den landesweiten Streiks am 15. Dezember.
Fotos von Streikposten am BAYER-Werk Antwerpen am 15. Dez.
Die im Oktober beschlossene Ausgliederung der Kunststoff-Sparte BAYER MaterialScience (BMS) droht zu Lasten der ausländischen Beschäftigten zu gehen. Die von der IG BCE ausgehandelte fünfjährige Arbeitsplatzgarantie gilt bislang nur für die deutschen Standorte.
In Antwerpen, einem der größten ausländischen BMS-Standorte, wurden die jüngsten Verhandlungen ohne Ergebnis abgebrochen. Levi Sollie, Vertrauensmann der Gewerkschaft Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV): „Wir fordern eine Jobgarantie, so wie sie die deutsche Belegschaft erhalten hat. In den zwölfstündigen Gesprächen mit der Werksleitung wurde uns jedoch kein ernsthaftes Angebot unterbreitet. Zwar wollte BAYER einen Bestand der Arbeitsplätze bis 2020 zusichern, allerdings hätte die Vereinbarung einen ´Solidarbeitrag der Belegschaft` beinhalten sollen. Auch hätte die Vereinbarung nicht für die Mitarbeiter der Verwaltung – immerhin 200 der 840 Mitarbeiter – gegolten.“ Die Belegschaft wird sich daher an dem landesweiten Streik am Montag beteiligen.
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) befürchtet eine Parzellierung von BAYER MaterialScience, die Vernichtung von Arbeitsplätzen und eine Absenkung der Löhne - so wie bei der Ausgliederungen der Chemie-Sparte Lanxess geschehen. Die CBG fordert den BAYER-Vorstand auf, die Kunststoffsparte nur an einen Investor zu verkaufen, der den Bestand der Arbeitsplätze weltweit garantiert.
Material Science hatte stets in der Gewinnzone gelegen, dennoch forderten Investoren seit Jahren eine Abspaltung. Um die Kunststoff-Sparte im Unternehmen zu halten, waren der Belegschaft in den vergangenen Jahren zahlreiche Zugeständnisse abverlangt worden. So hatte BAYER mittels mehrerer „Effizienz-Programme“ über 2.000 Arbeitsplätze vernichtet, Werke geschlossen und Bonus-Zahlungen gestrichen.
Levi Sollie abschließend: „BAYER hat die Verantwortung, unsere Löhne und Arbeitsbedingungen für die kommenden Jahre zu garantieren. Im März 2015 wird das Antwerpener BAYER-Werk seinen 50. Geburtstag begehen - den meisten Arbeitern ist aber nicht nach Feiern zu Mute.“
Presse Info vom 12. Dezember 2014
Indien: Supreme Court weist Patentklage von BAYER ab
Urteil macht Weg für bezahlbare Medikamente frei / weltweite Signalwirkung / Indien „Apotheke der Armen“
Die Firma BAYER hat im Patentstreit um das Krebsmittels Nexavar eine letztinstanzliche Niederlage erlitten. Der Oberste Gerichtshof in Delhi bestätigte die Entscheidungen der Vorinstanzen und ließ eine Zwangslizenz für den Generikahersteller Natco Pharma in Kraft. BAYER hatte das Präparat zum Vielfachen eines indischen Jahreslohns angeboten und dadurch rund 98% der Betroffenen von einer Behandlung ausgeschlossen.
Philipp Mimkes von der Coordination gegen BAYER-Gefahren begrüßt das Urteil: „Große Pharmahersteller können mit Hilfe von Patenten wahre Mondpreise verlangen. Die öffentliche Gesundheitsvorsorge muss jedoch Vorrang haben gegenüber monopolistischen Profiten der Produzenten. Denn für Patienten in armen Ländern sind Patente oftmals eine Frage von Leben und Tod.“
Bis in die 70er Jahre hatten auch westliche Länder Patente auf Medikamente nur teilweise akzeptiert, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu sichern. „Da Indien der weltweit wichtigste Lieferant für günstige Pharmazeutika ist, hätte ein Erfolg von BAYER schwerwiegende Folgen für die Gesundheitsversorgung in ärmeren Ländern gehabt. Die Rechtfertigung der Industrie, nur mit hohen Einnahmen ließe sich die Entwicklung neuer Präparate finanzieren, geht dabei an der Realität vorbei: Mehr als doppelt so viel wie für die Forschung geben BAYER und Co. für Werbung und Marketing aus“, so Mimkes weiter.
Einen seltenen – und verstörenden - Einblick in die Denkweise der Pharmaindustrie hatte Marijn Dekkers, Vorstandsvorsitzender von BAYER, auf einer Podiumsdiskussion im Dezember 2013 gewährt: „Wir haben dieses Medikament nicht für den indischen Markt entwickelt, um ehrlich zu sein. Wir haben es für Patienten im Westen entwickelt, die es sich leisten können“. Natco Pharma verkauft das Medikament in Indien nun zu einem um 97 Prozent niedrigeren Preis. Natco zahlt dafür eine Lizenzgebühr in Höhe von sechs Prozent der Verkaufserlöse an BAYER.
Gesundheitsinitiativen aus Indien und Deutschland, darunter Health Action International, das indische Peoples Health Movement, Ärzte ohne Grenzen, die Coordination gegen BAYER-Gefahren, die BUKO Pharma-Kampagne, der Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte und medico international, hatten BAYER wiederholt aufgefordert, die Klage zurückzuziehen. Vertreter der Initiativen hatten auch mehrfach Gegenanträge zur BAYER-Hauptversammlung eingereicht.
ausführliche Informationen zur Kampagne
11. Dezember 2014
BAYER: Glühwein für Mitarbeiter im Bundestag
CBG kritisiert Lobbyismus / Flugblätter verteilt
Heute organisierte BAYER für die MitarbeiterInnen der Abgeordneten im Bundestag einen Weihnachtsempfang mit Live-Musik. Unterstützer der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) nutzten den Termin, um ein Flugblatt zum Lobbyismus des Konzerns bezüglich des Freihandelsabkommens TTIP zu verteilen. BAYER will mit Hilfe von TTIP die Grenzwerte für Pestizide und gentechnisch manipuliertes Saatgut aufweichen.
Allein in Berlin treiben rund 5.000 Lobbyisten ihr Unwesen. Kein Wunder, dass bei Klimaschutz, Massentierhaltung oder Bankenregulierung fast ausschließlich die Interessen der Industrie berücksichtigt werden.
In der Veranstaltung selbst fiel kein einziger kritischer Satz, nicht einmal zur Firmengeschichte. Auf die Frage der CBG-Unterstützer, wo denn das Geld für das kulturelle Engagement herkomme - dieses ginge wohl auf Kosten von Natur und Gesellschaft, zum Beispiel indem sich der Konzern für TTIP oder lasche Pestizidstandards einsetze – ging der Referent nicht ein. Heute solle es nur um die Kultur gehen…
[gallery]11. Dezember 2014, Informationsdienst Gentechnik
Gentechnik-Raps von Bayer in der Schweiz entdeckt
Dass in der Schweiz Gentechnik-Raps wächst, der beim Transport verloren gegangen ist, ist schon länger bekannt. Nun wurden die Fundorte erneut untersucht: dabei wurde nicht nur festgestellt, dass sich der Monsanto-Raps GT73 weiter ausbreitet. Erstmals, so die Experten, sei auch in Kanada und den USA angebauter Raps des Bayer-Konzerns entdeckt worden.
Neben GT73, der bereits 2011 auf dem Gelände des Rheinhafens in Basel gefunden worden war, nun aber auch an einem weiteren Ort festgestellt wurde, haben die Mitarbeiter des Biosicherheitslabors des Kantons Basel-Stadt verwilderte Gentechnik-Rapspflanzen der Linien MS8, RF3 und der Kombination MS8xRF3 ausgemacht. Diese stammen von Bayer Cropscience, das Saatgut wird unter dem Namen „InVigor“ auf dem nordamerikanischen Markt verkauft. Mittels Gentechnik wurden sie immun gegen das Spritzmittel Glufosinat („Liberty“) gemacht, das in der EU wegen Gesundheitsrisiken nur noch sehr eingeschränkt genutzt werden darf.
Die Experten nahmen letztes Jahr mehrere Proben und untersuchten diese im Labor auf Merkmale der gentechnischen Veränderungen. Die Ergebnisse veröffentlichten sie im Fachjournal Plos One. Zwar gebe es keine Hinweise darauf, dass das künstlich eingebrachte Genmaterial auf natürliche Verwandte wie die Wilde Rauke übergesprungen ist. Bei zwei nicht-genmodifizierten Rapspflanzen sei das aber passiert – ihre Samen enthielten die spezifischen Gen-Sequenzen des Monsanto-Rapses GT73.
In der Schweiz wurde bislang kein Gentechnik-Raps angebaut oder im Land verarbeitet. Die Rohware aus Übersee wird jedoch am Rhein von Schiffen auf Güterzüge oder LKW umgeladen – dabei können Samenkörner verloren gehen, insbesondere beim besonders leichten Raps. Das aber nicht nur beim Import von Raps, der anschließend in andere europäische Länder transportiert wird. Die Mitarbeiter des Biosicherheitslabors halten es für „wahrscheinlich“, dass der Gentech-Raps über Weizenlieferungen eingeschleppt wurde. Denn die Schweiz habe zwischen 2010 und 2012 fast 250.000 Tonnen Getreide aus Kanada bezogen. Auf den dortigen Äckern folge Weizen häufig auf Raps – und Raps ist in Kanada fast immer gentechnisch verändert. Übrig gebliebene Rapspflanzen können dann die Weizenernte kontaminieren. Diese Annahme müsse aber noch bestätigt werden, heißt es.
Presse Info vom 9. Dezember
Duisbergweg in Lüdenscheid wird umbenannt
ehem. BAYER-Chef für Zwangsarbeit und Giftgas verantwortlich
Die Stadt Lüdenscheid hat beschlossen, eine nach dem ehemaligen BAYER-Generaldirektor Carl Duisberg benannte Straße umzubenennen. In der gestrigen Sitzung des Stadtrats stimmten alle Fraktionen einem entsprechenden Antrag zu (die einzige Gegenstimme kam vom Vertreter der NPD). Erst vor zwei Wochen war in Dortmund die Umbenennung der dortigen Carl-Duisberg-Straße beschlossen worden.
Das Lüdenscheider Stadtarchiv hatte zur Sitzung einen Bericht zum Leben Duisbergs vorgelegt. Hierin heißt es unter anderem:
=> Während des Ersten Weltkriegs wurde unter Duisbergs Vorsitz bei Bayer Giftgas für den Kriegseinsatz produziert. Abfallprodukte der Chemischen Industrie, die mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten kämpfte, dienten als Rohstoffe. In Leverkusen war das u. a. Phosgen, ein Gas, das besonders grausam wirkt.
=> Duisberg gehörte zu den führenden deutschen Industriellen, die während des Krieges die gewaltsame Deportation belgischer Zivilisten zur Zwangsarbeit nach Deutschland durchsetzten. Dieses Vorgehen stellte auch nach damaliger Rechtsauffassung eindeutig einen Bruch des Kriegs- und Völkerrechtes dar
=> Duisberg hatte beste Kontakte zur OHL und war maßgeblich an der Ausarbeitung des sogenannten „Hindenburg-Programms“ beteiligt, dem Wirtschafts- und Rüstungsprogramm der Dritten OHL von 1916, das die Fokussierung der gesamten Wirtschaft auf die Rüstungsproduktion vorsah.
=> Die Einführung der 8h-Schicht für die Arbeiter der Bayer AG und die Einführung von Sozialversorgungssystemen (zunächst v.a. für die Verwaltungsmitarbeiter und Ingenieure der Firma), die ebenfalls als Verdienste angeführt werden, hatten jedoch weniger mit Duisbergs Wohlwollen gegenüber seinen Angestellten und Arbeitern zu tun, als vielmehr mit seinem Bestreben, den Einfluss der Gewerkschaften zu eliminieren, die er Zeit seines Lebens rigoros ablehnte.
=> Seine grundsätzlich positive Haltung zur Politik der Nationalsozialisten – spätestens seit Übernahme der Macht durch diese – wird deutlich aus einem Brief an den Kölner OB Dr. Günter Riesen vom 16.10.1933, zwei Jahre vor seinem Tod:
„Zeit meines Lebens habe ich dem Führerprinzip gehuldigt und mich stets zu dem Grundsatz bekannt ‚Geführt muss werden’ und so hoffe und wünsche ich, dass unter der zielbewussten Führung unserer bewährten Kämpen Hindenburg und Hitler unsereneue Regierung innen- und außenpolitisch von Erfolg zu Erfolg schreitet und es ihr … glücken möge, durch straffe und unentwegte Schulung unseres Nachwuchses die Kräfte heranzuziehen und auszusondern, die durch Höchstleistungen (…) unter Beweis stellen, dass sie ein Anrecht auf Führerschaft besitzen. Nur auf diesem Wege wird unser geliebtes Vaterland den ihm gebührenden Platz an der Sonne unter den Nationen wieder erlangen und die unserem Volke durch Verleumdung und Lüge genommene Achtung unter den Kulturvölkern wieder erzwingen.
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren fordert, die noch verbleibenden Carl-Duisberg-Straßen, unter anderem in Frankfurt, Bonn, Krefeld, Leverkusen und Dormagen, sowie das Wuppertaler Duisberg-Gymnasium nun umzubenennen.
=> Die vollständige Stellungnahme des Stadtarchivs
4. Dezember 2014, Meinerzhagener Zeitung
Der „Duisbergweg“ soll aus dem Stadtbild verschwinden
Lüdenscheid - Der Straßenname „Duisbergweg“ soll aus dem Stadtbild verschwinden. Die politische Mehrheit dafür ist vorhanden. Am Montag steht das Thema auf der Tagesordnung des Rats (17 Uhr, Ratssaal).
Die Initiative geht zurück auf eine Antrag der Alternative für Lüdenscheid. Die Ampel-Mehrheit im Rat aus SPD, Grünen und FDP trage die Überlegung mit, sagte gestern für die SPD Fraktionschef Jens Voß nach Abstimmung auch mit den Ampelpartnern.
Für die Neubenennung der Straße zwischen Liebig- und Humboldtstraße sollten die Anwohner gebeten werden, entsprechende Vorschläge zu machen. Ein solchen Auftrag werde die SPD an die Verwaltung geben. „Bei einem solchen Verfahren sollte man die Anwohner einbeziehen“, so Voß. Im vorderen Teil der Straße liegen Eigentumswohnungen. Größere Anlieger, die sich dann ebenfalls auf eine Adressänderung einstellen müssten, sind die Agentur für Arbeit und die Arbeiterwohfahrt samt Kita und Mehrgenerationenhaus.
„Gemeinstes Zeug, das ich kenne“
Der Entscheidung zugrunde liegt eine historische Einordnung des Namensgebers Friedrich Carl Duisberg (geb. 29.9.1861 in Barmen, † 19.3.1935 Leverkusen) durch das Stadtarchiv. Duisbergs Wirken zeige durchaus positive Facetten. „Ohne Duisberg würden (Bayer) Werk und Stadt Leverkusen heute so nicht existieren“, bescheinigt ihm Stadtarchivar Tim Begler. Doch der Spitzenmanager der Chemiebranche zeichnet ebenso verantwortlich für die Produktion von Giftgas, für dessen Herstellung Abfallprodukte aus der Produktion verwendet werden konnten, unter anderem das grausam wirkende Phosgen. Duisberg setzte sich bei der Heeresleitung direkt für die Erprobung des Kampfstoffs ein („...das gemeinste Zeug, das ich kenne...“) und dafür, „die Gelegenheit dieses Krieges nicht vorübergehen zu lassen“.
CDU: Hinweis auf belgische Garnison
„Wir würden uns nicht verschließen“, macht auch CDU-Fraktionschef Oliver Fröhling im Rat angesichts der gestrebten Namensänderung deutlich. Aus den Reihen der Fraktion gebe es bereits auch Ideen zur Benennung der Straße. Die könnte nach dem belgischen König Baudouin benannt werden in Erinnerung an das deutsch-belgische Miteinander zur Zeit des in Lüdenscheid stationierten Militärs. Auch ein Standortkommandeur könnte Namensgeber sein, so die Überlegung. Von Florian Hesse
Presse Information vom 9. Dezember 2014
Neue TDI-Anlage: Umweltverbände bekräftigen Kritik
Der Bund für Umwelt und Naturschutz NRW und die Coordination gegen BAYER-Gefahren erneuern ihre Kritik an der TDI-Produktion in Dormagen. Die Anlage wird heute im Beisein von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und BAYER-Chef Marijn Dekkers eröffnet.
In Dormagen wird heute eine Anlage zur Produktion von Toluylen-Diisocyanat (TDI) mit einer Jahreskapazität von 300.000 Tonnen eröffnet. Die Chemikalie dient als Vorprodukt für Polyurethan-Weichschäume, die zum Beispiel in Autositzen und Matratzen verwendet werden.
Hierzu erklärt Philipp Mimkes von der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG): „Die TDI-Produktion ist ein Sinnbild für den Irrweg der Chlorchemie: Bei der Herstellung kommen hochtoxische Stoffe wie Phosgen und Kohlenmonoxid zum Einsatz, auch sind die Verfahren extrem energieaufwendig. Da die Stoffe nicht verrotten, landen sie mittelfristig auf Deponien oder als Plastikmüll im Meer. Wir benötigen dringend einen Umstieg auf erneuerbare Rohstoffe, biologisch abbaubare Endprodukte und eine ressourcen-schonende Wirtschaft“.
Angelika Horster vom nordrhein-westfälischen Landesverband des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND NRW) ergänzt: „Das Credo der Industrie lautet Wachstum. Dieses Wachstum geht stets mit zusätzlichen Emissionen und Ressourcenverbrauch einher. So auch in diesem Fall: die geringe Effizienzsteigerung wird durch die erhöhte Produktionsmenge weit in den Schatten gestellt.“
Die neue Anlage ist stark klimaschädigend, pro Tonne TDI entstehen etwa fünf Tonnen CO2. Im Erörterungstermin hatte sich der Konzern geweigert, für das Projekt eine detaillierte Ressourcen- und Energiebilanz vorzulegen. Zudem kommen in der Anlage pro Jahr rund 360.000 Tonnen des ehemaligen Giftgases Phosgen zum Einsatz. Zwar wird die TDI-Anlage erstmals mit einer Einhausung versehen, womit der Konzern einer jahrzehntelangen Forderung der Umweltbewegung nachkommt. Jedoch ist die Schutzwirkung der geplanten Blechhülle nicht vergleichbar mit der von den Verbänden geforderten gasdichten Betonkuppel, wie diese auch von anderen Herstellern für notwendig gehalten und gebaut wird.
In der Vergangenheit kam es in der TDI-Produktion von BAYER wiederholt zu schweren Unfällen. Dennoch hat BAYER kein Szenario eines Austritts großer Mengen Phosgen oder TDI vorgelegt. Hierzu Philipp Mimkes: „Die Störfälle im amerikanischen BAYER-Werk Institute oder bei INEOS in Dormagen zeigen, dass sich Unfälle nicht an vorhersehbare Abläufe halten. Auch für unwahrscheinliche Szenarien muss daher Vorsorge getroffen werden“.
BUND und CBG bemängeln zudem, dass die Anlage nur 300m vom S-Bahnhof Bayerwerk entfernt liegt, obwohl die Störfallkommission für den Einsatz von Phosgen einen Sicherheitsabstand von 1.500m empfiehlt. Die Verbände hatten sich mit Einwendungen gegen eine Genehmigung der Anlage gewandt. Auch hatten sie eine EU-Beschwerde gegen die Subventionierung des Projekts durch die staatliche KfW-Bank eingereicht.
weitere Informationen:
=> die Einwendungen der Umweltverbände
=> gelagerte Chemikalien im ChemiePark Dormagen
Presse Information vom 8. Dezember 2014
SYNGENTA, BAYER, MONSANTO profitierten von Kinderarbeit
Friedensnobelpreis für Kailash Satyarthi
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren und die deutsche Sektion des Global March against Child Labour beglückwünschen Kailash Satyarthi zum Friedensnobelpreis. Die Initiativen kooperierten mit Satyarthi bei der Bekämpfung von Kinderarbeit im indischen Baumwollsaat-Anbau. Hiervon hatten auch westliche Saatgut-Produzenten profitiert. Durch eine gemeinsame Kampagne konnte die Zahl beschäftigter Kinder drastisch reduziert werden.
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren und die deutsche Sektion des Global March against Child Labour gratulieren ihrem langjährigen Kooperationspartner Kailash Satyarthi zum Friedensnobelpreis.
Rainer Kruse vom Global March: „Kailash Satyarthi ist ein rastloser Arbeiter und Dickbrettbohrer. Im Hinblick auf sein Lebenswerk sind 80.000 befreite Kinder sicherlich tiefgestapelt. Ich weiß noch sehr genau, wie ich ihm das erste Mal begegnete – schon nach einer halben Stunde begann er, Pläne zu schmieden. Ich habe es stets als Privileg empfunden, diesem so herzlichen, Kindern spürbar zugewandten Charismatiker, der in der Tradition großer indischer Vorgänger Großes wagt, unterstützen zu können. Ohne ihn wären wir nie so weit gekommen.“
Kailash Satyarthi ist langjähriger Vorsitzenden des Global March Against Child Labour. Im Jahr 2003 hatte die Coordination gegen BAYER-Gefahren gemeinsam mit der deutschen Sektion des Global March, der indischen MV Foundation sowie dem India Committee of the Netherlands die Studie „Kinderarbeit im indischen Baumwollanbau - die Rolle multinationaler Saatgut-Konzerne“ veröffentlicht. Diese wies nach, dass internationale Saatgutfirmen wie MONSANTO, BAYER, UNILEVER und SYNGENTA von Kinderarbeit in ihrer schlimmsten Form profitierten.
Die sehr arbeitsintensive Produktion von Baumwoll-Saatgut in Südindien erfolgte durch kleine Zulieferer, die zwar nominell unabhängig, jedoch durch Qualitätsvorgaben und Lieferverträge an die Konzerne gebunden sind. Die hauptsächlich im Bundesstaat Andhra Pradesh gelegenen Farmbetriebe beschäftigten damals Zehntausende Kinder, überwiegend Mädchen zwischen 6 und 14 Jahren. Immer wieder kam es zu Vergiftungen durch Agrochemikalien.
Lange Zeit leugneten die Unternehmen die Probleme oder schoben die Verantwortung auf ihre Zulieferer. Die Initiativen reichten daher eine Beschwerde gegen den BAYER-Konzern wegen des Verstoßes gegen die OECD-Richtlinien ein. Erst als der öffentliche Druck zu groß wurde und als Investoren wie der norwegische Staatsfonds Druck machten, reagierte BAYER. Die Löhne im Saatgut-Anbau stiegen, Kontrollen wurden eingeführt, und bei den Zulieferern sank der Anteil von Kindern unter 14 Jahren deutlich.
Eine Studie von 2013 zeigt, dass die Verbesserungen von Dauer sind. In dem Report werden die Zustände bei der Firma Nunhems, einer 100-prozentigen BAYER-Tochter, untersucht. Die Kinderarbeit bei den Zulieferern von Nunhems ist demnach auf fast Null gesunken.
Philipp Mimkes von der Coordination gegen BAYER-Gefahren: „Reagiert hat BAYER damals nicht aus ethischen Gründen, sondern um weiteren Schaden für das Image zu vermeiden. Dieser Erfolg war jedoch nur durch Druck von außen zu erreichen, denn in Indien selbst war das Problem seit Jahren bekannt gewesen. Die Zusammenarbeit von Initiativen aus vier Ländern ist somit ein gelungenes Beispiel einer „Globalisierung von unten“. Wir hoffen, dass die Auszeichnung für Malala Yousafzay und Kailash Satyarthi nun zu weiteren Fortschritten im Kampf gegen die Kinderarbeit führt“.
Presse Information vom 27. November 2014
Dortmund: Carl-Duisberg-Straße wird umbenannt
BAYER-Generaldirektor verantwortlich für Giftgas-Einsatz und Zwangsarbeit / Umbenennung auch in Wuppertal, Frankfurt, Bonn und Leverkusen gefordert
Die Dortmunder Carl-Duisberg-Straße wird in Kleine Löwenstraße umbenannt. Die Bezirksvertretung Innenstadt-West folgte damit am gestrigen Abend einer Empfehlung des Dortmunder Stadtarchivs. Keine der Fraktionen stimmte gegen eine Namensänderung.
Jan Pehrke, Vorstandsmitglied der Coordination gegen BAYER-Gefahren, begrüßt das Votum: „Carl Duisberg, der geistige Vater der IG FARBEN, ging für Profite buchstäblich über Leichen. Wegen seiner Mitverantwortung für Gaskrieg, Zwangsarbeit und die enge Zusammenarbeit mit dem Nazi-Regime taugt er nicht als Vorbild für künftige Generationen. Auch die noch verbleibenden Carl-Duisberg-Straßen, unter anderem in Frankfurt, Bonn, Krefeld, Leverkusen und Dormagen, sowie das Wuppertaler Duisberg-Gymnasium sollten nun umbenannt werden.“
Das Dortmunder Stadtarchiv hatte die Umbenennung von sechs Straßen mit historisch belasteten Namensgebern vorgeschlagen. In der Bewertung von Duisberg schrieb das Stadtarchiv: „Während des Ersten Weltkriegs wurde unter seinem Vorsitz Giftgas für den Kriegseinsatz produziert. (…) Duisberg gehörte zu den führenden deutschen Industriellen, die während des Krieges die - auch nach dem damals geltenden internationalen Kriegsrecht illegale - Deportation belgischer Zivilisten zur Zwangsarbeit nach Deutschland durchsetzten.“ Die Überprüfung aller Dortmunder Straßennamen ging auf einen Antrag des früheren Ratsmitglieds Richard Kelber sowie eine Kampagne der Coordination gegen BAYER-Gefahren zurück.
Zum 150. Geburtstag von Carl Duisberg vor drei Jahren hatten sich unter anderem in Wuppertal, Leverkusen, Frankfurt und Marburg Initiativen gebildet, um Straßen, Schulen und Wohnheime, die den Namen des ehemaligen BAYER-Generaldirektors tragen, umzubenennen. Auch ein Entzug der Leverkusener Ehrenbürgerwürde war gefordert worden. In Frankfurt läuft ein Umbenennungsverfahren der dortigen Duisbergstraße; in Marburg führte das Engagement dazu, am dortigen Carl-Duisberg-Haus eine Plakette mit einer „Kritischen Würdigung“ anzubringen.
Einige Stationen aus Duisbergs Leben:
=> Schon 1900 hatte Carl Duisberg rücksichtslos die Vermarktung von Heroin als angeblich harmlosem Hustenmittel betrieben. Als Wissenschaftler das Suchtpotenzial von Heroin anprangerten, äußerte Duisberg - zu diesem Zeitpunkt Prokurist bei BAYER -, man müsse die „Gegner mundtot schlagen“. Obwohl sich rasch die Gefahr der Abhängigkeit herausstellte, ließ Duisberg den gewinnbringenden Verkauf mehr als ein Jahrzehnt lang fortführen.
=> Im 1. Weltkrieg entwickelte Carl Duisberg gemeinsam mit Fritz Haber Giftgase wie „Grünkreuz“ und „Senfgas“, testete diese persönlich auf Truppenübungsplätzen und verlangte vehement ihren Einsatz. So heißt es in einem Brief Duisbergs an die Oberste Heeresleitung: „Dieses Chlorkohlenoxyd ist das gemeinste Zeug, das ich kenne. ... Ich kann deshalb nur noch einmal dringend empfehlen, die Gelegenheit dieses Krieges nicht vorübergehen zu lassen, ohne auch die Hexa-Granate zu prüfen“. Duisberg und Haber verstießen damit wissentlich gegen die Haager Landkriegsordnung.
=> Duisberg engagierte sich in der vom antisemitischen „Alldeutschen Verband“ gesteuerten Kriegszielbewegung. Er forderte die Annexion des besetzten Belgien und von Nordfrankreich, etwas später auch „deutschen Lebensraum“ in Polen und Russland. Besonders auffällig ist Duisbergs Hass auf das „englische Krämervolk“, das man notfalls völkerrechtswidrig - wie er selbst einräumte - aus der Luft bombardieren sollte.
=> Im Herbst 1916 beklagte Duisberg den Mangel an Arbeitskräften und forderte mit dem Ausspruch „Öffnen Sie das große Menschenbassin Belgien" den Einsatz von Zwangsarbeitern. Das Reichsamt des Inneren griff den Vorschlag auf und ließ rund 60.000 Belgier deportieren, was international zu Protesten führte. Rund 12.000 Verschleppte starben. Die Deportation gilt als Vorläufer des ungleich größeren Zwangsarbeiter-Programms im 2. Weltkrieg.
=> Duisberg forderte den uneingeschränkten U-Boot-Krieg, Friedensverhandlungen lehnte er vehement ab. 1917 trat er in die Deutsche Vaterlandspartei ein. Der Historiker Hans Ulrich Wehler nennt diese Partei eine „rechtsextreme Massenorganisation mit deutlich präfaschistischen Zügen“. Ihre Parolen waren, so Wehler, „eine „giftige Fusion“ aus Antisemitismus, Radikalnationalismus, Expansionismus und Reformblockade. Zum Kriegsende befand sich Duisberg auf den Auslieferungslisten der Alliierten. Da er eine Anklage als Kriegsverbrecher fürchtete, floh er in die neutrale Schweiz.
=> Während der Weimarer Republik organisierte Duisberg, inzwischen Aufsichtsratsvorsitzender der IG FARBEN, Spenden an nationalistische Parteien, ab 1930 auch an die NSDAP. Im Gegenzug für ihre Millionen-Spenden erhielt die IG FARBEN von den Nationalsozialisten Absatzgarantien für synthetischen Treibstoff und Kautschuk. Kein anderes Unternehmen kollaborierte in der Folgezeit so eng mit dem Dritten Reich wie die IG FARBEN.
Philipp Mimkes vom Vorstand der Coordination gegen BAYER-Gefahren kommt zu dem Ergebnis: „Aus unserer Sicht muss Duisberg als verbrecherisches Genie bezeichnet werden. Duisberg war nicht nur ein `Kind seiner Zeit´, sondern trug entscheidend zu den mörderischen Entwicklungen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts bei. Daher sollten auch in anderen betroffenen Städten die politischen Instanzen und die Bürgerschaft aktiv werden.“
26. November 2014
Tödlicher Störfall im BAYER-Werk Institute (USA)
Roman „Valley at Risk“ erschienen
Kampagne der CBG, Buch Valley at Risk
In den USA ist ein Roman über den tödlichen Störfall im BAYER-Werk Institute erschienen. Das Buch „Valley at Risk“ beschreibt den Hergang der Katastrophe, die Verschleierungs-Versuche des Konzerns, den Kampf von Anwohner/innen und Umweltschützern gegen die anhaltende Bedrohung sowie weitere Skandale aus der BAYER-Historie.
Im August 2008 kam es in der Pestizidproduktion im amerikanischen Institute zu einer folgenschweren Explosion. Die Flammen schlugen rund 50 Meter in den Himmel, die Detonation war in einem Umkreis von 15 km zu spüren. Zwei Arbeiter verloren ihr Leben. Der US-Kongress kam in einer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass nur glückliche Umstände eine Katastrophe vergleichbar mit der in Bhopal verhindert hätten.
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) und örtliche Initiativen hatten zuvor jahrelang vor den Risiken der Fabrik gewarnt. Institute war das letzte Werk in den USA, in dem die Bhopal-Chemikalie Methylisocyanat (MIC) in großen Mengen produziert und gelagert wurde. Nach dem Störfall kooperierte die CBG mit der US-Aufsichtsbehörde Chemical Safety Board (CSB) bei der Aufklärung der Unglücksursachen.
Der Untersuchungsbericht des US-Kongresses kam zu dem Urteil: „Durch die Explosion flog ein mehrere Tonnen wiegender Rückstandsbehälter 15 Meter durch das Werk und zerstörte praktisch alles auf seinem Weg. Hätte dieses Geschoss den MIC-Tank getroffen, hätten die Konsequenzen das Desaster in Bhopal 1984 in den Schatten stellen können.“
BAYER hatte nach dem Störfall versucht, Bürgerinitiativen und kritische Journalist/innen in der Öffentlichkeit zu diskreditieren. Der US-Kongress urteilte hierzu: „BAYER beteiligte sich an einer Geheimhaltungskampagne. Die Firma hat den Sicherheitskräften entscheidende Informationen vorenthalten, hat den Ermittlern der Bundesbehörden nur eingeschränkten Zugang zu Informationen gewährt, hat die Arbeit von Medien und Bürgerinitiativen unterminiert und hat die Öffentlichkeit unrichtig und irreführend informiert.“
Dr. Dwight Harshbarger, Autor von „Valley at Risk“: „Ich verfolge die Arbeit der Coordination gegen BAYER-Gefahren seit der Explosion bei Bayer CropScience im Jahr 2008. Ich schätze Ihren Beitrag zur Sichtbarmachung der Geschäftstätigkeit von BAYER - die sonst wohl im Verborgenen bleiben würde - außerordentlich.“
Philipp Mimkes vom Vorstand der CBG: „Der Roman zeigt eindrucksvoll, welche Risiken Konzerne wie BAYER auf der Jagd nach Profiten in Kauf nehmen und dabei die Öffentlichkeit täuschen und belügen. Zum Schutz der Bevölkerung fordern wir grundsätzlich, dass die chemische Industrie auf den großtechnischen Einsatz tödlicher Chemikalien wie MIC und Phosgen verzichtet.“
Presse Info vom 26. November 2014
Xarelto: Kritik an Zulassung zur Behandlung des Koronarsyndroms
Stellungnahme der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren kritisiert die Zulassung des Gerinnungshemmers Xarelto zur Behandlung des Akuten Koronarsyndroms (ACS). Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte in der von BAYER vorgelegten Zulassungsstudie ATLAS ACS schwere Mängel gefunden: Unvollständigkeit und mangelnde Qualität der Primärdaten; fehlende Bestätigung der Ergebnisse durch andere Studiendaten; zu geringes Signifikanzniveau etc.
Die ATLAS ACS war die einzige Studie, die eine (und auch nur sehr geringfügige) Verbesserung der Überlebensrate von ACS-PatientInnen festgestellt hatte. Einzel-Studien werden für eine Zulassung in der Regel nur dann verwendet, wenn die vorliegenden Daten von hoher Güte sind. Dies war im vorliegenden Fall in keiner Weise gegeben. Die FDA hatte Anfang des Jahres daher eine Zulassung zur Behandlung des Akuten Koronarsyndroms verweigert.
Auch die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft sieht die Zulassung kritisch: „In der entsprechenden Zulassungsstudie senkte der Faktor-Xa-Inhibitor Rivaroxaban in Kombination mit ASS oder mit ASS plus Clopidogrel oder Ticlopidin nach einem ACS die kardiovaskuläre Mortalität. Die Häufigkeit von Myokardinfarkten oder Schlaganfällen wurde jedoch nicht gesenkt. Gleichzeitig erhöhte Rivaroxaban das Blutungsrisiko einschließlich intrazerebraler Blutungen, allerdings nicht die Häufigkeit tödlicher Blutungen. Der Studie werden schwere methodische Mängel vorgeworfen, weshalb diese Indikation von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA nicht zugelassen wurde. Darüber hinaus fehlen direkte Vergleiche zu Prasugrel und vor allem zu Ticagrelor. ACS-Studien mit dem Thrombininhibitor Dabigatran und dem Faktor-Xa-Inhibitor Apixaban zeigten ein negatives Nutzen-Risiko-Verhältnis. Vor diesem Hintergrund ist der Zusatznutzen von Rivaroxaban in der Indi-kation ACS derzeit zumindest fraglich.“
„Die Behörden müssen dringend die Nebenwirkungsrate von neuen Gerinnungshemmern wie Xarelto oder Pradaxa mit den Risiken älterer Präparate vergleichen. Es ist zu befürchten, dass durch gigantisches Marketing Medikamente mit erhöhtem Risiko-Profil in den Markt gedrückt werden. Nach heutigem Kenntnisstand lässt sich eine flächendeckende Umstellung der Patientinnen und Patienten auf Xarelto nicht rechtfertigen“, so Philipp Mimkes vom Vorstand der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) angesichts von 133 Meldungen an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte über Todesfälle mit Xarelto allein 2013.
Schon bei den Genehmigungsprozessen zu den Indikationen „Thrombose-Prophylaxe nach dem Einsetzen künstlicher Hüft- oder Kniegelenke“ und „Schlaganfall- und Embolie-Prophylaxe bei PatientInnen mit Vorhofflimmern“ hatte es in den Vereinigten Staaten Probleme gegeben. Die Aufsichtsbehörden warfen dem Konzern unter anderem vor, die ProbandInnen, die in der Vergleichsgruppe das Präparat Warfarin einnahmen (verwandt mit Marcumar), nicht richtig mit dem Medikament eingestellt zu haben.
weitere Informationen zu Xarelto
Leverkusener Anzeiger, 25. November 2014
Unterschriften gegen die CO-Pipeline
Die Gegner der CO-Pipeline in Leverkusen gehen jetzt auf die Straße. Die Initiative hat eine Unterschriftensammlung gestartet. Innerhalb der ersten eineinhalb Stunden haben sie schon 147 Unterstützer gefunden.
Die Gegner klagen – und hoffen, dass jetzt Bewegung ins Verfahren kommt. Bis Monatsende müssten sich die Bayer-Anwälte äußern, sagt Gottfried Schweitzer. Er steht an der Spitze der Kämpfer gegen die Kohlenmonoxid-Pipeline von Dormagen nach Leverkusen. Am Samstag begann die Initiative mit einer Unterschriftensammlung. Am Rialto-Boulevard verteilten die Pipeline-Gegner eine 16 Seiten starke Dokumentation und warben um Spenden.
Binnen eineinhalb Stunden hätten sich 147 Menschen der Forderung angeschlossen, die CO-Leitung sofort stillzulegen, hieß es. Die Leverkusener Pipeline-Gegner versuchen derzeit, mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht den Betrieb zu stoppen.
Ursprünglich hatte Schweitzer der Bezirksregierung Fehler bei der Betriebsgenehmigung für die Leitung nachweisen wollen. Das Rohr ist fast 50 Jahre alt und diente ursprünglich dem Transport des wesentlich harmloseren Gases Kohlendioxid. Die Bezirksregierung lehnte als Aufsichtsbehörde einen Betriebsstopp ab, räumte Schweitzer aber die Möglichkeit ein, gegen diesen Bescheid zu klagen. Der ließ sich nicht zweimal bitten; inzwischen ist der Bayer-Konzern zum Verfahren beigeladen. Wann es zur Verhandlung kommt, ist derzeit aber nicht abzusehen.
Unterdessen läuft das Genehmigungsverfahren für einen neuen Düker. Insbesondere an der Rhein-Unterführung für die Rohre gibt es Rostprobleme, weshalb Currenta als Betreiber der Pipeline unter anderem das Kohlenmonoxid in ein Parallelrohr umgeleitet hat. (tk)
Infos zur CO-Kampagne
Presse Information vom 14. November 2014
Höchst: BAYER CropScience erhöht Produktionsmengen von Pestiziden
„Profit auf Kosten von Landbevölkerung und Landarbeitern“
Die Firma Bayer CropScience hat gestern angekündigt, am Standort Höchst die Produktion des Herbizids Glufosinat zu verdoppeln. Jährlich sollen demnächst 16.000 Tonnen hergestellt werden. BAYER bietet das Herbizid unter den Markennamen BASTA und LIBERTY in Kombination mit gentechnisch verändertem Saatgut an, u. a. Raps, Reis, Zuckerrüben, Mais, Soja und Baumwolle.
Glufosinat kann Missbildungen bei Föten verursachen und ist als reproduktionstoxisch klassifiziert. Studien zufolge beeinträchtigt der Wirkstoff die Entwicklung des menschlichen Gehirns und ruft Verhaltensstörungen hervor. Der Wirkstoff gehört zu den rund 20 Pestiziden, die von der EU wegen ihrer hohen Gefahren für Landwirte und Verbraucher/innen aus dem Verkehr gezogen werden sollen.
Trotz der seit langem bekannten Risiken erhöht BAYER Jahr für Jahr die Produktionsmenge, vor allem für den Export nach Nord- und Südamerika. In Hürth bei Köln wurde der Glufosinat-Ausstoß im vergangenen Jahr erweitert, im US-Bundesstaat Alabama baut der Konzern momentan gar eine neue Produktionsanlage auf. Nach Aussage des Höchster Werksleiters, Frank Zurmühlen, bestehe große Nachfrage nach Glufosinat, da viele Unkräuter Resistenzen gegen das Konkurrenzprodukt „Glyphosat“ entwickelt hätten.
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) hingegen fordert einen weltweiten Verkaufsstopp – sowohl für Glufosinat als auch für Saatgut, dessen Einsatz mit Glufosinat gekoppelt ist. „Der Teufelskreis, in dem der Einsatz von immer mehr Pestiziden zur Entstehung von immer mehr resistenten Unkräutern führt, die dann mit noch mehr Agrochemikalien bekämpft werden, muss endlich durchbrochen werden“, so Philipp Mimkes vom Vorstand der CBG.
Nach Aussage von Mimkes ist die Ausweitung der Glufosinatproduktion unverantwortlich und ein klassischer Fall von doppelten Sicherheits-Standards: „Es ist zynisch, im Ausland eine Anbautechnik zu forcieren, die mit der Verwendung eines hochgiftigen und bei uns demnächst verbotenen Pestizids verknüpft ist. Das Schicksal der Landarbeiterinnen und Landarbeiter in Lateinamerika oder Asien ist dem Konzern augenscheinlich gleichgültig.“
In vielen Schwellen- und Entwicklungsländern explodierte der Verbrauch gefährlicher Agrochemikalien in den vergangenen Jahren. Allein in Argentinien und Indien hat sich die eingesetzte Menge seit 2004 mehr als verdoppelt. Durch den massiven Pestizideinsatz steigen Fehlgeburten und Krebsraten.
Anders als von den Lobbyisten stets behauptet, dient der Anbau von Gen-Pflanzen nicht der Lösung des Hungerproblems – im Gegenteil. BAYER, SYNGENTA und MONSANTO richten sich bei der Einführung von genverändertem Saatgut weitgehend nach den Bedürfnissen der globalen Fleisch-Industrie. Denn rund 80 Prozent der gentechnisch veränderten Pflanzen werden als Tierfutter verwendet. Die eingesetzten Gen-Pflanzen sind weder dürreresistent noch ertragreicher. Durch ihren Anbau auf immer größeren Flächen wird die Produktion von Lebensmitteln zurückgedrängt, wodurch sich die Versorgung der lokalen Bevölkerung erschwert.
Presse Information vom 12. November 2014
BAYER: unlautere Werbung in sozialen Netzwerken
Jubel-Postings unter falscher Identität
Die Wiener PR-Agentur Mhoch3 hat über Jahre hinweg mit gefälschten Identitäten Postings in Onlineforen platziert. Positive Kommentare wurden unter anderem im Auftrag von Opel, TUI, Red Bull und BAYER verfasst. Der Geschäftsführer von Mhoch3 bestätigte, dass das „Online-Reputationsmanagement“ seit zehn Jahren angeboten und weiterhin betrieben werde. Nach Recherchen des österreichischen Magazins DATUM veröffentlichte die Agentur mehrere hunderttausend Postings unter falschen Namen.
Die gefakten Kommentare finden sich vor allem auf deutschen Foren, darunter Plattformen und soziale Netzwerke wie YouTube oder GuteFrage.net, Nachrichtenseiten wie Spiegel.de und Focus.de sowie Sparten-Angebote wie MeinAuto.de. Die PR-Profis geben sich meist als unbedarfte Nutzer/innen aus, die aus Freundlichkeit Unterstützung anbieten. Rechtschreibfehler und persönliche Fragen sollen Authentizität suggerieren.
Im Fall von BAYER warb Mhoch3 unter anderem für Flohmittel wie Advantix, Advantage und Kiltix aus der Veterinärsparte des Konzerns. Zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit sollten die Mitarbeiter/innen eigens ein Haustier erfinden. In Interneteinträgen heißt es dann etwa: „Benny was hast du deiner katze letzt endlich gegeben damit die Flöhe verschwinden? Wir behandeln immer mitn Spot On von Bayer namens Advantage- kennst du das?...wünsch Euch viel Glück!“.
Im Fall der umstrittenen Hormonspirale Mirena wurde offenbar auch die Gesundheit der Anwenderinnen gefährdet. Obwohl für Mirena Tausende – teils schwerwiegende – Berichte von Nebenwirkungen vorliegen, veröffentlichte die Agentur Postings im Tonfall hilfsbereiter Freundinnen:
=> „also ich hab mir vor einem jahr die hormonspirale mirena einsetzen lassen und ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden damit bin. hatte am anfang angst vor dem einsezten, doch das war halb so schlimm“. Olivia34, psychologie.at
=> „Ich habe mir die Mirena einsetzen lassen, ist ebenfalls eine hormonspirale und damit hatte mein Frauenarzt sehr gute Erfahrungen bereits gemacht (…) – das kann ich voll empfehlen“
=> „@ sporzal: mein tip es könnte auch eventuell nicht von der mirena kommen, sondern eventuell eine Allergie sein, ich hab das leider auch erst mal in vor kurzer zeit festgestellt, ich hatte echt total oft Kopfweh und das ist nicht lustig – das kann ich nachvollziehen“. MauMau, hormonspirale-forum.de
Im internen Fazit von Mhoch3 nach der BAYER-Kampagne heißt es laut Süddeutscher Zeitung: „Grundsätzlich ist zu sagen, dass das Internet eine ideale Plattform zur Verbreitung von Informationen zum Thema Verhütung darstellt“. In zahlreichen Fällen hätten die Reaktionen der Nutzerinnen gezeigt, dass sie den freundlichen Kommentaren Glauben schenkten und sich für die Spirale interessierten.
Zur Aufgabe der Agentur gehörte es auch, Einträge bei wikipedia „aufzuhübschen“. Vor jeder Kampagne erhielten die PR-Schreiber/innen eine Schulung, mitunter sogar persönliche Vorträge der Kunden. Viele der gefakten Kommentare finden sich bis heute im Netz.
Jan Pehrke vom Vorstand der Coordination gegen BAYER-Gefahren fordert strafrechtliche Ermittlungen gegen die Verantwortlichen bei BAYER: „Unlautere Medikamentenwerbung hat bei BAYER Tradition. Im vorliegenden Fall sollten ganz offensichtlich die Gesetze umgangen werden, denn Werbung für verschreibungspflichtige Präparate wie Mirena ist verboten. Wir dürfen nicht zulassen, dass Pharmahersteller die Risiken von Medikamenten verharmlosen und schamlos die öffentliche Diskussion manipulieren!“.
BAYER gibt pro Jahr rund 10 Milliarden Euro für Werbung und Vertrieb aus, eine Aufschlüsselung verweigert der Konzern. Häufig überschreitet BAYER dabei die Grenzen des Erlaubten; Strafen für unlautere Werbung werden von vornherein mit einkalkuliert und aus der Portokasse beglichen.
In den vergangenen Jahren verlagerte BAYER zahlreiche Marketing-Aktivitäten ins Internet. Um das Werbeverbot für Medikamente zu umgehen, betreibt das Unternehmen eigene webseiten wie Pille.com oder testosteron.de, die als „Informationsangebote“ getarnt werden.
junge Welt greift Kampagne auf
weitere Informationen:
=> Artikel „Die Netzflüsterer“: http://www.datum.at/artikel/die-netzfluesterer
=> BAYER verschleiert Marketing-Ausgaben
=> Pharmamarketing bei BAYER
=> Social Marketing bei BAYER
=> Informationen zu Mirena
7. November 2014
Die Neuss Grevenbroicher Zeitung berichtet heute über den großen Brand in der Pestizidproduktion des Dormagener BAYER-Werks im Jahr 1979. Damals wurde Alarm bis an die holländische Grenze ausgelöst. Der Störfall war einer der Auslöser der Gründung der Coordination gegen BAYER-Gefahren. Hier ein Artikel zum Gusathion-Störfall von Axel Köhler-Schnura.
Über den Unfall erschien damals ein Roman von Klas Everwyn. Dieser erhielt zunächst einen Literaturpreis der Stadt Dormagen, wurde später jedoch von BAYER mit Klagen überzogen. Hierüber berichtete u.a. der SPIEGEL.
Der Artikel der NGZ suggeriert, dass es bei BAYER im wesentlichen ein Kommunikationsproblem gab. Tatsächlich gehen vom Dormagener Werk jedoch bis heute hohe Risiken aus. So kommen allein in der neuen TDI-Produktion jährlich 360.000 Tonnen des einstigen Kampfgases Phosgen zum Einsatz.
Eine Übersicht der Störfälle bei BAYER findet sich hier.
Störfall vor 35 Jahren veränderte Bayer-Politik
Am 7. November 1979 sorgte eine Gaswolke für Panik in Dormagen. Der Chemiekonzern betreibt seitdem viel Aufwand zur Vertrauensbildung. Von Stefan Schneider
NGZ - Für viele Dormagener waren es heute vor genau 35 Jahren beklemmende Stunden, voller Angst und Ungewissheit: Als am 7. November 1979, einem Mittwoch, im Dormagener Bayer-Werk eine Anlage zur Herstellung von Pflanzenschutzmitteln in Brand geriet, trat dabei eine Gaswolke aus, die einen extrem üblen Geruch über die Stadt und die umliegenden Kommunen legte. Der Gestank war so heftig, dass Menschen in Panik gerieten. Schließlich wussten sie zu diesem Zeitpunkt nicht, ob Gesundheitsgefahren von der Wolke ausgingen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem ausgetretenen Stoff um das Pflanzenschutzmittel Gusanthion, doch es dauerte eine ganze Weile, bis Ruhe einkehrte.
Der Austritt der Gaswolke beschäftigte sogar den Deutschen Bundestag. Auf eine Anfrage des Neussers Abgeordneten Heinz Günther Hüsch (CDU) zu dem Störfall antwortete der Parlamentarische Staatssekretär Andreas von Schoeler am 14. November 1979 u. a.: Auch bei ungünstigen Annahmen könne unterstellt werden, dass Gesundheitsgefahren für die in Werksnähe wohnenden Menschen nicht aufgetreten seien (...) Und: „Der Ausbruch der Gaswolke in Dormagen hat erneut die Notwendigkeit und die Dringlichkeit der in Vorbereitung befindlichen Störfall-Verordnung aufgezeigt (...)“.
Doch nicht nur nahm die Politik die Chemieindustrie nachfolgend an die Kandare, auch der Bayer-Konzern veränderte sich. Der damalige Dormagener Werkleiter Walter Bayer intensivierte die von seinem Vorgänger Werner Unger begonnene Öffnung des Unternehmens nach außen. Die Menschen, vor allem die direkten Nachbarn, sollten wieder Vertrauen zu Bayer gewinnen. Der Autor Karl-Heinz Engler vertritt in dem Buch „Dormagen und sein Werk 1917 - 1992“ indirekt die These, dass sich seit dem Störfall von 1979 die Öffentlichkeitsarbeit des Konzerns einschneidend vertiefte: Unger, Bayer „und ihre Nachfolger luden und laden nicht nur die Presse ins Werk, sondern beispielsweise auch Kommunalpolitiker und Bürgervereine, um gemeinsam Probleme, Absichten, Wünsche zu besprechen“.
Der Prozess ist bis heute im Fluss. Chempark-Leiter Ernst Grigat sagt: „Die Öffentlichkeitsarbeit des Chemieparks Dormagen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr geändert und entwickelt. Das hängt mit einem stärkeren Informationsbedürfnis der Nachbarschaft und von Entscheidungsträgern im Umfeld zusammen, das hängt zusammen mit anderen und neuen Medien und einem anderen Nutzerverhalten der Menschen. Die Akzeptanz in der Nachbarschaft für den Chempark und das Vertrauen in die Sicherheit ist für die Unternehmen ein wichtiger Faktor.“ Ihren Ausdruck finden die Bemühungen bis heute in Werksführungen, Präsentationen von Ausbildungswesen und Sicherheitseinrichtungen und nicht zuletzt in der Präsenz in der Stadt - mit dem Nachbarschaftsbüro Chepunkt Unter den Hecken.
Störfall bei Bayer war auch ein Roman-Thema
Was: Der Zukunftsroman „Der Dormagener Störfall von 1996 - Eine Legende“ von Klas Ewert Everwyn beschäftigte sich in den 1980er Jahren auf 105 Seiten fiktiv mit dem Szenario: Was, wenn bei Bayer etwas schiefgeht?
Folgen: Der „Spiegel“ widmete Everwyn und seinem Buch einen großen Beitrag, der Bayer-Konzern sah sich diffamiert und erwirkte einige Schwärzungen im Buch.
Auch die Coordination gegen BAYER-Gefahren steht vor Problemen, da durch die SEPA-Umstellung Spenderinnen und Spender verloren gingen, u.a. aus den hier dokumentierten Gründen
Pressemitteilung vom 6. November 2014
Spender werden zur Kasse gebeten: Fehlfunktion von SB-Terminals in Banken seit der SEPA-Umstellung
Deutscher Fundraising Verband fordert Banken zum Handeln auf
Viele Menschen kaufen in diesen Wochen nicht nur die ersten Weihnachtsgeschenke für ihre Liebsten, sondern möchten sich über eine Spende an gemeinnützige Organisationen auch für einen guten Zweck einsetzen. Das ist seit der SEPA-Umstellung leider gar nicht mehr so einfach.
Arne Peper, Geschäftsführer des Deutschen Fundraising Verbands (DFRV), erklärt: „Spenden-Zahlscheine von Organisationen werden an den SB-Kundenterminals der Banken teilweise als „nicht lesbar“ abgewiesen. Wenn die Spender dann damit zum Schalter gehen, werden sie zur Kasse gebeten und dürfen zu ihrer Spende noch eine saftige Bearbeitungs-Gebühr dazulegen.“
Wobei es aus Sicht der Organisationen manchmal noch schlimmer kommt. Mehrfach mussten sich bereits potenzielle Spenderinnen und Spender von unkundigen Filial-Angestellten Aussagen anhören wie: „Spenden geht unter SEPA nicht mehr“, „Sie können nur noch an eine Organisation spenden, die mit uns einen Vertrag abgeschlossen hat“ oder: „... die bei uns ein Konto hat.“ Fehlinformationen wie diese können die Organisationen auf Dauer hohe Summen an dringend benötigten Spendengeldern kosten.
Der Deutsche Fundraising Verband fordert die Banken daher zum Handeln auf:
• Spenden müssen kostenlos ermöglicht werden. Sollten die SB-Terminals dafür umgerüstet werden müssen, damit sie auch die für Spenden vorgesehenen Zahlscheine akzeptieren, so sollte bei den Bearbeitungen am Schalter bis dahin auf Gebühren verzichtet werden.
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen besser geschult werden, damit irreführende Falschaussagen vermieden werden und gerade den älteren Mitbürgern bei der Umsetzung von SEPA mehr geholfen wird.
• Es muss eine Clearingstelle für Probleme bei der SEPA-Umsetzung geschaffen werden, damit die Kundinnen und Kunden nicht daran scheitern, dass sich sowohl Banken als auch die Deutsche Kreditwirtschaft derzeit nicht für die Probleme zuständig fühlen.
Das Problem, dass die Zahlscheine am SB-Terminal nicht angenommen werden, tritt flächendeckend in Deutschland bei vielen Banken auf. Betroffen sind zahlreiche Organisationen, darunter zum Beispiel auch Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen, Brot für die Welt und der NABU.
DFRV-Geschäftsführer Arne Peper kommt daher zu dem Schluss: „Trotz der Jubelmeldungen der Bundesbank und des Bundesministerium für Finanzen ruckelt es noch ganz schön bei der SEPA-Umstellung.“
Der Deutsche Fundraising Verband
Dem Deutschen Fundraising Verband gehören rund 1300 Mitglieder an. Er vertritt die Interessen sowohl der einzelnen Fundraiser als auch der im Dritten Sektor tätigen gemeinnützigen Organisationen und der sie unterstützenden Dienstleister in Deutschland, fördert die Professionalisierung des Berufszweigs sowie die Umsetzung ethischer Prinzipien in der Branche.
4. November 2014, Oxfam
Zivilgesellschaft wartet seit einem Jahr auf Transparenz bei der German Food Partnership
Oxfam: Entwicklungsministerium verzögert Offenlegung von Verträgen mit BASF, Bayer & Co.
Entwicklungshilfe für Konzerne? Seit einem Jahr (5.11.2013) unterstützt das BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) Agrar- und Chemieriesen wie Bayer und BASF. Diese sind im Rahmen der German Food Partnership (GFP) in privat-öffentlichen Kooperationen mit der Hungerbekämpfung in armen Ländern beauftragt. Der Zivilgesellschaft versprach das BMZ schon vor einem Jahr vollständige Transparenz in Sachen GFP.
Doch bis heute wurden Oxfam trotz mehrfacher Anfragen seit dem 13. November 2013 weder die Verträge und Vereinbarungen zwischen dem BMZ, den beteiligten Unternehmen und den Stiftungen übermittelt, noch andere aussagekräftige Projektdokumente. Auf eine erneute Oxfam-Anfrage vom 30. September 2014, nun auf der Grundlage des Informationsfreiheits- und des Umweltinformationsgesetzes, antwortete das BMZ kurz vor Ablauf der gesetzlich Monatsfrist, dass die Bearbeitung der Anfrage noch „längere Zeit in Anspruch nehmen kann“. Für Oxfam ist dies absolut unverständlich, da das Ministerium und die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) bereits ein Jahr Zeit für die Zusammenstellung von Informationen hatten. „Das BMZ mauert massiv, wenn es um die Herausgabe von Informationen zur German Food Partnership geht“, kritisiert Oxfams Agrarexpertin Marita Wiggerthale. „Die Öffentlichkeit hat das Recht zu erfahren, was das Entwicklungsministerium mit Steuergeldern macht, die für die Armutsbekämpfung vorgesehen sind.“
Als Reaktion auf die Kritik an der Intransparenz der GFP vertröstete das BMZ Oxfam bisher stets mit dem Hinweis auf geplante Veröffentlichungen auf der Website. Zuletzt kündigte die Referatsleitung der Sonderinitiative „Eine Welt ohne Hunger“ am 24. September 2014 im Entwicklungsausschuss des Bundestages eine Veröffentlichung auf der Website der GFP für die darauffolgende Woche an. „Bis jetzt ist noch nicht einmal diese Veröffentlichung erfolgt“, sagt Wiggerthale. „Wir werden immer wieder vertröstet. Diese Hinhaltetaktik ist nicht weiter hinnehmbar.“ Oxfam behielte sich weitere Schritte vor.
Hintergrund:
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) betreibt im Rahmen von Kooperationen wie der German Food Partnership unter dem Deckmantel der Armutsbekämpfung Wirtschaftsförderung zum Vorteil riesiger Konzerne. Anstatt stärker Kleinbäuerinnen und -bauern zu unterstützen, die in Afrika 80 Prozent des dortigen Lebensmittelbedarfs decken, befriedigt das BMZ die Interessen der Konzerne. Die Unternehmen erschließen sich neue Märkte für ihr Saatgut und ihre Pestizide. Gegen diese Praxis haben Oxfam, FIAN, INKOTA und andere einen Appell gestartet. Das BMZ soll die Förderung von Agrar- und Chemieriesen beenden und offenlegen, wer wofür Entwicklungshilfegeld erhält. Zum Appell und zur Kampagne geht es hier: http://www.oxfam.de/informieren/agrarkonzerne
Presse Information vom 30. Oktober 2014
mögliche Übernahme durch Private-Equity-Firmen
BAYER MaterialScience: Sicherung der Arbeitsplätze gefordert
Bericht im Leverkusener Anzeiger
Die Private-Equity-Firmen Advent, Carlyle, Cinven, CVC und KKR haben die Kunststoffsparte von BAYER ins Visier genommen. Angesichts der Größe des Geschäfts – der Kaufpreis dürfte bei rund elf Milliarden Euro liegen – planen die Beteiligungsgesellschaften ein Konsortium.
Zu erwarten sind negative Auswirkungen für die mehr als 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jan Pehrke vom Vorstand der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG): „Das Interesse der Heuschrecken verheißt nichts Gutes. Wir befürchten eine Parzellierung von BAYER MaterialScience, die Vernichtung weiterer Arbeitsplätze und eine Absenkung der Löhne - so wie bei vielen Firmenübernahmen durch Private-Equity-Firmen zuvor“. Die CBG fordert den BAYER-Vorstand auf, die Kunststoffsparte nur an einen Investor zu verkaufen, der den Bestand der Arbeitsplätze weltweit garantiert.
Levi Sollie, Vertrauensmann der belgischen Gewerkschaft Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) bei BAYER MaterialScience in Antwerpen, ergänzt: „Die Gewerkschaften fordern eine Jobgarantie, so wie sie die deutsche Belegschaft erhalten hat. BAYER hat die Verantwortung, unsere Löhne und Arbeitsbedingungen für die kommenden Jahre zu garantieren. Im März 2015 wird das Antwerpener BAYER-Werk seinen 50. Geburtstag begehen - den meisten Arbeitern ist aber nicht nach Feiern zu Mute. Worauf wir jetzt zählen, ist ein Abkommen zur Sicherung der Arbeitsplätze“. Die GewerkschaftsvertreterInnen im Aufsichtsrat hatten der Abspaltung nach Drohungen der Unternehmensleitung zugestimmt. Als Gegenleistung konnte eine Arbeitsplatzgarantie bis 2020 ausgehandelt werden, diese gilt jedoch nur für die deutschen Standorte.
Material Science hatte zwar stets in der Gewinnzone gelegen, dennoch hatten Investoren seit Jahren eine Abspaltung gefordert. Offenbar führte ihre zunehmende Macht zu der jetzigen Entscheidung. Tatsächlich erhöhte sich der Aktienkurs am Tag der Verkaufsverkündigung um 6%.
Um die Kunststoff-Sparte im Unternehmen zu halten, waren der Belegschaft bereits in den vergangenen Jahren zahlreiche Zugeständnisse abverlangt worden. So hatte BAYER mittels mehrerer „Effizienz-Programme“ über 2.000 Arbeitsplätze vernichtet, Werke geschlossen und Bonus-Zahlungen gestrichen. Welche langfristige Entwicklung droht, zeigt die ehemalige Chemie-Sparte von BAYER, die vor zehn Jahren unter dem Namen Lanxess ausgegliedert wurde. Mehrere Tausend Arbeitsplätze wurden seitdem vernichtet, Tausende Mitarbeiter erlitten Lohneinbußen oder wurden in andere Werke versetzt. Im Lauf der Jahre wurde Lanxess immer weiter aufgeteilt - mehrere Bereiche wurden geschlossen, andere verkauft.
Unter dem Dach von MaterialScience befinden sich zahlreiche hochgefährliche Anlagen, zum Beispiel die Produktion von Polyurethan und Polycarbonat, bei der große Mengen toxischer Stoffe wie Chlor, Ammoniak, Kohlenmonoxid sowie das ehemalige Kampfgas Phosgen eingesetzt werden.
Philipp Mimkes vom Vorstand der CBG befürchtet daher auch Konsequenzen für die Anlagensicherheit: „Die künftigen Besitzer werden versucht sein, die Kosten für Wartung, Personal und Feuerwehr weiter abzusenken. Dies führt automatisch zu höheren Störfallrisiken. Da Bayer MaterialScience einige der – nach Atomkraftwerken – gefährlichsten Industrieanlagen in Deutschland betreibt, ist dies für die Öffentlichkeit von größtem Interesse. BAYER muss sicherstellen, dass die Betriebssicherheit durch den Verkauf nicht verringert wird.“
Zudem drohen Städten wie Leverkusen, Krefeld und Brunsbüttel Steuer-Verluste, wenn BAYER die Sparte an Private-Equity-Gesellschaften verkauft. Diese bürden den Verkaufspreis gerne ihren Neuerwerbungen als Schulden auf und senken so deren Gewinn. Zudem haben die Finanz-Konzerne ihren Sitz häufig in Steueroasen.
Fotos von Streikposten am BAYER-Werk Antwerpen am 15. Dez.
30. Oktober 2014, Mellifera e.V.
Imker streiten am Europäischen Gerichtshof gegen Pestizide
Nachdem die EU-Kommission im Herbst letzten Jahres den Einsatz bestimmter Pflanzenschutzmittel verboten hat, haben die Herstellerkonzerne BASF, Bayer und Syngenta vor dem Europäischen Gerichtshof Klage gegen die Kommission eingereicht. Sie werfen ihr unter anderem einen Mangel an Beweisen für eine schädliche Wirkung der Neonicotinoide auf Honigbienen vor. Die Imkerverbände haben sich jetzt erfolgreich durchgesetzt und wurden als Prozessbeteiligte für alle drei Verfahren zugelassen.
Neonicotinoide sind Nervengifte. Sie stellen ein großes Problem für die Umwelt und die Bienen dar. Das Verbot wurde von der Kommission aufgrund fehlender Studien zur Risikobewertung ausgesprochen und gilt zunächst für zwei Jahre. In dieser Zeit sollen neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden. Bayer & Co. wollen, dass das Verbot sofort wieder aufgehoben wird, schließlich gehören Neonicotinoide zu den am meisten verkauften Pflanzenschutzmitteln weltweit.
Auf Initiative des „Bündnis zum Schutz der Bienen“ hatten sechs Imkerverbände beim Europäischen Gerichtshof eine Prozessbeteiligung beantragt. Der Deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund und österreichische Imkerverbände wurden nun für die Verfahren zugelassen. Als Prozessbeteiligte können sich die Verbände jetzt aktiv in das Gerichtsverfahren einbringen. Sie erhalten Einsicht in alle Schriftsätze der klagenden Chemiekonzerne und der beklagten EU-Kommission. Nur so kann eine außergerichtliche Einigung hinter verschlossenen Türen verhindert werden.
Die Imkerverbände kämpfen nicht nur für die Bienen. Thomas Radetzki, Imkermeister von Mellifera e.V. und Koordinator des Bündnisses, ist überzeugt, dass es richtig und wichtig ist, hier mitzuwirken: „Es geht nicht allein um die Honigbienen. Die ständige Intensivierung der Landwirtschaft mit derartigen Pestiziden schädigt unsere Umwelt, beschleunigt den dramatischen Artenschwund und zerstört somit unser aller Lebensgrundlagen.“
Neonicotinoide sind hochwirksame Pestizide. Ihre Giftigkeit ist teilweise 7.000 mal höher als die von DDT. Besonders gefährlich sind ihre subletalen Effekte, diese führen nicht zum sofortigen Tod, sondern stören die Kommunikationsfähigkeit und den Orientierungssinn der Bienen. Sie finden nicht mehr in den heimischen Stock zurück und gehen zugrunde.
Neue wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass Neonicotinoide auch für einen Artensterben bei Singvögeln verantwortlich sind. Wissenschaftler kritisieren seit Jahren die mangelhaften Zulassungsanforderungen und intransparenten Zulassungsverfahren dieser Pestizide.
Bienen stellen nicht nur Honig her, mit ihrer Bestäubungsleistung bringen sie in Deutschland einen volkswirtschaftlichen Nutzen von zwei Milliarden Euro im Jahr. Ohne Bienen müssten wir Menschen auf ein Drittel unserer Nahrungsgrundlage verzichten.
Presse Information vom 27. Oktober
Tödliche Gas-Explosion in Ludwigshafen:
„Gefährliche Pipelines sollten Störfall-Verordnung unterliegen“
Anlässlich der jüngsten Gas-Explosion in Ludwigshafen fordert die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG), dass gefährliche Pipelines der Störfall-Verordnung unterliegen müssen. Auch müssten alle Leitungen in einem öffentlich einsehbaren Kataster einsehbar sein. Durch strengere Sicherheits-Maßnahmen und die Beteiligung der Öffentlichkeit ließe sich das Risiko deutlich mindern.
Prof. Dr. Jürgen Rochlitz, Mitglied der Kommission für Anlagensicherheit beim Bundesumweltministerium und Vertreter des wissenschaftlichen Beirats der CBG: „Viele Pipelines gehören dem Grunde nach und wegen der technischen Erfordernisse zu Betriebsbereichen von Störfallbetrieben. Aus ökonomischen Überlegungen jenseits von Sicherheitsfragen werden sie bislang jedoch nicht in die Überwachung von Störfallbetrieben einbezogen“.
Die Coordination gegen BAYER-Gefahren kritisiert seit Jahren den Bau einer Kohlenmonoxid-Pipeline zwischen den BAYER-Werken Dormagen und Krefeld. Die Leitung war ohne Beteiligung der Öffentlichkeit genehmigt worden. Polizei, Feuerwehr und medizinische Dienste haben deutlich gemacht, dass sie die Sicherheit der Bevölkerung bei einem Unfall nicht gewährleisten können; auch die betroffenen Kommunen lehnen die CO-Pipeline ab.
In Leverkusen gibt es zudem Kritik an der dort geplanten Gas-Hochdruckleitung, die in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten gebaut werden soll.
Bei der Explosion am Donnerstag waren 26 Personen verletzt worden, ein Bauarbeiter starb. Die Wucht der Detonation war so gewaltig, dass noch in rund 100 Meter Entfernung Scheiben von Häusern und geparkten Autos platzten. Der Bautrupp hatte an einer Hochdruckgasleitung gearbeitet, die einer Tochterfirma von BASF und Gazprom gehört.
weitere Informationen: Kampagne CO-Pipeline