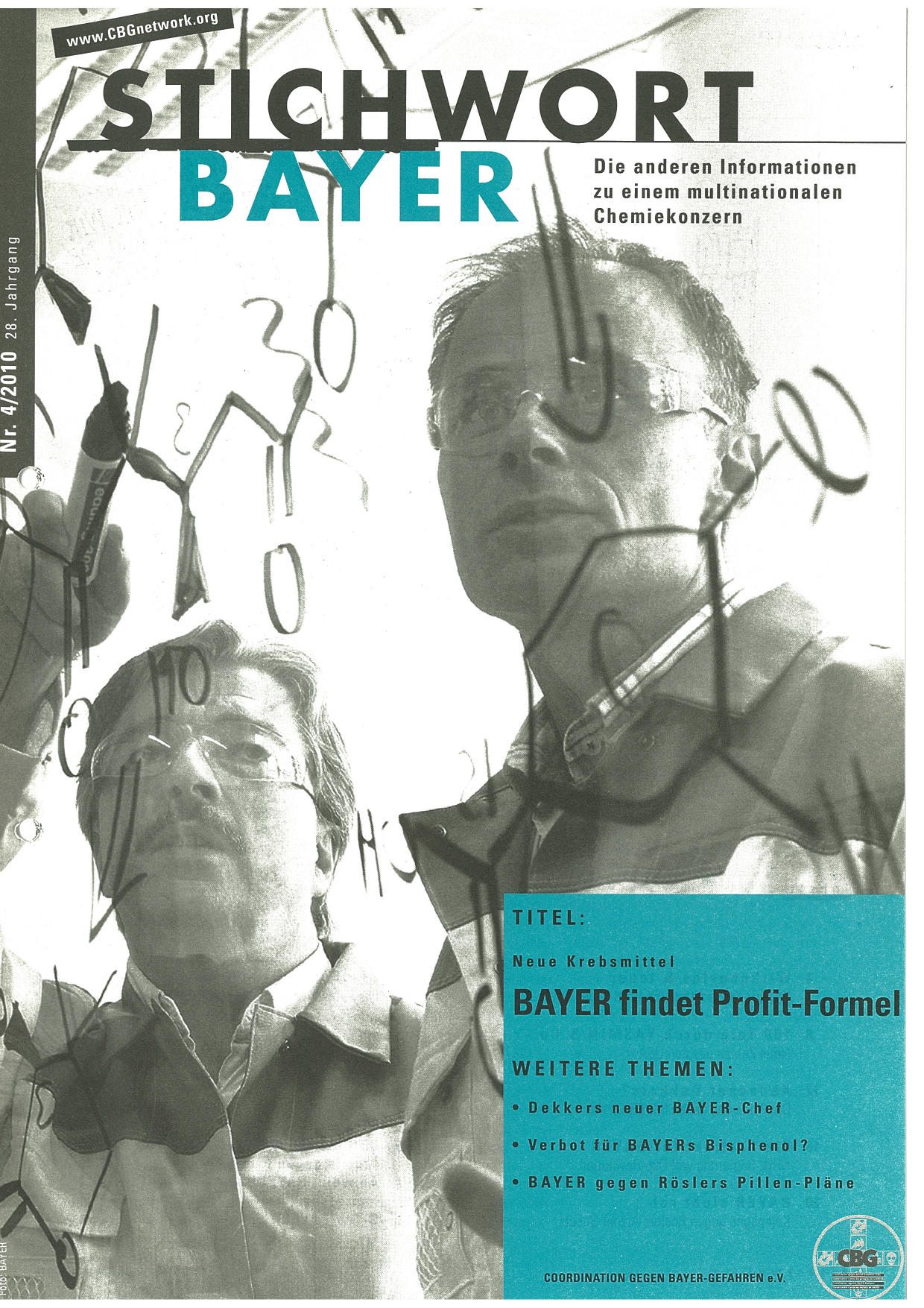AKTION & KRITIK
Protest-Lauf von PRIMODOS-Opfern
Der hormonelle Schwangerschaftstest PRIMODOS der heute zu BAYER gehörenden Firma SCHERING hat zu tausenden Todgeburten geführt. Darüber hinaus kamen unzählige Kinder mit schweren Missbildungen zur Welt. Die Opfer des auch unter dem Namen DUOGYNON vermarkteten Produkts fordern den Konzern auf seinen Hauptversammlungen regelmäßig auf, Entschädigungen zu zahlen, aber der Leverkusener Multi weigert sich konsequent. In England nutzen die Geschädigten deshalb einen vom Pharma-Riesen gesponsorten 10-km-Langstreckenlauf, um auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen. Sie liefen mit, verteilten Flugblätter und hielten entlang der Strecke Pappen mit Aufschriften wie „Warum wurden wir als Versuchskaninchen benutzt?“ hoch. Zudem setzten sie den Schlusspunkt des Sport-Events. Der Aktivist Karl Murphy kam nämlich nach knapp zwei Stunden als Letzter ins Ziel. Zu dieser Zeit wollten die VeranstalterInnen eigentlich längst die Siegerehrung durchgeführt haben, aber nach Protesten der ZuschauerInnen mussten sie noch ein geschlagenes Stündchen auf Murphy warten.
Anfrage wg. DUOGYNON/PRIMODOS
Grüne Bundestagsabgeordnete haben in Kooperation mit der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und Geschädigten des Schwangerschaftstest PRIMODOS (s. o.) eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Diese hielt sich jedoch bedeckt. Die Regierungskoalition wusste nichts über die Verschreibungshäufigkeit und die Zahl der Geschädigten. Das aus dem Jahr 1980 stammende Urteil, die PRIMODOS-Opfer nicht zu entschädigen, mochte sie nicht kommentieren. Auch sahen sich CDU und FDP nicht in der Lage, Auskünfte über die Fakten-Grundlage der im Jahr 1975 getroffenen Entscheidung zu geben, PRIMODOS trotz bedenklichen Sicherheitsprofils nicht die Zulassung als Schwangerschaftstest zu entziehen.
Datenschützer für Offenlegung
Vor zwei Jahren vereinbarte BAYER mit der Kölner Hochschule eine Kooperation auf dem Gebiet der Pharma-Forschung. „Sie ist die weitreichendste, die eine nordrhein-westfälische Universitätsklinik bislang eingegangen ist“, jubilierte Innovationsminister Andreas Pinkwart damals. Der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) und anderen Initiativen machte das eher Angst. Die Gruppen befürchteten eine Ausrichtung der Pharma-Forschung nach Profit-Vorgaben, eine Entwicklung von Präparaten ohne therapeutischen Mehrwert, eine Verheimlichung negativer Studienergebnisse und einen Zugriff des Konzerns auf geistiges Eigentum der Hochschul-WissenschaftlerInnen. Deshalb forderten sie eine Offenlegung des Vertrages. Das verweigerte die Universität aber mit Verweis auf das Forschungs- und Geschäftsgeheimnis. Die CBG schaltete daraufhin den nordrhein-westfälische Landesbeauftragten für Datenschutz ein, der das Begehr der Gruppen prüfte und für rechtmäßig erklärte. „Auf der Grundlage der mir vorliegenden Erkenntnisse gehe ich (...) von einem Informationszugangsanspruch aus“, heißt es in dem Schreiben. Die Kölner Hochschule nahm das jedoch nicht zum Anlass, ihre Position zu revidieren und blieb bei ihrer Verweigerungshaltung: „Der Rechtsansicht des Landesbeauftragten wird nicht gefolgt“. Unterdessen hat die CBG sich an die nordrhein-westfälische Forschungsministerin Svenja Schulze (SPD) gewandt und sie aufgefordert, „der Rechtsansicht der Landesbeauftragten“ Geltung zu verschaffen.
22.233 KraftwerksgegnerInnen
Im Frühjahr hatte TRIANEL offiziell den Genehmigungsantrag für das auf dem Gelände von BAYERs Chemie„park“ in Krefeld geplante Kohlekraftwerk gestellt. Weil die Anlage auf einen Kohlendioxid-Ausstoß von jährlich ca. 4,4 Millionen Tonnen kommt und die Umwelt darüber hinaus mit Feinstaub, Schwermetallen und Radioaktivität belastet, erhoben über 22.000 Privatpersonen, Nachbarstädte und Initiativen, darunter auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN, bei der Bezirksregierung Einspruch gegen das Projekt.
Einspruch gegen Antwerpener Kraftwerk
Gegen das vom Energie-Riesen E.ON auf dem Antwerpener Werksgelände von BAYER geplante Kohlekraftwerk haben GREENPEACE, der WWF und der niederländische Umweltverband BBLV wegen des zu erwartenden Ausstoßes von Kohlendioxid und anderen Stoffen offiziell Einspruch eingelegt.
Offener Brief wg. CO-Pipeline
Aus Protest gegen die von BAYER zwischen Dormagen und Krefeld geplante Kohlenmonoxid-Pipeline haben Kinder- und JugendmedizinerInnen aus der Region jetzt schon ihren zweiten Offenen Brief geschrieben, adressiert an BAYER, den Ministerpräsidenten, den Landtag und die Bezirksregierung. Bis auf eine Ausnahme unterzeichnete die komplette Innung, denn die ÄrztInnen sehen im Fall einer Leckage keine Rettungsmöglichkeiten. Gerade einmal zwei Sauerstoff-Überdruckkammern für die Behandlung von Vergifteten gebe es in ganz Nordrhein-Westfalen, kritisierten sie. Auch an dem Gefahrenabwehrplan ließen die Unterzeichner kein gutes Haar. „Es gibt nur eine einzige Prävention, und die ist, dass die Pipeline nicht in Betrieb gehen darf, so Dr. Martin Terhardt. BAYER hingegen blieb unbeeindruckt. Das Schreiben enthalte „mehrere längst widerlegte Behauptungen“, meinte der Konzern und schwelgte weiter in Pipeline-Poesie: „Für die CO-Pipeline zwischen Dormagen und Krefeld-Uerdingen wurde ein Sicherheitskonzept entwickelt, das die bisherigen Standards und gesetzlichen Regelungen übertrifft. Im normalen Leitungsbetrieb ist ein Austreten von CO auszuschließen“.
Feuerwehr kritisiert CO-Pipeline
Die Feuerwehren in der Region sind nach Ansicht des Kreisbrandmeisters Friedrich-Ernst Martin nicht auf einen Pipeline-Unfall vorbereitet. So schaffen es ihre Spezialgeräte nur, die Feuerwehrleute 45 Minuten mit Sauerstoff versorgen. „Das ist viel zu wenig Zeit, um Menschenleben in einem großen Wohnhaus retten zu können“, so Martin. Auch an Spezialfahrzeugen, die es erlauben, direkt zum Ort des Gasaustritts vorzudringen, fehlt es seiner Meinung nach - und an Personal sowieso.
Steinbrück kritisiert CO-Pipeline
Der den Wahlkreis Mettmann im Bundestag vertretende Peer Steinbrück (SPD) hat BAYER scharf für die Unregelmäßigkeiten beim Bau der Kohlenmonoxid-Pipeline kritisiert. „Wer eine gültige Planfeststellung so oft ändert oder jedenfalls nicht so erfüllt, wie er müsste, ist entweder verrückt oder allzu couragiert“, konstatierte der Ex-Finanzminister.
Quecksilber-Anfrage
BAYER gehört zu den letzten Konzernen, die ihre Chlor-Produktion so umstellen, dass dabei kein giftiges Quecksilber mehr anfällt (SWB 3/09). Was aber geschieht mit den Rückständen, immerhin mehrere 100 Tonnen? Das wollte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN von der Bezirksregierung wissen. Diese „dankt für Ihre kritischen und nachvollziehbaren Fragen“ und „versichert, dass diese im Rahmen der behördlichen Anlagen-Überwachung angemessene Berücksichtigung finden werden“. Antworten konnte die Bezirksregierung jedoch nicht geben. Wo das Quecksilber einmal landet, vermochte sie nicht zu sagen, da der Umbau noch bevorstehe. Immerhin ist Versorge für die Gesundheit der Beschäftigten getroffen: Sie müssen sich regelmäßigen Quecksilber-Tests unterziehen.
UN übt Konzern-Kritik
Die Vereinten Nationen werfen den großen Konzernen der Welt schwere Versäumnisse beim Umweltschutz vor. Allein die 3.000 wichtigsten Unternehmen sollen Umweltschäden von jährlich knapp zwei Billionen Euro verursachen; das Artensterben sei 100-mal schneller als es die Evolution vorgibt, so die UN. „Der Raubbau an der Natur durch die Wirtschaft setzt sich seit Jahren ungebremst fort. Das natürliche Kapital der Welt wird im großen Stil vernichtet“, konstatierte Achim Steiner, Leiter des UN-Umweltprogramms UNEP, in der Süddeutschen Zeitung und kritisierte: „In vielen Konzernen gilt noch immer die Devise: Natürliche Ressourcen sind unerschöpflich. Dabei müssen wir längst schmerzhaft spüren, dass das nicht mehr stimmt“. Steiner verlangte ein Einpreisen dieser negativen Ökobilanz in die Geschäftsbilanzen und forderte die Politik zum Umdenken auf. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN forderte allerdings auch ihn zum Umdenken auf, da seine Organisation mit einem der größten Übeltäter zusammenarbeitet. „Wir begrüßen die unmissverständlichen Aussagen von Achim Steiner zur mangelnden Verantwortung multinationaler Unternehmen. Die UNEP muss hieraus Konsequenzen ziehen und endlich die unselige Kooperation mit dem BAYER-Konzern beenden. BAYER als einer der größten Hersteller von Pestiziden und gentechnisch verändertem Saatgut gehört zu den Verursachern des Artensterbens“, heißt es in der Presseerklärung der CBG.
Persilschein für PONCHO & Co.
Pestizide gefährden das Leben von Bienen massiv. So hat BAYERs Saatgut-Beize PONCHO mit dem Wirkstoff Clothianidin vor zwei Jahren ein Massensterben verursacht, weshalb in vielen Ländern Verbote erfolgten und hierzulande die Zulassung für Mais-Kulturen einstweilen ruht. Die Bundestagsfraktion der GRÜNEN hat diese „Risiken und Nebenwirkungen“ zum Anlass für eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung genommen. Die Partei wollte wissen, welche Maßnahmen CDU und FDP zum Schutz der Tiere vor BAYERs PONCHO und ELADO sowie anderen Ackergiften schon ergriffen haben und welche sie in Zukunft noch planen. Für eine spezielle Überwachung dieser Produkte sah die schwarz-gelbe Koalition jedoch keinen Anlass. Nach der Risiko-Bewertung der Mittel durch die Aufsichtsbehörde würden keine „Anhaltspunkte für eine Schädigung von Bienenvölkern vorliegen“, antworteten Merkel & Co.
Protest gegen Pestizid-Ausbringungen
Nicht nur die massive Ausweitung des Soja-Anbaus in Südamerika führt zu einer entsprechenden Ausweitung des Pestizid-Gebrauchs. Auch die Umstellung auf das Direktsaat-Verfahren, für das die LandwirtInnen den Boden nicht mehr umpflügen müssen, sorgt für mehr Agrochemie auf den Feldern - und damit auch für mehr Gesundheitsschädigungen. Viele Wirkstoffe, die auch Bestandteile von BAYER-Mitteln sind, haben daran einen Anteil, so etwa das in GLYPHOS und USTINEX G enthaltene Glyphosat. Im argentinischen San Jorge etwa häufen sich die Asthma- und Krebsfälle. Zudem leiden immer mehr Männer unter Unfruchtbarkeit. Viviana Peralta wollte das nicht länger hinnehmen. Sie startete eine Unterschriften-Kampagne, zog vor Gericht und erreichte einen Teilerfolg. Die RichterInnen untersagten eine großräumige Ausbringung der Ackergifte und ordneten die Einrichtung einer Schutzzone an.
Boykott des Runden Tisches
Beim „Runden Tisch zur Pflanzen-Genetik“, den Forschungsministerin Annette Schavan deckt, haben KritikerInnen nicht viel zu sagen. Da die Initiativen nicht länger als Feigenblatt dienen wollten, haben sie nach dem letzten Treffen im September 2009 einen neun Punkte umfassenden Anforderungskatalog zur Sicherheit der Risikotechnologie formuliert, an dem die Bundesregierung sich orientieren sollte. Diese war jedoch nicht dazu bereit, ernsthaft über eine systematische Erfassung der gesundheitlichen Risiken von Genpflanzen, die Untersuchung von Wechselwirkungen der Laborfrüchte mit Pestiziden und eine Standardisierung der Zulassungstests zu diskutieren. Deshalb sagten die im DEUTSCHEN NATURSCHUTZRING organisierten Verbände ihre Teilnahme am „Runden Tisch“ vom Juli 2010 ab.
Mediziner kritisiert Industrie-Einfluss
Der Hannoveraner Medizin-Professor Dr. med. Arnold Ganser hat bitter das Fehlen einer von Big Pharma unabhängigen Arzneimittel-Forschung beklagt. „Durch die Hürden der Gesetzgebung, die durch Druck von seiten der Industrie durchgedrückt worden ist, sind heutzutage Arzneimittel-Studien ohne Unterstützung der Pharma-Industrie kaum mehr möglich. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass die zur Zulassung führenden und von der Pharma-Industrie üppig mit Geld unterstützten klinischen Studien nicht unbedingt das Optimum der therapeutischen Wirkung, sondern eher das Optimum des finanziellen Gewinns zum Ziel haben“, schreibt er in einem Leserbrief an die Faz. Im Interesse der „Gesundheit der Bürger“ fordert er deshalb die Politik auf, aktiv zu werden und den Einfluss von BAYER & Co. zu begrenzen.
KAPITAL & ARBEIT
Tarifverträge für 56 %
Nur bei 56 Prozent aller BAYER-Belegschaftsangehörigen ist ihr Entgelt durch Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen gesichert. Für Beschäftigte in Europa beträgt die Quote 88 Prozent, in Lateinamerika/Afrika/Nahost 42 Prozent, in der Asien/Pazifik-Region 18 Prozent und in Nordamerika 14 Prozent.
PRONOVA schluckt DER PARTNER
Mitte 2007 schloss sich BAYERs Betriebskrankenkasse mit der FORTISNOVA BKK zur PRONOVA BKK zusammen. Seither schluckt sie kleinere Kassen. So verleibte die PRONOVA sich bereits FORD & RHEINLAND und GOETZE & PARTNER ein. Und im April 2010 folgte schließlich DER PARTNER. Mit nunmehr 660.000 Versicherten gehört BAYERs ehemalige Versorgungseinrichtung mittlerweile zu den 25 größten Krankenkassen der Bundesrepublik.
Wenning verdient 3,57 Millionen
Im Krisenjahr 2009 hat BAYER-Chef Werner Wenning mit 3,57 Millionen Euro 90.000 Euro weniger verdient als 2008.
Vorstandsvergütung nicht populär
Den BAYER-AktionärInnen sind die hohen Bezüge des Vorstands nicht ganz geheuer. Während die Hauptversammlungen der anderen 29 Dax-Unternehmen die Gehälter der Chef-Etagen mit Zustimmungsraten von bis zu 99,93 Prozent absegneten, votierten beim Leverkusener Multi lediglich 95,25 Prozent für die Millionen-Gagen. Nur sieben Konzerne erzielten noch schlechtere Ergebnisse.
Pharma-Umstrukturierungen
Wirtschaftskreise üben seit längerem Kritik an der angeblich immer noch nicht abgeschlossenen Integration des 2006 gekauften Pharma-Riesen SCHERING in den BAYER-Konzern und machen „Doppelstrukturen und überflüssige Hierarchie-Ebenen“ aus. Das veranlasste den Leverkusener Multi jetzt zu Umstrukturierungen. So hat er bei BAYER SCHERING PHARMA die Geschäftsfelder Spezialmedizin und Diagnostik sowie Frauengesundheit und Allgemeinmedizin zusammengelegt. Die neue Abteilung „BAYER Medical Care“ soll vor allem den Absatz von Blutzucker-Messgeräten befördern, bei denen BAYERs Marktanteile massiv eingebrochen waren. Mit „Innovationen“ wie dem DIDGET (siehe PROPAGANDA & MEDIEN), computer-kompatiblen Apparaturen und Technologie-Partnerschaften bei Diagnostika-Neuentwicklungen will das Unternehmen verlorenes Terrain zurückerobern. Zudem hat der Global Player als neue Pharma-Führungsebene ein „Executive Committee“ eingeführt, das vor allem im angelsächsischen Raum verbreitet ist. „Es trifft die wichtigsten Entscheidungen, braucht aber anders als der Vorstand nicht dem Aufsichtsrat Rede und Antwort stehen“, benennt die Financial Times Deutschland die „Vorteile“. Die Zeitung gibt sich damit allerdings nicht zufrieden und erwartet vom neuen BAYER-Chef Marijn Dekkers eine umfassende Neu-Organisation der Sparte.
ERSTE & DRITTE WELT
BAYER & Co. bei Niebel
Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel betrachtet das Ministerium nicht länger als „Weltsozialamt“, sondern als Wirtschaftsförderungsamt. Deshalb hat er im März den „Bundesverband der Deutschen Industrie“ zu einem Roundtable-Gespräch eingeladen. „Dies ist der Beginn eines fortlaufenden Dialogs mit der Wirtschaft“, erklärte die Parlamentarische Staatssekretärin Gudrun Kopp und ließ keinen Zweifel daran, dass sie BAYER & Co. für die wahren EntwicklungshelferInnen hält. „Das Know-How deutscher Unternehmen wird in vielen Entwicklungsländern dringend gebraucht“, so Kopp. Auch der „Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft“ durfte bei Niebel schon vorsprechen. Der „Verband entwicklungspolitischer deutscher Nichtregierungsorganisationen“ kritisierte diesen Politikwechsel. Er verlangte, sich auf die Grundbedürfnisse der Menschen in den armen Ländern nach einer ausreichenden Gesundheits- und Nahrungsmittelversorgung zu konzentrieren statt auf die Grundbedürfnisse der bundesdeutschen Wirtschaft.
Neues Lateinamerika-Konzept
Die schwarz-gelbe Koalition hat ein neues Lateinamerika-Konzept erstellt, das ganz auf die Bedürfnisse von BAYER & Co. zugeschnitten ist. „Die Bundesregierung unterstützt die deutsche Wirtschaft bei der Erschließung des Potenzials Lateinamerikas. Sie misst der Beteiligung der Wirtschaft bei der Auswahl und Definition der Maßnahmen eine zentrale Rolle zu“, heißt es in dem Text.
Proteste gegen „Maiz Solidario“
Das Entwicklungshilfe-Programm „Maiz Solidario“ will Millionen Kleinbauern und -bäuerinnen der Chiapas-Region in den Genuss der industriellen Landwirtschaft bringen. Aber diese können auf Ackergifte und auf hybrides, also nicht für die Wiederaussaat geeignetes Saatgut sowie auf Genpflanzen gut verzichten. Deshalb protestieren sie gegen den Anschluss an den Agro-Weltmarkt mit all seinen negativen Folgen für die Nahrungssouveränität, die Gesundheit und die Umwelt.
Millionengeschäft mit der UNFPA
In seinem Nachhaltigkeitsbericht verbucht der Leverkusener Multi seine Kooperation mit dem „UN Population Fund“ (UNFPA) als zivilgesellschaftliches Engagement. Die Zusammenarbeit dient aber ausschließlich dem Zweck, neue Absatzmöglichkeiten für seine Kontrazeptiva zu finden. Die UN handelt nämlich immer noch nach der vom ehemaligen US-Präsidenten Lyndon B. Johnson formulierten Devise „Fünf gegen das Wachstum der Bevölkerung investierte Dollar sind wirksamer als hundert für das Wirtschaftswachstum investierte Dollar“ und verteilt unter den Armen der Welt Verhütungsmittel en masse. Deshalb hatte der seit 2006 zu BAYER gehörende SCHERING-Konzern schon früh entsprechende Kontakte geknüpft (SWB 4/06). Diese zahlen sich auch heute noch aus. Bei empfängnisverhütenden Mitteln steht der Pharma-Riese an der Spitze der UNFPA-Lieferliste; für 25 Millionen Dollar kauften die Vereinten Nationen 2009 in Leverkusen ein.
8.000 asiatische Versuchskaninchen
Der Leverkusener Multi verlegt immer mehr Medikamentenversuche in arme Länder. Dort locken ein großes Reservoir an ProbandInnen, unschlagbare Preise, schnelle Verfahren und eine mangelhafte Aufsicht (SWB 2-3/10). Allein in Asien setzen sich zur Zeit 8.000 Personen den Risiken und Nebenwirkungen von neuen BAYER-Arzneien aus.
POLITIK & EINFLUSS
Pott Kölner Hochschulrats-Vorsitzender
Der Leverkusener Multi hat mit der Kölner Universität im Jahr 2008 eine umfangreiche Forschungskooperation im Medizin-Sektor vereinbart, über deren genaue Modalitäten sowohl Hochschule als auch BAYER jede Auskunft verweigern (siehe AKTION & KRITIK). Die fürsorgliche Belagerung der Bildungseinrichtung durch den Multi spiegelt sich auch auf der Verwaltungsebene wider. So hat der Konzern-Manager Richard Pott den Vorsitz des Hochschulrats übernommen.
Konzerne starten Energie-Kampagne
Auf großflächigen Anzeigen haben BAYER-Chef Werner Wenning, EON-Vorstand Johannes Teyssen, Josef Ackermann von der DEUTSCHEN BANK und über 30 andere Manager die Energiepolitik der Bundesregierung angegriffen. Sie kritisierten geplante Maßnahmen wie die Brennelemente-Steuer und die Streichung der Ökosteuer-Ausnahmeregelungen für energie-intensive Branchen wie die Chemie und verlangten ein Bekenntnis zu Atom- und Kohlekraftwerken. „Damit die Preise für alle bezahlbar bleiben, können wir bis auf Weiteres nicht auf kostengünstige Kohle und Kernenergie verzichten“, schreiben die Bosse. Hauptsache billig, meinen sie also und nennen das „Mut zum Realismus“. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Millionäre wieder einmal mit Unbill für den Standort Deutschland. Ursprünglich drohte auch Michael Vassiliadis von der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE mit. Aber dann fehlte sein Konterfei doch, wofür es unterschiedliche Erklärungen gibt. Laut Süddeutscher Zeitung hat der RWE-Vorstandsvorsitzende Jürgen Großmann den Gewerkschaftler ohne dessen Wissen zum Bundesgenossen gemacht und vom verdutzten ArbeiterInnen-Vertreter kurz vor Toresschluss eine Absage erhalten. Nach Informationen der Rheinischen Post hingegen zog Vassiliadis seine Unterschrift erst zurück, nachdem VERDI-Chef Frank Bsirske seine Teilnahme verweigert hatte, da der IG BCEler inner-gewerkschaftlichen Twist vermeiden wollte. Auch unter den Konzernen selber herrscht nicht immer solch eine traute Eintracht. So haben große Stromkunden wie BAYER wegen der hohen Abgabe-Preise immer wieder mit den Strom-Anbietern gehadert und sogar Anspruch auf Teile des Extra-Profites von 66 bis 84 Milliarden Euro erhoben, den die AKW-Laufzeitverlängerung RWE & Co. in die Kassen spült (Ticker 2-3/10).
BAYER & Co. gegen Finanzmarkt-Reformen
Auch BAYER nutzt die umstrittenen Instrumente, die der Finanzmarkt bietet. So hat der Konzern Geld in Derivaten angelegt, die eine Art Wette auf Preissteigerungen oder -senkungen von Rohstoffen, Aktien, Währungen, Zinsen oder aber von Derivaten selber sind. Der Leverkusener Multi weist dabei das Motiv „Spekulation“ weit von sich. „Derivate Finanzinstrumente werden dabei fast ausschließlich zur Absicherung von gebuchten und geplanten Transaktion abgeschlossen“, heißt es im Geschäftsbericht. Aber die Interessen der SpekulantInnen sind auch die Interessen BAYERs. Darum hat der Leverkusener Multi in Tateinheit mit BMW, DAIMLER, ROLLS ROYCE und anderen Unternehmen an die EU appelliert, den Derivate-Markt nicht zu regulieren. Die Konzerne rechnen damit, im Falle einer solchen Reform nicht mehr so schnell an Finanzierungsmöglichkeiten zu kommen wie ihre US-amerikanische Konkurrenz und befürchten Wettbewerbsnachteile. In ihrer Eingabe sprechen sie allerdings nicht nur pro domo, sondern haben das große Ganze im Blick und entwerfen ein Horrorszenario. „Statt die nächste Krise zu verhindern, könnten sie die nächste Krise auslösen“, mit diesen Worten warnen BAYER & Co. die EU-Kommission vor strengeren Finanzcasino-Spielregeln.
Aus für Ökosteuer-Ausnahmen?
Die strom-intensivsten Branchen wie z. B. die Chemie-Industrie müssen relativ gesehen am wenigsten Ökosteuer zahlen. Nach erfolgreichen Interventionen von BAYER & Co. hatte die rot-grüne Koalition ihnen 1999 bei der Verabschiedung des Gesetzes großzügige Ausnahmeregelungen eingeräumt, die den Konzerne bis zu neun Milliarden Euro ersparen. Diese Subventionen will Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble jetzt um 2,5 Milliarden abbauen, was einen Sturm der Entrüstung auslöste. „Was da im Bundesfinanzministerium geplant wird, ist ein Anschlag auf Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze dieser Branchen“, sagte nicht etwa BAYER-Chef Werner Wenning, sondern Michael Vassiliades von der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE. Aber selbstverständlich kritisierten auch Chemie-Bosse das „Gesetz zur Reduzierung der Subventionen der ökologischen Steuerreform“. Von „Gift für den Aufschwung“ sprachen sie - und werden sicherlich auch erhört werden.
CDU-Wirtschaftsrat für Sozialkürzungen
Der Wirtschaftsrat der CDU, bei dem Wolfgang Große Entrup genauso wie bei BAYER für die Umweltpolitik zuständig ist, hat massive Kürzungen im Sozial- und Gesundheitsbereich gefordert. Im Etat von Ursula von der Leyen sieht er ein Einsparpotenzial von 40 Milliarden Euro. Das Budget ihres Kollegen Philipp Rösler will das Gremium durch eine forciertere Abwicklung des paritätisch von Beschäftigten und Unternehmern finanzierten Krankenversicherungssystems und die Ausklammerung der Zahnbehandlungskosten aus dem Erstattungskatalog der Krankenkassen entlasten.
Obamas Klimaschutz-Politik scheitert
Barack Obama trat mit einer ehrgeizigen Klima-Politik an. So wollte er die US-amerikanischen Kohlendioxid-Emissionen gegenüber 2005 um 17 Prozent reduzieren und einen den Ausstoß senkenden Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten einführen. Aber BAYER & Co. liefen Sturm gegen die angeblich gerade in Krisenzeiten kontraproduktive „Klima-Steuer“ und setzten sich durch. Erst änderten die DemokratInnen ihren Gesetzes-Entwurf, strichen die Passagen über Kohlendioxid-Obergrenzen und den Emissionshandel, dann gaben sie das Projekt im Juli 2010 schließlich ganz auf. „Wir wissen, dass wir nicht genug Stimmen haben“, so Harry Reid, der Fraktionsvorsitzende der DemokratInnen im Senat, zur Begründung.
BDI gegen EU-Klimaschutzpläne
8,1 Millionen Tonnen Kohlendioxid hat BAYER im Geschäftsjahr 2009 produziert. Um den Klimawandel nicht werter zu befördern, müsste der Konzern seinen Ausstoß drastisch reduzieren. Das jedoch lehnt er ab. In Tateinheit mit den anderen im „Bundesverband der deutschen Industrie“ (BDI) organisierten Unternehmen sprach sich der Leverkusener Multi gegen Pläne europäischer UmweltministerInnen aus, die Treibhausgas-Emissionen innerhalb der EU bis zum Jahr 2020 nicht mehr nur um 20 Prozent, sondern um 30 Prozent zu senken. „In Zeiten, in denen ganze Branchen schwerer zu kämpfen haben denn je zuvor, gefährdet jede zusätzliche Belastung den Aufschwung“, ließ der BDI verlauten.
BDI für Steuerentlastungspläne
Der „Bundesverband der deutschen Industrie“ (BDI) hat sich mit dem Steuerrecht befasst und nicht weniger als 170 Vereinfachungsvorschläge eruiert. Selbstverständlich geht es dabei überhaupt nicht um eine Senkung der Abgabe-Lasten, sondern nur um eine „Reduzierung unnötiger Bürokratie“. Als zu bürokratisch empfinden BAYER & Co. etwa die Steuern auf Verlagerungen von Betriebsteilen ins Ausland und das mit Steuer-Paradiesen wie Singapur vereinbarte Anrechnungsverfahren, das die dortigen Sätze auf das bundesdeutsche Niveau hebt (siehe auch RECHT & UNBILLIG).
BAYER spendet an UN
Mit BAYER, DAIMLER/CHRYSLER, SHELL und 47 anderen Global Playern unterzeichnete UN-Generalsekretär Kofi Annan Ende Juli 2000 in New York den „Global Compact“, eine unverbindliche Vereinbarung zur Umsetzung internationaler Menschenrechts-, Sozial- und Umweltstandards (Ticker 4/00). Im Gegenzug berechtigt die Unterschrift BAYER & Co., mit dem UN-Emblem für Konzern-Produkte zu werben. Das lassen die Unternehmen sich auch etwas kosten. 1,7 Millionen Dollar spendeten sie im Jahr 2009 dem „Global Compact“ für seine diversen Projekt. BAYER fand sich in der Gruppe der Konzerne, die 1.000 bis 5.000 Dollar gaben. Solch einen Wohltäter möchte die UN nicht verlieren. Während sie bereits 1.300 Firmen wegen Verstoßes gegen den Werte-Kanon ausschloss, weigert sie sich bisher standhaft, einer Forderung der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN nachzugeben und dem Leverkusener Multi wegen des Störfalls in Institute und dem nachfolgenden desaströsen Katastrophen-Management die Rote Karte zu zeigen (Ticker 1/10).
Lobbyismus als Dienstleistung
In wichtigen Hauptstädten wie Berlin, Brüssel, Washington und Peking unterhält der Leverkusener Multi mittlerweile so genannte Verbindungsbüros. „Wir bei BAYER verstehen uns als Bestandteil der Gesellschaft und sehen es daher als unsere Pflicht, uns in die gesetzgeberischen Entscheidungsprozesse einzubringen“, sagt der Vorstandsvorsitzende Werner Wenning zur Begründung. Und seine oberste Einbringerin in Berlin, Patricia Solaro, betrachtet sich nicht als schnöde Lobbyistin; ihrem Verständnis nach hat sie eine Service-Funktion. „Wir sind Dienstleister für die Politiker, das bedeutet, wir müssen komplexe Sachverhalte aus den Bereichen Pharma, Gesundheit und Chemie verständlich darstellen“. Im Moment gibt die Dame den Abgeordneten Nachhilfe in „steuerlicher Forschungsförderung“ (s. u.), „Bildungsförderung“ und „Ordnungspolitik“.
BAYERs Beitrag
„Mit dem BAYER-Politikbrief Beitrag bringen wir unsere Expertise in die politische Debatte in Deutschland ein“, so charakterisiert der Leverkusener Multi Sinn und Zweck seiner neuen Publikation, die sich an „politische Entscheider auf Bundes- und Landesebene sowie Wissenschaft, Wirtschaft und Medien“ wendet. Die neueste Ausgabe ist dem derzeitigen politischen Lieblingsthema des Konzerns, der steuerlichen Absetzbarkeit von Forschungsaufwendungen, gewidmet. BAYER-Vorstand Wolfgang Plischke zeigt den PolitikerInnen dort auch gleich, wie es gehen kann, und „entwirft eine steuerliche Förderung für Deutschland“. Um seinen Worten Gehör zu verschaffen, hat der Konzern sich prominenten Beistandes versichert. Jürgen Mlynek von der Helmholtz-Gesellschaft, der österreichische Finanzminister Josef Pröll und Christof Ernst und Friedrich Heinemann vom „Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung“ unterstützten BAYERs dreistes Subventionsbegehr.
BAYERs Lobby-Akademie
2009 hat BAYER in Kooperation mit dem „European Training Institute“ die „Brussels Academy“ gegründet. Die Einrichtung hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Schulungskursen Lobby-Techniken zu vermitteln. Zudem will sie „die Lücke zwischen Unternehmen und der Zivilgesellschaft“ schließen und baut zu diesem Zweck Beziehungen mit Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften und VerbraucherInnen-Organisationen auf. Der WORLD WILDLIFE FUND (WWF) ist dem Leverkusener Multi schon ins Netz gegangen und bereitet für den „Civil Society Council“ eine Diskussionsrunde zum Thema „Wissenschaft und Regulierungen“ vor.
Bund gründet Rohstoffagentur
Die Versorgung mit Öl und anderen zur Neige gehenden Rohstoffen bereitet BAYER & Co. zunehmend Sorge, weshalb ihr Druck auf die Politik zunimmt, die Ressourcen-Versorgung sicherzustellen (SWB 1/10). Um dies besser gewährleisten zu können, hat die Bundesregierung im Juni 2010 die „Deutsche Rohstoffagentur“ gegründet.
Tajani besucht BAYER
Der EU-Kommissar für Unternehmen und Industrie, Antonio Tajani von Berlusconis rechtspopulistischem „Haus der Freiheiten“, besuchte im März 2010 den BAYER-Stammsitz Leverkusen. „BAYER macht in der Unternehmensphilosophie und in den Produkten ein starkes Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit deutlich“, zeigte sich der Politiker beeindruckt. In Begleitung des alten BAYER-Bekannten Herbert Reul (CDU), der dem EU-Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie vorsitzt, erörterte Tajani mit Vorständler Wolfgang Plischke und anderen Managern Brüssels neue Industriepolitik-Strategie „Europa 2020“ sowie BAYERs Lieblingsthemen „Patentschutz“ und „Steuererleichterungen für Forschungsleistungen“.
Shouwen Wang besucht Chemie„park“
Im letzten Jahr haben die BAYER-Chemie„parks“ in Leverkusen, Dormagen und Krefeld ein Kooperationsabkommen mit einem chinesischen Pendant, dem „Nanjing Chemical Industry Park“ geschlossen und einen Informationsaustausch, gemeinsame Weiterbildungsaktivitäten sowie eine Überlassung von Beschäftigten vereinbart. Im Rahmen dieses „Joint Ventures“ besuchte der Nanjinger Bürgermeister Shouwen Wang im April 2010 mit zehn chinesischen Managern den Leverkusener Chemie„park“. Gastgeschenke wie Ansiedlungsversprechen chinesischer Betriebe hatte er allerdings nicht im Gepäck.
Schmitt im Dormagener Stadtrat
Bernhard Schmitt ist nicht nur der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende von CURRENTA, dem Gemeinschaftsunternehmen von BAYER und seiner Chemie-Abspaltung LANXESS, er gehört auch dem Dormagener Stadtrat an und sitzt dort der SPD-Fraktion vor.
PROPAGANDA & MEDIEN
BAYER sponsert Kindertheater-Projekt
Im Rahmen des „social sponsoring“ arbeitet der Leverkusener Multi seit längerem mit dem Kinderhilfswerk „Die Arche“ zusammen, das der evangelikalen „Deutschen Evangelischen Allianz“ angehört. Als neuestes Projekt fördert BAYER ein Theater-Angebot für 100 Kinder.
Biodiesel-PR in rumänischer Zeitung
Nicht nur die Sindelfinger Zeitung hat einen PR-Text von DAIMLER, der ein gemeinsam mit BAYER durchgeführtes Biodiesel-Projekt in den höchsten Tönen lobt, ohne Verweis auf die Quelle abgedruckt und ihm dadurch journalistische Weihen verliehen, was der Publikation dank der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN eine Rüge des Presserates einbrachte (SWB 2-3/10). Auch das rumänische Blatt Curierul National hat sich für diese Schleichwerbung hergegeben.
500 Millionen Pfund für Pillenwerbung
Für Pillenwerbung in Europa, Asien und Lateinamerika gibt BAYER jährlich 500 Millionen Pfund aus. Die USA einbezogen, dürfte noch einmal ein erkleckliches Sümmchen dazukommen. Dort ist nämlich Reklame für verschreibungspflichtige Medikamente erlaubt.
BAYER VITAL stockt Werbeetat auf
BAYER VITAL, die für rezeptfreie Arzneien zuständige Abteilung des Leverkusener Multis, hat im letzten Jahr nach Angaben des Fachmagazins Horizont 51,9 Millionen Euro für Reklame ausgegeben, fast 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Nur KLOSTERFRAU und BOEHRINGER INGELHEIM investierten mehr. TV-Werbung und Anzeigen in Publikumszeitschriften schlucken dabei den Löwen-Anteil des Etats. Immer größere Summen fließen jedoch ins Internet. Der Leverkusener Multi platziert fleißig Banner im Umfeld von Gesundheitswebseiten und sorgt dafür, dass GOOGLE vornehmlich BAYER findet. „Suchmaschinen-Marketing“ heißt das im Fachjargon.
Spielend den Blutzucker messen
BAYER will junge DiabetikerInnen mit dem Blutzucker-Messgerät DIDGET zur regelmäßigen Blutkontrolle anregen. Zu diesem Zweck enthält es ein extra für diese Altersgruppe unter den Blutzucker-Kranken entwickeltes Spiel, das NINTENDO-kompatibel ist und für gute Werte und regelmäßige Blutzucker-Checks Bonus-Punkte vergibt.
Ferien bei BAYER
Wenn das keine Alternative zu Sommer, Sonne & Strand ist: „Pünktlich zum Ferien-Start öffnet BAYER CROPSCIENCE für jugendliche Naturwissenschaftsfans sein Schülerlabor „Baylab Plants“, vermeldet die Rheinische Post. Und es haben sich wirklich ein paar Sonnen-AllergikerInnen gefunden, die es auch sonst nicht so mit der Natur haben und meinen, ihr auf die Sprünge helfen zu müssen, indem sie am Erbgut von Pflanzen herumdoktorn und etwa versuchen, Raps zu „verbessern“, damit er als Biokraftstoff besser in die Tanks passt. Über die Risiken und Nebenwirkungen des Agro-Sprits wie die Gefährdung der Ernährungssicherheit durch das Verdrängen von Anbaufläche für Nahrungsmittel-Grundstoffe erfuhren die SchülerInnen während ihrer „Betriebsferien“ natürlich nichts.
TIERE & ARZNEIEN
USA schränken Antibiotika-Gaben ein
BAYERs Geschäft mit dem Tier-Antibiotikum BAYTRIL (Wirkstoff: Fluorchinolon) läuft prächtig. Die ZüchterInnen verabreichen es ihrem Vieh nämlich nicht nur im Krankheitsfall, sondern routinemäßig zur Mast. Die massenhafte Gabe von Antibiotika in der Massentierhaltung birgt allerdings große Gefahren, denn Krankheitskeime können Resistenzen gegen die Mittel ausbilden und - wenn sie in den Nahrungskreislauf gelangen - z. B. schwere Magen/Darm-Infektionen auslösen, gegen die Human-Antibiotika auf Fluorchinolon-Basis wie BAYERs CIPROBAY dann machtlos sind. Aus diesem Grund hat die US-amerikanische Gesundheitsbehörde jetzt die Empfehlung ausgesprochen, BAYTRIL & Co. nur noch bei Gesundheitsschädigungen zu verabreichen.
DRUGS & PILLS
140 YASMIN-Tote
Nach Recherchen des schweizer TV-Magazins 10vor10 hat BAYERs Antibaby-Pille YASMIN in den USA den Tod von 140 Frauen verursacht; YAZ ist für weitere 50 Sterbefälle verantwortlich. 10.000 Spontanmeldungen über unerwünschte Nebenwirkungen von Kontrazeptiva gingen bei der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA binnen der letzten zehn Jahre ein. In der Bundesrepublik starben alleine im letzten Jahr fünf Personen an den Nebenwirkungen von BAYERs Verhütungsmitteln. Für die Pharma-Riesen ist das kein Grund zur Beunruhigung. Spontanmeldungen hätten keine Aussagekraft, wenn es um das Risiko eines Medikamentes ginge, wiegelten die Pillen-Produzenten gegenüber 10vor10 ab und hielten weiter am positiven Nutzen/Risiko-Profil ihrer Produkte fest.
YAZ gegen Regelschmerzen
Ungeachtet der schweren Nebenwirkungen von YASMIN und YAZ (s. o.) sucht BAYER neue Anwendungsmöglichkeiten für die Pillen, da ihr Patent ausgelaufen ist und Nachahmer-Präparate auf den Markt drängen. So hat der Leverkusener Multi in Japan eine Zulassung für YAZ als Mittel zur Behandlung von Regelschmerzen erhalten.
Krebs durch KINZAL?
BAYERs KINZAL (Wirkstoff: Telmisartan) und andere Bluthochdruck-Medikamente aus der Gruppe der Angiotensin-Antagonisten können das Krebsrisiko erhöhen. Das ergab eine Studien-Auswertung der „Case Western Reserve University“ unter Leitung von Ilke Sipahi. Bei ProbandInnen, die Angiotensin-Antagonisten einnahmen, bildeten sich deutlich mehr Tumore heraus als bei Testpersonen, die Betablocker, ACE-Hemmer oder Placebos schluckten. „Als beunruhigend und provokativ“, bezeichnete der Kardiologe Steven Nissen von der „Cleveland Clinic“ die Ergebnisse. Er vermutet, dass diese „Nebenwirkung“ schon in den Klinischen Prüfungen auftrat und fordert BAYER & Co. auf, die entsprechenden Unterlagen öffentlich zu machen.
Gelenk-Probleme durch ADALAT
Blutdruck-Senker aus der Gruppe der Kalzium-Antagonisten wie die BAYER-Mittel ADALAT und BAYMYCARD führen zu Wasserablagerungen und können so - trotz parallel eingenommener Entwässerungsmittel - Arthrosen in den Gelenken verschlimmern und die Herausbildung von offenen Stellen im Knöchelbereich befördern.
XARELTO bei Thrombosen?
Während die US-Behörden immer noch zögern, dem BAYER-Medikament XARELTO die Genehmigung zu erteilen, weil von ihm ein erhöhtes Risiko für Gefäß-Verschlüsse, Blutungen, Herz/Kreislaufstörungen und Leberschäden ausgeht und seine Langzeitwirkung nicht geklärt ist, gab die EU bereits 2009 grünes Licht. Sie ließ die Arznei mit dem Wirkstoff Rivaroxaban zur Thrombose-Vorbeugung bei schweren orthopädischen Operationen zu. Das reicht dem Leverkusener Multi jedoch nicht. Er möchte das Mittel nur allzu gerne als allgemeines Thrombose-Therapeutikum einsetzen und führt auch entsprechende Versuche durch. Im August vermeldete der Konzern einen durchschlagenden Erfolg, woraufhin der Unternehmenswert an den Börse gleich um zwei Milliarden Euro auf 40 Milliarden Euro stieg. Bei Licht besehen bleibt von dem blendenden Resultat allerdings nicht viel übrig, denn die Latte hing nicht sehr hoch. Die Studie war laut BAYER nämlich nur darauf ausgelegt, „bei mehr als 3.400 teilnehmenden Patienten nachzuweisen, dass Rivaroxaban der Vergleichsmedikation nicht unterlegen ist“. Dieses Klassenziel hat XARELTO erreicht, weshalb auf die Krankenkassen in Kürze wieder ein klassisches „Me too“-Produkt zukommen dürfte.
Kein ASPIRIN bei Hautkrebs
Nach einer Studie des australischen „Queensland Institute of Medical Research“ von 2006 senkt BAYERs ASPIRIN die Gefahr, an Hautkrebs zu erkranken. Eine neue Untersuchung, welche die Fachzeitschrift Archives of Dermatology veröffentlichte, bestätigte diesen Befund allerdings nicht. Sie konnte keinen Zusammenhang zwischen der Einnahme von ASPIRIN und einem verminderten Hautkrebs-Risiko erkennen.
Starke VIADUR-Nebenwirkungen
Mehrere Studien haben gefährliche Nebenwirkungen von BAYERs VIADUR und anderen Medikamenten zur Prostatakrebs-Behandlung festgestellt, die mittels Hormonen für eine Schrumpfung der Prostata-Drüse sorgen. Den WissenschaftlerInnen zufolge führten diese Arzneien zu Todesfällen, Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Diabetes. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA kündigte daraufhin genauere Untersuchungen an.
Warnung vor Testosteron-Pillen
Mit großer Anstrengung arbeitet der Leverkusener Multi daran, die „Männergesundheit“ als neues Geschäftsfeld zu etablieren und seinen Potenzpillen und Hormon-Präparaten neue und nur selten zweckdienliche Anwendungsmöglichkeiten zu erschließen. So hat er die Krankheit „Testosteron-Mangel“ erfunden, um seine Hormon-Pillen an den Mann zu bringen, obwohl die Testosteron-Werte von Männern ab 40 nur um ein bis zwei Prozent pro Jahr sinken. Das englische Fachmagazin Drug and Therapeutics Bulletin hat MedizinerInnen jetzt eindringlich davor gewarnt, sich in die Werbe-Maßnahmen einbinden zu lassen. Wegen Nebenwirkungen wie Prostata-Krebs, Harntrakt-Schädigungen oder Brust-Wachstum riet die Publikation zu äußerster Vorsicht beim Verschreiben der Mittel.
BAYER & Co. bezahlen ÄrztInnen
Nach einer Umfrage der Universität Mainz unter ÄrztInnen erhielt im Jahr 2007 jeder zweite der Befragten Zahlungen von der Pharma-Industrie. BAYER & Co. honorierten vor allem die als Wissenschaft getarnten Anwendungsbeobachtungen von Medikamenten, die nur dem Zweck dienen, die PatientInnen auf das getestete Präparat umzustellen. Aber auch für BeraterInnen-Tätigkeiten, Vorträge oder Aufsätze in Fachzeitschriften investierten die Konzerne Geld.
Russland reguliert Pharma-Markt
BAYER ist die Nummer fünf auf dem russischen Pharma-Markt. In Zukunft dürfte der Rubel aber nicht mehr so rollen. Die Regierung will nämlich die Preise regulieren und dabei den einheimischen Pillen-Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschaffen. Den Global Playern bleibt also nur, künftig vor Ort zu produzieren oder aber Allianzen mit russischen Firmen einzugehen.
Chinas Pharma-Markt wächst
China eifert den USA nach und integriert mehr Menschen in das Krankenversicherungssystem. Dem Leverkusener Multi wachsen so 200 Millionen neue KundInnen zu, die der Konzern binnen der nächsten fünf Jahre mit 20 neuen Arzneien begrüßen will. Der Chef von BAYERs chinesischer Pharma-Sparte, Chris Lee, rechnet mit einem Pillen-Markt, dessen Volumen sich von heute bis zum Jahr 2020 fast um das Zehnfache auf 220 Milliarden Dollar vergrößern wird.
Indiens Pharma-Markt wächst
Der Leverkusener Multi rechnet mit stark wachsenden Pillen-Umsätzen in Indien. Bei Steigerungsraten von jährlich 14 Prozent prognostiziert der Konzern für 2012 ein Markt-Volumen von 82 Milliarden Dollar (2007: 42 Milliarden). Darum hält er nach günstigen Zukäufen Ausschau und verdreifacht die Zahl seiner Pharma-ReferentInnen.
PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE
Endgültiges Aus für Tolylfluanid
Vor drei Jahren hatte das „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit“ (BVL) die Zulassung für BAYERs Pestizid-Wirkstoff Tolylfluanid ausgesetzt, den der Agro-Riese unter den Produkt-Namen EUPAREN M WG, FOLICUR EM und MELODY MULTI vermarktet (Ticker 2/07), da die Substanz bei der Trinkwasser-Aufbereitung ultragiftige Stoffe bilden kann. Benutzen die Wasserwerke bei der Reinigung nämlich Ozon, so kann es mit einem Abbauprodukt von Tolylfluanid reagieren und auf diesem Weg das gesundheitsgefährdende Nitrosamin produzieren. Diese Sachlage bewog die EU jetzt, die Agro-Chemikalie ganz zu verbieten.
Aldicarb raus aus USA
Das BAYER-Pestizid Aldicarb, vermarktet unter dem Namen TEMIK, gehört als Organophosphat zur Gefahrenklasse 1a - und damit zur höchsten. Die EU hat das Ackergift deshalb schon im Jahr 2007 aus dem Verkehr gezogen, wogegen der Leverkusener Multi sich mit Händen und Füßen gewehrt hatte. Die US-amerikanische Umweltbehörde EPA sieht jetzt ebenfalls Handlungsbedarf, weil die Agro-Chemikalie die Lebensmittel-Sicherheit gefährdet. Sie gewährte dem Agro-Riesen jedoch noch eine Gnadenfrist bis Ende 2014.
Alt-Pestizide in Nepal
In den vergangenen Jahrzehnten haben die Agro-Multis - gefördert von „Entwicklungshilfe“-Programmen - „Drittweltländer“ großzügig mit Ackergiften versorgt. Die Folge: Nach Schätzungen der Welternährungsorganisation der UN lagern dort über eine halbe Million Tonnen Alt-Pestizide, schlecht gesichert in lecken Behältern, zerrissenen Tüten und geplatzten Säcken. Altlasten made by BAYER sind nach GREENPEACE-Angaben in rund 20 Ländern vertreten. Unter anderem auch in Nepal. Vor neun Jahren begann die Umweltorganisation dort, Bestände zu sichern (SWB 4/01). Methyl Parathion, Solbar und Quecksilberchlorid aus den Werken des Leverkusener Multis verpackten die Umweltschützer zusammen mit Ackergiften anderer Firmen transportfertig in Spezialfässer. Aber immer noch ticken in dem Land chemische Zeitbomben. Im Moment setzt gerade die Asien-Sektion des PESTIZID-AKTIONS-NETZWERKs (PAN) die Arbeit von GREENPEACE fort und füllt Agro-Chemikalien von BAYER & Co. in dickwandige Behältnisse um.
Weniger Pestizide verkauft
Im Jahr 2009 schlug die Wirtschaftskrise auch auf den Pestizid-Markt durch, der um ca. zehn Prozent auf 37,7 Milliarden Dollar schrumpfte. Die Erlöse von BAYER CROPSCIENCE vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen gingen deshalb um 5,9 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro zurück.
GAUCHO & Co. noch gefährlicher
Eine Untersuchung des niederländischen Toxikologen Dr. Henk Tennekes stellt den beiden Pestizid-Wirkstoffen Imidacloprid (enthalten in BAYERs GAUCHO) und Thiacloprid (Produktname: PROTEUS) ein noch schlechteres Gesundheitszeugnis aus als frühere Studien. „Das Risiko von Pestiziden wie Imidacloprid und Thiacloprid wird wahrscheinlich enorm unterschätzt, besonders für Wasserlebewesen und Bodenorganismen. Die bislang gültigen Grenzwerte wurden weitgehend aus Kurzzeit-Tests abgeleitet. Würde man Langzeit-Versuche durchführen, könnten schon bei wesentlich geringeren Konzentrationen verheerende Schäden auftreten. Damit kann erklärt werden, wieso schon geringe Mengen Imidacloprid längerfristig Bienensterben verursachen können“, so der Wissenschaftler. Der Wissenschaftler zeigte sich äußerst besorgt über die hohen Ackergift-Konzentrationen in Oberflächen-Gewässern. So ergaben Messungen der niederländischen Umweltbehörde Imidacloprid-Belastungen weit oberhalb des EU-Grenzwertes für Trinkwasser von 0,1 µg/l pro Liter (µg/l): Bis zu 320 Mikrogramm pro Liter wiesen die BeamtInnen nach.
BAYER kritisiert Pestizid-Gesetz
Im Jahr 2009 hat die EU eine strengere Pestizid-Verordnung verabschiedet. Nach der neuen Regelung erhalten mit Glufosinat, Carbendazim, Mancozeb, Tebuconazole, Bifenthrin und Thiacloprid sechs Wirkstoffe, die auch in BAYER-Mitteln enthalten sind, keine Zulassung mehr. Der Leverkusener Multi ist darüber not amused. Er wirft der Europäischen Union eine „Überinterpretation des Vorsorge-Prinzips“ vor und sieht die Produktivität der Landwirtschaft wegen angeblichen Giftmangels schwinden.
Krebs durch BAYGON
In der Chiapas-Region hat die indigene Bevölkerung 2004 BAYERs Agrochemikalie BAYGON (Wirkstoff: Lindan) dazu benutzt, um die Kopfläuse ihrer Kinder zu behandeln, was zu einer deutlich gestiegenen Krebsrate geführt hat.
Bauernsterben durch Endosulfan
Jahrelang hat die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN den Leverkusener Multi aufgefordert, den in der Bundesrepublik schon längst verbotenen besonders gefährlichen Pestizid-Wirkstoff Endosulfan auch in anderen Ländern nicht mehr zu vertreiben. Im letzten Jahr erklärte sich der Konzern endlich dazu bereit (SWB 3/09). Aber vorher gab es noch einmal eine Überdosis Chemie. Das Unternehmen warf alle Restbestände auf den Markt, was zu hohen Belastungen führte. Besonders hart traf es brasilianische Bio-LandwirtInnen. Ihre Soja-Ernte weist so große Endosulfan-Rückstände auf, dass sie unverkäuflich ist. 300 Bauern und Bäuerinnen droht deshalb die Pleite.
Moskito-Netze mit Deltamethrin
BAYER hat Moskito-Netze entwickelt, in deren Fasern der Pestizid-Wirkstoff Deltamethrin eingearbeitet ist. Das soll die Mücken, die Malaria übertragen, unschädlich machen. Allerdings bergen die „Life-Nets“ mit ihrem nicht abgeschirmten textilen Gift-Reservoir auch selber Gesundheitsgefahren, besonders für Kinder.
Pyrethroide im Blut
Eine neue US-amerikanische Untersuchung stellte eine hohe Belastung der Bevölkerung durch Insektizide auf Pyrethroid-Basis fest. So fanden sich in 70 Prozent der Urin-Proben Spuren von Mitteln wie BAYERs BAYTHROID oder BULLDOCK; bei Kindern waren die Konzentrationen besonders hoch. Welche Gesundheitsgefahr von den Stoffen ausgeht, legte 2008 eine Studie der US-amerikanischen Umweltbehörde EPA dar (Ticker 3/08). Die Expertise machte die Pyrethroide für 20 Todesfälle und 22.500 zum Teil schwerwiegende Vergiftungen zwischen 1997 und 2007 verantwortlich.
ADHS durch Pestizide?
Eine neue Untersuchung von Maryse F. Bouchard und anderen ForscherInnen hat einen Zusammenhang zwischen erhöhter Pestizid-Belastung und der Anfälligkeit für die Aufmerksamkeitsdefizit-Störung ADHS festgestellt. So erhöht sich für Kinder mit auffälligen Agrochemie-Konzentrationen im Urin die Gefahr, an ADHS zu erkranken, um mehr als 50 Prozent.
Chlorpyrifos-Belastungen in Ägypten
Pestizide sind Nervengifte und können deshalb neurologische Gesundheitsschäden verursachen. Solche weisen nach einer neuen Untersuchung Beschäftigte im ägyptischen Baumwollanbau auf. Die ForscherInnen führten das auf den Pestizid-Wirkstoff Chlorpyrifos zurück, der auch in den BAYER-Produkten BLATTANEX, PROFICID und RIDDER enthalten ist. Die Chlorpyrifos-Werte der LandarbeiterInnen überschritten die Hintergrund-Belastung der US-Bevölkerung um das 1.300fache.
GENE & KLONE
LIBERTY ist überall
BAYERs genmanipulierter Raps LIBERTY LINK, der gegen das Unkrautmittel Glufusinat immun ist, hat sich in den USA weitflächig ausgekreuzt. An Straßenrändern weitab von den Gentech-Feldern untersuchten ForscherInnen 406 wild wachsende Rapspflanzen, und in nicht weniger als 347 von ihnen stießen sie auf Resistenzen gegen Glufosinat und/oder MONSANTOs Glyphosat. Vor solch einer unkontrollierten Ausbreitung hatten Gentechnik-GegnerInnen immer wieder gewarnt, aber Wirtschaft und Politik blieben tatenlos.
Kein Genreis in Brasilien
Im Jahr 2006 war gentechnisch veränderter Langkorn-Reis von BAYER weltweit in Supermärkten aufgetaucht, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nirgendwo eine Zulassung vorlag. Damit verursachte der Leverkusener Multi den größten Gen-Gau der Nuller-Jahre. Trotzdem hält er unverdrossen an seinem Labor-Reis fest. In Brasilien musste der Konzern sich jetzt aber dem Widerstand von LandwirtInnen, VerbraucherInnen und UmweltschützerInnen beugen: Er zog wegen der „Notwendigkeit, den Dialog mit den Hauptbeteiligten der Reis-Produktionslinie in Brasilien zu erweitern“ den Genehmigungsantrag für die gegen das hochgefährliche Herbizid Glufosinat (Produktname: LIBERTY) resistente Sorte „LL62“ vorerst zurück.
Abkommen mit SYNGENTA
Der Leverkusener Multi kann seine Baumwoll-Pflanzen bald mit neuen Genen bestücken. Er hat von SYNGENTA eine Lizenz zur Nutzung zweier Proteine erworben, die gegen den Baumwollkapselbohrer und die Tabakknospen-Eule wirken sollen.
Mehr Schadinsekten durch Bt-Pflanzen
BAYER & Co. bauen in ihre Laborfrüchte gern das Gift-Gen des Bacillus thuringiensis ein, um Schadinsekten zur Strecke zu bringen. Nach einer Langzeit-Studie chinesischer WissenschaftlerInnen sieht die Bilanz allerdings nicht so gut aus. Die ForscherInnen untersuchten Felder mit Bt-Baumwolle und stellten zwar eine abnehmende Zahl von Maiszünslern fest, dafür aber eine Zunahme von Weichwanzen und anderen Organismen.
Gen-Versuche im Müritzkreis
Im Müritzkreis, wo jetzt Freisetzungsversuche mit der BASF-Kartoffel AMFLORA stattfinden, haben nach Informationen der BI MÜRITZREGION - GENTECHNIKFREI WissenschaftlerInnen in der Vergangenheit auch gentechnisch manipulierte Raps- und Kartoffelsorten von BAYER getestet.
Kein NEXAVAR bei Lungenkrebs
BAYERs extrem teure und das Leben von Nieren- und Leberkrebs-PatientInnen nur minimal verlängernde Gentech-Arznei NEXAVAR (siehe auch SWB 4/10) scheitert bei immer mehr Versuchen, das Anwendungsspektrum zu erweitern. Nach negativ verlaufenden Tests bei Haut- und Bauchspeicheldrüsenkrebs kam jetzt auch das Aus bei Lungenkrebs.
WASSER, BODEN & LUFT
Pestizide belasten Gewässer
Dem Bewirtschaftungsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für seine Gewässer zufolge belasten Pestizide die Flüsse immer noch massiv. Zahlreiche Pestizid-Wirkstoffe, die auch in BAYER-Ackergiften enthalten und teilweise gar nicht mehr zugelassen sind, verletzten die Umweltqualitätsnorm. So überschritten die Werte für Endosulfan, Diuron, Dichlorprop, Fenthion, MCPA, Mecoprop, Diazinon und Glyphosat mehrmals im Jahr das Limit. Diese Belastungssituation entspricht nicht den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Deshalb will die Politik auch auf Zeit spielen und die Umsetzung verzögern. „Viele Maßnahmenträger haben bei genereller Zustimmung zu den Bewirtschaftungszielen Finanzierungs - und Planungsvorbehalte vorgetragen“, heißt es in dem noch von Umweltminister Eckhard Uhlenberg verantworteten Bericht, weshalb „Fristverlängerungen vorgesehen sind“.
Bisphenol A belastet den Rhein
BAYER ist einer der größter Hersteller der Industrie-Chemikalie Bisphenol A, die unter anderem in Baby-Flaschen und Konservendosen Verwendung findet und zu Schädigungen des Nervensystems, Übergewicht, Unfruchtbarkeit, Diabetes sowie Herz- und Lebererkrankungen führen kann (siehe SWB 4/10). Zu allem Unglück verunreinigt die Substanz laut Bewirtschaftungsbericht des NRW-Umweltministeriums auch den Rhein, wobei die Konzentration an mehreren Messstellen sogar die Orientierungswerte - Grenzwerte gibt es für den Stoff nicht - überschritten hat.
Jede Menge Kohle
Bei der Strom-Gewinnung setzt BAYER immer noch sehr stark auf die klima-schädliche Kohlekraft. An der Gesamtsumme der erzeugten Energie von 48.124 Terajoule hatte die Steinzeit-Technologie 2009 mit 17.000 Terajoule hinter Erdgas mit 29.400 Terajoule den größten Anteil.
8,1 Millionen Tonnen Kohlendioxid
Trotz markanter Produktionsdrosselungen infolge der Wirtschaftskrise hat BAYER 2009 den Kohlendioxid-Ausstoß kaum minimieren können. Er betrug 8,1 Millionen Tonnen und sank damit gegenüber dem Vorjahr nur um 0,56 Millionen Tonnen. Mit 4,83 Millionen Tonnen hatte BAYER MATERIAL SCIENCE den größten Anteil daran.
Antwerpen: Anhörung wg. Kraftwerk
Der Energie-Riese E.ON will auf dem Antwerpener Werksgelände von BAYER das größte Kohlekraftwerk der Benelux-Staaten errichten. Der Rat der Stadt hatte sich wegen der Emission klimaschädlicher Gase und gesundheitsgefährdender Stoffe allerdings gegen das Mammutprojekt ausgesprochen. Darum kam es jetzt zu einer Anhörung. Dabei hat E.ON zwar angeboten, den avisierten CO2-Ausstoß in Höhe von sechs Millionen Tonnen etwas zu drosseln, das Projekt aber für unabdingbar erklärt, weil sonst das BAYER-Werk in seinem Bestand gefährdet wäre. Eine solche Horrorvision entwarf Konzern-Chef Werner Wenning auf der letzten Hauptversammlung im April 2010 nicht. Seiner Ansicht nach fällt das Bau-Vorhaben von E.ON nicht in seinen Zuständigkeitsbereich. Zudem deutete das Unternehmen an, zur Not auch mit einem umweltfreundlichen Gas/Dampf-Kraftwerk leben zu können.
Kraftwerk: Dachau beteiligt sich nicht
Hinter TRIANEL, dem Bauherrn des auf dem Gelände von BAYERs Chemie„park“ in Krefeld geplanten Kohlekraftwerkes, stehen 47 Stadtwerke aus der Bundesrepublik, der Schweiz und Österreich. Im Falle des am Standort des Global Players anvisierten Projektes allerdings nicht so ganz. In Dachau hat ein Bürgerentscheid sich nämlich gegen die Beteiligung der örtlichen Stadtwerke an dem Bau ausgesprochen, woraufhin diese den Vertrag mit TRIANEL kündigten.
Modernes Kraftwerk in Leverkusen
Auch am BAYER-Standort Leverkusen stand kurz die Errichtung eines Kohlekraftwerks zur Diskussion. Der Multi hat sich jedoch eines Besseren belehren lassen und baut jetzt ein umweltschonendes Gas/Dampf-Kraftwerk. Warum nicht gleich so, und warum nicht auch woanders?
BAYER produziert mehr FCKW
2009 stieg bei BAYER die Produktion von FCKW und anderen ozon-abbauenden Stoffen um zwei Prozent auf 17,5 Tonnen. Abermals trägt die Hauptverantwortung dafür das Werk im indischen Vapi. Dessen bereits 2008 angekündigte Modernisierung will der Leverkusener Multi nun stufenweise durchführen und bis 2015 beendet haben.
Weniger Stickstoffoxid-Emissionen
Im Jahr 2009 hat BAYER mit 3,5 Tonnen 400 Kilogramm weniger Stickstoffoxid in die Luft geblasen als im Vorjahr. Die Werte für Kohlenmonoxid gingen um 300 Kilogramm auf 1,4 Tonnen zurück und die für Schwefeloxide um 400 Kilogramm auf 2,8 Tonnen. Die Feinstaub-Emissionen verharrten dagegen unverändert bei 200 Kilogramm.
Wasser-Belastung konstant hoch
Nur „konjunkturell bedingt“ sank dem Leverkusener Multi zufolge die Wasser-Belastung durch seine Werke im Jahr 2009 etwas. Diese leiteten 726 Tonnen anorganischer Salze in die Flüsse ein (2008: 812 Tonnen), 1,35 Tonnen Kohlenstoff (2008: 1,59 Tonnen), 740 Kilogramm Phosphor (2008: 780 Kilogramm), 640 Kilogramm Stickstoff (2008: 670 Kilogramm) und neun Kilogramm Schwermetall (2008: 10,4 Kilogramm).
Weniger, aber gefährlicherer Abfall
Im Jahr 2009 hat der Leverkusener Multi 914.000 Tonnen Abfall produziert, 163.000 Tonnen weniger als 2008. Dafür stieg aber der Anteil gefährlicher Hinterlassenschaften von 365.000 auf 375.000 Tonnen. Das Ziel, die Menge der gesundheitsschädlichen Rückstände auf 2,5 Prozent pro Tonne Verkaufsprodukt zu senken, hat der Leverkusener Multi damit verfehlt. Er macht dafür den 2006 erfolgten Erwerb von SCHERING, die ausgeweitete Pestizid-Produktion sowie - paradoxerweise - den Mengenrückgang bei der Kunststoff-Herstellung verantwortlich, der laut BAYER „das Verhältnis von gefährlichem Abfall zur Produktionsmenge weiter verschlechtert hat“.
CO & CO.
Kontroverse um Alarmplan
Das „Worst Case Scenario“ des Leverkusener Multis für einen Pipeline-Unfall stößt auf große Kritik (Ticker 2/3-10). René Schubert von der Ratinger Feuerwehr etwa prangerte die mangelhafte Ausstattung der Schieberstationen an, so habe das Unternehmen aus Kostengründen auf die Installation von Windmessern verzichtet, weshalb die Feuerwehr bei einem GAU auf den Wetterdienst angewiesen sei. Zudem kalkulierten die Hochrechnungen zum möglichen Umfang eines Gas-Austrittes extreme Wetterlagen nicht ein, so Schubert. Dieses monierte auch der Kreis Mettmann. Zudem sahen die Verantwortlichen nicht ein, warum von einem Zwischenfall zunächst BAYER und dann erst die betroffenen Regionen erfahren sollen. Den Regierungspräsident Jürgen Büssow störten die Bedenken nicht weiter. Er erklärte die Arbeit an dem Gefahrenabwehrplan kurzerhand für beendet. Nur eine Abstimmung der Landkreise mit der Bezirksregierung sei zu seiner Absegnung erforderlich, nicht aber ihre Zustimmung, stellte Büssow klar. Erst nach massiven Protesten an seiner gutsherrlichen Art bequemte er sich dazu, den Mettmanner Landrat Thomas Hendele noch einmal zu einem Meinungsaustausch zu treffen.
Vassiliadis für CO-Pipeline
Michael Vassiliadis, Chef der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE, hat sich die Argumente BAYERs in Sachen „Kohlenmonoxid-Pipeline“ zu Eigen gemacht und warnt vor einem Scheitern des Projektes. „Das würde die Attraktivität des Standortes deutlich verringern. Zug um Zug würden Produktionsanlagen unter Druck geraten und irgendwann verlagert“, drohte er in einem Interview mit der Rheinischen Post.
Treffen mit BAYER ohne Ergebnis
Anfang Juni 2010 haben sich VertreterInnen von Anti-Pipeline-Initiativen mit Emissären von BAYER getroffen. Zu einem konkreten Ergebnis führten die Gespräche allerdings nicht. „In den grundsätzlichen Fragen und in der Bewertung von Alternativen konnte keine Annäherung erreicht werden“, erklärte der Leverkusener Multi nach dem Meeting.
NANO & CO.
Bezirksregierung antwortet
BAYER betreibt in Leverkusen und in Laufenburg Versuchsanlagen zur Fertigung von Nano-Kohlenstoffröhrchen. Die Winzlinge können ungeahnte Folgen für Mensch, Tier und Umwelt haben. So gibt es beispielsweise Hinweise auf eine asbest-ähnliche Wirkung. Trotzdem haben die Verantwortlichen die Fertigungsstätten mit der Begründung, es handele sich nur um Test-Betriebe, in vereinfachten Verfahren ohne Umweltverträglichkeitsprüfungen genehmigt. Ein bereits abgeschlossener Liefervertrag mit der HIRTENBERGER PROSAFE SAFETY TECHNOLOGY GmbH und Aussagen von BAYER wie „Durch die Inbetriebnahme der weltgrößten Pilotanlage für BAYTUBES mit einer Kapazität von 200 Jahrestonnen kommt BAYER MATERIAL SCIENCE der großen Nachfrage einen erheblichen Schritt entgegen“, wecken allerdings Zweifel am Status der Fabriken. Und die Antwort der Kölner Bezirksregierung auf eine entsprechende Anfrage der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) vermochte diese auch nicht auszuräumen. Die Behörde schrieb zum Laufenburger Werk nämlich: „Nach Mitteilungen des Regierungspräsidiums Freiburg und der Fa. HC STARCK werden die in der CNT-Versuchsanlage seit 2007 bis heute hergestellten Carbon-Nanotubes (...) für Anwendungstests an Dritte veräußert“.
USA genehmigen BAYTUBES
Die US-amerikanische Umweltbehörde EPA hat BAYER eine Genehmigung zur Vermarktung seiner Nano-Röhrchen mit dem Produktnamen BAYTUBES (s.o.) erteilt, obwohl von den Winzlingen erhebliche Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt ausgehen können.
BAYTUBES in Flugzeugen
Obwohl BAYER seine BAYTUBES noch gar nicht vermarkten darf (s.o.), häufen sich die Meldungen über Geschäftsabschlüsse. So wurde der Leverkusener Multi mit SOLAR IMPULSE handelseinig und rüstet den Akku eines per Sonnenenergie betriebenen Flugzeugs mit Nano-Röhrchen aus.
PLASTE & ELASTE
Kunststoff in Sonnencremes
Auf der Suche nach neuen Vermarktungsmöglichkeiten für seine Kunststoffe hat der Leverkusener Multi Sonnencremes entdeckt. Ein bisschen Plaste in die Tube, und schon erhöht sich der Sonnenschutzfaktor - das wollen BAYER-ForscherInnen im Labor herausgefunden haben. Darüber hinaus plant der Konzern mit seinen Polyurethanen auch die Haftkraft von Wimperntusche und Make-Ups zu verstärken und Haaren mehr Halt zu verleihen (Ticker 1/09). Die Kunststoff-Nebenwirkungen wie Krebs, Allergien oder Schädigungen der Atmungsorgane stören bei diesem Business-Plan nicht.
IMPERIUM & WELTMARKT
Peterson folgt auf Berschauer
Die seit 2005 beim Leverkusener Multi beschäftigte US-Amerikanerin Sandra E. Peterson übernimmt den BAYER-CROPSCIENCE-Vorsitz von Friedrich Berschauer, der in Ruhestand geht. Mit den bundesdeutschen Verhältnissen ist Peterson trotz ihrer Herkunft bestens vertraut. Die ehemalige Unternehmensberaterin von MCKINSEY machte ihren College-Abschluss mit einer Untersuchung über die bundesdeutsche Chemie-Industrie und arbeitete im Rahmen eines Stipendiums der Robert-Bosch-Stiftung 1984/85 beim „Bundesverband der Deutschen Industrie“ und im Bundesfinanzministerium.
Reinhardt folgt auf Higgins
Der NOVARTIS-Manager Jörg Reinhardt übernimmt den BAYER-HEALTHCARE-Vorsitz von Arthur Higgins, der sich Hoffnungen auf den Posten des Vorstandsvorsitzenden gemacht hatte und nach der Nominierung von Marijn Dekkers kündigte.
Weintritt folgt auf Stegmüller
Volker Weintritt wird neuer Leiter des Brunsbütteler BAYER-Werkes. Sein Vorgänger Roland Stegmüller wechselt nach China und übernimmt den Chefposten der Shanghaier Niederlassung.
BTS-Regionalbüro in Singapur
BAYER TECHNOLOGY SERVICES (BTS), die hauptsächlich für den Anlagenbau zuständige BAYER-Sparte, richtet seit einiger Zeit rund um den Globus Regionalbüros ein. So entstanden neue Repräsentanzen in Mumbai und Singapur, weitere will BTS schon bald in Brasilien und Russland eröffnen.
Kooperation mit EQUITY
Beim Leverkusener Multi haben die Störfälle im letzten Jahr markant zugenommen (s. u.). Mit der haus-eigenen BAYKBIS-Software zur Inspektion von Industrie-Anlagen kann es also nicht allzu weit her sein. Sie ist offensichtlich nicht in ausreichendem Maße fähig, Schwachpunkte zu identifizieren. Trotzdem vermarktet der Konzern die Technologie großflächig und versucht Kunden aus der Öl-, Pharma-, Chemie oder Gasbranche zu gewinnen. Im März hat er nun ein Kooperationsabkommen mit einem anderen Hersteller von solchen Programmen unterzeichnet, der EQUITY ENGINEERING GROUP. Deren „API RBI-Software ist der industrielle Standard im Bereich Anlagen-Risikomanagement“, heißt es in der entsprechenden Pressemeldung. Jetzt wollen BAYER und EQUITY die beiden Systeme kombinieren und damit auch die Anforderungen an risiko-basierte Inspektionen (RBI) erfüllen, die das „American Petroleum Institute“ 1993 für Sicherheitschecks von Anlagen der Öl- und Chemie-Industrie formuliert hat. Das Institut dürfte seine Ansprüche allerdings noch einmal überprüfen, denn offensichtlich haben sie nicht ausgereicht, um die Öl-Katastrophe im Golf von Mexiko zu verhindern.
UNFÄLLE & KATASTROPHEN
Mehr Störfälle
Die Zahl der Störfälle bei BAYER hat 2009 markant zugenommen. Der Nachhaltigkeitsbericht listet für das Jahr mehr Unfälle auf, als bisher bekannt wurden und verzeichnet 13 „Umweltereignisse“, bei denen es zu einem Austritt gefährlicher Substanzen kam. Im Vorjahr waren es „nur“ neun.
Phosgen-Austritt in Dormagen
Im Dormagener Werk trat nicht bloß am 27.11.09, sondern bereits am 14.1.09 Phosgen aus. Um zu verhindern, dass die hochgiftige Chemikalie an die Luft gerät, musste der Leverkusener Multi eine Dampfwand aus - ebenfalls gesundheitsschädlichem - Ammoniak aufziehen.
LKW-Unfall in Kanada
Am 12.3.09 verunglückt in Kanada ein mit BAYER-Pestiziden b