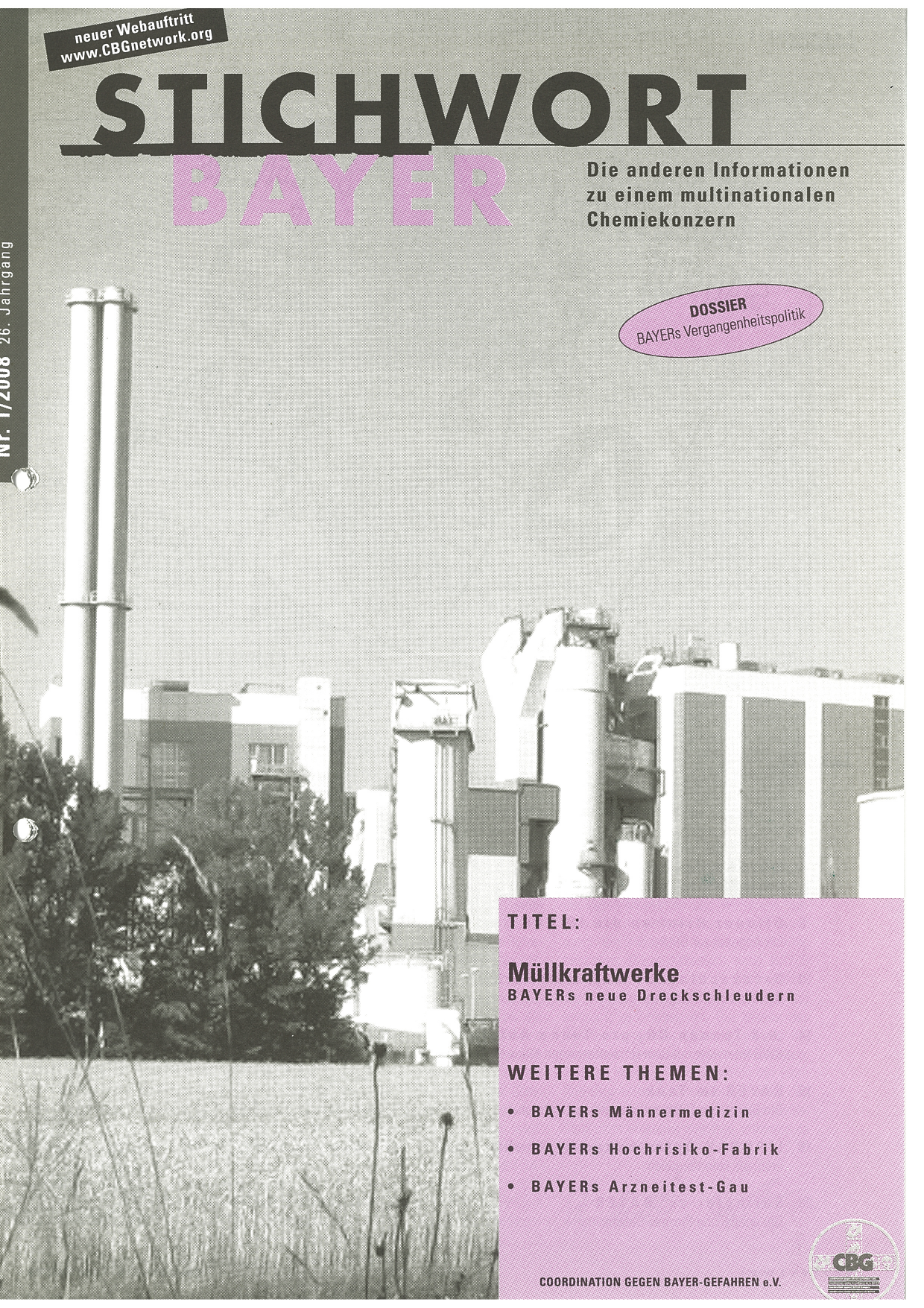Kurzmeldungen Ticker
AKTION & KRITIK
Pipeline-Demo in Erkrath
Der Protest gegen BAYERs umstrittene Kohlenmonoxid-Leitung reißt nicht ab. An zahlreichen Bauabschnitten halten die CO-GegnerInnen Mahnwachen ab, und am 13. März 2008 demonstrierten in Erkrath 500 Menschen gegen das Projekt. Der Protestmarsch, an dem LokalpolitikerInnen aller Parteien, Angehörige verschiedener Initiativen und natürlich auch VertreterInnen der COORDINATION gegen BAYER-Gefahren teilnahmen, führte von der Erkrather Innenstadt bis zur Pipeline-Baustelle, wo die TeilnehmerInnen 420 Holzkreuze mit Grablichtern aufstellten, um so auf die tödliche Gefahr durch den Röhren-Verbund aufmerksam zu machen.
CBG bei Pipeline-Veranstaltung
Ende Februar nahm CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes auf Einladung der DÜSSELDORFER BÜRGERINITIATIVE GEGEN DIE BAYER-GIFTGAS-LEITUNG gemeinsam mit VertreterInnen von anderen Gruppen und Parteien in Düsseldorf-Unterbach an einer Diskussionsveranstaltung zur umstrittenen BAYER-Pipeline teil.
Romy Quijano freigesprochen
Dr. Romy Quijano untersuchte in Kamukhaan auf den Philippinen die Risiken und Nebenwirkungen der auf einer Bananen-Plantage ausgebrachten Pestizide von BAYER und anderen Herstellern. Der Bananenbaron vom Unternehmen LADECO wollte den Wissenschaftler daraufhin mundtot machen und verklagte Quijano. Dabei schreckte der Plantagen-Besitzer nicht einmal davor zurück, DorfbewohnerInnen mit Bestechungsgeldern zu Aussagen gegen Romy Quijano zu veranlassen; es kam sogar zu Todesdrohungen. Im Jahr 2008 endete die juristische Auseinandersetzung nach sieben Jahren endlich mit einem Freispruch. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN, die sich seit Jahren an einer Solidaritätskampagne für den Umweltschützer beteiligt, gratulierte Romy Quijano umgehend zu seinem Erfolg.
Ter Meer ohne Grabschmuck
Alle Jahre wieder zu Allerheiligen schmückt BAYER das Grab des ehemaligen IG-FARBEN-Vorstandsmitglieds und Kriegsverbrechers Fritz ter Meer mit einem großen Kranz. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN protestiert seit Jahren gegen die Ehrung eines Mannes, den die Richter im Nürnberger IG-FARBEN-Prozess wegen seiner Verantwortung für Zwangsarbeit und Plünderungen zu sieben Jahren Haft verurteilt hatten. Das hat jetzt offensichtlich Wirkung gezeigt: Im letzten Jahr verzichtete der Leverkusener Multi zum ersten Mal auf diese Art der Traditonspflege.
CBG schreibt Gabriel
Das Bundesumweltamt unterhält zwar ein Störfall-Register, aber nähere Angaben zu den Betreibern der explosiven Anlagen finden sich darin nicht. Dieses kritisierte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) in einem Brief an Bundesumweltminister Sigmar Gabriel. „Mit dieser Art der Anonymisierung sind wir in keinster Weise einverstanden! Sie begünstigt in unangemessener Weise die Verursacher von Schäden gegenüber der Öffentlichkeit und den Betroffenen. Da die Unternehmen von sich aus kaum oder gar nicht über Unfälle berichten, haben Medien und Umweltverbände keine Möglichkeit, eine Störfall-Bilanz einzelner Firmen zu erstellen. Hierdurch könnte Druck auf die Unternehmen ausgeübt werden, ihre Sicherheitslage zu verbessern“, schrieb die CBG.
Genreis: CBG schreibt Bundesregierung
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN, das GEN-ETHISCHE NETZWERK, der BUND und andere Initiativen haben die Bundesregierung in einem Offenen Brief aufgefordert, sich auf EU-Ebene gegen eine Importzulassung von BAYERs Genreis auszusprechen, der - obwohl noch gar nicht zugelassen - im Jahr 2006 aus ungeklärter Ursache massenhaft in Haushaltsreis von ALDI und anderen Anbietern gelangt war. „Für über 2,5 Milliarden Menschen ist Reis das wichtigste Grundnahrungsmittel. Die Europäische Union darf sich nicht über die ökologischen und sozialen Risiken von LL RICE 62 in den potentiellen Anbau-Ländern hinwegsetzen. Wir fordern Sie auf, sich bei der EU gegen eine Import-Zulassung von LIBERTY LINK-Reis auszusprechen!“, heißt es in dem Schreiben wörtlich.
Kartelle: CBG schreibt Zypries
In Sachen „Kartelle“ entwickelt BAYER sich immer mehr zum Serientäter. Allein in den letzten Jahren haben die Behörden elf Fälle von illegalen Preisabsprachen entdeckt. Die hohen Bußgelder - der Konzern zahlte bislang ca. 500 Millionen Dollar - schrecken den Leverkusener Multi offenbar nicht ab. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) forderte Bundesjustiziministerin Brigitte Zypries deshalb in einem Offenen Brief auf, die ManagerInnen-Haftung einzuführen. „Es stellt unserer Meinung nach eine gesetzgeberische Fehlleistung ersten Ranges dar, dass Verstöße gegen Kartellvorschriften nur mit Bußgeldern und evtl. zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen belegt sind, nicht hingegen mit Strafen. Angesichts der Gemeinschädlichkeit derartiger Absprachen und des dadurch verursachten enormen Schadens stimmt es merkwürdig, dass nicht einmal in schweren Fällen Straftaten vorliegen. Wir fordern daher den Gesetzgeber auf, entsprechende Straftatbestände zu schaffen. Erst wenn die verantwortlichen Manager Gefängnisstrafen fürchten müssen, kann von einem abschreckenden Effekt ausgegangen werden“, stellt die CBG fest.
BAYER für „Public Eye Award“ nominiert
Alljährlich halten die Global Player im schweizerischen Davos ihr Klassentreffen ab. Die Schweizer Initiativen ERKLÄRUNG VON BERN und PRO NATURE nutzen die Gelegenheit, um als Spielverderber dem Unternehmen mit den fragwürdigsten Geschäftspraktiken den „Public Eye Award“ zu verleihen. Zu den Vorgeschlagenen zählte auch dieses Mal wieder: BAYER. Das FORUM FÜR UMWELT UND ENTWICKLUNG, das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK und die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN nominierten den Leverkusener Multi für seine Versuche, die Jatropha-Pflanze als Biotreibstoff-Reservoir zu nutzen und dazu auch gleich noch das passende Saatgut und die passenden Pestizide zu liefern. „Das Saatgut und die Pflanzenschutzmittel für Jatropha sollen die Pflanze für den Chemiekonzern und die Automobilindustrie profitabel machen. Verlierer sind einmal mehr die Bauern der südlichen Länder. Sie verlieren wertvolles, zur Nahrungsproduktion genutztes Land und tragen die Umweltbelastungen durch den intensiven Agrotreibstoff-Anbau. Zudem werden die Kleinbauern im Vertragsanbau abhängig gemacht von den teuren Agrochemie-Produkten“, heißt es in der Begründung der Gruppen.
CBG-Mitglied wg. Feldbesetzung verurteilt
Ein in Frankreich lebendes Mitglied der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hat an der Besetzung eines Genfeldes teilgenommen und kam dafür vor Gericht. Die Richterin verurteilte es zu einer Strafe von 1.000 Euro.
Prozess wg. Feldbesetzung
Im letzten Frühjahr führten Gentech-GegnerInnen die Besetzung eines Feldes durch, auf dem die Universität Gießen zu Versuchszwecken Gerste mit einer eingebauten Resistenz gegen Glufosinat ausgesät hatte, mit welcher BAYER auch die Pflanzen aus der LIBERTY-LINK-Serie versehen hat. Seit März 2008 haben sich die AktivistInnen dafür vor Gericht zu verantworten.
CBG bei „Dritte-Welt“-Diskussion
Philipp Mimkes nahm für die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) in Köln an einer Diskussionsveranstaltung zum Thema „Umweltschutz - Menschenrechte - soziale Standards: Wie sieht es aus mit der Unternehmensverantwortung?“ teil, die das DRITTE WELT JOURNALISTINNEN NETZ gemeinsam mit der Kölner MELANCHTON AKADEMIE initiiert hatte. Der CBG-Geschäftsführer sah, so weit es BAYER betrifft, schwarz für die Unternehmensverantwortung und zählte dem Publikum detailliert die doppelten Standards auf, deren sich der Leverkusener Chemie-Multi in Sachen Umweltschutz, Kinderarbeit, Produktionsbedingungen und Produktsicherheit befleißigt.
OECD kritisiert bundesdeutsche Justiz
Nach menschlichem Ermessen müsste der Exportweltmeister eigentlich auch Weltmeister im Bezahlen von Schmiergeldern sein. Und tatsächlich stützt nicht nur der Fall „SIEMENS“ diese Vermutungen. Auch BAYER hat nach Angaben eines ehemaligen Mitarbeiters im Iran und in Italien kräftig Bestechungsgelder gezahlt, um Bau-Vorhaben realisieren oder andere Konzern-Ziele durchsetzen zu können (siehe auch Ticker 2/03). Die bundesdeutschen Gerichte bleiben jedoch weitgehend untätig. Während US-RichterInnen seit 1998 70 Unternehmen wg. Korruption verurteilten, verhängten ihre deutschen KollegInnen nur vier Strafen. Diese Praxis hat jetzt die OECD, die gemeinsame Organisation der 30 größten Industrieländer, kritisiert. „Es gibt eine ganze Reihe von Fällen, die von den Staatsanwaltschaften nicht besonders aktiv verfolgt werden“, so der OECD-Korruptionsbeauftragte Mark Pieth. Der deutsche Richterbund wies die Vorwürfe umgehend zurück, räumte aber Mängel ein. „In den Wirtschaftsabteilungen der Staatsanwaltschaften haben wir generell ein großes Problem. Eigentlich bräuchten wir viel mehr Spezialisten“, gestand Richterbund-Präsident Christoph Frank.
Spärliche Auskünfte
Die OECD ist ein Zusammenschluss der weltweit größten Industriestaaten. Ihre Leitsätze verpflichten die Multis zu gesellschaftlich verantwortlichem Handeln. GERMAN WATCH wollte von den Global Playern jetzt einmal wissen, wie sie diese Anforderungen konkret umsetzen. BAYER zeigte sich dabei nicht sehr auskunftsfreudig. „Während einige der Unternehmen ausführliche Informationen zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie machten, gaben andere keine oder nur sehr unvollständige Antworten ab, z. B. BAYER und VOLKSWAGEN“, erklärte die Initiative.
IQWIG-Chef Sawicki droht
Das „Kölner Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWiG) führt Kosten/Nutzen-Analysen von Arzneimitteln durch, was eine Streichung von Medikamenten aus dem Erstattungskatalog der Krankenkassen zur Folge haben kann. Entsprechend nervös reagiert die Pharma-Industrie. Auf allen erdenklichen Wegen versucht sie, bei den Prüfungen ein Wörtchen mitzureden. Diese Bestrebungen haben den IQWIG-Leiter Peter Sawicki jetzt dazu gebracht, im Falle eines gesteigerten Einflusses von BAYER & Co. auf die Entscheidungen des Instituts seinen Rücktritt anzukündigen. „Wenn das geschehen sollte, bin ich nicht mehr da, wo ich jetzt bin“, sagte der Pharmakologe, woraufhin ihm Gesundheitsministerin Ulla Schmidt versprach, die „fürsorgliche Belagerung“ nicht zuzulassen.
Kritik an Gates-Stiftung
Nach dem Vorbild von MICROSOFT hat Bill Gates der von ihm gegründeten „Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung“, die auch Projekte von BAYER unterstützt (siehe ERSTE & DRITTE WELT) eine Monopolstellung bei der Malaria-Forschung verschafft. Daran nahm jetzt der Leiter des Malaria-Programms der Weltgesundheitsorganisation WHO, Arata Kochi, Anstoß. Er kritisierte die Dominanz der keiner öffentlichen Kontrolle unterworfenen Stiftung, die inzwischen alle maßgeblichen WissenschaftlerInnen an sich binde, und bezeichnete ihre bei der Malaria-Therapie eingeschlagenen Wege sogar als teilweise gefährlich.
KAPITAL & ARBEIT
Nur 1,3 Prozent über 60 Jahre
Von den 37.590 Beschäftigten der BAYER AG sind gerade einmal 1,3 Prozent über 60 Jahre alt.
Nur 905 Ausbildungsplätze
Die Zahl der Ausbildungsplätze bei BAYER ist in den letzten 17 Jahren um 700 zurückgegangen. Gab es 1990 in den Werken der BAYER AG noch 1.600 Lehrstellen, so strich sie der Konzern bis zum Herbst 2007 auf 905 zusammen. Nicht einmal der Kauf der SCHERING AG hat das Angebot nennenswert erweitert. Wieder einmal liegt der Multi damit unter der durchschnittlichen Lehrstellen-Quote der bundesdeutschen Wirtschaft von sieben Prozent der Belegschaft.
Wennings Tarifrunde: + 28,1 %
Für BAYER-Chef Werner Wenning hat sich die letzte Lohnrunde gelohnt. Er konnte sein Salär um 28,1 Prozent auf 4,444 Millionen Euro steigern. Das Sümmchen setzt sich aus einem „Grundgehalt“ von 3,294 Millionen und einer variablen, am Aktienkurs orientierten Komponente von 1,1 Millionen zusammen. „Die Manager sollten ihren Mitarbeitern einmal erklären, warum sie soviel Geld brauchen“, kommentierte der SPD-Politiker Joachim Poß die von der Welt am Sonntag vorgelegten Lohnstreifen von Wenning & Co.. Der Große Vorsitzende hat das in einem Interview mit der Wirtschaftswoche getan. Seiner Ansicht nach geht beim Leverkusener Chemie-Multi alles gerecht zu, nur Tätigkeit, Qualifikation, Erfahrung und Verantwortung entscheiden über die Bezahlung. „Dabei messen wir beim Top-Management wie bei den Tarif-Mitarbeitern mit der gleichen Elle“, so Wenning.
Betriebsräte verdienen 60.000 Euro
Die VW-Affäre hat die Frage aufkommen lassen, ob den Betriebsräten im Lande nicht eine allzu üppige Bezahlung das „Co-Management“ erleichtert. BAYER veröffentlichte deshalb Zahlen und bezifferte das Durchschnittsgehalt eines Konzern-Betriebsrats auf 60.000 Euro.
Brunsbüttel streicht 100 Stellen
BAYER heizt den konzern-internen Wettbewerb um Investitionen immer mehr an. Mit dem Projekt „Mustang“ verglich der Multi jetzt das Verhältnis von Anlagen-Kapazität und Personalstamm an jedem Standort und vergab schlechte Noten für Brunsbüttel. „Wir sind 15 - 20 Prozent schlechter in der Personaleffizienz“, mit diesen Worten akzeptierte der dortige Betriebsratsvorsitzende Hans-Joachim Möller die negative Beurteilung ohne Widerworte, die ein Rationalisierungsprogramm mit einer Vernichtung von 100 Arbeitsplätzen zur Folge hat. Möller wusste sich darin mit der Werksleitung einig. „Nur so können wir im Wettbewerb um eine neue Anlage mithalten“, verlautete aus der Zentrale der Niederlassung.
ERSTE & DRITTE WELT
Bill Gates sponsort BAYER
Im Jahr 1998 startete die Weltgesundheitsorganisation WHO in Kooperation mit der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung die Malaria-Initiative „Roll back Malaria“. Sie wollte 60 Prozent der Erkrankten sofort eine medizinische Versorgung ermöglichen und die Zahl der Malaria-Toten bis zum Jahr 2010 auf die Hälfte senken. Zu diesem Zweck unterstützte die Initiative auch das BAYER-Projekt, auf Basis des von der „Hongkong University of Science and Technology“ entdeckten Wirkstoffes Artemisone ein neues Medikament zu entwickeln. Um dieses Präparat ist es allerdings still geworden, und auch von anderen Erfolgen kann „Roll back Malaria“ kaum künden, so dass die medizinische Fachzeitschrift Lancet im Jahr 2005 eine ernüchterne Zwischenbilanz zog. Bill Gates glaubt aber immer noch an BAYER. Er stellte dem Leverkusener Multi 50,7 Millionen Dollar zur Verfügung, um mit dem Kooperationspartner „Innovative Vector Control Consortium“ nach einem neuen Pestizid gegen den Malaria-Erreger zu forschen und schon vorhandene Wirkstoffe zu verändern, da die Stechmücke als Überträger der Krankheit gegen die alten Substanzen Resistenzen herausgebildet hat.
Pesticides are coming home
In den vergangenen Jahrzehnten haben die Agro-Multis - gefördert von „Entwicklungshilfe“-Programmen - „Drittweltländer“ großzügig mit Ackergiften versorgt. Die Folge: Nach Schätzungen der Welternährungsorganisation der UN lagern dort über eine halbe Millionen Tonnen Alt-Pestizide, schlecht gesichert in lecken Behältern, zerrissenen Tüten und geplatzten Säcken. Altlasten made by BAYER sind nach GREENPEACE-Angaben in rund 20 Ländern vertreten. Ob die 75 Tonnen DDT aus Tansania, die der Konzern jetzt auf Kosten des Entwicklungshilfeministeriums in Dormagen verbrennen will, ganz, teilweise oder gar nicht aus eigenen Beständen stammen, ist hingegen nicht bekannt.
KONZERN & VERGANGENHEIT
VCI: Geschichtsaufarbeitung nicht erwünscht
Die bundesdeutsche Chemiebranche hat sich ihrer unheilvollen Vergangenheit immer noch nicht gestellt. Fragen nach den IG FARBEN, dem für Zwangsarbeit, eigene KZs und Kriegsvorbereitungen verantwortlichen Mörderkonzern, wiesen BAYER als IG-Initiator, BASF und HOECHST & Co. stets mit dem Verweis ab, sie hätten die Rechtsnachfolge des Chemie-Trusts nicht angetreten. Nur die BASF hat sich bisher diesem dunklen Kapitel in einer Unternehmensgeschichte gewidmet. Ob allerdings eine lückenlose Aufklärung erfolgte, steht in Frage, denn es halten sich Gerüchte über zurückgehaltene Dokumente und Knebelverträge die Veröffentlichungsrechte betreffend. Der „Verband der Chemischen Industrie“ erwog zwar einmal, den Historiker Michael Stürmer mit einer Aufarbeitung seiner Vergangenheit zu betrauen, aber die Verantwortlichen stoppten das Projekt. Und BAYER? Der Leverkusener Multi hat noch nicht einmal im Traum daran gedacht, einen Wissenschaftler zur Inventur seines Giftschrankes im Firmenarchiv zu verpflichten.
POLITIK & EINFLUSS
Der Leverkusener BAYER-Rat
Die partei-übergreifende BAYER-Fraktion im Leverkusener Stadtrat hat viele Mitglieder. Zahlreiche KommunalpolitikerInnen standen oder stehen noch in Diensten des Pharma-Riesen. Bei den Christdemokraten sind es Bernhard Apel (bis zu einer Pensionierung Diplom-Ingenieur bei BAYER und Betriebsleiter bei AGFA), der von 1957 bis 1999 bei AGFA als Chemie-Facharbeiter und Technischer Angestellter tätig gewesene Raimund Gietzen, der ehemalige BAYER-Industriekaufmann Dietrich (Dieter) Volberg und Ulrich Wokulat (Kaufmännischer Angestellter bis 1999). Die Sozialdemokraten zählen auf den als Industriemeister beim ehemals zu BAYER gehörenden Unternehmen DYSTAR arbeitenden Ferdinand Feller, den bei BAYERs Logistik-Ableger CHEMION unter Vertrag stehenden Wolfgang Oertel, den seine berufliche Karriere bei BAYER als Hochdruckrohr-Schlosser begonnen und bei der 2002 verkauften Wohnungsgesellschaft des Konzerns fortgesetzt habenden Dieter März sowie den seit 2006 im Ruhestand lebenden BAYER-Dreher Gerhard (Paul) Masurowski. Die Bürgerliste bietet den als Physiklaborant und Technischer Angestellter in BAYER-Diensten gestanden habenden Klaus-Peter Gehrtz und den CHEMION-Werker Stefan Manglitz auf. Die Grünen sind durch Georg Müller, der als Technischer Angestellter bei dem früher zu BAYER gehörenden Unternehmen LANXESS arbeitet, und Gerd (Gerhard) Wölwer, der von 1969 bis 1972 seine Lehre zum Chemielaboranten bei BAYER absolvierte, vertreten. Für die FDP sitzen der bis zu seinem Renteneintritt 2006 auf 40 Jahre BAYER-Erfahrung als Planungsingenieur, Organisationsberater, Betriebsleiter „Logistik“ und Vertragsmanager zurückblicken könnende Wolfgang Blümel und der einst in BAYERs Monheimer Pestizid-Produktion wirkende Chemiker Dr. Klaus Naumann im Stadtrat. Die Unabhängige Wählergruppe (UWG) schließlich schickte den CHEMION-Mann Reimund Vozelj in das Kommunalparlament. Bei dieser geballten Ladung BAYER hat der Chemie-Multi an seinem Stammsitz kaum noch politische Unbill zu befürchten.
Wenning wettert
BAYER-Chef Werner Wenning nutzte seine Abschiedsrede als Vorsitzender des „Verbandes der Chemischen Industrie“, um der Großen Koalition Hausaufgaben aufzugeben. So mahnte er weitere „Reformen“ an. „Was heute politisch opportun erscheint, darf nicht ausschlaggebend sein, wenn es um unsere Zukunft geht“, mahnte er. Auch ein bisschen weniger Klimaschutz hätte Wenning gern: „Bei allem Engagement für den Klimaschutz, den wir mit der Bundesregierung teilen, muss die Politik auch darauf achten, die Leistungsfähigkeit der Industrie nicht zu überfordern“. Im Bereich „Gentechnik“ hingegen sieht er die Seinen deutlich unterfordert. „Es wird höchste Zeit, dass die Bedingungen für die Forschung und den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen auch hier in Deutschland endlich verbessert werden“, forderte der Konzern-Lenker.
Wenning in Davos
Die alljährliche Hauptversammlung der Global Player im schweizerischen Davos gibt sich gerne einen idealistischen Anstrich. BAYER-Chef Werner Wenning strich da kräftig mit. Die Konferenzen, „die sich mit übergeordneten, uns alle betreffenden Fragestellungen befassen, wie zum Beispiel Klimaschutz“, machten für ihn den eigentlichen Wert des Forums aus. Wie materialistisch es aber in Wirklichkeit hinter diesen für die Weltöffentlichkeit aufgebauten Kulissen zuging, beschrieb der Filmregisseur Florian von Henckel Donnersmarck in einem Spiegel-online-Interview. Wer kaum mehr als fünf Milliarden Dollar Umsatz macht, gilt bei dem Klassentreffen nämlich schon als Unterschicht, welche die „feinen Unterschiede“ zu spüren bekommt. „Unternehmer zum Beispiel, die nur fünf Milliarden Dollar Umsatz machen und sich damit gerade mal für das Forum qualifizieren, werden weniger respektvoll behandelt, als solche, die sieben oder neun Milliarden machen“, so der Oscar-Preisträger.
Bund beschließt Gentechnik-Gesetz
Ende Januar 2008 hat der Bundestag das neue Gentechnik-Gesetz verabschiedet, das laut CDU/CSU die „Blockade“ bei der grünen Gentechnik beendet. Das Paragraphen-Werk legt mit 150 Meter Mindestabstände zwischen Genmais-Feldern und konventionell bzw. ökologisch bewirtschafteten Äckern fest, die teilweise weit unter denen in vielen anderen europäischen Ländern festgelegten bleiben. Zudem macht der Gesetzgeber diese zur Verhandlungssache, indem er Privatabsprachen zwischen Nachbarn zulässt. Auch die Haftungsbestimmungen sind völlig unzureichend, da das Verursacherprinzip nicht gilt und bestimmte Berufsgruppen wie ImkerInnen gar nicht erfasst sind. Zudem legt die neue Regelung eine äußerst knapp bemessene Einspruchsfrist fest. So kritisiert der BUND ÖKOLOGISCHER LEBENSMITTELWIRTSCHAFT (BÖWL) denn auch, dass „ein Großteil der zu erwartenden Schadensfälle durch die im Gesetz vorgesehene Haftung nicht abgedeckt“ ist. Nur bei der Etikettierung hat sich die Große Koalition zu einer Verschärfung durchgerungen. Wo „ohne Gentechnik“ drauf steht, darf jetzt kein 0,9-prozentiger Anteil von Futtermitteln aus Gentech-Produktion mehr drin sein. Dafür dürfen sich jetzt Medikamente und Vitamine, die GenköchInnen angerührt haben, unter dem Label wohlfühlen, wogegen prompt der „Hauptverband des deutschen Einzelhandels“ protestierte.
PROPAGANDA & MEDIEN
BAYER sponsort Pestizid-Symposion
Im Oktober 2007 hat der Leverkusener Multi ein internationales Symposion zum Thema „Grauschimmelfäule“ gesponsort, das im südafrikanischen Kapstadt stattfand. Veranstaltet vom zur Universität Stellenbosch gehörenden Institut für Wein-Biotechnologie, diente das Ganze laut Konzern als „Schaufenster für die neuesten Forschungsergebnisse“. Allerdings ließ die ausgestellte Produktvielfalt zu wünschen übrig: In der Auslage fanden sich nur BAYERs Antipilz-Wirkstoffe Fenhexamid und Pyrimethanil.
BAYER hetzt gegen die CBG
Ende August 2007 wollte BAYER als Ausrichter einer Konferenz der UN-Umweltbehörde UNEP, an der 150 junge UmweltschützerInnen aus aller Welt teilnahmen, weiter an seinem grünen Image feilen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) protestierte gegen die Alibi-Veranstaltung und präsentierte der Öffentlichkeit das Umweltsündenregister des Konzerns, was auf breite Resonanz stieß. So interviewte ein ungarischer Journalist CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes und konfrontierte den Leverkusener Multi anschließend mit den von der Coordination erhobenen Vorwürfen. In dem Antwortschreiben weist das Unternehmen die Kritik wie erwartet zurück. Man habe niemals Lobby-Aktivitäten gegen politische Vorhaben entfaltet und bemühe sich stets nach Kräften, „faire und effektive politische Rahmenbedingungen, welche den Wettbewerb nicht behindern“ zu erreichen, behauptet der Leverkusener Multi. Die CBG bezichtigt der Konzern hingegen einmal mehr, mit Halbwahrheiten und Falschinformationen zu operieren. Darüber hinaus bezeichnet das Unternehmen diese als Gruppe „einer extremen ideologischen Richtung“ - und auch diesmal fehlt der Verweis auf einen „teilweise kommunistischen Hintergrund“ nicht.
BAYERs Freund der Baum
Durch die Kooperation mit der UN-Umweltbehörde UNEP versucht sich BAYER ein grünes Image zu verleihen. So richtete der Pharma-Riese Ende August 2007 eine Konferenz in Leverkusen mit 150 jungen UmweltschützerInnen aus aller Welt aus. Neuester Greenwashing-Coup: Der Konzern pflanzt im Rahmen eines UNEP-Aufforstungsprogramms 300.000 Bäume, was angeblich den Kohlendioxid-Gehalt in der Luft um 7.500 Tonnen reduziert. Um allerdings das CO2 um einen solchen Wert zu senken, wie ihn die vom Unternehmen geplanten Kohlekraftwerke erhöhen, müsste er schon Milliarden von Bäumen aufbieten.
Lobby-Verband aufgeflogen
Seit Jahren versuchen BAYER & Co., das Reklame-Verbot für Arzneien aufzuheben, indem sie Werbung zu „Information“ umwidmen. Dabei bedienten sie sich auch der Mithilfe des Verbandes „Pro Patienteninformation“. Das Ziel der „Abschaffung des Informationsverbotes für verschreibungspflichtige Arzneimittel“ verfolgend, gab die Organisation vor, 55.000 PatientInnen sowie die Selbsthilfegruppen der Parkinson-, Osteoporose- und Morbus-Bechterew-Erkrankten zu vertreten. Diese wussten allerdings gar nichts von ihrem Glück. Das „IPAS Institut politische Analysen und Strategie“ hatte sie kurzerhand zu StatistInnen in seiner von der Pharma-Industrie finanzierten Lobby-Kampagne gemacht. Doch der Schwindel flog auf. Der „Deutsche Rat für Public Relations“ (DRPR) erteilte Jan Burdinski als Initiator der „allem Anschein nach virtuelle Koalition Pro-Patienteninformation“ eine Rüge. „Die Nichttransparenz sei als vorsätzlich und der Verstoß als schwerwiegend zu bewerten“, urteilte der DRPR.
Selbsthilfe zur BAYER-Hilfe
Die Unterstützung von Selbsthilfegruppen stellt für die Pillenriesen eine lohnende Investition dar. „Wenn Firmen zehn Prozent mehr in Selbsthilfegruppen investieren, wächst ihr Umsatz um ein Prozent im Jahr. Wenn sie zehn Prozent mehr in das Marketing bei Ärzten investieren, wächst ihr Umsatz nur zwischen 0,2 und 0,3 Prozent“, hat der als Gesundheitsökonom an der Universität Bremen lehrende Gerd Glaeske errechnet. Darum unterstützt der Leverkusener Multi Verbände wie die „Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft, die „International Diabetes Federation“, die „National Coalition for Cancer Survivorship“, die „Juvenile Diabetes Research Foundation“, die „National Hemophilia Foundation“ und die „American Heart Association“ finanziell. Darüber hinaus betrieb BAYER bis 2005 die Homepage „www.selbsthilfegruppen.de“. Um die Gruppen vor dem Ruch der Käuflichkeit zu bewahren, gab der Konzern die Pflege der Seite inzwischen an eine Leverkusener Agentur ab. Das Geld dürfte aber immer noch aus der Portokasse des Pharma-Riesen kommen.
100.000 Dollar für Bluterverband
Dem US-amerikanischen Bluterverband „National Hemophilia Foundation“ (s. o.) ist BAYER besonders gewogen, gilt es doch, vergessen zu machen, dass in den 90er Jahren Tausende Bluter an „HIV“-verseuchten Blutprodukten des Konzerns starben, weil das Unternehmen sein Präparat KOGENATE aus Kostengründen keiner Hitze-Behandlung unterzog. So überreichte der Multi der Organisation im Februar 2008 einen Scheck über 100.000 Dollar für ein Programm zur Förderung des Verbandsnachwuchses.
BAYERs DiabetikerInnen
„Hilfe zur Selbsthilfe“ (s. o.) betreibt BAYER auf dem Feld „Diabetes“ besonders intensiv. So hat er mit der „International Diabetes Federation“ (IDF) die Kampagne „Unite for Diabetes“ ins Leben gerufen. Der IDF zeigte sich dankbar und nahm die Blutzucker-Selbstkontrolle in ihren Richtlinien-Katalog zur Diabetes-Therapie auf, was den Abverkauf von Diabetes-Diagnostika made by BAYER nicht unwesentlich ankurbeln dürfte. Als hilfreich erwies es sich auch, dass das IDF-Vorstandsmitglied Anne Marie Felton gleichzeitig der „Federation of European Nurses in Diabetes“ angehört. So konnte die Organisation sich gleich einmal in Leverkusen zu einem Diabetes-Symposion treffen. Der Pharma-Riese nutzte das, um weiter Netzwerk-Arbeit zu betreiben. Es gelang ihm, Professor Oliver Schnell vom „Institut für Diabetes-Forschung“ der Universität München und Dr. Xavier Cos vom Katalonischen Gesundheitszentrum als Redner zu gewinnen, die selbstredend beide die Bedeutung der Blutzucker-Selbstkontrolle betonten.
BAYERs DiabetikerInnen
Mit dem gestiegenen Lebensstandard werden in den Schwellenländern auch die Zivilisationskrankheiten zunehmen, spekuliert BAYER und pflegt deshalb in Indien schon einmal die gesundheitspolitische Landschaft. So gehört er gemeinsam mit ELI LILLY und BD zu den Sponsoren eines millionen-schweren Diabetes-Weiterbildungsprogramms für Angestellte des Gesundheitswesens. Damit wollen die Pharma-Riesen die westlichen Behandlungsmethoden in Indien implementieren. Ein wesentlicher Bestandteil dieser „Entwicklungshilfe“ ist es, die PatientInnen zu einem „Selbstmanagement“ ihrer Krankheit anzuleiten, wozu natürlich die entsprechenden Blutzuckermessgeräte von BAYER & Co. unabdingbar sind.
BAYERs DiabetikerInnen
BAYER gehört zu den Sponsoren des EU-Projektes „Image“, das einheitliche Richtlinien zur Früherkennung und Behandlung von Diabetes entwickeln will.
BAYERs ASPIRIN-Kampagne
Der Leverkusener Multi hat seine Anstrengungen, ASPIRIN als Mittel zur Vorbeugung von Herz/Kreislaufkrankheiten am Markt zu platzieren, noch einmal verstärkt. In den USA gelang es dem Konzern, das „American College of Preventive Medicine“ und die „Partnership für Prevention“ für eine Kampagne einzuspannen. Diese setzt sich zum Ziel, ÄrztInnen und andere AkteurInnen des Gesundheitswesens für die Wirkungen des „Tausendsassas“ zu sensibilisieren, welche längst nicht alle ExpertInnen als segensreich empfinden. So erhöht das Mittel nach einer Studie der Universität Oxford z. B. das Risiko für durch Blutungen im Gehirn ausgelöste Schlaganfälle, da es den Blutfluss anregt (Ticker 3/07).
BAYER startet „Tierarzt-TV“
Der Leverkusener Multi nutzt künftig VeterinärInnen-Praxen als Werbe-Plattform. Der Leverkusener Multi strahlt in Wartezimmern sein „Tierarzt-TV“ aus. Das Magazin bietet alles rund ums Tier - und das entsprechende BAYER-Angebot. „Tierärzte sind von jeher unsere wichtigsten Multiplikatoren. Das von uns kreierte Tierarzt-TV bietet die Möglichkeit, Tierhalter in den Praxen direkt anzusprechen“, erläuterte BAYER-Mann Christian Behm die PR-Strategie.
BAYER schult ApothekerInnen
Die traditionelle bundesdeutsche Pharmazie steht derzeit durch Internet-Apotheken und Forderungen nach Aufhebung des Fusionsverbotes unter Druck. In dieser Situation bietet BAYER „Hilfe“ an. Die vom Leverkusener Multi gegründete „Innovations-Akademie Deutscher Apotheker“ will den Pillen-VerkäuferInnen Marketing-Nachhilfe geben - und als Nebenwirkung natürlich noch besser mit ihnen ins Geschäft kommen.
BAYER wäscht weiter
BAYER setzt die Kooperation mit der Zeitschrift National Geographic Deutschland (NGD) und damit auch die diesbezüglichen Greenwashing-Aktivitäten fort (siehe auch SWB 3/05). Der Konzern unterstützt weiterhin den von dem Magazin initiierten „Global Exploration Fund“, der sich der Ressource „Wasser“ widmet. Das letzte Mal stellte die Publikation dem Unternehmen dafür in einer Wasser-Broschüre vier Seiten zur Eigenwerbung zur Verfügung. Hinzu kamen „lobende Erwähnungen“ in zahlreichen Medien-Veröffentlichungen zum Thema. Damit kann sich der Leverkusener Multi einmal mehr medienwirksam als Schutzpatron des kostbaren Stoffes in Szene setzen, dem er im wirklichen Leben als Einleiter von Chemikalien und Großverbraucher arg zusetzt.
Fonds & Co. macht BAYER-Werbung
Die Zeitschrift Fonds & Co. widmet sich Finanz-Anlagen. Dies ist ein recht trockenes Thema. Deshalb hat sich die Publikation dafür entschieden, eine Artikelreihe zu Private Equity-Investments mit Einblicken in BAYERs Forschungslabors aufzumachen und mit den entsprechenden Fotos auszuschmücken, obwohl der Zusammenhang mehr als vage ist. Das hört sich dann zum Beispiel so an: „Bioscience-Wissenschaftler können nicht genau genug prüfen, bevor sie ein neues Produkt in den Freiversuch entlassen (...) Nicht viel anders als den Forschern von BAYER im Genter Labor ergeht es Zeichnern und Emissionshäusern“. Ein anderes Mal spannt der Autor den Bogen von BAYERs gentechnisch veränderten Baumwollpflanzen, von denen die wenigsten den Sprung vom Labor auf den Acker schaffen, zu den Gepflogenheiten der Finanzbranche. „Die Größe der Population hängt also von der Zahl der Pflänzchen am Start ab. Das Gleiche gilt, wenn man sich einen Eindruck von den Private-Equity-Investments verschaffen will, die am besten performt haben“, heißt es in dem Text. Es wäre schon ein großer Zufall, wenn die Assoziationen der Fonds-JournalistInnen nur aus freien Stücken immer wieder gen Leverkusen strebten ...
Funk Uhr wirbt für LEVITRA
Die Fernsehzeitschrift Funk Uhr macht unverhüllt Werbung für BAYERs LEVITRA und andere Potenzmittel. Dabei schließt sie sich natürlich auch der von den Pharmariesen in Umlauf gebrachten Diagnose an, wonach die Ursache der „erektilen Dysfunktion“ in 80 Prozent der Fälle organischer Natur sei. Die Frage „Was hilft?“ ist dann schnell beantwortet. „VIAGRA, LEVITRA und CALIS helfen medikamentös auf die Sprünge“, heißt es in dem Blatt.
Verkappte Werbung im Internet
In der Bundesrepublik ist es untersagt, für rezeptpflichtige Arzneien zu werben. BAYER & Co. versuchen zurzeit alles, um dieses Verbot aufzuheben. Parallel dazu finden die Multis aber auch jetzt schon Mittel und Wege, ihre Produkte anzupreisen. Wer sich beispielsweise im Internet über Verhütungsmittel informieren will und bei GOOGLE den Begriff „Pille“ eintippt, landet als erstes auf www.pille-mit-herz.de. Nur im Kleingedruckten findet sich der Betreiber der Seite angegeben: die BAYER-Tochter JENAPHARM. Die Webpage gibt vor, allgemein in das Thema einzuführen, stellt die unterschiedlichen Verhütungsmethoden sowie einzelne Pillen-Arten vor. Nur ganz behutsam führt JENAPHARM die SurferInnen auf den „richtigen“ Weg. Mit dem Slogan „Mehr als verhüten - sanft verhüten“ preist die Firma mit Drospirenon den Wirkstoff der haus-eigenen niedrig dosierten Verhütungspillen an. Natürlich fehlt der Hinweis darauf, dass diese Substanz doppelt so oft die Nebenwirkung „Blutgerinnsel“ hat wie Levonorgestrel oder Norethisteron. Darüber hinaus will das Unternehmen seine Präparate als Lifestyle-Medikamente an die Frau bringen. „Die neueste Entwicklung ist, dass deine Pille jetzt sogar einen Beauty-Effekt hat“, verkündet JENAPHARM und verheißt positive Effekte auf Haut und Haar an.
DRUGS & PILLS
Arznei-Test mit Nebenwirkungen
Im Jahr 2005 kam es bei Arznei-Tests mit Parkinson-Kranken, die der nun zu BAYER gehörende Pharma-Multi SCHERING in Kooperation mit dem Unternehmen TITAN in den USA durchführte, zu ernsthaften Zwischenfällen. Die per gehirnchirugischem Eingriff implantierten Zellen zur Dopamin-Produktion verursachten bei den ProbandInnen Verwirrtheitszustände, Depressionen bis zu Selbsttötungsversuchen, Lähmungserscheinungen, Sprachausfälle, epileptische Anfälle, Hirnblutungen, Asthma und andere körperliche oder geistige Beeinträchtigungen. Die dauerhaft geschädigte Suzanne Davenport hat deshalb Klage gegen den Leverkusener Agro-Riesen eingereicht (siehe auch SWB 1/08).
Leberschäden durch ZETIA?
Seit Juni 2007 vermarktet BAYER den Cholesterinsenker ZETIA (Wirkstoff: Ezetimib) gemeinsam mit SCHERING-PLOUGH in Japan. Um die Geschäfte mit dem Milliarden-Seller nicht zu gefährden, hat SCHERING-PLOUGH als Hersteller jahrelang interne Untersuchungsergebnisse über die leberschädigende Wirkung des Präparates geheim gehalten. Nicht einmal die Aussortierung einiger PatientInnen mit besonders hohen Leberwerten konnte das Resultat verbessern. Auf die Frage, warum der Konzern die Öffentlichkeit nicht umgehend informiert habe, antwortete ein Verantwortlicher, man habe die ganze Sache nicht für relevant gehalten. Ebenso irrelevant scheint für das Unternehmen eine ZETIA-Studie zu sein, die im Jahr 2002 begann und noch immer keinen Abschluss gefunden hat. Erst nach erheblichem Druck von Seiten des US-Kongresses erklärte sich der Pharma-Riese bereit, die Daten im März 2008 zu publizieren.
Schlaganfälle durch ASPIRIN
Der Leverkusener Multi bewirbt sein Schmerzmittel ASPIRIN mit dem Wirkstoff Acetylsalicylsäure seit einiger Zeit aggressiv als Mittel zur Prophylaxe von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Dabei erhöht das Mittel das Risiko für Schlaganfälle, die nicht durch einen Gefäßverschluss, sondern durch eine Blutung im Gehirn entstehen, weil der „Tausendsassa“ den Blutfluss im Kopf anregt (Ticker 3/07). Eine neue, in der Fachzeitschrift Lancet (Band 370, S. 493) veröffentlichte Studie hat jetzt auch seine Unterlegenheit gegenüber dem Gerinnungshemmer Warfarin beim Schutz älterer Menschen mit Vorhofflimmern vor einem Gehirnschlag dokumentiert. Während in der Warfarin-Gruppe 21 ProbantInnen einen Schlaganfall erlitten, so waren es in der Acetylsalicylsäure-Gruppe 44.
ASPIRIN-Resistenzen nehmen zu
Durch jahrelange Arbeit hat BAYER es geschafft, ASPIRIN eine Herz/Kreislauf-Erkrankungen vorbeugende Wirkung anzudichten. So nehmen z. B. schon fünf Prozent aller SchweizerInnen das Schmerzmittel aus prophylaktischen Gründen ein. Seit einiger Zeit beobachten MedizinerInnen aber gerade bei den KonsumentInnen des „Tausendsassas“ einen Zuwachs von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Die ÄrztInnen erklären sich dieses Phänomen mit der zunehmenden Herausbildung von ASPIRIN-Resistenzen. Allein in Thailand zählen die Gesundheitsbehörden schon 65.000 Fälle.
YASMIN-Patent verloren
Die Verhütungspille YASMIN ist BAYERs lukrativstes Medizin-Produkt. Allein in den USA macht der Konzern damit jährlich einen Umsatz von 321 Millionen Euro. Und die weiteren Aussichten schienen glänzend, denn das Patent sollte eigentlich erst 2020 auslaufen. Doch es kam anders. Das US-amerikanische Pharma-Unternehmen BARR focht in den Vereinigten Staaten eines der drei Patente an, die der Leverkusener Multi auf die Antibabypille hält, und bekam Recht zugesprochen. Der zuständige Richter Peter Sheridan wies BAYERs Anspruch auf geistiges Eigentum für die Praxis, das Hormon Drospirenone in so kleine Portiönchen aufzuteilen, dass der Organismus es schnell aufnehmen kann, zurück. Das wäre ein in der Pharmazie übliches Vorgehen und keine BAYER-Erfindung, begründete Sheridan das Urteil, das der Konzern in einem Revisionsverfahren wieder kippen will. Während BARR nun mit einer Nachahmer-Version von YASMIN auf den Markt drängt, sieht der Pillenriese nach der Gerichtsentscheidung auch das Patent für das Verhütungsmittel YAZ bedroht. Die Börse reagierte prompt mit Kursabschlägen für die BAYER-Aktie, und der Vorstandsvorsitzende Werner Wenning musste die Gewinnerwartungen für den gesamten Pharma-Bereich nach unten korrigieren.
Neue Verhütungspille
Nicht zuletzt der langwierige und jetzt vorerst entschiedene Patentstreit um das Verhütungsmittel YASMIN (s. o.) hat den Leverkusener Multi dazu getrieben, rasch für Nachschub in dem Segment zu sorgen. So hat er nun in Europa die Zulassung für ein neues Präparat beantragt. Ob das Mittel mit den beiden Hormonen Estradiol und Dienogest als Wirksubstanzen die Leber aber tatsächlich weniger schädigt als vergleichbare Produkte, wie BAYER behauptet, dürfte erst der Praxis-Test zeigen.
Doppelte DIANE-Standards
BAYER darf DIANE-35 in Europa und Kanada wegen seiner Risiken und Nebenwirkungen nicht als Verhütungsmittel vermarkten; zugelassen ist es nur noch als Arznei zur Behandlung schwerer Hormonerkrankungen. Das hinderte den Pharma-Riesen jedoch nicht, das Produkt in Schwellenländern als Antibabypille auf den Markt zu bringen. So erhielt DIANE-35 2001 in Südkorea eine Zulassung. Erst als unabhängige Nichtregierungsgruppen diese doppelten Standards kritisierten, machte der Leverkusener Multi einen Rückzieher.
Teststreifen-Rückruf
In den USA musste der Leverkusener Multi eine Rückruf-Aktion für Diabetes-Teststreifen starten. Durch einen Produktionsfehler zeigten sie um bis zu 17 Prozent höhere Blutzucker-Werte an.
LEUKINE-Rückruf
BAYER musste das gentechnisch produzierte LEUKINE in der flüssigen Darreichungsform nach Meldungen über schwere Nebenwirkungen vom Markt nehmen. Der vor allem zur Stärkung des Immunsystems von Leukämie-Kranken und nach Knochenmarktransplantationen zum Einsatz kommende Wachstumsfaktor hatte bei den PatientInnen wiederholt zu Bewusstlosigkeit geführt. Der Leverkusener Multi machte den der Flüssigkeit als Stabilisator beigegebenen Stoff Ethylendiamintetraacetat dafür verantwortlich.
AVELOX schädigt Leber
Nach Meldungen über von BAYERs Antibiotikum AVELOX ausgelöste Leber- und Hautschädigungen forderte das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ den Pharma-Riesen auf, ÄrztInnen in einem Brief ausdrücklich auf diese Nebenwirkungen hinzuweisen.
Lungenkrebs: NEXAVAR hilft nicht
Als „Meilenstein im Kampf gegen Krebs“ feiert BAYER sein Mittel NEXAVAR. Es kommt bisher bei der Behandlung von Nieren- und Leberkrebs zum Einsatz und sollte auch bei Lungenkrebs Anwendung finden. Jetzt musste der Leverkusener Multi entsprechende Tests allerdings abbrechen. Das Präparat mit dem Wirkstoff Sorafenib half nicht nur nicht, es verkürzte sogar die Lebenserwartung der PatientInnen.
Bluthochdruck durch NEXAVAR
Nach einer in der medizinischen Fachzeitschrift LancetOncology veröffentlichten Studie erhöht BAYERs Krebsmedikament NEXAVAR das Bluthochdruck-Risiko, wodurch für die PatientInnen die Gefahr steigt, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden.
Zulassung für Thrombose-Mittel beantragt
BAYER hat die Zulassung für die Thrombose-Arznei Rivaroxaban beantragt. Der Leverkusener Multi hofft auf eine Genehmigung für den prophylaktischen Einsatz zur Verhinderung von Blutgerinnseln nach größeren orthopädischen Operationen und will das Präparat unter dem Namen XARELTO vermarkten.
Riesige Gewinnspannen
Der Pharma-Markt hält für BAYER & Co. riesige Gewinnspannen bereit. Von dem Geld, das Kranke für ein Medikament zahlen, fließen über 60 Prozent an die Pillen-Produzenten zurück, während für die Apotheke nur 15,2, den Staat 12,8, die Krankenkassen 7,5 und den Großhandel 3,7 Prozent bleiben.
Fast alles zulässig
„Die Alte Welt ist auf dem besten Weg, zum neuen Lieblingsmarkt der Pharma-Industrie zu werden. Die Konzerne haben hier weniger Probleme mit der Zulassung als in den USA“, zitiert die BUKO-PHARMA-KAMPAGNE die Financial Times Deutschland. Wenn diese Wirtschaftspostille die bundesdeutschen Genehmigungsbehörden lobpreist, dann muss es um den vorbeugenden Gesundheitsschutz im Lande wahrlich schlecht stehen.
JENAPHARM erfindet Krankheiten
Für die vielen auf dem Markt befindlichen Pillen gibt es viel zu wenig Gesundheitsstörungen. Deshalb zeigen sich die Pharma-Riesen erfindungsreich. BAYERs Tochtergesellschaft JENAPHARM beispielsweise will kleine Zipperlein vor der Monatsblutung dem eh nur mit Biegen und Brechen als Krankheit durchgehenden „Prä-Menstruellen Syndrom“ zuschlagen und dafür mit der Pille PETIBELLE auch gleich die passende pharmakologische Lösung liefern.
Forschung an Brustkrebs-Arznei
„Sexualhormone selbst verursachen keinen Brustkrebs, sie können aber das Wachstum bestehender Karzinome fördern“ - diese Erkenntnis führt den Leverkusener Multi keinesfalls dazu, in einem Akt der Selbstkritik seine umstrittenen Hormontherapien für Frauen in den Wechseljahren vom Markt zu nehmen. Sie dient vielmehr dazu, neue Forschungen zur Verlangsamung des Brustkrebs-Wachstums vorzustellen. Setzten die MedizinerInnen hier bislang vor allem Antihormone ein, welche die Östrogen-Aufnahme hemmten, so konzentrieren sich die Leverkusener PharmakologInnen jetzt auf das Progesteron und testen einen Progesteron-Blocker in einer Phase-II-Studie mit 70 PatientInnen. Wenn es sich wie im Fall NEXAVAR verhält, dürfte das Mittel die Lebenserwartung der Patientinnen um 2-3 Monate erhöhen und BAYER wieder dazu veranlassen, mit Schlagzeilen wie „Leberkrebs im Visier“ oder „Weiterer Meilenstein im Kampf gegen den Krebs“ den Eindruck zu erwecken, wirklich eine Arznei gegen die Krankheit gefunden zu haben, was nicht den Tatsachen entspricht.
GENE & KLONE
BAYERs Genmedizin-Partner
Der Leverkusener Pharma-Riese führt mit zahlreichen Biotech-Unternehmen genmedizinische Forschungsprojekte durch. Die Kooperation mit AFFIMETRIX widmet sich ebenso wie die mit INPHARMATICA, NEUROSCIENCES VICTORIA und der Universität von Monash der Suche nach Arznei-Wirkorten. Mit ARTEMIS prüft er diese nach Herz und Nieren. Mit CELERA entwickelt BAYER ein Therapeutikum für Autoimmunkrankheiten. Mit den Firmen CHEMDIV und COMGENEX betreibt der Pillen-Hersteller Wirkstoff-Synthese, mit GENEDATA Bioinformatik. In Zusammenarbeit mit MORPHOSYS und NOVARTIS forscht der Multi nach Antikörpern zur Behandlung von Krebs und mit WARNER CHILLCOTT nach solchen zur Behandlung von Hautkrankheiten.
BAYER setzt auf molekulare Diagnostika
Der Leverkusener Multi entwickelt derzeit gentechnische Diagnose-Verfahren, die erste Anzeichen einer Krankheit bereits auf zellulärer Ebene aufspüren sollen. Der Konzern hofft, so ein Instrument zur Früherkennung degenerativer Gesundheitsstörungen wie etwa Alzheimer, Krebs oder Herz/Kreislauf-Erkrankungen entwickeln zu können. Diese „molekularen Diagnostika“ befinden sich allerdings noch in der ersten Phase der Klinischen Tests. Ob die Mittel die in sie gesetzten Erwartungen auch erfüllen werden, steht lange noch nicht fest.
MABCAMPATH: erweiterte Zulassung
Bisher durften MedizinerInnen das von BAYER und GENZYME gemeinsam entwickelte Gentech-Medikament MABCAMPATH (Wirkstoff: Alemtuzumab) bei der chronisch-lymphatischen Leukämie nur einsetzen, wenn die PatientInnen bereits mit anderen Arzneien vorbehandelt waren oder eine Therapie mit Fludarabin nicht den gewünschten Erfolg erbracht hatte. Nach der US-amerikanischen Zulassungsbehörde erteilte dem Pharmariesen nun aber auch ihr europäisches Pendant die Genehmigung für den Ersteinsatz des monoklonalen Antikörpers, der sich gezielt an von Leukämie befallene Zellen binden und das Immunsystem so anregen soll, diese zu zerstören.
KOGENATE zur Vorbeugung?
BAYER will das Anwendungsspektrum seines gentechnisch hergestellten Blutgerinnungshemmers KOGENATE erweitern und hat eine Studie durchführen lassen, die den prophylaktischen Einsatz ab einem Alter von sechs Monaten empfiehlt. Das würde Gelenkeinblutungen vorbeugen und so die Gelenkfunktion länger erhalten, meinen die AuftragsforscherInnen.
LIBERTY-LINK-Zulassung vertagt
Über die von BAYER bei der EU beantragte Import-Zulassung für genmanipulierte Soja- und Baumwoll-Pflanzen aus der LIBERTY-LINK-Baureihe müssen jetzt die Agrar-MinisterInnen entscheiden. Ein Ausschuss hatte sich zuvor weder auf eine Ablehnung noch auf eine Genehmigung einigen können.
Brasilien genehmigt Gen-Mais
Um die Genehmigung für genmanipulierten BAYER-Mais tobte in Brasilien lange eine heftige Auseinandersetzung. Nachdem Präsident Lula da Silva kurzerhand die Zulassungsbedingungen gelockert hatte, gaben die Behörden zunächst grünes Licht für die Genpflanze mit der eingebauten Resistenz gegenüber dem Herbizid LIBERTY LINK. Ein Bundesrichter hob das Votum jedoch wieder auf. Die einheimischen Sorten bedürften des Schutzes, gab er zur Begründung an. Das Moratorium währte allerdings nicht allzu lange. Anfang 2008 erlaubten die zuständigen Stellen die Aussaat des Labor-Mais wieder.
Raps made by BAYER
Seit einiger Zeit macht sich der Leverkusener Multi daran, Lebensmittel zu „verbessern“. So hat er mittels biotechnologischer Verfahren die Raps-Sorte INVIGOR HEALTH entwickelt. Diese muss bei der Weiterverarbeitung kein Härtungsverfahren mehr durchlaufen und bildet deshalb angeblich keine Trans-Fettsäuren mehr, die nach BAYER-Angaben das Herz/Kreislaufsystem schädigen können.
Pflanzen made by BAYER
Bislang leuchteten kaum einem die Segnungen der „grünen Gentechnik“ ein. BAYER hat aus dem Akzeptanz-Problem gelernt und will nun in die Pflanzen besser vermarktbare Eigenschaften einbauen. Seine Gen-KöchInnen suchen jetzt angeblich nicht mehr nach „dem maximalen Ertrag“. „Der richtige Mix vieler günstiger Eigenschaften“ ist ihnen wichtiger. In der Genter Versuchsküche des Konzerns arbeiten die WissenschaftlerInnen daran, den Stoffwechsel der Ackerfrüchte anzuregen, ihre Abwehrkräfte zu stärken und die Ausschüttung von Stresshormonen zu reduzieren. Wenn sich diese Eigenschaften, die der Agro-Riese schon in zehn Jahren wie „Legosteine“ zu kombinieren hofft, auf der freien Wildbahn einmal an Wildpflanzen vererben, dann dürfte ein Flurschaden ungeheurer Ausmaße einstehen.
PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE
BAYER-Pestizide sind überall
Das nordrhein-westfälische Umweltministerium hat die Pestizid-Belastungen von Obst und Gemüse im Internet öffentlich zugänglich gemacht. Unter www.ilm.nrw.de/pestrep/pestshow1.html listet es detailliert die Ergebnisse der Lebensmitteluntersuchungen auf. Wie nicht anders zu erwarten, ist BAYER prominent vertreten. Bei Äpfeln beispielsweise stammen fünf der zehn am häufigsten in den Früchten nachgewiesenen Ackergifte vom Leverkusener Multi. Die PrüferInnen stießen auf den unter dem Namen SEVIN oder SEVIN XLR PLUS vermarkteten Wirkstoff Carbaryl, auf Trifloxystrobin (FLINT), auf Chlorpyrifos (BLATTANEX, PROFICID und RIDDER), auf Pyrimethanil (CLARINET, FLINT STAR, MYSTIC, MYTHOS, SCALA, SIGANEX, VISION und WALABI) sowie auf die in der Bundesrepublik jüngst mit einem Verbot belegte Substanz Tolylfluanid. Bei Birnen, Tomaten & Co. dürfte der Marktanteil des Leverkusener Multis an den Giftdosen kaum geringer ausfallen.
Keine Zulassung für PONCHO
Die französischen Behörden haben BAYERs Saatgutbehandlungsmittel PONCHO mit dem Wirkstoff Clothianidine wegen seiner Bienengefährlichkeit eine Zulassung verweigert. Sie werteten die vom Agro-Riesen vorgelegten Unterlagen als „unpräzise“, „voller Ungereimtheiten“ und „nicht für eine Zulassungsprüfung geeignet“. Ihre Pendants in der Bundesrepublik und in anderen europäischen Ländern hatten da weniger Probleme: Sie genehmigten PONCHO ohne viel Federlesens.
Neue Vermarktungsstrategie für Pestizide
In Brasilien hat der Leverkusener Chemie-Multi eine neue Vermarktungsstrategie entwickelt, um den Absatz seiner Ultragifte BAYSISTON und FOLICUR unter den Kaffee-AnbauerInnen zu fördern: Er lässt sich in Naturalien auszahlen. „Diese Initiative vereinfacht das Leben des Kaffeebauern, denn er bezahlt mit seiner Produktion, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen“, so BAYERs Marketing-Direktor Gerhard Bohne (sic!).
BIOSPRIT & PROFIT
Agrosprit aus Institute
Der Leverkusener Multi versucht verstärkt, Biodiesel-Betrieben mit dem Zauberwort „Synergie-Effekte“ eine Ansiedlung in seinen von Leerständen heimgesuchten Chemie-Parks schmackhaft zu machen. In den USA erlag die KANAWHA BIODIESEL LLC den Lockrufen des Konzerns und bezog auf dem BAYER-Areal in Institute Quartier.
WASSER, BODEN & LUFT
Zwei neue Müllkraftwerke
Der Leverkusener Chemiemulti setzt bei seiner Energie-Versorgung zunehmend auf billige und dementsprechend umweltschädliche Lösungen. Neben Kohlekraftwerken zählen Müllkraftwerke, beschönigend Ersatzbrennstoffkraftwerke genannt, zu seinen Favoriten. So plant er in Brunsbüttel und Dormagen den Bau solcher Dreckschleudern, die unter anderem Dioxin, chlor-, brom- und fluorhaltige Kohlenwasserstoffe, Chloride, Furane, Kohlendioxid, Schwermetalle wie Quecksilber und Feinstaub, Rost-, Filter- und Kesselasche produzieren (siehe auch SWB 1/08).
Aus für Krefelder Kohlekraftwerk?
In Krefeld hält einstweilen die Opposition gegen das im Chemiepark von BAYER geplante Steinkohle-Kraftwerk mit einem Jahresausstoß von 4,4 Millionen Tonnen CO2, obwohl die CDU-Landtagsfraktion viel Druck auf ihre ParteifreundInnen vor Ort ausübt. Nachdem der Regionalrat den Bau einer solchen Dreckschleuder in einem Industriegebiet für grundsätzlich zulässig erklärte, indem er den Gebietsentwicklungsplan „nachbesserte“, änderten CDU und Grüne kurzerhand den Bebauungsplan, so dass dieser nun kein Kraftwerk in dieser Dimension mehr erlaubt. Beim Leverkusener Multi herrschte daraufhin „große Verbitterung“. Er hat jetzt ein Prüfverfahren bei der traditionell sehr BAYER-freundlichen Bezirksregierung beantragt und hofft auf einen positiven Bescheid bis zum Ende des Jahres.
Schadinsekten mögen CO2
ExpertInnen rechnen bis zur Mitte des Jahrhunderts mit einem Anstieg der Kohlendioxid-Konzentration in der Luft von bisher 380 ppm (Teile pro Million) auf 550 ppm, wozu BAYER mit einem jährlichen Treibhausgas-Ausstoß von 3,8 Millionen Tonnen nicht wenig beiträgt. ForscherInnen der Universität Illinois haben jetzt untersucht, welche Auswirkungen das auf das Verhalten von Schadinsekten hat. Auf einem Sojabohnenfeld simulierten sie die CO2-Erhöhung und stellten beim Japankäfer einen beträchtlich gewachsenen Appetit fest. Der durch die erhöhten Kohlendioxid-Werte in der Luft gestiegene Zuckergehalt bei reduziertem Eiweiß-Anteil brachten ihn auf den Geschmack. Und da die Pflanzen durch die veränderten Bedingungen weniger Abwehrstoffe produzierten, wurde er bei der Mahlzeit kaum noch gestört.
NANO & CO.
Nano im Beton?
Der Leverkusener Multi erweitert seine Produktpalette im Bereich der Nanotechnologie beständig. Er entwickelte bisher spezielle Duftkapseln, Folien, Eishockeyschläger und die BAYTUBE-Kohlenstoffröhrchen. Diese will er jetzt nicht nur Kunststoffen zusetzen, sondern auch Beton, um den Baustoff zugleich leichter und härter zu machen. Ein entsprechendes Forschungsprogramm führt der Leverkusener Multi gemeinsam mit dem „Institut für Bau- und Werkstoffchemie“ der Universität Siegen durch. Der Konzern erwartet von der „Zukunftstechnologie“ Millionen-Umsätze, nur leider teilt diese die schlechten Eigenschaften vieler alter Technologien: Sie stellt ein Risiko für Mensch, Tier und Umwelt dar. Das räumen BAYER & Co. sogar selber ein. „Bei vielen unlöslichen Nanomaterialien ist derzeit nicht auszuschließen, dass die inhalative Aufnahme dieser besonders kleinen Partikel am Arbeitsplatz zu Gefährdungen führen kann“, heißt es in dem vom „Verband der Chemischen Industrie“ gemeinsam mit der „Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin“ herausgegebenen „Leitfaden für Tätigkeiten mit Nanomaterialien am Arbeitsplatz“.
Mehr Nano aus Laufenburg
So ganz hat BAYER die Bande zu HC STARCK noch nicht gekappt. Der Leverkusener Multi nahm auf dem Laufenberger Werksgelände seiner ehemaligen Tochtergesellschaft eine Anlage zur Herstellung von BAYTUBE-Kohlenstoffröhrchen, die aus Nano-Materialien bestehen, in Betrieb. Zusammen mit der ebenfalls auf dem Areal befindlichen BAYTUBE-Pilotanlage will der Konzern damit die Jahresproduktion auf über 60 Tonnen ausweiten.
Kooperation mit FUTURECARBON
BAYER hat eine Zusammenarbeit mit der Bayreuther Firma FUTURECARBON vereinbart. Das Unternehmen produziert für den Leverkusener Multi eine Version der BAYTUBE-Nanoröhrchen in flüssiger Form. So will der Konzern in Zukunft auch mit Herstellern von Batterien und Wasserstoffspeichern ins Geschäft zu kommen.
Nano-Wirkstoffhüllen
Auch auf medizinischem Gebiet finden BAYER & Co. Anwendungsbereiche für die Nano-Technik. Bereits 40 nanomedizinische Produkte gibt es mittlerweile. Der Leverkusener Multi forscht zur Zeit an Arznei-Umhüllungen aus Nano-Materialien. Die winzig kleinen Kunststoff-Mäntel sollen ihre Fracht zielgenauer zum Wirkort transportieren und noch feinstes Gewebe durchdringen können. Eine Gesundheitsgefährdung ist mit dem bisschen Plaste & Elaste im Körper nach Ansicht des Leverkusener Multis nicht verbunden. „Nanomedizinische Produkte werden wie alle Arzneimittel umfassend geprüft und erst dann für den Markt zugelassen, wenn eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung für die Patienten positiv ausgefallen ist“, lässt er den Nanomediziner Dr. Oliver Bujok vom „Verein Deutscher Ingenieure“ (sic) versichern, ganz so, als ob es die Skandale um LIPOBAY und TRASYLOL nie gegeben hätte.
POLITIK & ÖKONOMIE
BAYERs AktionärInnen-Struktur
Bei den bundesdeutschen DAX-Unternehmen hat sich die AktionärInnen-Struktur in den letzten Jahren stark verändert. Besaßen ausländische KapitalanlegerInnen im Jahr 2005 rund ein Drittel der Aktien von MERCEDES, SIEMENS & Co., so konnten sie diesen Anteil bis 2007 auf 53 Prozent steigern. In ihrer Beliebtheitsskala liegt BAYER auf dem dritten Platz, 78 Prozent der AktionärInnen des Leverkusener Multis leben nicht in der Bundesrepublik. Die größte Beteiligung hält mit 20 Prozent die US-amerikanische Investmentgesellschaft CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY.
STANDORTE & PRODUKTION
Platzverweis für Rechtsextreme
Der Rechtsextreme Hans-Ulrich Pieper organisiert seit 1991 „Dienstagsgespräche“. Bisher nutzte er dafür in Dormagen auch das von BAYER verpachtete Parkrestaurant „Kasino“. Am 2.10.07 aber mussten Pieper, Holger Apfel, der Vize-Vorsitzende der NPD, Markus Beisicht, der Chef von „Pro Köln“ und „Pro NRW“ und ihre Anhängerschar draußen bleiben: Der Chemie-Multi machte erstmals von seinem Hausrecht Gebrauch. „Die „Dienstagsgespräche“ finden ab sofort nicht mehr in unserem Hause statt“ - diesen Hinweis im Eingangsbereich hatten die Rechten zur Kenntnis zu nehmen.
BAYER-Kaufhaus dicht
Die viel beschworene BAYER-Familie wird immer mehr zur Chimäre, weil die „Sozialpolitik“ für den Leverkusener Multi nicht mehr zum Kerngeschäft gehört. Nach der Schließung von Bibliotheken, Schwimmbädern, Werkskindergärten und der Abwicklung von Sportvereinen beraubte der Konzern seiner BAYER-Familie jetzt auch noch der Einkaufsmöglichkeit im werkseigenen Kaufhaus. Die 1897 gegründete „Konsumanstalt der Farbenfabriken“ schloss kurz vor Weihnachten 2007 endgültig ihre Pforten und muss nun einem Einkaufscenter weichen.
BAYWOGE wieder verkauft
Anfang 2002 hat BAYER seine Wohnungsgesellschaft BAYWOGE, die in Leverkusen über 6.000 Wohneinheiten verfügte, an die ESSENER TREUHANDSTELLE (THS) verkauft. Für die MieterInnen werde sich nichts ändern, betonte der Konzern damals. Ob sich dies bewahrheitet, steht nun allerdings in Frage, denn der Bund trennte sich von seinen THS-Anteilen und veräußerte sie für 450 Millionen Euro an die beiden anderen Gesellschafter, die RUHRKOHLE AG und die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE. Da das für die beiden neuen Besitzer schwierig zu refinanzieren ist, befürchten der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach und der SPD-Kommunalpolitiker Jürgen Scharf Nachteile für die MieterInnen. Zu verkaufsbedingten Mieterhöhungen darf es nach dem Vertrag von 2002 zwar nicht kommen, aber Scharf rechnet mit Einsparungen bei der Instandsetzung und bei der Modernisierung.
Neues Werk in Köln-Knapsack
BAYER baut in Köln-Knapsack für 60 Millionen Euro eine neue Anlage zur Pestizid-Herstellung. Unter anderem will der Konzern dort Glufosinat produzieren. Dass die EU diesen Stoff, den der Konzern bevorzugt in Kombination mit seinen Glufosinat-resistenten Gentech-Pflanzen der LIBERTY-LINK-Serie vermarktet, wegen seiner Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt gerade einer Sicherheitsprüfung unterzieht, scheint den Agro-Riesen nicht abzuschrecken.
BAYER wirbt auf der „Expo Real“
Der Leerstand in seinen Chemieparks bewog den Leverkusener Multi dazu, auf der Münchener Immobilien-Messe „Expo Real“ offensiv um neue Mieter zu werben. Die Standkosten teilte sich der Konzern mit der „Wirtschaftsförderung Leverkusen“, die ihrerseits den Manforter Innovationspark und die „Neue Bahnstadt Opladen“ anpries.
BAYER-Kreuz bleibt
Nach vielen Protesten hat sich der Pharma-Riese entschieden, sein weit über Leverkusen hinaus sichtbares BAYER-Kreuz nicht abzureißen. Zu den Gründen der „Denkmalschutz-Initiative“ schreibt die Süddeutsche Zeitung: „Weil seit langem auch über Ausgliederungen von Geschäftsbereichen und Stellenabbau diskutiert wird, ist auch dem letzten Romantiker in der Stadt klar, dass BAYER kein Wohltäter ist, sondern eine Firma, die gut wirtschaften wird. Dennoch erschien manchem in Leverkusen der Abriss des Kreuzes als symbolischer Akt, als endgültiger Bruch mit der Tradition. Eine solche Stimmungslage kann der BAYER-Führung nicht recht sein. Mit der Entscheidung, das Kreuz stehen zu lassen, signalisiert der Konzern, dass er die Wünsche seiner Nachbarn ernst nimmt“.
Neue Nano-Anlage
BAYER hat in Laufenburg eine neue Anlage zur Herstellung von Nano-Röhrchen in Betrieb genommen (siehe NANO & CO.).
Kommt die Verbund-Feuerwehr?
Wie an allen anderen BAYER-Standorten ist auch die 40-köpfige Werksfeuerwehr in Brunsbüttel von Rationalisierungsmaßnahmen bedroht. „Wir müssen was machen, die Kosten treiben uns. Am Ende geben wir Stück für Stück an Sicherheit auf“, warnt der Betriebsratsvorsitzende Hans-Joachim Möller und machte den Vorschlag, eine von allen Unternehmen im Chemiepark getragene Verbund-Feuerwehr zu gründen.
IMPERIUM & WELTMARKT
Nano-Röhrchen mit FUTURECARBON
Der Leverkusener Multi hat auf dem Gebiet der Nanotechnik eine Zusammenarbeit mit dem Bayreuther Unternehmen FUTURECARBON begonnen (siehe NANO & CO.).
PRODUKTION & SICHERHEIT
Berufskrankheit „Asbestose“
Der lange Zeit vor allem in der Bau- und Chemieindustrie verbreitete Werkstoff Asbest ist zwar seit 1993 verboten, aber seine Wirkungen entfaltet er noch heute, da es bis zu 40 Jahren dauern kann, bis z. B. eine Asbestose ausbricht. So zählen durch Asbest ausgelöste Leiden mit einem Anteil von über 15 Prozent immer noch zu den häufigsten - und tödlichsten - Berufskrankheiten. Wieviele ehemalige BAYER-Beschäftigte davon betroffen sind, darüber schweigt sich der Pharma-Riese aus. Die letzten Angaben datieren aus dem Jahr 2000, wo der Konzern die Zahl der anerkannten Berufskrankheiten auf 130 bezifferte und kurz und knapp mitteilte: „Als Krankheitsauslöser waren bei uns vor allem Expositionen gegen Asbest und Lärm relevant“.
UNFÄLLE & KATASTROPHEN
Ammoniak-Austritt: 23 Verletzte
Im Wuppertaler BAYER-Werk kam es am 12.3.08 durch eine bei Reparaturarbeiten versehentlich geöffnete Leitung zu einem Austritt von Ammoniak. 23 Personen zogen sich eine Vergiftung zu und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Feuerwehr forderte die BewohnerInnen auf, die Fenster geschlossen zu halten und ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Die Schwebebahn stellte umgehend den Betrieb ein. Die WuppertalerInnen hatten dabei noch Glück im Unglück, denn das Sturmtief „Kirsten“ sorgte dafür, dass die gen Innenstadt ziehende Giftwolke rasch vom Winde verweht wurde. „Die Wetterlage hat uns in die Hände gespielt“, so ein Feuerwehr-Sprecher erleichtert.
Thiodicarb-Fässer geborsten
Am 28. Dezember 2007 barsten am US-amerikanischen BAYER-Standort Institute mehrere Fässer mit dem von der Weltgesundheitsorganisation WHO als „extrem gefährlich“ eingestuften Pestizid Thiodicarb. Mehrere AnwohnerInnen mussten sich daraufhin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Aufgrund der starken Geruchsbelästigung liefen bei den Behörden die Telefone heiß. Die zögerliche Informationspolitik des Konzerns rügte der zuständige Verwaltungschef als „bodenloses Verhalten“ (siehe auch SWB 1/08).
Sturz in den Tod
Am 15. November 2007 stürzte auf dem Gelände des Uerdinger Chemieparks ein Arbeiter einer Fremdfirma bei Abbrucharbeiten 25 Meter tief in einen Lichtschacht und kam dabei ums Leben.
Arbeiter verlor Bein
Am 29 Februar 2007 geriet ein Arbeiter des Baytowner BAYER-Werks unter einen Schienenwagen und verlor dabei ein Bein.
RECHT & UNBILLIG
Gericht contra Pipeline
Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Münster hat BAYER verboten, die momentan im Bau befindliche Kohlenmonoxid-Pipeline in Betrieb zu nehmen und entzog damit dem von allen Landtagsparteien im Schnellverfahren verabschiedeten Enteignungsgesetz die Rechtsgrundlage. „Es fehlt eine überzeugende Darstellung der Bedeutung, die die von der Firma BMS (BAYER MATERIAL SCIENCE, Anm. SWB), einem privaten Unternehmen, betriebene Rohrleitungsanlage für die Allgemeinheit hat, um den staatlichen Zugriff auf das Eigentum Dritter zu rechtfertigen. Es müssten konkrete Informationen gegeben werden, beispielsweise Angaben zur Zahl der entstehenden Arbeitsplätze“, urteilten die RichterInnen und schlossen sich damit der Argumentation der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und anderer Initiativen an. In zwei weiteren Verfahren verbot das OVG dem Chemie-Multi das Verlegen der Rohre auf den Grundstücken von Gemeinden, die gegen das Enteignungsgesetz geklagt hatten. „Eine Ohrfeige für den Landtag“, kommentierte die Rhein