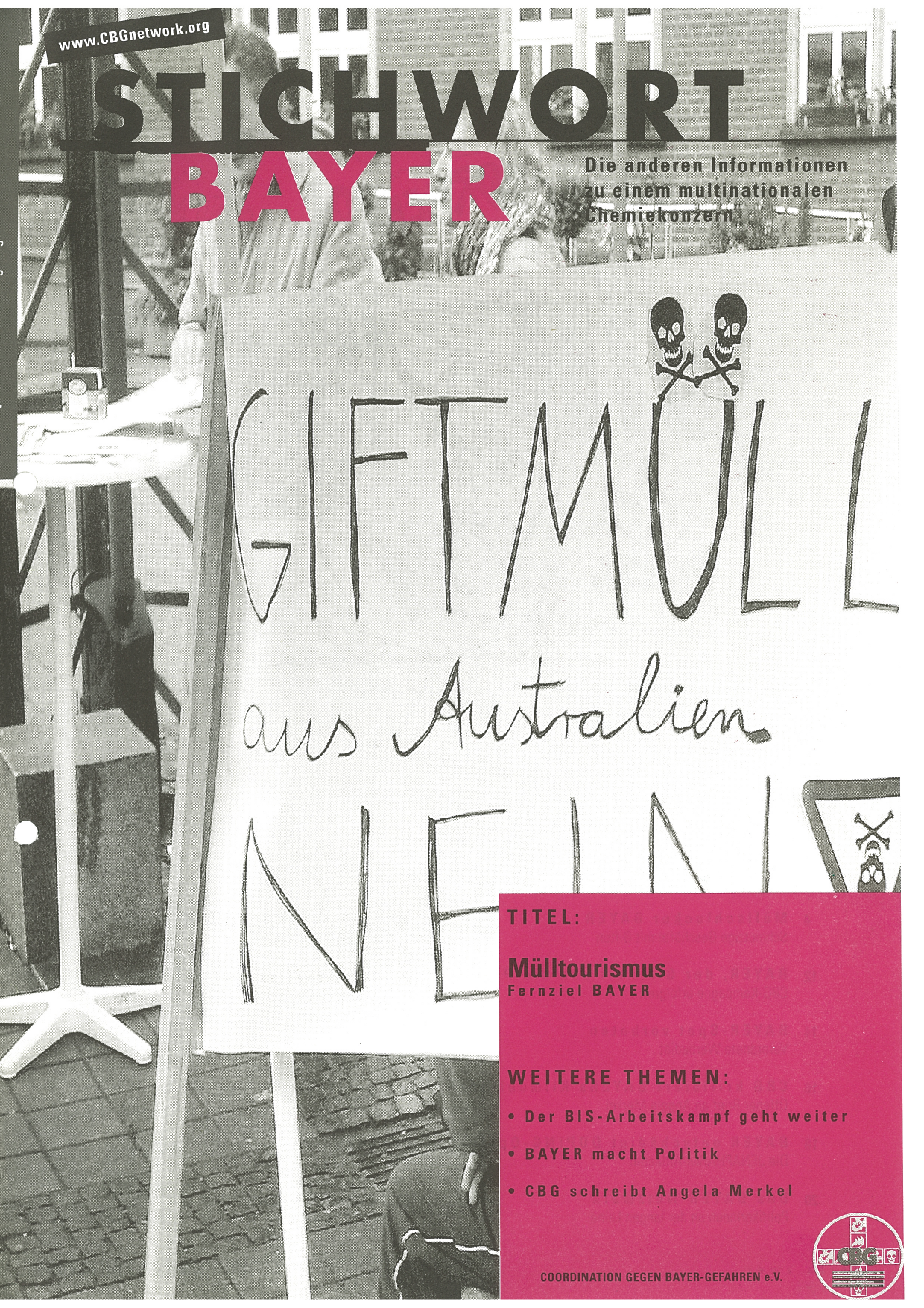AKTION & KRITIK
CBG schreibt Angela Merkel
Im Dezember 2006 wandten sich BAYER-Chef Werner Wenning und andere Konzern-Bosse in einem Schreiben an Angela Merkel, in dem sie die Bundeskanzlerin aufforderten, sich in Brüssel für großzügiger bemessene Lizenzen zum Kohlendioxid-Ausstoß einzusetzen (siehe POLITIK & EINFLUSS). Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) nahm dies zum Anlass, die CDU-Politikerin in einem Offenen Brief auf das umfängliche Klimasünden-Register des Unternehmens hinzuweisen, das unter anderem aus geschönten Klimabilanzen besteht, aus denen die von externen Stromanbietern bezogene Energie herausrechnet ist(siehe auch SWB 1/07).
Umweltbundesamt meldet sich
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hat die Explosion in einer brasilianischen BAYER-Anlage (siehe auch UNFÄLLE & KATASTROPHEN) per Presse-Information publik gemacht. Als Reaktion auf die Veröffentlichung wandte sich ein Mitarbeiter des Umweltbundesamtes an die CBG. Er führt für die Störfall-Kommission über Unfälle Buch und bat darum, künftig von der Coordination über Ereignisse bei BAYER in Kenntnis gesetzt zu werden.
CBG veröffentlicht Unfallliste
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hat den jüngsten Störfall in einem BAYER-Werk, die Explosion am brasilianischen Standort Belford Roxo, zum Anlass genommen, eine Unfallliste zu veröffentlichten. Die Aufstellung beginnt 1992, führt 70 Vorfälle auf und dokumentiert somit den Normalfall „Störfall“.
Task Force für Firmenschließung
Die von dem Entsorgungsunternehmen PHILIPS SERVICES vorgenommene Reinigung von Behältern, in denen BAYER mit Propylmercaptan einen Bestandteil des Pestizides MOCAP herstellte, löste bei über 250 AnwohnerInnen in einem Umkreis von 50 Quadratmeilen Krankheitssymptome wie Kopfschmerzen, Brechreiz, allergische Reaktionen und Atemstörungen aus (Ticker 2/06). Die staatlichen Behörden überprüften die Firma, gaben ihr jedoch bald wieder eine Betriebserlaubnis. Die SOUTH FULTON/FAYETTE COMMUNITY TASK FORCE fordert jedoch eine Schließung, bis WissenschaftlerInnen die genaue Ursache der Gesundheitsstörungen herausgefunden haben. Der Kongressabgeordnete David Scott schloss sich diesem Begehr an und schrieb einen entsprechenden Brief an die US-Umweltbehörde EPA. Diese sah jedoch keinen Handlungsbedarf, woraufhin die Task Force ein Protestschreiben aufsetzte. „Wir sind sehr enttäuscht über die mangelnde Bereitschaft der EPA, die Gesundheit der BürgerInnen zu schützen“, heißt es darin.
Neue MedizinerInnen-Initiative
BAYER & Co. versuchen auf vielfältige Weise, das Verschreibungsverhalten der MedizinerInnen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. So hat der Leverkusener Multi in der Vergangenheit ÄrztInnen Reisen im Orientexpress spendiert und ihnen für so genannte Beobachtungsstudien viel Geld gezahlt. Die neue MedizinerInnen-Initiative MEIN ESSEN ZAHL ICH SELBST (MEZIS) geht jetzt auf Distanz zur Pharmaindustrie. Mitglieder von MEZIS empfangen keine PharmareferentInnen in ihren Praxen, nehmen keine Musterpackungen und Geschenke an, beteiligen sich nicht an Arznei-Anwendungsstudien und verzichten auf Praxissoftware, die von den Pillenriesen gesponsort ist.
BfArM wehrt sich
Beharrlich arbeitet Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt daran, das für Pillen-Zulassungen zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-Produkte (BfArM) industrie-freundlicher zu gestalten. Nachdem eine Arbeitsgruppe, in der auch Vertreter von BAYER saßen, dem Institut vorwarf, der „Arzneimittel-Zulassung als Wettbewerbs- und Standort-Faktor“ nicht genügend Beachtung zu schenken, schasste Schmidt im Jahr 2005 den Leiter Harald Schwelm und ersetzte ihn durch den „Reformator“ Reinhard Kurth. Anfang 2007 präsentierte sie schließlich einen Gesetzesentwurf zur Umwandlung des BfArM in eine rechtlich eigenständige Gesellschaft. Der Personalrat der Institution wandte sich jedoch scharf gegen die Pläne, die das Bundesinstitut „durch eine erhebliche Unterfinanzierung in eine höhere Abhängigkeit führen werden“. Perspektivisch soll es nämlich seine Kosten nur noch durch die von BAYER & Co. erhobenen Gebühren decken.
Grüne für Aufsichtsratsquoten
Die Aufsichtsräte der bundesdeutschen Unternehmen sind nur zu 7,5 Prozent mit Frauen besetzt und 80 Prozent dieser Glücklichen verdanken ihr Mandat nicht den Konzernen, sondern den Gewerkschaften. So sitzt im 21-köpfigen BAYER-Aufsichtsrat nur eine Frau: Petra Kronen, die Betriebsratsvorsitzende des Uerdinger Werkes. Um diesen Missstand zu ändern, haben die NRW-Grünen die Landesregierung in einem Antrag aufgefordert, sich auf Bundesebene für die Einführung einer Frauenquote von 40 Prozent nach norwegischem Vorbild einzusetzen.
Imkerverband kritisiert Bienen-Monitoring
Französische ImkerInnen machten das BAYER-Pestizid GAUCHO mit dem Wirkstoff Imidacloprid für den Tod von Milliarden Bienen mitverantwortlich, weshalb ihre Regierung 2004 die Ausbringung des Ackergiftes auf Sonnenblumen- und Maisfeldern untersagte. Auch in der Bundesrepublik kam es zu einem Bienensterben im großen Ausmaß. Auf Druck der BienenzüchterInnen initiierte Rot/Grün deshalb eine Untersuchung. Allerdings unterstützten BAYER & Co. das „Bienenmonitoring“ finanziell und nahmen auch selbst daran teil. Der Leverkusener Multi ließ es sich dann auch nicht nehmen, selbst die Bienengefährlichkeit von GAUCHO zu testen. Vorhersehbarer Befund: Kein Grund zur Beunruhigung. Der „Deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund“ gibt sich mit diesem Ergebnis jedoch nicht zufrieden und fordert Studien von nicht konzern-gebundenen WissenschaftlerInnen ein. In einer Presseerklärung kritisierte der Verband das Bienen-Monitoring als reine PR-Maßnahme und drohte mit dem Ausstieg.
Sonnleitner rät von Gentechnik ab
Der Bauernverbandspräsident Gerd Sonnleitner ist zwar kein Gentechnik-Gegner, hat sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber gegen die Aussaat von Pflanzen mit verändertem Erbgut ausgesprochen. „Wir müssen vom Anbau gentechnisch veränderten Saatguts abraten. Und genau das wollte die Bundesregierung. Ich kann doch den Landwirten nicht etwas empfehlen, was unabsehbare Risiken birgt. Zudem wollen die Verbraucher die Produkte auch nicht. Warum sollen wir etwas produzieren, was niemand will“, so Sonnleitner in einem Interview mit der Rheinischen Post.
UNEP-Direktor kritisiert BAYER & Co.
Der bundesdeutsche Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), Achim Steiner, hat den Widerspruch zwischen Worten und Taten kritisiert, den BAYER & Co. in Sachen „Klimaschutz“ an den Tag legen. „Was mich in den letzten Monaten überrascht hat, ist eine gewisse Doppelzüngigkeit der Industrie“, sagte Steiner im Hinblick auf Lippenbekenntnisse zur Kohlendioxid-Reduzierung bei internationalen Konferenzen und nachfolgender klimaschädigender Realpolitik der Unternehmensverbände.
KAPITAL & ARBEIT
3,9 Prozent mehr Lohn
Um 133 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro stieg der Gewinn von BAYER im Geschäftsjahr 2005. Die anderen Unternehmen der Branche verdienten fast ebenso gut. Deshalb mussten die Chemie-Firmen ihre Beschäftigten zumindest einen marginalen Anteil an den Zuwächsen gewähren. Die Tarifparteien einigten sich im Marz 2007 auf eine Lohnsteigerung von 3,6 Prozent. Zudem vereinbarten Arbeitgeber und die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE eine Einmalzahlung, die 0,7 Prozent eines Monatsentgelts multizipliert mit dem Faktor 13 ausmacht. Diese kann allerdings entfallen, wenn der Betriebsrat des zahlungsunwilligen Unternehmens seine Einwilligung gibt. Zudem stimmten die Gewerkschaften abermals dem Vorgehen der Konzerne zu, bei der Einstellung von Langzeitarbeitslosen und Berufsanfängern nur 90 bis 95 Prozent des Tariflohns zu zahlen. Die kapitalfreundliche Presse kritisierte indessen das Verhandlungsergebnis. „Niemand will den Arbeitnehmern einen ordentlichen Schluck aus der Pulle vorenthalten. Doch diesmal haben sie den Mund zu voll genommen. Daran könnte sich nicht nur die Chemie verschlucken“, schrieb die Faz im Hinblick auf die noch kommenden Tarifrunden in anderen Wirtschaftszweigen.
SCHERING-Übernahme kostet Jobs
Gleich nach dem Kauf des Pharma-Unternehmens SCHERING kündigte BAYER an, 6.000 Arbeitsplätze vernichten zu wollen. Im März 2007 konkretisierte der Leverkusener Multi seine Pläne. Er kündigte an, in der Bundesrepublik 1.500 Stellen zu streichen, mit 1.200 einen Großteil davon am Berliner Stammsitz der Neuerwerbung. Weder Proteste der Belegschaft noch Interventionen des Wirtschaftssenators Harald Wolf und des Bürgermeisters Klaus Wowereit - „Es kann nicht sein, dass durch die Übernahme Mitarbeitern die Zukunft genommen wird“ - konnten den Pharmariesen von seinem Tun abbringen. In Wuppertal stehen 160 Jobs zur Disposition, in Jena 140. Die restlichen Arbeitsplätze baut der Konzern im übrigen Europa (1.650), in den USA (1.000), in Lateinamerika und Kanada (1.200) und Asien (750) ab.
Unfreundliche SCHERING-Übernahme
In der Übernahme-Schlacht um SCHERING trat BAYER als „weißer Ritter“ auf, der den Berliner Pharma-Multi im letzten Moment aus den Klauen des „bösen“ MERCK-Konzerns befreit. Auch nach dem Kauf demonstrierten BAYER-Boss Werner Wenning und SCHERING-Chef Hubertus Ehlen stets Einvernehmlichkeit, und die Leverkusener Edelmänner ließen dem Traditionsunternehmen sogar den Namen. Das war aber auch alles. Bei weniger weichen Themen gab sich BAYER unerbittlich. Im fünfköpfigen Verstand des neu gegründeten Pharma-Riesen fanden sich zunächst nur zwei ehemalige SCHERING-Manager wieder. Und im Januar 2007 war es dann nur noch einer. Der für Forschung und Entwicklung zuständige Marc Rubin musste gehen. „Es ist eine mit aller Härte durchgesetzte Übernahme. Das bekommen jetzt die Mitarbeiter zu spüren“, kommentierte Malte Diesselhorst von der „Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz“ den Vorgang.
BAYER verkauft WOLFF WALSRODE
Die 17 Milliarden Euro teure SCHERING-Übernahme fordert einen weiteren Tribut. Nachdem BAYER im November 2007 HC STARCK verkauft hatte, stieß der Konzern im Monat darauf WOLFF WALSRODE ab. DOW CHEMICAL erwarb die Tochtergesellschaft. Den Preis schätzen MarktbeobachterInnen auf 400 bis 500 Millionen Euro. Bei den Beschäftigen beginnt nun das Zittern um ihre Arbeitsplätze.
LANXESS verkauft Textilchemikalien
Der arbeitsplatzvernichtende Spaltungsprozess von BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS geht munter weiter. Nachdem der Konzern im Mai 2006 das Geschäft mit dem Styrol-Kunststoff SAN an BASF veräußerte, verkaufte er im Januar 2007 die Textilchemikalien-Sparte. Den nordamerikanischen Geschäftsteil erwarb STARCHEM, der Rest ging an den niederländischen Finanzinvestor EGERIA im Verbund mit den ehemaligen ManagerInnen des Unternehmensteiles.
LANXESS: Aus für Langenfeld
BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS macht den Standort Langenfeld dicht. Das Unternehmen will alle Vertriebsaktivitäten künftig vom Stammsitz Leverkusen aus steuern. 121 Langenfelder wechseln dorthin, 30 gehen nach Dormagen oder Krefeld. Dem Rest bleibt nur die Arbeitslosigkeit. „Für die verbleibenden Mitarbeiter aus der Verwaltung, deren Arbeitsplätze dann entfallen, werden gegenwärtig in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat Lösungen gesucht“, umschreibt es die LANXESS-Presseinformation.
Schmoldt: „Lebenslüge Vollbeschäftigung“
Der BAYER-Aufsichtsrat und Vorsitzende der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE), Hubertus Schmoldt, hat die Ansicht, ein konjunktureller Aufschwung könne die Arbeitslosigkeit signifikant abbauen, als „Lebenslüge“ bezeichnet. Schmoldt empfahl dagegen, zur Schaffung von Arbeitsplätzen einen staatlich alimentierten Billiglohnsektor einzurichten. Das schmale Salär, das BAYER & Co. dann nur noch zu zahlen haben, soll die Bundesagentur für Arbeit dann um 20 Prozent aufstocken. Der Gewerkschaftsvorsitzende findet auch nichts dabei, wenn Beschäftige zwei Jobs annehmen müssen, um sich durchzuschlagen, da sei er sich des Dissenses mit seinen DGB-Kollegen durchaus bewusst, so der IG BCEler zur Faz.
Mitbestimmungskommission gescheitert
Der neoliberal entfesselte Kapitalismus setzt auch das bundesdeutsche Modell der Mitbestimmung unter Druck. Auf Vorschlag des BAYER-Aufsichtsrats und Vorsitzenden der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE), Hubertus Schmoldt, hatte der damalige Bundeskanzler Schröder deshalb eine Kommission ins Leben gerufen, die Empfehlungen zur Mitbestimmung „in Zeiten der Globalisierung“ vorlegen sollte. Dem unter der Leitung von Kurt Biedenkopf stehenden Gremium gehörten Gewerkschaftler, Unternehmer und Wissenschaftler an, die unterschiedliche Zielrichtungen verfolgten. BDI-Präsident Jürgen Thumann und seine Kollegen sahen die Runde als ein willkommenes Instrument an, die Mitbestimmung zu demonierten, was auf den Widerstand von DGB-Chef Michael Sommer stieß. Deshalb konnte Biedenkopf der Presse im Dezember 2006 keinen gemeinsamen Abschlussbericht präsentieren. Schmoldt, welcher der Kommission nicht angehörte, gab aber nicht auf und schlug Mindeststandards zur Mitbestimmungsreform wie einen 12-köpfigen, auch mit Arbeitnehmervertretern von ausländischen Niederlassungen besetzten Aufsichtsrat vor.
Keine Altersgrenze für ManagerInnen
Durch Regelungen zur Altersteilzeit und andere Instrumente hat der Leverkusener Multi ältere Beschäftigte konsequent aus dem Erwerbsleben gedrängt. Nur sich selbst hat der Vorstand vor dem Jugendwahn verschont, so dass die Konzern-Spitze auch die Spitze der BAYER-Alterspyramide bildet. Und dies soll nach Ansicht von BAYER-Chef Werner Wenning auch so bleiben. Da der 59-Jährige eigentlich mit dem 63. Lebensjahr ausscheiden müsste, betrieb er schon mal Arbeitsplatzsicherung in eigener Sache und brach eine Lanze für rüstige Senioren von seinem Schlage. „Ich halte nichts von starren Altersgrenzen“, vertraute er der Bild am Sonntag an, für den Vorstandsvorsitzenden ist das Karriere-Ende „keine Frage von jung oder alt, sondern eine Frage der Leistungsfähigkeit“.
BKK erhöht ihre Beiträge
Die bitter teuren Pillen des Leverkusener Multis bereiten auch der eigenen Betriebskrankenkasse BAYER BKK Kopfschmerzen. Um die ständig steigenden Ausgaben für Medikamente finanzieren zu können, musste diese ihren Betragssatz auf 13,5 Prozent anheben.
BKK fusioniert mit FORTISNOVA
Die hausgemachten Finanzprobleme (s. o.) haben BAYERs Betriebskrankenkasse zu einer Fusion mit der BKK FORTISNOVA bewogen. Der Zusammenschluss zur BKK NOVA - nunmehr eine der 10 größten Betriebskrankenkassen der Bundesrepublik - soll „Verwaltungskosten“, also Arbeitsplätze sparen. Betriebsbedingte Kündigungen schloss der Leverkusener Multi einstweilen allerdings aus.
Arbeitsplatzvernichter Nr. 3
Auf der Hitliste der Top-Arbeitsplatzvernichter des Jahres 2006 belegt BAYER mit dem Abbau von 6.000 Jobs Platz 3. Nur VOLKSWAGEN und ALLIANZ strichen mehr Stellen.
Mehr Profit, weniger Beschäftigte
1980 sorgten in der Chemiebranche 560.000 Beschäftigte für einen Umsatz von 70 Milliarden Euro. Im Jahr 2006 waren es nur noch ca. 430.000, während die Einnahmen auf 160 Milliarden stiegen. Da haben BAYER & Co. dank der gestiegenen Arbeitsproduktivität ihrer MitarbeiterInnen über die Jahre einen ganz schönen Schnitt gemacht.
Das Ende des Konsenses?
Rolf Nietzard, der inzwischen pensionierte ehemalige Betriebsratsvorsitzende von BAYER, sieht schwerere Zeiten auf den Leverkusener Multi zukommen. Vor seinem geistigen Auge erscheinen schon Kundgebungen mit mehreren tausend TeilnehmerInnen vor den Leverkusener Werkstoren. „Wenn die Leute Angst um ihren Arbeitsplatz haben, gibt es auch in der Chemie keinen Konsens“, so Nietzard in der Zeit.
Sparen, sparen, sparen
Die Übernahme von SCHERING durch BAYER führt nicht zu einer blühenden Forschungslandschaft mit den entsprechenden Erträgen. Im Gegenteil: Kahlschlag ist angesagt. „Sparen, sparen, sparen, heißt die Devise. Als Pharma-ManagerInnen beim „Integrationsteam“ nachfragten, ob auch eine Expansion und damit verbunden eine Erhöhung der Erlöse zu den künftigen Geschäftszielen von BAYER SCHERING PHARMA gehöre, beschieden die FusionistInnen ihnen kurz und knapp: „Sie werden daran gemessen, wie Sie Ihr Ziel, die Kosten zu senken, erreichen“. Als erste Maßnahme kündigte BAYERs neuer Pharma-Chef Arthur Higgins eine Großinventur aller in der Pipeline befindlichen Projekte mit dem Ziel einer Ausmusterung wenig aussichtsreicher Kandidaten an. Higgins will lieber externes Know-how zukaufen und weiterverarbeiten. Das dürfte in den Labors von BAYER SCHERING PHARMA so einige Jobs kosten.
POLITIK & EINFLUSS
Wenning & Co. schreiben Merkel
Vor einigen Jahren hat die EU den Emissionshandel mit Kohlendioxid-Verschmutzungsrechten eingeführt. Er sieht vor, BAYER & Co. CO2-Emissionen nur in einer bestimmten Menge zu gestatten. Alles, was über ein bestimmtes Limit hinausgeht, sollte den Konzernen teuer zu stehen kommen, weil sie dafür Verschmutzungsrechte kaufen müssten. Damit wollte Brüssel Anreize zu Klimaschutz-Maßnahmen schaffen. Diese blieben allerdings weitgehend aus: Die Lizenzen zum CO2-Ausstoß waren so großzügig bemessen und überdies kostenlos, dass die Schornsteine der Industrie weiterhin nach Lust und Laune qualmen konnten. „Noch nie war es so billig, die Umwelt zu belasten“, urteilt etwa die Faz. Und die Bundesregierung tat nichts, um für eine Preiserhöhung zu sorgen. Der neue Nationale Allokationsplan bezog zwar erstmals auch Chemie-Anlagen in den Emissionshandel ein, beantragte bei der Europäischen Union jedoch Verschmutzungsrechte in Höhe von 465 Millionen Tonnen. Der EU-Umweltkommissar Stavros Dimas lehnte das jedoch ab und drückte die Zahl auf 453 Millionen Tonnen. Da sahen BAYER & Co. mal wieder den Untergang des Abendlandes heranziehen. BAYER-Chef Werner Wenning und die Bosse anderer Unternehmen schrieben einen Brandbrief an Angela Merkel. „Damit drohen Konsequenzen nicht nur für die Versorgungssicherheit, sondern auch für Arbeit und Wertschöpfung am Standort Deutschland“, schrieben sie und forderten eine politische Intervention. Diese Dreistigkeit erboste sogar konservative Politiker. „Der BDI muss sich entscheiden, ob er sich ernsthaft für den Klimaschutz engagieren oder an der Realisierung der Klimakatastrophe arbeiten will“, meinte etwa der CDU-Politiker Günter Krings. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN nahm das Vorgehen der Manager zum Anlass, ebenfalls ein Schreiben an Angela Merkel aufzusetzen (siehe AKTION & KRITIK).
EU-Parlament verabschiedet REACH
Am 13.12.06 hat das EU-Parlament das Chemikaliengesetz REACH verabschiedet. Nur die Fraktionen der Linken und der Grünen stimmten dagegen. „Die Verordnung trägt klar die Handschrift der deutschen Chemiebranche“, sagte die Grünen-Abgeordnete Hiltrud Breyer zur Begründung der Ablehnung. BAYER & Co. müssen dank ihrer erfolgreichen Lobby-Arbeit jetzt nur noch 30.000 Chemikalien auf ihre gesundheitsschädliche Wirkung hin untersuchen. Für chemische Altlasten reicht es überdies, einen einfachen Grunddatensatz vorzulegen. Elf Jahre haben die Konzerne dafür Zeit. Auch besteht für sie nicht mehr - wie ursprünglich geplant - die Pflicht, gefährliche Stoffe vom Markt zu nehmen. Krebserregende Substanzen etwa, für die es keinen Ersatz gibt, darf die Industrie weiter vermarkten, wenn die Produktion in geschlossenen Kreisläufen verläuft oder die „Chemie im Alltag“ einen bestimmten Grenzwert nicht überschreitet. Gibt es eine Alternative, so können die Unternehmen erst einmal auf Zeit spielen und einen „Substitutionsplan“ erstellen.
Winnacker will mehr Stammzellen
In den letzten Monaten seiner Amtszeit als Vorsitzender der „Deutschen Forschungsgemeinschaft“ trat der BAYER-Aufsichtsrat Ernst-Ludwig Winnacker noch einmal vehement für für eine Änderung des Stammzell-Gesetzes von 2002 ein. Es erlaubt Forschungen mit Stammzellen aus zuvor getöteten Embryos, allerdings nur mit bis zum Jahr 2002 gewonnenen, da der Gesetzgeber BAYER & Co. nicht die Lizenz zum Töten geben wollte. Eben diese möchte Winnacker jetzt haben. Er forderte, die Stichtagsregelung ganz aufzuheben, und die FDP machte sich seinen Vorschlag zu Eigen. Der Bundestag lehnte einen entsprechenden Antrag der Partei am 1. Februar 2007 jedoch ab.
Neues Gentechnikgesetz
Das Bundeskabinett einigte sich Ende Februar 2007 auf Eckpunkte zum geplanten Gentechnik-Gesetz. Die Gentechnik biete „interessante Perspektiven“ für die Ernährung, Energie- und Rohstoffversorgung, heißt es dort forsch. Von Risiken und Nebenwirkungen ist dagegen nicht viel die Rede. Im Falle eines Falles will der Staat die Haftung übernehmen, etwa wenn den WissenschaftlerInnen von BAYER & Co. mal etwas daneben (auf die Felder mit konventionell oder ökologisch angebauten Ackerfrüchte) geht. Für GAUs im kommerziellen Anbau soll künftig ein Fonds der Biotech-Branche aufkommen. Zur Sicherung der friedlichen Koexistenz zwischen gentechnischer und traditioneller bzw. ökologischer Landwirtschaft sieht der Entwurf eine Abstandsregelung vor, die mit 150 Meter allerdings knapper als in vielen europäischen Ländern bemessen ist und auch kaum das probate Mittel gegen Auskreuzungen darstellt. Die Blütenpollen überallhin tragenden Bienen beispielsweise pflegen sich nicht an solche Regularien zu halten, weshalb Seehofer & Co. auch nicht die Absicht haben, ImkerInnen für etwaige Gen-Kontaminationen haftbar zu machen. Die Gentech-Lobby hat also wieder einmal ganze Arbeit geleistet.
BAYER & Co. kooperieren mit dem BKA
„Weltkrieg um Wohlstand“ und „Der neue kalte Krieg. Kampf um die Rohstoffe“ - so lauten die Titel zweier populärer Wirtschaftsbücher. Der martialische Tonfall zeugt von einer zunehmenden Aggressivität bei der Jagd nach Profiten. Im Zuge dieser Aufrüstung bauen BAYER & Co. zunehmend auf eine Kooperation mit den Geheimdiensten. Vereinbarten die Konzerne bereits im April 2006 einen verstärkten Informationsaustausch mit dem Bundeskriminalamt (Ticker 2/06), so kam es nach Informationen von www.german-foreign-policy.com nun zur Einrichtung einer „Zentralen Koordinierungsstelle zur Weitergabe von Sicherheitsinformationen zwischen Staat und Wirtschaft“. Das „Bereitstellen von Risikoanalysen durch staatliche Ressorts und Nachrichtendienste bei der Erschließung neuer Märkte sowie Produktions- und Entwicklungsstandorte“ sowie Unterstützung bei der Eindämmung der Produktpiraterie erwartet sich der „Bundesverband der Deutschen Industrie“ hauptsächlich von den Schlapphüten.
BAYER & Co. lassen spionieren
Der so genannte Krieg gegen den Terror lässt dem CIA und anderen Geheimdiensten noch genug Zeit, mit ihrer Schnüffelei auch etwas für den heimischen Standort zu tun und Wirtschaftsspionage zu betreiben. Die hiesigen Dienste zieren sich dabei noch ein wenig, obwohl Besserung naht (s. o.). Nach Aussage des Geheimdienst-Experten Udo Ulfkotte fragen BAYER & Co. solche Geheimdienstleistungen deshalb mit Vorliebe bei russischen SpionInnen oder speziellen Consulting-Agenturen nach.
Weichmacher-Entlastungsstudie erschienen
Weichmacher wie das von BAYER hergestellte Bisphenol A können wegen ihrer hormon-ähnlichen Wirkung die Hirnentwicklung stören sowie Krebs, Unfruchtbarkeit oder Erbgutschädigungen verursachen. Darum fordert die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN gemeinsam mit anderen Verbänden seit Jahren ein Verbot dieser Stoffe. Jetzt kommt der Brüsseler Think-Tank „Centre for the New Europe“, nach eigener Aussage „Europas führender freier Markt-Think-Tank in Brüssel“, den bedrängten Chemie-Multis zur Hilfe. Sein Umweltforumsleiter Edgar Gärtner veröffentlichte das Entwarnungsbuch „Vorsorge oder Willkür? - Kunststoff-Weichmacher im politischen Kreuzfeuer“. Seit Urzeiten haben sich die Weichmacher Gärtner zufolge als „Chemie im Alltag“ bewährt: „Selbst für die beeindruckenden Höhlenmalereien (...) brauchten die Steinzeitmenschen Weichmacher“. Ob der Autor mit solchen wissenschaftlich zweifelhaften Ausgrabungen allerdings sein Ziel erreicht, bleibt dahingestellt - selbst der unternehmerfreudlichen Faz war seine Argumentation zu primitiv.
Merkel bei BAYER
BAYER, SIEMENS, BERTELSMANN und die anderen „Partner für Innovation“ haben unter anderem die berühmt-berüchtigte „Wir sind Deutschland“-Kampagne verbrochen, die dann in das - angeblich so ganz spontane - weltmeisterliche Fahnenmeer mündete. Am 26. Oktober 2006 zog die Initiative am Berliner Sitz von BAYER SCHERING PHARMA Bilanz und konnte aus diesem unfeierlichen Anlass hohen Besuch begrüßen. Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel zählten auch Wirtschaftsminister Michael Glos und Kanzleramtsminister Dr. Thomas de Maizière zu den Gästen. In ihrer Rede dankte Angela Merkel BAYER & Co. für die Überdosis „Patriotismus“, „die aus meiner Sicht weit über den engen Innovationsbereich hinaus ein Stück Stolz und Selbstbewusstsein geformt hat, was ja die Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt vorankommt.“ Von den Antichambrierkünsten des BAYER-Aufsichtsrats Hubertus Erlen bei den Treffen mit den „Partnern für Innovation“ zeigte sich die Kanzlerin besonders angetan. „Deshalb, Herr Erlen wäre es fahrlässig von Ihnen gewesen, wenn Sie nicht etwas zu dem gesagt hätten, was aus Ihrer Sicht im Zusammenhang mit der pharmazeutischen Industrie noch verbesserungsnotwendig ist. Wir werden das in unseren Herzen bewegen und es noch einmal in den Anhörungen behandeln“, sprach die Kanzlerin, die sich mit einem „Wir bleiben in Kontakt“ von den Konzernchefs verabschiedete.
Wenning kritisiert Gesundheitspolitik
Trotz prächtiger Pillen-Profite kritisiert BAYER-Chef Werner Wenning die bundesdeutsche Gesundheitspolitik. „Auch unsere zentralen Kritikpunkte sind die geplante Einführung von Höchstbeträgen für Arzneimittel, die vorgesehene Methodik zu einer Kosten-Nutzen-Bewertung und die fehlenden Elemente zu mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen“, sagte er in einem Faz-Interview. Die nach oben hin offene Preisgestaltung der Pharma-Multis zu deckeln, hält Wenning für kommunistisch und mit dem für die Bundesregierung Kosten/Nutzen-Analysen von Medikamenten vornehmenden „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ hadert BAYER von Beginn an, weil der Konzern bei den Expertisen gern ein Wörtchen mitreden würde. Aber der Vorstandsvorsitzende sieht auch einen Silberstreif am Horizont, der noch schneller in die heiß ersehnte 2-Klassen-Medizin führen könnte. Werner Wenning wünscht sich grünes Licht für die Krankenkassen, um unterschiedliche Leistungsangebote zu unterschiedlichen Tarifen anzubieten und gibt sich hoffnungsfroh: „Erfreulicherweise gibt es dafür erste Hinweise im jetzt vorliegenden Entwurf zur Gesundheitsreform“, meint der Große Vorsitzende.
Höfs bei Konferenz der Holocaust-Leugner
Der bekennende - und bereits vorbestrafte - Neonazi Dr. Hans-Ulrich Höfs, der im Leverkusener BAYER-Werk als Abteilungsleiter arbeitet (Ticker berichtete mehrfach), nahm an der Konferenz der Holocaust-Leugner in Teheran teil. Höfs war Bundesvorsitzender des „Gesamtdeutschen Studentenverbandes“ und gründete 1989 in Krefeld die „Republikaner“. Seitdem er seine Mitwirkung dort einstellte, treibt er sein Unwesen im „Krefelder Gesprächskreis - Deutsche Politik“ und im „Krefelder Forum Freies Deutschland“, das neuerdings auch zum Trägerkreis der rechtsextremen Denkfabrik „Deutsche Akademie“ gehört. Selbst von einer 1996 wegen „Volksverhetzung“ erfolgten Verurteilung ließ sich Höfs nicht von seinem Tun abhalten. Und der Leverkusener Multi schert sich nicht darum, was sein Angestellter in seiner Freizeit tut. Eine Ermahnung erfolgte lediglich, als Höfs sich auch innerhalb des Betriebes rechtsextremistisch betätigen wollte. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hat sich in der Vergangenheit bereits mehrmals an Aktionen gegen den Neonazi in BAYER-Diensten beteiligt.
Israelischer Umweltminister in Leverkusen
Im Herbst 2006 besuchte der israelische Umweltminister Gideon Ezra die Leverkusener BAYER-Werke und informierte sich im Klärwerk Bürrig über die Entsorgungstechnik. Dass der Konzern allein an seinem Stammsitz im „Dritten Reich“ über 9.000 ZwangsarbeiterInnen zu Frondiensten zwang, hielt den Politiker offenbar nicht von seiner Reise ab.
Ökosteuer adé
Für BAYER und andere Energie-Großverbraucher hält die Ökosteuer großzügige Ausnahmeregelungen parat (Ticker 3/06). Nach dem jüngsten Subventionsbericht der Bundesregierung beträgt ihr Geldwert jährlich 5,4 Milliarden Euro. Aber der Großen Koalition reicht das noch nicht. Sie will bei der Ökosteuer so lange nachbessern, bis nichts mehr von ihr übrig bleibt. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Reinhard Schulz spricht das ganz offen aus. „Deswegen werden wir die Höhe der Energiesteuern für das Produzierende Gewerbe wieder auf den Stand von 1998 - also vor Einführung der Ökosteuer - zurückführen“, so der Politiker. Als Mittel dazu dient das „Biokraftstoff-Quotengesetz“, das BAYER & Co. nicht nur Abschläge auf die Ökosteuertarife, sondern auch auf andere Energiesteuern einräumt.
Steuernachlass für BAYER HEALTH CARE
Die in der Nähe New Yorks gelegene Niederlassung von BAYER HEALTH CARE erhielt von den staatlichen Stellen 375.000 Dollar Steuern erlassen.
USA: Kampf um mehr Gewerkschaftsrechte
Gewerkschaften haben in den USA nicht viele Rechte, weshalb die Wirkmächtigkeit und in der Folge auch der Organisationsgrad nicht groß sind. Für BAYER ein nicht zu unterschätzender Standortfaktor: Nur in wenigen seiner US-Niederlassungen muss der Konzern sich mit Gewerkschaften herumschlagen. Und wenn es an Werksschließungen geht, sucht sich der Leverkusener Multi mit Vorliebe solche mit ArbeiternehmerInnen-Vertretungen aus, wie zuletzt in Elkhart geschehen (Ticker 2/02). Anfang des Jahres brachten die Demokraten nun einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Gewerkschaftsrechte in den Kongress ein. Unter anderem will das Paragraphen-Werk die Strafe für Unternehmen erhöhen, die ihren Beschäftigten das Organisationsrecht streitig machen. Der „Employee Free Choice Act“ erhielt auch die erforderliche Stimmenmehrheit, aber George W. Bush kündigte bereits ein Veto ein. Er weiß halt, was er seinen Konzernen schuldig ist. Allein BAYER unterstützte seinen Wahlkampf mit 120.000 Dollar.
BAYER-Vorsitz für kanadischen VFA
Der vom Leverkusener Multi gegründete „Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller hat auch einen kanadischen Ableger. Da war es Ehrensache, dass BAYERs Kanada-Chef Philip Blake im Jahr 2006 den Vorsitz von „Canadas Research-Based Pharmaceutical Companies“ übernahm.
PROPAGANDA & MEDIEN
CO2: BAYER lügt weiter
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hatte BAYER beim Klimaschwindel ertappt und die vom Konzern stets mit stolzgeschwellter Brust vorgetragene Zahl von 60 Prozent weniger Kohlendioxid auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Wie die CBG nachwies, hatte der Multi die Reduzierung größtenteils nicht durch Investionen in den Umweltschutz erreicht, sondern durch Betriebsschließungen, Verkäufe von Unternehmensteilen und ein Outsourcing der Energie-Produktion. Aber BAYER ficht das nicht an. Der Global Player bezeichnet sich selber weiterhin unverdrossen als Klimaschützer. Jetzt sogar um 70 Prozent will er seinen C02-Ausstoß in den letzten 15 Jahren gesenkt haben. Und manche fallen nach wie vor auf die Klimalüge rein. Die Investorengruppe des „Carbon Disclosure Project“ zeichnete das Unternehmen auch im Jahr 2006 wieder als eines der weltweit führenden in Sachen „Klimaschutz“ aus.
BAYER sponsort BodybuilderInnen
Der Leverkusener Multi tritt als Sponsor des „Bodybuilding Szene Shops“ auf. Produkte des Konzerns erfreuen sich nämlich auch bei den Muskelmännern und -frauen äußerster Beliebtheit. Viele BodybuilderInnen machen eine spezielle Diät, in der sie auf Kohlehydrate verzichten, um den Körper zur Fettverbrennung anzuregen. Der Organismus wandelt das Fett dann in so genannte Ketone um und scheidet es aus. Und um zu prüfen, ob die nicht eben risikolose Operation gelungen ist, greifen die Bizeps-FetischistInnen zu den BAYER KETOSTIX-Teststreifen, die der „Bodybuilding Szene Shop“ natürlich auch im Angebot hat.
BAYER lädt JournalistInnen ein
Im Rahmen der „BAYER Innovationsperspektive 2006“ bot der Leverkusener Multi auch vier workshops für JournalistInnen an. Dort diktierte der Konzern den SchreiberInnen sein segenreiches Wirken auf den Gebieten „Gefäßkrankheiten“, „neue Kunststoffe“, „Agrochemikalien“ und „rationellere Wirkstofftests“ in die Feder.
BAYER sponsort JournalistInnen-Preis
Die irische BAYER-Niederlassung hat 2006 erstmals den seit 18 Jahren von der Tageszeitung Daily Telegraph für populärwissenschaftliche Zeitungsbeiträge gestifteten Preis gesponsort und sorgte so dafür, dass die Auszeichnung nicht in konzern-kritische Hände gerät. Den „Daily Telegraph and BAYER Science Writer Award 2006“ gewannen Leili Farzenah und Philip Broadwith. Farzenah erhielt die Auszeichnung für einen Artikel über Bakterien, die Ackerfrüchte wie etwa die von BAYER umfunktionierten Tabakpflanzen (siehe GENE & KLONE) zu Wirkstofffabrikanten machen. Broadwith prämierten die JurorInnen für ein Werk über die „Metathese“ genannte chemische Reaktion, die es den Chemie-Multis erlaubt, Naturstoffe im Reagenzglas nachzubauen.
USA: Pharmawerbung für 300 Mio. $
BAYERs Pillen-PR geht mächtig ins Geld. 300 Millionen Dollar gab allein die US-Division von BAYER HEALTH CARE in den ersten neun Monaten des Jahres für Anzeigen-Kampagnen aus, die Schmerzmittel wie ASPIRIN und ALEVE, das PatientInnen einem erhöhten Herzinfarktrisiko aussetzt (s. u.), sowie Vitaminpillen anpriesen.
Teure ÄrztInnen-Werbung
Um ihre Pillen an den Medizin-Mann und die Medizin-Frau zu bringen, geben BAYER & Co. jährlich 35.000 Euro pro Nase aus. Auf diese Summe beläuft sich der Etat für Pharma-VertreterInnen, Broschüren, Kongresse und „sonstige Zuwendungen“ laut einer Studie der Wissenschaftlerin Kirsten Schubert vom „Zentrum für Sozialpolitik“ der Universität Bremen.
TIERE & ARZNEIEN
Forum für Veterinärkrankheit gegründet
Manche tierische Gesundheitsstörung ist einfach zu unbekannt, um BAYER den massenhaften Absatz von Produkten zu ermöglichen. Leishmaniose zum Beispiel, die zu den so genannten Vektorkrankheiten zählt, weil Insekten den Erreger übertragen, kennt kein Schwein. Der Leverkusener Multi hat sich deshalb entschlossen, ein wenig PR für Vektorkrankheiten zu machen und hat das „Canine Vector-Borne-Deseases World Forum“ gegründet, das ihm das passende Werbeumfeld für sein angeblich vor Leishmaniose schützendes Antiparasitikum ADVANTIX bietet.
DRUGS & PILLS
Aus für Blutgerinnsel-Arznei
„Erfolg versprechendes Thrombose-Medikament in der Pipeline“, verkündete der BAYER-Geschäftsbericht 2005. Das Konzern-Magazin Research pries es schon einmal unter der Überschrift „Gentechnik gegen Blutgerinnsel“ an. Eine Anzeigen-Kampagne schließlich komplettierte die konzertierte Aktion: Sie stellte schon einmal ungedeckte Schecks auf die Zukunft aus und weckte Hoffnungen auf einen Einsatz als Mittel zur Schlaganfall-Prävention. In der dritten und letzten Testphase kam aber die Ernüchterung über die Arznei, der die US-Gesundheitsbehörde FDA wegen erfolgversprechender Zwischenergebnisse sogar ein beschleunigtes Zulassungsverfahren zugebilligt hatte. Das gentechnisch aus einem Schlangengift-Enzym hergestellte Präparat konnte PatientInnen mit verstopften Arterien im Bein weder einen gefäßchirurgischen Eingriff ersparen noch Blutgerinnsel auflösen. Jetzt fällt beim Leverkusener Multi wieder einmal viel Altpapier an.
Herzinfarktgefahr durch ALEVE
Schmerzmittel wie BAYERs ALEVE können Herz und Kreislauf schädigen. Nach einer im Herbst 2004 vom US-amerikanischen „National Institute of Aging“ veröffentlichten Studie steigerte BAYERs Schmerzmittel ALEVE mit dem Wirkstoff Naproxen für die ProbandInnen das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, um 50 Prozent (SWB 1/05). Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA zeigte sich alarmiert, überprüfte die Medikamentengruppe und gab im Jahr 2005 schließlich Entwarnung. Das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ zwang BAYER immerhin, im Kleingedruckten der Beipackzettel auf die „Nebenwirkung Herzinfarkt“ hinzuweisen. Jetzt lieferte eine weitere Untersuchung neues Belastungsmaterial. WissenschaftlerInnen der „John Hopkins University School of Public Health“ testeten ALEVE und das Schmerzmittel CELEBREX auf ihre Verträglichkeit. Während das Herzinfarkt-Risiko der Placebo-Gruppe bei 5,6 Prozent und das der CELEBREX-PatientInnen bei 5,5 lag, betrug es bei den ALEVE-ProbantInnen 8,25 Prozent.
ASPIRIN kein Tausendsassa
BAYER bewirbt ASPIRIN gerne als „Tausendsassa“. Die „Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände“ sieht in dem Präparat allerdings kein Allheilmittel. Sie riet von einer Anwendung als Einschlafhilfe und als einem Mittel gegen den Kater ab und warnte wegen der zahlreichen Nebenwirkungen vor einer allzu häufigen Einnahme.
Längerer Beipackzettel für ASPIRIN & Co.
Die BAYER-Schmerzmittel ASPIRIN und ALEVE sowie andere Präparate dieser Medikamentengruppe haben große Nebenwirkungen. Allein in den USA sterben daran jährlich 16.000 Menschen. Die Zahl der Krankenhaus-Einlieferungen beläuft sich auf 200.000 Fälle. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die Hersteller deshalb gezwungen, auf den Beipackzetteln der Arzneien künftig Risiken und Nebenwirkungen wie Magenbluten aufzuführen, wie in der Bundesrepublik schon länger üblich. Die Institution plant zudem, BAYER & Co. auch zu Warnungen vor Herz/Kreislauf-Erkrankungen zu verpflichten.
YAZ: Die Pille gegen Akne
Die US-Behörden haben BAYERs Verhütungsmittel YAZ auch als Mittel zur Behandlung von Akne zugelassen.
NEXAVAR bei Leberkrebs?
BAYERs zur Behandlung von Nierenkrebs im fortgeschrittenen Stadium zugelassenes Gentech-Präparat NEXAVAR musste unlängst einige Rückschläge verkraften. Der Leverkusener Multi brach klinische Erprobungen zur Therapie von Haut- und Bauchspeicheldrüsenkrebs wegen Erfolgslosigkeit ab (Ticker 4/06). Trotzdem versucht er unverdrossen, das Verschreibungsspektrum der Arznei mit einem Jahresumsatz von 127 Millionen Euro, die auf ihrem angestammten Anwendungsgebiet „Nierenkrebs“ nur als Mittel zweiter Wahl gegenüber dem PFIZER-Präparat SUTENT gilt, zu vergrößern. Der Pharmariese strebt jetzt eine Zulassung für die Indikation „fortgeschrittener Leberkrebs“ an.
Kein PTK bei Darmkrebs?
„Eine unserer vielversprechensten Entwicklungen ist PTK/ZK. Dies ist ein so genannter Angiogenese-Hemmer, den wir gemeinsam mit der Firma NOVARTIS zur Behandlung von metastasiertem Dickdarmkrebs entwickeln“, hieß es im Jahr 2004 auf der SCHERING-Hauptversammlung. Wie so oft in der Genmedizin, kam die Ernüchterung schon wenig später. „Wahrscheinlich lässt sich der primäre Endpunkt der Studie, ein Überlebensvorteil mit der Substanz, nicht erreichen“, musste der seit kurzem zu BAYER gehörende Pharma-Konzern 2005 verkünden. Aber aufgeben wollte er nicht. Mit einem bescheideneren Ziel - der Verhinderung einer Verschlimmerung der Krankheit - strebten die WissenschaftlerInnen nunmehr eine Zulassung an. Aber das erscheint dem Partner NOVARTIS jetzt nicht mehr aussichtsreich genug. „Aus meiner Sicht ist PTK halbtot“, urteilt der Vorstandsvorsitzende Daniel Vasella.
FDA in der Diskussion
Bei einer Nachprüfung des dringend einer Erhöhung des Herzinfarkt-Risikos verdächtigen BAYER-Mittels TRASYLOL täuschte der Leverkusener Multi die US-Gesundheitsbehörde FDA, indem er negative Studien-Ergebnisse unterschlug (SWB 4/06). Seither ist in den USA eine Diskussion um die Kompetenz der Behörde entbrannt, die Bevölkerung vor Risiken und Nebenwirkungen von Arzneien zu schützen. Deshalb forderte der Harvard-Professor Jerome Avorn in einem Artikel, den das Fachblatt New England Journal of Medicine veröffentlichte, mehr unabhängige Arznei-Untersuchungen. Die FDA will ihrerseits BAYER & Co. stärker zur Kasse bitten, um Pharma-GAUs besser verhindern zu können.
PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE
GAUCHO gegen Pflanzenstress
90 Milliarden Bienen raffte das BAYER-Pestizid GAUCHO mit dem Wirkstoff Imidacloprid innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren in Frankreich dahin, weshalb das Land im Jahr 2004 die Ausbringung auf Sonnenblumen- und Maisfeldern untersagte. Trotzdem sucht der Leverkusener Multi unbeirrt nach weiteren Anwendungsmöglichkeiten für den auch unter dem Namen CONFIDOR vermarkteten Wirkstoff und preist ihn neuerdings auch als „Wellnesskur für Pflanzen“, die unter Wassermangel oder zu großer Hitze leiden, an.
GAUCHO-Verbot nützt
Der französische Staat untersagte im Jahr 2004 die Ausbringung des bienengefährlichen BAYER-Insektizides GAUCHO auf bestimmten Kulturen (s. o.) Jetzt hat der französische Imkerverband UNAP eine erste positive Bilanz des Verbotes gezogen. „Es gibt kein massives Bienensterben mehr“, so der UNAP-Präsident Henri Clément.
Indien: 15.000 Selbstmorde unter LandwirtInnen
In Indien haben sich schon 15.000 LandwirtInnen getötet, weil sie sich von ihrer Arbeit nicht mehr ernähren konnten. Teures Gen-Saatgut und teure Pestizide, die ihre Baumwolle dann doch nicht vor Schadinsekten schützen konnten, haben sie zu der Verzweiflungstat getrieben. „Die großen Multis wie MONSANTO, MYKO oder BAYER locken die Bauern mit Versprechungen: Nimm das, und die Pflanzen werden resistent, die Ernte wird reichlich. Aber das ist nicht wahr, sie betrügen die Bauern nur“, empört sich deshalb ein indischer Samenhändler in einem Bericht des TV-Magazins Weltspiegel.
Obst und Gemüse belastbarer
Das Verbraucherschutzministerium hat BAYER & Co. die Lizenz zur verstärkten Vergiftung von Obst und Gemüse erteilt, womit sich die Lobby-Arbeit der Agroriesen mal wieder ausgezahlt hat. Die staatlichen VerbraucherschützerInnen änderten das noch verträgliche Maß für 404 Pestizide. 293 Mal korrigierten sie nach oben und nur 111 Mal nach unten. Durchschnittlich hoben die MinistrantInnen die Grenzwerte um das 33fache an! Bei Produkten wie Salate oder Beeren darf das Limit das bisher Erlaubte auch schon einmal um das 500fache überschreiten. „Es ist unglaublich. Die Verbraucherschützer aus dem Ministerium machen konsequent das Gegenteil von dem, was notwendig wäre, um die Gesundheit der Verbraucher und die Umwelt zu schützen“, empörte sich der GREENPEACE-Chemieexperte Manfred Krautter.
Vergiftungsgefahr: Kindergarten schließt
Auf schlechterem Grund kann man einen Kindergarten kaum bauen: Im australischen Carlisle entstand eine Betreuungseinrichtung für Kinder auf dem Gelände einer ehemaligen Pestizid-Fabrik von BAYER. Sofort nach Bekanntwerden dieses Skandals schlossen die Behörden den Hort und nahmen Untersuchungen vor. Das Risiko giftiger Hinterlassenschaften ist auch deshalb hoch, weil der Leverkusener Multi das Areal nicht gerade besenrein hinterlassen hat und die Sanierungsarbeiten erst nach erheblichem Druck von seiten der Umweltbehörde beendet hat. Zudem veranlasste der Vorfall die staatliche Stellen dazu, eine Überprüfung aller Kindergarten-Grundstücke im westlichen Teil Australiens anzuordnen.
GENE & KLONE
Genreis auf den Philippinen?
Die Philippinen sind das gentech-freundlichste Land in Südostasien. 20 Laborfrüchte von BAYER & Co. ließ der Staat schon zu. Darum rechnet BAYER auch mit einer Einfuhrgenehmigung für seinen Genreis LL62. Diese Sorte fand sich jüngst ebenso wie sein Bruderprodukt LL 601 in ganz normalem Supermarkt-Reis wieder - wenn auch in weniger besorgniserregenden Mengen (siehe SWB 4/06) - und sorgte so mit für den jüngsten Gen-Skandal. Aber nicht nur deshalb formiert sich breiter Widerstand gegen die drohende Zulassung. So wandte sich der Erzbischof Gaudencio Cardinal Rosales in einem Offenen Brief an die Staatspräsidentin Arroyo, um sich gegen das Genfood auszusprechen. „Als kirchliche Einrichtung haben wir die Pflicht, die Interessen der Gotteskinder und ihre angestammten Rechte auf gesundes Essen und eine gesunde Umwelt zu schützen“, hieß es in dem Schreiben. Auch GREENPEACE engagierte sich. „Eine Zulassung von BAYERs Gentech-Reis hätte desaströse Folgen für unser wichtigstes Nahrungsmittel (...) Sie bedroht die Artenvielfalt und gefährdet die Umwelt und die menschliche Gesundheit“, warnte der Aktivist Daniel Ocampo.
Reis-Industrie gegen Genfood
Der Gen-GAU um BAYERs Laborfrucht LL 601, die sich in diversen Supermarkt-Packungen wiederfand (s. o.) hat UNCLE BEN & Co. schweren wirtschaftlichen Schaden zugefügt. Auf 150 Millionen Dollar belaufen sich die Verluste der Branche. Deshalb haben sich die großen Exporteure auch konsequent gegen die Zulassung von genmanipulierten Sorten der Getreideart ausgesprochen, wie GREENPEACE Anfang Februar 2007 bekannt gab.
BAYER forscht in Potsdam
Seitdem BAYER 2002 die Agrosparte von AVENTIS kaufte, gehört auch PLANTTEC, eine Ausgründung des „Max-Planck-Instituts für molekulare Pflanzenphysiologie“, zum Konzern. Am Standort Potsdam genmanipulieren die einstigen Max-PlanckerInnen nun für den Leverkusener Multi an Reis, Raps und Kartoffeln herum. Die Knollenfrucht wollen sie durch eine Erhöhung des Stärkegehaltes als Produkt für die Klebstoff- und Papierindustrie interessanter machen. Entsprechende Versuche des Konkurrenten BASF beurteilt die verbraucherInnenpolitische Sprecherin der Grünen, Ulrike Höfken, äußerst skeptisch, da die Genkartoffel-Saaten nicht nur teurer als die herkömmlichen sind, sondern auch ertragsärmer. Die EU-PolitikerInnen teilten die Bedenken und lehnte einen Zulassungsantrag ab, aber die gentech-freundliche Brüsseler Kommission hat das letzte Wort darüber noch nicht gesprochen.
Pflanzen als Pharmafabriken
BAYER treibt die gentechnologische Umrüstung von Pflanzen zu Pillen-Produzenten unaufhaltsam voran. Der Gen-Gigant ging jetzt eine Kooperation mit dem Freiburger Unternehmen GREENOVATION ein. Die Firma hat den Stoffwechsel von Blattmoos angeblich so verändert, dass das Kraut sich als Reaktor von Arznei-Wirkstoffen eignet. Sollte auch diese BAYER-Kreation sich wie der Genreis LL601 eines Tages mal bei ALDI im Regal wiederfinden, wären die Folgen weit fataler.
BAYER setzt auf „Smart Breeding“
Gentechnische Methoden finden zunehmend Eingang in die Produktion von herkömmlichem Saatgut. So ermöglicht die genaue Analyse des Erbgutes beispielsweise das Aufspüren von besonders widerstandsfähigen Sorten. Auf Basis dieses „Smart Breeding“ hat BAYER bereits spezielle Gemüse-, Raps- und Reisarten gezüchtet. Gentechnik-GegnerInnen wie der GREENPEACE-Aktivist Christoph Then begrüßen diese neue Methode als Alternative zur Risikotechnologie. Das sieht der Gengigant allerdings anders, weil das „Smart Breeding“ art-übergreifende Veränderungen ausschließt. „Deshalb kann nicht das ganze Potenzial der Pflanzenbiotechnologie ausgeschöpft werden“, dämpfte ein BAYER-Sprecher die Hoffnungen auf einen Gentech-Ausstieg.
WASSER, BODEN & LUFT
Aus für Kohlekraftwerk
Steinkohlekraftwerke stehen wieder hoch im Kurs, obwohl sie doppelt so viel Kohlendioxid ausstoßen wie Gaskraftwerke und auch die Energie-Effizienz zu wünschen übrig lässt. Ausschlaggebend für den Boom ist die Wirtschaftlichkeit. Während ein Gaskraftwerk im Jahr ca. 285 Millionen Euro abwirft, bringt es ein Steinkohlewerk auf 610 Millionen Euro. Darum wollte der Stromanbieter TRIANEL auf dem Gelände des BAYER-Chemieparks in Krefeld auch eine solche Dreckschleuder errichten, die jährlich 4,4 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Betreiben sollte es später BAYER INDUSTRIAL SERVICE. Aber gegen dieses Vorhaben formierte sich Widerstand. Ein Krefelder Arzt sammelte in wenigen Tagen 80 Unterschriften von MedizinerInnen, die sich wg. der zusätzlichen Feinstaub-Belastung und anderen Gesundheitsgefahren gegen das Projekt aussprachen. Der Lehrer Ulrich Grubert hat wegen der Pläne für das Kraftwerk und für eine Erweiterung der städtischen Müllverbrennungsanlage sogar einen Hungerstreik durchgeführt. „Das ist ein Großangriff auf Flora, Fauna, Mensch und Klima“, sagte er zur Begründung. Dieser Stimmung mochte sich der Krefelder Stadtrat nicht verschließen. Er lehnte den Bau des Klimakillers ab.
Klimakiller China
Die wie Pilze aus dem Boden schießenden Großanlagen von BAYER & Co. im Reich der Mitte haben einen enormen Energie-Bedarf. China deckt ihn hauptsächlich mit Kohlekraftwerken ohne Filteranlagen, welche mehr als doppelt so viel Kohlendioxid emittieren wie Gaskraftwerke. Das macht den Staat hinter den USA zum weltgrößten Klima-Killer mit Aussicht auf den Spitzenplatz. Das chinesische Energieforschungsinstitut errechnete für das Jahr 2009 einen Kohle-Verbrauch in Höhe von 2,5 Milliarden Tonnen und damit einhergehend einen CO2-Ausstoß von 5,8 Milliarden Tonnen.
Sparen am Umweltschutz
Die drastischen Rationalisierungsmaßnahmen BAYERs gehen auch zu Lasten des Umweltschutzes. So gehört zum Gerätepark des Multis zwar noch ein Meßwagen für Schadstoff-Emissionen, er bleibt aber meistens in der Garage. Früher war er rund um die Uhr auf dem Werksgelände unterwegs, heutzutage kommt er höchstens mal für zwei Stunden raus. Noch dazu fährt er oftmals noch nicht einmal die richtigen Stellen an und steht bei Schadstoff-Austritten nicht dort, wo die genauesten Messungen erfolgen können, weil die Mannschaft nicht mehr wie früher aus qualifiziertem Personal besteht.
EU verbessert Bodenschutz
EU-weit sind ca. vier Millionen Grundstücke durch Chemikalien, Schwermetalle oder Dioxin verunreinigt. Die Kosten für die Sanierung dieser Böden beziffert die Brüsseler Kommission auf 38 Milliarden Euro. Darum verstärkt die Europäische Union ihre Anstrengungen zum Bodenschutz. Nach einem neuen Richtlinien-Entwurf müssen BAYER & Co. beim Verkauf von Firmen-Arealen künftig Expertisen über die im Erdreich schlummernden Schadstoffe vorlegen. Darüber hinaus fordert die Regelung die Mitgliedsstaaten auf, ein für Privatpersonen und Unternehmen einsehbares Belastungskataster anzulegen.
Biopirat BAYER
BAYER betrachtet die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen lediglich als Rohstoff-Reservoir und plündert sie ohne Rücksicht auf Verluste aus. So produziert der Pharmariese das Diabetes-Mittel GLUCOBAY mittels eines Bakteriums, das aus dem kenianischen Ruiru-See stammt, ohne dem ostafrikanischen Land auch nur einen Cent dafür zu bezahlen (siehe SWB 1/06). Der neueste Biopiraterie-Coup des Konzerns: Er schaut sich gemeinsam mit dem Unternehmen MAGELLAN BIOSCIENCE GRUPPE INC. in den Weltmeeren nach Mikroorganismen um, deren Abwehrstoffe sich zur Herstellung neuer Pestizide eignen.
Antibiotika in der Umwelt
In der Humanmedizin kommen BAYERs CIPROBAY und andere Antibiotika massenhaft zum Einsatz, ihr Verbrauch lag 2004 bei 1.600 Tonnen. Dazu addieren sich noch die Anwendungen in der Massentierhaltung. Diese Gemengelage sorgt nicht nur für die Entstehung von Resistenzen, welche die Mittel unbrauchbar bei der Behandlung von Infektion machen, sie hinterlässt auch in der Umwelt ihre Spuren. So tummeln sich Antibiotika schon im Grund- und Trinkwasser und gelangen über Klärschlamm und Gülle auch in den Boden. Dort setzen sie dann den Mikroorganismen zu, was das Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringt und die Erde unfruchtbarer macht.
GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV
Geschlechtsumwandlung durch Weichmacher
Weichmacher wie das von BAYER hergestellte Bisphenol A können wegen ihrer hormon-ähnlichen Wirkung beim Menschen die Hirnentwicklung stören sowie Krebs, Unfruchtbarkeit oder Erbgutschädigungen verursachen. Bei Tieren können sie sogar Geschlechtsumwandlungen bewirken. Bei 95 bis 100 Prozent aller männlichen Kaulquappen, die Chemikalien ausgesetzt waren, beobachteten ForscherInnen der schwedischen Universität Uppsala eine Transformation in Weibchen. Nach Meinung der WissenschaftlerInnen erklärt der Schadstoff-Eintrag in die Gewässer deshalb auch das Aussterben vieler Froscharten.
PLASTE & ELASTE
BAYER Nr. 1 bei Polycarbonaten
Nach der Inbetriebnahme des Shanghaier MAKROLON-Werkes ist BAYER der weltgrößte Polycarbonat-Produzent.
STANDORTE & PRODUKTION
Visionen für Leverkusen?
45. 000 Menschen arbeiteten einst in den Leverkusener BAYER-Anlagen. Heute sind es nur noch 14.000; dazu kommen noch 5.000 bei der Chemie-Abspaltung LANXESS Beschäftigte. Der Schrumpfungsprozess hat auf dem Werksgelände ziemliche Lücken entstehen lassen, die auch die Anwerbung von Fremdfirmen im Rahmen des Chemiepark-Konzeptes nicht hat füllen können, nicht zuletzt weil die Grundstruktur des Areals dem Transformationsprozess einige Steine in den Weg stellt. Jetzt hat der Konzern zu einer preiswerten Lösung der Probleme gefunden, die ihm überdies die Planungshoheit gewährt. Er hat seine Beziehungen zur BDI-Unterabteilung „Kulturkreis der deutschen Wirtschaft“ spielen lassen und einen mit 10.000 Euro dotierten Architekturpreis für das Projekt „Leverkusen: vom BAYER-Werk zum Chemiepark“ ausgeschrieben.
IMPERIUM & WELTMARKT
Neue Pestizid-Kooperation
BAYER und das russisch-amerikanische Unternehmen MAGELLAN BIOSCIENCE GRUPPE INC. haben eine Zusammenarbeit bei der Suche nach Pestizid-Wirkstoffen auf Basis von aquatischen Mikroorganismen beschlossen (WASSER, BODEN & LUFT).
ÖKONOMIE & PROFIT
Mehr Profit, weniger Arbeitsplätze
BAYER-Chef Werner Wenning konnte in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des „Verbands der Chemischen Industrie“ glänzende Geschäftszahlen für die Branche vorlegen. Der Umsatz von BAYER & Co. stieg im Jahr 2006 um sechs Prozent auf 162 Milliarden Euro. Den Beschäftigten kam das allerdings nicht zugute; die Zahl der Arbeitsplätze sank um ein Prozent.
UNFÄLLE & KATASTROPHEN
Drei Verletzte bei Explosion
Am 16. Januar 2007 hat eine Explosion in dem brasilianischen BAYER-Werk am Standort Belford Roxo drei MitarbeiterInnen verletzt. Zwei Personen erlitten Verbrennungen, ein Helfer brach sich bei Löscharbeiten ein Bein.
Das Unglück ereignete sich durch einen bislang ungeklärten Temperaturanstieg in dem Kessel einer Anlage zur Herstellung des Pestizid-Wirkstoffes Methamidophos. Der große Knall war in einem Umkreis von fünf Kilometern zu hören und die auflodernden Flammen weithin zu sehen. Der ausströmende Gasgeruch verursachte bei vielen AnwohnerInnen Übelkeit. Feuerwehr-Züge aus drei Gemeinden waren nötig, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Als Reaktion auf den Störfall kündigte das zuständige Umweltministerium schärfere Sicherheitsauflagen an. Zudem muss BAYER mit einer Strafzahlung rechnen (siehe auch AKTION & KRITIK).
RECHT & UNBILLIG
Anklage wg. „Organisierten Verbrechens“
BAYER, PFIZER, ROCHE und 27 andere Pharmafirmen haben der türkischen Regierung überhöhte Kosten für importierte Arzneien in Rechnung gestellt. Eigentlich sollten diese sich an den niedrigsten Preisen in Frankreich, Griechenland, Spanien und Italien orientieren, aber die Konzerne haben Zahlenkosmetik betrieben und sich dadurch Extra-Profite gesichert. „Wegen der Teilnahme an einer illegalen Organisation, die das Ziel hatte, Verbrechen zu begehen, die staatliche Autorität zu missachten, offizielle Dokumente zu fälschen und in offiziellen Dokumenten zu lügen“ hat die Istanbuler Staatsanwalt deshalb Ermittlungen gegen BAYER & Co. aufgenommen.
BAYER gelobt Rechtstreue
Der Leverkusener Multi hat ein „Programm für gesetzmäßiges und verantwortungsbewusstes Handeln“ verabschiedet. „Rechtsfragen spielen eine zunehmend wichtigere Rolle bei der Gestaltung unserer Geschäfte“, sagte BAYER-Chef Werner Wenning zur Begründung des Vorstoßes, „Es gibt kaum einen Tätigkeitsbereich, der nicht davon betroffen ist.“ Weniger verklausuliert formuliert: Wer so dem Profit hinterherjagt wie wir, der bewegt sich zwangsläufig am Rande der Illegalität. Aber jetzt gelobte der Konzern, „Rechtsrisiken zu vermeiden“ und wartet mit Neuigkeiten auf. „Die BAYER AG respektiert das geltende Recht“, heißt es im so genannten Corporate-Compliance-Programm. In Zukunft soll in Sachen „Kartellrecht“, „Umgang mit gefährlichen Stoffen“, „Arbeitsschutz“, „Anlagenschutz“, „Umweltschutz“, „Gentechnik“ und „Datenschutz“ alles mit rechten Dingen zugehen. Wie unernst der Pharma-Riese es mit diesem Bekenntnis meint, zeigt der jüngste Gesetzesbruch in der Türkei (s. o.).
Diätpillen-Werbung bestraft
Erneut muss der BAYER-Konzern in den USA ein Bußgeld wegen unlauterer Werbung zahlen. Der Leverkusener Multi hatte in einem TV-Spot für die Diät-Pille ONE-A-DAY WEIGHTSMART fälschlicherweise behauptet, das Präparat würde den Stoffwechsel anregen. Wegen „irreführender Versprechungen“ verhängte die US-Wettbewerbsbehörde „Federal Trade Commission“ (FTC) deshalb eine Buße von 3,2 Millionen Dollar gegen den Pharmariesen. Nach Angaben der FTC-Vorsitzenden Deborah Platt Majoras handelte es sich dabei die höchste jemals von der Behörde verhängte Zivilstrafe (siehe SWB 1/07).
Klage gegen BAYER-Mais
Die mangelnde Akzeptanz von Genfood in Europa hat BAYER dazu veranlasst, die Entwicklungsländer als Anbaugebiete zu nutzen. Aber auch dort stößt die Risikotechnologie zunehmend auf Kritik. So klagten in Brasilien mehrere Nichtregierungsorganisationen gegen die geplante Aussaat von gentechnisch gegen das Unkrautmittel LIBERTYLINK immun gemachten Mais, und errangen einen Teilerfolg. Das Gericht setzte das Genehmigungsverfahren erst einmal aus und zwang die Nationale Biosicherheitskommission, eine BürgerInnen-Anhörung anzuberaumen.
RichterInnen erleichtern Stilllegungen
BAYER & Co. können künftig noch leichter Standorte dichtmachen. Bislang mussten die Konzerne im Vorfeld einer Schließung einen Interessensausgleich mit dem Betriebsrat suchen und im Falle eines Scheiterns eine Einigungsstelle anrufen. Das nahm unter Umständen mehrere Monate in Anspruch, während derer die Unternehmensleitung keine Vorbereitungen zur Abwicklung etwa durch Kündigungen treffen durfte, wollte sie keine Klagen von Seiten des Betriebsrats provozieren. Jetzt erleichtert ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes BAYER & Co. die Arbeit. Nach dem Votum der RichterInnen brauchen Kündigungen kurz vor Toresschluss nämlich nicht unbedingt mit der Stilllegung in Zusammenhang zu stehen, weshalb die Firmen in Zukunft schon während der Verhandlungen mit den Gewerkschaften tüchtig loslegen und so eine Menge Zeit sparen können.
Kein Giftgas-Prozess gegen Hussein
Der irakische Diktator Saddam Hussein schwörte auf BAYER-Produkte. Bei seinen Attacken auf kurdische Dörfer zwischen 1987 und 1988, denen 50.000 bis 100.000 Menschen zum Opfer fielen, kam das vom BAYER-Forscher Fritz Haber während des Ersten Weltkrieges entwickelte Senfgas zum Einsatz. In einem gesonderten Prozess sollte Hussein sich auch dafür verantworten, aber durch das Todesurteil im Hauptverfahren kommt es nicht mehr dazu. Die jetzige Regierung hat allerdings ebenfalls keine Probleme mit BAYER. Auf dem deutsch-irakischen Wirtschaftskongress Anfang 20004 hob ein Wirtschaftspolitiker die guten Beziehungen des Landes zur bundesdeutschen Chemie-Industrie hervor und lud BAYER & Co. zu einer Verstärkung ihres Engagements im Irak ein. Das brachte ihm damals jedoch wütende Reaktionen von Teilen der irakischen KurdInnen ein, die für die Hinterbliebenen der in Halabja durch Giftgas made in Germany Getöteten Reparationsansprüche geltend machen.
Kein Patent für Brüstle
Das Bundespatentgericht hat dem Stammzellen-Forscher Oliver Brüstle von der BAYER in vielfältiger Weise verbundenen Universität Bonn (siehe SWB 2/02) ein Patent auf Produkte aus embryonalen Stammzellen verweigert. Es gab damit dem Kläger GREENPEACE Recht. Zur Begründung verwiesen die RichterInnen auf die Biopatentrichtlinie der EU, welche die Kommerzialisierung von Embryonen als sittenwidrig einstuft. Der Genforscher will Beschwerde gegen das Urteil einlegen, das es ihm bedeutend schwerer macht, Risikokapital für seine Hochschul-Ausgründung „Life and Brain“ aufzutreiben.
BAYER muss Uni säubern
Die STAUFFER CHEMICAL COMPANY betrieb ihre Fabrik von 1897 bis 1987 in unmittelbarer Nähe der Universität Berkeley und verunreinigte das Hochschulgelände mit giftigen Substanzen. Staatliche Stellen haben jetzt BAYER und ZENECA als Rechtsnachfolger der Firma aufgefordert, die Altlasten zu entsorgen.
EU stärkt AktionärInnen-Rechte
Die EU plant, die Auskunftsrechte von AktionärInnen zu stärken. Ein Richtlinien-Entwurf sieht vor, Fragen von Aktien-BesitzerInnen zur Geschäftspolitik auch schon vor der Hauptversammlung zuzulassen und die Konzerne zu verpflichten, die Antworten im Internet zugänglich zu machen. Dieser Vorstoß hat allerdings bereits den Ministerrat auf den Plan gerufen. In einem Kompromissvorschlag spricht er sich für einen engen zeitlichen Rahmen zur Einreichung der Informationsersuche aus. Zudem wollen die MinisterrätlerInnen BAYER & Co. die Möglichkeit einräumen, zur Abwehr unliebsamer KritikerInnen formlos auf bereits veröffentlichte allgemeine Informationen zu verweisen.
Kommt der Bilanzeid?
Die Bundesregierung plant im Zuge der Umsetzung der Brüsseler Transparenz-Richtlinie eine Reihe von Veränderungen im Aktienrecht. Wer mehr als drei Prozent der Aktien eines Unternehmens besitzt, muss dies in Zukunft öffentlich bekannt geben. Früher lag die Schwelle bei fünf Prozent. Die Große Koalition will angeblich so Risikokapital-Investoren besser auf die Spur kommen. Darüber hinaus können PrüferInnen bei einem Anfangsverdacht auf Betrug die Bilanzen von BAYER & Co. künftig auch zweimal im Jahr durchgehen. Schließlich sollen die Vorstände bald einen Eid auf die Korrektheit ihrer Bilanzen ablegen. Nicht nur weil dies BAYER-Chef Werner Wenning und seinen KollegInnen schwer fallen dürfte, hat der Bundesrat laut Faz „bereits etliche Bedenken angemeldet“.
BAYER verkauft HENNECKE
Der Leverkusener Multi will sich von seiner Tochtergesellschaft HENNECKE trennen. HENNECKE stellt Maschinen zur Kunststoff-Produktion her und steht im Mittelpunkt einer langwierigen juristischen Auseinandersetzung um Patentraub (Ticker berichtete mehrfach). Mitte der 60er Jahre hatte der Düsseldorfer Erfinder Heinz Süllhöfer BAYER/HENNECKE eine Maschine zur Herstellung von Isolierplatten aus Polyurethan-Hartschaum zum Kauf angeboten. Der Leverkusener Chemie-Multi lehnte ab - und baute die Süllhöfer-Erfindung nach. In der Folge warf die Apparatur für den Konzern Milliarden-Gewinne ab. Süllhöfer strengte einen Prozess wegen Patent-Verletzung an, der mit einem Vergleich endete. Der Konstrukteur überließ dem Unternehmen die Nutzung der Platten-Maschine und sollte dafür Lizenz-Gebühren erhalten. Davon sah er allerdings nie eine müde Mark. Der Multi mogelte sich um die fälligen Zahlungen herum, indem er Unter-Lizenzen an andere Firmen vergab und diese mit deren Bestellungen von BAYER-Rohstoffen verrechnete. Der Düsseldorfer Erfinder reichte deshalb erneut eine Klage ein. Diese bildete den Auftakt für einen Prozess-Marathon, dessen Ende auch heute noch nicht abzusehen ist.
FORSCHUNG & LEHRE
Kooperation mit der Stanford University
BAYER hat mit der Universität von Stanford eine Forschungszusammenarbeit vereinbart. Hochschule und Unternehmen wollen ein auf molekularer Bildgebung beruhendes Diagnose-Verfahren zur Erkennung von Tumoren entwicklen. Das Geschäftsfeld „Diagnostische Bildgebung“ gehörte zu den Schwerpunkten des im Jahr 2006 von BAYER geschluckten SCHERING-Konzerns. Mit AVID RADIOPHARMACEUTICALS und der Züricher „Eidgenössischen Technischen Hochschule laufen bereits Kooperationen auf diesem Gebiet.
BAYER spendet BAYER
„Sozial ist, wenn es trotzdem nützt“ - nach dieser Devise fördert BAYER gemeinsam mit der US-amerikanischen Universitätsstadt Berkeley aus sozialen oder ethnischen Gründen benachteiligte BiowissenschaftlerInnen. Die Armen kommen durch die „Biotech Partners“ unter anderem in den Genuss von Praktika beim Leverkusener Gen-Giganten und können sich für künftige Arbeiten in den Konzern-Laboren empfehlen. Die gemeinnützige „BAYER Foundation“ hat jetzt mit einer Spende von 150.000 Dollar den Etat der Organisation noch einmal ein wenig aufgestockt.
SPORT & MEDAILLEN
Freispruch für Calmund
Angeblich zum Erwerb von Kaufoptionen für Fußballer hatte Reiner Calmund in seiner Eigenschaft als Manager von BAYER Leverkusen dem Spielerberater Volker Graul 580.000 Euro in bar übergeben. Belege für solch einen Verwendun