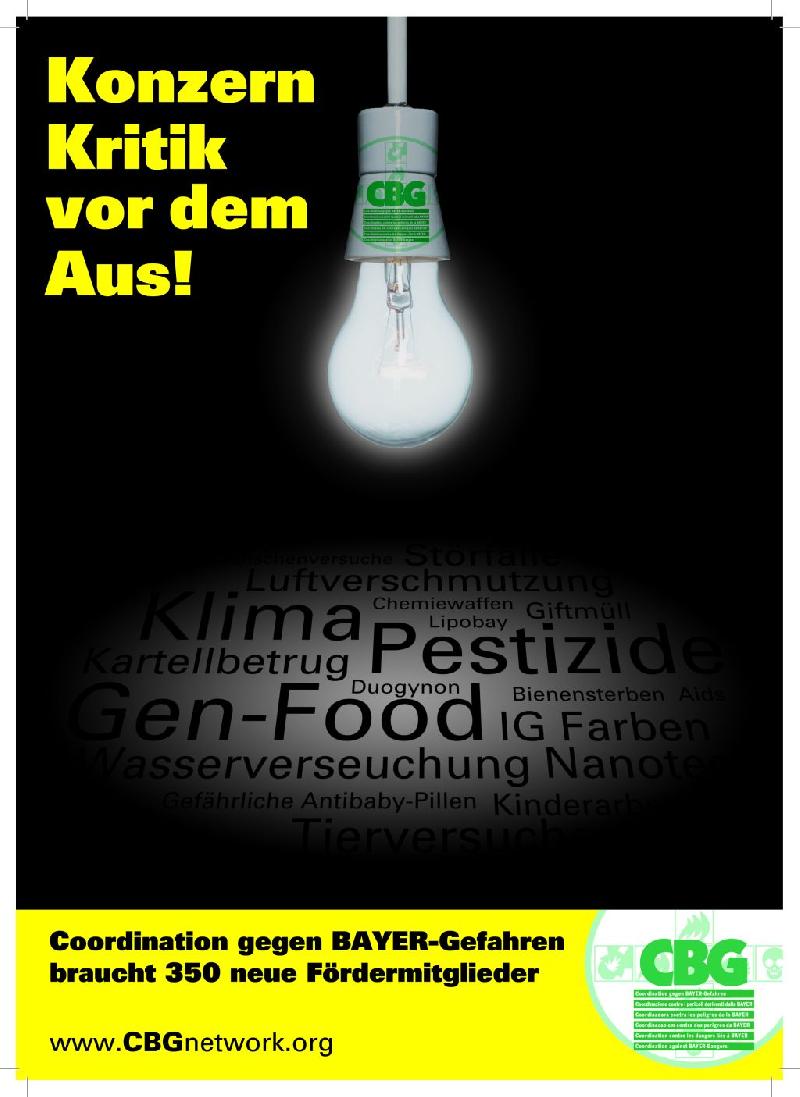AKTION & KRITIK
Die CBG in Indien beim PPT
Das seit 1979 bestehende PERMANENT PEOPLES TRIBUNAL (PPT) befasste sich im Dezember 2011 mit den katastrophalen Folgen des großflächigen Einsatzes von Agro-Chemikalien. Das Tribunal, das diesmal im indischen Bangalore stattfand, hatte auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) eingeladen, um den Fall des von BAYER-Pestiziden wesentlich mitverursachten globalen Bienensterbens darzulegen. CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes schilderte das Ausmaß der Katastrophe in aller Ausführlichkeit – und konnte die Jury überzeugen. Das sechsköpfige Gremium verurteilte in seiner Abschlusserklärung BAYER und die andern fünf Unternehmen, die den Weltmarkt für Pestizide und Saatgut dominieren, wegen schwerster Umwelt- und Gesundheitsschäden. Der ungezügelte Einsatz von Agrogiften verletze das Menschenrecht auf Gesundheit und Leben; Millionen Menschen, vor allem in den Ländern des Südens, würden wissentlich hohen Risiken ausgesetzt, so die RichterInnen (siehe auch SWB 2/12).
BAYER und die Kinderarbeit
Im Jahr 2003 veröffentlichte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) eine Studie zur Kinderarbeit in Indien, die Erschreckendes zu Tage förderte. Allein auf den Feldern von Zulieferern der BAYER-Tochter PROAGRO malochten ca. 2.000 Minderjährige. Die CBG startete daraufhin eine Kampagne. Sie informierte die Medien, schrieb einen Offenen Brief an BAYER, brachte das Thema auf die Hauptversammlung und wandte sich an die OECD. Trotzdem tat sich fünf Jahre lang kaum etwas. Nur ganz allmählich beugte sich der Leverkusener Multi dem öffentlichen Druck und zeigte Initiative, um einen Image-Schaden zu vermeiden. Der Konzern belohnte FarmerInnen, die auf Kinderarbeit verzichteten, gab ihnen Tipps zur besseren Bewirtschaftung der Felder und richtete Schulen ein. So konnte er das Problem weitgehend lösen. Der Agro-Riese stellt das jedoch anders dar. Er sieht sich als Entwicklungshelfer, der jahrelang heldenhaft gegen Windmühlen kämpfte. Und die Financial Times Deutschland kaufte BAYER diese Geschichte ab. Auf zwei Seiten schilderte die Zeitung im Dezember 2011 das Engagement des Unternehmens und ging dabei nur im Kleingedruckten auf seine profanen Beweggründe ein.
Kölner Uni richtet Kommission ein
Vor vier Jahren vereinbarte BAYER mit der Kölner Hochschule eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Pharma-Forschung. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) und andere Initiativen befürchteten eine Ausrichtung der Arznei-Forschung auf Profit, eine Entwicklung von Präparaten ohne therapeutischen Mehrwert, eine Verheimlichung negativer Studienergebnisse und einen Zugriff des Konzerns auf geistiges Eigentum der Hochschul-WissenschaftlerInnen. Deshalb forderten die Organisationen eine Offenlegung des Vertrages. Die Universität verweigerte das jedoch, weshalb die CBG die Hochschule im Mai 2011 verklagte. Intern jedoch scheint sich etwas zu regen. So hat die Bildungseinrichtung eine Kommission ins Leben gerufen, die Richtlinien für künftige Kooperationen dieser Art mit Unternehmen erarbeiten soll.
Vorgenehmigung für TDI-Anlage
Auf den Erörterungsterminen für die von BAYER in Dormagen geplante Kunststoff-Anlage hatten die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und andere Verbände Anfang Oktober 2011 viele Vorbehalte geäußert. Sie beanstandeten etwa die fehlenden Angaben zur Umweltbelastung, eine mangelhafte Störfall-Vorsorge und eine ungenügende, da nur mit Blech statt mit Beton vorgenommene Ummantelung der Produktionsstätte. Zudem verlangten die Initiativen den Einbau eines Schutz-Schleiers, der bei einer Explosion mit nachfolgendem Phosgen-Austritt neutralisierendes Ammoniak freisetzen könnte, und stellten in Frage, ob der Sicherheitsabstand der Fertigungsstätte zu Wohnsiedlungen ausreicht. Die Bezirksregierung hat dem Projekt trotzdem eine Vorgenehmigung erteilt. Aber so ganz unbeeindruckt hat sie die Kritik nicht gelassen. So hat die Behörde ein Gutachten zur Abstandsregelung in Auftrag gegeben und eine Exkursion nach Stade unternommen, um ein Chemie-Werk mit einer Betonhülle zu besichtigen. Allerdings führte das alles nicht zu geänderten Bau-Auflagen.
Kreuzweg der Arbeit führt zu BAYER
Die KATHOLISCHE ARBEITNEHMER-BEWEGUNG (KAB) hat Anfang März 2012 in Leverkusen einen „Kreuzweg der Arbeit“ initiiert, um auf das Leiden an den modernen Beschäftigungsverhältnissen aufmerksam zu machen. Sinnigerweise beginnt der Zug an einem Werkstor des Global Players. „Immer mehr Arbeitsplätze wurden in den letzten Jahren abgebaut, natürlich nicht nur bei BAYER. Aber eben das wollten wir darstellen“, so der KAB-Sekretär Wienfried Gather zur Erklärung.
Protest gegen Nano-Produktion
Bislang betreibt der Leverkusener Multi an seinem Stammsitz offiziell nur eine Versuchsanlage zur Nano-Produktion. Auch bei seiner ehemaligen Tochterfirma H. C. STARCK in Laufenburg läuft die Auftragsfertigung der Kohlenstoff-Röhrchen mit dem Produktnamen BAYTUBES nur im Testlauf. Dies soll sich nun ändern. H. C. STARCK hat beim Regierungspräsidium Freiburg einen Antrag auf einen Normalbetrieb nebst einer Kapazitätserweiterung von 30 auf 75 Tonnen im Jahr gestellt (siehe auch SWB 2/12). Die zuständige „Abteilung Umwelt“ hält das für eine reine Formsache. Da „keine schweren, komplexen, irreversiblen oder grenzüberschreitende, erheblich nachteilige Unweltauswirkungen auf den Standort (...) zu erwarten“ seien, will sie auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung verzichten und im Genehmigungsverfahren lediglich immissionsschutzrechtliche Aspekte berücksichtigen sowie eine Erheblichkeitsuntersuchung durchführen. Doch dagegen erhebt sich Protest, denn der Verein LEBENSWERTER HOCHRHEIN und die ÖKOLOGISCHE ÄRZTE-INITIATIVE HOCHRHEIN IM BUND befürchten sehr wohl negative Auswirkungen. Die Nano-Technologie lässt nämlich Werkstoffe auf winzig kleine Größen schrumpfen, wodurch diese unbekannte und nicht selten gefährliche Eigenschaften entwickeln. Deswegen haben die Verbände beim Regierungspräsidium eine Einwendung gegen das Vorhaben eingereicht, die sich die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN zum Vorbild für eine eigene genommen hat, und ihre Kritik am 21. März auch auf einem Erörterungstermin vorgetragen.
Leserbrief zur Sportförder-Kürzung
BAYER zieht sich immer mehr aus der Breitensport-Förderung zurück. So kündigte der Konzern Ende 2011 an, die Unterstützung um einen weiteren „niedrigen einstelligen Millionenbetrag“ zu kürzen und sich mit dem Etat von 13 Millionen Euro „zukünftig auf sechs Großvereine konzentrieren“. Dies führte zu einem erbosten Leserbrief an den Leverkusener Anzeiger. „Für mich zeigt sich in dieser Art der Unternehmensführung die scheußliche Fratze des ungezügelten Kapitalismus“, empört sich der Schreiber.
310 MedizinerInnen warnen vor Pipeline
Im vergangenen Jahr hatte der Hildener Kinderarzt Dr. Gottfried Arnold die Landesregierung in einem Offenen Brief vor den Gefahren der zwischen Dormagen und Krefeld geplanten Kohlenmonoxid-Pipeline gewarnt. Inzwischen haben sich 310 MedizinerInnen seiner Meinung angeschlossen. Auf einer Pressekonferenz hat Arnold, der auch Mitglied der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN ist, vor dem Hintergrund jüngster Unfälle mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen nochmals auf die Unmöglichkeit hingewiesen, im Falle eines Falles angemessen zu reagieren. „Die Rettungsmöglichkeiten bei einem Massen-Unfall sind völlig unzureichend“, kritisierte der Arzt angesichts ungenügender Behandlungskapazitäten in der Universitätsklinik Düsseldorf und nur einem Notarzt- und zwei Krankenwagen im Kreis Mettmann.
DIE LINKE gegen NRW-Hochschulräte
In den Hochschulräten als neuen Aufsichtsgremien der Universitäten sitzen zu einem Drittel VertreterInnen von Unternehmen. Der Leverkusener Multi darf da natürlich nicht fehlen. So ist der Konzern durch sein Vorstandsmitglied Richard Pott beispielsweise im Komitee der Universität Köln vertreten, mit welcher der Konzern auch eine umfassende Forschungskooperation unterhält (SWB 2/09). Die Partei DIE LINKE will solche Gepflogenheiten in Nordrhein-Westfalen jetzt unterbinden. Sie hat einen Gesetzes-Entwurf zur Abschaffung der Räte vorbereitet. Eine Mehrheit dürfte dieser jedoch kaum finden, obwohl die jetzige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft die durch das „Hochschulfreiheitsgesetz“ geschaffene Einrichtung im Wahlkampf noch als Beispiel für eine „Privatisierung der Hochschulen“ kritisiert hatte.
KAPITAL & ARBEIT
BAYER verlegt Rechnungslegung
Im Zuge seines 800 Millionen Euro schweren Rationalisierungsprogramms, das 4.500 Arbeitsplätze vernichtet, verlegt der Multi Teile der Rechnungslegung wie etwa die Kunden- und Lieferantenbuchhaltung von Leverkusen nach Asien und Osteuropa. Der Abteilung am Stammsitz bleiben dann nur noch Koordinierungsaufgaben, weshalb es dort zu Arbeitsplatz-Vernichtungen kommt.
BMS rationalisiert Rechnungswesen
BAYERs Kunststoff-Sparte BAYER MATERIAL SCIENCE hat seinen Bereich „Rechnungswesen“ einem Rationalisierungsprozess unterzogen. So schuf die Abteilung eine gemeinsame Controlling-Plattform für alle Standorte und legte Planungszyklen und Kostenstellen zusammen. Dadurch reduzierte das Unternehmen in den letzten drei Jahren seine Ausgaben um drei Millionen Euro – zum Leidwesen der Beschäftigten. „Der wesentliche Kostentreiber im Controlling ist das Personal. Der Großteil der Einsparungen beruht auf weggefallenen Personalkosten“, so der für die Umstrukturierungen verantwortliche Manager Axel Steiger-Bagel.
Weniger Jobs in Patent-Abteilung
Bisher beschäftigt der Leverkusener Multi in seiner Patent-Abteilung 200 Personen. Jetzt kündigte er im Zuge seines Rationalisierungsprogramms Umstrukturierungsmaßnahmen an, die 25 Arbeitsplätze vernichten. Der Konzern gründet die Tochter-Gesellschaft BAYER INTELLECTUAL PROPERTY (BIP) und löst die Patent-Sparte in Leverkusen komplett auf. Die Arbeit konzentriert sich so auf Monheim und die beiden neuen Standorte Eschborn und Schönefeld, die das Unternehmen nach eigenen Angaben aus Gründen der Steuer-Ersparnis wählte.
Sparen für die Traumrendite
Im Geschäftsjahr 2011 steigerte BAYERs Pillen-Sparte ihren Gewinn vor Sondereinflüssen um 6,7 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Der Konzern führt diese Entwicklung neben den besseren Verkaufszahlen für nicht verschreibungspflichtige Arzneien auf „Kostensenkungen bei Pharma“ zurück. In der Tat trifft das Rationalisierungsprogramm des Unternehmens, das die Vernichtung von 4.500 Arbeitsplätzen vorsieht, vor allem den Medizin-Bereich. „Sparen für die Traumrendite“ kommentierte deshalb die Financial Times Deutschland.
Sparen für die AktionärInnen
BAYER will mit seinem Rationalisierungsprogramm, das 4.500 Arbeitsplätze kostet, 800 Millionen Euro sparen.
Die Frankfurter Rundschau fragte deshalb den Vorstandsvorsitzenden Marijn Dekkers: „Warum heben Sie dann die Dividende an, was dieses Jahr allein 120 Millionen Euro kostet?“. Aber der Konzern-Leiter war um eine Antwort nicht verlegen: „Weil die Aktionäre Eigentümer des Unternehmens sind und sie einen Anspruch darauf haben, am Geschäftserfolg des vergangenen Jahres beteiligt zu werden“.
Schlechte Noten für Aufsichtsrat
Der Hochschulprofessor Peter Ruhwedel hat das Wirken der Aufsichtsräte der 30 DAX-Konzerne genauer untersucht und bewertet. BAYER kam dabei mit 59 von 100 möglichen Punkten nur auf den 25. Rang. Das Gremium des Konzerns ließ es sowohl an Sitzungsfleiß als auch an Transparenz fehlen und wies eine zu geringe Frauen- und AusländerInnenquote auf. RWE und LINDE, die anderen beiden Unternehmen, bei denen BAYER-Aufsichtsratschef Manfred Schneider die Rolle des Oberkontrolleurs innehat, erreichten sogar nur die Plätze 29 und 30.
Wennings Comeback
Seit 2010 verbietet das Aktiengesetz den unmittelbaren Wechsel vom Posten des Vorstandsvorsitzenden zu demjenigen des Aufsichtsratsvorsitzenden und schreibt eine 2-jährige Karenzzeit vor. Das Paragraphen-Werk sieht dadurch die Unabhängigkeit des Kontroll-Gremiums besser gewährleistet. Der Leverkusener Multi bekämpfte die Regelung von Beginn an vehement und beabsichtigt jetzt, ihre Folgen für das Unternehmen durch winkeladvokatische Tricks möglichst gering zu halten. Obwohl der ehemalige BAYER-Chef Werner Wenning zum Zeitpunkt der nächsten Hauptversammlung im April 2012 noch nicht zwei Jahre aus dem Amt ist, will ihn der Konzern dort mittels Vorratsbeschluss schon einmal inthronisieren, damit er schon im Herbst auf Manfred Schneider folgen kann und nicht bis 2013 warten muss.
Veränderungen im Aufsichtsrat
Im BAYER-Aufsichtsrat steht ein Wandel an. Es geht nicht nur der bisherige Vorsitzende Manfred Schneider (s. o.), mit Hubertus Schmoldt verlässt auch der ehemalige Vorsitzende der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) das Gremium. Seinen Sitz übernimmt Petra Reinbold-Knape, die Bezirksleiterin der IG BCE für die Region Nordost/Berlin. Der Vertreter der BELEGSCHAFTSLISTE, eine oppositionelle Gruppe innerhalb der Gewerkschaft, wechselt ebenfalls: André Aich ersetzt Michael Schmidt-Kiesling. Desgleichen verändert sich die personelle Zusammensetzung der Kapital-Seite. Sie nominierte als neue KandidatInnen den PROSIEBEN/SAT.1-Vorstand Thomas Ebeling und Sue H. Rataj, obwohl diese zur Zeit der „Deep Water Horizon“-Katastrophe Hauptverantwortliche für das Ölgeschäft von BP war.
IG BCE: kein Ja zum Plaste-Verkauf
Im März 2011 hatte BAYER-Chef Marijn Dekkers die Bereitschaft erkennen lassen, die Kunststoff-Sparte zu veräußern, falls der Konzern Geld für eine Akquisition benötige. Die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) kündigte an, einem solchen Beschluss im Aufsichtsrat „mit Sicherheit“ nicht zuzustimmen. „Es wird darum gehen, eine gewisse Grunderdung bei BAYER als weltweit agierender Konzern zu erhalten“, so das IG-BCE-Vorstandsmitglied Peter Hausmann.
Keine Behinderten-Integration
Der Gesetzgeber verpflichtet die Unternehmen seit langem, mindestens fünf Prozent Behinderte zu beschäftigen. Der Leverkusener Multi schafft jedoch nur eine Quote von 4,4 Prozent und muss dafür eine Ausgleichsabgabe in Höhe von 347.000 Euro zahlen.
ERSTE & DRITTE WELT
Zwangslizenz für NEXAVAR-Version
Der indische Generika-Hersteller NATCO PHARMA kann eine preisgünstige Version von BAYERs Krebs-Medikament NEXAVAR herausbringen. Das Indian Patent Office (IPO) hat dem Unternehmen unter Berufung auf einen Paragraphen des internationalen Patentabkommens TRIPS Anfang März 2012 eine Zwangslizenz zur Herstellung des Mittels erteilt. Dafür muss NATCO eine Gebühr von sechs Prozent des Verkaufspreises an den bundesdeutschen Pharma-Riesen zahlen. Die Behörde begründete die Entscheidung damit, dass BAYER es versäumt habe, den Preis für das Medikament (monatlich 4.200 Euro) auf eine für indische PatientInnen bezahlbare Höhe herabzusetzen. Zudem habe der Konzern ihnen die Arznei nicht in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt. Von den 8.842 Krebskranken, die das Mittel benötigt hätten, hätten es nur 200 erhalten, so das IPO. Die CBG begrüßt dieses Urteil aus prinzipiellen Gründen, obwohl sie NEXAVAR wegen seiner geringen Heilwirkung – das Präparat verlängert das Leben der PatientInnen nur um wenige Wochen – für kein sinnvolles Therapeutikum hält. Die Wirtschaftspresse hat die Nachricht hingegen in helle Aufregung versetzt. „In Bombay enteignet“, kommentierte etwa die Faz und stellte den ganzen Status Indiens als gelobtes Land der Pharma-Industrie in Frage. BAYER kündigte an, gerichtliche Schritte zu prüfen.
Soja-Anbau kostet ein Leben
In den südamerikanischen Ländern boomt der Soja-Anbau, wovon BAYER als einer der weltgrößten Pestizid-und Saatgut-Anbieter profitiert. Die GroßgrundbesitzerInnen können für die Pflanzungen gar nicht genug Flächen akquirieren und schrecken deshalb nicht einmal vor brutalsten Landnahmen zurück. So engagierten sie Mitte November 2011 in Brasilien sogar Killer, die ein Indigenen-Camp in Mato Grosso do Sul überfielen, einen Menschen töteten und drei Kinder verschleppten, um die UreinwohnerInnen einzuschüchtern und aus dem Gebiet zu vertreiben.
ACTA behindert Generika-Hersteller
Das umstrittene Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) schützt nicht nur das geistige Eigentum der Konzerne im Internet, sondern auch in der realen Welt – mit teilweise verheerenden Auswirkungen. So macht es das Abkommen Herstellern von Nachahmer-Arzneien schwerer, ihr Geschäft zu betreiben, was die Versorgung von Menschen in armen Ländern mit erschwinglichen Medikamenten behindert. Schon in der Vergangenheit hat Big Pharma diesen Firmen durch Patent-Prozesse und andere Mittel immer wieder Schwierigkeiten bereitet. So boten die Konzerne schon mal den Zoll auf, um Lieferungen indischer Generika an den Grenzen zu stoppen, obwohl die Arzneien gar nicht für den europäischen, sondern für den südamerikanischen Markt bestimmt waren. Jetzt haben die Unternehmen ein noch leichteres Spiel, denn ACTA sieht bei angeblichen Verstößen gegen Urheberrechte hohe Strafen für die Produzenten solcher Präparate, Zulieferer und Händler vor. Auch unterscheidet das Paragrafen-Werk nicht trennscharf zwischen Generika und Fälschungen, weshalb laut Sandy Harnisch vom AKTIONSBÜNDNIS GEGEN AIDS die Gefahr besteht, „dass legal hergestellte Generika mit Fälschungen verwechselt und deshalb beschlagnahmt oder sogar vernichtet werden können“.
IG FARBEN & HEUTE
„Berüchtigt“ ohne IG FARBEN
In dem Hitchcock-Film „Berüchtigt“ schmieden deutsche Wissenschaftler nach dem Zweiten Weltkrieg einen Plan, um dem Nationalsozialismus wieder zur Macht zu verhelfen. Den Auftrag dazu erteilte ihnen die IG FARBEN. „Als Teil eines Verbundes, der die deutsche Kriegsmaschine aufgebaut hat“, charakterisiert das Werk den von BAYER mitgegründeten Mörder-Konzern. Jedenfalls im Original. In der bundesdeutschen Version, die 1951 in die Kinos kam, fehlt jeder Hinweis auf den Faschismus im Allgemeinen und die IG FARBEN im Besonderen. In der 1969 ausgestrahlten TV-Fassung durfte es dann immerhin schon Nazis geben, aber die IG FARBEN auch weiterhin nicht.
POLITIK & EINFLUSS
Sechs Millionen Dollar für Lobbying
BAYER hat nach Angaben des US-amerikanischen CENTERS FOR RESPONSIBLE POLITICS im Jahr 2011 6,465 Millionen Dollar für Lobbying-Aktivitäten ausgegeben. Der Konzern lässt beispielsweise gegen den „Ban Poisonous Additives Act“ opponieren, der eine Anwendungsbeschränkung für die Industrie-Chemikalie Bisphenol A vorsieht. Zudem versucht der Leverkusener Multi ein Gesetz zu verhindern, das den Gebrauch von Antibiotika wegen der zunehmenden Resistenzen von Krankheitserregern einschränken will. Auch fühlte er sich berufen, die Kongress-Mitglieder für viel Geld davon zu unterrichten, welche Mühen es angeblich kostet, ein „innovatives“ Medikament auf den Markt zu bringen.
BAYERs US-Spenden
BAYER investiert viel Geld, um die politische Landschaft in den USA zu pflegen. Im Jahr 2010 gab der Konzern dafür 506.000 Dollar aus. Mit 406.000 Dollar unterstützte er US-amerikanische PolitikerInnen, besonders die republikanischen. Sie erhielten 57 Prozent vom Kuchen, die demokratischen dagegen lediglich 41 Prozent. Und im Wahljahr 2012 legt der Pharma-Riese noch einmal mächtig zu. 276.000 Dollar gab er bis zum 31. Januar schon aus. 234.000 davon erhielten Abgeordnete, wobei das Unternehmen Konservative noch deutlicher als 2010 bevorzugte. Sie bekamen 70 Prozent der Summe, Obamas Partei-GenossInnen dagegen nur 30 Prozent.
BAYER als Gesetzgeber
Das „American Legislative Exchange Council“ (ALEC) ist eine von den Konzernen gesponserte JuristInnen-Vereinigung. Die BAYER-Managerin Sandra Oliver sitzt für den Agro-Riesen in dem ALEC-Beirat, ihr Kollege Mike Birdsong gehört der „Health and Human Services Task Force“ an, und Bill Corley, das ALEC-Mitglied des Jahres 2005 in der Sektion „Privatwirtschaft“, steht im Bundesstaat Arkansas demjenigen Gremium vor, das sich um das legislative Wohlergehen von BAYER & Co. kümmert. Dank ALEC kontrollieren die Multis das ganze legislative Verfahren. Als etwa die republikanischen Politiker James Inhofe, George Nethercutt und Orrin G. Hatch mit Hilfe großzügiger Wahlkampf-Spenden von BAYER Mandate erlangten, da machten sich die willigen JuristInnen von ALEC gleich daran, ihnen die Entwürfe für Gesetzesinitiativen zum Öko-, Agrar- und Tierrechts„terrorismus“ zu liefern. Und im letzten Jahr gelang es dank ALEC, im Bundesstaat Wisconsin ein Paragrafen-Werk zu verabschieden, das für BAYER & Co. die Standards der Produkthaftung aufweicht und beispielsweise für Pillen-Hersteller die im Haftungsfall zu zahlenden Entschädigungssummen auf 750.000 Dollar begrenzt. Verkauft wurde das Ganze dann als Teil eines Programms zur Arbeitsplatz-Beschaffung.
ALEC leugnet Klimawandel
Einen Klimawandel gibt es für das „American Legislative Exchange Council“ (ALEC) nicht. Die von BAYER & Co. gesponserte JuristInnen-Vereinigung opponiert nicht nur gegen jegliche Art von Klimapolitik, sie sieht sogar etwas Gutes in der Aufheizung des Planeten. „Selbst eine substanzielle Erderwärmung ist gut für die Vereinigen Staaten“, meint ALEC. Und auf seinem Jahrestreffen, das BAYER finanziell unterstützt hat, pries der Klassenjustiz-Verband sogar „die Vorzüge von Kohlendioxid“.
Tricks mit Ökosteuer-Ausnahmen
Für BAYER und andere Energie-Großverbraucher hält die Ökosteuer großzügige Ausnahmeregelungen parat (Ticker 3/06), die den Konzernen jährlich ca. fünf Milliarden Euro ersparen. Die EU betrachtet das als eine versteckte Subvention und drängt auf Veränderungen. So will Brüssel die Vergünstigungen an Klimaschutz-Maßnahmen geknüpft wissen. Das allerdings plant ein neuer Gesetzesentwurf aus dem Finanzministerium zu umgehen. Er erhebt nur Energieverbrauchssenkungen zur Vorschrift, welche die Unternehmen ohnehin erbringen müssen.
Zwei Milliarden Euro Steuer-Entlastung
1999 brachte BAYERs ehemaliger Finanzchef Heribert Zitzelsberger die Unternehmenssteuer„reform“ auf den Weg, die dem Bund allein bis zum Jahr 2003 Einnahme-Ausfälle von mehr als 50 Milliarden Euro bescherte. Und seither haben Regierungen aller Couleur sogar immer noch „nachgebessert“. Momentan schnürt die schwarz-gelbe Koalition ein zwei Milliarden teures Geschenk. Ganz wie es sich der „Bundesverband der deutschen Industrie“ (BDI) gewünscht hatte, will Wolfgang Schäuble den Konzernen die Verrechnung von Gewinnen und Verlusten zwischen Tochter- und Muttergesellschaften erleichtern. Zudem plant er, die Verlustnutzung wieder zu erlauben, die es den Unternehmen gestattet, die Verluste gekaufter Firmen steuersparend vom eigenen Ertrag abzuziehen.
BAYER gegen Banken-Regulierung
1,85 Millionen lässt sich der Leverkusener Multi seine Lobby-Aktivitäten bei der EU nach eigenen Angaben jährlich kosten. Momentan investiert er viel von dem Geld in den Versuch, eine umfassende Reform des Finanzsektors zu verhindern. Der Konzern befürchtet nämlich steigende Kosten durch eine strengere Regulierung der Derivate – eine Art Wette auf Preissteigerungen oder -senkungen von Rohstoffen, Aktien, Währungen, Zinsen oder aber von Derivaten selber – , die der Chemie-Multi hauptsächlich zur Absicherung seiner globalen Transaktionen nutzt. Zudem graust es ihn vor schärferen Eigenkapital-Vorschriften für Banken, weil das seine Kredit-Konditionen verschlechtern könnte. Darum lässt der Global Player einen Brüsseler Emissär klagen: „Seitens der Realwirtschaft sind wir sehr besorgt über die Verteuerung nicht nur der OTC-Derivate (außerbörslich gehandelte Derivate, Anm. SWB) (...), sondern auch für die Refinanzierung, die aus den geänderten Eigenkapital-Vorschriften resultieren“.
BAYER & Co. gründen Rohstoff-Allianz
Den großen Konzernen drohen schon bald die Rohstoffe auszugehen. Darum haben BAYER, BASF, THYSSENKRUPP und andere Unternehmen Ende Januar 2012 eine „Allianz zur Rohstoff-Sicherung“ gegründet. Um auch in Zukunft die Versorgung der Multis mit Seltenen Erden, Wolfram, Kokskohle und anderen Substanzen zu garantieren, will die Initiative selber Vorkommen erkunden und Abbau-Rechte erwerben.
Arznei-Gremien ohne BAYER?
Die Bundesregierung plant, VertreterInnen der Pharma-Industrie aus wichtigen Arzneimittel-Kommissionen wie dem „Sachverständigen-Ausschuss zur Verschreibungspflicht“ zu verbannen, weil dies „im Hinblick auf die notwendige Unabhängigkeit der Gremien in rein fachspezifischen Fragen erforderlich“ sei. BAYER & Co. haben Einspruch eingelegt und versuchen, diese Veränderung des Arzneimittelgesetzes zu verhindern.
Gröhe bei BAYER
Der CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe besuchte BAYER zu einem „Fachgespräch“. Der Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers nutzte den Termin, um ein Klagelied über die Energiewende, die zu höheren Strompreisen führe, anzustimmen und einmal mehr die steuerliche Absetzbarkeit von Forschungsausgaben zu fordern. Einsparungen in Höhe von 20 bis 30 Millionen Euro erhofft sich der Holländer von einer solchen Gesetzes-Änderung.
Voigtsberger bei BAYER
BAYERs Chemie„parks“ liegen dem nordrhein-westfälischen Wirtschaftsminister Harry Voigtsberger (SPD) besonders am Herzen. Nachdem er bereits im November 2011 eine Konferenz zu deren Zukunft veranstaltet hatte (Ticker 1/12), die passenderweise auch gleich beim Leverkusener Multi stattfand, initiierte er Ende Februar 2012 ein Pressegespräch zum Thema – und natürlich wieder am Stammsitz des Konzerns.
Trittin bei BAYER
Schon zu seiner Zeit als Bundesumweltminister besuchte der Grünen-Politiker Jürgen Trittin den Leverkusener Multi. Anfang Dezember 2011 schaute er mal wieder vorbei. Bei den Gesprächen ging es nicht nur um die alten BAYER-Gassenhauer „Energie-Preise“ und „steuerliche Absetzbarkeit von Forschungsausgaben“ (s. o.), sondern zusätzlich auch noch um den Klimaschutz und finanzpolitische Fragen.
Jianmin Xu bei BAYER
Hierzulande lässt es der Leverkusener Multi auf seinen Hauptversammlungen – vorzugsweise bei den Gegenreden des CBG-Vorstandsmitglieds Axel Köhler-Schnura – selten an antikommunistischen Parolen fehlen, andernorts gehören KommunistInnen jedoch zu den geladenen Gästen BAYERs. So wohnte mit Jianmin Xu der Sekretär der Kommunistischen Partei Chinas der Einweihung einer Konzern-Anlage in Shanghai bei.
China: Mitwirkung an Patent-Gesetz
Eines der größten Hindernisse für die wirtschaftliche Aktivität der Global Players in Schwellenländern ist der angeblich mangelhafte Schutz des geistigen Eigentums. Deshalb hat BAYER in China schon „Entwicklungshilfe“ geleistet und an der Shanghaier Tongji-Universität einen Lehrstuhl für Patentrecht gestiftet (Ticker 1/08). Und das Engagement scheint sich auszuzahlen. Das Gesetzemachen gestaltet sich im Reich der Mitte fast schon so „demokratisch“ wie im Westen. So zeigte sich BAYERs oberster Patentschützer in China, Oliver Lutze, froh, im Prozedere zur Vorbereitung eines neuen Paragraphen-Werks zu den intellectual property rights (IPR) gehört zu werden: „Sie schicken den Industrie-Verbänden Entwürfe zu, und wir schicken es mit unseren Statements zurück. Und in manchen Punkten wurden unsere Vorschläge akzeptiert und die Passagen geändert.“
BAYER stellt Hunger-Experten
Im letzten Jahr initiierte der Bundestagsausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz eine öffentliche Anhörung zum Hungerproblem. Unter den geladenen ExpertInnen war auch der BAYER-Manager Dr. Manfred Kern. Und er wusste natürlich auch die Lösung: Eine nachhaltige Intensivierung der Landwirtschaft mit mehr Pestiziden, mehr Saatgut und mehr Gentechnik. Also noch mehr von alledem, was schon seit Jahrzehnten keinen Erfolg bei der Verbesserung der Welternährungslage zeigt und nur die Kassen der Agro-Multis füllt.
PROPAGANDA & MEDIEN
BAYER-Kreuz am Jungfrau-Berg
Jetzt müssen sogar schon Berge als Litfaßsäulen für die großen Unternehmen herhalten. So prankte auf dem schweizer Jungfrau-Massiv ein riesiges BAYER-Kreuz. Mit dieser „Bandenwerbung“ finanzierten die Jungfrau-Bahnen zu ihrem 100-jährigen Jubiläum eine Lichtkunst-Aktion von Gerry Hofstetter, der das Schweizerkreuz auf eine Gebirgswand projizierte. Die „Stiftung Landschaftsschutz“ übte Kritik an dem Budenzauber: „Es tut weh zu sehen, wie multinationale Konzerne die grandiose Berglandschaft zur Werbeleinwand degradieren.“ Und auch Katharina Conradin von der Naturschutz-Organisation MOUNTAIN WILDERNESS protestierte: „Ein Berg ist doch kein Werbeobjekt.“
BAYER spendet an Heartland-Institut
Auch BAYER zählt zu den Unterstützern des US-amerikanischen Heartland-Institutes, einer konservativen Lobby-Organisation, die durch die Finanzierung von Klimawandel-LeugnerInnen einige Berühmtheit erlangt hat. Der Leverkusener Multi allerdings benannte einen anderen Verwendungszweck für seine Spende. Er wollte das Geld in Kampagnen gegen die Einführung einer allgemeinen Krankenversicherungspflicht investiert wissen. Das legen interne Unterlagen der Einrichtung nahe, die ein Whistleblower dem Internet-Portal DeSmogBlog zugespielt hat.
KundInnen-Bindung 2.0
Das bundesdeutsche Gesetz erlaubt keine Werbung für verschreibungspflichtige Arzneien. BAYER & Co. streben eine Lockerung an und tun alles dafür, eine entsprechende Lösung auf EU-Ebene zu erreichen (Ticker 1/12). Bis es soweit ist, versuchen die Konzerne, bis an die Grenze des Erlaubten zu „informieren“. Dazu nutzen sie vor allem das Internet. So betreibt BAYER etwa das Portal MS-Gateway, das sich an Multiple-Sklerose-PatientInnen richtet. Es verfügt über einen offenen und einen geschlossenen Bereich, der nur für NutzerInnen des Konzern-Präparats BETASERON bestimmt ist. Einziges Ziel: neue KundInnen zu gewinnen und alte zu halten. Von Veranstaltungshinweisen über die Vermittlung von BeraterInnen und Apps zum Therapie-Management bis zu Foren und „Wellness-Diagrammen“ reicht das Angebot. Es stößt offenbar auf Resonanz: Auf 12.000 Mitglieder kann MS-Gateway zählen.
Eltern berichtet über MIRENA
Mehr als jede zehnte Anwenderin von BAYERs Hormon-Spirale MIRENA leidet unter schweren Nebenwirkungen wie Depressionen, Zyklusstörungen, Gewichtszunahme, Eierstock-Zysten, Unterleibsentzündungen, Schwindel, Übelkeit, starker Haarwuchs, Akne, Hautkrankheiten und Kopfschmerzen Zudem besteht der Verdacht auf Erhöhung des Brustkrebs-Risikos. Diesen unerwünschten Arzneimittel-Folgen widmete sich im Februar 2012 auch die Zeitschrift Eltern. Der Frauenarzt Michael Ludwig zerstreute dann allerdings die Bedenken. Und er hatte guten Grund dazu, der Mediziner steht nämlich seit Jahren immer wieder in Diensten BAYERs. Diese Information enthielt die Zeitschrift ihren LeserInnen jedoch vor. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hat der Redaktion deshalb einen Brief geschrieben, in dem es hieß: „Diese Abhängigkeiten hätten in dem Artikel unbedingt genannt werden müssen. Besser noch wäre es gewesen, ausschließlich unabhängige Frauenärzte zu befragen.“
Winnackers Gentech-Lob in der Zeit
Zeit Online bot dem BAYER-Aufsichtsrat Ernst-Ludwig Winnacker, einem „der einflussreichsten Wissenschaftsmanager und Politik-Berater Europas“, die Gelegenheit, sich ellenlang über die Behinderungen zu verbreiten, mit denen sich die „grüne“ Gentechnik konfrontiert sieht. Sie werde fälschlicherweise für das Artensterben verantwortlich gemacht, klagte er, wo sie doch so dringend für die Ernährung der Menschen rund um den Globus benötigt werde, denn: „Wer den Welthunger nur für ein Verteilungsproblem hält, argumentiert zynisch.“ Aber trotzdem machten die Abstandsregelungen hierzulande Freisetzungsversuche fast unmöglich, so Winnacker. Nur in Sachen „Patente auf Leben“ räumte der Biochemiker Fehler der Konzerne ein. Er selber bekennt sich zu einer kritischen Haltung gegenüber solchen Eigentumstiteln, „weil ihre gelegentlich kompromisslose Durchsetzung nicht in die Kultur der Landwirtschaft passt“ und stellt fest: „Die Patent-Strategien einiger Unternehmen haben zu einem beträchtlichen Vertrauensverlust und Imageschaden geführt.“
BAYER-Land der Ideen
BAYER gehörte 2006 zu den Sponsoren der Kampagne „Land der Ideen“, welche die Fußball-Weltmeisterschaft dazu nutzte, um für den hiesigen Industrie-Standort zu werben. Der PR-Betrieb hat die Ball-Treterei sogar überlebt und veranstaltet alljährlich den Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“. Selbstredend finden sich darunter immer wieder BAYER-Orte. Im letzten Jahr war es mit dem Baykomm das Kommunikationszentrum des Leverkusener Multis. Und dieses Mal schafften es sogar drei Konzern-Projekte in die Auswahl: das Integrationsprogramm „Einfach Fußball“, der Ideen-Trimmpfad des TSV BAYER 04 Leverkusen und die „Dream Production“ – ein alles anderer als traumhafter Versuch, bei der Kunststoff-Produktion Kohlendioxid zu recyclen (Ticker 4/11).
BAYER investiert in Schulen
Der Leverkusener Multi fördert Schulen über die „BAYER Science & Education Foundation“, denn dieses Stiftungsmodell erlaubt nebenher auch noch Steuer-Ersparnisse. Bei der Sponsoring-Maßnahme bilden nicht von ungefähr die naturwissenschaftlichen Bereiche einen Schwerpunkt. „Ich muss gestehen, wir fördern die Schulen nicht ganz uneigennützig. Wir sehen das als langfristige Investition“, so Stiftungsvorstand Thimo V. Schmitt-Lord.
Im Jahr 2011 verteilte der Konzern 462.000 Euro unter 52 Schulen in der Nähe seiner Standorte. Mit Geld bedachte er unter anderem die Monheimer „Lise-Meitner-Realschule“ für ihr Projekt „Nanotechnologie in Theorie und Praxis“, das „NaturGut Ophoven“ für ihre Lernwerkstatt zum Klimaschutz, das Schulzentrum Steinen für ihre Unterrichtseinheit zu naturwissenschaftlichen Grundgesetzen und die Gemeinschaftshauptschule Neucronenberg für ihren Lern-Parcours.
Das Humboldt-BAYER-Mobil rollt
In Kooperation mit der Berliner Humboldt-Universität betreibt der Leverkusener Multi ein rollendes Labor. Das „Humboldt-BAYER-Mobil“ fährt Schulen in Berlin und im Osten Deutschlands an und arbeitet mehr oder weniger spielerisch den naturwissenschaftlichen Lernplan des Konzerns ab.
BAYER lanciert Nano-Wettbewerb
Der Leverkusener Multi arbeitet eifrig an der Akzeptanz der umstrittenen Nano-Technologie und hat zu diesem Behufe gemeinsam mit dem „Landescluster NanoMikro+Werkstoffe.NRW“ den Wettbewerb „Nano erleben“ gestartet. Dieser fordert SchülerInnen, LehrerInnen und WissenschaftlerInnen auf, „ihre kreativen Ideen in Nanotechnologie-Demonstrationsversuche fließen zu lassen“. Davon erhofft sich dann BAYERs Nano-Beauftragter Peter Krüger „das Potenzial, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass Nanotechnologie fundierte und spannende Wissenschaft ist, die wesentlich zu unserer Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit beiträgt“.
Der Konzern als Kümmerer
Während der Konzern intern immer unsozialer wird, indem er Arbeitsplätze vernichtet und Arbeitsbedingungen verschärft, macht seine PR-Abteilung seit einiger Zeit verstärkt auf „sozial“. Zu diesem Behufe initiierte sie 2007 die „BAYER Cares Foundation“, die Projekte in der Nähe der Konzern-Standorte fördert. 2011 verteilte die Stiftung 126.000 Euro. Geld gab es unter anderem für die Ausbildung von jugendlichen StreitschlichterInnen in Dithmarschen, für die Bitterfelder Jugendkunstschule, einen Gnadenhof für Ponys in Leichlingen, eine Leverkusener Schuldenpräventionsinitiative, eine ForscherInnen-Werkstatt in Schochwitz und ein neues Beachvolleyball-Feld in Wollbach. Darüber hinaus soll der ASPIRIN-Sozialpreis das Bild vom barmherzigen Samariter BAYER in die Welt tragen. 2011 hat der Leverkusener Multi die Auszeichnung an eine Organisation verliehen, die brandverletzte Kinder unterstützt.
XARELTO-Muster per Post
Seit Mitte der 1980er Jahre untersagt das Arzneimittelgesetz BAYER & Co. die großflächige Versendung von Arzneimittel-Mustern an MedizinerInnen. Nach dem Paragrafen-Werk dürfen die Konzerne nur zur Tat schreiten, wenn eine Anforderung vorliegt. Der Leverkusener Multi verschickte jedoch trotzdem große Massen seines umstrittenen Blutverdünnungsmittels XARELTO (siehe DRUGS & PILLS), eine Empfangsbestätigung als „Just-in-Time“-Antrag für die Proben wertend. Die unabhängige Fachzeitschrift arznei-telegramm hat BAYER deshalb angezeigt, und auch die „Freiwillige Selbstkontrolle der Pharma-Industrie“ prüft den Fall.
BAYER VITAL wirbt für 54 Millionen
BAYER VITAL, die für rezeptfreie Arzneien zuständige Abteilung des Leverkusener Multis, hat 2011 nach Angaben des „Deutschen Apotheker-Verbandes“ allein in der Bundesrepublik 54,5 Millionen Euro für Reklame ausgegeben. Nur KLOSTERFRAU und BOEHRINGER INGENHEIM investierten mehr.
Podiumsdiskussion mit BAYER und DSW
„Fünf gegen das Wachstum der Bevölkerung investierte Dollar sind wirksamer als hundert für das Wirtschaftswachstum investierte Dollar“, sagte einst der ehemalige US-Präsident Lyndon B. Johnson über seine Vorstellung von „Entwicklungshilfe“. Zur großen Befriedigung BAYERs erfreut sich diese Ansicht auch heute noch großer Beliebtheit, die „gigantischen Fruchtbarkeitsmärkte“ in den armen Ländern versprechen nämlich gute Absatzchancen für die Verhütungsmittel des Konzerns. Um die Geschäftsaussichten für YASMIN & Co. noch ein wenig zu verbessern, sponsert das Unternehmen seit geraumer Zeit die „Deutsche Stiftung Weltbevölkerung“ (DSW), „denn mit ihren Projekten in Entwicklungsländern hilft die DSW vor allem jungen Menschen, ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden und sich vor HIV/Aids zu schützen. Damit nutzt sie die Chancen zur menschenwürdigen Verlangsamung des Weltbevölkerungswachstums und trägt zugleich unmittelbar zur Verbesserung der Lebensverhältnisse vor Ort bei“. Der Leverkusener Multi führt gemeinsam mit der DSW auch regelmäßig einen „Parlamentarischen Abend“ in Berlin durch. Am 24. April 2012 stehen unter anderem die Anwältin und Publizistin Seyran Ates, der kongolesische Botschafter S. E. Kennedy Nyauncho Osinde und die SPD-Bundestagsabgeordnete Karin Roth auf der Gästeliste.
TIERE & ARZNEIEN
ASPIRIN im Stall
BAYERs „Tausendsassa“ ASPIRIN hat sich einen neuen Markt erobert: die Tiere. Da die Massenzucht Hühnern, Puten und anderen Kreaturen unendliche Qualen bereitet, verabreichen ihnen TierärztInnen oft das Schmerzmittel, obwohl seine Anwendung nicht erlaubt ist.
Noch mehr Tierarzneien
Der Leverkusener Multi hat die Veterinärmedizin-Sparte des US-amerikanischen Chemie-Konzerns KMG übernommen. Diese besteht vor allem aus Insektiziden, die Rindern, Schweinen und Geflügel mittels Chemie Fliegen und andere Plagegeister vom Leib halten.
DRUGS & PILLS
TRASYLOL-Comeback
Im Februar 2012 gab die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA bekannt, BAYERs Arznei TRASYLOL wieder zuzulassen. Nach Ansicht der Behörde wies die sogenannte BART-Studie des „Ottawa Hospital Research Institutes“, die im Jahr 2007 den Ausschlag für den Verkaufsstopp gegeben hatte, gravierende Mängel auf. Das Institut wehrt sich gegen diese Vorwürfe. „Die BART-Wissenschaftler stellen fest, dass die Durchführung und Analyse der BART-Untersuchung den höchsten Standards entsprach“, heißt es in der Antwort auf eine Ticker-Nachfrage. Zudem beschwerte sich die Einrichtung darüber, von der EMA nie in der Angelegenheit kontaktiert worden zu sein. Aber selbst wenn die ForscherInnen Fehler gemacht haben sollten – bereits vorher hatten unzählige Expertisen dem Mittel, das zur Blutstillung nach Bypass-Operationen zum Einsatz kam, Gesundheitsgefährdungen bescheinigt. Nicht einmal eine von BAYER selbst in Auftrag gegebene Studie konnte bessere Resultate liefern. Der Harvard-Professor Alexander Walker analysierte für den Konzern die Unterlagen von 78.000 Krankenhaus-PatientInnen und stellte im Falle einer Behandlung mit TRASYLOL eine erhöhte Sterblichkeitsrate, sowie ein größeres Risiko für Nierenversagen, Schlaganfälle und Herzerkrankungen fest. „2.653 Patienten mussten zur Dialyse und 2.613 Patienten starben“, so lautete damals sein eindeutiger Befund, den das Unternehmen den zuständigen Behörden lieber verschwieg.
ASPIRIN-Entlastungsstudie
BAYERs „Tausendsassa“ ASPIRIN gerät mehr und mehr in die Kritik. So schätzt Dr. Friedrich Hagenmüller von der Hamburger Asklepios-Klinik die Zahl der Todesopfer durch die Nebenwirkung „Magenbluten“ allein in der Bundesrepublik pro Jahr auf 1.000 bis 5.000. Der Leverkusener Multi musste also etwas für das ramponierte Image der Arznei tun und gab eine Entlastungsstudie in Auftrag. Und siehe da: Es „wurde deutlich, dass das Jahrhundert-Medikament bei Kurzzeit-Behandlungen von Schmerzen und Fieber ebenso verträglich ist wie andere Schmerzmittel, zum Beispiel IBUPROFEN oder PARACETAMOL“.
Neue YASMIN-Packungsbeilage
Mit Drospirenon-haltigen Verhütungsmitteln wie BAYERs Produkten aus der YASMIN-Familie steigt im Vergleich zu Levonorgestrel-haltigen Kontrazeptiva das Risiko, eine Thromboembolie zu erleiden. Das haben Untersuchungen aus den USA und England nun erneut bestätigt. Das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-Produkte“ (BfArM) reagierte und forderte BAYER zu einer nochmaligen Aktualisierung des Beipackzettels auf, um deutlicher vor der Gefahr zu warnen.
LEFAX nur „ausreichend“
Die „Stiftung Warentest“ testete fünf Präparate gegen Blähungen und kam zu wenig überzeugenden Ergebnissen. Vier Präparate, darunter auch BAYERs LEFAX, bekamen die Note „ausreichend“, und ein Mittel erhielt das Prädikat „mangelhaft“.
XARELTO jetzt auch in Europa
Der Leverkusener Multi darf sein Präparat XARELTO jetzt auch in Europa und Japan als Mittel zur Schlaganfall-Vorbeugung bei PatientInnen mit Vorhofflimmern vermarkten. Eine entsprechende Genehmigung hatte vorher schon die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA erteilt. Allerdings tat sie sich mit der Entscheidung schwer. MitarbeiterInnen hatten sich noch Anfang September 2011 gegen die Genehmigung ausgesprochen, weil die von BAYER eingereichten Studien ihrer Meinung nach Fragen zu Herzinfarkt- und Blutungsrisiken aufwarfen. Zudem konnten sie im Vergleich zum bislang gebräuchlichen Wirkstoff Warfarin keinen therapeutischen Zusatznutzen entdecken. Aber die Behörde setzte sich über diese internen Einwände hinweg. Nicht einmal Meldungen über Sterbefälle bei der Klinischen Erprobung des Mittels in Indien (Ticker 1/12) vermochten sie umzustimmen.
Neue XARELTO-Indikation
Der Leverkusener Multi strebt eine Zulassung seines umstrittenen Mittels XARELTO (s. o.) zur Nachbehandlung des akuten Koronar-Syndroms (ACS) an. Das Präparat soll in Kombination mit einer anderen Therapie der nochmaligen Entstehung von Blutgerinnseln in der Herzkranz-Arterie vorbeugen. In den Tests zeigten sich allerdings auch deutlich die Risiken und Nebenwirkungen der Arznei. So erlitten XARELTO-ProbandInnen häufiger schwere Blutungen als die Test-Personen, welche die bisherige Standard-Medikation bekamen.
NICE nicht nice zu XARELTO
Die britische „National Institute for Health and Clinical Excellence“ (NICE), das Kosten und Nutzen neuer Arzneimittel bewertet, hat Zweifel an der Qualität von BAYERs Blutverdünner XARELTO. Da ihm die vom Leverkusener Multi zur Verfügung gestellten Daten für die Anwendungsgebiete „Thrombosen“ und „Schlaganfall-Vorbeugung bei PatientInnen mit Vorhofflimmern“ nicht ausreichten, forderte es vom Pillen-Riesen mehr Informationen an. Auch in Spanien erwartet der Konzern harte Verhandlungen mit den Behörden. Nur in der Bundesrepublik blüht dies dem Unternehmen nicht. Das hiesige Arzneimittel-Gesetz erspart nämlich Präparaten, die für andere Indikationen schon zugelassen sind, wie XARELTO zur Thrombose-Prophylaxe bei schweren orthopädischen OPs, eine solche Prozedur.
Zulassung für Augenmittel
Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat BAYERs Augen-Arznei VEGF-Trap-Eye genehmigt. Das Mittel zur Therapie der feuchten Makula-Degeneration – einer Augenerkrankung, die zur Blindheit führen kann – erschließt jedoch nicht gerade medizinisches Neuland. Laut Konzern zeigte das Medikament mit dem Produktnamen EYLEA lediglich „eine vergleichbare Wirkung (Nicht-Unterlegenheit) gegenüber der Behandlung mit LUCENTIS“. Nach dem positiven Bescheid strebt das Unternehmen nun auch Zulassungen für andere Krankheitsgebiete an.
Regorafenib-Zulassung beantragt
Krebsmedikamente sind teuer, helfen zumeist wenig und haben allzuoft nur ein eingeschränktes Anwendungsgebiet. So auch der Wirkstoff Regorafenib, für den BAYER 2012 in Europa und den USA die Zulassung beantragen will. Er darf nur bei PatientInnen mit fortgeschrittenem Darmkrebs, bei denen alle sonstigen Therapien versagten, zum Einsatz kommen und zeigte nur äußerst bescheidene Test-Ergebnisse. Die Substanz steigerte die Gesamtüberlebenszeit der ProbandInnen im Vergleich zur Placebo-Gruppe gerade einmal um 1,4 Monate und schenkte ihnen bloß eine um 0,2 Monate längere Zeit ohne weiteres Tumor-Wachstum.
Überdosis CIPROBAY
Immer mehr Krankheitserreger bilden gegen Antibiotika wie BAYERs CIPROBAY Resistenzen aus und lösen so todbringende Gesundheitsstörungen aus (siehe auch SWB 2/12). Trotzdem verordnen MedizinerInnen die Mittel immer noch viel zu häufig. Das ergab eine Studie der Universität Bremen zur Verschreibungspraxis von KinderärztInnen. Obwohl die Präparate nur gegen Bakterien wirken, setzen PädiaterInnen sie der Untersuchung zufolge häufig auch bei Virus-Infektionen wie Erkältungen oder Mittelohr-Entzündungen ein. Und in Schwellenländern wie Indien geben Apotheken CIPROBAY sogar ohne Rezept und Beipackzettel ab.
Muskelschwäche durch CIPROBAY
Antibiotika sorgen nicht nur für resistente Krankheitskeime (s. o.), sie haben auch noch ganz andere Risiken und Nebenwirkungen wie beispielsweise Sehnen-Entzündungen und Sehnenrisse. Health Canada warnt jetzt vor einer neuen Gegenanzeige: BAYERs CIPROBAY und andere Mittel aus der Substanzklasse der Fluorchinolone können die Autoimmun-Krankheit Myasthenia gravis auslösen. Die Medikamente stören das Zusammenspiel zwischen Nerven und Muskeln, indem sie die Aufnahme des Impulse weiterleitenden Neurotransmitters Acetylcholine behindern und führen so zu Lähmungserscheinungen im Bereich der innere Organe, im Bewegungsapparat oder im Gesicht. Deshalb zwang die Behörde den Leverkusener Multi und andere Hersteller, die PatientInnen über diese mögliche Folge der Antibiotika-Einnahme zu informieren.
Neue Preisgestaltung ärgert BAYER
Nach dem 2011 in Kraft getretenen Arzneimittel-Gesetz dürfen die Pharma-Riesen die Preise für ihre neuen Medikamente nicht mehr selber festlegen. Sie sind jetzt Gegenstand von Verhandlungen auf Basis des Zusatznutzens im Vergleich zu älteren Pillen und der in anderen Staaten verlangten Beträge. Die Veröffentlichung der Länder-Referenzliste, auf der sich unter anderem Belgien, Dänemark, Großbritannien, Frankreich und Griechenland befinden, sorgte jetzt für einigen Unmut beim von BAYER gegründeten „Verband forschender Arzneimittel-Hersteller“ (VFA). „Deutschland ist nicht Griechenland. Ein Unterbietungswettbewerb durch Vergleich mit wirtschaftlich schwachen Ländern gefährdet die Einführung von Arzneimittel-Innovationen in Deutschland“, ereiferte sich die VFA-Geschäftsführerin Birgit Fischer.
Zwangsrabatte ärgern BAYER
Nach dem seit 2011 gültigen „Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittel-Marktes“ müssen BAYER & Co. den Krankenkassen für neue Medikamente einen Hersteller-Rabatt von 16 Prozent einräumen. Darüber hat sich BAYER-Chef Marijn Dekkers auf der Bilanz-Pressekonferenz im Februar 2012 bitterlich beklagt und angesichts der diesjährigen Überschüsse von DAK & Co. eine Abschaffung der Regelung gefordert: „Sachliche Gründe für eine Beibehaltung gibt es also nicht.“ Trotzdem ließ sich die Bundesregierung nicht erweichen. Das rief wiederum den von BAYER gegründeten „Verband der forschenden Arzneimittel-Hersteller“ auf den Plan. Er sah „Politisches Kalkül statt faktenbasierter Prüfung“ am Werk und wiederholte Dekkers Kritik wortwörtlich: „Sachliche Gründe für eine Beibehaltung gibt es also nicht.“ Die Dienstwege sind eben kurz.
PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE
HEDONAL geht an die Nieren
In El Salvador sorgen Pestizide für massive Gesundheitsprobleme. So leiden in der Küstenregion Bajo Lempa über 20 Prozent der Menschen an Nieren-Erkrankungen. Mauricio Sermeño von der Umweltorganisation UNIDAD ECOLÓGICA SALVADOREÑA macht dafür hauptsächlich zwei Ackergifte verantwortlich: SYNGENTAs GRAMOXON und BAYERs HEDONAL mit dem Wirkstoff 2-4-Dichlorphenoxyessigsäure, der als ein Bestandteil von Agent Orange traurige Berühmtheit erlangte. Nach den Angaben der Organisation gibt es in bestimmten Gebieten des Landes kaum EinwohnerInnen, die nicht einen Verwandten oder Freund durch NierenVersagen verloren hätten (siehe auch SWB 2/12).
OXFAM kritisiert FLINT-Sprühungen
Auf den Bananen-Plantagen Ecuadors herrschen einer OXFAM-Studie zufolge unhaltbare Zustände. So müssen die Angestellten dort für einen Hungerlohn arbeiten und auch noch ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Während Flugzeuge Pestizide wie Mancozeb (enthalten unter anderem in BAYERs FLINT) versprühen, dürfen die LandarbeiterInnen die Felder nicht verlassen, obwohl sie bloß in Ausnahmefällen Spezialkleidung tragen. „Wir bekommen die Pestizide ab und können uns nur mit unseren Händen und Bananen-Blättern schützen“, klagt einer von ihnen. Zudem verseuchen die auf dem Luftweg ausgebrachten Ackergifte auch die Umgebung und sorgen so für hohe Krankheitsraten, vor allem unter Kindern. „Sie leiden unter Gehirn-Erkrankungen, Problemen in den Armen und Beinen, Hautausschlag etc.“, so eine Feldarbeiterin.
COCA COLA mit Carbendazim
In Orangensäften des Unternehmens COCA COLA fanden sich Spuren des BAYER-Pestizids Carbendazim. Und der Wirkstoff, den der Leverkusener Multi unter dem Produktnamen DEROSAL vermarktet, hat es in sich. „Giftig für Wasser-Organismen“, „kann das Kind im Mutterleib schädigen“, „kann vererbbare Schäden verursachen“ – so lauten einige Warnhinweise für das Fungizid. Darum sollte die Substanz ursprünglich ebenso wenig wie weitere fünf Agro-Chemikalien des Konzerns eine neue Zulassung von der Europäischen Union erhalten. Aber für Carbendazim machte Brüssel dann kurz vor Ablauf der Frist eine Ausnahme und gewährte eine Verlängerung. Es gäbe „annehmbare Anwendungen“, erklärte die EU-Kommission und berief sich dabei ausgerechnet auf Studien der Agro-Riesen sowie auf eine Expertise der von Industrie-VertreterInnen durchsetzten „Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit“ (siehe auch TICKER 2/11).
Kein Glyphosat-Verbot
Die Liste der Risiken und Nebenwirkungen des von MONSANTO entwickelten Pestizid-Wirkstoffs Glyphosat, den BAYER etwa im Kombi-Pack mit der gegen diese Substanz immun gemachten Baumwollpflanze „GHB 614“ verkauft, ist lang. So stört die Agrochemikalie das Embryo-Wachstum, lässt Soja-Gewächse absterben und Mais verwelken, macht wertvollen Boden-Organismen den Garaus und dezimiert die biologische Vielfalt. Das alles aber reichte der Bundesregierung nicht aus, um den Stoff aus dem Verkehr zu ziehen. Sie lehnte Anfang Februar 2012 einen entsprechenden Antrag der Grünen ab und verlängerte die Zulassung bis 2015.
Verkauf von Ultra-Giften
Der Leverkusener Multi trennt sich im Rahmen der Verkleinerung seines Pestizid-Sortiments weiter von besonders schädlichen Agrochemikalien der Gefahrenklasse I. Nachdem er im letzten Jahr schon NEMACUR und MOCAP verkauft hatte, stößt er nun SEVIN (Wirkstoff: Carbaryl) ab. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) kritisiert diesen Schritt, den der Konzern der Öffentlichkeit gegenüber als Teil seiner Nachhaltigkeitsstrategie verkauft: „BAYER hätte die Produktion längst einstellen müssen, statt diese Ultra-Gifte jetzt noch profitabel zu verramschen“.
GAUCHO befördert Milben-Befall
BAYERs Imidacloprid-haltiges Pestizid GAUCHO sorgte für den Tod von Millionen Bienen. Der Leverkusener Multi streitet diese „Nebenwirkung“ jedoch ab und macht stattdessen die Varroa-Milbe für die Sterbefälle verantwortlich. Eine von einem Bienenforschungsinstitut, das dem US-amerikanischen Landwirtschaftsministerium untersteht, durchgeführte Studie wies jetzt einen Zusammenhang zwischen beiden Phänomen nach. Der Untersuchung zufolge zeigten sich durch GAUCHO & Co. geschwächte Bienen anfälliger für den Befall mit der Milben-Art als gesunde Tiere.
GENE & KLONE
BAYER-Gensoja zugelassen
Nachdem sich weder ein ExpertInnen-Gremium der EU noch ein Berufungsausschuss über die Import-Genehmigung für BAYERs Gensoja der BASTA-Produktreihe und drei weiteren Laborfrüchten einigen konnte, hat die Europäische Kommission ein Machtwort gesprochen und alle Sorten zugelassen. Die COORDINATON GEGEN BAYER-GEFAHREN und andere Initiativen haben immer vor einem solchen Schritt gewarnt. „A5547-127“ ist nämlich durch eine auf gentechnischem Wege eingebaute Resistenz auf den Gebrauch des hochgefährlichen Herbizides LIBERTY mit dem Wirkstoff Glufosinat abgestimmt, dessen Gebrauch die Europäische Union ab 2017 verboten hat. Zudem unterscheidet sich die LIBERTYLINK-Pflanze auf Stoffwechsel-Ebene von seinen konventionellen Ebenbildern, was auf eine genetische Instabilität hindeutet, die eigentlich der Gegenstand eines Stress-Tests hätte sein müssen. Dieser unterblieb jedoch. Auch Daten-Material von Fütterungstests liegt nur sporadisch vor. Das alles macht den Soja des Konzerns zu einem unkalkulierbaren Risiko.
Genbaumwoll-Anbau beantragt
Der Leverkusener Multi hat in Spanien einen Antrag auf eine Anbau-Genehmigung für seine Gentech-Baumwolle „GHB 614“ gestellt, die gegen das gefährliche Anti-Unkrautmittel Glyphosat (siehe auch PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE) resistent ist.
Genraps-Anbau beantragt
BAYER hat in Australien einen Antrag auf eine Anbau-Genehmigung für seine Genraps-Sorte INVIGOR gestellt. Die Pflanze ist nicht nur gegen Glufosinat immun, sondern auch gegen MONSANTOs berühmt-berüchtigten ROUND-UP-READY-Wirkstoff Glyphosat (siehe auch PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE). Schadinsekten gewöhnen sich nämlich zunehmend an die Pestizide, welche die Hersteller im Kombipack mit ihren gegen diese Wirkstoffe resistenten Genpflanzen verkaufen. Ein Lizenzabkommen mit dem US-Unternehmen ermöglichte dem Leverkusener Multi die Entwicklung des Doppelpacks. Die australische Initiative GENEETHICS hat Einspruch gegen das Zulassungsbegehr erhoben und dabei mit der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN zusammengearbeitet.
Pestizide per Gentechnik
BAYER nutzt die Biotechnologie zur Produktion von Pestiziden. So kommen bei der Herstellung des Anti-Unkrautmittels INDAZIFLAM gen-manipulierte Coli-Bakterien zum Einsatz.
PFLANZEN & SAATEN
BAYER kauft Raps-Sparte
BAYER hat die Rapssaatgut-Abteilung des Unternehmens RAPS GbR erworben. Nach Ansicht der BAYER-CROPSSCIENCE-Vorsitzenden Sandra Peterson wird der Kauf „den Eintritt von BAYER CROPSSCIENCE in den europäischen Raps-Markt weiter beschleunigen“. Der Agro-Multi, der in den USA bereits eine führende Stellung im Raps-Geschäft innehat, will noch in diesem Jahr erste Sorten auf den EU-Markt bringen.
WASSER, BODEN & LUFT
Luftverschmutzungskosten: bis zu 169 Mrd.
Die Europäische Umweltagentur EUA hat ausgerechnet, wie hoch die Kosten für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sind, welche die Luftverschmutzung verursacht. Sie kam auf staatliche Zahlen: Zwischen 102 und 169 Milliarden Euro bewegt sich der Wert. Dabei richten die 191 größten Betriebe die Hälfte des Gesamtschadens an. Und auf dieser Liste durfte BAYER natürlich nicht fehlen. Sowohl die Werke in Leverkusen als auch die in Krefeld fanden sich auf ihr wieder.
Endgültiges Aus für Kohlekraftwerk
Im letzten Jahr hatte der Leverkusener Multi nach massiven Protesten den Verzicht auf die Errichtung eines klimaschädlichen Kohlekraftwerks in Krefeld bekannt gegeben. Stattdessen plante er gemeinsam mit TRIANEL ein umweltfreundlicheres Gas- und Dampfkraftwerk. Aber so ganz in trockenen Tüchern war das Vorhaben lange nicht. „Ob dieses Projekt wirtschaftlich umsetzbar ist, wird sich im Laufe der Projekt-Entwicklung zeigen“, erklärte der Konzern nämlich. Aber Anfang Februar 2012 machte er die Entscheidung dann endgültig, indem er den Bauantrag für die Dreckschleuder offiziell zurückzog.
GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV
BAYER: „Bisphenol keine Gefahr“
Im März 2011 hatte die EU die Verwendung der Industrie-Chemikalie Bisphenol A in Babyflaschen untersagt, da die Substanz Schädigungen des Nervensystems, Übergewicht, Unfruchtbarkeit, Diabetes sowie Herz- und Lebererkrankungen verursachen kann. Der Leverkusener Multi, der zu den größten Produzenten des Stoffes zählt, spielt die Gefahr jedoch immer noch herunter. Eine Studie des BUNDs, der Kindertagesstätten überprüfte und in 92 von 107 Staubproben Bisphenol nachwies, fand er nicht weiter beunruhigend. Bisphenol A sei nicht krebserzeugend und habe keinen Einfluss auf die Fruchtbarkeit, wiegelte Konzernsprecherin Gisela Stropp gegenüber dem Pfälzischen Merkur ab.
CO & CO.
Erdeinbrüche durch Zechen-Schächte?
Immer wieder kommt es entlang der Trasse von BAYERs Kohlenmonoxid-Pipeline zu Erdeinbrüchen. In Erkrath und rund um Ratingen bildeten sich teilweise schon 80 cm tiefe Krater. Stillgelegte Zechen entlang der Trasse könnten diese Gefahr durch die Hohlräume, die von den Schächten herrühren, noch verstärken. 12 solcher Bergbau-Areale hat Erich Hennen von der Initiative STOPP BAYER-CO-PIPELINE ausgemacht, obwohl die Bezirksregierung und das Bergbau-Amt keine Unterlagen herausgaben. „Es wird gemauert, verdeckt, verschwiegen“, kritisierte Hennen.
NANO & CO.
Nano-Kongress in Bayreuth
Anfang Februar 2012 hielt die vom Bundesforschungsministerium geförderte „Innovationsallianz Carbon Nanotubes“, der auch der Leverkusener Multi angehört, ihren vierten Jahreskongress in Bayreuth ab. Von dem Gefährdungspotenzial, das von den Kohlenstoff-Nanoröhrchen (CNT) ausgeht, sprachen die TeilnehmerInnen natürlich nicht, obwohl einige WissenschaftlerInnen es mit demjenigen von Asbest vergleichen. Die Nano-Technologie lässt nämlich Werkstoffe auf winzig kleine Größen schrumpfen, wodurch diese unbekannte und nicht selten gefährliche Eigenschaften entwickeln. BAYER-Manager Peter Krüger focht das nicht an. Er malte die Nano-Zukunft in goldenen Farben: „Unsere Forschungsarbeiten zeigen, dass CNT wichtige Impulse geben können (...) Das sorgt für innovative Produkte, stärkt die Wirtschaft und schafft Arbeitsplätze. Außerdem geben Kohlenstoff-Nanomaterialien wichtige Impulse für mehr Klimaschutz und Ressourcen-Effizienz.“
BAYER eröffnet Nano-Konferenz
Am 21. und 22. März fand in Brüssel die Konferenz „Nano Enhancers for Plastics 2012“ statt. Sie befasste sich mit dem Segen, den die Nanotechnologie angeblich für die Kunststoff-Industrie bereithält. Das Grundsatz-Referent durfte BAYERs Nano-Beauftragter Peter Krüger halten. Und natürlich ließ er es sich nicht nehmen, in seinem Beitrag die Werbetrommel für die BAYTUBES-Kohlenstoffröhrchen des Konzerns zu rühren.
NIOSH für höhere Nano-Grenzwerte
Selbst ist der Multi: BAYER hatte den Grenzwert für die Belastung der Beschäftigten mit Nano-Stäuben eigenmächtig auf 50 Mikrogramm festgesetzt – und die damalige schwarz-gelbe Landesregierung Nordrhein-Westfalens nickte diesen auch ohne Murren ab. Mittlerweile fordern WissenschaftlerInnen viel schärfere Limits. So empfiehlt das US-amerikanische „National Institute for Occupational Safety and Health“ (NIOSH) eine Marke von sieben Mikrogramm pro Kubikmeter Raumluft.
Nanotubes können Erbgut schädigen
Nano-Röhrchen aus Kohlenstoff, wie der Leverkusener Multi sie mit seinen BAYTUBES herstellt, sind imstande, das Erbgut zu schädigen. Das kann dem österreichischen „Institut für Technikfolgen-Abschätzung“ zufolge sowohl durch einen direkten Kontakt mit der DNA als auch durch entzündliche Reaktionen des Körpers geschehen.
Energie-intensive Nano-Herstellung
Die Herstellung von Kohlenstoff-Nanoröhrchen (CNT) wie BAYERs BAYTUBES ist sehr energie-intensiv. Die Produktion von einem Kilogramm Nanotubes verschlingt bis zu 1 Terrajoule, zu deren Erzeugung es ca. 26.550 Liter Erdöl braucht. „Demnach wären CNTs eines der energie-intensivsten Materialien, die uns bekannt sind“, resümiert das österreichische „Institut für Technikfolgen-Abschätzung“.
UNFÄLLE & KATASTROPHEN
Gas-Austritt in Tarragona
Am 11. Januar 2012 kam es auf dem Gelände des spanischen BAYER-Standortes Tarragona zu einem Gasaustritt, was einen mehrstündigen Alarm auslöste.
PLASTE & ELASTE
Neues Forschungszentrum
BAYER MATERIAL SCIENCE, die Kunststoff-Sparte des Leverkusener Multis, hat in Dormagen ein neues Forschungszentrum in Betrieb genommen. Es hat die Aufgabe, „die technischen Abläufe bei der Produktion der Isocyanate MDI und TDI sowie der dabei benötigten Vorprodukte weiter zu erforschen und zu optimieren“. Es geht also vornehmlich um Effizienz-Steigerung. Dabei wäre ein ganz anderer Forschungsschwerpunkt wichtig: Der Versuch, bei der Herstellung der Plaste-Produkte ohne das gefährliche Giftgas Phosgen auszukommen.
STANDORTE & PRODUKTION
Chemie-„Park“ als Giftlager
Seit Jahren bemüht sich die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) darum, Angaben über die auf den Werksarealen von BAYER gelagerten gefährlichen Chemikalien zu erhalten. Trotz Umweltinformationsgesetz gelang ihr dies bisher nie – der Leverkusener Multi machte stets Terror-Gefahren geltend. Im Frühjahr 2011 jedoch entsprach die Bezirksregierung erstmals einem Antrag der CBG und teilte Zahlen für den gesamten Dormagener Chemie„park“ mit. Sie geben einigen Anlass zur Sorge. So befinden sich auf dem Gelände 70.000 Tonnen „giftige“ bzw. „sehr giftige“, über 13.000 Tonnen leicht entzündliche und über 65 Tonnen brandfördernde Stoffe. Von den sehr giftigen BAYER-Substanzen erreicht Toluol-diisocyanat (TDI) mit 7.765 Tonnen das größte Volumen. Es folgen Dimethylsulfat mit 51, Phosgen mit 36 und Brom mit zwei Tonnen. Bei den „nur“ giftigen Chemikalien nimmt die Propylenoxid-Menge mit 6.400 Tonnen das beträchtlichste Ausmaß an. Dann kommen Methanol mit 951, Chlor mit 761 und Hydrazin mit 360 Tonnen.
Mehr Pillen aus Weimar
BAYERs Verhütungsmittel aus der YASMIN-Familie haben mehr Nebenwirkungen als andere Kontrazeptiva. So registrierte allein die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA in den letzten zehn Jahre 190 Sterbefälle nach Thromboembolien. Trotzdem will der Konzern die Produktion von YASMIN und anderen Pillen ausweiten. Darum rief er seine Niederlassungen zu einem internen Standort-Wettbewerb auf, aus dem Weimar als Sieger hervorging. Hier baut der Multi demnächst für 25 Millionen Euro; neue Arbeitsplätze entstehen durch die Investition nicht.
BMS investiert 700 Mio. in Deutschland
BAYER MATERIAL SCIENCE (BMS) kündigte an, bis 2014 ca. 700 Millionen Euro in der Bundesrepublik zu investieren. Zu den Projekten der Kunststoff-Sparte gehört die TDI-Anlage in Dormagen, eine neue Fabrik für Lackrohstoffe in Leverkusen und eine Kapazitätserweiterung in Krefeld. Der Multi feiert das als Bekenntnis zum Standort, obwohl sein finanzielles Engagement in Asien die für Deutschland vorgesehene Summe bei Weitem übersteigt – allein in Shanghai hat sich BMS neue Fertigungsstätten binnen der letzten zehn Jahre 2,1 Milliarden Euro kosten lassen. Viele neue Arbeitsplätze schafft das Unternehmen durch die Bau-Vorhaben auch nicht. So entstehen durch die in Leverkusen geplante Lack-Produktion nach Angaben des Konzerns gerade einmal „bis zu zehn“ neue Jobs.
Keine „Kultur GmbH“ in Leverkusen
Seit der Unternehmenssteuerreform von 2000/2001, die BAYERs ehemaliger Finanzchef Heribert Zitzelsberger in seiner Funktion als Staatssekretär wesentlich mitgeprägt hat, verringerte sich die Abgabenlast des Global Players merklich. Das bescherte den Städten mit BAYER-Standorten große finanzielle Nöte. Darum existierten im chronisch klammen Leverkusen Pläne, das Kulturprogramm des Pharma-Riesen stärker mit demjenigen der Kommune zusammenzuführen. Dazu wird es allerdings nicht kommen. „Wir haben schließlich bemerkt, dass die erhofften Synergie-Effekte bei einer engeren Kooperation doch nicht so groß wären“, so die Kulturpolitikerin Marion Grundmann zu den Motiven für den Entschluss, doch lieber weiter getrennte Wege zu gehen. Der Pharma-Riese, der gern