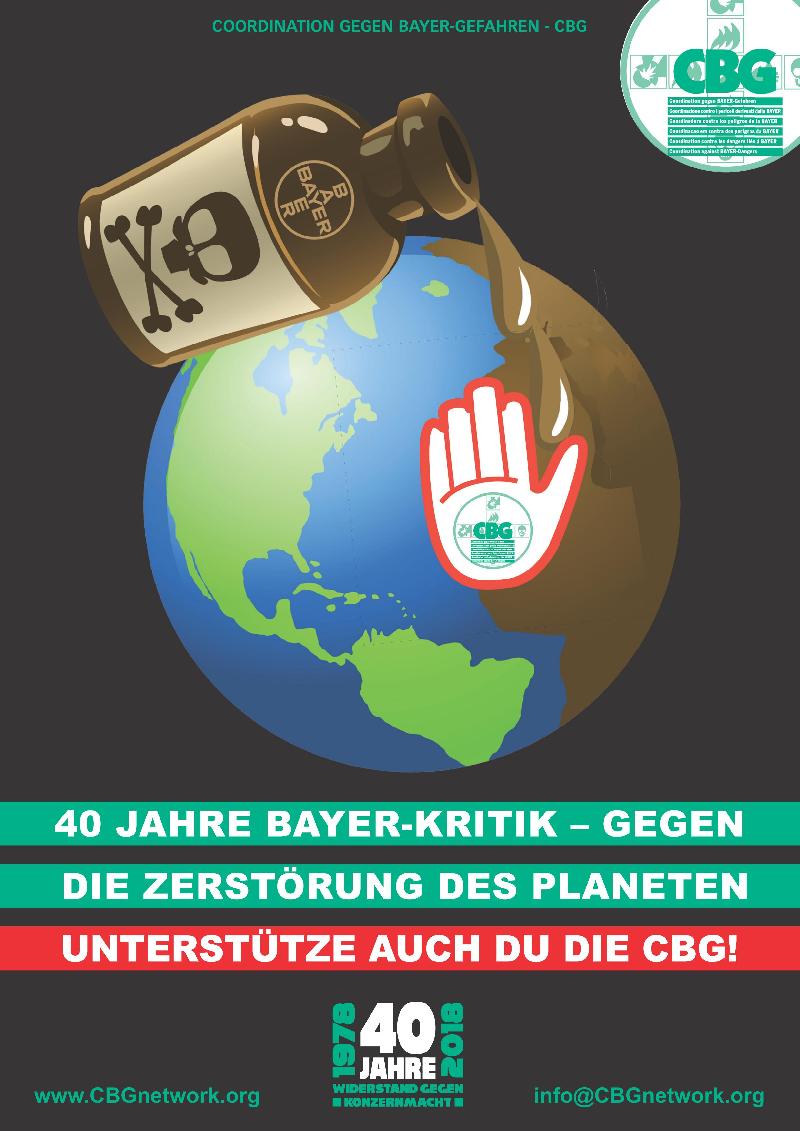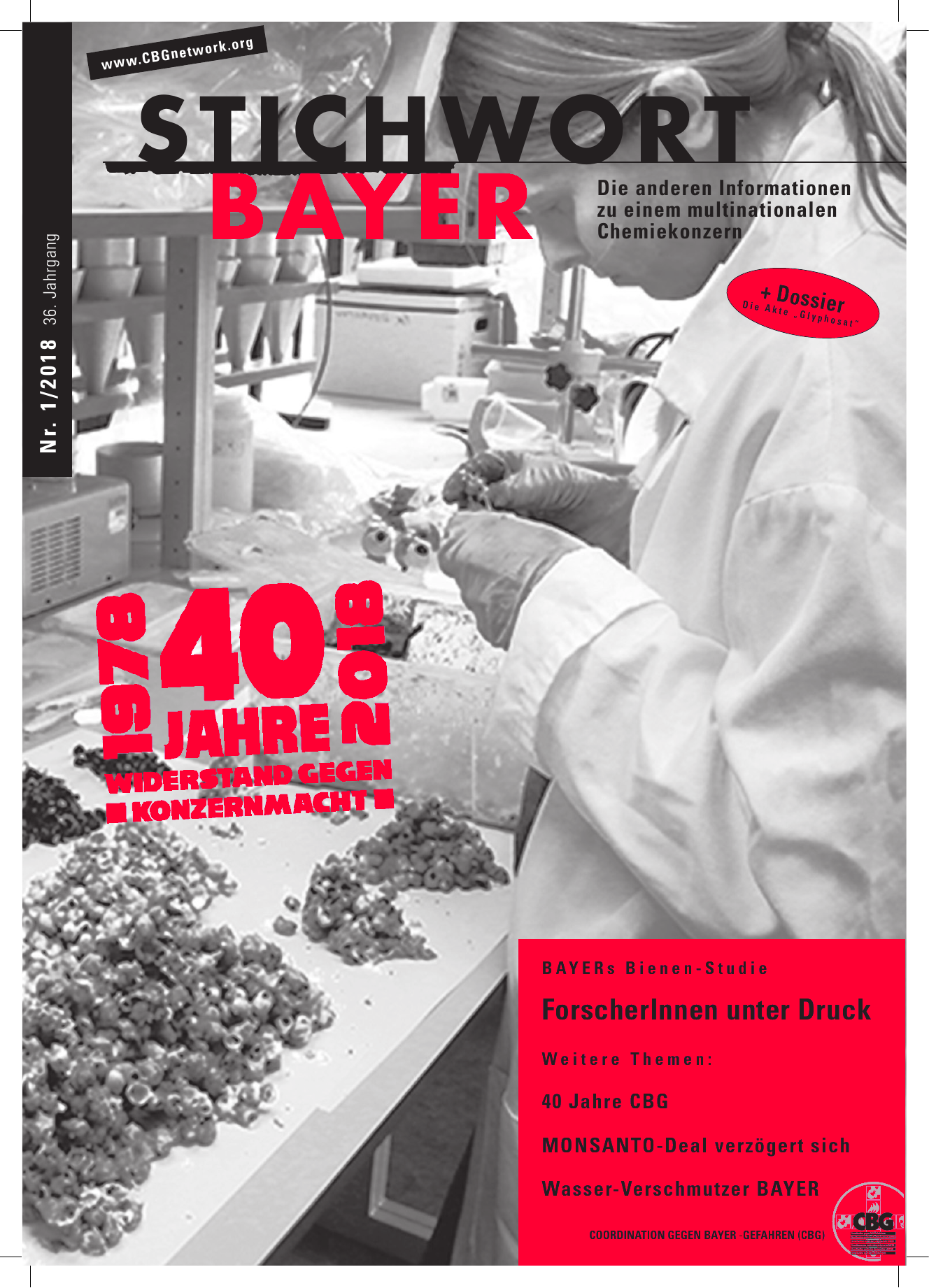In diesem Jahr kann die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Mit einem ganz frischen Blick auf die Geschichte der Coordination befragt der neue CBG-Geschäftsführer Jens Wegener im Stichwort BAYER das Gründungsmitglied Axel Köhler-Schnura und den 1997 dazugestoßenen Jan Pehrke zu den Anfängen, den ersten Erfolgen, den Gegen-Reaktionen BAYERs, dem Standhalten und den neuen Herausforderungen, vor denen das Netzwerk steht. Aus gegebenem Anlass musste das Interview nur leider am Krankenlager von CBG-Urgestein Köhler-Schnura stattfinden, der schon seit Juni 2017 an einem ebenso komplizierten wie schmerzhaften Oberschenkel-Bruch laboriert (siehe auch Kasten).
Jens: Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN feiert dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Ihre Gründung geht auf zwei große Unfälle bei BAYER im Jahr 1978 zurück. Wie genau ist es denn passiert, dass daraus ein so großes Netzwerk entstanden ist?
Axel: Die zwei Beinahe-Katastrophen ereigneten sich in Wuppertal. Dort gründete sich BAYER im vorletzten Jahrhundert, und das Werk steht mitten in der Stadt. Deswegen sind Unfälle in einem solchen Werk auch besonders gefährlich. Und dass die zwei Unfälle auch noch kurz hintereinander passiert sind, hat dazu geführt, dass sich eine Bürgerinitiative gegründet hat. Unfälle gibt es jeden Tag irgendwo in Deutschland in irgendeinem Industrie-Werk, und sie sorgen auch einige Tage für Aufregung, aber wenn dann erst mal wieder Ruhe einkehrt und das dann anschließend wieder zehn Jahre gut geht, dann passiert halt nichts. Aber in Wuppertal ist im Abstand von wenigen Wochen ein zweiter Unfall eingetreten, und dadurch sind die Leute wach geworden. Ich selbst gehörte zu den Menschen, die damals zu einer Bürgerversammlung aufgerufen hatten. Wir haben eine Gaststätte gesucht, da haben vielleicht 100 Leute reingepasst, aber es kamen fast 1.000. Sie standen dann vor der Gaststätte, und die Polizei musste sogar die Straße absperren und den Verkehr aufhalten für dieses Treffen. Die AnwohnerInnen waren wirklich auf den Barrikaden durch diese kurz aufeinanderfolgenden zwei Unfälle. Hätte es nur den ersten gegeben, kann man heute rückblickend sagen, gäbe es vielleicht gar keine COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN. Dann hätte das alles in der lokalen Presse Wellen geschlagen, und es hätte viele Leserbriefe gegeben und vielleicht einiges mehr, aber dann wäre es wieder verplätschert.
Jan: Es waren aber glaube ich auch nicht nur die Unfälle selber, sondern auch die Reaktionen von BAYER auf die Unfälle, die zu der Empörung führten.
Axel: Nein, es waren erst mal nur die Unfälle. Wobei dann, als die Bürgerinitiative zu arbeiten begonnen hat, sich der Ärger über den Konzern schon gesteigert hat, weil BAYER mit verharmlosenden Falschmeldungen reagiert hat. Beim ersten Unfall hatte es auch bereits solche Falschmeldungen gegeben, und das hat auch da zu Unmut geführt, aber so richtig den Protest beflügelt hat natürlich dann, was nach dem zweiten Unfall passiert ist. Da hat nämlich die Bürgerinitiative schon gearbeitet. Sie konnte so immer direkt reagieren und dem Protest in der Öffentlichkeit auch Stimme und Kraft verleihen. Und verharmlost hat der Konzern nicht zu knapp, z. B. anfangs bei den Angaben über das ausgetretene Gift. Die Menge hat sich binnen drei Wochen von einigen Gramm auf hunderte von Kilogramm erhöht.
Jens: Es ist ja immer wieder so: Es passiert etwas, aber gleich darauf kommt die Meldung: Es besteht keinerlei Gefahr, obwohl es eigentlich gar nicht möglich ist, diese Aussagen zu einem solchen Zeitpunkt zu treffen. Gelang es euch, das in Wuppertal durchkreuzen, indem ihr recherchiert habt und dann mit konkreten Fakten an die Leute herangegangen seid? War das ein wichtiger Impuls dafür, dass die Leute gesagt haben: Wir müssen längerfristig etwas gegen BAYER unternehmen?
Axel: Nein, das war alles viel simpler. Da war erst einmal so die allgemeine Empörung, die Angst. Man hat gesehen, wie die Vögel tot vom Himmel fallen; man hat gesehen, wie die Balkon-Pflanzen und die Straßenbäume ihre Blätter abgeworfen haben; man hat beim ersten Unfall gesehen, wie die ganzen Fensterscheiben und Tür-Stöcke barsten in einem Umkreis von 500 bis 1.000 Metern rund ums Werk. Da hat es ausgesehen wie nach einem Bomben-Angriff. Das haben die Leute gesehen. Aber sie wussten nicht, was das bedeutet, woher das kommt, warum das so ist und ob sich das morgen wiederholen kann. Also so ein ganz diffuses Angst-Gefühl. Man hat plötzlich gemerkt: Hoppla, da ist eine Gefahr, und ich bin betroffen. Deswegen ging es der Bürgerinitiative zuerst einmal darum, rauszukriegen, was überhaupt los war. Also, wir haben keine Fakten gehabt, gar nichts. Wir haben gerade mal gewusst, dass das Wort „BAYER“ aus fünf Buchstaben besteht und nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt haben wir angefangen: Was heißt das überhaupt, diese fünf Buchstaben? Da ist eine Werksmauer, und was passiert dahinter? So hat das angefangen.
Jan: Was sind das überhaupt für Gifte? Was ist eine Pestizid-Produktion, wie ist die aufgebaut? Was lauern da für Gefahren? All das wusste damals keiner, es waren alles Laien mehr oder weniger.
Axel: Voll die Laien, keine Ahnung von nichts. So hat das angefangen, und das hat auch zu den Antworten geführt: Das und das ist ausgetreten, aber in einer ganz kleinen Menge. Als wir dann diese Information hatten, haben wir uns erst mal mit dem Stoff auseinandergesetzt, mit der Menge. Dann ergaben sich plötzlich Widersprüche, und BAYER musste ständig nachbessern, weil das alles nicht gepasst hat. Schließlich wurde man immer sachkundiger und ist praktisch erschrocken, dass man eine Straßenbreite getrennt von einer Produktion lebt, die Atomkraftwerkscharakter hat. Das hat dann dazu geführt, dass die Initiative sich stabilisiert und weitergearbeitet hat und letztendlich so etwas wie die Coordination dabei herausgekommen ist.
Jens: Ihr habt da rausgefunden: Wir müssen den Konzern genauer beobachten, wir müssen überall dort mehr recherchieren, wo BAYER zum Schaden von Mensch, Tier und Umwelt agiert. Eine Baustelle war da die Nordsee.
Axel: Du meinst die Proteste gegen die Dünnsäure-Verklappung in der Nordsee – das war fünf Jahre später. So schnell ging das alles nicht. Man hat erst einmal herausgefunden, dass das ein gefährliches Werk war und hat auch die gesamte Komplexität nach ein, zwei Jahren noch nicht so richtig überblickt. Was aber passierte: Ein Jahr später hat sich ein noch viel gefährlicherer und größerer Unfall ereignet, in Dormagen, das ist 30, 40 Kilometer von Wuppertal entfernt. Verschiedene Sachen erfolgten dann. Wir haben erst einmal festgestellt, dass BAYER dort genauso verharmlost und genau dieselben dummen Sprüche bringt, um die Bürger einzulullen und Nebelkerzen zu werfen. Und wir haben festgestellt, dass die Bürger dort genauso beunruhigt waren oder sogar noch sehr viel mehr als bei uns in Wuppertal, weil das tatsächlich tödliche Gifte waren, die da ausgetreten sind. In einem Gebiet von 300 Quadratkilometern wurde Katastrophen-Alarm ausgelöst. Da wir jetzt schon praktisch seit anderthalb Jahren dabei waren, haben wir sofort Kontakt aufgenommen mit den Bürgern und den Journalisten. Und das war ein Quantensprung, in jeder Hinsicht. Bei uns ist die Erkenntnis gewachsen: Oh, BAYER-Werke gibt es also nicht nur in Wuppertal. Das war uns vorher gar nicht so klar, weil wir so beschäftigt waren mit den beiden Unfällen, dass wir Konzern-Strukturen und all das gar nicht gesehen haben. Und über diesen Gedanken sind wir dann auch zum Gesamt-Konzern gekommen – und noch mal ein paar Jahre später zur Nordsee.
Das Zweite war, dass wir den Leuten in Dormagen unsere Erfahrungen, die wir in Wuppertal gemacht haben, vermitteln konnten. Darum hatte der Protest dort von Anfang an eine ganz andere Qualität und entsprechend viel Resonanz. Und da haben wir auch unsere erste Auseinandersetzung mit BAYER direkt gehabt. Der WDR kam für eine Sendung über den Unfall nach Dormagen, die live im Radio übertragen wurde: Vor Ort. Es war jemand von BAYER da, der Bürgermeister, Vertreter der Feuerwehr plus etwa 1.000 Bürger. Aber BAYER ist baden gegangen, in einer verheerenden Art und Weise, weil wir dort aus unseren Wuppertaler Erfahrungen schöpfen konnten und gewappnet waren. Die BAYER-Vertreter wurden ausgebuht und ausgelacht. Das war die Situation, und das alles live über den Sender. Das war die erste große Niederlage, und die hat auch direkt dazu geführt, dass die „Vor Ort“-Sendungen von diesem Zeitpunkt an nicht mehr live gemacht wurden. Und von dieser Sendung gibt es beim WDR nicht einmal mehr Kopien.
Jens: Wenn ein Konzern merkt, dass sich da etwas organisiert, dann versucht er natürlich auch, das zu bekämpfen. Was ist euch da denn so entgegengeschlagen in den ersten Jahren?
Axel: BAYER war in keinster Weise darauf vorbereitet, dass es da jetzt eine Bürgerinitiative gab, die länger besteht als nur zwei Wochen, also eine Kontinuität über die Zeit hinweg zeigt und überdies auch räumlich hinausgreift. Der Konzern hat da relativ hilflos herumoperiert. Mit Falschmeldungen, mit Verleumdungen und mit dem allgemeinen Programm: den Werkschutz in Stellung bringen, mal gucken, was sind das überhaupt für Leute ... das war es dann erst mal. In der Folgezeit, als wir schon systematisch Kontakt zu allen BAYER-Standorten in der Bundesrepublik aufgebaut hatten und regelmäßig die Probleme vor Ort thematisierten, kam die erste große Gegenmaßnahme, die speziell mit unserer Arbeit zu tun hatte. BAYER gab die Nachbarschaftszeitung BAYER direkt heraus. Damit hat der Konzern versucht, der wachsenden BAYER-kritischen Stimmung an den Standorten entgegenzuwirken.
Dann haben sie direkt draufgesattelt und Veranstaltungen gemacht, haben sogar BAYER-Gebäude zugänglich gemacht und als Bürgerzentren ausgewiesen. Dort haben sie den Kontakt zur Bevölkerung gesucht und versucht, sich mit uns auseinanderzusetzen, aber nicht direkt. Nach dieser „Vor Ort“-Sendung hat sich BAYER uns bis auf den heutigen Tag nie mehr direkt gestellt. Wenn dem Konzern etwa bekannt wurde, dass einer von uns bei einer Diskussion mit auf dem Podium sitzt, sagte er alles ab. Bis zum heutigen Tag war das damals in Dormagen das letzte öffentliche Zusammentreffen von BAYER-Vertretern mit Coordinationsvertretern. Aber indirekt hat der Konzern durch diese Nachbarschaftszeitungen, über diese Bürgerzentren versucht, auf uns zu reagieren.
Aber auch da haben sie direkt eine Niederlage erlitten, da wir durch Kontakte in das Werk hinein genau wussten, wann diese Zeitung erscheinen sollte. Und einen Tag vorher verteilten wir dann flächendeckend an allen Standorten den vier-seitigen Flyer „Direkt von BAYER – direkt in den Müll“. Das war die zweite große Niederlage, die BAYER erlitten hat, denn damit hatte der Konzern auch nicht gerechnet, dass wir den Charakter dieses Propaganda-Blattes enthüllen.
Jan: Später hat BAYER dann schon härtere Geschütze aufgefahren. Der Konzern hat den Werkschutz gegen uns in Stellung gebracht. Er hat ihn mit DKP-Fahnen ausstaffiert und zu unseren Hauptversammlungsaktionen beordert, um den Protest als DKP-gesteuert darzustellen. Und in den 1980er Jahren hat BAYER uns einen großen Prozess angehängt, der wirklich an unsere finanzielle Substanz ging. Sie haben sich ein Flugblatt von uns vorgenommen, eine Passage rausgepickt, wo wir dem Konzern vorwerfen, in seiner grenzenlosen Jagd nach Profiten demokratische Prinzipien zu verletzen, Kritiker unter Druck zu setzen und sich politischen Einfluss zu erkaufen und uns wegen Verleumdung angeklagt. Und der Streitwert war, ich weiß nicht, wie hoch war der Streitwert, Axel?
Axel: Der Streitwert war nicht das Entscheidende. Sie haben wegen Verleumdung geklagt, und wir sind verurteilt worden. Der Richter hat sich dann sogar noch angemaßt anzuordnen, dass wir die inkriminierte Passage nicht mehr wiederholen dürfen und dass wir jedes Mal, wenn sie irgendwo erscheint, eine Strafe zahlen müssen von 5.000 DM. Da die ganze Prozess-Berichterstattung logischerweise das inkriminierte Zitat gebracht hat, mussten wir für jeden Artikel 5.000 DM Strafe zahlen. Das hat natürlich zu hohen Strafen geführt, und der Prozess selbst hat auch noch mal eine Menge Geld gekostet. Das hat sich insgesamt auf einen Betrag von 400.000 Euro summiert. Wir sind dann vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Es hat alle Urteile revidiert, und wir haben auch alle Strafgelder zurückbekommen, aber die Prozess-Kosten nicht. Allein das Rechtsgutachten – vor dem Bundesverfassungsgericht kann man nicht bloß mit einer Klage-Schrift argumentieren, man braucht ein Rechtsgutachten – hat uns 100.000 DM gekostet.
Jan: Roman Herzog, der später Bundespräsident geworden ist, hatte damals den Vorsitz und in seiner Urteilsbegründung von dem hohen Gut der Meinungsfreiheit gesprochen, das es zu schützen gelte.
Axel: Wäre das Urteil nicht durch das Bundesverfassungsgericht revidiert worden, dann würden die Zeitungen heute alle ganz anders aussehen. Der Richter, der in der 2. Instanz das Urteil gesprochen hat, riet dem BAYER-Konzern sogar, uns nicht nur zivilrechtlich, sondern auch noch strafrechtlich zu belangen. Wenn er dann der Vorsitzende Richter wäre, hat er wörtlich gesagt, würde er mich für drei Jahre ins Gefängnis stecken. Das zeigt, wie drakonisch dieses Urteil war, und welche Auswirkungen es auf die bundesdeutsche Presselandschaft gehabt hätte. Darum war der Zuschauer-Raum auch voll mit Medien-Vertretern. Da saßen die ganzen Justiziare von Gruner & Jahr, vom Westdeutschen Rundfunk und haben sehr genau zur Kenntnis genommen, wie da die Urteile gefällt worden sind. Das Urteil ist schließlich zu der juristischen Grundlage für jede demokratische Berichterstattung in der Bundesrepublik geworden und gehört inzwischen zum Curriculum der Journalisten-Ausbildung. BAYER hat also von Beginn an immer wieder Niederlagen erlitten, die schon schmerzhaft waren. Das waren so Erfolge, die wir nebenbei erzielt haben, das waren jetzt noch nicht mal so direkte Erfolge wie der,
die Dünnsaure-Verklappung in der Nordsee zu stoppen.
Jens: Zu den größten direkten Erfolgen der CBG gehört die Verhinderung des Baus eines Pestizid-Werkes in Australien. Wie hat sich das genau abgespielt?
Axel: Es war Mitte der 80er Jahre, da gab es noch keinen Email-Verkehr. Da haben wir ein Fax bekommen von Leuten aus einem kleinen Dorf in Australien: Der BAYER-Konzern hätte in der Nähe des Dorfes, das in einem Wattenmeer-Naturschutzgebiet liegt, angefangen, ein Pestizid-Werk zu bauen. Sie wären zutiefst beunruhigt, wüssten aber nicht so genau, was es mit einem solchen Werk auf sich hat und was sie machen sollten. Wir haben die Menschen dann erst einmal über Pestizid-Werke informiert, haben im Austausch herausgefunden, was BAYER genau dort produzieren will und dann Material zu den Stoffen geliefert. Das hat die Leute qualifiziert, ihrerseits Pressevertreter und Vertreter von Umwelt-Organisationen sachgerecht zu informieren. Und wir haben gleichzeitig hier Alarm geschlagen, denn es ist ja immer eine unserer Hauptaufgaben, dass wir Proteste, die woanders entstehen, nicht nur dort austragen, sondern auch immer direkt bei BAYER in Leverkusen.
Nach einiger Zeit kam dann noch heraus, dass BAYER von dem australischen Bundesstaat tatsächlich die Genehmigung hatte, dieses Pestizid-Werk mitten ins Naturschutzgebiet im Wattenmeer zu bauen. Das hat noch weiter zur Skandalisierung des Ganzen beigetragen und dazu geführt, dass eine Konfrontation mit BAYER und dem Bundesstaat entstanden ist und es wenig später übergesprungen ist auf das ganze Land. So ist die Regierung unter Druck geraten und hat in ihrer Not eine Volksabstimmung über das BAYER-Werk angesetzt. Jetzt haben noch ganz andere Gruppen in die gesellschaftliche Diskussion eingegriffen, die Parteien, die Gewerkschaften und die Kirchen. Praktisch ist es zu einer wirklichen nationalen Diskussion darüber gekommen, ob der BAYER-Konzern in dem Wattenmeer ein Pestizid-Werk bauen darf oder nicht. Und die Bevölkerung war der Meinung: BAYER darf da kein Werk bauen. Das war ein gigantischer Sieg. Und wir haben dann hinterher auch dutzende von Dankesbriefen bekommen von Parteien, Gewerkschaften, Umweltverbänden, Kirchen, die sich bei uns persönlich bedankt haben für die großartige Unterstützung in dieser Auseinandersetzung.
Jens: Der BAYER-Konzern hat enorme Möglichkeiten, um seinen Standpunkten in der Öffentlichkeit Geltung zu verschaffen, aber die CBG bringt auch ein eigenes Magazin heraus, in dem sie eine Gegenposition dazu bezieht, das Stichwort BAYER. Wie schafft es die Coordination in einer Zeit, da viele Printmedien über Schwierigkeiten klagen, regelmäßig ein solches Magazin herauszubringen?
Jan: Es sind unsere Mitglieder, die uns dabei unterstützen. Und es war uns von Anfang an klar, dass wir ein publizistisches Organ brauchen, in dem wir darstellen, was wir gemacht haben, die Aktionen durcharbeiten, aber auch durch die Recherchen der Redaktion neue Anregungen für unsere Arbeit erhalten. Nur in unseren großen Krisen stand es mal in Frage, das Stichwort BAYER aufzugeben, aber im Allgemeinen haben wir es immer als sehr wichtig empfunden.
Axel: Jan hat ja schon gesagt: die Mitglieder. Ich würde noch hinzufügen: und die SpenderInnen. Das muss man nämlich wirklich einmal laut und deutlich sagen: Die Mitglieder und Spenderinnen sind unser A und O, denn die Coordination erhält keinerlei institutionelle Förderung. Es gibt keinen Geldgeber, der die Coordination regelmäßig finanziert. Das heißt, wir müssen alles durch Spenden und Förderbeiträge aufbringen – auch das Geld für das Stichwort BAYER. So eine Zeitschrift kostet nämlich: das Layout, der Druck, die Postzustellung ... Über den Preis von 30 Euro für das Jahres-Abonnement ist das nicht zu finanzieren. Es ist ein hoher fünfstelliger Betrag, den wir aufbringen müssen. Und da ist es ein großer Erfolg, dass die Zeitschrift erscheint, und dass sie auch wirklich schon seit Anfang der 80er Jahre erscheint. Das zeigt, dass es möglich ist, eine Zeitschrift herauszubringen, die dauerhaft und mit einer steigenden Auflage einen Konzern unter Kritik stellt mit all den Informationen, die über andere Konzerne nirgends zu lesen sind. Spätere Generationen werden sich darüber freuen. Der BAYER-Konzern ist meines Wissens der einzige Konzern in der ganzen Welt, der in dieser Weise umfangreich dokumentiert ist. Wie es ja auch im Ganzen keinen Konzern gibt, der sich schon so lange mit so etwas wie der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN herumschlagen muss.
Jens: Und der Konzern muss sich seit 1983 auch auf seinen Aktionärsversammlungen mit der Coordination herumschlagen ...
Jan: Ja, meine Vorgänger haben irgendwann entdeckt, dass man Zugang zu den Hauptversammlungen hat, wenn man eine Aktie kauft und das die Möglichkeit eröffnet, Konzern-Kritik direkt in der Höhle des Löwen zu betreiben. Man hat da den Vorstand direkt vor sich und kann ihn direkt damit konfrontieren, was alles so falsch läuft im Unternehmen. Das Pestizid-Werk in Australien z. B. – das haben wir auch da zur Sprache gebracht. Und der Vorstand muss uns aufgrund des Aktien-Rechts auf unsere Fragen auch Antworten geben. Er bemüht sich natürlich nach Kräften, möglichst ausweichende Antworten zu geben, aber manchmal ergeben sich da auch ganz interessante Momente.
Axel: Der BAYER-Konzern hat ja seit der WDR-Sendung in Dormagen zu dem Groß-Unfall nie wieder ein öffentliches Aufeinandertreffen zugelassen von BAYER-Vertretern und Coordinationsvertretern. Und genau deshalb sind wir dann zur Hauptversammlung gegangen. Wir haben gesagt: Wenn die nicht mit uns reden, kommen wir eben zu den Hauptversammlungen und reden mit ihnen.
Jens: Wenn man sich das alles so anhört, wie viel die CBG so macht, dann fragt man sich natürlich: Wie finanziert man das, vor allem unter dem Aspekt, dass der CBG der Anspruch auf Gemeinnützigkeit verweigert wurde?
Axel: Die Verweigerung der Gemeinnützigkeit, was bedeutet, dass Spenden an uns also nicht von der Steuer absetzbar sind, war 1983, in der Frühzeit der Gründung, eine der Maßnahmen, uns das Leben schwer zu machen. In den Akten schrieb der damalige Polizeipräsident von Wuppertal: Diese Organisation darf niemals die Gemeinnützigkeit kriegen. Dabei war klar, dass das ein von BAYER gesteuerter Akt war, weil der Konzern in Wuppertal die ganze Stadt dominiert – an allen Standorten dominiert er die Politik vor Ort. Und auf Landes- und Bundesebene tut er das genauso wie auf internationaler Ebene. Wir haben trotzdem 13 Jahre lang mit steuerrechtlichen und anderen juristischen Mitteln versucht, die Gemeinnützigkeit zu bekommen, aber es ist uns nicht gelungen. Unterstützung haben wir jedoch trotzdem erhalten. Die Leute entscheiden sich und sagen: Ich finde es richtig, Konzern-Kritik zu unterstützen oder eben nicht. Und da spielt es dann nicht die entscheidende Rolle, ob sie dafür eine steuerwirksame Spenden-Quittung bekommen oder nicht. Geld an eine Organisation wie die CBG zu geben, ist eine bewusste Entscheidung, das geschieht nicht einfach aus einem karitativen Impuls heraus.
Jan: Es gab auch gerade wegen der fehlenden Gemeinnützigkeit Solidarisierungseffekte bei den Leuten. Sie wissen eben, dass wir besonders auf Unterstützung angewiesen sind, weil wir keine großen anderen Möglichkeiten haben, unsere Arbeit zu finanzieren, etwa durch institutionelle Förderung oder durch großartige Anträge bei der EU.
Axel: Darum ist eigentlich der größte Erfolg in der Geschichte der Coordination, dass wir über 40 Jahre hinweg sicherstellen konnten, dass die Arbeit der Coordination immer finanziert wurde. Und das ist nicht nur ein finanzieller Erfolg, sondern auch ein politischer Erfolg, weil hinter der Unterstützung immer bewusste Entscheidungen stehen. Es wird tatsächlich wahrgenommen, dass diese Arbeit wichtig ist und dass sie erfolgreich ist.
Jens: Aktuell steht natürlich auch viel Arbeit an, und da ist vor allem die von BAYER geplante MONSANTO-Übernahme zu nennen.
Axel: So etwas wie die MONSANTO-Übernahme haben wir seit Bestehen der Coordination noch nicht erlebt. Seit der Zerschlagung der von BAYER mitgegründeten IG FARBEN nach 1945 hat der Konzern nicht mehr versucht, ein Monopol zu errichten. BAYER galt lange als Konzern, der eine wesentliche Mitschuld an den beiden Weltkriegen trägt und musste vorsichtig agieren, um sich überhaupt wieder im Wirtschaftsbereich zu etablieren.
Jan: In den USA durfte BAYER lange Zeit gar nicht unter dem eigenen Namen auftreten. Erst 1994 gelang es dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Manfred Schneider, die bereits im Ersten Weltkrieg von den Amerikanern als „Feindvermögen“ konfizierten Namensrechte zurückzukaufen.
Axel: Aber jetzt setzt der Konzern mit der MONSANTO-Übernahme erstmals wieder – zwar nur in einem Teilbereich – dazu an, ein Monopol zu errichten. Und deswegen halte ich die MONSANTO-Übernahme für das einschneidenste Ereignis überhaupt in der bisherigen CBG-Geschichte. Sollte der Deal zustandekommen, wäre das für die Coordination eine riesige Herausforderung. Wir müssten uns einarbeiten in die MONSANTO-Produkte, die MONSANTO-Standorte und unser Netzwerk ausweiten, zwar keine Übernahme machen wie BAYER, aber unsere Aktivitäten mit dem weltweiten MONSANTO-Protest zusammenführen und tragfähige internationale Kooperationen herstellen. Wir sind jedoch gewappnet. Seit anderthalb Jahren schon haben wir einen internationalen Aufruf, und wir haben 2016 das MONSANTO-Tribunal in Den Haag als Startpunkt für den Aufbau dieses gemeinsamen antikapitalistischen Widerstandsnetzwerkes genommen.
Kasten
Ohne Ihre Hilfe geht es nicht.
Gegen einen internationalen Konzern anzutreten, kostet Geld. Viel Geld. Deswegen braucht die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN Ihre Hilfe. Darum: Schenken Sie uns zum Geburtstag Ihre Fördermitgliedschaft. Oder erhöhen Sie Ihren Beitrag, wenn Sie schon Fördermitglied sind. Natürlich wissen wir, dass das bei vielen nicht geht. Fühlen Sie sich deshalb also nicht bedrängt. Aber machen Sie sich bitte einmal fünf Minuten Gedanken darüber, was es finanziell bedeutet, einem Multi 40 Jahre lang die Stirn zu bieten? Woher soll das Geld für dieses harte Auseinandersetzung kommen? Zumal der CBG aufgrund ihrer konsequent konzern-kritischen Haltung die Gemeinnützigkeit vorenthalten bleibt und sie auch keine institutionelle Förderung erhält.
Zudem geht die Coordination geschwächt in ihr Jubiläumsjahr. Der bei der CBG für die Finanzen zuständige Axel Köhler-Schnura hat sich einen komplizierten Oberschenkel-Bruch zugezogen und kann deshalb schon seit Juni lange nicht mehr mit voller Kraft arbeiten, was sich auch auf die Ertragslage des Netzwerks auswirkt.
Deshalb: Falls Sie Mitglied werden oder Ihren Beitrag erhöhen können, tun Sie das bitte. Ohne Ihre Hilfe geht es nicht!