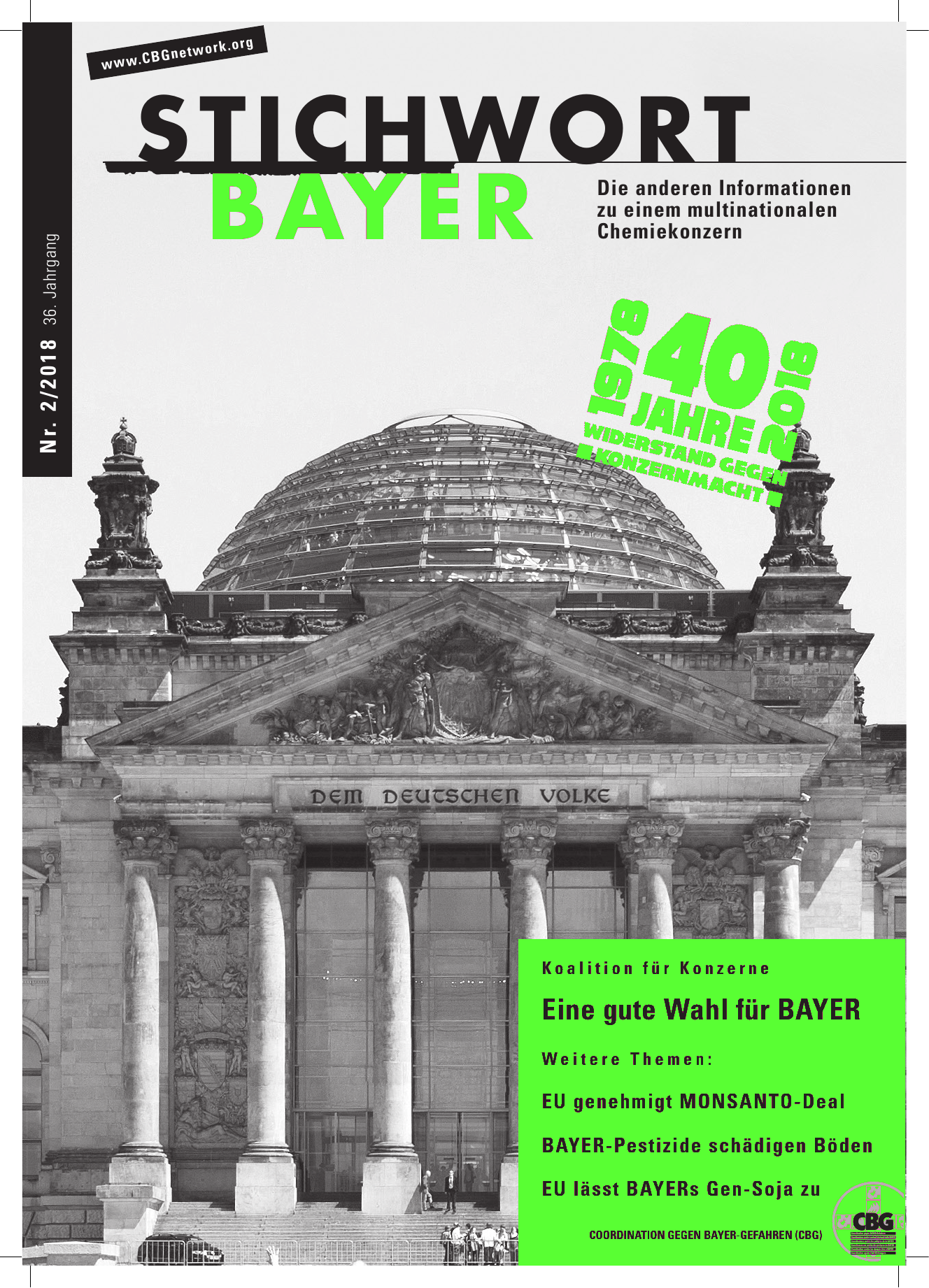Beiträge verschlagwortet als “SWB 02/2018”
Auch die neue Bundesregierung pflegt die ökonomische Landschaft. Sie stellt die „Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts“ vor den Schutz von Mensch, Tier und Umwelt und räumt den Konzernen auch sonst den Weg zur gnadenlosen Profit-Jagd frei. Nicht umsonst halten die BAYER-ManagerInnen große Stücke auf Angela Merkel.
Von Jan Pehrke
„Frau Merkel macht seit vielen Jahren gute Arbeit“, das antwortete BAYER-Chef Werner Baumann der Bild-Zeitung auf die Frage, ob eine 4. Kanzlerschaft gut für die Wirtschaft wäre. Und der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Wenning pflichtet ihm bei: „Ich sehe im Moment keine Alternative zu ihr.“ Warum sollten die beiden Manager auch mit der CDU-Politikerin hadern? Unter allen bisher von ihr geführten Regierungen hat der Leverkusener Multi schalten und walten können, wie er wollte – und glänzende Geschäfte gemacht.
Prima Klima für BAYER
Das neue Regierungsprogramm setzt diese Politik nicht nur fort, sondern hält zusätzlich noch einige Schmankerl für den Konzern bereit. So haben sich CDU und SPD von dem Ziel verabschiedet, die Kohlendioxid-Emissionen bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent gegenüber dem Wert von 1990 zu senken, und damit den Offenbarungseid in der Klima-Politik geleistet. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hatte vor dieser Entwicklung schon seit Längerem gewarnt und angemahnt, die Wirtschaft stärker in die Pflicht zu nehmen. „Die Bundesrepublik droht ihre selbstgesteckten Klimaschutz-Ziele zu verfehlen. Das liegt nicht zuletzt an der Industrie, die kaum einen Beitrag zur Kohlendioxid-Reduktion leistet“, hieß es 2017 in der Presseerklärung der Coordination zur Bonner Weltklima-Konferenz.
Eine große Rolle bei der Suspendierung der CO2-Minderung spielte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). „Wir brauchen im Bund eine Politik, die auch den energie-intensiven Industrie-Sparten Stahl, Aluminium, Chemie, Glas und Papier einen zukunftssicheren Standort in Deutschland bietet“, hatte der getönt. Die Klagen von BAYER & Co. über angeblich zu hohe Strom-Preise fanden in ihm einen geeigneten Resonanzkörper. „Das Erneuerbare-Energien-Gesetz und die Subventionen für regenerative Energien sind heute für viele Unternehmen fast ein größeres Problem (sic) als die Personalkosten“, meinte der Christdemokrat. Am Ende hatte Laschet Erfolg mit der Panikmache. „Bei dem Herzensthema von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gab es früh eine Einigung. Das nationale Klima-Ziel für 2020 wurde gekippt, nun gelten die im Pariser Abkommen genannten Ziele für 2030“, schrieb die Rheinische Post zu den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag.
Die Große Koalition benötigt die zusätzlichen zehn Jahre, weil sie sich entschlossen hat, die Energiewende zu schaffen, „ohne die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Industrie-Standortes Deutschland zu gefährden“. Aus Rücksichtnahme auf die Befindlichkeiten der Industrie hat sie sich vorgenommen, bei der Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen „Kos-ten-Effizienz und Verhältnismäßigkeit zu gewährleisten“. „Offenbar sind hier die Sondierer willens, die Realität anzuerkennen“, lobte der „Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) umgehend. Auch die Androhungen von BAYER & Co., wegen vermeintlich zu hoher Strom-Rechnungen zu Klimaschutz-Flüchtlingen zu werden und Produktionsstätten in andere Länder zu verlagern, haben bei CDU und SPD sichtlich verfangen. Es gelte, eine solche „Carbon Leakage“ zu verhindern, halten die Parteien fest. Darum fehlt in dem Koalitionsvertrag jede verbindliche Aussage zu einer Reform des EU-Emissionshandels, der in seiner jetzigen Form überhaupt nicht funktioniert. Weil die Lizenzen zum Ausstoß von Kohlendioxid zum Schnäppchen-Preis zu haben sind, fehlt den Unternehmen jeglicher Anreiz, ihre Emissionen zu drosseln. Aber trotzdem visiert die GroKo keine konkreten Maßnahmen an. „Den EU-Emissionshandel wollen wir als Leitinstrument weiter stärken“, heißt es lediglich. Und den Kohleausstieg schieben Merkel & Co. auch auf die lange Bank. Sie gründen erst einmal eine Kommission, die dazu Genaueres ausarbeiten soll. Folgerichtig verkündete der bisher im Wirtschaftsministerium für diesen Politik-Bereich zuständige Staatssekretär Rainer Baake seinen Rücktritt. Da die Koalitionsvereinbarung „in den Bereichen Energiewende und Klimaschutz eine herbe Enttäuschung“ sei, bat er um seine Entlassungspapiere.
Aber nicht nur um den Klimaschutz braucht sich der Leverkusener Multi bei seiner Rendite-Jagd nicht groß zu kümmern, auch den Schutz von Mensch, Tier und Umwelt kann er weiter außer Acht lassen. Die GroßkoalitionärInnen bekennen zwar: „Wir wollen für unsere Kinder und Enkelkinder eine intakte Natur bewahren“, konkrete Maßnahmen folgen dem jedoch kaum. Im Pestizid-Bereich etwa plant die neue Bundesregierung, sich bis zur Mitte der Legislatur-Periode Zeit zu lassen, um eine Ackerbau-Strategie „für u. a. umwelt- und naturverträgliche Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln“ auszuarbeiten. Die Umsetzung erfolgt dann laut Koalitionsvertrag „gemeinsam mit der Landwirtschaft“ und ist von Förder-Maßnahmen zum Insektenschutz begleitet. „Dabei liegt uns der Schutz der Bienen besonders am Herzen“, erklären die PolitikerInnen. Aber selbst durch diesen kleinen Ausflug in ihre Gefühlswelt gewinnt ihre Agenda nicht an Überzeugungskraft. Konkret zeigt sich das am Beispiel von Glyphosat, dem von der Weltgesundheitsorganisation als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuften Ackergift-Wirkstoff. Statt einen Sofort-Ausstieg zu beschließen, einigte sich die Große Koalition auf eine „Minderungsstrategie“, die lediglich „so schnell wie möglich“ ohne das Mittel auskommen will. Darum steht zu befürchten, dass CDU und SPD Glyphosat hierzulande im Herbst 2018 erst einmal eine neue Zulassung erteilen. Und zu allem Überfluss nehmen sich Merkel & Co. auch noch einem alten BAYER-Wunsch an und beschleunigen die Genehmigungsverfahren für Pestizide, auf dass noch mehr ungenügend auf ihre Risiken und Nebenwirkungen untersuchte Produkte die Äcker heimsuchen.
Das Ziel, „Wasser und Böden besser zu schützen“, verfolgen Christ- und SozialdemokratInnen ähnlich ambitionslos: „Im Dialog mit der Landwirtschaft werden wir auf eine gewässer-schonende Bewirtschaftung hinwirken.“ Und in Sachen „Arzneimittelrückstände im Wasser“ soll es eine Öffentlichkeitskampagne richten. Die AnwenderInnen und Hersteller der wasser-belastenden Produkte an den Kosten für die Aufbereitung der lebenswichtigen Ressource zu beteiligen, schwebt den Parteien hingegen nicht (mehr) vor. Der entsprechende Passus flog wieder aus dem Koalitionsvertrag. Jetzt steht dort lediglich zu lesen: „Die Abwasserabgaben-Regelung wollen wir mit dem Ziel der Reduzierung von Gewässer-Verunreinigungen weiterentwickeln.“ Zu zahlen haben das dann die VerbraucherInnen, fürchtet der „Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft“ (BDEW). „Der jetzige Vorschlag wälzt die Kosten für eine vierte Reinigungsstufe auf die Verbraucherinnen und Verbraucher ab, obwohl sie nicht die Verursacher der Gewässer-Verunreinigungen sind“, erklärte der BDEW. „Ökonomie vor Ökologie“, so überschrieb Der Spiegel seinen Artikel über die avisierte Umweltpolitik der Großen Koalition passenderweise.
Spahns Spendierlaune
BAYERs Pharma-Sparte darf mit dem GroKo-Programm ebenfalls zufrieden sein. Eine Reduzierung der ständig steigenden Pillen-Preise nehmen sich CDU und SPD nämlich nicht vor, obwohl vor allem die Krankenkassen hier ein Einschreiten gefordert hatten. Besonders bei neu zugelassenen Arzneien sahen sie Handlungsbedarf, weil BAYER & Co. hier ein Jahr lang ihren Rendite-Phantasien freien Lauf lassen können, ehe die mit AOK & Co. ausgehandelten Preise greifen. Der frisch ins Amt gekommene Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der sich durch Lobby-Tätigkeiten im Pharma-Bereich für den Job qualifiziert hat, sieht sogar noch Luft nach oben. „Die Preise für neue Arzneimittel müssen so sein, dass es sich lohnt, für echte Innovationen, für wirklichen Fortschritt, etwa bei Demenz, zu forschen“, meint er.
Von rechtlicher Seite her droht den Pillen-Profiten auch kein Unbill. Sammelklagen wie in den USA, die den Leverkusener Multi dort schon zu Milliarden-Zahlungen an Geschädigte seiner Pharmazeutika LIPOBAY und YASMIN zwangen, finden keinen Eingang ins Bürgerliche Gesetzbuch. Dem BDI, der vor einem enorm hohen volkswirtschaftlichen Schaden durch dieses Rechtsinstitut gewarnt hatte und es mit großen Missbrauchsrisiken behaftet sieht, gelang es mal wieder, sich durchzusetzen. Lediglich eine Musterfeststellungsklage beabsichtigen Merkel & Co. einzuführen. Diese beschränkt die Klage-Befugnis wohlweislich auf bestimmte, nicht näher beschriebene Einrichtungen, „um eine ausufernde Klage-Industrie zu vermeiden“, denn: „Bewährte wirtschaftliche Strukturen sollen nicht zerschlagen werden.“
Von einem anderen juristischen Mittel bleibt BAYER ebenfalls verschont. Hatte es in dem Koalitionsvertrag von 2013 geheißen: „Wir prüfen ein Unternehmensstrafrecht für internationale Konzerne“, so liegt das Ergebnis fünf Jahre später nun vor. Die GroßkoalitionärInnen haben sich gegen ein solches Instrument entschieden. Ein bisschen ungemütlicher dürfte es für die Multis aber trotzdem werden. Die neue Bundesregierung will nämlich sicherstellen, „dass bei Wirtschaftskriminalität grundsätzlich auch die von Fehlverhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern profitierenden Unternehmen stärker sanktioniert werden“, und eine solche Strafverfolgung nicht länger in das Ermessen der zuständigen Behörde stellen. Überdies haben CDU und SPD vor, die bisherige Bußgeld-Obergrenze von zehn Millionen Euro anzuheben.
An die Steuerspar-Modelle von BAYER & Co. traut sich die Regierungskoalition hingegen nicht heran. Nur die bisher nach unten offene Abgaben-Skala beabsichtigt sie, mit Mindest-Sätzen ein wenig zu begrenzen. Viel mehr Eigeninitiative entwickelt die Merkel-Riege jedoch nicht. Sie bekundet lediglich ihre Solidarität mit Vorhaben auf EU- und OECD-Ebene: „Wir unterstützen ausdrücklich alle Bemühungen für eine gerechte Besteuerung großer Konzerne.“ Derartigen Lippenbekenntnissen könnten jedoch schon bald Taten in die andere Richtung folgen. Die Bundesregierung gedenkt nämlich, „eine Antwort auf internationale Veränderungen und Herausforderungen, nicht zuletzt in den USA“, zu geben. Entsprechenden Druck hatte vorher der BDI ausgeübt und mit Blick auf Donald Trumps massive Senkungen der Tarife „strukturelle Steuerreformen“ angemahnt, um „wettbewerbsfähig zu bleiben“. Der CDUler Fritz Güntzler weiß diese Aufgabe bei Finanzminister Olaf Scholz in guten Händen, erinnerte er sich doch in einem Gespräch mit der Faz noch an die maßgeblich vom ehemaligen BAYER-Finanzchef Heribert Zitzelsberger gestaltete und den Multis Milliarden-Entlastungen eintragende Unternehmenssteuerreform des Jahres 2000. „Jetzt erkenne man den großen Plan, warum die Union das Finanzministerium an die SPD abgegeben habe, scherzte er“, so gibt die Zeitung seine Worte wieder.
Der BAYER-Stammsitz Leverkusen hat sich bis heute nicht von diesem Paragrafen-Werk erholt. Die Kommune musste dem „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ beitreten und steht aktuell unter der Finanzaufsicht des Kölner Regierungspräsidenten. Der die Stadt im Bundestag vertretende Karl Lauterbach (SPD) verteidigte den Koalitionsvertrag trotzdem. Gerade für die Beschäftigten würde er durch Veränderungen auf dem Gebiet des Arbeitsrechts viel bringen. Besonders hob der Politiker dabei Erleichterungen für ArbeiterInnen und Angestellte hervor, die durch Kettenverträge gezwungen sind, sich bei einem Unternehmen von Befristung zu Befristung zu hangeln. „Das ist besonders bei den BAYER-Töchtern hier in Leverkusen der Fall“, meinte Lauterbach und kündigte ein Verbot dieser Praxis durch die Große Koalition an. Ob CDU und SPD da liefern und die Belegschaftsangehörigen des Multis davon wirklich profitieren, bleibt allerdings abzuwarten. Verpflichtet zeigt sich der Koalitionsvertrag im Wesentlichem nämlich nur einem: den Profit-Interessen von BAYER & Co. ⎜
Die Entscheidung über BAYERs MONSANTO-Deal rückt näher
EU genehmigt Übernahme
Am 21. März 2018 hat die Europäische Union BAYERs Antrag auf Übernahme von MONSANTO genehmigt. Brüssel sieht durch die Bereitschaft des Leverkusener Multis, sich von einigen Geschäftssparten zu trennen, die Gefahren eines solchen Mega-Deals gebannt. Trotzdem kann der Leverkusener Multi die Sektkorken noch nicht knallen lassen, denn es stehen noch einige Entscheidungen aus. Und die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN wird gemeinsam mit ihren Bündnis-Partnern bis zuletzt weiter gegen Baysanto streiten.
Von Jan Pehrke
„Wir haben die Übernahme von MONSANTO durch BAYER genehmigt, weil unsere wettbewerbsrechtlichen Bedenken durch die von den Unternehmen vorgelegten Verpflichtungszusagen, die einen Umfang von weit über sechs Mrd. Euro haben, vollständig ausgeräumt werden“, das erklärte die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager zur Begründung der Zustimmung. Ein positives Votum Brüssels hatte sich schon länger abgezeichnet. Zwar zögerte die Generaldirektion Wettbewerb das Ende der Prüf-Phase mehrfach hinaus, aber einen Anlass zur Hoffnung gab das nicht unbedingt. „Wenn eine Entscheidung verschoben wird, hat das oft damit zu tun, dass wir mehr Zeit brauchen, um uns anzuschauen, was das Unternehmen uns für Angebote macht, um unsere Bedenken aus dem Weg zu räumen“, erklärte Vestager nämlich.
Ein erstes solches Angebot hatte BAYER im Herbst 2017 gemacht. Der Leverkusener Multi zeigte sich willens, ein Paket mit seinen gen-manipulierten Raps-, Soja- und Baumwoll-Pflanzen der „LIBERTY LINK“-Baureihe samt dem dazugehörigen Pestizid Glufosinat sowie einige weitere Ackerfrüchte an die BASF zu veräußern. Ein weiteres Zugeständnis unterbreitete der Global Player im Februar 2018. Da stellte er seine Gemüsesaatgut-Tochter NUNHEMS zur Disposition. Zudem verkündete der Konzern Konzessionen im Bereich der digitalen Landwirtschaft. So beabsichtigt BAYER, der BASF eine Exklusiv-Lizenz zur Nutzung dieser „Zukunftstechnologie“ einzuräumen. Ganz trennen mochte sich der Agro-Riese von Produkten dieser Abteilung jedoch nicht, da er mit der Bereithaltung von Tools zur daten-gestützten Bodenbewirtschaftung zu einer Art GOOGLE der Äcker aufzusteigen gedenkt.
Die Wettbewerbskommissarin akzeptierte all das jedoch, obwohl ihre KollegInnen einige der Posten schon zur Makulatur haben werden lassen. Die Europäische Union hat nämlich die Zulassung von Glufosinat wegen dessen erbgut-schädigenden Eigenschaften nicht verlängert, weshalb es die ihm von Margrethe Vestager zugedachte Rolle „eines Konkurrenz-Produkts für das MONSANTO-Produkt Glyphosat“ gar nicht mehr zu spielen vermag.
So erreicht Baysanto dann trotz der Auflagen im Pestizid-Bereich einen Markt-Anteil von mehr als 20 Prozent und beim konventionellen Saatgut einen Markt-Anteil von ca. 30 Prozent. Beim gen-manipulierten Saatgut beträgt dieser sogar 90 Prozent. Diese dominierende Stellung bedroht die Landwirtschaft, da die LandwirtInnen mit höheren Preisen rechnen müssen und überdies weniger Auswahl haben. Auch die VerbraucherInnen können beim Einkauf nicht mehr zwischen so vielen Sorten wählen, wenn der Leverkusener Multi mit seinem Vorhaben wirklich zum Ziel kommen sollte. Daran stört sich die EU-Kommission offensichtlich nicht. Mit ihrem Genehmigungsbescheid hat sie dem von vier Konzernen gebildeten und von BAYER unangefochten angeführten Oligopol im Landwirtschaftssektor ihren amtlichen Segen erteilt.
Aber die Übernahme hat noch weitere Folgen, welche Vestager & Co. gar nicht erst in den Blick nahmen, weil sie ihre Perspektive allein auf das Wettbewerbsrecht verengten und selbst da nicht so genau hinsahen. Die Beschäftigten sehen sich Arbeitsplatz-Vernichtungen durch die bei solchen Gelegenheiten immer viel beschworenen Synergie-Effekte gegenüber. Und schließlich stehen den Standort-Städten im Fall des Falles finanzielle Einbußen ins Haus, denn BAYER pflegt seine Shopping-Touren immer von der Unternehmenssteuer abzusetzen.
Mit der EU haben jetzt mehr als die Hälfte der 30 involvierten Kartellbehörden dem Deal ihre Zustimmung erteilt. Einige tun sich zum Glück jedoch noch schwer. So verlangte die russische Föderale Antimonopol-Behörde FAS von BAYER im November 2017 mehr als nur eine kleine Fasten-Kur, ehe das Schlucken von MONSANTO beginnen kann. Sie machte dem Konzern zur Bedingung, den FarmerInnen des Landes Zugang zu den Züchtungstechnologien und zu den Angeboten der digitalen Landwirtschaft zu verschaffen. „Sie haben so große Datenmengen, dass von unserem landwirtschaftlichen Sektor nach einem Zusammenschluss nicht mehr viel übrig sein wird“, sagte FAS-Chef Igor Artemjev zur Begründung. Bis Ende Februar gab die Behörde dem Global Player Zeit, darüber nachzusinnen. Weil es für das Unternehmen hier um das Eingemachte ging, reichte ihm diese Zeit nicht. Deshalb strengte BAYER eine Verfahrensklage an – verbunden mit der Drohung, notfalls eben auf den russischen Markt zu verzichten. Wenig später verlängerte die FAS die Prüfrist, und im März 2018 kam es auch zu einer Annäherung in Sachen „digitale Landwirtschaft“.
Die FAS-Forderungen wiederum hatten in den Vereinigten Staaten Besorgnis hervorgerufen. Sollte es Artemjev & Co. wirklich gelingen, Baysanto einen Technologie-Transfer aufzunötigen, geriete Wissen über avancierte Methoden der Nahrungsmittel-Produktion in russische Hände, warnten BeobachterInnen. Sie sahen dadurch die nationale Sicherheit der USA gefährdet und äußerten im Nachhinein Zweifel an der Entscheidung des „Ausschusses zur Überprüfung ausländischer Investitionen“, der so etwas nicht vorhergesehen hatte und das BAYER-Vorhaben im Dezember 2017 bedenkenlos passieren ließ. Auch sonst hakt es in den USA. Das Justizministerium verlangt deutlich mehr Verkäufe vom Leverkusener Multi als die bisher angekündigten, was Baumanns Zeitplan ein weiteres Mal durcheinanderzubringen droht.
PR in eigener Sache
Durch die sich in die Länge ziehenden Verfahren sahen sich die BAYER-Bosse zu verstärkten diplomatischen Anstrengungen gezwungen. So traf der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann im Januar 2018 bereits zum zweiten Mal Donald Trump, um gut Wetter für die MONSANTO-Akquise zu machen. Der Konzern-Chef gehörte zu den 14 UnternehmenslenkerInnen, die beim Davoser Weltwirtschaftsforum mit dem US-Präsidenten speisten. Sich so ehrfürchtig und beflissen wie ein Klosterschüler vor dem Papst gebährdend, stellte Baumann sich ihm bei Tisch als Vertreter desjenigen Unternehmens vor, das ASPIRIN produziert. Anschließend versuchte er, Trump mit der Ankündigung von großen Investitionen in den USA für den Coup zu erwärmen. Milliarden-Beträge stellte Baumann in Aussicht, falls es zu der MONSANTO-Übernahme käme. „Das ist wirklich gut“, lobte Trump.
In ähnlicher Weise umwarben Joe Kaeser von SIEMENS und die anderen Firmen-Vorstände den Präsidenten. „Deutsche Konzern-Chefs huldigen Trump“, überschrieb die Faz deshalb ihren Artikel zum Meeting. BAYERs Aufsichtsratsvorsitzender Werner Wenning fand da überhaupt nichts daran und attestierte Werner Baumann, einen guten Job gemacht zu haben. Kaum weniger verwunderliche Ansichten tat Werner Wenning zum Objekt von BAYERs Begierde kund. „MONSANTO macht als Biotech-Unternehmen das, was die Natur und der Mensch seit Jahrhunderten vormachen – Saatgut weiterentwickeln und verbessern“, meint er. Und natürlich bloß aus Sorge um die Ärmsten der Armen will der Leverkusener Multi mit dem Erwerb der US-Gesellschaft dem Vorbild „Natur“ noch ein wenig intensiver nacheifern. „Nur weil Europa noch kein Ernährungsproblem hat, verschwindet das Ernährungsproblem ja nicht. Hier vergessen viele, dass weltweit etwa 800 Millionen Menschen hungern“, gerierte sich der Manager als Mahner. Werner Baumann wollte da nicht zurückstehen und präsentierte sich auf der Bilanz-Pressekonferenz Ende Februar 2018 als Mutter Teresa in Nadelstreifen: „Wir können mit MONSANTO noch besser dazu beitragen, die Ernährung der Weltbevölkerung zu sichern“.
Die wahren Motive hingegen nannte er bei einer Veranstaltung der Schmalenbach-Gesellschaft in Düsseldorf. Dort führte der BAYER-Chef aus, anfangs wäre die gesamte Führungsriege gegen die Transaktion gewesen. Erst das veränderte Lagebild im Landwirtschaftsgeschäft durch CHEMCHINAs SYNGENTA-Kauf hätte zu einem Umdenken geführt. „Deren Folgen für die langfristige Position BAYERs im Agrochemie-Sektor habe ihn letztlich dazu bewogen, die MONSANTO-Übernahme in Erwägung zu ziehen“, mit diesen Worten gibt das zur Faz-Gruppe gehörende Portal Finance Baumanns Einlassungen wieder.
Der Konzern sah sich also ganz profan im Monopoly-Spiel der Branche in Zugzwang und hob nach der Devise „Die Letzten werden die Ersten sein“ nun dazu an, sich an die Spitze der Bewegung zu setzen und innerhalb des Agro-Oligopols die Führungsposition anzustreben.
Proteste halten an
Dagegen haben aber zahlreiche AktivistInnen aus der ganzen Welt etwas. Deshalb reißt auch in diesem Jahr der Protest gegen das avisierte Milliarden-Geschäft nicht ab. „Dämmen Sie die Markt-Konzentration von Großunternehmen ein, weil diese die Verwirklichung des Rechts auf Nahrung und eine positive ländliche Entwicklung bedroht“, lautete etwa eine der zentralen Forderungen der „Wir haben es satt“-Demonstration, zu der am 20. Januar 2018 über 30.000 Menschen nach Berlin gereist waren. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) setzte das Thema dort ebenfalls auf die Agenda. „Stopp BAYER/MONSANTO“ war der Aufruf überschrieben, den CBG-AktivistInnen auf der ganzen Route zwischen Hauptbahnhof und Brandenburger Tor verteilten.
Am 31. Januar 2018 konfrontierte das von der Coordination initiierte „Stopp BAYER/MONSANTO!“-Bündnis den Leverkusener Multi direkt mit der Kritik. An dem Tag wollte MONSANTO auf seiner Hauptversammlung in den Vereinigten Staaten nämlich weitere Vorbereitungen zur Elefanten-Hochzeit treffen. Das nahmen die rund 40 ProtestlerInnen von ATTAC, FIAN, der ÖkolandwirtInnen-Vereinigung IFOAM, der linken Karnevalstruppe PAPPNASEN ROT-SCHWARZ und der CBG zum Anlass, der BAYER-Zentrale einen Besuch abzustatten und dem Konzern schon mal seine Braut zu präsentieren. Aus Sicherheitsgründen war dazu ein Feuerwehr-Einsatz nötig, denn die Auserkorene hatte gleich ihre Mit-Gift dabei: den kleinen „Glypho-Satan“ und andere nicht ganz ungefährliche Dinge. Auch der Trauzeuge stellte sich bereits vor. Für diesen Posten hatte sich Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) in Brüssel durch seine Zustimmung zur Glyphosat-Zulassungsverlängerung qualifiziert, die dem Paar in spe die Aussicht auf eine noch praller gefüllte Familien-Kasse eröffnete. Dezent im Hintergrund hielt sich in Leverkusen hingegen der vom ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Friedrich Merz vertretene Heiratsvermittler BLACKROCK, der die Partnerschaft mit eingefädelt hatte.
Dank der PAPPNASEN ROT-SCHWARZ konnte das Bündnis sogar den Kölner Rosenmontagszug als Forum nutzen. Die alternative Karnevalstruppe hatte für ihren „Zoch vor dem Zoch“ nämlich das offizielle Motto „Mer Kölsche danze us der Reih“ in „Mer klääve nit am Wachstumswaahn, mer danze us der Reih“ umgestrickt, und da passte BAYERs MONSANTO-Operation wunderbar rein. Ein Symptom für den Wachstumswahn ist diese Idee von Baumann & Co. nämlich fürwahr. An dem Tag hatten aber nicht nur das Horror-Brautpaar und ihr „Glypho-Satan“ ihren Auftritt, sondern auch das BAYSANTO-Monster, „Mad Scientists“ und die Bienen-Leichen, die ihren Weg pflasterten. So vor den ZuschauerInnen an der Strecke vorbeiparadierend, wurden die Polit-Jecken von einer der Tribünen gar als „Protest-Zug aus Leverkusen“ begrüßt, obwohl in ihren Reihen auch noch andere böse Buben wie z. B. der Klima-Killer RWE ihr Unwesen trieben.
Das Versagen der Behörden bei der Beaufsichtigung des bunten Treibens von BAYER & Co. trieb die Initiative „Konzernmacht beschränken“ zum Handeln. Das Bundeskartellamt, dessen VertreterInnen in Brüssel über Fusionen und Unternehmensaufkäufe mitentscheiden, habe bisher kaum Transaktionen verhindert, monierte das Bündnis, obwohl dies gerade im Fall des MONSANTO-Deals bitter Not täte. „Bei einer Genehmigung der Übernahme von MONSANTO durch die deutsche BAYER AG würden in Zukunft nur drei Konzerne 60 Prozent des weltweit verkauften Saatguts sowie 70 Prozent des globalen Pestizid-Marktes kontrollieren“, warnten die AktivistInnen. Darum lud sich „Konzernmacht beschränken“ am 22. Februar 2018 selbst zum 60. Geburtstag des Bundeskartellamts ein und brachte den zahnlosen WettbewerbshüterInnen als Geschenk einen neuen Satz Kau-Werkzeuge mit. „Wir sind heute hier, weil wir dem Bundeskartellamt in Zukunft mehr Biss wünschen wollen“, erklärte Jutta Sundermann. Ob sie und ihre MitstreiterInnen damit Erfolg haben werden und die WettbewerbshüterInnen in Zukunft wirklich kraftvoller zubeißen, steht allerdings sehr in Frage.
Die ARBEITSGEMEINSCHAFT BÄUERLICHE LANDWIRTSCHAFT und FRIENDS OF THE EARTH richteten bei ihren Protesten das Augenmerk besonders auf die beängstigende Entwicklung den Sektor der digitalen Landwirtschaft betreffend, die bei einem Vollzug des Kaufes droht. Die Organisationen warnen eindringlich vor einer Monopol-Stellung des Leverkusener Multi auf dem Gebiet dieser Technologie, die auf einer Vernetzung von Daten über das Wetter, die Boden-Beschaffenheit und das Schadinsekten-Aufkommen mit Landmaschinen, die Pestizide ausbringen oder die Felder bewässern, beruht. „BAYER-MONSANTO würde zum größten Akteur im Bereich der Daten-Plattformen und Daten-Sammlung. Dies birgt für Bauern und Bäuerinnen ähnliche Risiken und Probleme, wie sie bereits durch Daten-Plattformen wie GOOGLE, AMAZON und FACEBOOK entstanden sind“, hält FRIENDS OF THE EARTH fest.
Auf internationaler Ebene tut sich ebenfalls eine Menge. So hat die bekannte Gentechnik-Gegnerin Vandana Shiva eine dutzende Seiten umfassende Eingabe an die indische Kartell-Behörde verfasst, die dazu auffordert, dem BAYER-Vorhaben die Zu-stimmung zu verweigern. Zur Begründung führt Shiva vor allem die bisherigen Geschäftspraktiken MONSANTOS an, die in dem Land eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben. An erster Stelle nennt Shiva die vielen Selbsttötungen von LandwirtInnen in den Regionen, in denen die Bt-Baumwolle des US-Unternehmens wächst. Wegen zu schlechter Ernten im Verhältnis zu den hohen Lizenz-Gebühren haben sich dort bereits hunderttausende FarmerInnen umgebracht. Die Gebühren verlangt der US-amerikanische Agro-Riese, obwohl er in Indien gar kein Patent auf das Bt-Saatgut selber, sondern nur auf die Herstellungsweise hält, empört sich die Autorin. Die indische Regierung reagierte auf den Wucher beim Lizenz-Verkauf mit einem staatlich verordneten Preis-Limit, wogegen der US-Multi umgehend klagte – und dafür die Unterstützung von BAYER erhielt. Im Bund mit den Leverkusenern potenzieren sich die Risiken und Nebenwirkungen einer solchen Unternehmenspolitik der Inderin zufolge noch einmal. „Mit der Fusion werden BAYER und MONSANTO ihre dominante Position ausbauen und das nutzen, um fortgesetzt Gesetze und Regeln des Landes zu brechen und die staatlichen Institutionen zu unterminieren, die Indiens Interessen schützen“, prophezeit die Wissenschaftlerin.
Zudem beschuldigt sie den bundesdeutschen Agrar-Riesen, den indischen Behörden gegenüber falsche Angaben zu den Auswirkungen der Transaktion – wie z. B. über das zu erwartende Ausmaß der Beherrschung des Baumwoll-Marktes – gemacht zu haben. Auch kritisiert Vandana Shiva beide Unternehmen für ihre Praxis, fortwährend kleinere Saatgut-Firmen aufzukaufen oder mit unfairen Verträgen an sich zu binden. „Angesichts der weitreichenden Konsequenzen (...) für den Wettbewerb, für das Wohlergehen der Farmer, die Gesundheit der Verbraucher und für die Demokratie steht die Akquisition von MONSANTO durch BAYER nicht im Einklang mit dem Wettbewerbsrecht und sollte nicht erlaubt werden“, schließt Shiva ihre Ausführungen.
Am französischen BAYER-Standort Lyon hat derweil die Initiative ALTERNATIBA Rhône mit einer spektakulären Aktion gegen die „Hochzeit des Todes“ protestiert. Sie veranstaltete Anfang März 2018 ein Die-in, um die Gesundheitsgefahren plastisch darzustellen, die von dem agro-industriellen Komplex ausgehen, den der Konzern durch die Einverleibung seines US-Konkurrenten noch einmal ein wenig komplexer gestalten will. Und die Ackergifte made in Leverkusen leisteten an dem Tag ganze Arbeit: Vor einer zentralen Metro-Station der Stadt lagen nicht nur Menschen darnieder, sondern auch Tiere und Pflanzen – einige AktivistInnen hatten sich nämlich Flora und Fauna anverwandelt.
In den Vereinigten Staaten reißt der Widerstand gegen das BAYER-Vorhaben ebenfalls nicht ab. So haben in jüngster Zeit unter anderem die „Texas Corn Producers“, die „Farm and Ranch Freedom Alliance“, die Milchvieh haltenden Öko-LandwirtInnen von der „Northeast Organic Dairy Producers Alliance“ und einige PolitikerInnen wie etwa die für die Partei der Demokraten im US-Senat sitzende Elizabeth Warren ihrer Besorgnis über den Deal Ausdruck verliehen. Einer Umfrage zufolge fürchten sich 93,7 Prozent der befragten US-amerikanischen LandwirtInnen vor den Folgen der Transaktion.
Die BAYER-Reaktionen
BAYER reagiert auf diese Kritik mit Verleumdungskampagnen und Drohungen. Der Konzern spricht der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und den vielen anderen Initiativen, die sich gegen die Übernahme wenden, schlicht die Lauterkeit ihrer Motive ab und wirft ihnen vor, kommerzielle Interessen zu verfolgen. „Wir erleben, dass die emotionale Aufbereitung von Ängsten die Debatte prägt, oft mehr als die Vermittlung von Fakten. Das lehnen wir insbesondere dann ab, wenn Angst als Geschäftsmodell benutzt und damit zum eigenen Vorteil geschürt wird“, hält der neueste Geschäftsbericht der Gesellschaft fest.
Andererseits spürt das Unternehmen ganz genau, dass der Rückhalt für die Transaktion nicht einmal betriebsintern besonders groß ist. Die Stimmungslage gleich nach Bekanntwerden von BAYERs MONSANTO-Aspirationen fasste ein Beschäftigter in dem WDR-Film „Die Saat der Gier“ zusammen: „Die Kollegen waren entsetzt, weil es eben genau dieser Partner ist, der da gekauft werden soll. Das Besondere: Dass das für alle für mich erkennbaren Hierarchie-Ebenen so war.“ Darum kam von der Geschäftsleitung über das Intranet die Anweisung: „Vermeiden Sie Spekulationen und Kommentare zu der Übernahme oder den möglichen Auswirkungen sowohl gegenüber Ihren Kollegen als auch gegenüber externen Personen. Das umfasst auch die sozialen Medien.“ Zu Recht konstatiert da der interviewte Belegschaftsangehörige: „Viele haben das als Maulkorb empfunden.“ Den löste der Global Player zwar bald wieder, aber nur, um den KollegInnen die seiner Meinung nach passenden Textbausteine in den Mund zu legen. „Argumente für die Hosentasche“ überschrieb er die Sprachregelungen für die ArbeiterInnen und Angestellten. Auf die Frage „Was hälst Du von dem Deal?“ etwa gibt er die Antwort vor: „Der Zusammenschluss von BAYER und MONSANTO erhöht unsere Innovationskraft und führt damit zu breiterer Auswahl, höherer Qualität und Ernährungssicherheit.“
Und BAYERs Wahlverwandter fackelte im Umgang mit seinen KritikerInnen nicht lange und zog gleich vor Gericht. MONSANTO verklagte die US-Organisation AVAAZ auf Herausgabe aller E-Mails und internen Dokumente zum Thema „Glyphosat“; sogar die Mail-Adressen der Mitglieder verlangt der Konzern. Aber die Initiative gibt sich kämpferisch: „MONSANTO mag unbegrenzte Ressourcen haben, um andere einzuschüchtern, aber die AVAAZ-Gemeinschaft vereint die Kraft von Millionen von Menschen, und unsere Mitglieder haben keine Angst.“
Die kennt auch die CBG nicht. Sie hat schon bei der letzten BAYER-Hauptversammlung allen Versuchen des Konzerns getrotzt, den Protest kleinzuhalten und arbeitet mit ihren Bündnis-Partnern weiter daran, die Übernahme zu stoppen. Die Planungen für Aktionen zur nächsten AktionärInnen-Versammlung des Konzerns am 25. Mai haben schon begonnen. ⎜
ÄrztInnen unter Einfluss
BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO hat sich zu einem Milliarden-Seller entwickelt, obwohl die „Arzneimittel-Kommission der deutschen Ärzteschaft“ wegen der Risiken und Nebenwirkungen von dem Präparat abrät. Wie konnte das passieren?
Von Dr. med. Niklas Schurig
Die „Arzneimittel-Kommission der deutschen Ärzteschaft“ hat erneut festgestellt, dass die neuen Gerinnungshemmer bzw. Antikoagulantien (NOAK) nur Mittel der zweiten Wahl bei Vorhofflimmern sind (1). Dennoch werden immer mehr PatientInnen neu von Vitamin-K-Antagonisten (VKA) wie Phenprocoumon auf BAYERs XARELTO (Wirkstoff: Rivaroxaban) und andere Präparate dieser Medikamenten-Gruppe um- und eingestellt. Die Ursachen hierfür liegen in der minutiös geplanten Vermarktungsstrategie, die auch durch finanzielle Zuwendungen für ÄrztInnen in Deutschland erkauft wurde und wird. Die Einflussnahme durch BAYER soll an drei Beispielen verdeutlicht werden: CME-Fortbildungen (CME = Continuing Medical Education, Anm. SWB), europäische und deutsche Leitlinien.
Fortbildungen
Eines von vielen Beispielen für interessenkonflikt-behaftete Fortbildungskurse, die von den Ärztekammern unkritisch mit CME-Punkten zertifiziert werden, kann man aktuell hier bewundern und auch noch absolvieren: www.cme-kurs.de (2): „Triple-Therapie mit NOAK – Praxis und Studienlage.“ Autor ist Professor Christoph Bode aus Freiburg. Das Handout (3) endet mit dem nicht direkt verständlichen Schlusssatz: „Experten wie der Amerikaner Dr. Deepak Bhatt empfehlen, dass die Therapie mit Rivaroxaban in den klinischen Alltag integriert werden sollte.“ Auch die CME-Testat-Fragen sind dementsprechend gestrickt. Vitamin-K-Antagonisten (VKAs) werden abgewertet: „Die klassische Triple-Therapie mit Warfarin-ASS-Clopidogrel führt zu einem 3,7-fachen BlutungsRisikoanstieg.“ XAREL-TO wird dagegen auf fragwürdige Weise aufgewertet: „Im Rahmen einer Post-hoc-Analyse konnte eine verringerte Mortalitäts- oder Rehospitalisierungsrate (Mortalität = Sterblichkeit, Anm. SWB) in beiden Rivaroxaban-Studienarmen vs. VKA dargestellt werden.“
Diese Aussagen dürfen in Zweifel gezogen werden. Klarer wird der einseitig werbende Inhalt des Handouts (und des Vortrags), wenn man sich die Interessenkonflikte ansieht: Professor Bode arbeitet nämlich für BAYER und bekam für den Vortrag 12.000 Euro. Die Ärztekammer Rheinland-Pfalz hatte dagegen nichts einzuwenden und zertifizierte diese recht offensichtliche XARELTO-Werbung mit 2 CME-Punkten.
Geleitete Leitlinien
Die europäische Leitlinie zum Vorhofflimmern der „European Society of Cardiology“ (ESC), die den Einsatz von NOAKs als Mittel der ersten Wahl empfiehlt, tut dies vielleicht auch deshalb, weil 15 von 17 AutorInnen der Leitlinien-Gruppe Interessenkonflikte haben (4). Darunter befinden sich allein sechs, welche Geschäftsbeziehungen direkt zu BAYER unterhalten (5).Ob die Methoden der Studienbewertung von den Interessenkonflikten beeinträchtigt wurden oder ob es abgeleitete Konsequenzen wie z. B. Enthaltungsregeln gibt, legt die ESC nicht dar (6). Somit hat diese Leitlinie eine deutlich schlechtere Qualität als ihre deutschen Pendants, ist aber in Europa leider die Referenz-Leitlinie.
Da die ESC-Leitlinie für Deutschland diesen Maßstab-Charakter hat, wurde auch hierzulande der bislang verwendete Schlaganfall-Risiko-Score CHADS2 durch den neuen CHADS2VASC-Score ersetzt. Diese Scores geben das Schlaganfall-Risiko bei PatientInnen mit Vorhofflimmern an und werden zur Klärung der Notwendigkeit einer (oft lebenslangen) Blutverdünnung eingesetzt. Durch den Wechsel zu diesem neuen Score benötigten statt 60 Prozent nun über Nacht 85 Prozent der PatientInnen mit Vorhofflimmern eine Blutverdünnung. So wurden durch die Score-Änderung 2012 und die Indikationsausweitung Hundertausende zu potenziellen XARELTO-PatientInnen (1).
Die Deutsche Leitlinie zur Schlaganfall-Prophylaxe wurde ebenfalls von BAYER beeinflusst und unter grober Missachtung des Reglements durch bezahlte AutorInnen in Richtung XARELTO „verbogen“. Im Leitlinienreport (7) heißt es dazu: „Alle Mitglieder der Leitliniengruppe gaben an, dass keine bedeutsamen Interessenkonflikte sie an der Teilnahme an dem Leitlinienvorhaben hindern würden (…) Die Evaluation aller Erklärungen wurde abschließend auf der zweiten Konsensuskonferenz diskutiert, mit dem Ergebnis, dass keine Interessenkonflikte vorlagen, die einen Ausschluss aus der Leitlinien-Gruppe nach sich gezogen hätten. Falls ein stimmberechtigtes Mitglied aufgrund von Interessen-Konflikten bei der Konsentierung der Empfehlungen (d. h. beim Einigungsprozess über die Empfehlungen, Anm. SWB) einzelner Schlüsselfragen nicht unbefangen abstimmen konnte, bestand die Auflage, dass sich der- bzw. diejenige bei dieser Abstimmung enthalten würde.“
Am Beispiel der Empfehlung 13.10 zum Einsatz von Antikoagulantien wird aber deutlich, dass diese Abstinenz bei Befangenheit nicht konsequent eingehalten wurde. Die Empfehlung lautet: „Die neuen Antikoagulantien (d. h. Dabigatran, Rivaroxaban und Apixaban) stellen eine Alternative zu den Vitamin-K-Antagonisten dar und sollten aufgrund des günstigeren Nutzen-Risiko-Profils zur Anwendung kommen. (Empfehlungsgrad B).“ Laut Leitlinienreport wurde die Empfehlung mit 10 zu 9 Stimmen in der Stichwahl ausgesprochen. Von den 23 stimmberechtigten Mit-gliedern der Leitlinien-Gruppe gaben 10 an, Berater-Verträge mit den Herstellern der neuen oralen Antikoagulantien zu haben. Sechs weitere waren über Vortragshonorare mit den Produzenten dieser Medikamente verbunden. Von diesen 16 Befangenen enthielten sich jedoch bei der Abstimmung nur sechs, in der Stichwahl nur noch vier. Dabei unterhielten 19 von insgesamt 35 Leitlinien-AutorInnen Geschäftsbeziehungen zu BAYER (8).
Fazit
Diese gezielte Ausnutzung von Grauzonen bei der CME-Zertifizierung und bei den Leitlinien-Reglements gehört leider immer noch zu den Standard-Werkzeugen der Pharma-Firmen bei der Vermarktung ihrer Produkte. Dies ist lange bekannt. Wir ÄrztInnen stehen in der Verantwortung, dies zu ändern. Den Druck auf Landesärztekammern bei industrie-beeinflussten CME-Vorträgen können nur wir erhöhen. „Schlechte“ Leitlinien kommen meist von „schlechten“ Fachgesellschaften und es liegt an uns, die industrie-freundlichen Fachgesellschaften und ihre Leitlinienarbeit von innen heraus zu ändern. ⎜
Dr. med. Niklas Schurig ist Hausarzt in Rastatt, Vorstandsmitglied bei MEZIS e. V. und arbeitet bei leitlinienwatch.de sowie der AG CME mit.
Interessenkonflikte: keine weiteren
(1) AKDÄ (2016) Leitfaden „Orale Antikoagulation bei nicht valvulärem Vorhofflimmern“ https:www.akdae.de/Arzneimitteltherapie/LF/OAKVHF/index.html Zugriff: 31.1.2018 https:www.akdae.de/Arzneimitteltherapie/LF/index.html
(2) cme kurs (2017) Triple-Therapie mit NOAK – Praxis und Studienlage
https:www.cme-kurs.de/kurse/triple-therapie-mit-noak-praxis-und-studienlage/
(3) C Bode (2017) Triple-Therapie mit NOAKs Praxis und Studienlage
https:www.cme-kurs.de/cdn2/pdf/Handout_Triple-Therapie-mit-NOAK.pdf Zugriff: 31.1.2018
(4) Kirchhoff P, Benussi S, Benussi D et al (2016) ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS, European Heart Journal; 37; 38, pp 2893–2962 7.10. 2016
ESC-Leitlinie zum Management des Vorhofflimmerns (ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation) https:academic.oup.com/eurheartj/article/37/38/2893/2334964 Zugriff: 31.1.2018www.escardio.org
(5) Ahlsson A, Atar D, Benussi D et al (2016) Interessenkonflikterklärungen https:www.escardio.org/static_file/Escardio/Guidelines/DOI/DOI_Summary_2016_AFIB.pdf Zugriff: 31.1.2018
(6) Leitlinienwatch (2017) https:www.leitlinienwatch.de/esc-leitlinie-zum-management-des-vorhofflimmerns-esc-guidelines-for-the-management-of-atrial-fibrillation/ Zugriff: 31.1.2018
(7) AWMF Leitlinienreport S3-Leitlinien – Teil 1 Sekundärprophylaxe ischämischer Schlaganfall und transitorische ischämische Attacke
http:www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/030-133m_S3_Sekun%C3%A4rprophylaxe_isch%C3%A4mischer_Schlaganfall_2015-02.pdf Zugriff: 31.1.2018
(8) neurologyfirst.de Zugriff: 31.1.2018
Gentech-Gefahr hoch 3
Die EU-Kommission hat Ende 2017 Import-Zulassungen für neue Gentechnik-Sojabohnen der Firma BAYER erteilt. Dabei handelt es sich um die Ernte von gentechnisch veränderten Soja-Pflanzen, die erstmals nicht nur gegen ein oder zwei Herbizide resistent sind, sondern jeweils gleich eine dreifache Resistenz aufweisen. Die „Balance Bean“-Soja von BAYER ist immun gegenüber Glyphosat, Glufosinat und Isoxaflutol. Bei dem Genehmigungsverfahren ließ die Europäische Union allerdings viele Risiken und Nebenwirkungen, die von diesen neuen Ackerfrüchten ausgehen können, außer Acht.
Von Christoph Then, TESTBIOTECH
Die Gentech-Geschäftsidee
BAYER setzt ähnlich wie Monsanto auf den Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen, die gegen Herbizide resistent gemacht sind. Die Geschäftsidee ist einfach: So können patentiertes Saatgut und Unkrautvernichtungsmittel im Doppelpack verkauft werden.
Die speziellen Herbizide (wie z. B. Glyphosat), gegen die die Pflanzen resistent sind und die dann beim Anbau zur Anwendung kommen, werden auch komplementäre Herbizide genannt. Die Gentechnik macht es möglich, dass die Pflanzen diese „Giftdusche“ überleben. Gleichzeitig entstehen in den Pflanzen aber neue Stoffwechselprodukte und Herbizidrückstände, die Risiken für die VerbraucherInnen mit sich bringen.
Hauptanbauländer dieser Pflanzen sind Argentinien, Brasilien und die USA. Seit über 20 Jahren wird dort insbesondere Gentechnik-Soja angebaut, die gegen Glyphosat resistent gemacht wurde. Dieses Spritzmittel ist seit geraumer Zeit in die Kritik geraten. Zum einen, weil es von einem internationalen Expertengremium der WHO als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft wird. Zum anderen wird die biologische Vielfalt durch den weitverbreiteten Einsatz des Mittels geschädigt.
Mittlerweile haben sich mehrere Unkrautarten an den massenhaften Einsatz von Glyphosat angepasst und sind jetzt ihrerseits resistent. Diese resistenten Unkräuter sind ein zunehmendes Problem in den Anbauländern der Gentechnik-Pflanzen. Sie führen unter anderem zu steigenden Pestizidmengen und zu einer weiteren „Aufrüstung“ der Gentechnik-Pflanzen: In Pflanzen wie Soja und Mais werden zunehmend Gen-Konstrukte eingebaut, die diese gleich gegen mehrere Herbizide immun machen sollen, um Resistenz-Bildungen durch mehr Variabilität beim Einsatz der Mittel vorbeugen zu können.
BAYERs neue Gensoja
Der BAYER-Konzern hat in diesem Zusammenhang die Gentechnik-Soja FG72 entwickelt („Balance Bean“). Diese Soja ist nicht nur resistent gegenüber dem Einsatz von Glyphosat. Auch Herbizide wie Isoxaflutol, welche die Wild-Pflanzen ausbleichen und absterben lassen (sogenannte HPPD-Hemmer), können ein-ge-setzt werden. In einer Erweiterung dieses Geschäftsmodells hat BAYER die Sojabohnen jetzt mit anderen Gentechnik-Varianten gekreuzt, um sie zusätzlich gegenüber Glufosinat resistent zu machen. Glufosinat ist unter Markennamen wie Liberty oder Basta bekannt geworden. Im Resultat ist diese Soja (Kürzel: FG72 x A5547-127) jetzt mit einer Dreifachresistenz gegenüber Herbiziden ausgestattet. Die genannten Herbizide sind als gesundheitsschädlich klassifiziert oder stehen diesbezüglich unter Verdacht:
– die gesundheitsschädliche Wirkung von Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend“ ist strittig
– Glufosinat ist von der EFSA offiziell als reproduktionstoxisch eingestuft und in der EU ab August 2019 verboten
– Isoxaflutol ist offiziell als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft
Ihre Ernte soll zum Zweck der Verarbeitung in Lebens- und Futtermitteln ebenfalls in die EU importiert werden. Die Soja wurde Ende 2017 von der EU-Kommission für den Import zugelassen. Zusammen mit einer ähnlichen Gentechnik-Soja der Firma DOW war dies die erste EU-Genehmigung für gentechnisch veränderte Sojabohnen mit einer dreifachen Resistenz gegenüber Herbiziden.
Die für die Importzulassung notwendigen Antragsdokumente hat Testbiotech im Detail geprüft und dabei festgestellt, dass es erhebliche Mängel bei der Risikobewertung der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA gibt.
Kein Praxis-Test
Ein wichtiger Aspekt bei der Risikobewertung von Gentechnik-Pflanzen, die gegen bestimmte Herbizide resistent gemacht worden sind, ist die Dosierung der Herbizide und die Anzahl der in den Feldversuchen durchgeführten Spritzungen. Davon hängt nicht nur die Rückstandsbelastung der Ernte und deren mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit ab, auch die Zusammensetzung der Pflanzeninhaltsstoffe kann dadurch beeinflusst werden.
Aus den Antragsdokumenten geht aber hervor, dass die von BAYER angewandten Dosierungen im Versuchsanbau erheblich geringer waren, als dies unter Praxisbedingungen zu erwarten ist: In Feldversuchen verwendete BAYER nur etwa ein Kilogramm Glyphosat pro Hektar oder weniger.
In der landwirtschaftlichen Praxis dagegen werden zwei, drei oder sogar acht Kilogramm pro Hektar empfohlen. Auch die Dosierung eines anderen Komplementärherbizids (Glufosinat) lag wesentlich niedriger als in der landwirtschaftlichen Praxis üblich.
Nach Ansicht der EU-Kommission sind die Risiken der Gentechnik-Pflanzen unabhängig von der Anwendung der Herbizide zu bewerten, gegen die sie resistent gemacht sind. Testbiotech weist diese Darstellung als unangemessen und irreführend zurück. Auch die Prüfvorschriften der EU schreiben vor, dass die Pflanzen für die Risikoprüfung mit den entsprechenden Herbiziden behandelt werden müssen. Werden diese Tests aber nicht unter realistischen Bedingungen durchgeführt, ist die Risikoprüfung wertlos.
Werden bei Versuchen wesentlich weniger Herbizide eingesetzt, als dies in der Praxis üblich ist, beeinflusst dies nicht nur die Menge der jeweiligen Rückstände. In Abhängigkeit von der Menge der Spritzmittel können sich auch die Inhaltsstoffe der Pflanzen verändern und so beispielsweise Allergien oder die Wirkung pflanzlicher Östrogene verstärkt werden. Diese Risiken wurden weder nach dem Gentechnikrecht noch nach dem Pestizidrecht geprüft. BAYER führte auch keine Fütterungsstudien durch, um die gesundheitlichen Risiken der Soja zu untersuchen.
Fehlende Daten
Grundsätzlich ist zu erwarten, dass die komplementären Herbizide auch Rückstände in den Pflanzen bzw. der Ernte zurücklassen. Die Art der Rückstände und Abbaustoffe ist dabei abhängig von der Pflanzensorte, dem eingebauten Gen-Konstrukt sowie der Menge und der Häufigkeit der Anwendungen.
Am besten erforscht sind die Rückstände von Glyphosat. Hier entsteht insbesondere der Abbaustoff AMPA (Aminomethylphosphonsäure). Dieser wird als ähnlich giftig wie Glyphosat eingeschätzt. Die Menge an AMPA (und anderen Abbaustoffen), die in den Pflanzen gebildet wird, kann je nach Gentechnik-Konstrukt unterschiedlich sein. Zudem können auch andere Abbauprodukte entstehen. Für die Risikoabschätzung von FG72 wäre es notwendig zu wissen, wie hoch die Konzentration der jeweiligen Glyphosat-Rückstände bei verschiedenen Anwendungen (einfache oder mehrfache Anwendung, niedrige oder hohe Dosierung) tatsächlich ist. Entsprechende Daten wurden aber nicht vorgelegt.
Bei der Anwendung von Isoxaflutol, das als „möglicherweise krebserregend“ klassifiziert ist, entstehen neue Abbaustoffe, die bisher in den Sojabohnen nicht vorhanden waren. Nach Ansicht der EFSA können die gesundheitlichen Risiken dieser Stoffe nicht bewertet werden, da die notwendigen Daten fehlen. Die EU-Behörde sieht sich deswegen außerstande, Grenzwerte für Höchstmengen festzulegen, wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist (Verordnung 396/2005).
Keine Daten scheint es auch darüber zu geben, welche Abbaustoffe in welcher Konzentration bei der Anwendung von Glufosinat an herbizidresistenten Sojabohnen zu erwarten sind. Soweit Testbiotech bekannt ist, liegen dazu keine Publikationen und keine offiziellen Bewertungen vor. Glufosinat wird offiziell als reproduktionstoxisch eingestuft.
Kombinationswirkungen?
Schließlich müssen mögliche kombinatorische Effekte bewertet werden. Die kombinatorischen Wirkungen von Rückständen können die Toxizität der einzelnen Substanzen bei weitem übersteigen. Da jedoch eine spezifische Kombination von komplementären Herbiziden auf die Pflanzen angewendet werden kann, wäre es relativ einfach, kombinatorische Effekte zu bestimmen. Bislang wurden solche Untersuchungen aber nicht durchgeführt. Die EU-Kommission hat lediglich eingeräumt, dass kombinatorische Effekte untersucht werden müssten.
Neben den Wirkstoffen enthalten kommerzielle Herbizidmischungen wie Roundup (Glyphosat) weitere Zusätze sowie als Wirkungsverstärker zum Einsatz kommende Netzmittel. Diese Substanzen können dazu führen, dass eine Herbizidmischung wesentlich giftiger ist als der eigentliche Wirkstoff. In mehreren Ländern der EU wurde deswegen bereits der Einsatz von besonders problematischen Zusatzstoffen wie Tallowaminen eingeschränkt oder verboten, in den Anbauländern der Gentechnik-Pflanzen dagegen nicht. Diese Stoffe werden aber bei der Zulassungsprüfung gentechnisch veränderter Pflanzen für den Import bisher außer Acht gelassen. Entsprechende Lücken in der Risikobewertung werden sogar von der EU-Kommission zugegeben.
Auch die Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA) stellt fest, dass hier weitere Untersuchungen nötig sind und es derzeit nicht möglich ist, die gesundheitlichen Risiken der Rückstände der Spritzmittelmischungen, die in den Anbauländern eingesetzt werden, zu bewerten. Wie aktuelle Dokumente zeigen, die von Monsanto in den USA veröffentlicht werden mussten, wissen auch dort die Behörden nicht im Detail, was den Spritzmitteln jeweils zugesetzt wird bzw. welche Rückstände in der Ernte zu erwarten sind.
Weitere Gesundheitsrisiken
Durch den veränderten Stoffwechsel in den Gentechnik-Pflanzen kommt es zu weiteren spezifischen Risiken:
– Durch die neu eingeführten Stoffwechselwege können die Inhaltsstoffe der Pflanzen ungewollt verändert werden. Gerade bei Soja ist dies relevant, weil es in den Bohnen natürlicherweise eine hohe Konzentration an pflanzlichen Östrogenen und Allergenen gibt, deren Konzentration steigen kann. Die jeweiligen Veränderungen können davon abhängen, welche Herbizide in welcher Dosierung eingesetzt werden. Tatsächlich zeigen verschiedene Untersuchungen, dass die Anwendung des Herbizids in Abhängigkeit von der Dosis signifikante Veränderungen in den Inhaltsstoffen der Sojabohnen verursachen kann. Diesen Fragen geht die EFSA bisher nicht nach.
– Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass auch spezielle Wechselwirkungen zwischen den Rückständen der Herbizide und pflanzlichen Inhaltsstoffen möglich sind. Dabei ist insbesondere an die natürlicherweise in den Pflanzen vorkommenden Allergene und Östrogene zu denken. Deren gesundheitliche Risiken können durch Interaktion mit diversen Wirkstoffen, Zusatzstoffen oder Abbaustoffen der Herbizide verstärkt werden. So zeigten sich beispielsweise Störungen des Hormonsystems, wenn an junge Ratten Sojamilch in Kombination mit Glyphosat verfüttert wurde. Entsprechende Publikationen wurden von der EFSA ignoriert.
– Es muss zudem berücksichtigt werden, dass sich die ständige Belastung mit diesen Rückständen über Umwege auch auf die Gesundheit auswirken kann: Die Rückstände können beispielsweise zu Veränderungen in der Darmflora von Mensch und Tier führen, wodurch möglicherweise die Entstehung von Krankheiten begünstigt wird. Es ist bekannt, dass die Anwendung von Glyphosat zu einer veränderten Zusammensetzung der mikrobiellen Bodenflora führen kann. Zudem hat Glyphosat auch eine antibiotische Wirkung gegenüber bestimmten Bakterien wie E. coli. Dass es bei einer permanenten Zufuhr von Glyphosat auch zu Veränderungen der Darmflora bei Menschen kommen kann, erscheint daher naheliegend. Diese Risiken werden im Rahmen der EU-Zulassung nicht berücksichtigt.
Schlussfolgerungen
Wie die Analyse von Testbiotech zeigt, werden die speziellen Risiken der Anwendung von Herbiziden bei Gentechnik-Pflanzen derzeit weder von der Gentechnik-Zulassungsprüfung noch von der Pestizid-Gesetzgebung abgedeckt. Diese Regelungslücke betrifft die Mehrzahl der bisherigen Zulassungen: Über 50 der bis August 2017 in der EU für den Import zugelassenen rund 60 Gentechnik-Pflanzen sind gegenüber mindestens einem Herbizid resistent gemacht.
Entscheidende Daten über die Veränderung der Inhaltsstoffe der Pflanzen fehlen ebenso wie die zu Rückständen der Herbizide. Zudem werden zentrale Fragen der Risikoabschätzung, wie die nach möglichen Wechselwirkungen und kombinatorischen Effekten, völlig außer Acht gelassen. Die für den Import zugelassenen Pflanzen können deswegen nicht als sicher angesehen werden. Es besteht vielmehr das Risiko, dass der Verzehr der Sojabohnen negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat.
Die aktuelle Zulassungspraxis steht im Widerspruch zur Gentechnik-Gesetzgebung der EU. Die Verordnung 1829/2003 sieht vor, dass gentechnisch veränderte Pflanzen nur dann für den Import zugelassen werden dürfen, wenn sie insgesamt als sicher bewertet worden sind. Wenn diese Pflanzen mit einer Kombination möglicherweise gesundheitsgefährdender Rückstände belastet sind, weil sie per Gentechnik gegen Herbizide resistent gemacht wurden, muss dies vor einer Zulassung selbstverständlich untersucht werden.
Vor diesem Hintergrund sollten keine weiteren Gentechnik-Pflanzen mehr für den Import zugelassen werden, die gegen Glyphosat oder andere Herbizide resistent gemacht wurden, bis umfassende Untersuchungen der gesundheitlichen Risiken der entsprechenden Rückstände vorliegen. Dabei müssen Gentechnik-Zulassungsprüfung und Pestizid-Recht verknüpft werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass keine Risiken übersehen werden. Dazu gehören insbesondere folgende Voraussetzungen:
– Bewertung aller Wirkstoffrückstände unter Berücksichtigung der verschiedenen relevanten Praxisbedingungen (z. B. Dosierung und Häufigkeit der Herbizidanwendung)
– Bewertung aller relevanten Wirkstoffe, Zusatzstoffe und deren Rückstände
– Untersuchung kombinatorischer Effekte der eingesetzten Herbizide
– Untersuchung der Veränderungen der Pflanzeninhaltsstoffe unter Berücksichtigung verschiedener Dosierungen der Herbizide
– Untersuchung von möglichen Wechselwirkungen zwischen den Herbiziden und den Pflanzeninhaltsstoffen
– Untersuchung der Langzeiteffekte des Verzehrs der Gentechnik-Sojabohnen unter Berücksichtigung von möglichen Wirkungen auf das Hormonsystem, die Reproduktion und das Mikrobiom (Darmflora) von Mensch und Tier ⎜
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) lehnt Tierversuche ab. Ihrer Ansicht nach braucht es sie nicht, um die Gefährlichkeit eines Stoffes zu prüfen. Darum setzt sich die Coordination bereits seit Langem dafür ein, dass bei BAYER und anderswo mehr Alternativ-Verfahren zum Einsatz kommen.
BAYER erhält Rüge
Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat bei einer Betriebsinspektion von BAYERs Leverkusener Pharma-Anlagen „signifikante Verstöße gegen die gute Herstellungspraxis“ festgestellt.
Von Jan Pehrke
Im Februar 2017 hat die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA BAYERs Pillen-Fabrikation in Leverkusen inspiziert und dabei schwerwiegende Mängel festgestellt. Die KontrolleurInnen forderten den Konzern anschließend auf, diese umgehend zu beheben. Da der Global Player dem nicht nachkam, sandte die „Food and Drug Administration“ ihm im November 2017 einen „Warning Letter“ zu und machte die Defizite öffentlich.
Von „signifikanten Verstößen gegen die gute Herstellungspraxis (CGMP)“ spricht die „Food and Drug Administration“ in dem Schreiben. Gleich bei der Produktion von vier Medikamenten – ADALAT OROS, ASPIRIN CARDIO, AVELOX und LEVITRA – deckten die BetriebsprüferInnen Verfehlungen auf.
Der Pharma-Riese hat etwa verschiedene Medikamente in einem Raum gefertigt, ohne die benutzte Ausrüstung und die Arbeitsflächen nach den jeweiligen Durchläufen gründlich zu säubern. Das hatte Verunreinigungen von Medikamenten zur Folge. So fanden sich in dem blutdruck-senkenden Nifedipin (Markenname ADALAT) Rückstände des Wirkstoffs Sorafenib, den BAYER eigentlich zur Behandlung von Krebs vertreibt. Die Behörden reagierten prompt und forderten den Konzern und die von ihm mit der Substanz belieferten Unternehmen zu einem Rückruf der entsprechenden Präparate auf.
Überdies kontrollierte der Multi der FDA zufolge die Stabilität der Zusammensetzung seiner Pharmazeutika nicht ausreichend. Die Mess-Geräte ließen ihrer Ansicht nach viel zu große Schwankungsbreiten zu. Auch die Toleranz-Grenzen der Apparaturen zur automatisierten Qualitätskontrolle legte der Global Player zu großzügig fest, damit sich der Ausschuss in Grenzen hielt. Darüber hinaus hat er nicht angemessen auf Probleme mit undichten Medikamenten-Packungen reagiert. Obwohl die Aufsichtsbehörden ihn schon gezwungen hatten, Chargen zurückzurufen, weil die Tabletten feucht zu werden drohten, zeigte das Unternehmen nur wenig Engagement bei der Fehler-Suche. „Ihre Firma hat es nicht geschafft, eine ordentlich arbeitende Qualitätskontrolle-Abteilung aufzubauen“, resümiert die US-Einrichtung in ihrem Schreiben.
„Die Zustände, die die FDA in der Pharma-Produktion von BAYER aufgedeckt hat, sind skandalös. Bei der Profit-Jagd vernachlässigt der Konzern seine Sorgfaltspflichten massiv und setzt damit die Gesundheit der PatientInnen aufs Spiel“, konstatierte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) in ihrer Presse-Erklärung.
Zu allem Übel zeigte sich der Pillen-Riese auch noch als Wiederholungstäter. Bereits 2009 stieß die FDA bei einer Inspektion des Bergkamener Werkes auf unreine Pharma-Stoffe und solche, die in ihrem pharmakologischen Aufbau erhebliche Unregelmäßigkeiten aufwiesen. Und schon damals machte sie Defizite bei der Reinigung und Wartung der Produktionseinrichtungen aus. Bundesdeutsche Aufsichtsbehörden schauen da offenbar nicht so genau hin – von ihnen erhielt der Leverkusener Multi noch nie einen Blauen Brief.
Gift für Äcker
Dass es den Bienen nicht gut geht, war in den letzten Jahren häufig zu lesen. Einer der hauptverdächtigen Ursachen: Insektizide der Stoffklasse „Neonikotinoide“ wie etwa die BAYER-Wirkstoffe Imidacloprid und Clothianidin sowie SYNGENTAs Thiamethoxam. Doch während man sich allseits um die fliegenden Helferlein sorgt, findet ein Raum kaum Beachtung: Der Boden. Denn der größte Teil der Gifte bleibt dort, wo sich normalerweise eine riesige Zahl von Insekten und anderen wirbellosen Tieren und Mikroorganismen um die Bodenfruchtbarkeit kümmert. Die reagieren meist ebenfalls negativ auf die Gifte. Und das hat negative Folgen, auch für die LandwirtInnen. Denn Studien weisen darauf hin, dass Insektizide den Nährstoff-Kreislauf so stark unterdrücken, dass sogar die Erträge leiden können.
Von Sebastian Tilch
„1:0 für die Bienen“ verkündete Martin Häusling, agrar- und umweltpolitischer Sprecher der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament. Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments hatte am 22. Juni 2017 mit großer Mehrheit den Vorschlag der EU-Kommission bestätigt, die drei als besonders bienengefährlich geltenden Insektizide aus der Gruppe der Neonikotinoide vollständig zu verbieten und einen Gegenvorstoß der Konservativen damit abgeschmettert. Und das 2:0 kam Ende Februar 2018. Da hatte die Europäische Behörde für Lebensmittel-Sicherheit (EFSA) ihre Risiko-Bewertung der Mittel vorgelegt und festgehalten: „Die meisten Anwendungen neonicotinoider Pestizide stellen ein Risiko für Wild- und Honigbienen dar.“ Aber geschlagen gab sich der Leverkusener Multi damit noch nicht: „BAYER ist mit den Ergebnissen der Risikobewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittel-Sicherheit (EFSA) für die Wirkstoffe Imidacloprid und Clothianidin grundsätzlich nicht einverstanden.“ Ob die EU sich dem Votum beugt und die Ackergifte endgültig aus dem Verkehr zieht oder sich auch für eine Verlängerung der Lebenszeit dieser Pestizide wieder willige PolitikerInnen finden lassen, wie es im Fall von Glyphosat mit Christian Schmidt (CSU) der Fall war, bleibt abzuwarten.
Bereits seit 2013 besteht ein EU-weites Verbot für die Verwendung der drei meistverwendeten Neonikotinoide Imidacloprid, Clothianidin und Thiamethoxam. Allerdings nicht flächendeckend, sondern nur für Kulturpflanzen, die von Bienen angeflogen werden, sowie für Mais und Sommergetreide. Ausgenommen sind et-wa Wintergetreide und Zuckerrüben, aber auch Gewächshaus-Kulturen. Die direkte Blattbehandlung ist nur zulässig, sofern sie nach der Blüte stattfindet.
Die Begründung des Verbotes lautet „akute Gefährdung von Bienen“. Der Ausfall dieser Insekten hat Konsequenzen, da diese maßgeblich für die Bestäubung vieler Feldfrüchte und Obstplantagen und damit für die Nahrungssicherheit notwendig sind. So hängen Erntemenge und Qualität von über drei Vierteln der weltweit meist genutzten Nahrungspflanzen voll oder zu einem gewissen Grad von Tier-Bestäubung ab, schreibt der Weltbiodiversitätsrat IPBES.
Seit Anfang der 1990er Jahre werden Neonikotinoide in der Landwirtschaft und in Gärten gegen Schadinsekten wie Blattläuse, Käfer, Mottenschildläuse und Kleinschmetterlinge eingesetzt. Inzwischen sind sie die meistverwendete Insektizid-Gruppe weltweit. Größter Hersteller ist der BAYER-Konzern mit so klangvollen Produktnamen wie CALYPSO (Thiacloprid), ADMIRE bzw. CONFIDOR und GAUCHO (Imidacloprid), oder PONCHO (Clothianidin). Hauptsächlich wird das Gift in Form von Saatgut-Beize angewendet, von wo aus es systemisch in alle Pflanzenteile übergeht - auch in Nektar und Pollen.
Neonikotinoide stören das Nervensystem verschiedener Organismen, vor allem Insekten, indem sie an den Nikotinischen Acetylcholinrezeptor (nAChR) binden und so eine neutrale Reizübertragung behindern. Neonikotinoide sind enorm potent, einige sind bis zu 10.000 Mal giftiger für Bienen als das berüchtigte Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT), das in der EU seit Jahrzehnten verboten ist.
Doch das Gift wirkt nicht spezifisch auf die Schadinsekten. Zwar belegten die Hersteller in Versuchen immer wieder, dass die im Freiland anzutreffenden Konzentrationen in der Regel nicht tödlich für Honigbienen sind, inzwischen ist jedoch klar, dass sie zumindest subletal wirken, also nicht direkt tödlich sind, aber dennoch die Tiere nachhaltig schädigen (1). So hatten die WissenschaftlerInnen unter anderem herausgefunden, dass Honigbienen durch Neonicotinoide auf ihren Flügen die Orientierung verlieren und nicht in den Stock zurückkehren bzw. beim Schwänzeltanz falsche Informationen zu Futterquellen weitergeben. Auch schwächten die Toxine das Immunsystem von Honigbienen und förderten die Ausbreitung von Krankheiten und Parasiten wie etwa der Varroa-Milbe. Dies könne ganze Bienenvölker gefährden, so die ForscherInnen.
80 % weniger Insekten
„Um die Honigbiene mache ich mir gar nicht so große Sorgen“, sagt dagegen Professor Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ). Diese zeigten sich im Verhältnis zu anderen Nichtziel-Arten deutlich weniger empfindlich gegenüber Neonikotinoiden (2). Außerdem würden sie als domestizierte Art ja vom Menschen gehegt und gepflegt. Für die Bestäubung mindestens genauso wichtig hätten sich die vielen anderen Bienenarten gezeigt. So gibt es in Deutschland allein rund 550 verschiedene Wildbienen. Weltweit sind es sogar 20.000. Dazu kommen Schmetterlinge, Fliegen, Käfer usw. Deren Zahl schrumpft derzeit dramatisch, warnte der „Entomologische Verein Krefeld“ vergangenes Jahr. Vergleiche der Bestände in den 1990er Jahren mit den heutigen hatten einen Rückgang von rund 80 Prozent, vor allem von Schmetterlingen, Bienen und Schwebfliegen, ergeben. Als Ursache nennen die AutorInnen unter anderem auch Neonikotinoide.
Nun dürfte der Mehrheit der deutschen LandwirtInnen das Bestäuber-Sterben höchstens ein müdes Schulterzucken abringen. Zumindest aus wirtschaftlicher Sicht, denn lediglich 2,5 Prozent ihrer Erträge hängen laut Weltbiodiversitätsrat IPBES von Bestäubern ab. Dennoch beschränken sich die Kampagnen der Neonikotinoid-GegnerInnen auf die Rettung der Honigbiene. Dabei fällt ein ganzer Lebensraum unter den Tisch, der für die hiesige Ernährungswirtschaft vermutlich noch bedeutender sein dürfte: Der Boden.
So werden laut Silva et al. (3) bei gebeiztem Saatgut nur 1,6 Prozent der Neonikotinoide von der Pflanze aufgenommen. Über 98 Prozent bleiben im Boden und reichern sich dort an. Rückstände davon lassen sich noch bis zu drei Jahre nach der Anwendung nachweisen. Ein Effekt, der von den konventionell arbeitenden LandwirtInnen durchaus geschätzt wird, wirkt er doch längerfristig lästigen Schadinsekten entgegen, die sich an die Pflanzen-Wurzeln heranmachen. Doch indem GAUCHO & Co. den Fraß einiger weniger Organismen verhindern, machen sie auch viele weitere Arten zunichte, deren Leistungen für eine natürliche Bodenfruchtbarkeit nötig sind.
Der Boden wimmelt von Insekten, Milben, Asseln, Würmern und anderen Arten-Gruppen, die den LandwirtInnen buchstäblich den Boden bereiten. Regenwürmer und Ameisen transportieren abgestorbenes Material in verschiedene Erdschichten, lockern dabei die Erde auf und machen sie aufnahmefähig für Luft und Wasser. Tausendfüßler, Asseln und Milben zerkleinern totes Pflanzen-Material. Vor allem aber Mikroorganismen wie Pilze und Bakterien bauen das tote Material ab und überführen die Nährstoffe in einen mineralischen Zustand. Pro Hektar werden auf diese Weise bis zu 15 Tonnen organische Substanz umgewandelt. So entsteht Humus, der den Pflanzen die Nährstoffe zur Verfügung stellt.
„Ohne Bodenorganismen wären die Böden überhaupt nicht ertragfähig“, sagt Hubert Höfer, Bodenökologe am Staatlichen Museum für Naturkunde in Karlsruhe (4). Die Nährstoffe, die durch die Ernte einem landwirtschaftlichen System entnommen werden, könnten durch Düngung ersetzt werden. Ob und wie lange sie aber den Pflanzen zur Verfügung stehen, entschieden die von Bodenorganismen geschaffenen und erhaltenen Strukturen wie Poren, Ton- und Humusgehalt.
Ökosystem Boden leidet
Da Ziel- und Nichtziel-Organismen sehr ähnliche physiologische Eigenschaften besitzen, ist es wenig verwunderlich, dass Neonikotinoide auch im Boden viele „Unschuldige“ treffen. Zumal die Bewohner hier den Giften mitunter wesentlich direkter und vor allem dauerhafter ausgesetzt sind. „Neonikotinoide werden im Zulassungsverfahren der EU wie alle Pflanzenschutzmittel auf repräsentative Arten aller relevanten Lebensgemeinschaften getestet, seien es Vögel, Kleinsäuger, Nichtziel-Arthropoden, Nichtziel-Pflanzen, Wasserlebewesen und auch Bodenorganismen“, meint Prof. Dr. Christoph Schäfers vom „Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie“. Bei Unsicherheiten oder besonderen Bedenken bezüglich des Wirkmechanismus‘ oder der Anwendungsweise würden weitere Tests bis hin zu Empfindlichkeitsverteilungen zahlreicher Nicht-Standardarten oder Freilandstudien durchgeführt.
Rund 400 Publikationen zu den Auswirkungen von Neonikotinoiden gab es 2012 laut eines Überblicks von Thiel et al. (5), der weitaus größte Teil davon hat die Gesundheit von Menschen und anderen Säugetieren im Blick. Lediglich rund drei Prozent der Studien betrachten Insekten, und hier dominiert wieder die Honigbiene das Feld. Zu Bodenorganismen finden sich in der Literatur einige Daten zur mittleren tödlichen Dosis, Reproduktionsentwicklung und Verhalten. Manche dieser Untersuchungen widmen sich den Regenwürmern. Mit bis zu 80 Prozent der gesamten tierischen Biomasse im Boden sind sie die wohl bedeutendsten Gestalter dieses Lebensraums, zumindest in unseren Breiten. Die neurologischen Prozesse der Regenwürmer laufen ähnlich ab wie die der Insekten und sprechen deshalb ebenfalls auf GAUCHO & Co. an. Imidacloprid, das als die toxischste Substanz unter den Neonikotinoiden gilt (6), heftet sich gerade an feuchte, mit organischen Stoffen angereicherte Bodenkrume an, die Regenwürmer so lieben. Wang et al. (7) schätzen das Mortalitätsrisiko durch Körperkontakt für Regenwürmer um mindestens zehn Mal höher ein als durch orale Aufnahme.
Dass die effektive Konzentration im Boden die letale Dosis erreicht, ist bei Regenwürmern allerdings eher unwahrscheinlich. Die AutorInnen weisen jedoch auf ein klares Risiko für subletale Effekte hin. Schon geringe Konzentrationen im Boden von 0,1 bis 0,5 ppm (Anteile pro Million, Anm. SWB) riefen bei Würmern Gewichtsverlust und Verhaltensveränderungen hervor. Realistische Konzentrationen seien zwischen 0,3 und 0,7 ppm. Die WissenschafterInnen verweisen darauf, dass diese Effekte Auswirkungen auf die wichtigen Funktionen der Würmer im Boden haben könnten. Vor allem fehlten Kenntnisse zu Langzeitwirkungen, da die Stoffe zum Teil lange im Boden nachweisbar seien.
Auch Ameisen krempeln den Boden gehörig um. Sie gehören wie die Bienen zu den Hautflüglern, und entsprechend wirken die Nervengifte auch bei ihnen. Zwar verloren sie in Versuchen von Thiel und Köhler (8) nicht wie Honigbienen die Orientierung, allerdings änderte eine der untersuchten Arten ihr Verhalten auf fatale Weise. So steigerte Imidacloprid die Aggressivität einer eigentlich untergeordneten Art. Die Arbeiterinnen attackierten wesentlich öfter Vertreterinnen einer anderen Art, mit der sie sonst friedlich koexistieren. Dies senkte die individuelle Überlebenswahrscheinlichkeit um über 60 Prozent, was längerfristig das Volk benachteiligen dürfte.
Eine zentrale Rolle im natürlichen Nährstoff-Haushalt spielen Springschwänze (Collembola) – zwischen 0,1 und 17 Millimeter große Insekten, die sich von totem Pflanzenmaterial, Pilzen und Bakterien ernähren. Sie erhöhen die Zersetzungsgeschwindigkeit von Laub um bis zu 30 Prozent (9), unterstützen die Umwandlung von Nährstoffen in aufnehmbare Formen und beeinflussen dadurch auch entscheidend das Pflanzenwachstum (10). Genau diese Artengruppe zeigte sich in verschiedenen Studien als besonders empfindlich gegenüber Neonikotinoiden. Eine dreijähriger Versuch von Peck (11) mit Imidacloprid belegte den Rückgang diverser Gliedertiere, einschließlich Springschwänzen, um 54 bis 62 Prozent. Imidacloprid war dabei zehn Mal giftiger als Thiacloprid.
Weniger Wachstum
Doch was bedeuten die negativen Auswirkungen auf die Bodenorganismen nun für das Ökosystem Boden? Dies ist bisher so gut wie nicht untersucht worden. Einige Studien-AutorInnen vermuten hier entsprechende Auswirkungen auf Funktionen wie Bodenauflockerung und Nährstoffverfügbarmachung, also Leistungen, die wesentlich das Wachstum der Pflanzen beeinflussen.
Eisenhauer et al. (12) beobachteten in einem Freilandversuch mit Chlorpyrifos (das nicht den Neonikotinoiden angehört, aber ebenfalls systemisch wirkt), dass Graspflanzen unter dem Einfluss des Insektizids weniger gut wuchsen als in der Kontrolle. Unter den untersuchten Boden-Tierarten waren Springschwänze die am stärksten dezimierte Gruppe. Insbesondere deren Ausfall und die damit unterbundene Mineralisierung und Verfügbarkeit von Nährstoffen seien vermutlich für das geringere Wachstum verantwortlich, schlossen die Autoren. Das Ergebnis zeige, wie wichtig eine intakte Artengemeinschaft im Boden für das Pflanzenwachstum sei und dass der Wegfall von Nützlingen die Vorteile von Insektiziden mindestens neutralisieren könne, so ihr Resümee.
Insektizide haben aber alle verschiedene Eigenschaften, weshalb man ein solches Ergebnis nicht einfach verallgemeinern könne, meint Christoph Schäfers. Hier bedürfe es stoffspezifischer Untersuchungen. „Sollte ein negativer Effekt auf das Pflanzenwachstum allerdings auch bei Neonikotinoiden zu beobachten sein, wäre dies ein wichtiger Grund, die Auswirkungen auf die Bodenfunktionen in das Zulassungsverfahren einzubeziehen“, meint er. Seines Wissens würde das Pflanzenwachstum unter Insektizid-Einfluss im Gegensatz zu dem unter Herbizid-Einfluss im Prüfverfahren bisher jedoch nicht untersucht.
Mindestens zehn Prozent Mehrertrag stellen die Hersteller der Neonikotinoide den LandwirtInnen in Aussicht – ein Versprechen, das offenbar nicht grundsätzlich einzuhalten sein dürfte. Im Gegenteil: Vermutlich hätte ein vollständiges Verbot von Insektiziden wie Neonikotinoiden kaum Ertragseinbußen zur Folge. Dies lässt auch das Ergebnis einer aktuellen, groß angelegten Studie (13) vermuten, die knapp tausend französische Bauernhöfe auf die Effektivität ihres Insektizid-Einsatzes überprüft hat. Im Schnitt könnten 42 Prozent davon eingespart werden – ganz ohne Ertragsverluste, rechnen die Autor-Innen vor.
Natürlich geht es aber auch nicht nur um die Erträge hier und heute. Unsere Böden müssen auch noch viele weitere Generationen ernähren. Doch deren Qualität sinkt. Durch die Intensiv-Bewirtschaftung gehen laut Bundesverband Boden e. V. in Deutschland pro Hektar und Jahr etwa 20 Tonnen fruchtbaren Bodens verloren, vor allem durch Wind- und Wasserabtrag. Durchschnittlich maximal eine Tonne Humus pro Hektar können jedoch jährlich neu gebildet werden – wenn die Bodenorganismen ihre Arbeit machen dürfen (14).
„Wir vergiften Insekten mit Insektiziden und wundern uns, dass die Vergiftungen wirken“, fasst Peter Neumann, Professor für Bienengesundheit an der Universität Bern, die Situation zusammen. Dass politisch noch immer über die negativen Wirkungen diskutiert würde, ärgert ihn. Neonikotinoide seien unspezifische Insektizide, die Insekten töten oder zumindest gravierende subletale Effekte hätten, was inzwischen hundertfach wissenschaftlich belegt worden sei.
Entsprechend sieht Europa-Parlamentarier Martin Häusling in dem nun von der Kommission vorgeschlagenen Totalverbot von Imidacloprid, Thiamethoxam und Clothianidin lediglich einen Anfang. Denn es sind weitere Stoffe wie Thiacloprid und Acetamiprid auf dem Markt. Außerdem warte die Industrie auf die EU-Zulassung ihrer Weiterentwicklungen wie Cyantraniliprol, Flupyradifuron und Sulfoxaflor mit dem gleichen Wirkmechanismus. Laut der EU-Risikobewertungsbehörde EFSA könnten auch für diese Substanzen Risiken für Bestäuber und andere Gliederfüßer nicht ausgeschlossen werden. Was man tatsächlich bräuchte, sei eine konsequente Anwendung des Vorsorge-Prinzips und somit ein Totalverbot für die gesamte Stoffklasse der Neonikotinoide. Dies sei auch im Interesse der Landwirtschaft selbst, die auf Bestäuber und andere Nützlinge angewiesen sei, so Häusling.
„So funktioniert aber das Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln nicht“, sagt Christoph Schäfers. Im Gegensatz zur EU-Chemikaliengesetzgebung würden im Pflanzenschutz nur bestimmte Anwendungen zugelassen. Im Extremfall könne die Zulassung wieder zurückgenommen werden, wenn Gefahr im Verzuge sei. „Ein komplettes Verbot ist nur möglich, wenn der betreffende Stoff Eigenschaften mitbringt, die eine Risikobewertung unmöglich machen, wie etwa eine sehr hohe Lebensdauer, die Anreicherung im Körper, krebserzeugende, erbgut- oder fruchtschädigende Wirkungen oder wenn nachgewiesen werden kann, dass hormon-ähnliche Wirkungen Populationen bestimmter Organismen gefährden.“ So bliebe kein anderer Weg, als jede neue Neonikotinoid-Substanz durch das aufwändige Zulassungsverfahren zu schleusen. Das sei aus seiner Sicht im Übrigen wesentlich besser als sein Ruf.
Allerdings sollten Zulassungsverfahren auch die Frage nach der generellen Sinnhaftigkeit einer Pflanzenschutz-Maßnahme beantworten können - also nicht nur, ob eine Substanz auf die Zielarten wirkt, sondern auch, ob sie am Ende wirklich zu einem Netto-Ertragszuwachs führt. Dazu ist die Einbeziehung sämtlicher relevanter Ökosystem-Funktionen notwendig, auch die der Bodenlebewesen. Das ist aufwändig, aber bei der Reichweite der ökologischen Konsequenzen nur legitim.
Einstweilen gilt es erst einmal abzuwarten, wie Brüssel auf die von der EFSA vorgelegte Risikobewertung für Imidacloprid, Clothianidin und Thiacloprid reagiert.
Doch selbst wenn sämtliche Neonikotinoid-Anwendungen untersagt würden: Ein Verbot ist immer nur so gut wie seine Umsetzung. Das bisherige Teilverbot jedenfalls brachte der Insektenwelt bisher recht wenig. „Sowohl Absatz- als auch Einsatzmengen von Neonikotinoiden sind trotz EU-Verbot nahezu gleich geblieben, da von den Mitgliedstaaten immer wieder großzügig Ausnahmegenehmigungen beantragt und von der Kommission genehmigt wurden“, sagt Häusling. ⎜
Sebastian Tilch ist Diplom-Biologe und arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) als Pressereferent und Online-Redakteur des „Netzwerk-Forums zur Biodiversitätsforschung Deutschland“
(NeFo), das diesen Text auch als erstes veröffentlichte.
(1) Simon-Delso, N.; Amaral-Rogers, V.; Belzunces, L. P.; Bonmatin, J. M.; Chagnon, M.; Downs, C.: Systemic insecticides (neonicotinoids and fipronil): trends, uses, mode of action and metabolites. In: Environ Sci Pollut Res 22 (1), S. 5–34. DOI: 10.1007/s11356-014-3470-y
(2) Rundlöf, Maj; Andersson, Georg K. S.; Bommarco, Riccardo; Fries, Ingemar; Hederström, Veronica; Herbertsson, Lina (2015): Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees. In: Nature 521 (7550), S. 77–80. DOI: 10.1038/nature14420
(3) Lima E Silva, Cláudia de; Brennan, Nicola; Brouwer, Jitske M.; Commandeur, Daniël; Verweij, Rudo A.; van Gestel, Cornelis A. M. (2017): Comparative toxicity of imidacloprid and thiacloprid to different species of soil invertebrates. In: Ecotoxicology (London, England) 26 (4), S. 555–564. DOI: 10.1007/s10646-017-1790-7
(4) www.biodiversity.de/schnittstellen/produkte/interviews/experten/uns-fehlen-flachendeckend-verlassliche-daten-bodentieren
(5) Thiel, Sarina; Köhler, Heinz-R.: A sublethal imidacloprid concentration alters foraging and competition behaviour of ants. In: Ecotoxicology 25 (4), S. 814–823. DOI: 10.1007/s10646-016-1638-6
(6) Alves, Paulo Roger L.; Cardoso, Elke J. B. N.; Martines, Alexandre M.; Sousa, José Paulo; Pasini, Amarildo (2013): Earthworm ecotoxicological assessments of pesticides used to treat seeds under tropical conditions. In: Chemosphere 90 (11), S. 2674–2682. DOI: 0.1016/j.chemosphere.2012.11.046
(7) zit. n. Pisa, L. W.; Amaral-Rogers, V.; Belzunces, L. P.; Bonmatin, J. M.; Downs, C. A.; Goulson, D.: Effects of neonicotinoids and fipronil on non-target invertebrates. In: Environ Sci Pollut Res 22 (1), S. 68–102. DOI: 10.1007/s11356-014-3471-x
(8) Thiel, Sarina; Köhler, Heinz-R.: A sublethal imidacloprid concentration alters foraging and competition behaviour of ants. In: Ecotoxicology 25 (4), S. 814–823. DOI: 10.1007/s10646-016-1638-6
(9) A‘Bear, A. Donald; Boddy, Lynne; Hefin Jones, T. (2012): Impacts of elevated temperature on the growth and functioning of decomposer fungi are influenced by grazing collembola. In: Glob Change Biol 18 (6), S. 1823–1832. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2012.02637.x
(10) Filser, Juliane; Faber, Jack H.; Tiunov, Alexei V.; Brussaard, Lijbert; Frouz, Jan; Deyn, Gerlinde (2016): Soil fauna. Key to new carbon models. In: SOIL 2 (4), S. 565–582. DOI: 10.5194/soil-2-565-2016
(11) zit. n. Pisa, L. W.; Amaral-Rogers, V.; Belzunces, L. P.; Bonmatin, J. M.; Downs, C. A.; Goulson, D.: Effects of neonicotinoids and fipronil on non-target invertebrates. In: Environ Sci Pollut Res 22 (1), S. 68–102. DOI: 10.1007/s11356-014-3471-x
(12) Eisenhauer, Nico; Sabais, Alexander C.W.; Schonert, Felix; Scheu, Stefan (2010): Soil arthropods beneficially rather than detrimentally impact plant performance in experimental grassland systems of different diversity. In: Soil Biology and Biochemistry 42 (9), S. 1418–1424. DOI: 10.1016/j.soilbio.2010.05.001
(13) Lechenet M, Dessaint F, Py G, Makowski D, Munier-Jolain N (2017): Reducing pesticide use while preserving crop productivity and profitability on arable farms. In: Nature Plants; Mar 1; 3:17008. Doi: 10.1038/nplants.2017.8
(14) Blume, Hans-Peter; Horn, Rainer; Thiele-Bruhn, Sören (2011): Handbuch des Bodenschutzes. Bodenökologie und -belastung : vorbeugende und abwehrende Schutzmassnahmen. 4., vollständig überarbeitete Aufl. Weinheim: WILEY-VCH
AKTION & KRITIK
CBG auf „Wir haben es satt“-Demo!
Mit über 30.000 Menschen hatte die diesjährige „Wir haben es satt“-Demonstration weit mehr Zulauf als die von 2017. Die TeilnehmerInnen, die am 20. Januar 2018 nach Berlin kamen, unterstrichen damit noch einmal die Dringlichkeit einer Landwende. Sie traten für eine Landwirtschaft ein, die ohne Glyphosat & Co., Massentierhaltung, Antibiotika wie BAYERs BAYTRIL, Insektensterben, Land-Konzentration, Export-Orientierung und – last but not least – BAYSANTO auskommt. „Wir wollen, dass Demokratie sich gegen Konzern-Macht durchsetzt, weltweit“, hieß es in der Erklärung der Veranstalter. „Dämmen Sie die Markt-Konzentration von Großunternehmen ein, weil diese die Verwirklichung des Rechts auf Nahrung und eine positive ländliche Entwicklung bedroht“, forderten sie deshalb von den PolitikerInnen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) setzte dieses Thema in Berlin ebenfalls auf die Tagesordnung. „Stopp BAYER/MONSANTO“ war der Aufruf überschrieben, den CBG-AktivistInnen auf der ganzen Demo-Strecke verteilten.
CBG beim Kölner Rosenmontagszug
Die alternative Kölner Karnevalstruppe „Pappnasen Rot-Schwarz“ hatte für ihren diesjährigen Rosenmontagsbeitrag das offizielle Motto „Mer Kölsche danze us der Reih“ in „Mer klääve nit am Wachstumswaahn, mer danze us der Reih“ umgestrickt. Sich traditionell als „Zoch vor dem Zoch“ an die Spitze des närrischen Treibens setzend, dichteten sie auch das jecke Liedgut ein wenig um. „D’r Kappetalismus/Dä hätt ene Voll-Schuss/Einer fängk zu wachse aan/bis jeder mitmuss“, inthronierten die rund 80 Alternativ-KarnevalistInnen unter anderem. Und da der BAYER-Konzern ebenfalls ganz dolle von dem Wachstumsvirus befallen ist, wie sein MONSANTO-Übernahmeplan zeigt, durften er und seine Auserwählte bei dem Umzug so wenig fehlen wie AktivistInnen der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN. Als „Hochzeit des Todes“ hatte das Horror-Brautpaar seinen Auftritt, ihren kleinen „Glypho-Satan“ im Kinderwagen vor sich her schiebend. Hinter ihnen folgten das BAYSANTO-Monster, „Mad Scientists“ und die Bienen-Leichen, die ihren Weg pflasterten. So vor den ZuschauerInnen an der Strecke vorbeiparadierend, wurden die Pappnasen von einer Tribüne aus sogar schon als „Protest-Zug aus Leverkusen“ begrüßt, obwohl in ihren Reihen auch noch andere Konzerne wie z. B. der Klima-Killer RWE ihr Unwesen trieben.
Proteste vor BAYER-Zentrale
Am 31. Januar 2017 wollte das US-Unternehmen MONSANTO auf seiner Hauptversammlung weitere Vorbereitungen zur Elefanten-Hochzeit mit BAYER treffen. Das von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN initiierte „Stopp BAYER/MONSANTO!“-Bündnis nahm dies zum Anlass, dem Multi vor seiner Leverkusener Zentrale schon einmal die Braut zu präsentieren. Aus Sicherheitsgründen war dazu ein Feuerwehr-Einsatz nötig, denn die Auserkorene hatte gleich ihre Mit-Gift dabei: das laut WHO „wahrscheinlich krebserregende“ Glyphosat, das berühmt-berüchtigte Agent Orange und das Baumwoll-Saatgut, das in Indien so viele LandwirtInnen in den Tod treibt. Für BAYER trübt das die Anziehungskraft jedoch nicht. Im Gegenteil: Der Global Player erkennt darin eine Wahlverwandtschaft, steht es mit seinem Lebenswandel doch ebenfalls nicht zum Besten. Die rund 40 AktivistInnen – unter anderem von ATTAC, FIAN, der ÖkolandwirtInnen-Vereinigung IFOAM und von den PAPPNASEN ROTSCHWARZ – verwiesen darauf symbolisch, indem sie vor der Konzern-Zentrale die letzte Biene zu Grabe trugen, niedergestreckt durch Pestizide des deutschen Agro-Konzerns. Auch der Trauzeuge stellte sich bereits vor. Für diesen Posten hatte sich Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) in Brüssel durch seine Zustimmung zur Glyphosat-Zulassungsverlängerung qualifiziert, die dem Paar in spe die Aussicht auf eine noch praller gefüllte Familien-Kasse eröffnete. Dezent im Hintergrund hielt sich hingegen der vom ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Friedrich Merz vertretene Heiratsvermittler BLACKROCK, der die Partnerschaft mit eingefädelt hatte. Der Hausbesuch, mit dem das Bündnis die diesjährigen Aktionen gegen die von BAYER geplante MONSANTO-Übernahme einleitete, fand breite Resonanz bei Medien und Beschäftigten und vermittelte Zuversicht für den weiteren Verlauf der Kampagne.
Die-In gegen Baysanto
Am 3.3.18 hat die Initiative ALTERNATIBA Rhône am französischen BAYER-Standort Lyon mit einer spektakulären Aktion gegen die von BAYER geplante MONSANTO-Übernahme protestiert. Die Organisation veranstaltete Anfang März 2018 ein Die-in, um die Gesundheitsgefahren plastisch darzustellen, die von dem agro-industriellen Komplex ausgehen, den der Konzern durch die Einverleibung seines US-Konkurrenten noch einmal ein wenig komplexer gestalten will. Und die Ackergifte der beiden Unternehmen leisteten an dem Tag ganze Arbeit: Vor einer zentralen Metro-Station der Stadt lagen nicht nur Menschen darnieder, sondern auch Tiere und Pflanzen – einige AktivistInnen hatten sich nämlich Flora und Fauna anverwandelt.
Warnung vor Bio-Kunststoffen
Die Konzerne stellen Kunststoffe zunehmend aus pflanzlichen Rohstoffen her. So entwickelt die BAYER-Tochter COVESTRO, an welcher der Konzern direkt 14,2 Prozent der Aktien hält und sein Pensionsfonds 8,9 Prozent, etwa Lackhärter mit Biomasse-Anteilen. Zudem forscht die Gesellschaft an vielen anderen Plaste-Produkten auf der Basis von Celluse, Milchsäure oder Zucker. „Die Umweltverträglichkeit wird zur Markt-Erfordernis“, so begründet das Unternehmen den Versuch, Alternativen zur Petrochemie zu finden. Mit der Umweltverträglichkeit der sogenannten Bioplastics ist es allerdings so eine Sache. Aufgrund ihrer komplexen Struktur bauen sie sich in der Natur nur äußerst langsam ab und setzen dabei zu allem Überfluss auch noch das klima-schädliche Gas Methan frei. Das Recycling bereitet wegen ihrer chemischen Zusammensetzung ebenfalls Schwierigkeiten. Da die Bio-Kunststoffe trotzdem unter dem Öko-Label firmieren und so einen Konsum ohne Reue befeuern, sehen FRIENDS OF THE EARTH EUROPE und andere Initiativen die neuen Kunststoffe eher als Teil des Problems denn als Teil der Lösung an. Priorität hat für die Gruppen nach wie vor eine Gebrauchsreduktion von Plastik. Eine solche Strategie forderten sie auch von der Europäischen Union ein. Überdies verlangten sie von Brüssel, den Umgang mit den Bioplastics zu regulieren. Konkret treten die Umweltschützer-Innen für Maßnahmen ein, welche für eine bessere Recycling-Fähigkeit der Materialen sorgen, Nachhaltigkeitskriterien für sie entwickeln und COVESTRO & Co. irreführende Öko-Werbung mit den Stoffen untersagen.
KAPITAL & ARBEIT
Neues Gesetz zur Lohn-Transparenz
Im letzten Jahr hat der deutsche Bundestag das „Gesetz zur Förderung der Entgelt-Transparenz zwischen Frauen und Männern“ verabschiedet. Es soll helfen, die bestehende Ungleichheit in der Bezahlung der beiden Geschlechter zu mildern. So verpflichtet das Paragrafen-Werk die Unternehmen, Berichte über Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen im Allgemeinen und über Maßnahmen zur Herstellung der Entgelt-Gleichheit im Besonderen zu erstellen. Beim Leverkusener Multi hatte der Betriebsrat in der Vergangenheit bei einigen Tochter-Gesellschaften des Konzerns eine Befragung durchgeführt und Gehaltsdifferenzen von 0,7 bis 1,8 Prozent festgestellt. Nach Angaben der stellvertretenden BAYER-Betriebsratsvorsitzenden Roswitha Süsselbeck hat der Konzern auf die Erhebung reagiert und die Löhne angeglichen. Wäre die überdurchschnittlich oft von Frauen ausgeübte und in der Regel schlechter bezahlte Teilzeit-Arbeit mit in die Untersuchung eingeflossen, hätten sich höchstwahrscheinlich weitaus größere Unterschiede ergeben.
ERSTE & DRITTE WELT
Entwicklungshilfe zur Selbsthilfe
Seit einiger Zeit haben die Global Player auf der Suche nach neuen Absatz-Gebieten die „Low-income Markets“ entdeckt (siehe auch SWB 4/13). So entwickelte der Leverkusener Multi bereits 2013 eine „Afrika-Strategie“. Bei der Umsetzung geriert sich der Agro-Riese gerne als Entwicklungshelfer. „BAYER kooperiert mit der gemeinnützigen Organisation ‚Fair Planet’ und wird Teil des Projekts ‚Bridging the Seed Gap’ in Äthiopien. Ziel des Projekts ist es, neue Anbau-Möglichkeiten für Kleinbauern zu schaffen“, vermeldete der Konzern etwa Anfang 2016. Nur handelt es sich leider bei „Fair Planet“ um einen Verband, der sein Geld von BAYER, SYNGENTA, LIMAGRAIN & Co. erhält. Und so sehen die Programme auch aus. Die „Anbau-Möglichkeiten für Kleinbauern“ beschränken sich auf Tomaten, Paprika und Zwiebeln made by BAYER. Zudem handelt es sich um hybride, also nicht zur Wiederaussaat geeignete Sorten. Diese nur für den einmaligen Gebrauch bestimmten Arten, deren Preis trotzdem den von konventionellem Saatgut übersteigt, können die FarmerInnen zunächst kostenlos testen. Anschließend müssen sie für die Produkte allerdings die Werbetrommel rühren. „Sie sollen dann weiteren Landwirten in den Dörfern und Regionen die Vorteile dieses Saatguts demonstrieren“, so lautet der Business-Plan des Konzerns. Und der ging bis jetzt offenbar auf. Im Juli 2017 setzten der Global Player und „Fair Planet“ ihre Zusammenarbeit fort.
POLITIK & EINFLUSS
Mehr Innovation, weniger Vorsorge
Die Europäische Union legt bei der Beurteilung möglicher Gesundheitsgefährdungen durch chemische und andere Stoffe das Vorsorge-Prinzip zugrunde. Sie kann theoretisch also schon reagieren, wenn negative Effekte von Substanzen für Mensch, Tier und Umwelt nicht auszuschließen sind, und nicht erst bei zweifelsfreien wissenschaftlichen Belegen für eine solche Wirkung. Die Industrie opponiert schon seit Jahren gegen diese Herangehensweise. So schrieb der damalige BAYER-Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers in der Angelegenheit gemeinsam mit anderen Konzern-Lenkern bereits 2013 einen Offenen Brief an die EU-Kommission. Darin traten die Bosse dafür ein, dem Vorsorge-Prinzip ein Innovationsprinzip zur Seite zu stellen. Ein Gleichgewicht zwischen Gesundheitsschutz und Innovationsförderung sollte Brüssel nach Meinung der Vorstandschefs anstreben, denn: „Innovationen sind per definitionem mit Risiken verbunden.“ Und nun wiederholte der Dekkers-Nachfolger Werner Baumann diese Forderung und verlangte, dass „alle neuen Gesetze auf ihre Folgen für die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft sinnvoll überprüft werden müssen“. Scheinheilig stellte er seinen Vorschlag als Ergänzung und nicht etwa als Unterminierung des Vorsorge-Prinzips dar.
Zahmer Aktionsplan
Der Leverkusener Multi hat in seiner Geschichte vielfach gegen Menschenrechte verstoßen. So nutzte er etwa Menschen aus der „Dritten Welt“ ohne deren Wissen als Versuchskaninchen für neue Pharma-Produkte, übte massiven Druck auf GewerkschaftlerInnen aus und griff auf Kinderarbeit zurück. Um solche Rechtsverstöße – entweder von den Global Playern selbst begangen oder aber von den Vertragsfirmen ihrer Lieferketten – besser ahnden zu können, hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen vor einiger Zeit „Guiding Principles on Business and Human Rights“ verabschiedet. Die EU hat ihre Mitgliedsstaaten daraufhin angehalten, eigene Aktionspläne zu erstellen. Die vorletzte Große Koalition tat das mit einiger Verspätung: Ihr Nationaler Aktionsplan (NAP) trat erst 2017 in Kraft. Viel zu befürchten haben die Konzerne von ihm auch nicht – ihr Extrem-Lobbyismus zeigte Wirkung. SPD und CDU blieben ihren Ankündigungen treu und setzen lediglich auf „Dialogformate“ und die Unterstützung von Trainingsprogrammen. Haftungsregeln sieht der Plan hingegen nicht vor, da „es sich bei Subunternehmen begrifflich um rechtlich selbstständige Unternehmen handelt, auf die ein anderes Unternehmen keinen gesellschaftsrechtlichen Einfluss ausüben kann“. Die Parteien lehnen es zudem ab, die Klage-Möglichkeiten wegen Verstößen gegen die Leitlinien des Industrieländer-Zusammenschlusses OECD zu verbessern und möchten lieber, „dass die Unternehmen freiwillig und aus eigener Verantwortung gesellschaftliche Verantwortung übernehmen“, wie es 2014 in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage von BÜNDNIS 90/Die Grünen hieß. Bis zum Jahr 2020 haben BAYER & Co. nun Zeit, um ihre Wertschöpfungsketten hinsichtlich etwaiger Menschenrechtsverletzungen zu kontrollieren und Bericht zu erstatten. Erst danach folgen – eventuell – „weitergehende Schritte“. „Falls die wirksame und umfassende Überprüfung des NAP 2020 zu dem Ergebnis kommt, dass die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht ausreicht, werden wir national gesetzlich tätig und uns für eine EU-weite Regelung einsetzen“, hält der Koalitionsvertrag fest.
BAYER droht May wg. Brexit
Großbritannien stellt für den Leverkusener Multi einen wichtigen Export-Markt dar. Darum war er über den Brexit not amused. Der Chef von BAYERs England-Geschäft, Alexander Moscho, sorgt sich hauptsächlich darum, künftig mehr Schwierigkeiten bei der Besetzung von Top-Positionen zu haben. Zudem befürchtet er, mit Arzneien und Pestiziden nicht mehr so schnell auf den britischen Markt kommen zu können, wenn London künftig EU-Genehmigungen nicht mehr anerkennt und stattdessen eigene Zulassungsbehörden aufbaut. Deshalb baut Moscho, den die mit dem Brexit verbundenen Probleme nach eigenem Bekunden 30 Prozent seiner Arbeitszeit kosten, in Gesprächen mit den politisch Verantwortlichen Druck auf. „Wir teilten der Regierung auch mit, dass unsere Diskussion mit der Konzern-Zentrale sich in letzter Zeit verändert haben. Wenn wir früher über Investitionen redeten, geht es heute eher darum, den Status Quo zu sichern“, sagte er in einem Interview mit the pharmaletter. „Eine subtile psychologische Veränderung“ nannte der Manager das und drohte eine Fortsetzung dieser Entwicklung an, „wenn es der Regierung nicht gelingt, auf einige Schlüsselfragen rund um den Brexit klärende Antworten zu geben“.
PROPAGANDA & MEDIEN
BAYERs „Big Data“-Marketing
Der Leverkusener Multi greift beim Marketing zunehmend auf Big Data zurück. So nutzt seine Veterinär-Sparte die Dienste der Firma CONSUMER ORBIT, um ihre Angebote passgenau auf bestimmte VerbraucherInnen-Gruppen zuzuschneiden. Zusammen mit den eigenen Informationen kommt der Konzern so auf 63 Billionen Daten. Und das versetzt ihn in die Lage, „ein Modell zu entwickeln, das uns zeigt, wie unsere Kunden aussehen, wer unsere Produkte nutzt und was für Gewohnheiten diese Personen haben“, preist Marketing-Leiter Doug Yoder die neuen Werbe-Möglichkeiten.
BAYER unterstützt ASA-Initiative
Wenn medizinische Fachgesellschaften sich Krankheiten widmen, für die BAYER vermeintlich die passenden Arzneien im Angebot hat, können sie immer mit Schecks aus Leverkusen rechnen. Schließlich gilt es für den Konzern, die pharmazeutische Landschaft zu pflegen. So unterstützt der Pillen-Riese auch die „Together to end stroke“-Initiative der „American Stroke Association“ (ASA) und der „American Heart Association“ (AHA), die über die Prävention und Behandlung von Schlag- und Herzanfällen informieren will. Allerdings setzt das Unternehmen bei solchen Kampagnen naturgemäß eigene Schwerpunkte. Nach ein paar Hinweisen über die prophylaktische Wirkung von Sport und gesundem Essen kommt schon der Rat: „Fragen Sie Ihren Doktor nach einer Behandlung mit ASPIRIN.“ Schließlich vermarktet der Global Player seinen Tausendsassa schon seit Längerem auch zur Vorbeugung von Schlag- und Herzanfällen.
DRUGS & PILLS
Liefer-Engpass bei ASPIRIN i. V.
Big Pharma unterwirft seine Produktion immer strengeren Profit-Kriterien. So stellt BAYER viele Wirkstoffe gar nicht mehr selber her, sondern gliedert die Fertigung aus, gerne auch in „Entwicklungsländer“, wo billige Arbeitskräfte und fehlende Umweltauflagen locken (SWB 4/17). Weil so oft genug nur noch ein einziges Unternehmen die Herstellung einer weltweit nachgefragten Substanz verantwortet, gefährdet dieses Produktionsregime die Versorgungssicherheit. Das zeigte sich jetzt im Fall von ASPIRIN i. V. Bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwölf Monaten kann der Pillen-Riese dieses Pharmazeutikum, das NotärztInnen bei Herzinfarkten verwenden und ansonsten bei hohem Fieber und starken Schmerzen zum Einsatz kommt, entweder gar nicht oder nur „in einer angepassten Menge“ liefern. „Ursache des Problems sind qualitätsbedingte Ausfälle bei einem Lohn-Unternehmer in Frankreich, der ASPIRIN i. V. für BAYER herstellt“, teilte der Global Player mit. Er bekundet nun, fieberhaft an einer Lösung zu arbeiten. Schnelle Abhilfe verspricht er indessen nicht: „Das wird noch einige Monate dauern.“
Liefer-Engpass bei PHYTODOLOR
Immer wieder kommt es bei BAYER-Medikamenten zu Liefer-Engpässen (s. o.). Besonders häufig treten diese bei Heilmitteln auf pflanzlicher Basis, den sogenannten Phytopharmaka, auf. So mussten die Apotheken im letzten Jahr lange auf das Rheuma-Präparat PHYTODOLOR verzichten. Nach Angaben des Konzerns haperte es bei der Arznei, die wegen ihres Alkohol-Gehaltes in der Kritik steht, mit der Qualität des Goldruten-, Eschenrinde- und Zitterpappelrinde-Krautes. Zuvor hatten die PatientInnen bereits lange vergeblich auf das zur Behandlung von leichten bis mittelschweren Depressionen zur Anwendung kommende Johanneskraut-Mittel LAIF warten müssen (Ticker 3/16).
Neue LAIF-Rezeptur
Das Johanneskraut-Präparat LAIF bereitete BAYER in letzter Zeit viel Kummer. So traten Liefer-Engpässe wegen mangelhafter Qualität des Rohstoffes auf (s. o.). Ob diese in Zusammenhang mit zu hohen Rückständen von gesundheitsschädlichen Pyrrolizidin-Alkaloiden standen, mochte der Leverkusener Multi damals lieber nicht sagen. Darüber hinaus quollen die feuchtigkeitsempfindlichen Tabletten oft auf. Dagegen hat der Konzern jetzt mit einer neuen Formulierung Abhilfe geschaffen, die einen Eindruck davon vermittelt, wie viel Chemie doch in einem Heilmittel auf pflanzlicher Basis so stecken kann. Der Pharma-Riese fügte der Rezeptur Hyprolose, Hypromellose, mikrokristalline Cellulose, mittelkettige Triglyceride, Sterarinsäure und vorverkleisterte Stärke zu und strich dafür Carboxyethylstärke-Natrium, Eudragit E100 und Natriumhydrogen-Carbonat.
BAYER will Phyto-Sparte ausbauen
Ungeachtet der vielen Schwierigkeiten mit Arzneimitteln auf pflanzlicher Basis (s. o.) will BAYER diese Sparte ausbauen. Zu diesem Behufe hat der Konzern in Darmstadt ein Kompetenz-Zentrum eingerichtet. Er hält die große Nachfrage nach LAIF, IBEROGAST & Co. nämlich für einen nachhaltigen Trend und hofft auf wachsende Renditen in diesem Bereich.
ALKA-SELTZER-Rückruf Nr. 2
Im August 2017 musste BAYER in den USA wegen fehlerhafter Verpackungen einen Rückruf bestimmter ALKA-SELTZER-Produkte starten. Es traten undichte Stellen auf, und die Tabletten drohten feucht zu werden. Im März 2018 erfolgte der „Volontary Recall“ von bestimmten „ALKA-SELTZER PLUS“-Chargen dann, weil die vorne auf den Packungen des Schmerz- und Erkältungsmittels aufgeführten Inhaltsstoffe nicht den auf der Rückseite angegebenen entsprachen. Dies könnte KonsumentInnen, die allergisch auf bestimmte Wirkstoffe reagieren, zur Einnahme der Präparate verleiten und deshalb „ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen“ haben, warnte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA.
85.367 XARELTO-Nebenwirkungen
Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA erreichen immer mehr Meldungen über schwerwiegende Nebenwirkungen, die im Zusammenhang mit der Einnahme von BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO stehen. Bisher hat die Institution bis zum 1.3.18 insgesamt 85.367 Kranken-Akten erhalten. Allein im Februar 2018 gingen bei der Agentur über 1.500 Berichte über unerwünschte Pharma-Effekte ein.
XARELTO: schwankende Gerinnungswerte
In den Klinischen Prüfungen zeigte sich BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO dem altgedienten Marcumar nicht überlegen. Deshalb wirbt der Leverkusener Multi mit den praktischen Vorteilen der Arznei aus der Gruppe der Antikoagulantien wie dem Wegfall der regelmäßigen Blutgerinnungsmessung. Aber selbst damit ist es bei dem Medikament nicht weit her. „Wir sehen häufig bei Patienten, die neue Antikoagulantien einnehmen, dass sie trotzdem derangierte Blutwerte haben“, sagt etwa die Berliner Unfall-Chirugin Hanna Neumann. Ein Wissenschaftler des Pharma-Riesen selber räumte gegenüber dem Handelsblatt ein, dass die Gerinnungswerte unter XARELTO eine erhebliche Schwankungsbreite aufweisen – dementierte diese Aussage jedoch gleich wieder (siehe SWB 2/16). Durch diese Eigenschaft des Mittels steigt die Gefahr plötzlich auftretender, lebensgefährlicher Blutungen enorm – zumal für das Präparat bisher kein blutstillendes Gegenmittel existiert, obwohl der Konzern ein solches Antidot immer wieder ankündigt. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde will nun im Mai 2018 über die Zulassung eines entsprechenden Produkts entscheiden, die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA erst im nächsten Jahr.
Haarausfall unter XARELTO
Die Liste der unerwünschten Arznei-Effekte von BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO wird immer länger. Zu den gefährlichsten zählen Blutungen, die allzu oft einen tödlichen Ausgang nehmen. Aber auch Leber-Schädigungen, Haut- und Blutkrankheiten kann der Milliarden-Seller auslösen. Und unlängst kam noch eine neue Nebenwirkung hinzu, die nicht auf dem Beipackzettel vermerkt ist: Haarausfall. Entsprechende Verdachtsmeldungen dazu gingen bei der Weltgesundheitsorganisation WHO ein.
Neue XARELTO-Studie
Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat das Sicherheitsprofil von BAYERs gefährlichem Gerinnungshemmer XARELTO (Wirkstoff: Rivaroxaban) mit dem von Marcumar (Warfarin) bei PatientInnen mit Vorhof-Flimmern miteinander verglichen. Nach dieser Studie, die auf Daten von 115.000 PatientInnen basierte, besteht unter XARELTO ein höheres Risiko, Blutungen im Magen/Darm-Trakt zu erleiden, während das Risiko, Blutungen im Gehirn oder sogar einen Hirnschlag zu erleiden, unter Warfarin größer ist.
Patent-Verlängerung für XARELTO
Erhalten die Konzerne für neue Entwicklungen ein Patent, so gewährt ihnen das eine Monopol-Stellung in dem betreffenden Markt. Das garantiert den Unternehmen Extra-Profite über viele Jahre hinweg. Und wenn es sich bei den Innovationen um Arzneien oder Pestizide handelt, sieht es sogar noch ein bisschen besser aus. Mit Pharmazeutika und Ackergiften können die Multis nämlich noch mal in die Verlängerung gehen. Sie brauchen für sie lediglich „ergänzende Schutz-Zertifikate“ zu beantragen. Und genau das hat BAYER im Fall von XARELTO getan. So gelang es dem Leverkusener Multi dann, die Schutzfrist für den gefährlichen Gerinnungshemmer (s. o.), die eigentlich im Dezember 2020 ausgelaufen wäre, bis auf den 28. August 2024 auszuweiten.
Wieder Test mit ADEMPAS
Wenn eine von BAYER entwickelte Arznei für eine bestimmte Indikation eine Genehmigung erhalten hat, versucht sich der Konzern umgehend an einer Erweiterung der Anwendungszone. So ging er auch beim zur Behandlung der beiden Lungenhochdruck-Krankheiten CTEPH und PAH zugelassenen Pharmazeutikum ADEMPAS (Wirkstoff: Riociguat) vor, obwohl das Fach-Magazin Arzneimittelbrief die therapeutischen Effekte des Mittels schon bei diesen Gesundheitsstörungen als nur „marginal“ bewertet. Momentan führt der Pharma-Riese gemeinsam mit dem Unternehmen MERCK eine klinische Erprobung bei solchen PAH-PatientInnen durch, die nicht auf die Arznei-Stoffe Sildenafil und Tadalafil ansprechen. Kindern mit Lungenhochdruck will er das Produkt ebenfalls angedeihen lassen. Zudem testet der Global Player ADEMPAS gerade als Medikament gegen die Autoimmun-Krankheit „Systemische Sklerose“. Und damit nicht genug, beabsichtigt er, das Präparat bei Herz-Insuffizienz und Schädigungen der Niere in Anschlag zu bringen.
May zieht DUOGYNON-Bericht zurück
Ein hormoneller Schwangerschaftstest der heute zu BAYER gehörenden Firma SCHERING hat ab den 1950er Jahren zu tausenden Totgeburten geführt. Darüber hinaus kamen durch das unter den Namen DUOGYNON und PRIMODOS vertriebene Medizinprodukt bis zum Vermarktungsstopp Anfang der 1980er Jahre unzählige Kinder mit schweren Missbildungen zur Welt. Geschädigte oder deren Eltern fordern den Leverkusener Multi auf seinen AktionärInnen-Versammlungen seit Jahren dazu auf, die Verantwortung dafür zu übernehmen, bislang allerdings vergeblich. In England konnten sie jedoch die Politik mobilisieren. Das britische Parlament gab im Oktober 2015 eine Untersuchung zum Fall „Primodos“ in Auftrag. Der Abschluss-Bericht bestritt aber einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Test und den Gesundheitsschädigungen. Allerdings weist die Expertise zahlreiche Unstimmigkeiten auf. So berücksichtigt sie beispielsweise nicht alle bisher zugänglichen Dokumente zu dem Medizin-Skandal. Aus diesen Gründen zog die britische Premierministerin Theresa May den Report vorerst zurück und ordnete eine Überprüfung seines Befundes an.
EU will Kosten/Nutzen-Prüfung ändern
Das Arzneimittel-Neuverordnungsgesetz (AMNOG) von 2011 schreibt für neue Medikamente eine Kosten/Nutzen-Prüfung vor. Diese führt der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von MedizinerInnen, Krankenhäusern und Krankenkassen durch. Bescheinigt dieses Gremium dem zu begutachtenden Pharmazeutikum dann eine Überlegenheit gegenüber den bisherigen Mitteln, so können die Hersteller anschließend mit DAK & Co. einen Preis aushandeln. Fällt das G-BA-Votum dagegen negativ aus, müssen die Pillen-Produzenten Preisabschläge in Kauf nehmen. Zu solch einem Urteil kamen die ExpertInnen z. B. bei BAYERs Krebs-Präparat STIVARGA, woraufhin der Leverkusener Multi auf die Vermarktung des Produktes in der Bundesrepublik verzichtete. Dementsprechend kritisch steht nicht nur der Leverkusener Multi, sondern die gesamte Branche diesem Instrument zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen gegenüber. Und entsprechend positiv beurteilen die Pharma-Riesen die Pläne der EU, Brüssel die Zuständigkeit für den Arznei-Check zu übertragen. Johann-Magnus von Stackelberg vom Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) reagiert dagegen alarmiert: „Wir befürchten die Absenkung der hohen Standards, die wir in Deutschland für die Bewertung von neuen Medikamenten haben.“ Die PolitikerInnen teilen diese Sorgen und weisen das Ansinnen der Europäischen Union, sich zum Wohl von BAYER & Co. in die Gesundheitspolitik der einzelnen Mitgliedsländer einzumischen, zurück: Am 22.3.18 erteilte der Bundestag der EU-Kommission einstimmig eine sogenannte Subsidiaritätsrüge.
Kooperation mit DELSITECH
Medikamente für Augen-Krankheiten zählen zum Kerngeschäft von BAYERs Pharma-Sparte. Darum bemüht sich der Konzern stets, das Segment auszuweiten. Zu diesem Behufe hat er jetzt einen Kooperationsvertrag mit dem Unternehmen DELSITECH geschlossen. Die finnische Firma forscht an medizinisch unproblematischen Träger-Stoffen für die eigentlichen Wirk-Substanzen. Nach der nun getroffenen Vereinbarung übernimmt der Leverkusener Multi die Entwicklungskosten für ein entsprechendes Projekt. Zudem verpflichtet er sich, abhängig von DELSITECHs Fortschritten bei dem Vorhaben, zu weiteren Zahlungen.
Kooperation mit T2
BAYER hat einen Kooperationsvertrag mit der Firma T2 BIOSYSTEMS geschlossen. Die Vereinbarung gewährt dem Leverkusener Multi Zugang zu einer Magnetresonanz-Technologie zur Bestimmung der Blut-Gerinnung.
Kooperation mit LEICA
Die personalisierte Medizin, also die Entwicklung einer passgenauen, auf die jeweiligen Bedürfnisse der PatientInnen ausgerichteten Therapie-Form, erfüllt die in sie gesteckten Erwartungen bisher nicht. „Die Sache ist komplizierter als gedacht“, räumte BAYERs Pharma-Forscher Jörg Müller einmal ein. Insbesondere fehlen Kenntnisse darüber, was sich in den Körpern der einzelnen Kranken auf molekularer Ebene konkret abspielt. Aufschluss darüber versprechen bestimmte Tests zu geben. Darum hat BAYER das Unternehmen LEICA beauftragt, einen solchen auf Basis von Gewebe-Proben zu entwickeln. „Die personalisierte Medizin hat dann Aussicht auf Erfolg, wenn wir mit hochwertigen diagnostischen Tests genau die Patienten-Populationen bestimmen können, die mit größter Wahrscheinlichkeit von der Therapie profitieren werden“, so Jonathan Roy von LEICA. Auch das Hildener Unternehmen Qiagen entwickelt solche Analyse-Verfahren für den Leverkusener Multi.
AGRO & CHEMIE
Aus für Glufosinat
Jahrzehntelang hat die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN für ein Verbot des erbgut-schädigenden BAYER-Pestizides Glufosinat gestritten. Jetzt kann sie endlich den Erfolg verbuchen: Die EU lässt den Wirkstoff, den der Leverkusener Multi unter anderem unter den Produkt-Namen LIBERTY und BASTA vermarktet, auf ihrem Territorium nicht länger zu. Der Agro-Riese zog seinen Antrag auf Verlängerung der Genehmigung Ende 2017 zurück und begründete dies mit „anhaltenden regulatorischen Unwägbarkeiten innerhalb der EU“. Noch bis zum 1. August 2019 dürfen die LandwirtInnen das Mittel verwenden, dann ist Schluss. Frankreich hatte das Ackergift zuvor schon mit einem Bann belegt und ihm eine Gnadenfrist bis zum 24.10.18 eingeräumt.
Kommt das GAUCHO-Verbot?
Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide wie BAYERs Saatgutbehandlungsmittel GAUCHO (Wirkstoff: Imidacloprid) und PONCHO (Clothianidin) haben einen wesentlichen Anteil am weltweiten Bienensterben, weshalb die EU einige dieser Agrochemikalien schon mit einem vorläufigen Verkaufsbann für wichtige Kulturen belegt hat. Jetzt rückt die Entscheidung über ein endgültiges Verbot näher. Ende Februar 2018 nämlich legte die Europäische Behörde für Lebensmittel-Sicherheit (EFSA) ihre Risiko-Bewertung der Mittel vor und hielt fest: „Die meisten Anwendungen neonicotinoider Pestizide stellen ein Risiko für Wild- und Honigbienen dar.“ Die Stellungnahme des Leverkusener Multis dazu kam postwendend und fiel erwartungsgemäß aus: „BAYER ist mit den Ergebnissen der Risikobewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittel-Sicherheit (EFSA) für die Wirkstoffe Imidacloprid und Clothianidin grundsätzlich nicht einverstanden.“ Aber die EU-Kommission ließ sich davon nicht beirren und präsentierte dem Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel am 22.3.18 einen Vorschlag zum Stopp von GAUCHO & Co. Zu einer Abstimmung kam es jedoch nicht. Einige Länder sahen noch Diskussionsbedarf, darunter wohl auch Deutschland. Die Bundesregierung hat nämlich in dieser Sache keine eindeutige Position – trotz ihres Bekenntnisses aus dem Koalitionsvertrag: „Dabei liegt uns der Schutz der Bienen besonders am Herzen“. Wie schon im Fall von Glyphosat gehen zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsressort die Meinungen auseinander. Dabei hat nach Informationen des Web-Portals EURACTIV im Klöckner-Ministerium nicht zuletzt das Extrem-Lobbying der Zuckerrüben-Industrie meinungsbildend gewirkt, die auf Ausnahme-Regelungen für ihre Ackerfrucht pocht.
GAUCHO & Co.: Teilverbot greift nicht
Seit 2014 gilt innerhalb der Europäischen Union ein Teilverbot für bestimmte Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide. Brüssel hat den LandwirtInnen die Ausbringung der BAYER-Wirkstoffe Imidacloprid und Clothianidin sowie der SYNGENTA-Substanz Thiamethoxam auf bestimmten Kulturen untersagt. Das hatte jedoch kaum Auswirkungen auf die Neonicotinoid-Verkäufe insgesamt. Beliefen sich diese im Jahr vor der EU-Entscheidung auf 200 Tonnen, so stiegen die Zahlen zwölf Monate später auf 207 Tonnen an und erreichten 2015 noch 203 Tonnen. Die großzügigen Ausnahme-Regeln und ein ausreichendes Angebot an legalen Neonicotinoiden machen das möglich. Darum fordert die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN ein Komplett-Verbot dieser Substanzen für alle Anwendungen.
Kein Mittel gegen Citrus Greening
Gegen immer mehr Pflanzen-Krankheiten können die Pestizide von BAYER & Co. nichts mehr ausrichten. Und bei dem Versuch, Abhilfe zu schaffen, können und wollen die Konzerne sich auch nicht mehr allein auf die eigenen Forschungsabteilungen verlassen. Nicht zuletzt aus Kosten-Gründen kooperieren sie lieber mit öffentlichen Einrichtungen. So sucht BAYER etwa zusammen mit dem „Internationalen Forschungs- und Entwicklungsfonds“ (INREF) nach Mitteln gegen den aggressiven Pilz „Tropical Race 4“ (TH4), der Bananen befällt (Ticker 2/17). In Sachen „Citrus Greening“, eine vom Bakterium Candidatus liberibacter bei Zitronen und Orangen ausgelöste Grün-Färbung, arbeitet der Leverkusener Multi ebenfalls mit anderen Institutionen zusammen. Gemeinsam mit der „Citrus Research and Development Foundation“, die unter anderem von PEPSICO und COCA COLA Geld erhält, forscht er hier nach Lösungen.
Tröpfchenweise weniger Pestizide?
Mittlerweile räumt der Leverkusener Multi selber ein, dass die industriell betriebene Landwirtschaft der Umwelt schadet und obendrein enorme Mengen Wasser verbraucht. Der Konzern versucht sogar, Lösungen zu finden, „mit denen wir die Umwelt-Auswirkungen der Landwirtschaft weiter reduzieren und natürliche Ressourcen einsparen“. Und er glaubt auch schon, eine solche gefunden zu haben. Darum kooperiert der Global Player mit dem israelischen Unternehmen NETAFILM, das die „DripByDrip“-Technologie entwickelt hat. Mittels dieser gelangen die Pestizide Tropfen für Tropfen direkt zu den Pflanzen-Wurzeln, was BAYER zufolge die Ausbring-Mengen und den Wasser-Einsatz reduziert. Über das Versuchsstadium ist dieser Ansatz bisher allerdings nicht hinausgekommen.
Fungizid-Kooperation mit SUMITOMO
Der Leverkusener Multi will seine eigenen Mittel gegen Pilz-Krankheiten von Pflanzen mit einem neuen Produkt des japanischen Chemie-Unternehmens SUMITOMO CHEMICAL mischen und daraus ein Ackergift für Soja-Kulturen entwickeln. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten die beiden Konzerne im Sommer 2017.
Neues Insektizid für Grünflächen
Seit einiger Zeit nimmt BAYERs Sparte für Agro-Chemie in den USA den „ornamentals market“ stärker in den Blick und bietet gezielt Pestizide für den Einsatz in Gewächshäusern, Gartencentern und auf großen Grünflächen wie etwa Golf-Plätzen an. Nun hat der Leverkusener Multi mit ALTUS auch ein neues Insektizid für diese Anwendungen herausgebracht. Der Konzern selber bezeichnet den Wirkstoff Flupyradifuron als nicht bienen-gefährdend. Daran bestehen jedoch erhebliche Zweifel. Die Chemikalie gehört zwar nicht wie die wegen ihrer Bienenschädlichkeit von der EU mit einem vorläufigen Bann belegten BAYER-Substanzen Imidacloprid und Clothianidin zur Gruppe der Neonicotinoide, sie ähnelt diesen jedoch in ihrer Funktionsweise.
PFLANZEN & SAATEN
Zuckerrüben-Lizenz vergeben
BAYER hat im Jahr 2015 zusammen mit KWS eine Zuckerrüben-Art entwickelt, deren Erbgut eine natürliche und durch Züchtung verstärkte Enzym-Veränderung aufweist. Auf diese Weise übersteht die Labor-Frucht eine Behandlung mit solchen Anti-Unkrautmitteln, welche die Acetolactat-Synthese stören, unbeschadet. Allerdings überstehen auch immer mehr Wildpflanzen die Behandlung mit diesen so genannten ALS-Hemmern unbeschadet. Deshalb könnte die neue Rübe, wenn sie 2019 gemeinsam mit dem auf die Pflanze abgestimmten Herbizid CONVISO (Wirkstoffe: Foramsulfuron und Thiencarbazone-methyl) auf den Markt kommt, schon bald ziemlich alt aussehen. Nichtsdestotrotz gelang es BAYER und KWS, mit der belgischen Firma SESVANDERHAVE ins Geschäft zu kommen. Die beiden Unternehmen verkauften dem auf Zuckerrüben-Saatgut spezialisierten Betrieb eine Lizenz für das „CONVISO SMART“-Anbausystem. „Wir möchten so viele Züchter wie möglich für diese Technologie gewinnen. Wenn große Saatgut-Anbieter zusammenarbeiten, um diese Technologie voranzubringen, werden viele Landwirte von ihren Vorteilen profitieren können“, meint der Leverkusener Multi.
GENE & KLONE
Fragwürdige Soja-Zulassung
Ende 2017 hat die EU BAYERs Gen-Soja der Marke BALANCE eine Import-Genehmigung erteilt. Bei der Prüfung des Antrags hat Brüssel es allerdings nicht allzu genau genommen, wie Recherchen der Initiative TESTBIOTEST ergaben. Die Europäische Union erteilte der Labor-Frucht nämlich eine Einfuhr-Erlaubnis, obwohl der Leverkusener Multi die dafür erforderlichen Tests nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat. So setzte der Konzern bei den Versuchen mit der Soja, die gegen die Ackergifte Glyphosat, Glufosinat und Isoxaflutol resistent ist, nur ein Kilogramm Glyphosat pro Hektar statt der sonst in der Praxis üblichen vier bis acht Kilogramm ein. Zudem fand bloß eine einmalige Spritzung statt. In den KundInnen-Empfehlungen von BAYER und MONSANTO werden dagegen zwei bis drei Durchgänge vorgeschlagen. Überdies hat der Leverkusener Multi – angeachtet der vielen Hinweise auf Erkrankungen von Tieren nach dem Verzehr von Soja mit Glyphosat-Rückständen – keine Fütterungsstudien unternommen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) kritisierte die Entscheidung der Europäischen Union deshalb scharf. „In der Öffentlichkeit betont BAYER immer wieder die Ungefährlichkeit von Glyphosat, das die Krebsagentur der WHO als ‚wahrscheinlich krebserregend’ eingestuft hat. Bei seinen Testreihen traute das Unternehmen aber offenbar seinen eigenen Worten nicht und ging auf Nummer Sicher“, hieß es in ihrer Presseerklärung.
Moratorium für BAYERs Gen-Senf
2002 hatte BAYER erstmals versucht, in Indien die Genehmigung zum Anbau des gen-manipulierten Senfs DMH 11 zu erhalten. Aber die zuständige Behörde lehnte den Antrag ab. Die Feldversuche hätten, anders als vom Leverkusener Multi behauptet, keinen Nachweis über Ertragssteigerungen durch die Erbgut-Veränderung erbracht, lautete die Begründung. Mehr als zehn Jahre später starteten der Professor Deepak Pental und sein Team von der „University of Delhi“ einen erneuten Anlauf zur Zulassung der Pflanze, die gegen das vom Leverkusener Multi hergestellte, erbgut-schädigende Pestizid Glufosinat resistent ist. Als „BAYERs Trojanisches Pferd“ bezeichneten Zeitungen Pental daraufhin. Und die Gentechnik-Kritikerin Vandana Shiva verlangte vom indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi in einem Offenen Brief, auf eine Offenlegung aller Vereinbarungen des Genforschers mit BAYER und anderen Konzernen zu dringen. Auch andere AktivistInnen und Gruppen opponierten gegen DMH 11. Nicht zuletzt dieser öffentliche Druck hat das „Genetic Engineering Appraisal Committee“ (GEAC) schließlich dazu bewogen, vorerst kein grünes Licht für den Senf zu geben und stattdessen weitere Forschungsarbeiten anzumahnen.
WASSER, BODEN & LUFT
Spatenstich zur Dhünnaue-Öffnung
Am 11. Oktober 2017 hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zwei Klagen gegen die Erweiterung der Autobahn A1 und den Bau einer neuen Rhein-Brücke abgewiesen (Ticker 1/18). Damit machte es dem „Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen“ den Weg frei, im Rahmen der Bau-Maßnahmen BAYERs ehemalige Dhünnaue-Giftmülldeponie wieder zu öffnen. Der Spatenstich zu dem risiko-reichen Manöver erfolgte am 14.12.17 im Beisein des nordrhein-westfälischen Verkehrsministers Hendrik Wüst (CDU). An Ort und Stelle konnte der symbolische Akt allerdings nicht stattfinden, denn da standen schon DemonstrantInnen. Gezwungenermaßen erfolgte er deshalb in einem Zelt. Dieses war allerdings nicht schall-isoliert, weshalb ein Trillerpfeifen-Konzert und ein lauthals skandiertes „Kein Eingriff in die Deponie“ in die Ohren der geladenen Gäste drang und die feierlichen Reden draußen bleiben mussten.
BAYER entsorgt sich selbst
Dem Leverkusener Multi ist das Kunststück gelungen, mit seinem eigenen Müll ein Geschäft zu machen. Seine Tochter-Gesellschaft CURRENTA, an welcher der Konzern 60 Prozent der Anteile hält, sicherte sich nämlich den Auftrag, all das kontaminierte Erdreich zu entsorgen, das seit dem 14.12.17 bei der Öffnung seiner alten Dhünnaue-Deponie anfällt. An diesem Tag nämlich hat der „Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen“ trotz massiver Proteste der LeverkusenerInnen damit begonnen, im Zuge des Baus der neuen Rhein-Brücke und der Erweiterung der Autobahn A1 BAYERs Gift-Grab teilweise wieder auszuheben.
Dhünnaue-Experte warnt
Der Ingenieur, der jahrelang als Projekt-Leiter für die Abdichtung von BAYERs alter Dhünnaue-Deponie verantwortlich war, hat im Leverkusener Anzeiger eindringlich vor den Gefahren der Öffnung des Gift-Grabes im Zuge der Brücken- und Autobahnausbau-Arbeiten (s. o.) gewarnt. „Wenn Sie mich fragen: Sie sollen die Finger davon lassen“, rät der lieber anonym bleiben wollende Mann dem „Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen“. Er fürchtet, der Eingriff könne die hochkomplexe unterirdische Sicherheitsarchitektur aus Trenn- und Drainage-Schichten, Erde und Folien zerstören und die bösen Geister der toxischen Abfälle von Quecksilber über Arsen und Chrom bis hin zu Blei wieder zum Leben erwecken. Schon die Probe-Bohrungen zur Erkundung des Bodens hält der ehemalige Projekt-Leiter der Sanierung für ein riskantes Unternehmen. „Haben sie den Bohrer etwa einfach mit Gewalt durch die Folie hindurchgestoßen?“, fragt er alarmiert. Auch den Plan, die Bohrlöcher lediglich mit Ton-Granulat wieder zu verschließen, lehnt der Experte ab: „Aber einfach nur Ton genügte uns damals nicht als Dicht-Material.“ Aus all diesen Gründen schließt er sich der „Tunnel statt Stelze“-Fraktion an und meint: „Ein langer Tunnel unter dem Rhein wäre ein schönes Leuchtturm-Projekt für die Bau-Branche geworden.“
Kein Notfall-Plan
Die Öffnung von BAYERs alter Dhünnaue-Deponie im Zuge der Arbeiten an der neuen Rheinbrücke und an der Autobahn A1 ist mit vielen Risiken verbunden. Deshalb hat die im Leverkusener Rat vertretene Bürgerliste die Erstellung eines Notfall-Plans eingefordert. Das Stadt-Parlament lehnte dies aber ebenso ab wie die Bezirksregierung Köln. Das Gift-Grab falle nicht unter die Störfall-Verordnung, dekretierte letztere. „Somit ist aus Sicht der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr kein externer Notfallplan erforderlich“, antwortete die Behörde der Bürgerliste. Jetzt bleibt nur noch die Hoffnung, dass ein solches „Worst Case Scenario“ über den Gerichtsweg kommt, denn die Wählergemeinschaft hat in der Sache Klage bei der Staatsanwaltschaft Köln eingereicht.
RAG untersucht Bergleute auf PCB
Polychlorierte Biphenyle (PCB) gehören zu den giftigsten Hervorbringungen der Chlorchemie (SWB 1/14). Die vor allem von BAYER und MONSANTO in Umlauf gebrachten gefährlichen „Alleskönner“ kamen bis zu ihrem vollständigen Verbot 1989 in Elektrogeräten, Fugendichtungsmassen, Farben, Ölen, Lacken und Bodenbelägen zum Einsatz – und stellen immer noch ein beträchtliches Gesundheitsrisiko dar. Von den 1985 in der Bundesrepublik verkauften 72.000 Tonnen landete mehr als ein Sechstel im Bergbau, wo die schweren Gerätschaften viel Hydraulik-Öl brauchten. „Wir sind mit dem Zeug umgegangen, als wäre es Milch“, zitiert der Spiegel einen Bergmann. Dementsprechend leiden viele seiner KollegInnen heute an den Spätfolgen und zeigen Vergiftungssymptome wie Haut-, Nieren- und Leberschäden. Der Bergbau-Konzern RAG hat jetzt angekündigt, 200 Kumpel der Jahrgänge 1947 bis 1968 auf PCB-induzierte Krankheiten hin untersuchen zu lassen, wiegelte aber im gleichen Atemzug schon ab. Anlass zur Besorgnis wegen aufgetretener Erkrankungen gebe es bisher nicht, erklärte das Unternehmen wider besseren Wissens.
Neue Trinkwasser-Richtlinie der EU
Der Leverkusener Chemie-Multi trägt durch seine Herstellungsprozesse und viele seiner Produkte massiv zur Verschmutzung der Gewässer bei (siehe auch SWB 1/18). Einigen Substanzen droht jetzt die neue Trinkwasser-Richtlinie der Europäischen Union das Leben schwerer zu machen. So sieht der im Winter 2018 vorgelegte Entwurf schärfere Grenzwerte für Blei und Chrom vor. Zudem will Brüssel erstmals Kontrollen für Plastik-Teilchen und hormonell wirksame Stoffe wie BAYERs Industrie-Chemikalie Bisphenol A und den Arznei-Wirkstoff Beta-Estradiol (enthalten in ANGELIQ, einem Mittel gegen Wechseljahres-Beschwerden) vorschreiben. Da kommt also viel Lobby-Arbeit auf den Global Player zu.
GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV
Kein Bisphenol-Verbot in der EU
Viele Chemikalien enthalten Wirkstoffe, die in ihrem chemischen Aufbau Hormonen ähneln. Zu diesen endokrinen Disruptoren zählt im BAYER-Sortiment unter anderem Bisphenol A (BPA). Rund eine Millionen Tonnen dieses Stoffes, der z. B. in Lebensmittel-Verpackungen Verwendung findet, stellt der Leverkusener Multi jährlich her. Vom menschlichen Körper aufgenommen, kann das Bisphenol Fehlsteuerungen im Organismus auslösen und zu Schädigungen des Nervensystems, Übergewicht, Unfruchtbarkeit, Diabetes sowie Herz- und Lebererkrankungen führen. Die EU hat deshalb bereits die Verwendung in Babyflaschen untersagt. Zudem verkündete Brüssel für 2019 das BPA-Aus in Thermo-Papieren wie etwa Kassenzetteln und erließ schärfere Grenzwerte. Aber nach einer Expertise der Europäischen Chemikalien-Agentur gab es zusätzlichen Handlungsbedarf. Die ECHA stufte das Bisphenol A nämlich als „besonders besorgniserregende Substanz“ ein, die „ernsthafte Gesundheitsauswirkungen“ habe, wobei die Effekt „dauerhaft und irreversibel“ seien. Einige EU-ParlamentarierInnen wie der Grünen-Politiker Martin Häusling forderten deshalb ein Total-Verbot für Anwendungen im Nahrungsmittel-Bereich. Dazu kam es allerdings nicht. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte im Januar 2018 einem Vorschlag der EU-Kommission zu, die eine nochmalige Absenkung der Grenzwerte für Rückstände in Lebensmitteln um den Faktor 12 (von 0,6 Milligramm pro Kilogramm auf 0,05 Milligramm) vorsieht und den BPA-Bann auf Schnabel-Tassen für Kinder erweitert. Dem Extrem-Lobbying von BAYER & Co. in Brüssel ist es offenbar gelungen, das Schlimmste zu verhindern.
Bisphenol-Kombinationswirkungen
Die Gefährlichkeit der Chemikalie Bisphenol A (s. o.) kann sich potenzieren, wenn die Substanz in Kontakt mit anderen Stoffen kommt. Das ergab eine Studie von Pierre Gaudriault und anderen WissenschaftlerInnen, die in der Fach-Zeitschrift Environ Health Perspect erschienen ist. Demnach stört das Bisphenol den Testosteron-Stoffwechsel 10 Mal so stark, wenn es nicht allein, sondern in Kombination mit weiteren Substanzen wie etwa Pharma-Wirkstoffen oder Acker-Giften auftritt.
Neue EU-Richtlinie zum Arbeitsschutz
Die Europäische Union hat ihre „Richtlinie 2004/37/EG“ verändert, die den Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch krebserregende und erbgut-schädigende Stoffe regelt. Elf Substanzen bezog Brüssel zusätzlich in die Direktive ein und legte Belastungslimits für sie fest. Unter anderem handelt es sich dabei um Acrylamid, Hydrazin, Bromethylen und 1,3-Butadien. Für Vinylchlorid-Monomer und Hartholz-Stäube verschärfte die EU überdies die Grenzwerte. Neun Jahre hat es bis zur Verabschiedung der Regelung durch das Europäische Parlament gedauert – nicht zuletzt „dank“ der Interventionen von BAYER und anderen Unternehmen. Aber den LobbyistInnen der Konzerne gelang es nicht nur, den legislativen Prozess immer wieder zu verzögern, sie erreichten auch bedeutende Änderungen. So gelang es ihnen beispielsweise, die Neuaufnahmen zu begrenzen. Ursprünglich standen neben Acrylamid bis zu 49 weitere Stoffe auf der Liste. Die Strategie der Multis: Das Anzweifeln von Studien und der Verweis auf die EU-Maxime der „Better regulation“, die vorsieht, bei allen neuen Initiativen die Auswirkungen auf die Wirtschaft mit zu berücksichtigen. Allerdings könnte sich die Regelungszone der Richtlinie doch noch ausweiten. Es steht nämlich ein EU-Vorschlag zur Aufnahme von sieben weiteren Substanzen zur Diskussion.
PRODUKTION & SICHERHEIT
Mängel in der Pillen-Produktion
Bei einer Betriebsinspektion von BAYERs Leverkusener Pharma-Anlagen hat die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA gravierende Mängel festgestellt (siehe auch SWB 2/18), die ein Gesundheitsrisiko für die PatientInnen darstellen. Sowohl die Produktion von ADALAT als auch die von ASPIRIN CARDIO, AVELOX und LEVITRA beanstandeten die PrüferInnen. Von „signifikanten Verstößen gegen die gute Herstellungspraxis (CGMP)“ spricht die „Food and Drug Administration“. Unter anderem hat der Pillen-Riese verschiedene Medikamente in einem Raum gefertigt, ohne die benutzte Ausrüstung und die Arbeitsflächen nach den jeweiligen Durchläufen gründlich zu säubern, was zu Verunreinigungen von Medikamenten führte. Überdies kontrollierte der Multi der FDA zufolge die Stabilität der Zusammensetzung seiner Pharmazeutika nicht ausreichend. Die Mess-Geräte ließen ihrer Ansicht nach viel zu große Schwankungsbreiten zu. Die Apparaturen zur automatisierten Qualitätskontrolle stellte der Global Player ebenfalls so ein, dass sich der Ausschuss in Grenzen hielt. Zudem hat er nicht angemessen auf Probleme mit undichten Medikamenten-Packungen reagiert. „Ihre Firma hat es nicht geschafft, eine ordentlich arbeitende Qualitätskontrolle-Abteilung aufzubauen“, resümiert die FDA in ihrem „Warning Letter“. Nun muss der Pharma-Gigant die Fertigung umfassend neu organisieren, will er den Zugang zum US-Markt nicht verlieren. Ein normaler Betrieb ist in dieser Zeit nicht möglich, weshalb BAYER große finanzielle Einbußen erleidet. Die „Liefer-Ausfälle durch Korrektur-Maßnahmen in der Produktion“, wie der der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann das auf der Bilanz-Pressekonferenz im Februar 2018 ausdrückte, kosten das Unternehmen rund 300 Millionen Euro.
STANDORT & PRODUKTION
BAYER baut Standort Basel aus
Der Leverkusener Multi baut den Baseler Hauptsitz seiner Sparte „Consumer Health“ aus, in der er die Geschäfte mit den in den Apotheken ohne Rezept erhältlichen Pharmazeutika wie ASPIRIN, BEPANTHEN und ALKA-SELTZER bündelt, aus. 20 Millionen Franken investiert der Konzern am Standort. Zudem kündigte er die Schaffung von 100 Arbeitsplätzen an.
IMPERIUM & WELTMARKT
EU genehmigt MONSANTO-Deal
Am 21. März 2018 hat die Europäische Union BAYERs Antrag auf Übernahme von MONSANTO genehmigt. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) verurteilte diese Entscheidung auf Schärfste. „Mit ihrem Genehmigungsbescheid hat die EU ohne Not einem Oligopol im Landwirtschaftssektor mit BAYER an der Spitze ihren amtlichen Segen erteilt. Fortan trägt sie Mitverantwortung für die von dem Quartett verantworteten Geschäftspraktiken“, hieß es in ihrer Presseerklärung. Die von Brüssel gemachten Auflagen ändern an der neuen Markt-Macht des Leverkusener Multis kaum etwas. Auch mit den von der Generaldirektion Wettbewerb verlangten Verkäufen von Unternehmensteilen erreicht der Konzern im Pestizid-Bereich noch einen Markt-Anteil von mehr als 20 Prozent und beim konventionellen Saatgut einen Markt-Anteil von ca. 30 Prozent. Beim gen-manipulierten Saatgut beträgt dieser sogar 90 Prozent. Diese dominierende Stellung bedroht die Landwirtschaft, da die LandwirtInnen mit höheren Preisen rechnen müssen und überdies weniger Auswahl haben. Auch die VerbraucherInnen können beim Einkauf nicht mehr zwischen so vielen Sorten wählen, wenn der Leverkusener Multi mit seinem Vorhaben wirklich zum Ziel kommen sollte. Und der Mega-Deal hätte noch weitere Folgen. So sehen sich die Beschäftigten mit Arbeitsplatz-Vernichtungen durch die bei solchen Gelegenheiten immer viel beschworenen Synergie-Effekte konfrontiert. Und schließlich stehen den Standort-Städten im Fall des Falles finanzielle Einbußen ins Haus, denn BAYER pflegt seine Shopping-Touren immer von der Unternehmenssteuer abzusetzen. Bisher haben allerdings noch längst nicht alle Kartell-Behörden ihr Prüf-Ergebnis bekannt gegeben. Nicht zuletzt darum wird die CBG ihre Kampagne gegen das Milliarden-Geschäft mit unverminderter Kraft fortsetzen.
Pharma-Standort Russland
Im Jahr 2011 hat die russische Regierung eine „Pharma 2020“-Strategie entwickelt. Ziel des Programmes ist es, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu verbessern und die Entwicklung einer heimischen Pharma-Industrie voranzubringen. Von diesem Zeitpunkt an konnten die Global Player der Branche ihre Medikamente nur noch in dem Staat vertreiben, wenn sie dort auch selber produzierten und/oder sich vor Ort Partner suchten. Und das machte der Leverkusener Multi dann auch. „Lokale Fertigung ist ein strategischer Schritt vorwärts in der Entwicklung des Unternehmens, der BAYERs Unterstützung der ‚Pharma 2020’-Strategie bekräftigt“, verkündete der Russland-Chef des Konzerns, Niels Hessmann. So ging der Pillen-Riese etwa eine Partnerschaft mit MEDSINTEZ zur Fertigung des Antibiotikums AVELOX ein. Den umstrittenen Gerinnungshemmer XARELTO und seine Röntgenkontrast-Mittel GADOVIST, MAGNEVIST und ULTRAVIST stellt er mittlerweile in Kooperation mit POLYSAN her. Und Krebs-Mittel will die Aktien-Gesellschaft bald ebenfalls in dem Land selber zusammenbrauen.
ÖKONOMIE & PROFIT
BAYER verkauft COVESTRO-Aktien
Im Jahr 2015 gab BAYER die Trennung von seinem Kunststoff-Geschäft bekannt. Unter dem Namen COVESTRO brachte er es an die Börse. Seither reduzierte der Konzern seine Anteile an der ehemaligen Unternehmenssparte peu à peu. Der letzte Verkauf fand im Januar 2018 statt. Der Konzern veräußerte in jenem Monat weitere 10,4 Prozent der Papiere und strich dafür 1,8 Milliarden Euro ein. Momentan hält der Agro-Riese selbst noch 14,2 Prozent des COVESTRO-Kapitals und sein Pensionsfonds weitere 8,9 Prozent. Der Global Player will seine Aktien möglichst schnell losschlagen, weil er für die MONSANTO-Übernahme Geld braucht. Täte der Konzern dies nicht, könnte er nur schwer die Kreditwürdigkeit erhalten, weil die Rating-Agenturen seine Bonität herabstufen würden.
BAYSANTO & MONBAYER
Ernte-Ausfälle durch Dicamba
Das Ackergift Dicamba findet in den USA hauptsächlich in Kombination mit Genpflanzen von MONSANTO, BASF und DUPONT Verwendung, die gegen das Mittel resistent sind. Aber auch der Leverkusener Multi setzt auf die Agro-Chemikalie, die in den Vereinigten Staaten jetzt massive Ernte-Schäden verursacht hat. Sie bleibt nämlich nach dem Ausbringen nicht einfach an Ort und Stelle, sondern verflüchtigt sich. Und vom Winde verweht machte die Substanz sich auf die Reise von den gegen das Mittel resistenten Genpflanzen hin zu den konventionellen Ackerfrüchten, die nicht gegen den Stoff gewappnet waren und deshalb eingingen. Auf einer Fläche von 1,25 Millionen Hektar starben Pflanzen durch das Pestizid ab, das die Konzerne in Ermangelung neuer Herbizid-Wirkstoffe in ihren Labors wieder aus der Mottenkiste geholt hatten. Die Bundesstaaten Arkansas und Missouri verhängten deshalb Sprüh-Verbote. MONSANTO zog dagegen sofort – allerdings vergeblich – vor Gericht und landete in der Sache selber auf der Anklagebank: Geschädigte FarmerInnen reichten nämlich eine Sammelklage gegen das Unternehmen ein. Auch gegen BASF und DUPONT leiteten die Bauern und Bäuerinnen juristische Schritte ein.
RECHT & UNBILLIG
IBEROGAST: BAYER verklagt BfArM
Auch Medikamente auf pflanzlicher Basis wie BAYERs Magenmittel IBEROGAST, das 2013 mit dem Kauf von STEIGERWALD in die Produkt-Palette des Pharma-Riesen gelangte, können es in sich haben. So schädigt der IBEROGAST-Inhaltsstoff Schöllkraut die Leber. Arzneien mit einer hohen Schöllkraut-Konzentration hat das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) deshalb schon aus dem Verkehr gezogen. Vom Leverkusener Multi verlangte es, diese Nebenwirkung auf dem Beipackzettel zu vermerken. Der Konzern lehnte es aber ab, dieser Aufforderung nachzukommen. Für ihn ist die „hohe Sicherheit“ des Präparates „durch eigene Daten vollständig belegt“. Darum zeigt er sich auch nicht bereit, den Widerspruch zurückzunehmen, den STEIGERWALD vor zehn Jahren gegen die Anordnung eingelegt hatte. Und selbst nach dem Scheitern dieses Widerspruchs zeigt das Unternehmen keine Einsicht. „Das Nutzen/Risiko-Profil zu IBEROGAST bleibt unverändert positiv“, behauptet der Global Player in schon aus unzähligen Hauptversammlungen bekannten Worten – und ließ Taten folgen. Er klagte gegen den Stufenplan-Bescheid des BfArMs zur Änderung der Packungsbeilage. Dabei käme das Präparat auch ohne Schöllkraut aus, worauf unlängst der Pharmakologe Gerd Glaeske mit Verweis zwei Studien (Rösch et al. 2002; Madisch et al. 2004) hinwies. Die Weigerung des Pillen-Riesen, vor den möglichen Leberschäden zu warnen, stieß auf massive Kritik. „Dass der Hersteller BAYER das nicht in seine Packungsbeilage aufnimmt und auf seinem Internet-Auftritt im Zusammenhang mit der Einnahme von IBEROGAST während der Schwangerschaft die angeblich ‚gute Verträglichkeit’ des ‚rein pflanzlichen’ Arzneimittels betont, ist ein Skandal!“, meinte etwa die Gesundheitspolitikerin Kordula Schulz-Asche von Bündnis 90/Die Grünen.
XARELTO-Urteil aufgehoben
BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO mit dem Wirkstoff Rivaroxaban hat gefährliche Nebenwirkungen – im Jahr 2016 gingen allein beim „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) 117 Meldungen über Todesfälle ein. In den USA ziehen deshalb immer mehr Geschädigte bzw. deren Hinterbliebene vor Gericht. Mittlerweile liegen dort 20.500 Klagen vor (Stand: Oktober 2017), und auch in Kanada bahnen sich juristische Auseinandersetzungen an. Nachdem der Leverkusener Multi die ersten vier Prozesse für sich entscheiden konnte, verlor er im Dezember 2017 den fünften. Der „Philadelphia State Court“ gab einer Frau recht, die reklamierte, durch XARELTO schwerwiegende Blutungen erlitten zu haben, und verurteilte den Pharma-Riesen zu einer Strafzahlung in Höhe von 28 Millionen Dollar. Der Konzern ging allerdings in Berufung und konnte sich durchsetzen: Im Januar 2018 hob ein Richter das Urteil wieder auf.
Patent-Streit mit DOW
Bereits seit Langem tobt zwischen dem Leverkusener Multi und DOW CHEMICAL ein Rechtsstreit um bestimmte Gentechnik-Patente. Im Jahr 1992 hatte eine inzwischen vom US-Unternehmen geschluckte Firma vom bundesdeutschen Konzern das Recht erworben, Pflanzen mit Resistenz-Genen gegen das BAYER-Pestizid Glufosinat bestücken zu dürfen. 2007 dann stellte DOW der Firma MS Technologies Sublizenzen zur Nutzung der fünf Patente aus. 2012 ging BAYER dagegen gerichtlich vor und kündigte die Vereinbarung mit der US-amerikanischen Aktien-Gesellschaft. Der bundesdeutsche Agro-Riese brachte den Fall vor das Schiedsgericht der Internationalen Handelskammer (ICC) und bekam 455 Millionen Dollar zugesprochen. DOW CHEMICAL focht das Urteil vor heimischen Gerichten an, scheiterte aber bisher schon dreimal. Zuletzt lehnte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, der U.S. Supreme Court, die Klage des Agro-Riesen ab.
Patent-Streit mit TEVA
Der Leverkusener Multi gehen routinemäßig gegen Pharma-Hersteller vor, die nach Ablauf der Patent-Frist von BAYER-Pillen erschwinglichere Nachahmer-Produkte auf den Markt bringen wollen. So hofft der Konzern sich die lästige Billig-Konkurrenz möglichst lange vom Leibe halten zu können. Deshalb leitete er auch gegen das Unternehmen TEVA, das eine Generika-Version von STAXYN – der Schmelztabletten-Form der Potenz-Pille LEVITRA – vorbereitet, juristische Schritte wegen Verletzung des geistigen Eigentums ein. Der TEVA-Anwalt William Jay bezeichnete dieses Vorgehen als den „Standard-Versuch eines Pharmazeutika-Herstellers, um die Patentlaufzeit eines profitablen Marken-Produkts zu verlängern“. Die RichterInnen sahen das offenbar ähnlich: Sie wiesen die Klage des bundesdeutschen Global Players ab.
Kritik an STIVARGA-Patent
Erhalten die Konzerne für neue Pharmazeutika ein Patent, so garantiert ihnen das eine Monopol-Stellung und entsprechende Extra-Profite. Andere Firmen dürfen so lange nicht mit dem entsprechenden Wirkstoff experimentieren, bis die Schutzrechte abgelaufen sind. Das behindert den wissenschaftlichen Fortschritt immens. Genau das kritisierte jetzt Dr. David Tran von dem Biotech-Startup FUSTIBAL. Die Firma arbeitet an der Weiterentwicklung gängiger Krebs-Mittel etwa durch die Nano-Technologie und hätte das gerne auch mit BAYERs STIVARGA getan. Aber zu diesem Präparat bleibt der Firma der Zugang versperrt. BAYER kann auf dessen Wirk-Substanz Regorafenib nämlich noch geistiges Eigentum reklamieren, obwohl diese nur ein einziges kleines Fluor-Atom von dem Inhaltsstoff NEXAVARs – dem anderen Tumor-Therapeutikum des Leverkusener Multis – unterscheidet. „Wir glauben, dass das in Rede stehende Patent ungültig ist und den Forschungsgeist behindert“, sagt Tran. Deshalb beantragte er beim „Patent Trial and Appeal Board“ (PTAB) eine Überprüfung des Anspruchs. Dieses Begehr hat das Gremium jedoch abgelehnt.