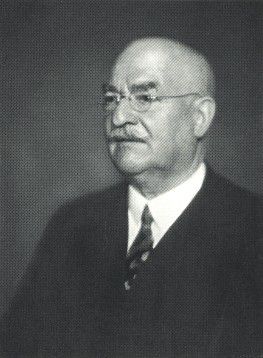Plusminus (ARD), 21. Januar 2015
Medikamente
Teure neue Arzneien nicht ohne Risiko
Beitrag hier ansehen
Noch heute wird sie wütend, wenn sie ihre Krankenhausakten ansieht und sie weiß immer noch nicht, wie viel Blut sie damals verloren hat. Der Schreck sitzt Sorika Creß auch jetzt noch in den Knochen.
»Das Blut lief wie Wasser weiter. Und das ganze Bettlaken war dann durchgeblutet und die Schwester war ja unterwegs, den Arzt zu verständigen. Und dieses Warten auf den Arzt, da hatte ich schon das Gefühl, wenn er nicht bald kommt, dann verblute ich jetzt. Und das ganze Bett, das Bad, da sah es aus wie im Schlachthaus.«
Nach einer Krampfaderoperation bekommt Sorika Creß ein Mittel zur Blutverdünnung: Xarelto. Es soll das Entstehen eines Blutgerinnsels verhindern. Erst später stellt sie fest, dass auch Blutungen als Nebenwirkungen auftreten können.
Das Medikament Xarelto, produziert von Bayer, gehört zu einer neuen Generation von Blutverdünnern - neben Pradaxa von Boehringer Ingelheim und Eliquis von Bristol Myers Squibb. Alle drei werden vor allem auch zur Vorbeugung gegen Schlaganfälle eingesetzt. Bislang nehmen die Patienten dafür einen anderen Wirkstoff, am bekanntesten ist das Mittel Marcumar. Doch dabei muss regelmäßig Blut abgenommen werden, um die Wirkung zu kontrollieren. Bei den neuen Präparaten sei dies nicht nötig.
Ein wichtiges Werbeargument der Hersteller: »Bei Pradaxa ist es nicht erforderlich, die Blutgerinnung regelmäßig zu prüfen. Es ist auch nicht erforderlich, die Dosis immer wieder anzupassen.«
Um den Milliardenmarkt der Blutverdünner ist ein heftiger Kampf entbrannt. Bislang war die Therapie günstig, denn für die alten Mittel ist der Patentschutz längst abgelaufen. Eine Jahrestherapie damit kostet gerade mal um die 60 Euro. Die neuen Medikamente sind 20 Mal teurer, ein gigantischer Kostenschub für die Krankenkassen.
Und die Verschreibungszahlen steigen: Bei Pradaxa um rund 80, bei Xarelto sogar um mehr als 200 Prozent. Experten wie Prof. Wolf-Dieter Ludwig sind der Meinung, die neuen Mittel sollten nur in bestimmten Fällen eingesetzt werden, etwa wenn die alten nicht vertragen werden.
Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft: »Es ist sicherlich so, dass die Schwelle, diese Blutverdünner einzusetzen natürlich viel niedriger ist als bei Marcumar. Man braucht keine Tests. Man kann das Medikament einnehmen, ohne dass der Patient regelmäßig zum Arzt geht. Dabei werden aber natürlich die Risiken übersehen.«
Auch die Hausärztin Sigrid Süßmeyer setzt anfangs auf die neuen Mittel. Auf Fortbildungen hört sie, die Präparate seien neuer Standard. Xarelto-Patient Ludwig Schlichtherle hätte es beinahe nicht überlebt.
Dr. Sigrid Süßmeyer, Fachärztin für Innere Medizin: »Sie sind in die Notaufnahme gekommen und sind dann in der Notaufnahme kollabiert. Und dann sind alle zusammengelaufen. Das wissen Sie alles gar nicht mehr. Und haben dann letztendlich drei Blutkonserven bekommen.«
Ludwig Schlichtherle: »Ich habe nichts mehr mitgekriegt, was man gemacht hat.« Dr. Sigrid Süßmeyer, Fachärztin für Innere Medizin: »Sie wären ein Stunde später tot gewesen.«
Blutungen können auch bei den alten Blutverdünnern wie Marcumar auftreten. Allerdings gibt es hier ein wirksames Gegenmittel, anders als bei den neuen Präparaten. Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft: »Da wir kein Gegenmittel haben, ist es dann möglicherweise sogar mit schwerwiegenden Komplikationen verbunden. Und ich denke, dass wir langfristig, wenn wir weitere Daten haben, aus sogenannten Registern, also Langzeitbeobachtungen unter Alltagsbedingungen, möglicherweise sehen werden, dass Blutungsrisiko möglicherweise höher ist oder gleich wie bei den älteren Blutverdünnern.«
Im Jahr 2014 sind beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte mehr als 2.600 Verdachtsmeldungen über unerwünschte Nebenwirkungen bei den neuen Blutverdünnern eingegangen, darunter 244 Todesfälle.
Allerdings: Ein Kausalzusammenhang sei nicht sicher belegt. Darauf verweisen auch die Hersteller. Bayer zum Beispiel teilt uns auf Anfrage mit: »Das Sicherheitsprofil von Xarelto wird von Bayer kontinuierlich überprüft, denn Patientensicherheit hat bei Bayer höchste Priorität.«
Bei Sigrid Süßmeyer ist Ludwig Schlichtherle nicht der einzige Patient, der Probleme bekam. Der schlimmste Fall war der eines 86-jährigen Mannes. Dr. Sigrid Süßmeyer, Fachärztin für Innere Medizin: »Die Polizei öffnet die Türe und findet dann den Mann im ersten Stock. Das war ganz schlimm: Eine riesen Blutspur die Treppe rauf hat man da gesehen. Dann im ersten Stock war das Telefon am Bett. Und da war auch alles voller Blut. Und er lag vor dem Telefon in einer Blutlache. Alle Hilfe war zu spät.«
Die Hersteller verweisen darauf, dass die neuen Produkte in ihren Studien zu weniger schweren Blutungen führen als die herkömmlichen. Doch wie sieht es bei der Anwendung im Alltag aus? Prof. Gerd Glaeske hat die Nebenwirkungen bei Versicherten einer Krankenkasse ausgewertet. Die bislang unveröffentlichte Studie zeigt Alarmierendes: Prof. Gerd Glaeske, Arzneimittelexperte Universität Bremen: »Das sieht nicht mehr so besonders günstig für die neuen Mittel aus. Das heißt, wir haben durchaus höhere Risiken von Blutungen in ganz bestimmten Bereichen, die bei den neuen Mitteln gegenüber den bewährten Mitteln häufiger auftreten, zwischen 6 Prozent und 12 Prozent.«
Erst jetzt, Jahre nach der Markteinführung, sollen Gegenmittel angeboten werden. Boehringer etwa will laut eigener Aussage die Zulassung noch dieses Halbjahr beantragen. Doch warum warten die Ärzte nicht ab und verschreiben weiterhin massenhaft die neuen Mittel?
Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft: »Ich persönlich denke, dass das Marketing eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ich habe selten eine derartige Kampagne gesehen, wie bei diesen neuen Blutverdünnern. Es gibt eine Vielzahl von Artikeln in gekauften Zeitschriften der Industrie. Es gibt Meinungsführer, die ziemlich skrupellos diese neuen Medikamente propagieren, obwohl es dafür keinen klaren Grund derzeit gibt und es gibt Fortbildungsveranstaltungen, in denen so genannte Meinungsführer mit Interessenkonflikten auftreten und durch ihre Aussagen ganz wesentlich ein unkritisches Verordnungsverhalten fördern.«
Dr. Sigrid Süßmeyer, Fachärztin für Innere Medizin: »Bei 14 Patienten habe ich dann Schluss gemacht. Da haben neun geblutet davon, vier schwer, einer war tot. Und da sind genau fünf Patienten übrig geblieben, die keine Komplikationen hatten. Und dann habe ich gesagt: Dieses Medikament wird bei mir ausrangiert. Seitdem verwende ich es nicht mehr und erlebe halt bei den Kollegen diese Blutungen, die das noch verwenden.«
Sie verordnet jetzt wieder herkömmliche Mittel. Damit hat sie gute Erfahrungen gemacht. Wichtig ist, dass Patienten die neuen Blutverdünner nicht einfach ohne ärztliche Begleitung absetzen. Denn das könnte lebensbedrohlich sein.
Plusminus-Hinweis: Wenn Sie Blutverdünner einnehmen und Fragen haben, handeln Sie nicht eigenmächtig, sondern gehen Sie zunächst zum Arzt und lassen sich von ihm beraten.
weitere Infos zu Xarelto