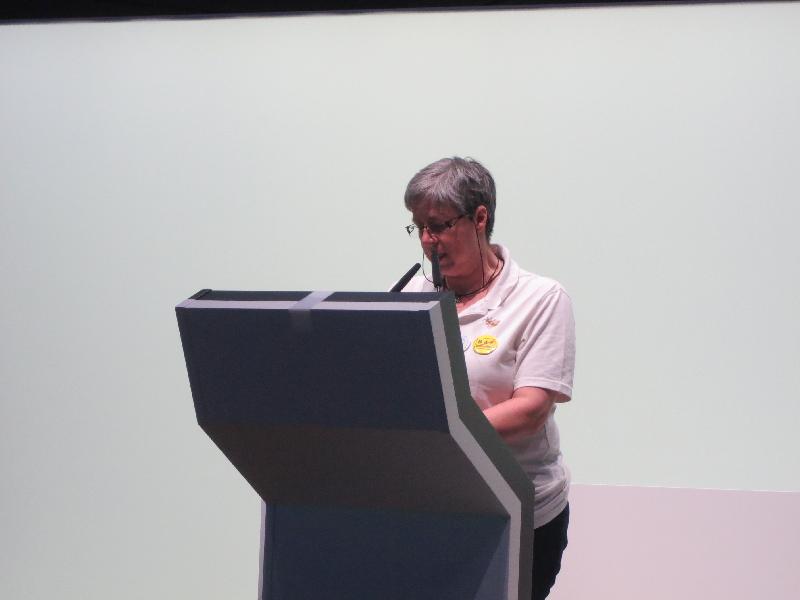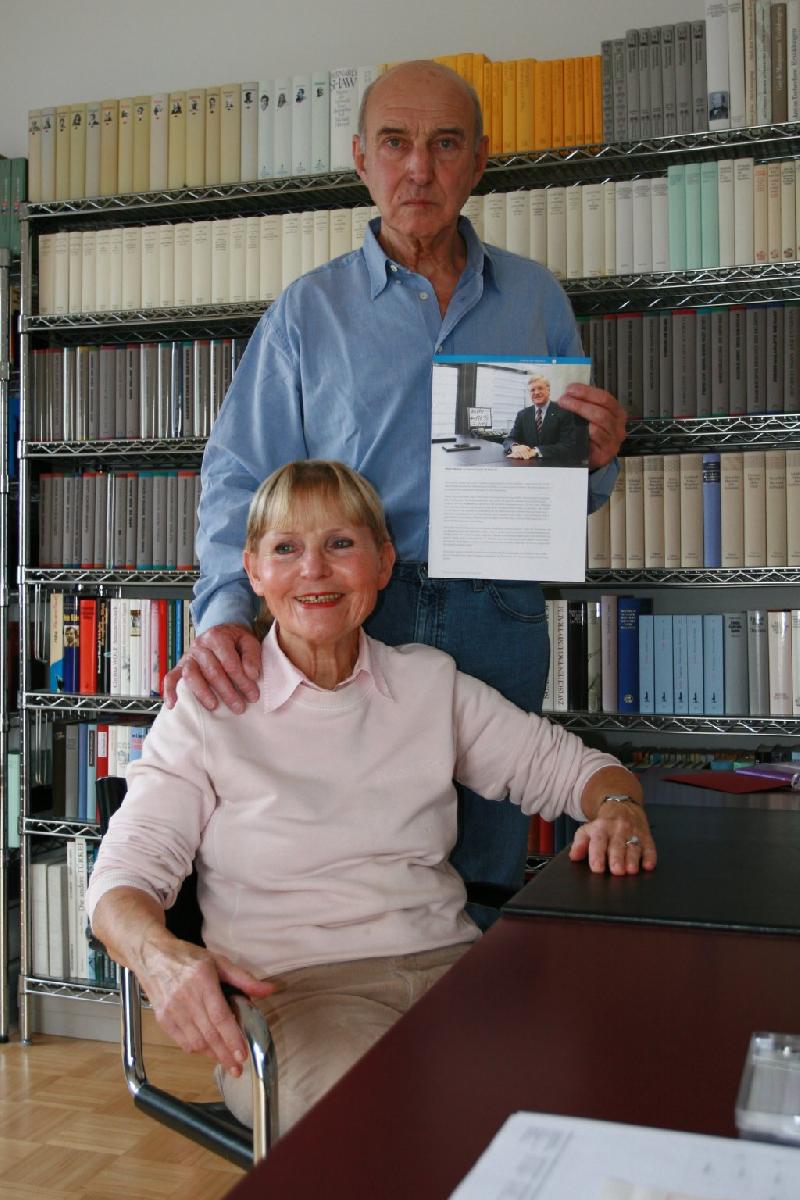Der vollständige Briefwechsel zwischen Herbert Heitmann (BAYER) und Coordination gegen BAYER-Gefahren
Vorstellung
Date: 09.12.2013
Sehr geehrte Damen und Herren der CBG,
mein Name ist Herbert Heitmann und ich bin seit dem 1.9.2013 für die weltweite Kommunikation, die Beziehungen zu Regierungen und Nicht-Regierungsorganisationen sowie die Unternehmensmarke der Bayer AG zuständig. Mit Interesse habe ich ihre Webseiten und Publikationen gelesen und würde mich gerne mit Ihnen austauschen. Dabei ist mir besonders daran gelegen, zu erfahren, was ihre Ziele sind und ob bzw. wie wir gegebenenfalls zusammenarbeiten können. Wenn ihrerseits an einem solchen Gespräch Interesse besteht, würde ich mich über einen Terminvorschlag freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Herbert Heitmann
Corporate Communications, Brand & Government Relations
Re: Vorstellung
Date: 28.01.2014
Sehr geehrter Herr Heitmann,
>> Mit Interesse habe ich ihre Webseiten und Publikationen gelesen und würde mich gerne mit Ihnen austauschen
soso, Sie finden also unsere Arbeit interessant..... ;)
Es ehrt uns, dass wir Gegenstand einer ihrer ersten Amtshandlungen geworden sind.
Doch Spaß beiseite. Natürlich stehen wir für Gespräche zu Verfügung. Daran hat sich nie etwas geändert, nachdem 1979 der erste - im WDR ausgestrahlte - Austausch dazu führte, dass die Firma BAYER den öffentlichen Diskurs mit uns einstellte und seitdem nur noch über Dritte mit uns kommuniziert.
Allerdings führen wir keine Kamin- und Hinterzimmergespräche. Das Wirken von BAYER steht im Fokus des öffentlichen Interesses. Deshalb werden wir Gespräche stets aufzeichnen, unsere Vertreter frei besetzen und einen Journalisten unserer Wahl mitbringen. Alternativ wäre für uns auch eine Podiumsdiskussion denkbar.
Die Teilnehmerzahl sollte paritätisch sein. Auch sollten wir vorab zwei oder drei Sachthemen festlegen. Zum Beispiel könnten die Bereiche Antibabypillen, CO-Pipeline, Emissionen von Treibhausgasen, das BAYER-Jubiläum oder auch der Umgang Ihres Unternehmens mit KritikerInnen gewählt werden.
Direkte Gespräche - so wie Sie es vorschlagen - machen nur Sinn, wenn auf der Seite von BAYER Sach- und Entscheidungskompetenz am Tisch sitzt und vorher abgeklärt wird, welche Konsequenzen ein Gespräch hat. Wieso sollten wir z. B. über das Thrombose-Risiko von Antibabypillen sprechen, wenn für den Vorstand sowieso feststeht, dass an den Produkten aus der Yasmin-Reihe festgehalten wird? Auch sollten wir für das Gespräch einen Zeitrahmen festlegen und einen neutralen Treffpunkt wählen.
Mit freundlichen Grüßen,
Axel Köhler-Schnura
Philipp Mimkes
Jan Pehrke
Uwe Friedrich
Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG)
AW: Re: Vorstellung
Date: 02.02.2014
Sehr geehrte Herren,
Vielen Dank für ihre Antwort. Ich interessiere mich in erster Linie für ihre Motivation. Wollen Sie helfen, Bayer besser zu machen oder reicht es ihnen, Bayer schlecht zu machen. Mein Auftrag ist es, die Kommunikation von Bayer weiter zu verbessern und dazu gehört als erster Schritt, die verschiedenen Interessengruppen kennenzulernen und ihnen zuzuhören, sie zu verstehen. Im zweiten Schritt geht es dann darum, die oftmals bestehende Lücke zwischen interner und externer Wahrnehmung und Wirklichkeit zu schließen. Dazu bediene auch ich mich dann gerne der Unterstützung von Experten. In meinem ersten Gesprächsangebot ging es mir allerdings um das Kennenlernen und da ich in Sachen Kommunikation auch eine Art „Experte“ bin, könnten wir hier sogar beim ersten Treffen auch in „medias res“ gehen. Und da ich zu dem stehe, was ich sage, gibt es auch keinen Grund, dies im Stillen oder Geheimen zu tun, weshalb sie zu einem solchen ersten Kennenlernen gerne andere hinzuladen können und das Gespräch auch aufzeichnen können. Allerdings lasse ich mich nicht gerne vor den Karren anderer spannen und mir auch nicht das Wort im Munde umdrehen, weshalb ich, wenn aufgezeichnet wird, Wert darauf lege, dass das gesamte Gespräch zugänglich ist und nicht nur Auszüge. Nach wie vor denke ich, ein erstes Kennenlernen, so wie ich es mit Journalisten, Politikern und NGO-Vertretern gemacht habe, um weitere Aktivitäten zu sondieren und vorzubesprechen, macht Sinn.
Mit freundlichen Grüßen
Herbert Heitmann
AW: Re: Vorstellung
Date: 07.03.2014
Sehr geehrter Herr Heitmann,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Als Termin schlagen wir Mittwoch, den 14. Mai von 16 – 18 Uhr vor. Für dieses Datum haben wir einen neutralen Ort reserviert, den „Säulenraum“ in der Alten Feuerwache (Südtrakt), Melchiorstr. 3 in Köln. Wie bereits besprochen, werden wir das Gespräch aufzeichnen und einige Journalisten mitbringen.
Gerne werden wir im Gespräch die Positionen und Forderungen unseres Netzwerks erläutern. Von Ihnen würden wir gerne erfahren, was BAYER zu tun gedenkt, um Frauen vor den Risiken von Antibaby-Pillen der Yasmin-Reihe zu schützen. Auch interessiert uns, wie Ihr Unternehmen einen sachlichen und konstruktiven Umgang mit Kritiker/innen gewährleisten will. Wir gehen davon aus, dass die Diskussion über Sachfragen den Schwerpunkt des Gesprächs bilden wird. Für das Kennenlernen im Rahmen der Vorstellungsrunde sollten 20 Minuten ausreichen. Persönliche Motivationen werden wir nicht diskutieren.
Zurückweisen möchten wir die Unterstellung, unser Ziel könnte es sein, „BAYER schlecht zu machen“. Für negative Schlagzeilen aufgrund von Umweltschäden oder gefährlichen Produkten – oftmals mit Schäden für die menschliche Gesundheit oder gar tödlichen Folgen – sind nicht wir verantwortlich. Uns interessiert zu erfahren, was Sie unternehmen, um gegebene Probleme abzustellen.
Wir bitten um eine kurze Bestätigung des Termins.
Mit freundlichen Grüßen,
Philipp Mimkes
Axel Köhler-Schnura
Jan Pehrke
Uwe Friedrich
Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG)
AW: Re: Vorstellung
Date: 28.03.2014
Sehr geehrte Herren,
entschuldigen Sie meine späte Antwort. Ich freue mich über den Terminvorschlag, doch möchte ich bei unserem ersten Gespräch auf die Begleitung durch Journalisten auf Ihrer wie meiner Seite verzichten. Der Aufzeichnung des Gesprächs steht nichts im Wege, wenn wir uns darauf verständigen, diese Aufzeichnung nicht zu schneiden, sondern wenn, dann als Ganzes zu verwenden. Der Grund für diese Einschränkungen liegt in meiner persönlichen Erfahrung mit dem ersten Mail-Austausch und der aus der Weiterleitung entstandenen Medienresonanz. Dies ist für mich keine PR-Aktion und ich habe sie auch nicht publik gemacht! Schlagzeilen wie „Glasnost bei Bayer“ oder „Ende des Kalten Kriegs“ als Resultat einer einfachen Vorstellungsmail mit persönlichem Gesprächsangebot sind einfach vollkommen überzogen. Lassen Sie uns erst die Inhalte schaffen, bevor wir dem Ganzen bombastische Überschriften verschaffen. Ich möchte ein Gespräch mit Ihnen, dass nicht auf Zitate und Schlagzeilen abzielt, sondern uns Gelegenheit gibt, bei der Diskussion von Sachthemen, einander näher kennenzulernen. Da unser erstes Treffen nun nach der Hauptversammlung stattfindet, hätte das auch den Vorteil, dass zu vielen ihrer Fragen, Sie ja dann die Antworten bereits kennen und wir das nicht wiederholen müssen.
Wenn wir fünf uns also am 14.05.2014 (mit Rekorder) im Säulenraum der Feuerwache treffen können und mit den Inhalten wie besprochen umgehen können, dann sage ich den Termin gerne zu.
Schönes Wochenende
Herbert Heitmann
Re: AW: Vorstellung
Date: 11.04.2014
Sehr geehrter Herr Heitmann,
vielen Dank für Ihre Nachricht. Weiterhin sind wir gerne bereit, im persönlichen Austausch die Positionen unseres Netzwerks zu erläutern.
Auch wir betrachten das Treffen nicht als PR-Termin. Da aber die Geschäftstätigkeit von BAYER Auswirkungen für die Allgemeinheit hat, ist Transparenz für uns unabdingbar. Insofern gelten für uns weiterhin die im ersten Schreiben genannten Voraussetzungen, wonach wir das Gespräch aufzeichnen (und gerne nur ungeschnitten weitergeben), unsere Vertreter frei bestimmen und Journalisten unserer Wahl mitbringen. Diese Kriterien wurden von unserer Mitgliederversammlung schon in den 80er Jahren beschlossen, weswegen sie für uns bindend sind. Die Voraussetzungen entsprechen der Praxis vieler NGOs im Umgang mit Konzernen, und Sie hatten diese in Ihrem Schreiben vom 2. Februar ja auch bestätigt.
Insofern halten wir uns den Termin am 14. Mai weiterhin frei. Über eine Rückmeldung würden wir uns freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
Jan Pehrke
Axel Köhler-Schnura
Philipp Mimkes
Uwe Friedrich
Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG)
eine Antwort stand bis zum 14. Mai aus, weswegen das Treffen nicht zustande kam