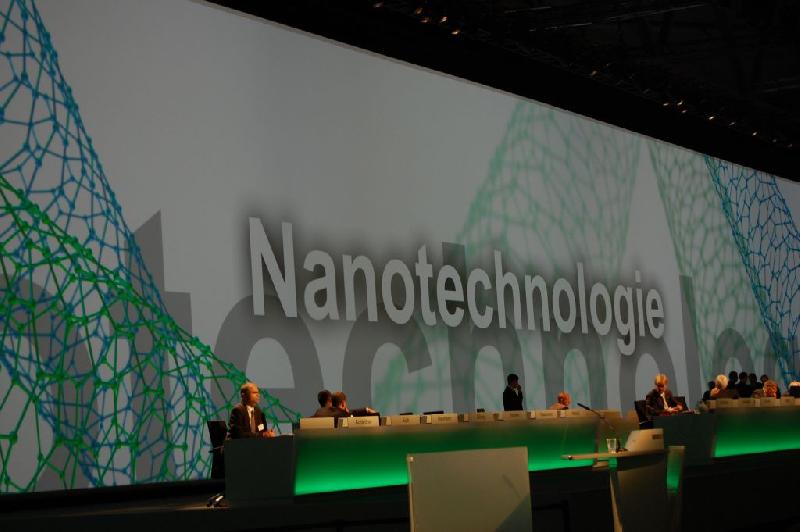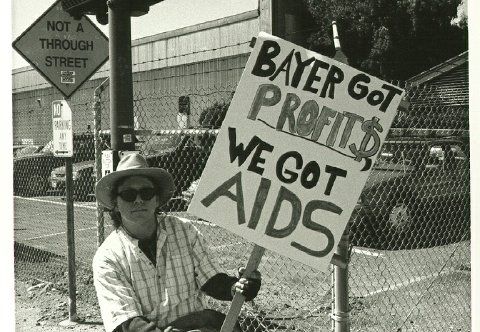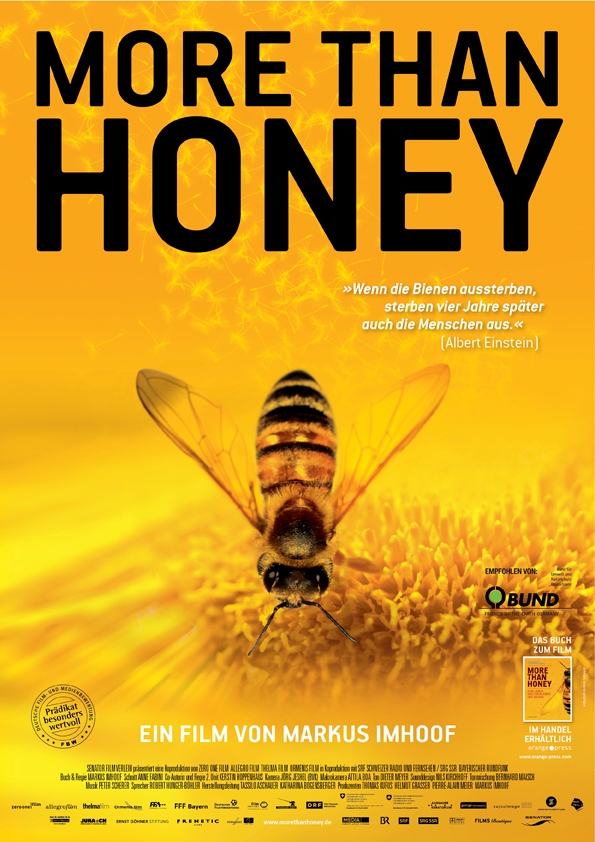Carl Duisberg, der ehem. BAYER-Generaldirektor, war verantwortlich für den Einsatz von Giftgas, die Verschleppung von Zwangsarbeitern und den Verkauf von Heroin als Hustenmittel (siehe Kampagne). Offensichtlich war er zudem für mehrere Verkehrsunfälle mit Todesfolge verantwortlich:
Leverkusener Anzeiger, 11. Juni 2013
Ein rechthaberischer Herrenfahrer
Wenn Carl Duisberg, der ehemalige Geheimrat des Bayer-Werkes, auf der Straße war, konnte es gefährlich werden. Das Archiv verzeichnete in der Akte „Verkehrsunfälle“ zwei Tote und einen Schwerverletzten. Von Thomas Käding
Leverkusen - Wer glaubt, dass es zu Duisbergs Zeiten langsam und gemütlich zuging, vertiefe sich in die Aufzeichnungen aus dem Werksarchiv. Der Geheimrat war fraglos ein sehr geachteter Mann. Aber man wusste auch, dass mit dem Vorstandschef nicht zu spaßen war. Weder im Werk („Der erste machte Alarm“), noch außerhalb.
Dass Duisberg über ein gelegentlich aufbrausendes Naturell verfügte, legt auch die Akte „Verkehrsunfälle“ nahe, die Werner Plumpe ausgewertet hat. Der Frankfurter Historiker arbeitet sich seit Jahren durch das Bayer-Archiv und kommt in dieser Sache zu dem Ergebnis: „Das Strafregister Duisbergs ist nicht lang, aber erheblich.“ Bei Unfällen mit den Limousinen, in denen sich der Geheimrat chauffieren ließ, starben zwei Menschen, einer wurde schwer verletzt. Über den Ausgang der Gerichtsverfahren gegen Duisbergs Fahrer schweigen die Akten. Dokumentiert ist aber, dass man mit dem Geheimrat an Bord oft viel zu schnell unterwegs war. Gegen Bußgeldbescheide sei Duisberg mit großer Energie vorgegangen, schreibt Plumpe und nennt ein harmloses Beispiel: eine Bußgeldandrohung der Hildener Polizei vom 12. Januar 1907 über drei Mark, weil an Duisbergs Limousine eine mehrtönige Hupe angebracht sei. Der Geheimrat antwortet natürlich nicht den Ordnungshütern, sondern schreibt gleich an den Hildener Bürgermeister.
In dem Brief leugnet er, eine vorschriftswidrige Hupe an seinem Auto zu haben – er könne das beurteilen, da sie oft genug benutzt werde. Überhaupt gibt Autofahrer Duisberg die verfolgte Unschuld: Die Polizei trete „bekanntlich den Automobilen in unnachsichtiger Weise entgegen“, beklagt sich das Mitglied des Kaiserlichen Automobilclubs zu Berlin. Mehrfach wehrte sich der Manager gegen den Vorwurf, zu schnell unterwegs gewesen zu sein. Orte durften seinerzeit nur in einer Geschwindigkeit passiert werden, die einem „mäßigen Trab“ entsprachen. Ob die stetigen Auseinandersetzungen mit der Polizei eher einem Hang zur Rechthaberei entsprangen, oder ob einer der bestbezahlten Industriemanager jener Zeit einfach nur geizig war, ist schwer zu beurteilen. Plumpe neigt der Knickerigkeits-Hypothese zu: So fetzte sich CD mit der Polizei, die ihm fünf Mark wegen des Befahrens einer gesperrten Straße abknöpfen wollte. Dorthin aber habe Duisberg seinen Fahrer nur dirigiert, weil er eine Brückenmaut von 20 Pfennig sparen wollte. „Selbst Park- und Halteverbote konnten Duisberg erheblich erzürnen“, schließt Plumpe aus dem Studium der Akten.
Und dann war da noch die Sache mit dem toten Hund: Am 22. Oktober 1912 ließen sich Carl Duisberg, seine Frau Johanna, Tochter Hildegard und Hausdame Minna Sonntag vom Chauffeur Hartung von Leverkusen nach Elberfeld fahren. Kurz hinter Haan überholte Hartung ein Pferdefuhrwerk der Brennerei Hoppenhaus, als ein Hund vor den Wagen sprang. Das Tier wurde überrollt, Hartung fuhr einfach weiter.
Die Hundebesitzer von der Brennerei reagierten mit einer saftigen Forderung: Duisberg sollte 150 Mark Schadenersatz bezahlen – das war ungefähr der Monatslohn eines Facharbeiters. Wenn nicht, gehe die Sache vor Gericht. „Bei Duisberg war man freilich mit einer derartigen Drohung an den Richtigen geraten“, schreibt Plumpe. Der Geheimrat dachte natürlich gar nicht daran, einfach so zu zahlen. Vor dem Amtsgericht Mettmann wurde drei Tage lang verhandelt – samt Zeugenaussagen, Sachverständigengutachten, und so fort. Duisbergs Chauffeur wurde neben zu schnellen Fahrens vorgeworfen, nicht ausreichend gehupt und somit den Tod des Hundes befördert zu haben: Das Tier verfügte über eine Polizeiausbildung und hätte auf das Hupen sofort reagiert, hieß es im Prozess.
Das Gericht sah es schließlich anders: Die Klage wurde abgewiesen. Der wehrhafte Automobilist Carl Duisberg war mal wieder davon gekommen.