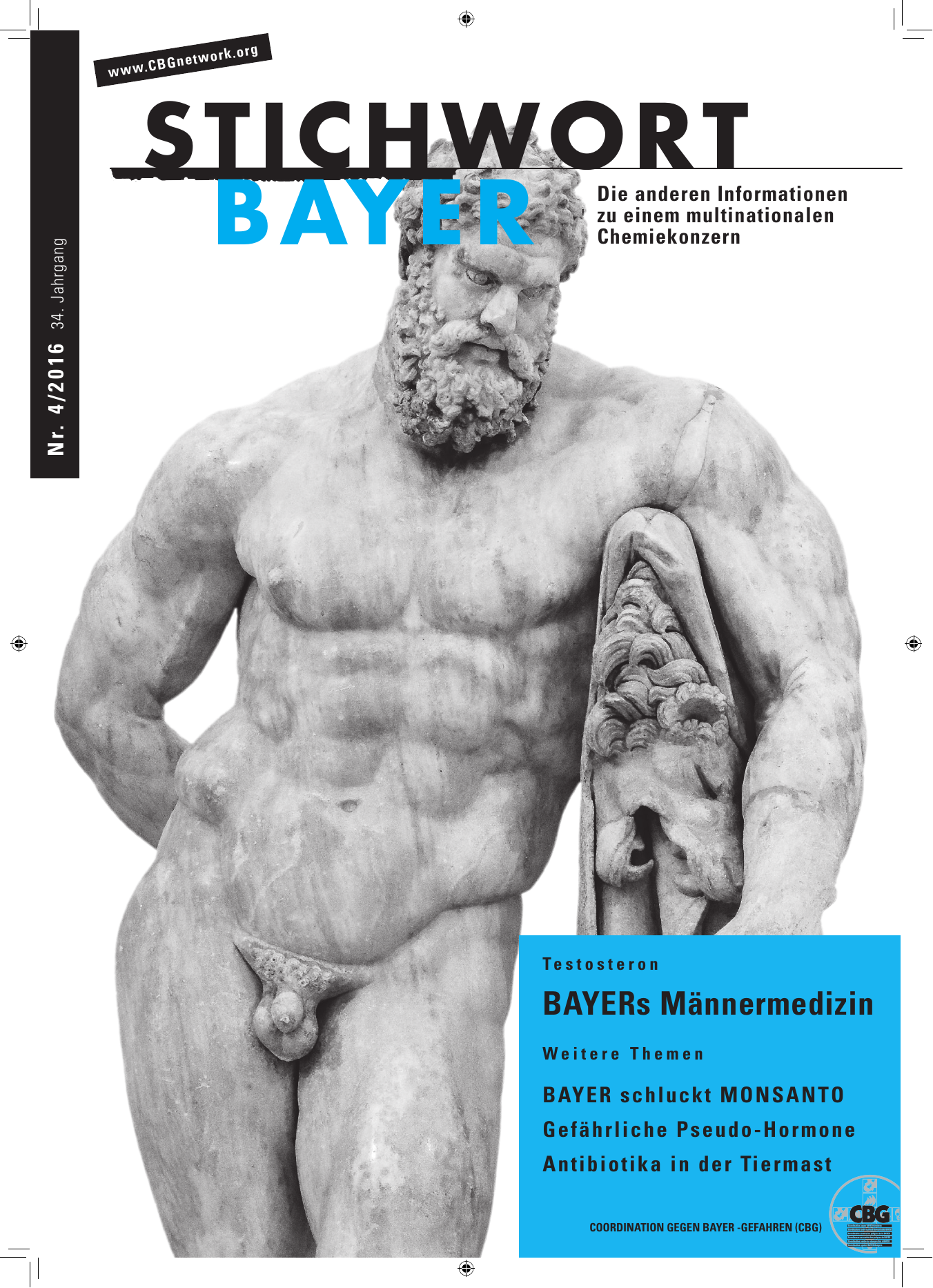Veröffentliche Beiträge in “SWB 04/2016”
Politik & Einfluss
Hormon-ähnliche Chemikalien von BAYER & Co.
Eine globale Bedrohung
Chemikalien haben viele gesundheitsgefährdende Eigenschaften. Eine der unheimlichsten: Manche Substanzen wirken ähnlich wie bestimmte körpereigene Stoffe und können damit den menschlichen Organismus gehörig durcheinanderwirbeln. So gleichen bestimmte Pestizide, Weichmacher oder andere Produkte wie etwa Bisphenol A in ihrem chemischen Aufbau Hormonen. Krebs, Diabetes, Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit und andere Gesundheitsstörungen beschreiben MedizinerInnen als mögliche Folge. Darum will die EU die VerbraucherInnen besser vor diesen Produkten von BAYER & Co. schützen. Aber die Konzerne torpedieren dies nach Kräften. Ein Lehrstück in Sachen „Lobby-Arbeit“.
Von Jan Pehrke
Hormone sind die Botenstoffe des Körpers. Sie erfüllen damit eine wichtige Aufgabe in seinem Regulationssystem. Die biochemischen Substanzen steuern beispielsweise das Knochenwachstum, den Zucker- und Fettstoffwechsel, die Verdauung und die Sexualentwicklung. Stört nun etwas die Signal-Übertragung, so kommen falsche Botschaften an, was die Abläufe gehörig durcheinanderwirbelt. Und als solche „Störer“ – sogenannte endokrine Disruptoren (EDCs) – hat die Wissenschaft seit einiger Zeit bestimmte Chemikalien ausgemacht. Viele dieser Substanzen gleichen in ihrem Aufbau nämlich Hormonen und haben deshalb ein beträchtliches Irritationspotenzial. Die mögliche Folge: Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Fettleibigkeit, Dysfunktionen des Nerven- und Immunsystems sowie Herz-, Leber- und Gebärmutter-Leiden.
BAYER hat eine ganze Menge dieser Stoffe im Angebot. Und manche davon, wie etwa das Antiraupen-Mittel RUNNER, sollen sogar hormonelle Effekte entfalten. Es zählt nämlich zu den Insekten-Wachstumsregulatoren, die der europäische Lobbyverband der Agro-Riesen, die „European Crop Protection Association“ (ECPA), wie folgt beschreibt: „Pheromone und Insekten-Wachstumsregulatoren werden im Pflanzenschutz speziell wegen ihrer Wirkungsweise als endokrine Disruptoren eingesetzt, um den Fortpflanzungsprozess zu stören oder den Lebenszyklus der Insekten zu verkürzen.“
Bei anderen Agro-Giften des Konzerns fällt die Beeinträchtigung des Hormonsystems hingegen eher in die Rubrik „Risiken und Nebenwirkungen“. Dies ist auch bei den anderen Substanzen mit hormon-ähnlichen Eigenschaften aus der Produktpalette des Global Players der Fall, wie z. B. bei Weichmachern oder der Industrie-Chemikalie Bisphenol A, von welcher der der Pharma-Riese allein im Jahr 2011 rund 1,2 Millionen Tonnen herstellte.
Bereits seit den 1990er Jahren warnen WissenschaftlerInnen vor den Gefahren, die durch endokrine Disruptoren drohen. Die Politik blieb jedoch lange untätig. Die Europäische Union brachte 1999 zwar eine „Strategie für Umwelthormone“ auf den Weg, erkannte aber erst in der Dekade nach dem Jahrtausendwechsel Handlungsbedarf, wie die französische Publizistin Stéphane Horel in ihrem Buch „Intoxication“ ausführt. Im Rahmen der Neuordnung der Pestizid-Zulassungen nahm die EU 2009 auch die hormonelle Wirkung der Ackergifte ins Visier. Das Europäische Parlament sprach sich dabei für ein Verbot dieser Substanzen aus. Zu einer entsprechenden Regelung in der „Verordnung 1107/2009“ kam es damals jedoch nicht. Diese sollte erst per Nachtrag erfolgen, wenn die Europäische Kommission genaue Kriterien zur Bestimmung der EDCs entwickelt hatte. Bis Ende 2013 gab das EU-Parlament ihr dafür Zeit.
Mit der Detailarbeit betraute die Kommission dann – vorerst – die „General-Direktion Umwelt“. Diese beauftragte zunächst eine Gruppe von WissenschaftlerInnen mit einer Untersuchung zum Forschungsstand in Sachen „hormon-ähnliche Chemikalien“. Anfang 2012 lag der Report „State of the Art Assessment of Endocrine Disrupters“ schließlich vor. Er bescheinigte den Stoffen einmal mehr gesundheitsschädigende Eigenschaften. Diese „rechtfertigen es, die endokrinen Disruptoren als ebenso besorgniserregende Substanzen anzusehen wie krebserregende, erbgutschädigende und reproduktionstoxische Produkte“, hält die Studie fest. Die ForscherInnen schlugen deshalb vor, eine eigene Kategorie für RUNNER & Co. zu schaffen und diese auch nicht wie andere potenziell gefährliche Hervorbringungen der Industrie nach der Wirkstärke zu beurteilen. Dieses Kriterium erlaubt den WissenschaftlerInnen zufolge nämlich keine Rückschlüsse auf das von den EDCs ausgehende Gesundheitsrisiko. Die Dosis macht das Gift – eben das trifft auf die endokrinen Disruptoren nicht zu, weshalb nach Meinung der AutorInnen auch Grenzwerte nicht vor deren Gefahren schützen. Der an der Expertise beteiligte Toxikologe Dr. Andreas Kortenkamp hatte das schon 2002 in einem Experiment nachgewiesen. Er mischte Polychlorierte Biphenyle (PCB), wie sie BAYER bis zu ihrem Verbot im Jahr 1989 massenhaft produzierte, Bisphenol A und sechs weitere Chemikalien zusammen, die für sich genommen nicht östrogen wirken. Er erhielt ein überraschendes Ergebnis. „0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 8“ lautete das Resultat. Also das glatte Gegenteil eines Nullsummenspiels. „Etwas, das aus dem Nichts entsteht“, fasste Kortenkamp den beunruhigenden Befund zusammen. „Schädliche chemische Stoffe in Produkten des täglichen Bedarfs müssen verboten werden. Die Gesundheit steht über dem wirtschaftlichen Interesse“, forderte der Toxikologe deshalb später in einem Zeitungsartikel.
Die unter seiner Federführung entstandene Untersuchung für die General-Direktion Umwelt alarmierte die Industrie und trieb sie zu einer beispiellosen Lobby-Offensive, in der BAYER eine Hauptrolle einnahm. Zudem machten noch zahlreiche große Organisationen Druck. So setzte die CEFIC, der europäische Verband der Chemie-Industrie, die endokrinen Disruptoren ganz oben auf ihre Liste mit den „Lobbying-Schlüsselthemen“. Und die CEFIC kann sich diesem Schlüsselthema mit einiger Macht widmen: Sie ist mit ihren 29.000 Mitgliedsfirmen die größte europäische Unternehmensvereinigung, hat in Brüssel 150 Beschäftigte und verfügt über einen Jahresetat von 40 Millionen Euro. Damit nicht genug, opponierten noch weitere Verbände der Konzerne gegen allzu weitreichende Regulierungspläne. Zu ihnen zählten etwa die ECPA, der Zusammenschluss der europäischen Pestizid-Hersteller, dessen US-amerikanisches Pendant „Croplife“, das „American Chemistry Council“ und „Plastic Europe“ mit Patrick Thomas an der Spitze, dem Chef der BAYER-Tochter COVESTRO.
Zunächst heuerten BAYER & Co. willige WissenschaftlerInnen an, um Zweifel am Kortenkamp-Report zu säen.
Der vom „American Chemistry Council“ bestellte und bezahlte Text erschien dann Ende Mai 2012 in der Fachzeitschrift Criticial Reviews in Toxicology. Schon ein Blick auf die deklarierten Interessenskonflikte genügt, um sich eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Kritik, die sich hauptsächlich auf Fragen der Methodik konzentriert, zu ersparen. Alle sechs Autoren verfügten nämlich über beste Verbindungen zu den Multis. Sie arbeiteten beispielsweise als Berater für die BASF oder das „American Chemistry Council“ und veröffentlichten in Tateinheit mit ForscherInnen von BAYER, DUPONT oder MONSANTO Artikel.
Einen ersten Zwischenerfolg erzielten die Konzerne schon bald darauf. Hatten die Unternehmen schon länger daran gearbeitet, den Einfluss der General-Direktion Umwelt zu begrenzen und industrie-freundlicheren EU-Organisationen mehr Gewicht in dem Prozess zukommen zu lassen, so konnten sie im Oktober 2012 einen Etappen-Sieg erringen. Die Europäische Kommission übertrug der „Europäischen Behörde für Lebensmittel-Sicherheit“ (EFSA) die Aufgabe, ein wissenschaftliches Gutachten zur Identifizierung und zur Bewertung der endokrinen Disruptoren zu verfassen. Und die Agentur, deren MitarbeiterInnen mehr als einmal mit ihren Beziehungen zur Wirtschaft in die Schlagzeilen geraten waren, versuchte ihrem schlechten Ruf bereits von Anfang an gerecht zu werden: In der von ihr berufenen Arbeitsgruppe befanden sich nämlich überhaupt keine Hormon-SpezialistInnen. Das Ergebnis fiel entsprechend aus: „EDCs können wie alle anderen den Menschen und die Umwelt gefährdenden Substanzen behandelt werden.“ Eine Beurteilung nicht einzig nach dem Gefahren-Potenzial, sondern überdies nach dem üblichen Kriterium der Wahl, dem Risiko-Potenzial, schlug die EFSA deshalb vor.
Endokrine Disruptoren fallen für die Agentur also nicht aus dem Rahmen dessen, was sonst so an schädlichen Chemikalien aufläuft. Der Umgang mit diesen kann nach Ansicht der EFSA daher auch weitgehend in dem bisherigen Rahmen stattfinden. Das war natürlich ganz im Sinne der Industrie. Besonders die Zurückweisung des Gefahren-Ansatzes als einzigem Maßstab zur Beurteilung der EDCs fand ihren Gefallen. Eine Prüfung der Stoffe auf Grundlage der „Gefahr“ unterscheidet sich nämlich maßgeblich von einer solchen auf der Grundlage des „Risikos“. Eine Bewertung anhand der Gefahr nimmt allein die Eigenschaften des Produkts in den Blick, eine anhand des Risikos berücksichtigt indes das Ausmaß, in dem Mensch, Tier und Umwelt der Chemikalie ausgesetzt sind. Während die Gefahr einer Substanz also immer absolut gilt und keine Grenzen kennt, ist das Risiko immer relativ. Es ist unter anderem von der Wirkstärke abhängig. Und als Maß der Dinge kommt so der Grenzwert ins Spiel, der das Höchstmaß der Belastbarkeit anzeigt. Solche Limits träfen auf die – zähneknirschende – Zustimmung von BAYER & Co., erlaubten diese ihnen doch zumindest, ihre Waren, wenn auch mit mehr oder weniger großen Beschränkungen, auf dem Markt zu halten. Das gelänge bei einer Inventur unter der Maßgabe der Gefahr nicht. Danach müssten etwa alle als EDCs identifizierte Acker-Gifte mit einem Verbot rechnen.
Genau dies legte der Kortenkamp-Report 2012 ganz im Sinne der Pestizid-Richtlinie von 2009 nahe, indem er den endokrinen Disruptoren einen Sonderstatus zuschrieb und das Prinzip der Wirkstärke als Richtschnur für die Bewertung ablehnte. Kein Wunder also, dass die EFSA exakt das jetzt zur Disposition stellte. Und die Behörde tat dies wider besseren Wissens, war sie doch kurz vor dem Veröffentlichungsdatum noch drauf und dran, alles zu revidieren. Dass zwei UN-Organisationen den Stand der Wissenschaft so ganz anders wiedergegeben hatten als sie selber und von den endokrinen Disruptoren als einer „globalen Bedrohung“ sprachen, hatte sie nämlich ins Zweifeln gebracht. „Ich denke, dass wir unseren Bericht (...) leider umarbeiten müssen, damit er besser reflektiert, was der Rest der Welt denkt“, e-mailte ein Mitglied der Arbeitsgruppe aufgestört. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der EFSA schlug indessen vor, wenigstens das Kapitel „Schlussfolgerungen“ zu ändern. Aber am Ende blieb doch alles, wie es war.
Die GD Umwelt hatte also allen Grund, an ihrem umfassenderen Schutz-Ansatz festzuhalten. Das allerdings rief BAYER auf den Plan. Der Leverkusener Multi gelangte vorzeitig in den Besitz des entsprechenden Papiers der GD Umwelt – ein Vertrauter bei der Kommission hatte es dem Chemie-Verband CEFIC durchgesteckt – und setzte im Juni 2013 einen Brief an die stellvertretende Generalsekretärin der EU-Kommission, Marianne Klingbeil, auf. „Die DG ENV (= GD Umwelt, Anm. SWB) favorisiert gegenwärtig ein Konzept, welches durchgängig auf der Basis des Vorsorge-Prinzips konstruiert worden ist (Hazard assessment). Dies bedeutet eine fundamentale Abkehr von den Prinzipien der Risiko-Bewertung und wird in Konsequenz weitreichende, gravierende Auswirkungen auf die Chemie-Branche und Agrar-Industrie (vor allem wegen der bei Pflanzenschutzmitteln angewandten Cut-off-Kriterien, die einen Verlust der Zulassung bedingen), nach sich ziehen“, zeigte sich der Pharma-Riese alarmiert. Mehr als 37 Pestizide sieht er von einem Verbot bedroht. Allein der Bann der Antipilz-Mittel aus der Gruppe der Triazole, zu denen etwa die BAYER-Produkte PROVOST OPTI, FOLICUR und NATIVO gehören, würde zu einem Produktivitätsrückgang von 20 Prozent und zu Ernte-Verlusten bis zu 40 Prozent führen, rechnet der Konzern unter Bezugnahme auf zwei Studien vor. Mit Verweis auf die EU-Maxime der „Better regulation“ fordert er die Kommission deshalb auf, bei ihrer Entscheidung über die endokrinen Disruptoren die Auswirkungen auf die Wirtschaft mit zu berücksichtigen und ein sogenanntes Impact Assessment durchzuführen.
Und Brüssel erhörte die Signale: Statt wie vorgesehen 2013 die Kriterien zur Beurteilung der EDCs vorzulegen, kündigte die EU-Kommission erst einmal eine ökonomische Folgeabschätzung an. Der Leverkusener Multi gab sich damit aber nicht zufrieden. Hatte er bereits vor dem Brief an Marianne Klingbeil gemeinsam mit BASF und SYNGENTA ein Scheiben an die EU verfasst und sich darin besorgt gezeigt, die Kriterien zur Bestimmung der endokrinen Disruptoren könnten ihren „komplett sicheren“ Pestiziden den Garaus machen, so setzte er zusammen mit mehreren anderen Konzernen Mitte Oktober 2013 erneut ein Schriftstück auf. Darin gingen die Absender das Vorsorge-Prinzip von einer anderen Seite her an. Sie wollten es nun durch ein „Innovationsprinzip“ ergänzt wissen. Ein Gleichgewicht zwischen Gesundheitsschutz und Innovationsförderung sollte Brüssel nach Meinung der Vorstandschefs anstreben, denn: „Innovationen sind per definitionem mit Risiken verbunden.“
Damit endeten die Lobby-Aktivitäten von BAYER & Co. aber noch bei Weitem nicht. So brachte der willige Wissenschaftler Daniel Dietrich, der immer wieder gern gemeinsam mit den ForscherInnen von BAYER, DOW oder ASTRAZENECA Studien publiziert, in der Fachzeitschrift Toxicology Letters einen höhnischen Artikel über die mit den endokrinen Disruptoren verbundenen Ängste unter. Darin deklarierte er forsch die den EDCs zugeschriebenen Fruchtbarkeitsschädigungen wie etwa die Minderung der Samen-Qualität zu Symptomen einer männlichen Hysterie. „Man kann sich fragen, ob das ganze Thema ‚EDCs’ nicht eher in die Kompetenz von Dr. Sigmund Freud fällt als in die der Toxikologie“, meinten Dietrich und seine Co-Autoren. Auf kaum höherem Niveau argumentierten die Konzerne und ihre Lobby-Organisationen.
Die CEFIC etwa griff in ihren zahlreichen Eingaben zum Standard-Argument der Industrie und bestritt den Kausal-Zusammenhang zwischen Substanz und Nebenwirkungen. Stattdessen führte die Organisation andere mögliche Ursachen ins Feld, wie Umwelteinflüsse und Lebensführung. Zudem erklärte sie die Symptome für reversibel. Allen Ernstes führte sie dafür in einem Schreiben an die EU Horror-Filme als Beispiel an. Diese riefen auch hormonelle Reaktionen des Körpers hervor, allerdings klängen diese bald wieder ab, so die CEFIC.
BAYER versuchte darüber hinaus noch, die LandwirtInnen gegen eine allzu weitreichende Regulation der endokrinen Disruptoren zu mobilisieren. Der Leverkusener Multi entwarf ein Horror-Szenario von Ernte-Verlusten durch bald nicht mehr erhältliche Pestizide und rief die FarmerInnen dazu auf, sich an den Konsultationen Brüssels zu den EDCs zu beteiligen. Darüber hinaus ließ der Global Player seine Beziehungen spielen, um direkt mit Karl Falkenberg, dem Leiter der GD Umwelt, ins Gespräch zu kommen. Der heute beim Berliner „Global Forum for Food and Agriculture“ tätige Eckart Guth bat seinen früheren EU-Kollegen Falkenberg, den BAYER-Manager Franz Eversheim zu empfangen. „Lieber Karl, ich schreibe dir, um dich zu bitten, Herrn (Name in dem EU-Dokument geschwärzt, Anm. SWB) zu treffen, den Leiter Public and Government Affairs Europa von BAYER CROPSCIENCE. Wir haben vor einiger Zeit beim Bier nach dem Tennis über das zur Diskussion stehende Thema gesprochen. Aber ich fürchte, es ist zu ernst, um es dabei belassen zu können. Darum würde ich dir vorschlagen, Herrn (geschwärzt, Anm. SWB) zu treffen, den ich in institutionellen Angelegenheiten berate“, hieß es in dem Schreiben. Das zur Diskussion stehende Thema waren die Kriterien zur Bestimmung der endokrinen Disruptoren. Ob es dann wirklich zu dem angeregten Tête-à-Tête gekommen ist, das vermochte Stéphane Horel nicht herauszubekommen. Dennoch zeigt das Dokument sehr gut, wie Lobbyarbeit in Brüssel funktioniert.
Im Jahr 2013 brachten es BAYER & Co. allein in der zweiten Juni-Hälfte auf sechs Treffen mit EU-Offiziellen; rund 30 Mails der Industrie liefen in diesem Zeitraum auf. Sogar den Profi-AntichambrierInnen von der ECPA begann das alles über den Kopf zu wachsen. Der Druck von Seiten der Mitgliedsfirmen sei „enorm“, schütteten sie Peter Korytar von der GD Umwelt ihr Herz aus. Dazu kam noch Unterstützung aus Übersee. „Croplife America“, der US-Verband der Pestizid-Produzenten, und das „American Chemistry Council“ übten Druck auf die EU-Repräsentanz in Washington aus, weil sie sich Sorgen um ihre Agrogift-Exporte machten. Darum setzten sie die Pläne der EU in Sachen „endokrine Disruptoren“ auch auf die Agenda der TTIP-Verhandlungen. Als mögliches Handelshemmnis und ein konkretes Beispiel für Reform-Bedarf bei der Regulierungszusammenarbeit galten diese den US-amerikanischen Verbänden.
All das ließ die EU-Kommission nicht ungerührt. Sie entzog schließlich der GD Umwelt endgültig die Verantwortung in diesem Prozess und verschleppte die Arbeit zur Bestimmung der EDC-Kriterien immer mehr. So sehr, dass dem Mitgliedsland Schweden schließlich der Kragen platzte. Der nordeuropäische Staat verklagte die Kommission wegen Untätigkeit und bekam im März 2016 auch Recht zugesprochen.
Nun mussten Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und seine Mannschaft endgültig liefern. Und Mitte Juni taten sie es schließlich: Die Europäische Kommission unterrichtete das Europäische Parlament und den Europäischen Rat „über endokrine Disruptoren und die Entwürfe der Kommissionsrechtsakte zur Festlegung der wissenschaftlichen Kritierien für ihre Bestimmung im Kontext der EU-Rechtsvorschriften über Pflanzenschutzmittel und Biozid-Produkte“.
Bei der Definition der EDCs verzichtet die Kommission auf die umstrittenen Kategorie der Wirkstärke. Sie greift zur Freude von BAYER & Co. „wohl aber bei der Bewertung des tatsächlichen Risikos, das von endokrinen Disruptoren ausgeht“, auf diese zurück. Und noch eines weiteren „Aber“ bedient sich Junckers Riege: Sie will die Verbotsanordnungen zwar grundsätzlich auf der Grundlage des Gefahren-Ansatzes verhängen und nicht dem Risiko-Relativismus frönen, der sich am dem Maß der EDC-Dröhnung orientiert. Allein: „Es gibt jedoch einige begrenzte Ausnahmen“. Zu diesen zählt die Kommission ein vernachlässigbares Risiko, eine vernachlässigbare Exposition, sozio-ökonomische Gründe und ernste Gefährdungen der Pflanzengesundheit. Eine ganz schön große Auswahl für die Konzerne – da hatte das die wirtschaftlichen Folgen der EDC-Regulierung abschätzende „Impact Assessment“ seine Wirkung offensichtlich nicht verfehlt.
Dementsprechend hart fiel das Urteil von Seiten der Umweltverbände und der Fachwelt aus. „Das Vorsorge-Prinzip wird durch die Vorschläge mit Füßen getreten“, konstatiert etwa das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK (PAN). Hätte ursprünglich der Beleg einer hormon-schädlichen Eigenschaft für eine Regulierung ausgereicht, so müsse nun die Relevanz eines schädlichen Effekts beim Menschen tatsächlich nachgewiesen sein“, moniert die Initiative. Zudem kritisiert PAN die Erweiterung der Ausnahmebestimmungen für hormon-aktive Pestizide, die jetzt im Umlauf bleiben dürfen, wenn sie eine bestimmte Schwelle nicht überschreiten. Als „ganz im Sinne der Pestizid- und Chemie-Industrie“ und „Vorboten von CETA und TTIP“ bezeichnet die PAN-Aktivistin Susanne Smolka die Vorschläge der EU. Die Wissenschaftsvereinigung „Endocrine Society“ lehnt den vorgelegten Entwurf ebenfalls ab. „In Bezug auf die endokrinen Disruptoren noch strengere wissenschaftliche Maßstäbe anzulegen als in Bezug auf die Karzinogene, für die sie schon sehr streng sind, wäre ein Schritt in die falsche Richtung“, so Rémy Slama. Auch das Umweltbundesamt zeigt sich enttäuscht: „Damit verlässt die EU den gefahren-basierten Ansatz, den wir fordern.“ Während bundesdeutsche PolitikerInnen sich mit Kommentaren zurückhielten, bezeichnete die französische Umweltministerin Ségolène Royal die Vorlage aus Brüssel als „extrem enttäuschend“. Gemeinsam mit ihren KollegInnen aus Schweden und Dänemark setzte sie deshalb einen Brief an Jean-Claude Juncker auf, der ein generelles Verbot von endokrinen Disruptoren in Pestiziden zur Forderung erhob.
Die Industrie ließ sich indessen ihre Freude nicht anmerken. Aus taktischen Gründen zog sie es vor, gleichfalls in den Chor der KritikerInnen einzufallen, um die Vorlage der EU als goldenen Mittelweg erscheinen zu lassen und ihre erfolgreiche Lobby-Arbeit nicht durch eine Geste des Triumphalismus zu gefährden.
Die ECPA richtete ihren Tunnelblick einzig auf die Ausnahme-Regelungen und empfand diese als ungenügend. Aus diesem Grund krittelte der Pestizid-Verband an den Kriterien herum, die sich seiner Ansicht nach etwas risiko-freudiger hätten zeigen sollen, statt nur der Gefahr ins Auge zu sehen. „Eine Regulierung durch Ausnahmen ist weder akzeptabel noch wissenschaftlich. Wenn man immer mehr Ausnahmen schaffen muss, ist das ein Anzeichen dafür, dass mit den Kriterien etwas nicht stimmt“, meinte ECPA-Sprecher Graeme Taylor. Der „Verband der Chemischen Industrie“ zeigte sich ebenfalls demonstrativ verstimmt. „Die Kriterien taugen in der Praxis nicht zu einer verlässlichen Unterscheidung in schädliche und harmlose Stoffe“, konstatierte er. Harmlose Substanzen gibt es unter den Chemikalien mit hormoneller Wirkungen nach Ansicht der Lobby-Organisation von BAYER & Co. nämlich wirklich. „Eine sichere Handhabung hormon-aktiver Stoffe ist möglich“, befand der Verband und plädierte einmal mehr für eine Regulierung mit Hilfe von Grenzwerten nach Maßgabe der Wirkstärke der EDCs. Und dienten seinem europäischen Pendant CEFIC noch Horror-Filme als Beispiele für hormonell Wirksames mit geringer Halbwertzeit, so rekurriert der bundesdeutsche Chemie-Verband nun auf Vitamin D und Koffein als Substanzen, die unterhalb bestimmter Konzentrationen keine Irritationen im Hormon-System hervorrufen.
Lob erntete Brüssel kaum. Nur das „Bundesinstitut für Risiko-Bewertung“ (BfR) tat sich wieder einmal unrühmlich hervor. Hatte sich das Institut, in dessen Kommissionen VertreterInnen von BAYER, BASF und anderen Konzernen sitzen, schon in Sachen „Glyphosat“ als Anwalt von Unternehmenspositionen hervorgetan, so ging es nun auch d’accord mit dem EU-Entwurf zu den EDCs. „BfR begrüßt wissenschaftliche Kriterien der EU-Kommission für die Identifizierung endokriner Disruptoren“, überschrieben die Risiko-BewerterInnen ihre Pressemeldung. Kunststück: Die Bundeseinrichtung hatte ihren Einfluss in dem ganzen Prozess immer wieder geltend gemacht. So saßen BfR-VertreterInnen etwa in der EFSA-Arbeitsgruppe, die keinen prinziellen Unterschied zwischen den endokrinen Disruptoren und anderen Chemikalien machen wollte. Darüber hinaus betonte das Bundesinstitut schon früh „die große ökonomische Tragweite“ der Entscheidung über die hormonellen Substanzen“ und trat deshalb bei der Kommission immer für Grenzwerte statt für Totalverbote ein.
In der belgischen Hauptstadt geht jetzt erst einmal alles seinen EU-bürokratischen Gang. Andere Gremien müssen sich mit dem Kommissionsentwurf befassen, was noch zu einigen Konflikten führen dürfte. BAYER & Co. haben sich dafür schon einmal in Stellung gebracht und im Falle eines missliebigen Ergebnisses sogar mit gerichtlichen Auseinandersetzungen gedroht. Aber auch die Umweltverbände und kritischen Initiativen haben bereits mit Aktionen begonnen. So hat das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK eine Unterschriften-Aktion an den Start gebracht. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN wird ebenfalls nicht untätig bleiben.
Tiere & Arzneien
MassentierhalterInnen setzen auf BAYER-Antibiotikum
Mehr BAYTRIL in den Ställen
Antibiotika aus der Gruppe der Fluorchinolone wie BAYERs BAYTRIL erfreuen sich bei den MassentierhalterInnen zunehmender Beliebtheit. Und auch die Jubel-Meldung des „Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittel-Sicherheit“ über den zurückgehenden Gebrauch der anderen Mittel entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Ente.
Von Jan Pehrke
„Unter den gegenwärtigen landwirtschaftlichen Bedingungen ist die Anzahl der Tiere pro Stall sehr hoch. Deshalb ist die Behandlung der gesamten Herde und nicht die individuelle Medikation das Mittel der Wahl, um den Infektionsdruck zu mildern und die Ansteckungsgefahr zu senken“, mit solchen Worten legt der BAYER-Konzern den MassentierhalterInnen den massenhaften Einsatz seiner Antibiotika ans Herz.
Der Erfolg dieser Empfehlung lässt sich an der neuesten Zahlen ablesen, die das „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-Sicherheit“ (BVL) Anfang August 2016 veröffentlichte. Demnach erhöhte sich die Gabe von BAYTRIL und anderen Antibiotika aus der Gruppe der Fluorchinolone in der Tiermast drastisch. Von 12,3 auf 14,9 Tonnen stiegen 2015 die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Gebrauch von Cephalosporinen nahm zu.
„Diese beiden Antibiotika-Klassen sind für die Therapie beim Menschen von besonderer Bedeutung“, hielt das BVL lapidar fest. Warum das so ist, erläuterte die Behörde nicht, und damit unterschlug sie auch, welche Gesundheitsgefahren der Zuwachs gerade bei diesen Mitteln heraufbeschwört. Die „besondere Bedeutung“ kommt Fluorchinolonen und Cephalosporinen deshalb zu, weil sie in den Krankenhäusern zu den Reserve-Antibiotika zählen, die nur zum Einsatz kommen, wenn andere Mittel bereits versagt haben. Und der massenhafte Einsatz von BAYTRIL & Co. in der Massentierhaltung führt nun dazu, dass diese Präparate in der Humanmedizin ihre Wirkkraft mehr und mehr verlieren. Die Bakterien gewöhnen sich nämlich zunehmend an die Substanzen. Gelangen die Krankheitserreger dann über den Nahrungskreislauf oder andere Wege von den Ställen in den menschlichen Organismus, können sie Gesundheitsstörungen auslösen, gegen die kein Kraut mehr gewachsen ist.
Nur folgerichtig, dass da CIPROBAY und AVELOX, BAYERs „humane“ BAYTRIL-Pendants, die PatientInnen immer weniger schützen können. Die Zahl der gegen diese Medikamente oder andere Mittel aus dieser Substanz-Klasse resistenten „Staphylococcus aureus“-Erreger wuchs nach Angaben des „German Network for Antimicrobial Resistance Surveillance“ von 1990 sechs Prozent auf über 26 Prozent im Jahr 2006. Anderen Studien zufolge trotzen mittlerweile bis zu 70 Prozent der „Staphylococcus epidermides“-Keime, bis zu 90 Prozent der „Enterococcus faecium“-Erreger, 76,3 Prozent der „Staphylococcus haemolyticus“-Erreger und knapp 40 Prozent der „Enterococcus faecalis“-Erreger CIPROBAY & Co.
Ende der 1990er Jahre starben dem US-amerikanischen Wissenschaftler Dudley Williams zufolge weltweit bereits rund 200.000 Menschen, weil Antibiotika nicht mehr die Möglichkeit hatten, ihnen zu helfen. In den USA sorgte 2005 allein ein multiresistenter „Staphylococcus aureus“-Keim für 18.650 Todesfälle. Und in der Bundesrepublik erliegen nach Angaben des Max-Planck-Institutes alljährlich ca. 15.000 Personen Infektionen, da alle Arzneien versagen.
Dem „Bundesamt für Verbraucherschutz“ gilt der Anstieg bei den Fluorchinolonen und Cephalosporinen als ein kleiner Wermutstropfen, nicht imstande, das Bild eines positiven Gesamttrends einzutrüben. „Menge der abgegebenen Antibiotika in der Tiermedizin halbiert“, diese Jubelmeldung setzte das BVL ab, als es die Ergebnisse der neuesten Auswertung bekannt gab. Einen Rückgang um 401 Tonnen auf 837 Tonnen im Vergleich zu 2014 vermeldete die Behörde stolz. Nur leider sagen diese Zahlen für sich genommen herzlich wenig aus, da die Wirkstärke der Pharmazeutika zugenommen hat. Während eine Tonne des Alt-Antibiotikums Tetracyclin gerade einmal für 39.000 Mastschweine langt, vermögen die LandwirtInnen mit einer Tonne von BAYERs BAYTRIL 2,2 Millionen Tiere zu versorgen. So kann sich hinter der „Halbierung“ sogar ein Mehr an behandelten Tieren verbergen.
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) rückte die Angaben des Bundesamtes deshalb in einer Pressemeldung ins rechte Licht. Für sie demonstrierten die Daten einmal mehr, wie notwendig eine Stall-Wende ist. „Wir brauchen eine Tierzucht ohne Antibiotika. Letztlich ist dies nur möglich, wenn der auf Maximal-Profite ausgerichtete agrar-industrielle Komplex, der den exzessiven Einsatz von Bakteriziden erst notwendig macht, durch eine bäuerliche und ökologisch nachhaltige Landwirtschaft ersetzt wird, die Mensch und Natur wieder in Einklang bringt“, lautete das Resümée.
Überdies initiierte die Coordination einen Offenen Brief an den „Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft“, Christian Schmidt, um Maßnahmen gegen den steigenden Gebrauch von Antibiotika im Allgemeinen und von Reserve-Antibiotika im Besonderen zu verlangen. „Wir sehen dringenden Handlungsbedarf für Nachbesserungen hinsichtlich der Regeln zum Antibiotika-Einsatz in Tierhaltungen“, heißt es in dem Schreiben unter anderem, das die CBG gemeinsam mit den ÄRZTEN GEGEN MASSENTIERHALTUNG, GERMAN WATCH, HEJSUPPORT, dem PESTIZID AKTIONS-NETZWERK und den TIERÄRZTEN FÜR VERANTWORTBARE LANDWIRTSCHAFT aufsetzte. Zu den wichtigsten Forderungen zählen ein Verbot von Reserve-Antibiotika wie BAYTRIL in der Tiermast und eine Erfassung der Antibiotika-Gaben, die im Gegensatz zu einer Angabe in Tonnen belastbare Aussagen über Rückgang oder Anstieg des Gebrauchs erlaubt. Eine Antwort auf den Offenen Brief lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.
Wasser, Boden & Luft
Die Stadt, der Müll und die Autobahn
Der Erörterungstermin
In der Stadthalle von Köln-Mülheim gab es Anfang Juli viel zu bereden: Die Pläne des Landes Nordrhein-Westfalen, die Autobahn A1 auszubauen und dafür den Weg durch eine Giftmüll-Deponie von BAYER freizumachen, stoßen nämlich auf viel Widerstand. 268 Einwendungen gegen das Projekt hatte die Bezirksregierung erhalten, darunter auch eine der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN.
Von Jan Pehrke
Gleich zu Beginn ging es hoch her in der Köln-Mülheimer Stadthalle: „Tumultartige Szenen“ machte der Leverkusener Anzeiger“ beim Erörterungstermin zum Ausbau der Bundesautobahn A1 aus. Dieser fand nämlich nicht nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt wie alle derartigen Veranstaltungen, die Bezirksregierung und der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW) beabsichtigten zusätzlich, die Presse-VertreterInnen aus dem Saal zu weisen. Versammlungsleiter Andreas Hein verwies dazu auf die Gesetzeslage. Nach vielen Unmutsäußerungen aus den Reihen der EinwenderInnen versuchte er erst einmal vergeblich, die VertreterInnen von Straßen.NRW umzustimmen. Diese blieben zunächst hart, aber nicht etwa, weil sie lieber nichts über sich selber in der Zeitung lesen wollten. Nein, „weil die Bürger dann nicht frei sprechen könnten“, lautete die fadenscheinige Begründung aus dem Mund von Projektleiter Thomas Raithel. „Wir Bürger haben kein Problem mit der Öffentlichkeit, aber Sie“, schallte ihm jedoch entgegen. Und schlussendlich mussten er und seine Crew doch noch einlenken.
Dann bekam Straßen.NRW ausreichend Gelegenheit, das vorzustellen, auf das sich Raithel bei seinem Amtsantritt im Herbst 2015 als „eines der größten Infrastruktur-Projekte in Nordrhein-Westfalen“ so gefreut hatte: Die A1-Erweiterung nebst neuer Brücke. Dabei gaben sich die IngenieurInnen alle Mühe, Zweifel ob ihres Vorhabens zu zerstreuen. Sie nannten das Risiko „vertretbar“, Hand an BAYERs Dhünnaue-Deponie zu legen, um einen Teil der Bundesautobahn dort entlangzuführen. Eine Erdschicht von zwei Metern Tiefe, die 87.820 Kubikmeter Giftmüll birgt, planen die StraßenbauerInnen für das Fundament der Trasse abzutragen. Als die IngenieurInnen 1960 eine neue Autobahn anlegten, hatten sie sich noch für einen Komplettaushub entschieden, denn auf Altlasten kann eigentlich keine/r bauen. In denen rumort es nämlich bisweilen noch kräftig. Der organische Anteil des Mülls zersetzt sich, weshalb das Volumen abnimmt und mit Bodenabsenkungen zu rechnen ist. Das tut auch Straßen.NRW. In ihren Planungen gehen die IngenieurInnen vorsichtshalber schon einmal von einstürzenden Neubauten aus. „Eine ggf. erforderliche vorzeitige Instandsetzung des Oberbaus ist berücksichtigt“, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme des Landesbetriebs zur Einwendung der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG). Ansonsten verweisen die StraßenbauerInnen jedoch auf die 1970 ebenfalls nur auf einer zwei Meter starken Polsterschicht errichtete A 59, die sich im Großen und Ganzen als stabil erwiesen habe. Dass die neue A1 jedoch ein viel größeres Verkehrsaufkommen zu bewältigen hat, ficht Raithel & Co. dabei nicht an.
Aus rein finanziellen Erwägungen heraus entschied sich der Landesbetrieb für das, was er selbst einen nur „beschränkt optimierten Eingriff“ nennt. Ein Mitarbeiter bezeichnete beim Erörterungstermin die Auskofferung des ganzen Giftgrabes ganz offen als die „optimale Gründung“ für die A1. Nichtsdestotrotz müht sich der NRW-Betrieb nach Kräften, die kleine Lösung als besonders sanfte, da minimal-invasive Methode erscheinen zu lassen. Ziel sei es, „den Eingriff auf ein Mindestmaß zu beschränken“ und „die zu entnehmenden Abfall-Massen möglichst gering zu halten“, gibt sich Straßen.NRW in der Antwort auf die CBG-Einwendung bedächtig. Und mit diesem „beschränkt optimierten Eingriff“ ändern sich zu allem Übel auch noch die Verantwortlichkeiten für Quecksilber, Arsen, Chrom, Blei & Co. Die Haftung geht nämlich an den „Zustandsstörer“ über, wie es das BürokratInnen-Deutsch verklausuliert. Im Klartext: Die SteuerzahlerInnen kommen im Fall des Falles für den Schaden auf.
Eine Ingenieurin versuchte derweil wacker Überzeugungsarbeit zu leisten, indem sie den immensen Sicherheitsaufwand darlegte, mit dem die StraßenbauerInnen zu Werke gehen wollen. Aber gerade die Bilder, mit denen sie ihren Powerpoint-Vortrag illustrierte, führten noch einmal die ganze Monströsität des Vorhabens vor Augen. Da sogar aus der eigentlich abgedichteten Deponie noch Gas austritt, plant der Landesbetrieb mit viel Aufwand eine Absaugvorrichtung zu installieren und alle ArbeiterInnen mit Schutzanzügen auszustatten. Originalton Straßen.NRW: „Es wurden relativ geringe Schadstoff-Gehalte festgestellt“. Und damit weder Gas noch Gift von der Baustelle unkontrolliert an andere Orte gelangt, müssen die Lastwagen, die den Müll in besonders gesicherten Containern abtransportieren, erst einmal eine Art Waschstraße durchfahren, ehe sie das Gelände verlassen. Gespenstische Szenen warf der Computer da auf die Leinwand – der Rückbau eines AKWs dürfte sich kaum komplizierter gestalten.
Und so gewann dann die von der CBG und vielen Initiativen vorgeschlagene Alternative, den Verkehr statt durch die Dhünnaue unterirdisch durch einen langen Tunnel zu führen, noch mehr an Überzeugungskraft. Entsprechend hart gingen die EinwenderInnen mit den VertreterInnen von Straßen.NRW ins Gericht. „Es wird alles in Frage gestellt“, jammerten diese schon bald und stellten auf stur. „Wir werden nur noch auf unsere schriftlichen Stellungnahmen verweisen“, verkündeten die StraßenbauerInnen und demonstrierten damit ihr Verständnis von Dialogkultur.
Die Bezirksregierung sah das alles erwartungsgemäß anders. Sie fasste das Geschehen am 6. Juli wie folgt zusammen: „Die Auswirkungen auf die Alt-Ablagerung Dhünnaue beschäftigte die Versammlung den ganzen Tag. Die Plausibilität der Gutachten zur Standsicherheit der Autobahn, die Entsorgungswege und die Auswirkungen auf die Nachbarn wurden im Detail hinterfragt. In der Sache konnten zahlreiche Fragen beantwortet und die Vorgehensweise erläutert werden.“ Darum dürfte die Bezirksregierung Köln die Pläne von Straßen.NRW im Herbst auch durchwinken und allenfalls ein paar kosmetische Änderungen verlangen.
Imperium & Weltmacht
BAYER schluckt MONSANTO
Der schwarze Mittwoch
Kurz vor dem Redaktionsschluss von Stichwort BAYER gab BAYER die MONSANTO-Übernahme bekannt.
Von Jan Pehrke
Jetzt ist der Worst Case eingetreten! BAYER übernimmt für 66 Milliarden Dollar MONSANTO. „Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir von der Qualität des Managements, der Qualität der Produkte, der Stärke der Innovationskraft und auch von der Kultur MONSANTOs sehr überzeugt sind“, mit diesen Worten begründete BAYER-Chef Werner Baumann den Deal. Und große Kultur-Unterschiede zwischen den beiden Multis bestehen wirklich nicht. Was dem US-Unternehmen sein Glyphosat, das ist dem Leverkusener Multi sein Glufosinat, was dem US-amerikanischen Konzern seine Gen-Pflanzen der Produktreihe „ROUND UP“, das sind seinem deutschen Pendant die LIBERTY-LINK-Ackerfrüchte, und auch ansonsten geben sie sich nicht viel.
Die Geschäftszahlen von 2015 zugrunde gelegt, kommen die Landwirtschaftssparten beider Gesellschaften zusammen auf einen Umsatz von 23,1 Milliarden Dollar. Damit kann niemand aus der Branche mithalten. Die frisch vermählten Paare SYNGENTA/ChemChina und DUPONT/DOW folgen mit weitem Abstand (14,8 bzw. 14,6 Milliarden), und auf Rang vier landet abgeschlagen BASF mit 5,8 Milliarden. Bei den Pestiziden erreichen BAYER und MONSANTO zusammen einen Marktanteil von rund 25 Prozent, beim Saatgut für gentechnisch veränderte und konventionelle Ackerfrüchte einen von rund 30 Prozent. Allein die Gen-Pflanzen betrachtet, erreichen die beiden Konzerne vereint mit weit über 90 Prozent sogar eine klar dominierende Position.
Entsprechend alarmiert reagierte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG). „Mit der Übernahme von MONSANTO durch BAYER erreicht die Konzentration auf dem Agro-Markt einen neuen Höhepunkt. Schlüsselelemente der Nahrungsmittelkette liegen nun in der Hand eines einzigen Konzerns. Die LandwirtInnen müssen sich nun auf höhere Preise einstellen und haben überdies weniger Auswahl. Zudem dürfte sich der Innovationsstau der Branche, vor allem bei den Herbiziden, noch einmal zuspitzen“, hieß es in der Presse-Erklärung.
Mit Alternativen zu den chemischen Keulen auf den Äckern ist nun auch weniger denn zu rechnen. BAYER hat 66 Milliarden Dollar in ein beschleunigtes „Weiter so“ investiert. Und der Global Player hat dabei noch die Chuzpe, das Monopoly-Spiel als Antwort auf die Frage zu präsentieren: „Wie schaffen wir es, bis zum Jahr 2050 zusätzlich drei Milliarden Menschen auf ökologisch nachhaltige Art und Weise zu ernähren?“ Mit Glyphosat, Glufosinat, Gentechnik und Gewächsen wie Soja und Mais, die hauptsächlich für die Futtertröge der Massentierhalter gedacht sind, bestimmt nicht, das ist schon mal klar.
Auf die Standort-Städte und die Beschäftigten dürften jetzt ebenfalls harte Zeiten zukommen. Der Leverkusener Multi setzt seine Neuerwerbungen nämlich bevorzugt von der Gewerbesteuer ab und redet schon drohend von Synergie-Effekten, die es beispielsweise in der Verwaltung zu realisieren gelte. Auch die Trennung von einzelnen Unternehmensteilen steht zu befürchten. Entsprechend besorgt reagieren die Belegschaftsangehörigen. Äußern dürfen sie sich jedoch nicht. Laut Rheinischer Post hat BAYER ihnen einen Maulkorb verpasst.
Aus all diesen Gründen wird sich die CBG in den kommenden Monaten nach Kräften bemühen, sich mit den verschiedenen MONSANTO-Initiativen kurzzuschließen und den konzern-kritischen Widerstand nun mit Fokus auf BAYER neu auszurichten.
Recht & Unbillig
Hormon-Präparat mit tödlichen Nebenwirkungen
Anklage: Mord
Contagan, Teil 2 – so bezeichnen Betroffene den DUOGYNON-Skandal. Aber während der Pharma-GAU „Contagan“ zu trauriger Berühmtheit gelangte, erhielt der Fall „DUOGYNON“ nie eine vergleichbare Aufmerksamkeit. Dabei hat der hormonelle Schwangerschaftstest der heute zu BAYER gehörenden Firma SCHERING ab den 1950er Jahren zu tausenden Totgeburten geführt und unzählige Gesundheitsstörungen hervorgerufen. Die Verantwortlichen wurden dafür nie zur Rechenschaft gezogen, aber jetzt versucht es Gisela Clerc noch einmal: Sie hat eine Strafanzeige wegen Mordes erstattet.
Von Jan Pehrke
„Meine Tochter, die ich hier vertrete, ist zu schwach, um über ihr Schicksal zu reden. Sie bat mich, es an ihrer Stelle zu tun“, mit diesen Worten wandte sich Gisela Clerc 2012 in der BAYER-Hauptversammlung an die AktionärInnen. Anschließend berichtete sie, was ihr nach der Einnahme des Schwangerschaftstests DUOGYNON widerfuhr. „Kurze Zeit später bekam ich einen Blutsturz, der zwei Tage anhielt und starke Unterleibsschmerzen. Trotzdem war ich schwanger und bekam 1969 eine schwer missgebildete Tochter. Sie hatte am und im Herzen: ductus botalli, Aorten-Stenose an der Herzscheidewand und zwei defekte Herzklappen.“ Am Schluss ihrer Rede forderte die Rentnerin den Leverkusener Multi auf, die Konzern-Unterlagen zu dem Mittel freizugeben. Gisela Clerc wollte in Erfahrung bringen, wie viel die ManagerInnen damals selber über die Risiken und Nebenwirkungen des Präparates wussten. Aber der Pharma-Riese weigerte sich, Einsicht in die Dokumente des Unternehmens SCHERING zu gewähren, das er 2006 erworben hatte. Der DUOGYNON-Geschädigte Andre Sommer reichte deshalb eine Auskunftsklage ein. Diese scheiterte jedoch ebenso wie ein Prozess um Entschädigungen. Die Ansprüche seien verjährt, entschieden die RichterInnen jeweils.
Gisela Clerc ist gerichtlich auf diesem Wege allerdings nicht zu stoppen. Sie hat nach dem Tod ihrer Tochter, die Anfang des Jahres im Alter von nur 47 Jahren an den DUOGYNON-Spätfolgen starb, nämlich eine Strafanzeige wegen eines Deliktes erstattet, für das der Gesetzgeber keine Verjährung vorgesehen hat. Mit nichts geringerem als Mord „durch Unterlassen in Verdeckungsabsicht in einer unbekannten Zahl von Fällen“ hat sich die Berliner Staatsanwaltschaft im Fall von DUOGYNON nun zu beschäftigen.
Die 74-Jährige kann sich dabei auf neues Beweis-Material stützen, denn Andre Sommer fand beim Stöbern im Berliner Landesarchiv alte SCHERING-Akten aus einem früheren Verfahren. Und diese zeigen eindeutig, wie gut der Konzern über die Risiken und Nebenwirkungen seines Medizin-Produktes informiert war. „Ein Zusammenhang zwischen den gefundenen Anomalien und der Substanz-Applikation kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden“, hielt ein Wissenschaftler beispielsweise nach desaströsen Tierversuchen fest. Ein anderer Forscher stufte DUOGYNON als „hochgradig embryo-toxisch“ ein, und ein Kollege vermochte sogar genaue Angaben über den Grad zu machen. Er meldete der Berliner Zentrale, „dass bei denen, die einen hormonellen Test gehabt hätten, ein relatives Risiko von 5:1 bestehe, ein missgebildetes Kind zu bekommen.“
Nach Meinung der Anwälte von Gisela Clerc hätten diese Befunde SCHERING veranlassen müssen, das Pharmazeutikum sofort vom Markt zu nehmen und nicht erst Anfang der 1980er Jahre. „Dies unterließen sie jedoch und nahmen den Tod der Kinder zumindest billigend in Kauf“, urteilen Detlev Stoffels und Jörg Heynemann.
Statt umgehend zu reagieren, suchte der Konzern nach Mitteln und Wegen, an dem Präparat festhalten zu können. Dafür traf er sich mit ExpertInnen und arbeitete Strategien für Schadensersatz-Prozesse aus. So plante SCHERING unter anderem, vor Gericht bei der Kausalitätsfrage anzusetzen und systematisch Zweifel an dem ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Medikament und den unerwünschten Arznei-Effekten zu säen. Das Unternehmen erwog sogar, mit dem Rechtsanwalt einen BeraterInnen-Vertrag zu schließen, der die Firma Grünenthal in Sachen „Contergan“ vor Entschädigungszahlungen bewahrt hatte. Und es gelang dem Pillen-Produzenten Ende der 1970er Jahre dann auch wirklich, die juristische Auseinandersetzung mit der INTERESSENSGEMEINSCHAFT DUOGYNON-GESCHÄDIGTER zu gewinnen.
Vom damaligen Bundesgesundheitsamt (BGA) hatte die Aktien-Gesellschaft ebenfalls nichts zu befürchten. Sie hatte dort nämlich jemanden sitzen, der sich selbst als „Advokat der Firma SCHERING“ bezeichnete. Der Herr Professor schmuggelte entlastende Unterlagen in die Behörde und hielt den Konzern immer über die Vorgänge im BGA auf dem Laufenden. Und das gewährte dem Mittel dann auch Bestandsschutz. In England, wo er den Schwangerschaftstest unter dem Namen PRIMODOS in Umlauf brachte, hatte der Konzern auch beste Beziehungen zu den EntscheidungsträgerInnen. So traf der Pharma-Riese sich mit einem Mitarbeiter der englischen Gesundheitsbehörde zu einem netten Plausch auf den Bermudas, wo der Mann dem Berliner Unternehmen zusicherte, eine DUOGYNON-kritische Untersuchung zu vernichten. Zur Sicherheit aber eruierte SCHERING zusätzlich noch die politische Stimmung im Unterhaus und ließ PolitikerInnen-Dossiers anfertigen. Über einen Mandatsträger hieß es darin beispielsweise: „Ein führender linker Flügelspieler, unnachgiebig, sehr klug, ein gewaltiger Gegner, vollkommen unbestechlich“.
Auf diese Weise hielt der Multi das Medizin-Produkt in England bis 1978 und in Deutschland sogar bis 1981 auf dem Markt. Und nach Ansicht von BAYER könnte es sogar heute noch in den Apotheken stehen. Wie der Global Player zur Strafanzeige von Gisela Clerc erkärte, schließt er „DUOGYNON nach wie vor als Ursache für embryonale Missbildungen aus“.
Der mutige Schritt der Rentnerin ist der vorerst letzte Akt einer Auseinandersetzung, welche die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) mit angestoßen hat. Vor acht Jahren wurde sie auf die Aktivitäten von britischen Betroffenen aufmerksam und lud zwei von ihnen zur BAYER-Hauptversammlung ein. In ihren Reden konfrontierten Karl Murphy und Valerie Williams den Vorstand zum ersten Mal direkt mit dem Schicksal der DUOGYNON-Geschädigten. Das verschaffte dem Thema in Deutschland eine breitere Öffentlichkeit und ließ auch die bundesdeutschen LeidensgenossInnen von Murphy und Williams aufhorchen. Motiviert von den beiden EngländerInnen, begannen jene sich alsbald zu vernetzen, suchten die AktionärInnen-Treffen auf und planten gemeinsam weitere Schritte. Dabei gelang es sogar, die Musikerin Nina Hagen als Fürsprecherin zu gewinnen. „Ich bin entsetzt über die Ignoranz und Dreistigkeit der verantwortlichen Konzerne gegenüber den leidgeprüften DUOGYNON-Opfern und ihren Eltern. Ich hoffe sehr, dass die deutsche Gerichtsbarkeit gerecht urteilen wird und dass die Opfer endlich eine Entschuldigung und gerechte Entschädigung bekommen“, sagte sie 2010.
Nina Hagens Hoffnungen haben sich bisher nicht erfüllt, und ob sich das im Fall der Strafanzeige von Gisela Clerc ändern wird, steht auch dahin. Aber BAYER droht noch von anderer Seite Ungemach. In England beschäftigt sich zurzeit nämlich ein parlamentarischer Gesundheitsausschuss mit dem Schwangerschaftstest. Und auf den Faktor „Zeit“ kann der Leverkusener Multi dabei nicht setzen. Auf der Insel gelten nämlich andere Verjährungsfristen.
Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
nun hat BAYER also wirklich MONSANTO übernommen und damit die Drohung wahr gemacht, zum größten Agro-Konzern der Welt zu werden. Das Stichwort BAYER (SWB) hat die Nachricht auf dem falschen Fuß erwischt. Das Heft war schon beim Layouter und sollte bald in Druck gehen. Auf den letzten Drücker mussten wir noch mal umdisponieren und Platz für die schlechte Nachricht schaffen. Eine ausführliche Analyse des Coups konnte die Redaktion in der Kürze der Zeit aber nicht mehr leisten. Diese folgt in der nächsten Ausgabe.
Dafür hat sich das SWB schon einmal einer neuen Gen-Pflanze des frisch geschaffenen Giganten gewidmet: dem Soja FG 72. Die EU-Kommission hat der Labor-Frucht im Sommer die Import-Genehmigung erteilt, wobei ihr die Verhandlungen zum Handelsabkommen CETA Beine gemacht haben.
Am ausführlichsten jedoch widmen wir uns diesmal solchen von Pestiziden und anderen Stoffen des Leverkusener Multis ausgelösten Gesundheitsgefährdungen, welche die Wissenschaft lange Zeit übersehen hat: Manche Chemikalien gleichen in ihrem Aufbau Hormonen und können den menschlichen Organismus deshalb gehörig durcheinander bringen. Die EU hatte da nach einigem Zögern auch Handlungsbedarf erkannt, aber BAYER & Co. gelingt es, durch Extrem-Lobbying ordentlich Sand ins Getriebe zu streuen und den Prozess in ihrem Sinne zu beeinflussen.
Und dann gibt es auch immer wieder Gelegenheit zu einer Beschäftigung mit der Vergangenheit des Leverkusener Multis und seiner Weigerung, diese angemessen zu „bewältigen“. Trauriger Anlass ist der Tod des Schriftstellers Elie Wiesel, der am 2. Juli starb. Wiesel kam 1944 als 14-Jähriger nach Auschwitz, wo die von BAYER mitgegründeten IG FARBEN ein eigenes KZ unterhielten und mit ZwangsarbeiterInnen wie dem Jungen aus dem rumänischen Sighet ein neues Werk errichteten. Im Jahr 1995 hat sich BAYERs damaliger USA-Chef Helge Wehmeier dafür bei Wiesel entschuldigt. Das Unternehmen würdigte dieses jedoch zu einer Privatangelegenheit des Managers herab. Der Konzern als solcher zeigte sich bis heute nicht zu einer derartigen Geste bereit.
Überdies verfolgt das Stichwort BAYER die Auseinandersetzung um die Erweiterung der Bundesautobahn A1 weiter, für welche die PlanerInnen BAYERs Dhünnaue-Giftgrab wieder öffnen wollen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hat dagegen wie viele andere Initiativen und Einzelpersonen Beschwerde eingelegt, Anfang Juli kamen sie bei dem Erörterungstermin in der Stadthalle von Köln-Mülheim auf den Tisch.
Schließlich wirft die Abteilung „Risiko und Nebenwirkungen“ von Arzneien wieder einige Fragen auf, die weder der Beipackzettel noch die ÄrztInnen oder ApothekerInnen beantworten können. So kämpfen die Geschädigten des Schwangerschaftstests DUOGYNON, den das heute zu BAYER gehörende Unternehmen SCHERING von den 1950er bis zu den frühen 1980er Jahren vermarktete, immer noch um ihre Rechte. Die Mutter einer an den Spätfolgen von DUOGYNON Verstorbenen hat deshalb jetzt zu einem drastischen Mittel gegriffen und Strafanzeige wegen Mordes gestellt. Die Testosteron-Präparate des Pharma-Riesen haben es ebenfalls in sich. Trotzdem preist er sie zur Behandlung einer Krankheit an, die es gar nicht gibt: die männlichen Wechseljahre. Zu einem immer größeren Problem entwickelt sich auch die massenhafte Gabe von Antibiotika in der Massentierhaltung. Durch die Dauer-Dröhnung gewöhnen sich die Krankheitskeime nämlich an die Mittel. Und gelangen die Erreger dann über den Nahrungskreislauf oder andere Wege in den menschlichen Organismus, vermögen sie Gesundheitsstörungen auszulösen, gegen die kein Kraut mehr gewachsen ist.
Das Stichwort BAYER bietet also mal wieder ein volles Programm. Dass es seinen LeserInnen gefällt, hofft
Jan Pehrke
Gene & Klone
BAYERs Gen-Soja entert die EU
Der BALANCE-Akt
Ende Juli 2016 hat die EU BAYERs Gensoja BALANCE eine Import-Genehmigung erteilt.
Von Jan Pehrke
Der Umweltausschuss der Europäischen Union hatte sich dagegen ausgesprochen, das Parlament in Straßburg lehnte es ab, und unter den Mitgliedsländern fanden sich auch nicht genügend Fürsprecher – aber es nützte alles nichts, die Europäische Kommission erteilte Ende Juli 2016 drei gen-manipulierten Soja-Sorten die Importgenehmigung. Somit dürfen BAYERs FG 72 sowie MONSANTOs Labor-Früchte MON 87708 x MON 89788 und MON 87705 x MON 89788 ihre Reise zum alten Kontinent antreten und als Rohstoffe in den Lebensmittel-Fabriken, vor allem aber in den Futtertrögen der Massentierhalter landen.
Der USSEC, der US-amerikanische Export-Verband für Soja, begrüßte den Beschluss überschwenglich, stellt doch der europäische Markt einen bedeutenden Faktor für die Händler dar. Rund 4,6 Millionen Tonnen gehen jährlich dorthin, und ohne die Brüsseler Lizenz zum Import hätten FG 72 & Co. einen ziemlich schlechten Stand im „corn belt“ des Mittleren Westens.
Auch für die kanadische Soja-Industrie spielt die Europäische Union als Absatz-Gebiet eine bedeutende Rolle. Entsprechend viel Lobby-Druck entfaltete die Lobby-Organisation „Soy Canada“, die unter anderem BAYER und MONSANTO zu ihren Mitgliedern zählt, im Vorfeld der Entscheidung. Dabei mahnte sie die EU auch, zu den im Rahmen des Handelsabkommens CETA getroffenen Vereinbarungen zu stehen. „Wir fordern von der EU-Kommission eine Erklärung dafür, warum die Genehmigung der drei Produkte sich so sehr verzögert und warum sie ihre Versprechungen, die sie bei den CETA-Verhandlungen gemacht hat, nicht einhält“, verlautete aus Ottowa.
Während sich „Soy Canada“ nun zu dem verspäteten Erfolg beglückwünschen kann, sehen die europäischen VerbraucherInnen neuen Gefahren entgegen. Die Pflanze des Leverkusener Multis mit dem Namen BALANCE gibt es für die LandwirtInnen nämlich nur im Kombi-Pack mit den beiden als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuften Antiunkraut-Wirkstoffen Glyphosat und Isoxaflutol. Und weisen die Substanzen schon für sich genommen genügend Gesundheitsgefahren auf, so potenzieren sich ihre unerwünschten Effekte im Zusammenspiel noch, denn das Gift-Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Diese Risiken und Nebenwirkungen hat die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA im Laufe des Genehmigungsverfahrens lieber erst gar nicht untersucht. Andere vermochte sie nicht zu prüfen. Aufgrund der dürftigen Datenlage sah die Einrichtung sich nicht imstande, das Gefährdungspotenzial einzuschätzen, das von den Pestizid-Rückständen in den Gen-Konstrukten ausgeht.
Überdies zeigt sich Glyphosat nur bei seinen Nebenwirkungen stabil, seine Hauptwirkungen lassen hingegen immer mehr zu wünschen übrig. Die Wildpflanzen stellen sich zunehmend auf den Stoff ein und bilden Resistenzen aus. Deshalb müssen die LandwirtInnen immer mehr Pestizide kaufen und nicht weniger, wie ihnen die Gentech-Multis versprochen hatten. So sind die Ausgaben der Soja-Bauern und -Bäuerinnen für die Agro-Chemikalien einer Studie der „South Dakota State University“ zufolge in den letzten sechs Jahren um 88 Prozent gestiegen.
All das focht die Europäische Kommission bei ihrer Entscheidung am 22. Juli jedoch nicht an. „Wieder einmal hat Brüssel nicht im Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschutzes gehandelt, sondern im Sinne der großen Konzerne und ihrer Profit-Interessen“, hieß es aus diesen Gründen in der Presse-Erklärung der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN zum EU-Votum.
Drugs & Pills
BAYERS Testosteron-Präparate
Jungbrunnen mit Nebenwirkungen
Eigentlich sollten die Pharma-Firmen Medikamente für bestimmte Krankheiten entwickeln. Manchmal gehen sie jedoch den umgekehrten Weg und entwickeln Krankheiten für bestimmte Medikamente. So hat BAYER die männlichen Wechseljahre erfunden, um einen größeren Markt für NEBIDO und andere Hormon-Präparate zu schaffen.
Von Dr. Jan Salzmann (MEZIS)
Leiden auch Männer unter Wechseljahren? Diese Frage bejahen mittlerweile nicht nur zahlreiche Arzneimittelhersteller, sondern auch diverse Urologen, BuchautorInnen, PsychologInnen und ApothekerInnen. Die „Andropause“ führe nicht nur zu Lustlosigkeit und Erektionsstörungen, sondern auch zu Haarausfall, Knochenschmerzen, Muskelschwund, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, vermehrtem Schwitzen, Reizbarkeit und Sinnkrisen1,2, so das Urteil vermeintlicher ExpertInnen.
Im Internet kursieren „Selbsttests“ mit 15 bis 20 Items, die die typischen Symptome des „Climacterium virile“ abfragen. Begleitend finden sich jede Menge Werbung und Hinweise auf Heil-Möglichkeiten mit der Aussicht – einem Jungbrunnen gleich – aus dem lustlosen Trauerkloß einen allzeit aktiven und zu allem bereiten Hengst machen.
Trotz aller Emanzipation – als „Schwächling“ oder „Versager“ will wohl kaum ein Mann im Schlafzimmer auffallen. Die Bereitschaft, sich bei sexuellen Problemen diskrete Hilfe zu holen und hier auch jede Menge Geld zu investieren, ist hoch. Das wissen natürlich auch BAYER und die anderen Hersteller von Testosteron-Präparaten und machen flugs eine schlichte Gleichung auf: Sexuelle Probleme = Hormon-Mangel = Andropause/Wechseljahre des Mannes = Lösung durch Substitution, also eine Testosteronersatz-Therapie.
„Das Verkaufen von Medikamenten ist das Geschäft der Pharma-Firmen. Beim Testosteron aber wird die Krankheit gleich zum Produkt mitverkauft. Die hormon-produzierenden Firmen haben Meinungsforschungsinstitute, Werbeagenturen, PR-Unternehmen, Universitätsprofessoren und Journalisten in Gang gesetzt, um die Wechseljahre des Mannes als ernst zu nehmende und weit verbreitete Erkrankung bekannt zu machen“, so Jörg Blech in einem bemerkenswerten Buch zu „erfundenen Krankheiten“3.
„Disease mongering“ lautet der Fachausdruck für diese Übung. Sie ist ein lukratives Geschäft und wird seit Jahrzehnten mit Erfolg betrieben. Bevorzugte Fanggründe für die Pharma-Riesen sind die Tabuzonen der Gesellschaft: psychische Erkrankungen und sexuelle Störungen. Hier sprechen die Betroffenen nicht gerne drüber, auch mit dem Hausarzt oder der Hausärztin nicht, sondern schauen mal im Internet oder in populär-medizinischen Zeitschriften nach. Und da finden sie dann so etwas wie Serotonin-Wiederaufnahmehemmer zur Behandlung der Ejaculatio praecox und andere Wundermittel.
Dr. Christiane Fischer, Geschäftsführerin der ÄrztInnen-Initiative MEIN ESSEN ZAHL’ ICH SELBT (MEZIS), stieß 2015 im Internet etwa auf die Seite des Unternehmens CGC CRAMER-GESUNDHEITS-CONSULTING, das sich ganz offen damit brüstet, für NEBIDO, TESTOGEL und andere BAYER-Produkte mit Werbe-Tricks einen Markt geschaffen zu haben. „Das Hormontief des Mannes – Mit PR eine neue Indikation begründet“, lobt sich die Firma auf ihrer Webpage selber. „Das Hormon-Tief wird als ernstzunehmende behandlungsbedürftige Erkrankung dargestellt, und der Urologe als Spezialist für das Krankheitsbild positioniert. Empirische Meinungsforschung zeigt, dass die Botschaften innerhalb von drei Jahren über die Hälfte der betroffenen Altersgruppe sowie die Mehrzahl der Ärzte erreicht haben“, so bilanziert CGC den Erfolg der Kampagne. Nach einer Einladung zu einer Podiumsdiskussion des Deutschen Ethikrates verschwand die Seite dann ganz plötzlich aus dem Netz.
Das Geschäft mit dem Mythos der Andropause läuft für BAYER & Co. gut. Nach Angaben der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA ist der Markt für Testosteron in den USA von 2009 bis 2013 um 65 Prozent gewachsen, Die Zahl der Verordnungen stieg von 1,3 Millionen im Jahr 2010 auf 2,3 Millionen im Jahre 2013. Auch in Deutschland sind nach dem Arzneiverordnungsreport der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) in dem Zeitraum von 2008 bis 2012 die DDD (definierten tägliche Dosen) von 8,3 Millionen auf 13 Millionen gestiegen4.
Dass die Argumente für das neue Krankheitsbild medizinisch keineswegs zu halten sind, ist mittlerweile durch diverse Untersuchungen belegt. So stellten Wu et al. in einer Studie zum „Late-onset hypognadism in middle-ages and elderly men“ fest, dass viele unspezifische und spezifische Symptome (psychische und sexuelle) keine Korrelation zu den Testosteron-Spiegeln zeigen. Nach Ansicht der WissenschaftlerInnen ist ein substitutionspflichtiger Hypogonadismus (hormonelle Minderproduktion, die durch Hormon-Gabe behandelt werden muss) zudem sehr selten und nur mit einer definierten Kombination spezifischer sexueller und laborchemischer Befunde zu diagnostizieren5,6.
Auch die „Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie“ betonte noch 2015, dass die „Wechseljahre des Mannes“ ein Mythos seien7. Während die meisten Urologen, insbesondere die Mehrzahl der Klinikchefs, die Existenz der Andropause verneinen, gibt es eine Menge – vor allem niedergelassener – Kollegen, die sich der Behandlung dieses „Krankheitsbildes“ verpflichtet haben und das im Internet auch kräftig bewerben. Ob aus finanziellen Gründen, oder weil sie selber daran glauben, das wissen wir nicht.
Dabei erhöhen NEBIDO & Co. nicht nur den Umsatz der Urologen und Arzneimittelhersteller, sondern auch die Gesundheitsrisiken der Betroffenen. Testosteron-Substitution kann neben zahlreichen anderen unerwünschten Wirkungen das kardiovaskuläre Risiko steigern und das Wachstum von Prostata-Karzinomen fördern8,9,10. Somit kann der Einsatz von Testosteron-Präparaten dazu beitragen, die Lebenszeit zu verkürzen, statt die Jugendzeit zu verlängern. Mann sollte sich also besser mit den Tatsachen abfinden: Ab dem Alter von 40 Jahren sinkt der Testosteron-Spiegel aus physiologischen Gründen, und dass die Kräfte im Laufe des Lebens weniger werden, ist genauso normal wie seelische oder soziale Krisen.
Aber BAYER & Co. lassen nicht locker und sind gerade dabei, sich eine weitere Zielgruppe für ihre Testosteron-Arzneien zu erschließen: übergewichtige und zuckerkranke Männer. Aufgrund der Stoffwechsel-Lage kann es tatsächlich zur einer generellen Hormon-Verschiebung kommen, da das Bauchfettgewebe Vorstufen für diverse Hormone bildet, unter anderem ist ein Absinken des Testosteron-Spiegels möglich. Anstatt dies jedoch nebenwirkungsfrei mit Sport und gesunder Ernährung zu ändern, wird in medizinischen Zeitschriften für eine Hormon-Gabe geworben, die den Blutzuckerwert verbessern und die Gewichtsabnahme beschleunigen soll11. NEBIDO, TESTOGEL und andere Testosteron-Produkte dürften BAYER’s Kasse also noch so einige Zeit zum Klingeln bringen.
(1) http:www.psychotipps.com/wechseljahre-mann.html
(2) http:www.wechseljahre-des-mannes.de/wechseljahre/index.html
(3) Jörg Blech, Die Krankheitserfinder, Wie wir zu Patienten gemacht werden, Fischer-Verlag 2014
(4) http:www.medscapemedizin.de/artikel/4901903 Neue Kennzeichnung für Testosteron gefordert – doch Berater der Arzneimittelbehörden halten kardiovaskuläre Risiken für nicht bewiesen
(5) WU F. et al.: „Identification of Late-Onset Hypogonadism
in Middle-Aged and Elderly Men”, N Engl J Med 2010;363:123-35.
(6) http:www.sueddeutsche.de/wissen/medizin-die-wechseljahre-des-mannes-sind-ein-mythos-1.960516
(7) http:www.aerzteblatt.de/nachrichten/62177/Wechseljahre-des-Mannes-laut-Fachgesellschaft-ein-Mythos
(8) http:www.medscapemedizin.de/artikel/4901903 Neue Kennzeichnung für Testosteron gefordert – doch Berater der Arzneimittelbehörden halten kardiovaskuläre Risiken für nicht bewiesen
(9) arznei-telegramm 2/2004, 35, 17, Jungbrunnen Testosteron
10) arznei-telegramm 2/2015, 46, 25-26 EMA, FDA: Kardiovaskuläre Sicherheit von Testosteron nicht belegt
(11) F. Saad, Testosteron-Therapie 2015: Adipositas und Typ-2-Diabetes beim hypogonadalen Mann, Diabetes, Stoffwechsel und Herz, Band 24, 5/2015
IG FARBEN & heute
Nachruf auf Elie Wiesel
„Nie werde ich das vergessen“
Am 2. Juli 2016 starb der Schriftsteller Elie Wiesel. Im Alter von 14 Jahren kam er gemeinsam mit seiner Familie nach Auschwitz. Er leistete dort Zwangsarbeit für die von BAYER mitgegründeten IG FARBEN und durchlitt im konzern-eigenen KZ Monowitz Höllenqualen. Rund 50 Jahre später bat der damalige US-Chef des Leverkusener Multis ihn „für die Taten der IG FARBEN und des deutschen Volkes“ um Verzeihung. Die Unternehmenszentrale in Deutschland tat dies jedoch als eine persönliche Geste ab. Zu einer offiziellen Entschuldigung bei Wiesel und den zahllosen anderen Opfern der IG konnte der Global Player sich bis heute nicht durchringen.
Von Jan Pehrke
„Ihr seid in Auschwitz. Und Auschwitz ist kein Erholungsheim, sondern ein Konzentrationslager. Hier wird gearbeitet. Sonst geht ihr in den Schornstein. In die Gaskammer. Arbeiten oder Gaskammer – ihr habt die Wahl“, mit diesen Worten begrüßte ein SS-Offizier im Frühjahr 1944 den 14-jährigen Elie Wiesel und seine LeidensgenossInnen.
Die Wahl trafen allerdings ganz andere, zum Beispiel der berüchtigte SS-Arzt Josef Mengele. Er ließ den Jungen, der mit seiner Familie aus dem rumänischen Sighet ins Lager verschleppt worden war, gemeinsam mit den anderen neuen Gefangenen gleich nach der Ankunft zu einem zynischen Defilee antreten. Um bei der Fleischbeschau zu bestehen, machte Wiesel sich auf Anraten eines erfahreneren Mithäftlings um vier Jahre älter und gab sich zudem als Landarbeiter aus – wer weiß, ob er sonst die ersten Tage in Auschwitz überstanden hätte.
So aber hieß es „arbeiten“. Elie und sein Vater mussten auf die Baustelle der vom BAYER-Konzern mitgegründeten IG FARBEN in Monowitz, während seine Mutter und seine drei Schwestern nach Birkenau kamen. „Die IG FARBENINDUSTRIE hat mit dem Projekt Auschwitz einen Plan zu einer neuen Werksgründung größten Ausmaßes entworfen. Sie ist entschlossen, unter Einsatz ihrer besten Kräfte ein lebendiges Werk aufzubauen, das sich ebenso gestaltend auswirken wird wie die vielen anderen Anlagen in West- und Mitteldeutschland. Die IG FARBENINDUSTRIE erfüllt damit eine hohe Pflicht, auf ihre Weise mitzuwirken und alle Kräfte einzusetzen, dass diese Industriegründung zu einem festen Eckpfeiler wird für ein kräftiges, gesundes Deutschtum im Osten“, hatte der IG-Manager Otto Ambros am 7. April 1941 erklärt1.
Billige Arbeitskräfte
Bei dieser Mission hatte Auschwitz einen großen Standort-Vorteil zu bieten: die Verfügungsgewalt über ein Heer billiger ArbeiterInnen zum Aufbau der Fertigungsstätte. Vier Reichsmark pro Tag für Fachkräfte zahlte die IG an die SS, drei Reichsmark für Hilfskräfte – alles inklusive. In diesem Preis war sowohl die Verpflegung als auch die „Lieferung frei Haus“ aus dem sechs Kilometer von Monowitz entfernten Auschwitz enthalten. Da der tägliche Fußmarsch die Gefangenen zusätzlich entkräftete und so den Wert ihrer Arbeitskraft senkte, entschloss sich die IG FARBEN jedoch Anfang 1942, gleich neben der Baustelle das konzern-eigene KZ Monowitz/Buna zu errichten.
Zwölf Stunden lang musste der junge Elie in Monowitz schwere Steinblöcke schleppen. Besonders schlimm war das im Winter. „Die Steine waren so kalt, dass sie an den Händen zu kleben schienen, sobald man sie berührte“, schreibt Wiesel in seinem Buch „Die Nacht“. Und früher war alles sogar noch schlimmer, erfuhr der 14-Jährige von Mithäftlingen: „Damals war Buna die wahre Hölle. Es gab kein Wasser, keine Decken, und weniger Suppe als heute. Nachts schlief man fast nackt, und das bei 30 Grad unter Null. Jeden Tag sammelte man die Leichen zu Hunderten ein.“ Noch 1944 waren die Lebensbedingungen so schlecht, dass sogar die SS-Ärzte auf eine Verbesserung der Situation drangen. Aber der IG-Betriebsführer Walther Dürrfeld lehnte es strikt ab, mehr Krankenhaus-Plätze zu schaffen oder andere Maßnahmen in die Wege zu leiten. „Warum mehr in die Häftlinge investieren und so die Arbeitskosten erhöhen, wenn es doch schier unbegrenzt Nachschub gab?“, fragten sich Dürrfeld & Co. und gingen stattdesssen den umgekehrten Weg. Sie kürzten die Zuwendungen an die SS. So zahlte die IG FARBEN etwa nur noch für zwei bis drei Wochen Krankengeld. Wer länger arbeitsunfähig war, der unterschrieb damit sein Todesurteil.
Zudem drängten die Konzern-Manager die Nazi-Organisationen, ein strengeres Regiment zu führen. „Eine Sorge, die von Woche zu Woche brennender wird, bildet die ständig abnehmende Arbeitsmoral auf der Baustelle. So werden z. B. Reklamationen bei der Gestapo wegen Behandlung von uns gemeldeter Arbeitsbummelanten mit dem einfachen Hinweis beantwortet, dass sich die Gestapo nicht drängeln ließe. Diese Tatsache allein zeigt, dass man dort noch nicht erkannt hat, um was es geht“, empörte sich etwa der IG-Bauleiter Max Faust. Er wusste auch sogleich Abhilfe: „Bezüglich der Behandlung der Häftlinge habe ich zwar stets dagegen opponiert, dass Häftlinge auf der Baustelle erschossen oder halbtot geschlagen werden. Ich stehe jedoch auf dem Standpunkt, dass eine Züchtigung in gemäßigten Formen unbedingt notwendig ist, um die nötige Disziplin unter den Häftlingen zu wahren.“
Die Selektionen
Das Mittel der Wahl, um die Arbeitsleistung nicht abfallen zu lassen, waren für die IG aber die Selektionen. Diese fanden immer dann statt, wenn die Krankenstation keine Betten mehr frei hatte oder der Krankenstand eine bestimmte Quote überstieg. Beschwerden über einzelne Gefangene konnten ebenfalls als Anlass dienen. Dabei machten die Schergen die Entscheidung über „Arbeiten oder Gaskammer“ auch immer davon abhängig, wie erfolgreich es der Wehrmacht auf ihren Feldzügen gelang, neue Arbeitskräfte-Reservoirs für Monowitz auszuheben. Oftmals kam es gleich nach den Dienstbesprechungen zwischen IG und SS zu Selektionen. Die Aussonderungen selber nahmen SS-Ärzte vor. Kurzzeitig betraute der Mörder-Konzern sogar einen eigenen Angestellten mit dieser Aufgabe: den BAYER-Mediziner Helmuth Vetter, der „hauptberuflich“ jedoch medizinische Experimente mit den Häftlingen durchführte.
Was es für die KZ-InsassInnen bedeutete, wenn es galt, „den Gesamtbestand an Häftlingen auf seine Arbeitsfähigkeit zu überprüfen“, wie es offiziell hieß, schildert Elie Wiesel in seinem Buch2. Das Unheil kündigte sich mit einem Verbot an, abends den Block zu verlassen. „Bald darauf lief ein schreckliches Wort durch das Lager: die Selektion“, schreibt Wiesel2. Fieberhaft bereiteten die Gefangenen sich darauf vor und versuchten etwa verzweifelt, mit sportlichen Übungen etwas Farbe in ihre ausgemergelten Gesichter zu bringen. Wiesel folgte dem Rat eines älteren Gefangenen, möglichst schnell an Mengele und seinen Helfershelfern vorbeizulaufen, um auf diese Weise seine Gesundheit zu demonstrieren. Und es gelang ihm schließlich auch, dem kritischen Blick der ÄrztInnen standzuhalten. Aber sein Vater erlitt einen Schock: Er fand sich auf der Liste der Mediziner wieder und musste ein zweites Mal antreten. Er wollte dem Sohn schon all seine „Kostbarkeiten“ – ein Messer und einen Löffel – abtreten, kam aber schließlich doch noch einmal mit dem Leben davon.
Selbst den Todesmarsch von Auschwitz nach Buchenwald, zu dem die Nazis die Gefangenen zwangen, weil die Rote Armee sich Auschwitz näherte, überlebte Shlomo Wiesel. Unter großen Anstrengungen überstand er die 70 Kilometer lange Strecke bei bitterer Kälte bis nach Gleiwitz und die anschließende strapaziöse Reise in Viehwaggons zum endgültigen Bestimmungsort.
Erst in Buchenwald verließen ihn endgültig die Kräfte. Auch seine Frau Sarah und seine jüngste Tochter Tsipora starben im Lager, während Beatrice und Hilda ebenso wie Elie dem Tod entrinnen konnten. Wiesels Zeit in Auschwitz, die ihn schon in der ersten Nacht zu der Wehklage „Nie werde ich das vergessen“ bewegte, endete nach der Befreiung in seinem Krankenzimmer mit dem ersten Blick in den Spiegel seit langer Zeit. „Aus dem Spiegel blickte mich ein Leichnam an. Sein Blick verlässt mich nie mehr“, lauten die letzten Zeilen von „Die Nacht“.
Nach dem Krieg kam Elie gemeinsam mit 400 weiteren Kindern, die in den KZs ihre Eltern verloren hatten, nach Frankreich. Ein von einer jüdischen Organisation geleitetes Waisenhaus in der Normandie nahm den Jungen und seine Schwestern Beatrice und Hilda auf. Nach dem Abitur studierte Wiesel in Straßburg und Paris und arbeitete anschließend als Journalist. Das Thema „Auschwitz“ allerdings mied er. Erst Mitte der 1950er Jahre konnte Elie Wiesel sich dieser Erfahrung stellen. Den Anstoß dazu gab eine Begegnung mit dem französischen Schriftsteller François Mauriac. Auf einer Schiffsreise brach dann ein 862 Seiten starkes Konvolut aus Wiesel heraus, nicht von ungefähr in seiner Muttersprache Jiddisch geschrieben. Stark gekürzt, entstand daraus schließlich „Die Nacht“. Die französische Fassung erschien 1958. Zwei Jahre später folgte die Übersetzung ins Englische. Zunächst verkaufte sich das Buch schlecht; erst allmählich fand es Absatz. Schlussendlich entwickelte es sich jedoch zu einem Welterfolg.
Die (Nicht-)Entschuldigung
Wiesel ließen die dunklen Jahre fortan nicht mehr los. Unzählige Werke, Reden und Aufsätze widmete er ihnen, immer wieder trat er als Mahner auf. Noch als über 80-Jähriger hielt er 2009 eine Rede in Buchenwald. Zu einer denkwürdigen (Wieder)Begegnung mit BAYER kam es im Jahr 1995. An seinem US-amerikanischen Stammsitz in Pittsburgh unterstützte der Leverkusener Multi die dortige jüdische Gemeinde seit Längerem mit großzügigen Spenden. Auch eine „Anne Frank“-Ausstellung, zu der Elie Wiesel als Redner eingeladen war, sponserte der Pharma-Riese. Eine Gruppe um den Historiker David Rosenberg, die dieses Engagement kritisch sah, weil der Konzern es nicht mit einer Aufarbeitung seiner Rolle im „Dritten Reich“ verband, kontaktierte Wiesel daraufhin und machte ihn auf den großen Anteil BAYERs an der unheilvollen Geschichte der IG FARBEN aufmerksam. Der Schriftsteller reagierte prompt und sagte die Veranstaltung ab. Daraufhin griff der damalige US-Chef von BAYER, Helge Wehmeier, persönlich zum Telefon und bot Wiesel an, öffentlich eine Entschuldigung für die damaligen Verbrechen auszusprechen, wenn er sich umstimmen ließe. Elie Wiesel willigte ein, und Wehmeyer hielt Wort. Vor einem Publikum von rund 1.800 Menschen erklärte der BAYER-Manager, dass er „Elie Wiesel und alle anderen Betroffenen für die Taten der IG FARBEN und des deutschen Volkes um Entschuldigung bitte“. „Trauer, Bedauern und Scham“ brachte Wehmeier zum Ausdruck.
An die Presse geben wollte BAYER die Rede jedoch zunächst nicht. David Rosenberg und seine Mitstreiter vom COMMITTEE FOR APPROPRIATE ACKNOWLEDGMENT (Komitee für einen angemessenen Umgang mit der Schuld, Anm. SWB) mussten gehörig Druck aufbauen, bis der Multi sich doch noch bereitfand, die Worte Wehmeiers einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Und die Konzern-Zentrale in Deutschland tat alles, um den Akt als eine persönliche Angelegenheit des Managers darzustellen. Eine offizielle Entschuldigung von Seiten des Konzerns für seine Untaten während der NS-Zeit – dazu erklärte sich der Multi nicht bereit, 1995 so wenig wie 1945. Es existierte noch nicht einmal ein Schuldbewusstsein. Bei den Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozessen zu Buna und der Zwangsarbeit befragt, antwortete das ehemalige IG-Vorstandsmitglied Fritz ter Meer schlicht: „Den Häftlingen ist dadurch kein besonderes Leid zugefügt worden, da man sie ohnedies getötet hätte.“ Die RichterInnen folgten solch fadenscheinigen Entlastungsversuchen nicht und verurteilten ter Meer zu sieben Jahren Haft. Noch 1988 prangerte BAYERs Firmen-Chronik „Meilensteine“ dies als Sieger-Justiz an: „In der Industrie war man bestürzt über dieses Urteil. Man wusste, dass ter Meer kein Nazi gewesen war.“ Die Bestürzung brauchte damals allerdings nicht lange anzuhalten. Da der heraufziehende Kalte Krieg ein milderes Klima für die Verbrecher des alten Krieges mit sich brachte, kam der IG-Manager wegen „guter Führung“ schon nach zwei Jahren frei – und heuerte flugs wieder bei BAYER an. Noch lange nach seinem Tod ließ es sich der Leverkusener Multi nicht nehmen, Blumen auf seinem Grab niederzulegen. Erst nach energischer Kritik der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN stellte der Konzern diese Gedenkpraxis ein.
Selbst in den späten 1990er Jahren, als die ZwangsarbeiterInnen ihre Ansprüche geltend machten und die Vergangenheit den Leverkusener Multi damit massiv einholte, zeigte er sich nicht zu einer Entschuldigung für die Konzern-Verbrechen wie etwa den rund 30.000 Toten von Buna und den ca. 300.000 von der IG versklavten ArbeiterInnen bereit. David Rosenberg war 1999 extra nach Deutschland zur BAYER-Hauptversammlung gereist, um den Global Player dazu zu bewegen, sich seiner Geschichte zu stellen. Aber das Management erteilte ihm eine schnöde Abfuhr. Es erklärte sich schlicht für nicht zuständig. Er hätte Dinge vorgetragen, die BAYER als Unternehmen nicht beträfen, da es 1951 neu gegründet worden sei, gab der damalige Vorstandschef Manfred Schneider Rosenberg zu verstehen. Mit all dem, was vorher war, hatte die Aktiengesellschaft nach Ansicht des Großen Vorsitzenden deshalb nichts mehr zu tun. Die Vorstandsriege des Jahres 1999 könne sich nicht für etwas entschuldigen, wofür sie nicht selbst verantwortlich ist, so seine Worte sinngemäß. Und in Sachen „Entschädigung“ für die ZwangsarbeiterInnen verwies Schneider auf die Bundesstiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“.
An diese hatten BAYER & Co. die Forderungen der SklavenarbeiterInnen delegiert. Und obwohl die Unternehmen nur 50 Prozent des Stiftungskapitals aufbringen mussten, weil der Staat die andere Hälfte beisteuerte, geizten die Konzerne mit Zahlungen und zogen die Verhandlungen mit den Opferverbänden schamlos in die Länge. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN schaltete sich deshalb gemeinsam mit dem COMMITTEE FOR APPROPRIATE ACKNOWLEDGMENT in diesen Prozess ein. Im Rahmen dieser transatlantischen Kooperation reiste der damalige CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes auf Einladung der jüdischen Gemeinde von Pittsburgh zusammen mit dem ehemaligen Zwangsarbeiter Hans Frankenthal sogar zu einer Konferenz über den großen Teich, um dort für eine angemessene Entschädigung einzutreten.
Und kleine Spuren hat das Engagement der beiden Gruppen in der Stadt bis heute hinterlassen. Der in Pittsburgh erscheinende Jewish Chronicle kam in seinem Nachruf auf Elie Wiesel nicht umhin, an die Wehmeier-Entschuldigung, aus der dann keine BAYER-Entschuldigung wurde, zu erinnern.
1 zit. n. Otto Köhler: Unsere Welt in Auschwitz; junge Welt 7.4.16
2 leicht korrigierte Übersetzung
AKTION & KRITIK
CBG bei den TTIP-Protesten
Über 300.000 Menschen haben am 17. September 2016 an den Demonstrationen gegen die Handelsabkommen TTIP und CETA teilgenommen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) ging in Köln auf die Straße, um gegen die von der EU geplanten Vereinbarungen mit Kanada und den USA zu protestieren, denn diese halten diverse Schmankerl für BAYER & Co. bereit. Allein den TTIP-Effekt, der vor allem durch niedrigere Zölle und vereinheitlichte Regulierungsverfahren entsteht, beziffert der Leverkusener Multi auf einen dreistelligen Millionen-Betrag im Jahr. Auch von laxeren Standards für Pestizide, Gen-Pflanzen und hormonell wirksame Stoffe wie Bisphenol A sowie von privaten Schiedsgerichten zum Investitionsschutz hofft der Konzern zu profitieren. „Für Deutschland ist es ein Muss, hier dabei zu sein“, sagt BAYERs Aufsichtsratschef Werner Wenning deshalb. Für die CBG war es da natürlich ein Muss, bei den Protesten dabei zu sein.
Proteste gegen BAYERs MONSANTO-Coup
Mit vielen Aktionen hatte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) versucht, BAYERs MONSANTO-Übernahme zu verhindern. Noch am 8. September 2016, knapp eine Woche, bevor der bundesdeutsche Agro-Multi Vollzug meldete, zog die CBG gemeinsam mit der UMWELTGEWERKSCHAFT und anderen Gruppen vor das Tor 1 des Leverkusener Werks, um vor den Auswirkungen des Deals auf die Beschäftigten, die VerbraucherInnen, die LandwirtInnen und die Menschen in den Armutsregionen zu warnen.
Offener Brief wg. BAYTRIL & Co.
Anfang August 2016 vermeldete das „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-Sicherheit“ (BVL) einen Anstieg des Gebrauchs von Antibiotika aus den Klassen der Cephalosporine und der Fluorchinolone, zu denen BAYERs BAYTRIL zählt. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) nahm das zum Anlass, einen Offenen Brief an den Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) zu initiieren. Sie sah Gefahr im Verzuge, weil Fluorchinolone und Cephalosporine in der Humanmedizin zu den Reserve-Antibiotika zählen, die nur zum Einsatz kommen, wenn andere Mittel bereits versagt haben. Und durch den massenhaften Einsatz von BAYTRIL & Co. in den Ställen drohen auch diese Substanz-Gruppen mehr und mehr zu versagen. Durch die Dauerdröhnung gewöhnen sich die Krankheitserreger nämlich zunehmend an die Präparate. Gelangen die Keime dann in den menschlichen Organismus, ist kein Kraut mehr gegen sie gewachsen. Darum forderte die CBG gemeinsam mit den ÄRZTEN GEGEN MASSENTIERHALTUNG, GERMAN WATCH, HEJSUPPORT, dem PESTIZID AKTIONS-NETZWERK und den TIERÄRZTEN FÜR VERANTWORTBARE LANDWIRTSCHAFT, die Verwendung von Reserve-Antibiotika in der Massentierhaltung zu verbieten. Zudem zweifelten die Initiativen die Aussage des „Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittel-Sicherheit“ (BVL) an, dass die Antibiotika-Gaben abgesehen von den Cephalosporinen und den Fluorchinolonen zurückgingen. Dabei stützt sich die Behörde nämlich nur auf einen Rückgang der verwendeten Mengen. Und diese Zahlen sagen für sich genommen herzlich wenig aus, denn bei den neueren Präparaten ist weniger mehr. Während eine Tonne des Alt-Antibiotikums Tetracyclin gerade einmal für 39.000 Mastschweine langt, können die LandwirtInnen mit einer Tonne von BAYERs BAYTRIL 2,2 Millionen Tiere versorgen. (Kurz vor dem Ticker-Redaktionsschluss korrigierte das BVL seine Angaben. Demnach nahm der Gebrauch von Fluorchinolonen nicht zu, sondern leicht von 12,3 auf 10,6 Tonnen ab. Bei den Cephalosporinen der 3. Und 4. Generation gingen die Verordnungen um 100 Kilogramm auf 3,6 Tonnen zurück. Ein Grund zur Entwarnung ist das jedoch nicht, Anm. Ticker.)
Offener Brief zu Pseudo-Hormonen
Chemische Stoffe haben viele gesundheitsgefährdende Eigenschaften. Eine der unheimlichsten: Manche Substanzen wirken ähnlich wie Hormone und können damit den menschlichen Organismus gehörig durcheinanderwirbeln (siehe auch SWB 4/16). Pestizide des Leverkusener Multis wie RUNNER, PROVOST OPTI, FOLICUR und NATIVO oder Industrie-Chemikalien made by BAYER wie Bisphenol A sind deshalb imstande, Krebs, Diabetes, Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit und andere Gesundheitsstörungen auszulösen. Hormonell wirksame Ackergifte wollte die EU eigentlich schon 2009 im Rahmen einer Neuordnung der Zulassungsgesetze verbieten. Dazu kam es allerdings nicht. Nach Ansicht Brüssels galt es zunächst, genaue Kriterien zur Definition der Pseudo-Hormone – sogenannter „endokriner Disruptoren“ (EDCs) – zu entwickeln. Mit drei Jahren Verspätung legte die Europäische Kommission den entsprechenden Entwurf im Sommer 2016 vor. Die Bestimmungen kehren jedoch die Beweislast um und fordern eindeutige Belege für die gesundheitsschädliche Wirkung der EDCs; ein plausibler Verdacht reicht Juncker & Co. nicht aus. Da dies nicht dem Vorsorge-Prinzip entspricht, hat das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK einen Offenen Brief an die bundesdeutschen RepräsentantInnen der EU-Fachausschüsse initiiert, der auf Veränderungen dringt. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hat das Schreiben mitunterzeichnet.
Tote Bienen vor BAYER-Gebäude
Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide wie BAYERs Saatgutbehandlungsmittel GAUCHO (Wirkstoff: Imidacloprid) und PONCHO (Clothianidin) gelten als besonders bienengefährlich. Die EU hat diese Stoffe deshalb ebenso wie andere Ackergifte dieser Substanz-Klasse bereits mit einem vorläufigen Verkaufsbann belegt. Aber auch anderswo werden entsprechende Forderungen laut. So zog im Juni 2016 ein Protestzug von BienenzüchterInnen, LandwirtInnen und UmweltaktivistInnen unter der Losung „Haltet die Bienenstöcke am Leben“ quer durch die USA. Vier Millionen Unterschriften zum Stopp von GAUCHO & Co. hatte er im Gepäck. Am 20. Juni machte der Treck Halt vor der Niederlassung des Leverkusener Multis in Durham und lud dort 2,6 Millionen tote Bienen ab. Die TeilnehmerInnen der Karawane verglichen die Folgen der Neonicotinoide mit denen von DDT. Weil Bienen wichtige Dienste als Bestäuber von Getreide-Pflanzen und anderen Ackerfrüchten leisten, warnten die ProtestlerInnen zudem vor den Auswirkungen des Bienensterbens auf die Lebensmittel-Versorgung. Diese Risiken und Nebenwirkungen ignorieren BAYER & Co. Und zwar komplett: Sie gehen nur ihren Profit-Interessen nach. „Wenn wir der Agrochemie-Industrie eine Fortsetzung dieser kurzsichtigen Praxis erlauben, werden die Kosten für Lebensmittel wegen der Verknappung des Angebots steigen“, prophezeite deshalb Scott Nash von der Bioladen-Kette MOM’S ORGANIC MARKET.
Das CIPROBAY-Desaster
BAYERs Antibiotikum CIPROBAY mit dem Wirkstoff Moxifloxacin, der zur Gruppe der Fluorchinolone gehört, hat zahlreiche Nebenwirkungen. So registrierte die US-Gesundheitsbehörde FDA zwischen 1998 und 2013 etwa 3.000 Todesfälle, die im Zusammenhang mit fluorchinolon-haltigen Medikamenten stehen. Insgesamt erhielt die FDA rund 50.000 Meldungen über unerwünschte Arznei-Effekte. Am häufigsten treten Gesundheitsschäden im Bereich der Sehnen, Knorpel, Muskeln und Knochen auf. Die Pharmazeutika stören nämlich das Zusammenspiel zwischen Nerven und Muskeln, indem sie die Weiterleitung des Neurotransmitters Acetylcholine behindern. Auch Störungen des Zentralen Nervensystems, die sich in Psychosen, Angst-Attacken, Verwirrtheitszuständen, Schlaflosigkeit oder anderen Krankheitsbildern manifestieren, beobachten die MedizinerInnen. Darüber hinaus sind CIPROBAY & Co. für Herzinfarkte, Unterzuckerungen, Hepatitis, Autoimmun-Krankheiten, Leber- oder Nierenversagen und Erbgut-Schädigungen verantwortlich. Der US-amerikanische Mediziner Dr. Jay Cohen hat dazu jetzt ein Buch geschrieben. „Wie wir die CIPRO- und LEVAQUIN-Katastrophe stoppen können – das größte medizinische Desaster der US-Geschichte“ lautet der Titel vielsagend.
BAYERs Lernpläne durchkreuzen!
Der Leverkusener Multi tut viel, um zukünftige Generationen für sich zu gewinnen. Er erstellt unter anderem Unterrichtsmaterialien, schickt rollende Chemie-Labore durch die Lande und sponsert Schulen. Mit Wimmelbüchern „beglückt“ er sogar schon Kindergärten (SWB 2/16). Und mit diesem Engagement steht der Konzern nicht allein da: 16 der 20 größten deutschen Unternehmen betätigen sich – unbehelligt von den Schulbehörden – auf dem Feld der Bildung. Dabei profitieren sie von der Finanzschwäche der Kommunen, die es nicht mehr schaffen, die Einrichtungen angemessen auszustatten. Der Frankfurter Wissenschaftler Tim Engartner hat jetzt Maßnahmen gegen den pädagogischen Eros von BAYER & Co. gefordert. Seiner Meinung nach „bedarf es angesichts der inhaltlichen Einflussnahme durch Privatakteure eines eindeutigen staatlichen Regelwerks, das die Trennung zwischen Schule und Privatwirtschaft garantiert“.
PCB: VBE schlägt Alarm
Polychlorierte Biphenyle (PCB) gehören zu den giftigsten Hervorbringungen der Chlorchemie (SWB 1/14). Die vor allem von BAYER und MONSANTO in Umlauf gebrachten, gefährlichen „Alleskönner“ kamen bis zu ihrem vollständigen Verbot 1989 in Elektrogeräten, Fugendichtungsmassen, Farben, Ölen, Lacken und Bodenbelägen zum Einsatz – und stellen immer noch ein beträchtliches Risiko dar. In Deutschland weisen besonders öffentliche Gebäude hohe Belastungen auf; rund 24.000 Tonnen PCB „beherbergen“ sie. Nach Schätzungen des Bundesumweltamts (UBA) ist jede dritte Schule kontaminiert. Eine Beteiligung an den Dekontaminationsarbeiten lehnt der Leverkusener Multi jedoch ab. „Die Sanierung PCB-belasteter Gebäude liegt (...) nicht in unserem Verantwortungsbereich“, verlautet aus der Firmen-Zentrale. Allzu häufig kommt es jedoch gar nicht erst zu solchen Sanierungen. Die Entscheidungsgrundlage für diese stellt nämlich die PCB-Richtlinie dar; und diese erklärt selbst eine Konzentration des Stoffes in der Atemluft für unbedenklich, wenn diese um den Faktor 50 über dem Richtwert der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt. Udo Beckmann von der LehrerInnen-Vereinigung „Verband Bildung und Erziehung“ kritisiert das vehement: „Die Politik spielt mit der Gesundheit von Lehrkräften und Schülern. Obwohl PCB von der ‚Internationalen Agentur für Krebsforschung’ in die höchste Gefahren-Gruppe eingeordnet wurde, gelten in Deutschland völlig veraltete Richtlinien.“ Es passe nicht zusammen, dass LehrerInnen SchülerInnen zu umweltbewussten BürgerInnen erziehen sollen, während die Ausbildungsstätten PCB-verseucht sind, so Beckmann. „Die Beschäftigten an den Schulen und Hochschulen sowie die Schüler und Studenten haben einen Anspruch auf belastungsfreie Unterrichtsräume“, hält der Pädagoge fest.
Gen-Raps unter Beobachtung stellen!
2015 hatte ein in der EU nicht zugelassener Gen-Raps von BAYER das Saatgut einer konventionellen Züchtung verunreinigt. In der Pflanze, welche die französische Firma RAGT entwickelt hat, fanden sich Spuren des gegen die Herbizid-Wirkstoffe Bromoxynil und Ioxynil immunen Raps’ NAVIGATOR. RAGT strebte für sein Produkt eine Zulassung in EU-Ländern an. Deshalb fand ein Probe-Anbau in England, Frankreich, Dänemark und Deutschland statt. Nach Bekanntwerden des Skandals haben die hiesigen Behörden sofort die Anweisung erteilt, die auf 48 Versuchsfeldern in verschiedenen Bundesländern kultivierten Pflanzen zu zerstören. Das reicht als Maßnahme jedoch nicht aus, denn die Laborfrucht hat eine lange Halbwertzeit und bleibt lange keimfähig. „Daher müssen die Bundesländer die betroffenen Flächen über 20 Jahre hinweg überwachen und auflaufenden Durchwuchs-Raps vernichten“, forderte Annemarie Volling von der ARBEITSGEMEINSCHAFT BÄUERLICHE LANDWIRTSCHAFT (AbL). Unterstützung erfuhr der Verband dabei von der IG SAATGUT und dem GENETHISCHEN NETZWERK.
KAPITAL & ARBEIT
Tarifrunde 2016: 3 Prozent mehr
BAYER fährt von Jahr zu Jahr höhere Gewinne ein. Im Geschäftsjahr 2015 wuchs das Konzern-Ergebnis um 18,6 Prozent auf rund 1,380 Milliarden Euro. Die Beschäftigten profitieren davon jedoch kaum. Bei den diesjährigen Tarif-Verhandlungen vereinbarte die Chemie-Branche mit den Gewerkschaften Ende Juni 2016 lediglich eine Entgelt-Anhebung von 3 Prozent für die nächsten 13 Monate. Dann folgt für die 11-monatliche Restlaufzeit des Tarifvertrages noch einmal ein Aufschlag von 2,3 Prozent.
H.C. STARCK in Schwierigkeiten
Im Zuge der „Konzentration auf das Kerngeschäft“ hat BAYER viele Unternehmensteile abgestoßen. Eine aussichtsreiche Zukunft erwartete die Abteilungen in der Regel nicht. Besonders kleinere Sparten wie DYSTAR, DYNEVO, TANATEX, KRONOS TITAN und AGFA gerieten in Schwierigkeiten. Entweder gingen sie Pleite, schrumpften empfindlich oder wurden von anderen Konzernen geschluckt. Aktuell sieht sich H.C. STARCK mit ernsten Problemen konfrontiert. Das Unternehmen hat massive Finanz-Probleme. Der Leverkusener Multi hatte den Spezialchemie-Hersteller nämlich an zwei Finanzinvestoren veräußert, die H.C. STARCK die Kaufsumme als Schulden in die Bücher geschrieben haben. Nun muss die Firma Arbeitsplätze vernichten und andere Restrukturierungsmaßnahmen durchführen, um neue Kredite zu erhalten.
Verändertes Schichtsystem
Der BAYER-Konzern hat an seinem Pestizid-Standort Hürth-Knapsack in Kooperation mit dem Betriebsrat das Schichtsystem geändert. Das bisherige 4-Schichtsystem wurde „aus arbeitsmedizinischen und organisationstechnischen Erwägungen“ durch das beim Leverkusener Multi auch sonst übliche 5-Schichtmodell ersetzt. Dieses erlaubt jetzt längere Ruhe-Phasen vor den Schicht-Wechseln. Auch führt es zu kürzeren Wochenarbeitszeiten. Der Konzern wollte deshalb sogleich die Entgelte entsprechend senken, konnte sich damit aber nicht ganz durchsetzen. „Letztlich haben die Betriebsräte in Knapsack für die Kollegen am Standort einen guten Kompromiss mit einer attraktiven finanziellen Abfederung erreichen können“, so der Betriebsratsvorsitzende Franz-Josef Christ.
ERSTE & DRITTE WELT
Entwicklungshilfe zur Selbsthilfe
Seit einiger Zeit haben die Global Player auf der Suche nach neuen Absatz-Gebieten die „Low-income Markets“ entdeckt (siehe auch SWB 4/13). So entwickelte der Leverkusener Multi bereits 2013 eine „Afrika-Strategie“. Bei der Umsetzung geriert sich der Agro-Riese gerne als Entwicklungshelfer. „BAYER kooperiert mit der gemeinnützigen Organisation ‚Fair Planet’ und wird Teil des Projekts ‚Bridging the Seed Gap’ in Äthiopien. Ziel des Projekts ist es, neue Anbau-Möglichkeiten für Kleinbauern zu schaffen“, vermeldete der Konzern etwa Anfang 2016. Auch LandwirtInnen-Verbände und Hochschulen sitzen mit im Boot. Und bei der Unterzeichnung des Vertrags waren sogar RegierungsvertreterInnen zugegen. Nur handelt es sich leider bei „Fair Planet“ um einen Verband, den BAYER, SYNGENTA, LIMAGRAIN & Co. seit Längerem großzügig unterstützen. Zudem bestehen die neuen „Anbau-Möglichkeiten für Kleinbauern“ lediglich aus Tomaten-, Peperoni- und Zwiebel-Saatgut made by BAYER. Diese können die FarmerInnen zunächst kostenlos testen. Anschließend müssen sie für diese Sorten allerdings die Werbetrommel rühren. „Sie sollen dann weiteren Landwirten in den Dörfern und Regionen die Vorteile dieses Saatguts demonstrieren“, so lautet der Business-Plan des Konzerns. Bei näherem Hinsehen wird also aus der angeblichen Entwicklungshilfe pure Markterschließung.
Die „Neue Allianz“ in der Kritik
Im Jahr 2012 gründeten die Teilnehmer-Staaten des G8-Treffens gemeinsam mit BAYER, MONSANTO und anderen Firmen die „Neue Allianz für Lebensmittelsicherheit und Ernährung“. Mit Entwicklungshilfe hat diese Public-Private-Partnership allerdings nicht viel im Sinn. Sie dient den Konzernen vielmehr als Vehikel, um in Afrika die Rahmenbedingungen für eine industrielle Landwirtschaft mittels Gentechnik und allem Drum und Dran durchzusetzen. So dringen die Global Player etwa darauf, die „Verteilung von frei verfügbarem und nicht verbessertem Saatgut systematisch zu beenden“. Zudem fordern sie einen stärkeren Patentschutz, Landrechtsreformen, „effizientere“ Pestizid-Zulassungsverfahren und Maßnahmen gegen die Produkt-Piraterie. Dafür fließen öffentliche Mittel en masse: Die G8-Staaten gaben bereits über drei Milliarden Euro frei, während BAYER & Co. noch nicht einmal eine Milliarde zubutterten. Dies zog jetzt die Kritik des Europa-Parlaments auf sich. Die Abgeordneten forderten, die Strategie der Allianz komplett zu ändern. Sie müsste sich mehr auf die Kleinbauern und -bäuerinnen konzentrieren, den lokalen Saatguthandel schützen und dürfe nicht mehr länger dem Landraub Vorschub leisten, so die ParlamentarierInnen. Dem entwicklungspolitischen Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Uwe Kekeritz, ging das jedoch nicht weit genug. Er verlangte von der Bundesregierung, auf eine Auflösung der „Neuen Allianz“ zu dringen: „Die Reform der 2012 von der G8 gegründeten Allianz ist angesichts ihrer grundlegend falschen Ausrichtung aussichtslos.“
Die „Neue Allianz“ in der Kritik
Die „Neue Allianz für Lebensmittelsicherheit und Ernährung“, die von den G8-Staaten gemeinsam mit BAYER, MONSANTO und anderen Firmen 2012 initiierte Public-Private-Partnership (s. o.), heizt das Landgrabbing an. Zu diesem Resultat kommt die Studie „Land grabbing and human rights“, die das Europäische Parlament in Auftrag gegeben hat. So verloren in Tansania mehr als 1.300 Bauern und Bäuerinnen ihr Land, weil das „Neue Allianz“-Mitglied ECOENERGY vom Staat 20.374 Hektar Ackerfläche erworben hat, um dort eine Zucker-Plantage anzulegen. Auch ganz allgemein fördern die Aktivitäten der Allianz der Untersuchung zufolge die Bodenspekulation und die Landkonzentration, denn die Devise von BAYER & Co. lautet: „Think Big“. Afrikanische FarmerInnen-Verbände kritisieren das Vorgehen der Multis deshalb massiv. Auch die AutorInnen der Untersuchung sehen nur negative Effekte. Aus diesem Grund fordern sie die EU-Mitgliedsländer unter den G8-Nationen auf, der „Neuen Allianz für Lebensmittelsicherheit und Ernährung“ die Unterstützung zu entziehen.
Patente: Ausnahmen nur bis 2033
Mit Patenten auf Pharmazeutika sichern sich BAYER & Co. Monopol-Profite. Dieses Vorgehen macht die Arzneien besonders für Menschen in armen Ländern unerschwinglich. Wenn diese Staaten trotzdem versuchen, sich den Zugang zu den benötigten Medikamenten zu sichern, indem sie sich – wie Südafrika im Jahr 2001– auf einen Ausnahme-Paragrafen des internationalen TRIPS-Patentschutzabkommens berufen, bemühen BAYER und die anderen Pillen-Riesen gern einmal die Gerichte (siehe SWB 2/01). Nur für die ärmsten der armen Nationen, die „least-developed countries“ (LDCs), galten bis zum Januar 2016 eigene Regelungen. Bei den neuen Verhandlungen um diesen Sonderstatus haben die VertreterInnen der LDCs eine unbefristete Verlängerung gefordert. Die Welthandelsorganisation WTO beugte sich allerdings dem Druck von Big Pharma und gewährte nur einen Aufschub bis 2033.
BAYER senkt JADELLE-Preis
„Fünf gegen das Wachstum der Bevölkerung investierte Dollar sind wirksamer als hundert für das Wirtschaftswachstum investierte Dollar“, sagte einst der ehemalige US-Präsident Lyndon B. Johnson. Zu diesen „wirksamen Investitionen“, die Entwicklungshilfe sparen helfen, gehört auch BAYERs Verhütungsmittel-Implantat JADELLE. Das Medizin-Produkt mit dem Wirkstoff Levonorgestrel ist für die BevölkerungskontrolleurInnen nämlich ziemlich praktisch, verrichtet es seine Dienste doch fünf Jahre lang. Für die Frauen allerdings weniger: Unter anderem klagen sie über Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Depressionen, Gewichtszunahme und Haarausfall. Großeinkäufern wie etwa der „Bill & Melinda Gates Foundation“ hat der Leverkusener Multi bisher schon große Rabatte eingeräumt. Anfang des Jahres hat er eine generelle Preis-Senkung für Entwicklungsländer verkündet. Statt rund 18 Dollar pro Implantat berechnet er jetzt nur noch die Hälfte.
POLITIK & EINFLUSS
BAYERs EU-Frühstücke
„Um Unternehmensvertreter über aktuelle Entwicklungen zu informieren“, organisiert die Lobby-Firma AMISA2 „monatlich Frühstücksdebatten mit Schlüssel-Persönlichkeiten der EU-Institutionen“. BAYER, GOOGLE, AIRBUS und 15 weitere Konzerne durften auf diese Weise schon einen „Blick in die Zukunft der Klimapolitik“ werfen – eröffnet von der damals als EU-Kommissarin für den Klimaschutz fungierenden Connie Hedegaard – oder mit der stellvertretenden Generalsekretärin der EU-Kommission, Marianne Klingbeil, zusammentreffen.
VCI spendet 128.000 Euro
Im Jahr 2015 hat der „Verband der Chemischen Industrie“ (VCI) 128.000 Euro in Parteispenden investiert. Mit je 40.000 Euro erhielten CDU und FDP am meisten. Die SPD bedachte der Lobby-Club von BAYER & Co. mit 35.000 Euro, die Grünen konnten 13.000 Euro verbuchen. Nur die Partei „Die Linke“ ging leer aus. Dabei wird der VCI nicht nur proaktiv tätig. Es gibt auch direkte „Spenden-Anfragen der Schatzmeister oder Spitzenkandidaten der Parteien im Zusammenhang mit Bundestags-, Landtags- und Europawahlen“, wie der Verband mitteilt.
Kerins im USCC-Vorstand
Bei dem „U.S. Chamber of Commerce“ (USCC) handelt es sich um den größten Unternehmensverband der Welt. Und seit Dezember 2015 sitzt BAYERs oberster Öffentlichkeitsarbeiter in den USA, Raymond Kerins Jr., dort im Vorstand. Welche Auffassung er vom Verhältnis der Ökonomie zur Politik hat, machte der PR-Profi gleich bei seinem Amtsantritt deutlich. Da bezeichnete Kerins Jr. es als eine der Aufgaben des USCC, die MandatsträgerInnen darin zu unterweisen, wie sie das Wachstum der US-amerikanischen Wirtschaft am besten aufrechterhalten könnten.
BAYER sponsert Rohstoff-Behörde
Die „Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe“ (BGR) berät nach eigener Auskunft „die Bundesregierung und die deutsche Wirtschaft in allen geowissenschaftlichen und rohstoff-wirtschaftlichen Fragen“. Da der Zugriff auf Bodenschätze für den Leverkusener Multi eine enorme Bedeutung hat, gehört er mit zu den Unternehmen, welche die BGR seit 1982 indirekt sponsern. Seit 1987 tun BAYER & Co. dies über die „Hans-Joachim-Martini-Stiftung“, welche die milden Gaben als Preisgelder oder als Forschungsförderung tarnt. Die Investition lohnt sich, denn die Ergebnisse der BGR-Expertisen fallen fast immer im Sinne der Industrie aus. So erteilte die Bundesanstalt dem Fracking eine Unbedenklichkeitserscheinung und leugnete in Studien weitgehend den Zusammenhang zwischen dem Kohlendioxid-Ausstoß der Konzerne und dem Klimawandel. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) hatte in einer internen Revision zwar Anstoß an der Praxis der Stiftung genommen, zog aber bislang keine Konsequenzen. Die Partei Bündnis 90/Die Grünen nahm die Vorgänge zum Anlass, eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung zu stellen. Diese sieht jedoch keinen Handlungsbedarf. „Die BGR ist eine eigenständige wissenschaftlich-technische Behörde, an deren Unabhängigkeit die Bundesregierung keinen Zweifel hat“, hielten Merkel & Co. fest.
Ökosteuer-Ausnahmen bleiben
Im Zuge der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes wollte die Große Koalition ursprünglich den Strom, den die Konzerne mit ihren eigenen Kraftwerken produzieren, ökosteuerpflichtig machen. Sofort brach ein Sturm der Entrüstung los. „Auch wenn die überfällige EEG-Reform nun endlich auf dem Weg ist, die Mehrbelastung der Eigenstrom-Erzeugung ist ein unüberwindlicher Stolperstein und für unsere Branchen nicht hinnehmbar. Jene Unternehmen, die ihren Strom in eigenen Kraftwerken vor allem in Kraft-Wärme-Kopplung und sehr effizient herstellen, hätten dadurch Mehrkosten von insgesamt über 300 Millionen Euro im Jahr“, erklärte der „Verband der Chemischen Industrie“ (VCI). Und der Leverkusener Multi, der fast 60 Prozent seines Energie-Bedarfs selber deckt, warnte: „Unsere KWK-Anlagen würden sich, sollten diese Pläne umgesetzt werden, nicht mehr wirtschaftlich betreiben lassen, sowohl die bestehenden als auch die neuen.“ Und die Politik erhörte die Signale. Alte Anlagen blieben von der Umlage befreit, modernisierte müssen nur 20 Prozent und neue 40 Prozent des Satzes zahlen. Die EU legte allerdings ein Veto ein, denn sie sah in den gewährten Rabatten eine unerlaubte Beihilfe. Aber Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel konnte die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestagen im August 2016 „nach intensiven Gesprächen“ umstimmen und Bestandsschutz für die Ausnahme-Regelungen erwirken.
PROPAGANDA & MEDIEN
BAYER zahlt ÄrztInnen 7,5 Millionen
Die Pillen-Produzenten investierten im letzten Jahr 575 Millionen Euro dafür, die medizinische Landschaft zu pflegen und die ÄrztInnen zum Verschreiben ihrer Medikamente zu bewegen. Rund 71.000 MedizinerInnen standen auf ihren Gehaltslisten. BAYER gab 2015 dafür 7,5 Millionen Euro aus. Damit spendierte der Konzern den Doktores unter anderem Fortbildungsveranstaltungen in netter Umgebung samt Kost & Logis sowie Begleitung. Rund 2.400 Personen kamen in den Genuss dieses Angebotes. Ca. 3.000 ÄrztInnen strichen zudem für ihre Tätigkeit als RednerInnen auf Kongressen, BeraterInnen oder DienstleisterInnen Geld ein. Für den offenen Umgang mit diesen Zahlen lobt sich der Konzern ausgiebig selbst. Zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell gehöre eben Transparenz, so BAYER-Manager Eberhard Schmuck. Allzu weit ist es mit dieser allerdings nicht her: Was der Global Player den MedizinerInnen nämlich für die sogenannten Anwendungsbeobachtungen zahlt, die nur den Zweck haben, die PatientInnen auf das getestete Präparat umzustellen, verschweigt er lieber. Die nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin Barbara Steffens sieht durch solche Zahlungen die Unabhängigkeit des Standes gefährdet. „Patienten müssen darauf vertrauen können, dass Ärzte ihnen ein Medikament verschreiben, weil sie von der Wirksamkeit überzeugt sind – und nicht, weil sie auf der Honorar-Liste der Hersteller stehen“, hielt die Grünen-Politikerin fest.
7,4 Millionen für Krankenhäuser
BAYER hält nicht nur die ÄrztInnen mit Zuwendungen bei Laune (s. o.), der Konzern bedenkt auch viele Institutionen des Gesundheitswesens, um die Absatz-Chancen für seine Pillen zu verbessern. Krankenhäusern, medizinischen Standesorganisationen, Instituten und medizinischen Gesellschaften wie z. B. der „Deutschen Parkinson Vereingung“ hat der Leverkusener Multi im Jahr 2015 rund 7,4 Millionen Euro zukommen lassen.
BAYER bildet ApothekerInnen weiter
Im Mittleren Osten unterhält BAYER bereits seit 2012 ein Programm zur Fortbildung von ApothekerInnen. Am diesjährigen Workshop nahmen rund 200 PharmazeutInnen aus Kuwait, Quatar, Oman, Barain und anderen Ländern teil. Obwohl der Leverkusener Multi diese Aktivitäten als Teil einer Initiative der Weltgesundheitsorganisation WHO darstellt, dient das Ganze der Absatz-Förderung eigener Präparate. So besteht ein Lernziel für die ApothekerInnen laut Konzern darin, die PatientInnen zur Selbstmedikation und zur Einnahme von Vitaminen und Medikamenten zur Vorbeugung von Krankheiten anzuhalten, um dadurch „dem Staat Lasten abzunehmen“.
BAYER sponsert Agrar-JournalistInnen
BAYER lässt sich die Pflege der Presselandschaft einiges kosten. So sponserte der Leverkusener Multi beispielsweise den Weltkongress der Agrar-JournalistInnen, der dieses Mal in Deutschland stattfand. Die Grüne Woche hatte ihn nach Berlin gelockt. Die Veranstaltung versuchte dann auch, seinem Geldgeber alle Ehre zu machen. Sie begab sich daran, ein idyllisches Bild der hiesigen Agrarwirtschaft zu malen. Die Konferenz wollte nichts weniger als zeigen, „wie Landwirte in Deutschland sich den Herausforderungen von heute stellen. Dazu zählen eine effiziente Wirtschaftsweise, der Schutz von Natur und Biodiversität sowie die Bereitstellung hochwertiger und bezahlbarer Lebensmittel“.
TIERE & ARZNEIEN
BAYTRIL-Gebrauch sinkt leicht
Ende Juli 2016 vermeldete das „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-Sicherheit“ (BVL) zunächst einen erhöhten Verbrauch von Antibiotika aus der Gruppe der Fluorchinolone wie BAYERs BAYTRIL in der Massentierhaltung. Dann korrigierte es seine Angaben. Demnach sanken die Gaben leicht von 12,3 auf 10,6 Tonnen. Aber auch die neuen Zahlen stimmen noch bedenklich, führt doch die häufige Verwendung dieser Mittel in den Ställen dazu, dass die Krankheitserreger sich zunehmend an die Substanzen gewöhnen. Gelangen diese dann über den Nahrungskreislauf oder andere Wege von den Ställen in den menschlichen Organismus, können sie Gesundheitsstörungen auslösen, gegen die kein Kraut mehr gewachsen ist. Und bei den Fluorchinolonen ist das besonders bedenklich, da diese Substanzen in der Humanmedizin zu den Reserve-Antibiotika zählen, die nur zum Einsatz kommen, wenn andere Mittel bereits versagt haben (siehe auch AKTION & KRITIK).
BAYTRIL in Bio-Ställen
Auch die LieferantInnen von Bio-Fleisch setzen in ihren Ställen Antibiotika ein. So tragen auch diese ZüchterInnen mit dazu bei, dass immer mehr Krankheitserreger Resistenzen gegen diese Mittel entwickeln. Gelangen die Keime dann über den Nahrungskreislauf oder andere Wege in den menschlichen Organismus, können sie Gesundheitsstörungen auslösen, gegen die dann nichts mehr hilft. Der Verband „Bioland“ hat seinen Mitgliedern deshalb zumindest verboten, Medikamente aus der Gruppe der Fluorchinolone wie BAYERs BAYTRIL zu verwenden. Diese Substanzen zählen in der Humanmedizin nämlich zu den Notfall-Antibiotika, die bevorzugt zum Einsatz kommen, wenn andere Stoffe bereits versagt haben. Aber selbst zu diesen Fluorchinolonen greifen die Biobauern und –bäuerinnen. Allein im Jahr 2014 hat Bioland 35 Ausnahmegenehmigungen für BAYTRIL & Co. erteilt. Zudem geben nicht wenige LandwirtInnen ihren Tieren diese Mittel, ohne das formell zu beantragen.
Kooperation mit BIONTECH
BAYER hat eine Kooperation mit dem Unternehmen BIONTECH auf dem Gebiet der Tiermedizin vereinbart, in dessen Rahmen die Mainzer Firma für den Leverkusener Multi Immun-Therapeutika, Impfstoffe und andere Veterinär-Arzneien entwickeln soll.
DRUGS & PILLS
ESSURE führt zu mehr Komplikationen
Bei ESSURE, BAYERs ohne Hormone auskommendes Medizinprodukt für eine dauerhafte Empfängnis-Verhütung, handelt es sich um eine kleine Spirale, deren Kunststoff-Fasern für ein so großes Wachstum des Bindegewebes sorgen sollen, dass sich nach etwa drei Monaten die Eileiter verschließen. Eine Studie verglich ESSURE jetzt mit anderen Sterilisationsmethoden, die Zugriff auf die Eileiter nehmen. Das Ergebnis der im British Medical Journal veröffentlichten Untersuchung fiel verheerend für die Spirale des Leverkusener Multis aus. Sie erhöht für die Frauen das Risiko, sich nachträglichen Operationen unterziehen zu müssen, im Vergleich zu anderen Praktiken um mehr als das Zehnfache. Wegen seiner vielen Nebenwirkungen steht das Pharma-Produkt schon länger in der Kritik. Zu diesen zählen unter anderem Hautausschläge, Kopfschmerzen, Übelkeit und Allergien. Die Spirale bleibt zudem oft nicht an dem vorgesehenen Ort, sondern wandert im Körper umher und verursacht Risse an den Wänden innerer Organe, was zu lebensgefährlichen inneren Blutungen führen kann.
Gesundheitsbehörden warnen vor ESSURE
Die vielen unerwünschten Arznei-Effekte von BAYERs Medizin-Produkt ESSURE (s. o.) haben die Gesundheitsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten zum Handeln bewogen. „Health Canada“ informierte die ÄrztInnen in einem Brief über die zahlreichen Risiken und Nebenwirkungen des Präparats und setzte auch die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis. Die US-amerikanische FDA verpflichtete BAYER derweil, die Spirale nur noch mit einem Warnhinweis der dringlichsten Stufe zu vertreiben und die Sicherheit von ESSURE in einer neuen Studie zu überprüfen. Den vielen Geschädigten in den USA ging das allerdings nicht weit genug. Sie hatten auf ein Verbot gehofft und kritisierten die FDA-Maßnahmen deshalb als unzureichend.
IBEROGAST schädigt die Leber
Auch Medikamente auf pflanzlicher Basis wie BAYERs Magenmittel IBEROGAST, das 2013 mit dem Kauf von STEIGERWALD in die Produktpalette des Pharma-Riesen gelangte, können es in sich haben. So schädigt der IBEROGAST-Inhaltsstoff Schöllkraut die Leber. Arzneien mit einer hohen Schöllkraut-Konzentration hat das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) deshalb schon aus dem Verkehr gezogen. Vom Leverkusener Multi verlangte es, diese Nebenwirkung auf dem Beipackzettel von IBEROGAST zu vermerken. Der Konzern weigert sich aber, dieser Aufforderung nachzukommen. Für ihn ist die „hohe Sicherheit“ des Präparates „durch eigene Daten vollständig belegt“. Darum zeigt er sich auch nicht bereit, den Widerspruch zurückzunehmen, den STEIGERWALD vor acht Jahren gegen die BfArM-Anordnung eingelegt hatte. Und so gibt es dann immer noch keine Warnhinweise auf den Faltblättern der Packungen. „Das ist genau die Situation, die wir immer wieder beklagen. Im Grunde genommen hat der Hersteller viele Möglichkeiten, das immer wieder herauszuzögern (...) Derzeit hat man den Eindruck an vielen Stellen, dass der Hersteller-Schutz vor dem Patienten-Schutz rangiert“, kritisiert der Pharmakologe Prof. Gerd Glaeske.
Verantwortlicher Umgang mit ASPIRIN?
BAYER bewirbt ASPIRIN erfolgreich als „Tausendsassa“. Darum findet es weite Verbreitung, obwohl das Präparat viele Nebenwirkungen wie etwa Magenbluten hat. So bezifferte der Mediziner Dr. Friedrich Hagenmüller 2012 die Zahl der Todesopfer allein in der Bundesrepublik auf jährlich 1.000 bis 5.000. Den Leverkusener Multi ficht das jedoch nicht an. Wenn JournalistInnen ihn auf das Gefährdungspotenzial von ASPIRIN durch einen zu sorglosen Umgang mit dem Mittel ansprechen, verweist der Konzern einfach auf eine von ihm selbst durchgeführte Studie, die angeblich eine verantwortungsvolle Handhabung belegt.
ASPIRIN: Größere Präventionswirkung?
Der verantwortungslose Umgang mit ASPIRIN birgt hohe Risiken (s. o.) Haben Menschen jedoch schon einmal einen Herzinfarkt erlitten, raten MedizinerInnen zur Verhinderung eines zweiten zu dem Mittel. Studien zufolge senkt das Medikament mit dem Wirkstoff Acetylsalicylsäure das Risiko für eine nochmalige Attacke um 13 Prozent. Nur die ersten sechs Wochen nach dem ersten Infarkt betrachtet, liegt die Präventionswirkung einer neueren Untersuchung zufolge sogar noch höher. Wie Peter M. Rothwell und sein Team herausfanden, reduziert die Arznei die Wahrscheinlichkeit eines Wiederholungsfalles um 60 Prozent. Allerdings haben drei an der Studie beteiligte WissenschaftlerInnen schon einmal in Diensten BAYERs gestanden, was die Aussagekraft der Arbeit erheblich trübt.
CIPROBAY-Anwendungsbeschränkungen
BAYERs Antibiotikum CIPROBAY mit dem Wirkstoff Moxifloxacin, der zur Gruppe der Fluorchinolone gehört, hat zahlreiche Nebenwirkungen (siehe auch AKTION & KRITIK). Darum erließ die US-Gesundheitsbehörde FDA im Mai 2016 Anwendungsbeschränkungen für CIPROBAY und andere fluorchinolon-haltige Präparate. Bei Bronchitis, Sinusitis und einfachen Formen von Blasen-Entzündungen dürfen die MedizinerInnen diese Arzneien jetzt nur noch verordnen, wenn alle andere Mittel versagt haben.
Zahlreiche MIRENA-Nebenwirkungen
BAYERs Hormon-Spirale MIRENA ruft zahlreiche unerwünschte Arznei-Effekte hervor. „Insgesamt 3.607 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen“ hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-Produkte“ (BfArM) registriert, wie eine Anfrage des TV-Magazins Frontal21 ergab. Allein 44 Meldungen zu Brustkrebs, 153 zu Eileiter-Schwangerschaften und 328 zu Gebärmutter-Verletzungen erhielt das BfArM unter anderem.
Verhandlungen mit GOOGLE
Die GOOGLE-Tochter VERILY widmet sich medizinischen Forschungsprojekten auf Gebieten wie „Krebs“, „Diabetes“ und Herz/Kreislauf-Erkrankungen. Zudem entwickelt sie Operationsroboter und bioelektronische Systeme. Im Februar 2016 hat das Unternehmen Verhandlungen mit BAYER über mögliche Kooperationen aufgenommen.
16 Krebs-Wirkstoffe im Test
Krebs-Arzneien versprechen den Pharma-Riesen den größten Profit. Mittlerweile fressen sie – ohne die Lebenszeit der PatientInnen entscheidend verlängern zu können – schon rund ein Viertel des Medikamenten-Budgets der Krankenkassen. Folgerichtig setzt der Leverkusener Multi ganz auf dieses Segment. Mit NEXAVAR, STIVARGA und XOFIGO bietet er bereits drei Onkologie-Präparate an; zudem befinden sich 16 Wirkstoffe in der klinischen Erprobung.
Mehr Profit durch Direktvertrieb
Vom Hersteller über den Großhandel zu den Apotheken – so sieht eigentlich der Vertriebsweg für Medikamente aus. BAYER & Co. umgehen aber immer öfter den Großhandel und bestücken die Pharmazien selbst mit ihren Produkten. Auf diese Weise schalten sie einen Mitverdiener aus und erhöhen ihre Gewinnmarge. Zudem sieht die Branche dies als eine wirksame Methode an, die Zwischenhändler am Export der Arzneien in solche Länder zu hindern, in denen sie mit den Produkten zum Schaden der Pillen-Produzenten mehr Geld machen können. Also halten die Pharma-Firmen den Großhandel knapp und springen in die Bresche, wenn dieser nicht mehr liefern kann. Zu diesem Behufe hat BAYER gemeinsam mit BOEHRINGER, NOVARTIS und anderen Konzernen die PHARMA MALL GESELLSCHAFT FÜR ELECTRONIC COMMERCE gegründet. Den Unternehmen zufolge soll diese Gesellschaft der „Optimierung der Transaktionsprozesse zwischen Herstellern und Kunden“ dienen. In der Realität aber verkompliziert sich für die Apotheken durch die beiden nebeneinander herlaufenden Systeme die Beschaffung der Pharmazeutika, weshalb die PatientInnen oftmals länger auf ihre Mittel warten müssen. Überdies schrumpfen die Einnahmen der Pharmazien durch diesen Direktvertrieb, weil sie dadurch nicht mehr in den Genuss von Großhandelsrabatten kommen. Die Bundesregierung sieht bei alldem jedoch keinen Grund zum Eingreifen. In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Partei „Die Linke“ verweist die Große Koalition auf die Zuständigkeit der Bundesländer.
Anfrage zu Beobachtungsstudien
Erkenntnisse werfen Anwendungsbeobachtungen (AWB) zu Medikamenten, die MedizinerInnen mit ihren PatientInnen durchführen, kaum ab. Dies ist aber auch gar nicht Sinn der Übung. Die Anwendungsuntersuchungen verfolgen einzig den Zweck, die Kranken auf das getestete Präparat umzustellen (siehe auch PROPAGANDA & MEDIEN). Im Jahr 2014 standen BAYER & Co. dafür 17.000 ÄrztInnen zu Diensten. Die Pharma-Riesen honorierten ihnen dies mit ca. 100 Millionen Euro. Nach Angaben des Recherche-Netzwerkes Correct!v fanden von 2009 bis 2014 in den Praxen 41 solcher „Studien“ mit BAYER-Medikamenten statt (Ticker 3/16). Die Bundesregierung nimmt an diesem Marketing-Instrument, das sich einen wissenschaftlichen Anstrich gibt, im Grundsatz keinen Anstoß. „Mit AWB können Erkenntnisse über die Anwendung zugelassener Arzneimittel in der Praxis gewonnen werden“, hält sie in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Partei „Die Linke“ fest. Im geplanten „Gesetz zur Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen“ will die Große Koalition lediglich die Vorschriften für die Schnelltests etwas verschärfen.
AGRO & CHEMIE
Glyphosat-Zulassung verlängert
Der Pestizid-Wirkstoff Glyphosat, der in BAYER-Mitteln wie GLYFOS, PERMACLEAN, USTINEX G, KEEPER und SUPER STRENGTH GLYPHOSATE enthalten ist und in Kombination mit Gen-Pflanzen wie der Soja-Art BALANCE zum Einsatz kommt, gilt als gesundheitsgefährdend. So hat eine Krebsforschungseinrichtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Substanz als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft. Trotzdem hat sich die EU im Juni 2016 schlussendlich dem Druck der Industrie gebeugt und die Zulassung des Herbizids um 18 Monate verlängert.
Comeback für Glufosinat?
BAYERs Antiunkraut-Mittel Glufosinat, das unter anderem im Kombipack mit den Gen-Pflanzen der „LIBERTY LINK“-Baureihe zum Einsatz kommt, schädigt das Erbgut und kann Krebs auslösen. Deshalb hatte die EU die Zulassung des Pestizids nicht über den September 2017 hinaus verlängert. Jetzt droht Brüssel jedoch einen Rückzieher zu machen. Die „Europäische Behörde für Lebensmittel-Sicherheit“ (EFSA), deren MitarbeiterInnen mehr als einmal durch ihre Beziehungen zur Wirtschaft in die Schlagzeilen geraten waren, schlug nämlich Ausnahmeregeln für Glufosinat und andere Ackergifte vor, falls die LandwirtInnen keine Alternative hätten und eine „ernsthafte Gefahr für die Gesundheit der Pflanze“ bestehe. Das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK (PAN) kritisierte diesen Vorstoß vehement.
Pestizid-Plage in Costa Rica
Costa Rica ist der weltgrößte Ananas-Produzent. Auf einer Fläche von 38.000 Hektar wächst dort die Frucht. Dabei kommen einer Studie von OXFAM zufolge immense Mengen an Agro-Chemikalien zum Einsatz. 30 bis 38 Kilogramm pro Hektar bringen die Plantagen-BesitzerInnen jährlich aus. Darunter befinden sich mit Glyphosat, Diuron, Mancozeb und Chlorpyrifos viele, die auch BAYER anbietet. Die Beschäftigten müssen schon bald nach den Sprühaktionen wieder auf die Felder und verfügen nicht immer über einen Arbeitsdress, der ihnen die Mittel in ausreichender Form vom Leibe hält. Dementsprechend erleiden viele der Belegschaftsangehörigen Gesundheitsschädigungen. „Ich war einen Monat lang im Krankenhaus wegen einer Vergiftung. Als ich wiederkam, musste ich wieder mit Pestiziden und ohne Schutzkleidung arbeiten“, erzählt einer von ihnen. Auch Krebs-Krankheiten, Magenleiden, Augen-Schädigungen und Hautausschläge zählen zu den Nebenwirkungen. Überdies verseuchen die Mittel das Trinkwasser in der Nähe der Ananas-Äcker.
Pestizid-Plage in Ecuador
Auf den Bananen-Plantagen in Ecuador herrschen OXFAM zufolge ähnlich verheerende Bedingungen wie auf den Ananas-Äckern in Costa Rica (s. o.) Hier sehen sich die LandarbeiterInnen ebenfalls ohne ausreichenden Schutz gefährlichen Pestiziden ausgesetzt. Oftmals dürfen sie die Felder nicht verlassen, wenn die Sprüh-Flugzeuge zum Einsatz kommen und Substanzen wie die auch von BAYER vermarkteten Stoffe Glyphosat und Mancozeb ausbringen. „Wir machen uns große Sorgen, weil wir unter dem Pestizid-Regen arbeiten müssen. Wir bekommen Hautausschläge. Aber wenn man sich beschwert, riskiert man, entlassen zu werden“, klagt etwa einer der Beschäftigten. Und es bleibt nicht bei Hautausschlägen. Zu den weiteren Leiden der Plantagen-ArbeiterInnen zählen Herz-Leiden, Magen-Erkrankungen, Augenbrennen, Schlafstörungen und Durchfall. Überdies erweisen sich die chemischen Keulen als erbgut-schädigend. „Angesichts besonders hoher Behinderungsraten der Kinder in den Bananen-Provinzen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es hier einen Zusammenhang gibt“, sagt etwa Beatriz Garcia Pluas, die Direktorin einer Schule für Gehandicapte.
PilotInnen als Pestizid-Opfer
Nicht nur die LandarbeiterInnen oder die AnwohnerInnen der Plantagen leiden unter den Pestiziden, sondern auch die PilotInnen, welche die Agro-Chemikalien mit ihren Flugzeugen ausbringen. So berichtet der Ecuadorianer Jorge Acosta Orellana in dem Interview mit der taz über Leiden wie Herzrhythmus-Störungen, Schwindel und Augen-Trübungen. „Ich bin zum Arzt gegangen, aber der meinte, dass mein Herz in Ordnung sei und dass ich eine Vergiftung haben könnte. Ich habe dann mit anderen Piloten geredet und festgestellt: Die haben ähnliche Probleme. Bald waren wir überzeugt, dass das alles in Zusammenhang mit dem Fungizid Mancozeb (enthalten unter anderem in den BAYER-Produkten ZETANIL und ACROBAT, Anm. Ticker) stehen könnte. Das haben wir auf den Plantagen nämlich zum Sprühen verwendet.“ Orellana zufolge kam es sogar schon zu Flugzeug-Abstürzen, weil die PilotInnen – benebelt von den chemischen Keulen – die Kontrolle über ihre Maschinen verloren.
ALDI bannt Bienenkiller
Der Lebensmittel-Discounter ALDI bannt acht bienengefährliche Agro-Chemikalien. Dazu zählen mit Chlorpyrifos, Clothianidin, Deltamethrin, Fipronil und Imidacloprid auch fünf Wirkstoffe, die BAYER anbietet. „Mit dem Ziel, den Bienenschutz in Deutschland aktiv zu fördern und weiterhin im Sinne der Verbraucher an einer Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden zu arbeiten, haben die beiden Unternehmensgruppen ALDI-NORD und ALDI-SÜD im vergangenen Jahr neue Anforderungen an ihre Lieferanten gestellt“, erklärte der Konzern. Diese müssen nun garantieren, dass die landwirtschaftlichen Produkte, die sie ALDI verkaufen, keine Behandlung mit Chlorpyrifos & Co. erfahren haben.
Neues Erdnuss-Pestizid
Der Leverkusener Multi hat mit PROVOST OPTI ein neues Antipilz-Mittel für Erdnuss-Kulturen auf den Markt gebracht. Allerdings handelt es sich dabei um neuen Wein in alten Schläuchen. Die Inhaltsstoffe stimmen mit denen von PROVOST überein. Der Konzern änderte lediglich das Mischungsverhältnis von Prothioconazol und Tebuconazol.
PFLANZEN & SAATEN
Neues Weizenzucht-Zentrum in Kanada
Im Saatgut-Geschäft des Agro-Riesen bildet Weizen einen Schwerpunkt, weil die Ackerfrucht die weitverbreitetste Kulturpflanze der Welt ist. Bis 2020 will der Konzern 1,5 Milliarden Euro in Züchtungsprogramme investieren, um eine führende Rolle in diesem Markt-Segment einzunehmen. Nachdem der Agro-Riese gerade eben erst seine Weizenzucht-Station in Gatersleben erweitert hat, eröffnet er jetzt ein neues Zentrum im kanadischen Saskatchewan. Vor allem hybride, also nicht zur Wiederaussaat geeignete Gewächse will der Konzern dort entwickeln. Auf Qualität kommt es ihm dabei weniger an als auf den Output. „Wer erfolgreich eine wesentlich ertragreichere Weizen-Sorte entwickelt, wird ein lukratives Geschäft auftun“, prophezeit Liam Condon, der Chef von BAYER CROPSCIENCE.
GENE & KLONE
Blockbuster EYLEA
EYLEA, das BAYER-Präparat zur Behandlung der feuchten Makula-Degeneration – einer Augenerkrankung, die zur Blindheit führen kann – erschließt nicht gerade medizinisches Neuland. Laut Konzern zeigte das Pharmazeutikum in Tests lediglich „eine vergleichbare Wirkung (‚Nicht-Unterlegenheit’) gegenüber der Behandlung mit LUCENTIS“. Einen Zusatznutzen mochten dem Gentech-Medikament deshalb weder das „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWIG) noch die Techniker Krankenkasse bescheinigen. Trotzdem entwickelt sich die Arznei dank BAYERs massivem Werbeaufwand zu einem Blockbuster, der LUCENTIS gehörig Konkurrenz macht: Im zurückliegenden Geschäftsjahr betrug der EYLEA-Umsatz 1,2 Milliarden Euro.
EU lässt BAYERs Gen-Soja zu
Ende Juli 2016 hat die EU BAYERs Gen-Soja mit dem Produktnamen BALANCE eine Einfuhrgenehmigung erteilt (siehe auch SWB 4/16). Die Laborfrucht ist gentechnisch darauf geeicht, auf den Feldern Sprühattacken mit den Herbizid-Wirkstoffen Glyphosat und Isoxaflutol standzuhalten. Da die Menschen darauf nicht „geeicht“ sind, stellen die Rückstände der beiden als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuften Pestizide in den Pflanzen für sie eine ernstzunehmende Gesundheitsgefahr dar. Damit nicht genug, potenzieren sich die unerwünschten Effekte im Zusammenspiel noch einmal: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN kritisierte die Zulassung deshalb.
Lizenz-Abkommen mit ERS
BAYER setzt weiter auf die „Synthetische Biologie“, zum Beispiel auf Gen-Scheren, die das Erbgut angeblich präzise an einer vorgegebenen Stelle auftrennen und dort neue, im Labor hergestellte DNA-Stränge einfügen können. Nachdem der Konzern Ende 2015 ein Joint Venture mit dem US-Unternehmen CRISPR THERAPEUTICS eingegangen ist (siehe STANDORTE & PRODUKTION), schloss er im Mai 2016 eine Lizenzvereinbarung mit der irischen Firma ERS GENOMICS ab. Diese sichert dem Pharma-Riesen den Zugriff auf mehrere Patente, die ERS auf die Anwendung der Schnippel-Technik CRISPR-Cas9 hält.
Gentech lost in Europe
BAYERs Innovationsvorstand Kemal Malik sieht die Zukunft der „grünen Gentechnik“ in Europa düster. „Wir haben die Auseinandersetzung über Gen-Pflanzen in Europa verloren. Ich glaube nicht, dass es noch genug politischen Willen gibt, um den Bann aufzuheben oder wieder in die Debatte einzusteigen“, sagte er der Zeitung The Australian im Marz 2016. Zum Teil gibt er dafür auch der Industrie selber die Schuld: „Wir haben nicht genug Anstrengungen unternommen, um die Technologie zu erklären und die Öffentlichkeit und die Entscheidungsträger mitzunehmen.“
WASSER, BODEN & LUFT
Anhörung zum A1-Ausbau
Das Land Nordrhein-Westfalen plant, die Bundesautobahn A1 auszubauen und im Zuge dessen auch eine neue Brücke über den Rhein zu errichten. Das stößt jedoch auf viel Widerstand, vor allem weil Straßen.NRW dafür Teile der Dhünnaue-Deponie BAYERs wieder öffnen will. Der Landesbetrieb beabsichtigt, den Müll bis zu einer Tiefe von zwei Metern abzutragen und die Grube mit einer Polsterschicht für das Fundament der Straße aufzufüllen. 268 Einwendungen gegen das Projekt erhielt die Bezirksregierung, darunter auch eine der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG). Anfang Juli 2016 fand dazu in der Stadthalle Köln-Mülheim der Erörterungstermin statt (siehe auch SWB 4/16). Zweifel an dem Vorhaben konnten die Straßenbau-BeamtInnen dort allerdings nicht ausräumen, zumal sie selber das Risiko nur vorsichtig „vertretbar“ nannten. Einer ihrer Ingenieure bezeichnete die Auskofferung des ganzen Giftgrabes sogar ganz offen als die eigentlich „optimale Gründung“ für die A1. Auf Altlasten baut es sich nämlich schlecht. Der organische Anteil des Mülls zersetzt sich, weshalb das Volumen abnimmt und mit Bodenabsenkungen zu rechnen ist. Das tut auch Straßen.NRW. „Eine ggf. erforderliche vorzeitige Instandsetzung des Oberbaus ist berücksichtigt“, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme des Landesbetriebs zur Einwendung der CBG. Und so gewann dann die von der Coordination und vielen anderen Initiativen vorgeschlagene Alternative, die Hände ganz von der Dhünnaue zu lassen und den Verkehr stattdessen unterirdisch durch einen langen Tunnel zu führen, durch den Erörterungstermin noch mehr an Überzeugungskraft.
Neues Fracking-Gesetz
US-Unternehmen profitieren von den neuen Öl- und Erdgas-Fördertechniken. Das ebenso brachiale wie umweltschädliche Fracking, das mit Hilfe von Chemikalien Risse in unterirdischen Gesteinsschichten erzeugt, um so Vorkommen zu erschließen, hat für einen Boom gesorgt und den Konzernen so zu billiger Energie verholfen. „Die damit günstigeren Produktionskosten in den USA verschärfen natürlich in einigen Bereichen den Konkurrenzdruck“, konstatierte etwa der ehemalige BAYER-Chef Marijn Dekkers. Darum setzte er sich vehement dafür ein, diese Methode auch in der Bundesrepublik zuzulassen: „Fracking wäre für Deutschland eine Alternative.“ Manchmal müsste man auch etwas wagen, um zu gewinnen, so der Niederländer. Darauf wollte sich die Bundesregierung so aber nicht einlassen. Sie verhängte zwar kein generelles Verbot des Frackings, schränkte dieses aber weitgehend ein. Bohrungen in Schiefer-, Ton-, Mergel- und Kohleflöz-Gestein verbietet das neue Fracking-Gesetz. Lediglich Probe-Bohrungen zur wissenschaftlichen Auswertung erlaubte die Große Koalition und erfüllte damit die Mindestanforderung Dekkers’. Mit Hilfe der auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse soll der Bundestag die Regelungen im Jahr 2021 dann noch einmal überprüfen. Sogenanntes konventionelles Fracking im poröseren und deshalb leichter aufzuspaltenden Sandstein können die Energie-Multis jedoch nach wie vor betreiben. Nur müssen nun Umweltverträglichkeitsprüfungen die Unbedenklichkeit erweisen.
Ausgelaugte Böden
Die industrielle Landwirtschaft setzt den Ackerflächen enorm zu. So sorgen schwere Landmaschinen für eine Verdichtung des Grundes, die dessen Fruchtbarkeit mindert. Nach Angaben der Bundesregierung beobachten WissenschaftlerInnen dieses Phänomen bereits auf 10 bis 20 Prozent der deutschen Äcker. Die inzwischen schon 1,4 Millionen Hektar in Anspruch nehmende Kultivierung von Mais als Energiepflanze fördert zudem die Bodenerosion, weil dieses Süßgras sehr langsam wächst und die Erde somit länger Wind und Wetter preisgibt. Die schwache Rückhalte-Wirkung der Feldfrucht sorgte im Frühjahr 2016 auch mit für die immensen Überschwemmungsschäden vor allem in Bayern. Rückstände der Pillen von BAYER und anderen Herstellern im Dünger oder die Düngemittel selber tragen ein Übriges zur Schadensbilanz bei. Wegen dieser beunruhigenden Entwicklung wollte die Europäische Union schon 2010 eine Bodenschutz-Richtlinie auf den Weg bringen. Aber die Landwirtschaftsverbände und BAYER & Co. wehrten sich vehement gegen eine solche Regelung, weil sie strengere Auflagen befürchteten. Sie hatten damit Erfolg: Die Bundesrepublik legte zusammen mit vier anderen Ländern ein Veto ein und blockierte damit das Paragrafen-Werk; 2014 legte es Brüssel endgültig zu den Akten.
Proteste gegen Pipeline-Ausbesserung
Die Gas-Fernleitung zwischen Duisburg und Köln, die unter anderem BAYER, HENKEL und diverse Stadtwerke mit Gas versorgt, stammt aus dem Jahr 1930. Darum ersetzen die Betreiber THYSSENGAS und OPEN GRID EUROPE derzeit die Rohre und führen Ausbesserungsmaßnahmen durch. Unter anderem verbreitern sie den Schutzstreifen auf das seit einiger Zeit gesetzlich vorgeschriebene Maß von 5,70 m. Da die beiden Unternehmen dafür rund 500 Bäume fällen müssen, kam es zu Protesten von NaturschützerInnen und LokalpolitikerInnen. Diese forderten einen anderen Trassen-Verlauf und kritisierten, dass es vor Beginn der Arbeiten kein Planfeststellungsverfahren gab, bei dem Alternativen hätten geprüft werden können.
GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV
Merkel & Co. gegen Bisphenol-Verbot
BAYER ist mit einer Jahresproduktion von ca. einer Million Tonnen einer der größten Produzenten der Industrie-Chemikalie Bisphenol A (BPA). Drei Prozent davon kommen in Verpackungen von Nahrungsmitteln wie etwa Konservendosen zum Einsatz. Die Substanz ähnelt in ihrem chemischen Aufbau Hormonen, was zu Stoffwechsel-Irritationen und so zu Schädigungen des Nervensystems, Übergewicht, Unfruchtbarkeit, Diabetes sowie Herz- und Lebererkrankungen führen kann (siehe auch SWB 4/16). Die EU hat deshalb bereits deren Verwendung in Babyflaschen untersagt und für 2019 das BPA-Aus in Thermopapieren wie etwa Kassenzetteln verkündet. Auch hat sie schärfere Grenzwerte erlassen. Frankreich verbot den Stoff in Lebensmittel-Verpackungen sogar grundsätzlich. Die Bundesregierung will diesem Beispiel jedoch nicht folgen. Es gäbe wegen EU-Initiativen zu Bisphenol A „derzeit keinen Spielraum für nationale Regelungen“, erklärte sie in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Partei „Die Linke“. Aber selbst wenn die Große Koalition könnte, würde sie nichts machen: „Für ein generelles Verbot von Bisphenol A in Lebensmittel-Kontaktmaterialien liegt nach Einschätzung der Bundesregierung zudem keine wissenschaftliche Grundlage vor.“
STANDORTE & PRODUKTION
Erste CRISPR-Standorte
Ende 2015 ist der BAYER-Konzern mit dem US-Unternehmen CRISPR THERAPEUTICS ein Joint Venture eingegangen und hat sich damit den verstärkten Zugriff auf eine neue Gentechnologie gesichert. CRISPR arbeitet auf dem Gebiet der „Synthetischen Biologie“ und hat so genannte Gen-Scheren entwickelt, die das Erbgut angeblich präzise an einer vorgegebenen Stelle auftrennen und dort neue, im Labor hergestellte DNA-Stränge einfügen können. Der Leverkusener Multi beabsichtigt, mit Hilfe dieses „gene editings“ Therapien für Blut-, Herz- und Augenkrankheiten zu entwickeln. Auch im Genpflanzen-Bereich beabsichtigt der Agro-Riese, Gen-Scherereien zu machen. Ende August 2016 konkretisierte er diese Pläne. Der Global Player gab mit CASEBIA den Namen der neuen Gesellschaft bekannt und kündigte für das Jahr 2017 die Aufnahme von Forschungstätigkeiten an drei Standorten an. Den größten Betrieb errichtet BAYER im US-amerikanischen Cambridge, kleinere Niederlassungen in San Francisco und in Köln. KritikerInnen trauen den Versprechungen der Gentechnik 2.0 indes nicht, denn so geschliffen wie prophezeit schnippeln die Gen-Scheren dann doch nicht am Erbgut herum. So kam es etwa bei einem Experiment chinesischer ForscherInnen mit Embryonen einerseits an unbeabsichtigten Orten zu den beabsichtigten Mutationen und andererseits an den beabsichtigten Orten zu unbeabsichtigten Mutationen. Sogar Gentech-Befürworter wie Christof von Kalle, der Präsident der „Deutschen Gesellschaft für Gentherapie“, warnen vor übertriebenen Erwartungen. „Für die Anwendung in der Gentherapie bei Menschen wäre es jedoch Voraussetzung, die Effizienz und Verlässlichkeit des Systems noch einmal deutlich nach oben zu treiben. Nur wenn reproduzierbar gezielt Reparatur-Sequenzen von außen an die entsprechende Stelle geschrieben werden können, kann von einem echten Editieren die Rede sein, und dies ist nach heutigem Stand eben noch nicht effizient erreicht“, schreibt der Mediziner in der Faz.
Fabrik-Eröffnung in China
Im Jahr 2014 hatte BAYER das chinesische Unternehmen DIHON erworben. Kurz darauf gab der Konzern den Bau einer neuen Anlage in Majinpu bekannt, um die Produktion der freiverkäuflichen DIHON-Pharmazeutika, wozu sowohl Mittel auf chemischer als auch solche auf Basis der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) gehören, zu steigern. Mit der Fertigungsstätte will der Konzern die Herstellung von TCM-Produkten verdreifachen. Auch freiverkäufliche BAYER-Arzneien beabsichtigt der Pillen-Riese an diesem Standort zu fabrizieren. Anfang 2016 nahm er einen ersten Teilabschnitt in Betrieb; der Abschluss der gesamten Arbeiten ist für 2020 vorgesehen.
RECHT & UNBILLIG
DUOGYNON: Anklage „Mord“
Der hormonelle Schwangerschaftstest DUOGYNON der heute zu BAYER gehörenden Firma SCHERING hat ab den 1950er Jahren zu tausenden Totgeburten geführt. Darüber hinaus kamen bis zum Vermarktungsstopp Anfang der 1980er Jahre unzählige Kinder mit schweren Missbildungen zur Welt. Bisherige Gerichtsverfahren um Entschädigung oder die Herausgabe von Firmen-Unterlagen zu diesem Medikament scheiterten. Die Ansprüche seien verjährt, entschieden die RichterInnen. Das können die JuristInnen im Prozess, den Gisela Clerc jetzt in Berlin angestrengen will, jedoch nicht zur Entlastung der Beschuldigten anführen. Die Rentnerin hat nämlich eine Klage gegen Unbekannt wegen Mordes eingereicht. Und für diese Straftat gibt es keine Verjährungsfrist. Clerc bezichtigt die damaligen Beschäftigten von SCHERING, für den Tod ihrer Tochter verantwortlich zu sein, die im Januar 2016 mit nur 47 Jahren an den DUOGYNON-Spätfolgen verstarb. Bei der juristischen Auseinandersetzung stützt sich die 74-Jährige auf neue Dokumente aus dem Berliner Landesarchiv, die belegen, dass die ManagerInnen schon sehr früh Informationen über die fatalen Risiken und Nebenwirkungen des Präparates hatten (Ticker 2/16). Der Leverkusener Multi streitet „einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Einnahme von DUOGYNON und den seinerzeit gemeldeten Fällen“ trotzdem immer noch ab.
ESSURE-Sammelklage in Kanada
ESSURE, BAYERs ohne Hormone auskommendes Medizin-Produkt für eine dauerhafte Empfängnis-Verhütung, hat zahlreiche Nebenwirkungen (siehe auch DRUGS & PILLS). „Starke, stechende Becken-Schmerzen, Unterleibsschmerzen“, nennt etwa Susan Hill. Zudem litt die 38-jährige Kanadierin an blutenden Ausschlägen, bis sie sich dazu entschloss, die Spirale entfernen zu lassen. Dafür beansprucht Hill jetzt Schmerzensgeld: Sie zählt zu den 184 Frauen in ihrem Heimatland, die eine Sammelklage gegen BAYER eingereicht haben. Auch in den USA zogen bereits dutzende ESSURE-Geschädigte vor Gericht.
Neue YASMIN-Klage
In den USA sieht sich der Leverkusener Multi wegen der Nebenwirkungen seiner Verhütungsmittel aus der YASMIN-Familie Tausenden von Prozessen gegenüber, was ihn bereits 1,9 Milliarden Dollar Schadensersatz kostete. In Europa hat BAYER von den Gerichten in Sachen „VerbraucherInnenschutz“ weniger zu befürchten. Aber auch hier häufen sich die juristischen Auseinandersetzungen. Allein 80 Klagen gibt es in Frankreich. In der Bundesrepublik tut sich ebenfalls etwas. Neben Felicitas Rohrer hat nun auch Christian Schock, der seine Frau durch YASMIN verlor, rechtliche Schritte gegen den Pharma-Riesen eingeleitet.
BELT bleibt verboten
Im Jahr 2009 hatte die US-amerikanische Umweltbehörde EPA BAYERs Pestizid-Wirkstoff Flubendiamid eine vorläufige Genehmigung erteilt. Sie machte es dem Leverkusener Multi dabei zur Auflage, noch Studien zu den Effekten der Substanz auf Wasser-Organismen nachzureichen. Das tat der Konzern jedoch bis heute nicht, während die EPA Belege für die Gefährdung aquatischen Lebens durch Flubendiamid fand. Deshalb entzog die Behörde dem Agro-Riesen die Zulassung für den Stoff, den er z. B. unter den Produktnamen BELT und FAME vertreibt. BAYER legte umgehend Widerspruch gegen die Entscheidung ein. Die Beschwerdekammer der EPA erkannte diesen allerdings nicht an, was für BELT & Co. das Aus auf dem US-Markt bedeutet.
FORSCHUNG & LEHRE
Subventionen für Pflanzen-Forschung
„Gemeinsam zu den Pflanzen der Zukunft“ lautet die Losung von Plant 2030. Das vom Bund großzügig geförderte Projekt setzt auf eine „enge Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft“ und verkündet: „Neue Forschungsergebnisse fließen auf kürzestem Weg in die Entwicklung neuer Sorten ein“. Bei einer solchen konzertierten Aktion macht BAYER natürlich gerne mit. Für ein Vorhaben zur „Verbesserung der Stress-Resistenz, Ressourcen-Nutzung und Produktivität von Nutzpflanzen“ holte sich der Agro-Riese einen Zuschuss von 1,34 Millionen Euro ab. Und für Forschungen zu Pflanzen-Hormonen, die Einfluss auf das Wachstum haben („Bioregulatoren“), strich er sogar knapp 1,9 Millionen Euro ein.
Neue Pflanzenforschungskooperation
BAYER hat mit dem Forschungszentrum Jülich eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Pflanzenforschung vereinbart. Nach Angaben des Leverkusener Multis wollen sich die Kooperationspartner dabei auf die Wurzeln von Ackerfrüchten konzentrieren. „Die Kultur-Pflanzen der Zukunft müssen Höchstleistungen erbringen. Und die Ertragsleistung hängt mit der Funktionsweise der Wurzeln zusammen. Wir können stärkere Wurzel-Systeme züchten, wenn wir die Wurzel-Phänotypen und die sie steuernden Gene verstehen“, so der BAYER-Manager Raphael Dumain.