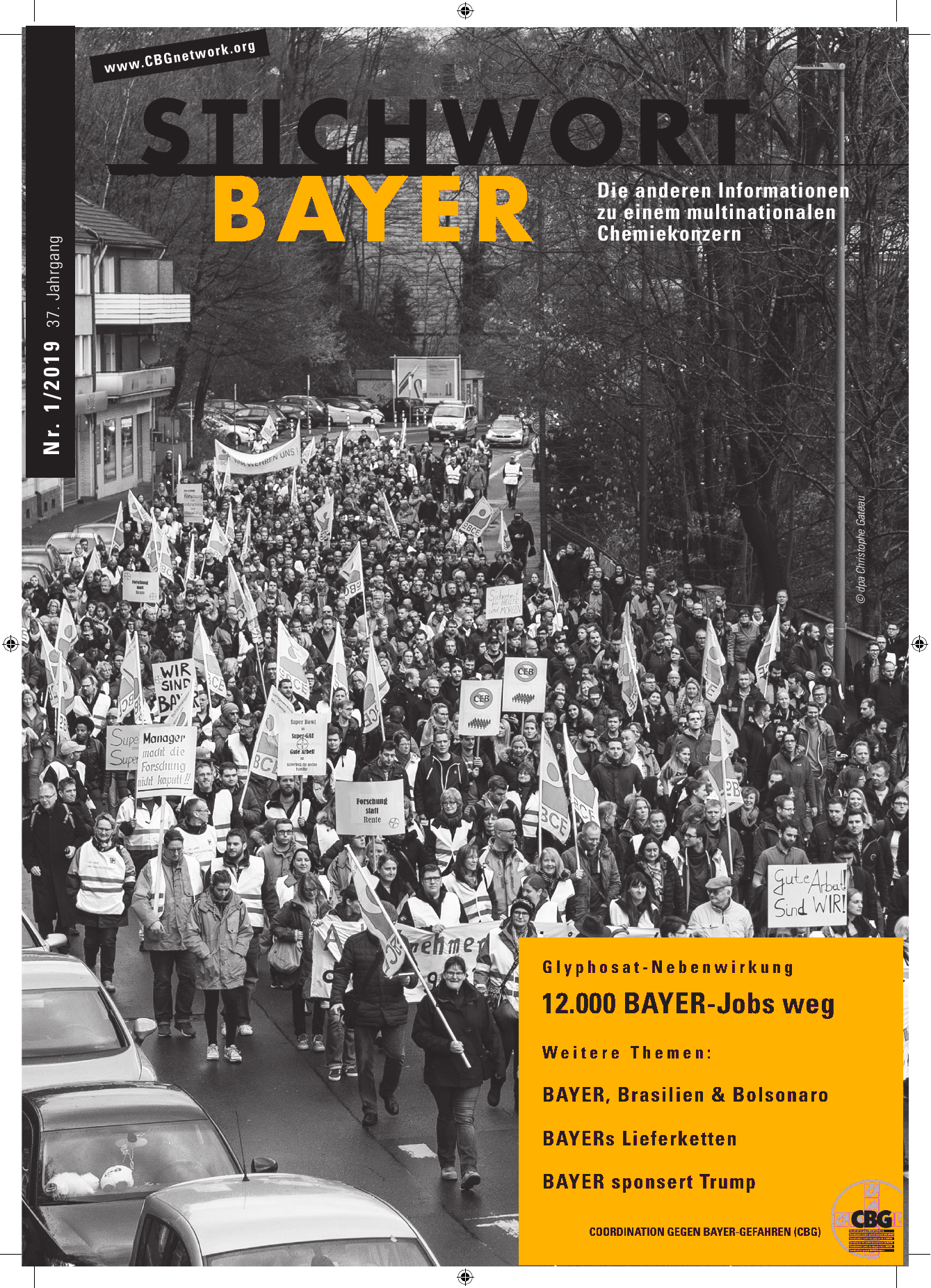AKTION & KRITIK
CBG-Anfrage an die Bezirksregierung
Im letzten Jahr hatte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA BAYERs Leverkusener Pharma-Anlagen inspiziert und dabei „signifikante Verstöße gegen die gute Herstellungspraxis“ festgestellt (siehe auch SWB 2/18). In ihrem „Warning Letter“ listete die „Food and Drugs Administration“ viele gravierende Mängel auf. So hat der Pharma-Riese etwa verschiedene Medikamente in einem Raum gefertigt, ohne die benutzte Ausrüstung und die Arbeitsflächen nach den jeweiligen Durchläufen gründlich zu säubern, was Verunreinigungen von Medikamenten zur Folge hatte. Überdies kontrollierte der Multi der FDA zufolge die Stabilität der Zusammensetzung seiner Pharmazeutika nicht ausreichend. Auch die Toleranz-Grenzen der Apparaturen zur automatisierten Qualitätskontrolle legte der Global Player zu großzügig fest, damit sich der Ausschuss in Grenzen hielt. Darüber hinaus hat er nicht angemessen auf Probleme mit undichten Medikamenten-Packungen reagiert. „Ihre Firma hat es nicht geschafft, eine ordentlich arbeitende Qualitätskontrolle-Abteilung aufzubauen“, resümierte die US-Einrichtung in ihrem Schreiben folglich. In der Bundesrepublik obliegt die Kontrolle der Pillen-Produktion des Konzerns der Bezirksregierung Köln. In einer Anfrage an ihre Adresse wollte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN deshalb unter anderem wissen, warum deren InspektorInnen die Missstände verborgen geblieben sind und wann überhaupt die letzte Kontrolle erfolgte.
Viele Marches
In 428 Städten rund um die Welt fanden im Mai 2018 „Marches Against MONSANTO“ statt. Und vielerorts hießen diese schon „Marches against MONSANTO and BAYER“. So auch in Düsseldorf, wo AktivistInnen der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) zu den TeilnehmerInnen zählten. Und in seiner Kundgebungsrede wünschte sich Jan Pehrke vom CBG-Vorstand für das nächste Jahr eine endgültige Umbenennung: „Heute ist es der „March Against MONSANTO, BAYER und BASF“, gestern war es der „March Against MONSANTO“ und 2019 muss es der „March Against BAYER“ sein, damit das alte MONSANTO-Spiel nicht unter neuem Namen ungestört weiterlaufen kann!“
Vandana Shiva kritisiert BAYSANTO
Die bekannte indische Aktivistin Vandana Shiva hatte im Zuge der letzten Hauptversammlung des Leverkusener Multis an den BAYSANTO-Protesten teilgenommen. Am Tag vor dem Aktionär-Innen-Treffen hielt sie bei der Veranstaltung, die dem Thema „Einstieg in den Ausstieg aus der Pestizid-Falle“ gewidmet war, eine Rede und diskutierte anschließend mit dem grünen Bundestagsabgeordneten Harald Ebner, dem brasilianischen Umweltschützer Alan Tygel und Jan Pehrke von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN. Entsprechend erbost reagierte die Wissenschaftlerin auf die knapp zwei Wochen danach erfolgende endgültige Genehmigung des Deals. „Durch die Fusion wird BAYER den Großteil des Saatgut- und Pestizidmarktes beherrschen“, kritisierte sie. Zu den Hauptleidtragenden der letzten Konzentrationswelle im Agro-Business zählt für Shiva die Umwelt, als hätte diese unter dem Status quo ante nicht bereits genug gelitten: „Die Industrialisierung der Landwirtschaft, auch angetrieben durch BAYER und MONSANTO, hat schon 75 Prozent des Planeten zerstört: Die Verarmung von Böden, die Verschmutzung von Gewässern, der Verlust von Biodiversität – das ist die wirkliche Ernte der Chemie.“ Ihrer Ansicht nach hat die Übernahme von MONSANTO durch BAYER nicht zuletzt auch politische Auswirkungen: „Zusammen sind sie größer als irgendeine Regierungseinrichtung. Deshalb ist der Zusammenschluss auch gefährlich für unsere Demokratie, und das nicht nur in Indien.“
Aufruf gegen Saatgut-Patente
„Stoppt die Monopolisierung von Saatgut durch BAYSANTO“, ist der internationale Aufruf der Initiative NO PATENTS NO SEEDS überschrieben. Er wendet sich dagegen, BAYSANTO und anderen Agrar-Konzernen das Recht zu gewähren, Patente auf Pflanzen und Tiere geltend zu machen. „BAYSANTO & Co. beeinflussen maßgeblich, welche Pflanzen gezüchtet, angebaut und geerntet werden, was Saatgut kostet und wie unsere Lebensmittel in Zukunft produziert werden. Diese Markt-Macht basiert zu großen Teilen auf einer stark steigenden Anzahl von Patenten“, so Katherine Dolan von der den Aufruf mittragenden Organisation ARCHE NOAH. Zu den über 40 Gruppen, die den Appell unterzeichnet haben, zählt auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN.
Glyphosat: Petition gegen Bahn
Die DEUTSCHE BAHN gehört zu den Großverbrauchern von Glyphosat. 65 Tonnen des von der Krebsforschungsagentur IARC der Weltgesundheitsorganisation als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuften Pestizids versprüht das Transport-Unternehmen Jahr für Jahr, um sein Schienennetz frei von Wild-Pflanzen zu halten. Die Initiative SumOfUs hat deshalb eine Online-Petition gegen die Bahn und ihre „33.500 Kilometer voller Glyphosat, die sich wie eine Giftspur durch die ganze Bundesrepublik ziehen“, gestartet. Über 50.000 Menschen haben den Appell bisher schon unterzeichnet (Stand: 22.06.18).
IBEROGAST: Grüne wollen BfArM stärken
Auch Medikamente auf pflanzlicher Basis wie BAYERs Magenmittel IBEROGAST, das 2013 mit dem Kauf von STEIGERWALD in die Produkt-Palette des Pharma-Riesen gelangte, können es in sich haben (siehe auch Ticker 2/18). So schädigt der IBEROGAST-Inhaltsstoff Schöllkraut die Leber. Präparate mit einer hohen Schöllkraut-Konzentration hat das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) deshalb schon aus dem Verkehr gezogen. Von den Herstellern weniger hoch dosierter Produkte verlangte es, einen entsprechenden Warnhinweis auf dem Beipackzettel anzubringen. Der Leverkusener Multi lehnte es aber ab, dieser Aufforderung nachzukommen. Stattdessen zog er vor Gericht – und bleibt damit so lange, wie Justitias Mühlen mahlen, von der Umsetzung der Auflage befreit. Die aufschiebende Wirkung solcher Klagen wollen die Grünen nun aber nicht länger hinnehmen. Sie forderten die Bundesregierung auf, die Rechte des BfArM BAYER & Co. gegenüber zu stärken.
KAPITAL & ARBEIT
Rationalisierungsprogramm „Super Bowl“
Als BAYER-Chef Werner Baumann bei den Investment-Gesellschaften um Zustimmung für den MONSANTO-Deal warb, sah er sich gezwungen, ihnen Kosteneinsparungen zu versprechen, um die mit der Transaktion verbundene Schuldenlast zu drücken. Sonst hätten die Verbindlichkeiten die Rating-Agenturen nämlich dazu bewogen, dem Unternehmen eine äußerst schlechte Note in Sachen „Kreditwürdigkeit“ zu geben. Besonders den neuen Finanzchef des Konzerns, Wolfgang Nickl, sahen die Finanzmarkt-AkteurInnen in der Pflicht. „Herr Nickl muss dafür einstehen, dass BAYER Cash aus jeder möglichen Quelle generiert“, gab etwa der Finanzanalyst Jeremy Redenius vor. Und so kam es im Pharma-Bereich dann zum Effizienz-Programm „Super Bowl“, dem Belegschaftsangehörigen zufolge allein in der Bundesrepublik 1.000 Arbeitsplätze zum Opfer fallen könnten. Besonders die Beschäftigten am Standort Berlin fürchten um ihre Jobs.
POLITIK & EINFLUSS
Neue Kriterien für Hormon-Gifte
Chemische Stoffe haben viele gesundheitsgefährdende Eigenschaften. Eine der unheimlichsten: Manche Substanzen wirken ähnlich wie Hormone und können damit den menschlichen Organismus gehörig durcheinanderwirbeln (siehe auch SWB 4/16). Pestizide des Leverkusener Multis wie FOLICUR (Wirkstoff: Tebuconazole), BETANAL (Lenacil), FENOMENAL (Fenamidon) oder Industrie-Chemikalien made by BAYER wie Bisphenol A sind deshalb imstande, Krebs, Diabetes, Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit und andere Gesundheitsstörungen auszulösen. Hormonell wirksame Ackergifte wollte die EU eigentlich schon 2009 im Rahmen einer Reform der Zulassungsvorschriften verbieten. Dazu kam es allerdings nicht. Nach Ansicht Brüssels galt es zunächst, genaue Kriterien zur Charakterisierung der Pseudo-Hormone – sogenannter endokriner Disruptoren (EDCs) – zu entwickeln. Mit drei Jahren Verspätung, nicht zuletzt dem Extrem-Lobbyismus von BAYER & Co. geschuldet, legte die Europäische Kommission den entsprechenden Entwurf im Sommer 2016 vor. Dieser ließ viele gefährliche Chemikalien aus dem Raster fallen und enthielt zudem zahlreiche Ausnahme-Regelungen wie z. B. für gezielt das Hormonsystem von Schadinsekten angreifende Ackergifte. Deshalb kritisierten das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK (PAN), die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und andere Gruppen die Vorlage scharf. Im Marsch durch die EU-Institutionen gab es dann auch einige Nachbesserungen. So fanden etwa die hormonell wirksamen Insektizide wieder Aufnahme in den EDC-Katalog. Aber wirklich zufriedenstellen können die Ende April endgültig angenommenen und im Oktober in Kraft tretenden Kriterien trotzdem nicht – sie erfassen immer noch nicht alle endokrinen Disruptoren. Zudem legen sie die Schwelle für ein Verbot zu hoch an.
Der Branchen-Dialog „Chemie“
In der letzten Legislatur-Periode hat die damalige Große Koalition Branchen-Dialoge in den Sektoren „Pharma“ und „Chemie“ gestartet. Die Gesprächsrunde zu letzterem bewerteten die Teilnehmer äußerst positiv. Es sei gelungen, „gemeinsam Lösungen für mehr internationale Wettbewerbsfähigkeit zu entwickeln“, hielten das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi), der „Verband der Chemischen Industrie“ (VCI), die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE und der „Bundesarbeitgeberverband Chemie“ fest. Und die Ergebnisse können sich für BAYER & Co. wirklich sehen lassen. „BMWi bringt verstärkt Belange der Chemie-Industrie kontinuierlich in die Enterprise Policy Group (Experten-Gruppe der EU-Kommission) ein“, konstatiert der Monitoring-Bericht trocken. Auch in der 7+7-Gruppe, die aus EmissärInnen der Chemie-Verbände und der Wirtschaftsministerien der sieben Länder Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande und Spanien besteht, ist der Einfluss des VCIs der Publikation zufolge gesichert. Zudem erreichte die Organisation in zahlreichen Bereichen Zugeständnisse der Politik. So rang der Lobby-Club dem Wirtschaftsministerium ein Bekenntnis zum Pestizid-Standort Deutschland ab, inklusive fälliger Standortsicherungsmaßnahmen wie etwa beschleunigte Zulassungsverfahren. Bei der Registrierung gefährlicher Chemikalien, welche die EU seit 2007 betreibt, sicherte das Ministerium den Unternehmen ebenfalls regierungsamtliche Hilfe zu, droht hier aus Gründen des vorsorglichen Gesundheitsschutzes doch der „Wegfall von Verwendungen“ oder schlimmer noch „Stoff-Wegfall“. Der Sorge der Konzerne um eine Energie-Wende zu Lasten ihrer ebenso billigen wie schmutzigen Strom-Quellen nimmt sich indes ein informelles Gremium an, das sich mit der „energie-politischen Strategie nach 2020“ befasst und „die aktuellen Gesetzgebungen kontinuierlich weiter beobachtet“. Auch ganz generell hat sich der Branchen-Dialog vorgenommen, eine „Gesetzesfolgen-Abschätzung“ zu initiieren, weil es bisher „keine systematische Betrachtung der Auswirkungen der Regelungsvorhaben auf die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft“ gibt. Eine Innovationsbremse hat die Chemie-Industrie bereits identifiziert: das Arzneimittel-Neuverordnungsgesetz (AMNOG) von 2011, das neuen Medikamenten doch tatsächlich eine Kosten/Nutzen-Prüfung aufbürdet.
NRW: Schwarz-Gelb für BAYER & Co.
Die schwarz-gelbe Landesregierung in Nordrhein-Westfalen bekennt sich freimütig zur Wirtschaft im Allgemeinen und zur Chemie-Industrie im Besonderen – mit entsprechenden Nebenwirkungen für Klima und Umwelt (s. u.). „Christdemokraten und Freie Demokraten stellen sicher, dass die Interessen des Industrie- und Energiestandorts Nordrhein-Westfalen künftig wieder wahrnehmbar gegenüber dem Bund und der Europäischen Union vertreten werden“, heißt es im Koalitionsvertrag. Dabei wollen die PolitikerInnen bevorzugt für eine Branche Lobby-Arbeit betreiben: „Einen besonderen Fokus legen wir auf den Erhalt der Wertschöpfungsketten, der Wettbewerbsfähigkeit, der Arbeitsplätze und der Innovationsfähigkeit der in Nordrhein-Westfalen ansässigen chemischen Industrie.“
Prima Klima in NRW für BAYER & Co.
Das Land Nordrhein-Westfalen trägt fast ein Drittel zu den bundesdeutschen Kohlendioxid-Emissionen bei, woran BAYER alles andere als unschuldig ist. Für die schwarz-gelbe Landesregierung stellt das zur Freude des Leverkusener Multis jedoch keinen Grund zum Umsteuern dar. Sie hat andere Prioritäten: „Wir werden die Energie- und Klimapolitik danach ausrichten, Nordrhein-Westfalen als Energieland Nummer eins zu stärken, um führendes Industrieland, auch für energie-intensive Industrien, zu bleiben und Wertschöpfungsketten zu erhalten“, schreiben die Parteien in ihrem Koalitionsvertrag. Dementsprechend legen sie Hand an das Landes-Klimaschutzgesetz von Rot-Grün und kappen alle Regelungen, die über EU-Maßgaben hinausgehen. Zudem bekennen sich Laschet & Co. zum Klima-Killer Braunkohle („unser einziger heimischer Rohstoff, der wettbewerbsfähig ist und zudem einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit leistet“) und drohen an, die Strom-Steuer senken zu wollen.
Klima-Politik: BAYER will mitreden
Der BAYER-Manager Wolfgang Große Entrup gehört dem Wirtschaftsrat der CDU an. Er leitet dort die Bundesfach-Kommission „Umwelt“ und äußert sich dementsprechend oft zu Umwelt-Themen – natürlich auch pro domo. Jüngst ergriff er dazu in einer Beilage der Faz zum Wirtschaftstag – die Zeitung nennt diese vom Wirtschaftsrat ins Leben gerufene Veranstaltung „eines der hochkarätigsten Foren für den Austausch von Wirtschaft und Politik“ – die Gelegenheit. In seinem Beitrag klagte Große Entrup einmal mehr über die angeblich mit der Energiewende einhergehenen hohen Strom-Kosten und wusste auch schon ein probates Mittel dagegen: mehr Mitsprache-Rechte für BAYER & Co. „Dabei sollte die Wirtschaft stärker in die entscheidungsrelevanten Dialog-Prozesse eingebunden werden. Denn eine marktwirtschaftliche Umsetzung der klima- und energiepolitischen Ziele kann nur gemeinsam mit der Wirtschaft erreicht werden“, meinte Große Entrup. Ansonsten trat er in Sachen „Klima“ für „einen internationalen Schulterschluss“ ein, was Leute seines Schlages gern tun, weil sie genau wissen, dass dieser nie zustande kommen wird.
Lobbying für CRISPR/Cas & Co.
Gen-Scheren, die das Erbgut an einer vorgegebenen Stelle auftrennen und dort neue, im Labor hergestellte DNA-Stränge einfügen können, arbeiten nach Ansicht von BAYER & Co. so präzise, dass die von ihnen herbeigeführten Veränderungen sich gar nicht mehr von denjenigen unterscheiden, welche die konventionelle Züchtung zu Wege bringt. Deshalb fallen CRISPR/Cas und andere Verfahren für sie nicht unter „Gentechnik“ und ergo auch nicht unter die entsprechenden Regularien. Davon wollen die Unternehmen auch die EU überzeugen und setzen dabei auf alte Bekannte. So hat Bernd Müller-Röber vom „Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland“ (VBIO) Abgeordnete des Europa-Parlaments jüngst in einem Schreiben davon zu überzeugen versucht, die „Gentechnik 2.0“ nicht als Update der „Gentechnik 1.0“ zu betrachten und sie aus diesem Grund auch vor den für diese geltenden Auflagen zu verschonen. Eigene Patent-Anträge zu DNA-Manipulationen, die sich der neuen Methoden bedienen, verschwieg er dabei allerdings ebenso wie seine Mitarbeit an einigen alten „Gentechnik 1.0“-Patenten von BAYER.
Brexit: VfA will Übergangsfrist
Rund ein Fünftel aller Zulassungsverfahren für Medikamente bearbeitet die britische Arzneimittel-Behörde. Wegen des Brexits wird sie dies allerdings nur noch bis Ende März 2019 tun, was dem von BAYER gegründeten „Verband der forschenden Arzneimittel-Hersteller“ (VfA) Anlass zur Besorgnis gibt. „Der Brexit könnte die Zulassung von Arzneimitteln in Europa gefährden“, warnt er und fordert Übergangsfristen. Diese müssten „ganz oben auf der Agenda der konkreten Austrittsverhandlungen stehen“, erklärt die Lobby-Organisation.
Kein Glyphosat-Verbot in Frankreich
Der französische Präsident Emmanuel Macron wollte in seinem Land das BAYER-Pestizid Glyphosat verbieten, das die Krebs-Agentur der Weltgesundheitsorganisation als „wahrscheinlich krebserregend“ einstuft. Der Politiker konnte sich mit diesem Ansinnen allerdings nicht durchsetzen. Die Nationalversammlung lehnte den Antrag ab. Selbst einige Mitglieder von Macrons „En Marche!“ stimmten gegen den Bann.
Ein bisschen weniger Glyphosat
Nach dem Dafürhalten von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner darf es ein bisschen weniger Glyphosat sein – aber nur klitzekleines bisschen. Die Christdemokratin legte im Frühjahr den Entwurf einer entsprechenden Verordnung vor. Diese will den Einsatz des „wahrscheinlich krebserregenden“ BAYER-Pestizids vor allem im HobbygärtnerInnen-Sektor einschränken, obwohl der Bereich nur für zwei Prozent des Glyphosat-Verbrauchs verantwortlich ist. Die Landwirtschaft hat hingegen kaum Einschränkungen zu fürchten. „Für unser gemeinsames Ziel, den Einsatz von Glyphosat grundsätzlich zu beenden, werden weitere Schritte folgen müssen“, sagte deshalb Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), und Toni Hofreiter von BÜNDNIS 90/Die Grünen kritisierte, „kleine, kosmetische Maßnahmen“ seien nicht genug: „Stattdessen muss die Anwendung von Glyphosat in der Landwirtschaft in den nächsten vier Jahren auf Null heruntergefahren werden.“
BAYER & Co. wollen Forschungsförderung
Seit Jahr und Tag fordert der BAYER-Konzern die steuerliche Absetzbarkeit von Forschungsaufwendungen. Jetzt hat seine Interessensvertretung, der „Bundesverband der Industrie (BDI), einen neuen Vorstoß in dieser Richtung unternommen. „Steuerliche Forschungsförderung unverzüglich einführen!“ ist das entsprechende Positionspapier überschrieben. „Im weltweiten Wettbewerb um die Forschungsstandorte in multinationalen Unternehmen und Branchen ist die staatliche Förderung von Forschung und Entwicklung nicht alles, oft aber der entscheidende Grund, Forschungskapazitäten auszubauen oder neu anzusiedeln“, hält die Lobby-Organisation fest. Einen konkreten Plan für die Umsetzung hat der BDI auch schon ausgearbeitet. Ihm schwebt eine Steuer-Gutschrift pro Beschäftigtem in Höhe von bis zu 6.000 Euro vor. „Maximal 2,5 Milliarden Euro“ würde das den Staat kosten – nach Ansicht von BAYER & Co. ein Schnäppchen.
PROPAGANDA & MEDIEN
Neues Corporate Design
Um das Image BAYERs steht es nicht zum Besten. Darum sah das Management Handlungsbedarf. Da aber gute Taten mit einem der Profit-Logik folgenden Konzern nur schwerlich zu bewerkstelligen sind, entschloss sich der Vorstand stattdessen, am Erscheinungsbild zu feilen. „BAYER will sympathischer werden – und hat deshalb sein Corporate Design überarbeitet“ vermeldete das PR-Fachblatt W&V. Bei diesem Unterfangen hat der Leverkusener Multi dann weder Kosten noch Mühen gescheut. Er befragte 1.500 Menschen aus sechs Ländern zu seiner Reputation und wertete weitere Umfragen zu diesem Thema aus. Die Resultate wiesen BAYERs oberstem Öffentlichkeitsarbeiter Michael Preuss zufolge höhere Kompetenz- als Sympathie-Werte aus. Und da hat die Branding-Agentur LANDOR angesetzt und rechtzeitig zur MONSANTO-Übernahme alles „wärmer und emotional ansprechender“ gestaltet. Aber ob ’s hilft, ist noch die Frage ...
Vertriebskosten: Elf Milliarden Euro
Unter Vertriebskosten verbucht der Leverkusener Multi all das, was es braucht, um seine Produkte loszuschlagen: Werbung, Marketing, KundInnen-Beratung, den Außendienst inklusive Pharma-DrückerInnen und andere Posten. Im Jahr 2017 gab der Konzern dafür rund elf Milliarden Euro aus.
Lobby-Offensive wg. MONSANTO
Der BAYER-Konzern hat 2017 in den USA viel Geld investiert, um Stimmung für die Ziele des Unternehmens zu machen. 10,5 Millionen Dollar steckte er in die Pflege der dortigen politischen Landschaft – mehr Geld für solche Aktivitäten gab in dem Land kein anderes deutsches Unternehmen aus. Unter anderem galt es, die DemokratInnen und RepublikanerInnen vom Sinn der MONSANTO-Übernahme und vom Unsinn der Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel zu überzeugen. Auch die Verbreitung der Mär, dass die Neonicotinoide GAUCHO und PONCHO keiner Biene etwas zu Leide tun können, war dem Unternehmen teuer. Etwas Schlimmes konnte der Konzern an diesem Einsatz nicht finden: „BAYER ist stolz darauf, sich aktiv am politischen Prozess in den USA zu beteiligen, damit auch unsere Stimme gehört wird.“
PR-Offensive wg. MONSANTO
BAYER begleitet die Übernahme von MONSANTO mit einer PR-Offensive. Um die journalistische Landschaft zu pflegen, ließ der Konzern die 40-seitige Broschüre „Landwirtschaft und Ernährung von morgen“ in einer Auflage von 30.000 Exemplaren erstellen und sie Fachmagazinen wie Wirtschaftsjournalist und medium beilegen. Allerdings gab es prompt Ärger mit der Publikation. Der Leverkusener Multi hatte darin nämlich den Schweizer Professor Urs Niggli mit einer positiven Aussage über die neuen Gentechniken zitiert, wogegen dieser sich verwahrte (s. u.). Darüber hinaus richtete der Agro-Riese die Dialog-Plattform „Zukunftsfelder“ ein, die sich allerdings nicht gerade großen Zuspruchs von Umweltverbänden erfreute. Zudem sponserte er die vom Berliner Tagesspiegel ausgerichtete Diskussionsveranstaltung „World Food Conference“, die mit so prominenten Gästen wie der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) aufwartete, und redete zu Themen wie „Zulassungsverfahren“ auch ein Wörtchen mit.
PR-GAU
„Für Landwirte – auch für Öko-Landwirte – eröffnet die neue Methode viele Chancen“, diese lobende Worte fand Professor Urs Niggli, Direktor des schweizer Forschungsinstituts für biologischen Landbau, zu CRISPr-Gas und anderen neuen Gentechniken. Ein gefundenes Fressen für BAYER. Der Leverkusener Multi zitierte die Äußerung in seiner Propaganda-Broschüre „Landwirtschaft und Ernährung von morgen“, hatte dabei aber die Rechnung ohne Niggli gemacht. Dieser verwahrte sich gegen die Übernahme. Vom „Missbrauch meines Namens“ sprach der Agrar-Wissenschaftler und betonte, er habe völlig andere Positionen als der Agro-Riese. Der Konzern musste daraufhin alle noch verbliebenen Exemplare der Schrift in die Tonne klopfen und den Niggli-Satz von seiner Internet-Seite nehmen. Auch auf Beiträge des Professors zur Dialog-Plattform „Zukunftsfelder“ konnte er nicht länger zählen. Er sähe keinen Sinn in Dialogen, die auf die Strategie der Firma BAYER keine Wirkung hätten, erklärte Urs Niggli laut Informationsdienst Gentechnik.
BAYER vs. Vandana Shiva
Auch die bekannte indische Aktivistin Vandana Shiva nahm an den diesjährigen Protesten rund um die BAYER-Hauptversammlung teil (siehe AKTION & KRITIK). Dadurch sah sich der Leverkusener Multi zu einer Reaktion gezwungen. „Herzlich Willkomen, Vandana Shiva!“ begrüßte der Konzern die Wissenschaftlerin auf seiner Internet-Seite, um dann sieben Thesen von ihr einem „Faktencheck“ zu unterziehen. Selbstredend kam da keine einzige heil heraus. Stattdessen gibt es nichts Gesünderes auf der Welt als gentechnisch veränderte Lebensmittel, selbst wenn sie in ihrem Vorleben auf den Äckern ein paar Glyphosat-Duschen abbekommen haben, hat doch „dieser Wirkstoff eine äußerst geringe Giftigkeit“. Und indische LandwirtInnen, die Baumwolle mit einer eingebauten Resistenz gegen den Bacillus thuringiensis (Bt) anpflanzten und sich anschließend wegen der Missernten umbrachten, kennt der Konzern nicht. „Es besteht nachweislich kein direkter Zusammenhang zwischen der Einführung gentechnisch veränderter Baumwolle und der Selbstmord-Rate bei indischen Bauern“, hält er fest und behauptet stattdessen: „Die Einführung von Bt-Baumwolle in Indien war ein Erfolg.“ Und so geht die Märchenstunde dann munter bis zur siebten These weiter, wo BAYERs FaktencheckerInnen sich darin versuchen, dem goldenen Gen-Reis all den Glanz zurückzugeben, den Vadana Shiva ihm geraubt hatte.
BAYER darf mehr Schule machen
Ganz so, als hätten die Konzerne nicht schon genug Einfluss auf die Bildungseinrichtungen, darf es für Schwarz-Gelb in BAYERs Stammland Nordrhein-Westfalen gerne noch ein bisschen mehr sein. „Wir wollen Unternehmen und andere gesellschaftliche Gruppen ermutigen, ihr Personal und ihre besondere Expertise vor allem in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, Anm. Ticker) stundenweise den Schülern zur Verfügung zu stellen“, drohte Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) an. Davon verspricht die Politikerin sich, „den Kindern Kenntnisse direkt aus der Praxis zu vermitteln“. Zudem kann der Leverkusener Multi sich in NRW über das neue Schulfach „Wirtschaft“ freuen.
DRUGS & PILLS
BfArM warnt vor XOFIGO
BAYERs XOFIGO hat bisher eine Zulassung für einen solchen Prostata-Krebs, der bereits die Knochen angegriffen hat und auf eine Hormon-Entzugsbehandlung – Testosteron und andere Androgene haben Einfluss auf das Wachstum der Krebs-Zellen – nicht reagiert. Nun wollte der Leverkusener Multi das strahlen-therapeutische Mittel mit dem Wirkstoff Radium-223-Dichlorid in Kombination mit Abirateronacetat und Prednison bei einer anderen Art des Prostata-Karzinoms zum Einsatz bringen. Er musste die klinischen Tests allerdings abbrechen (Ticker 1/18). Bei den XOFIGO-Probanden, die entweder noch gar keine oder nur schwache Symptome der Krankheit hatten, war nämlich laut BAYER „ein erhöhtes Auftreten von Todesfällen und Frakturen“ zu beobachten. Während die Todesrate in der Gruppe, die mit Abirateronacetat und Prednison ein Placebo einnahm, bei 20 Prozent lag, betrug diese bei den XOFIGO-Patienten 27 Prozent. Und Knochen-Brüche traten unter XOFIGO mehr als drei Mal so häufig auf (24 Prozent zu sieben Prozent). Darum hat die Klinische Prüfung ein Nachspiel. Nach Auskunft des „Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizin-Produkte“ (BfArM) untersucht jetzt die „Europäische Arzneimittel-Agentur“ die Vorfälle, „um die Bedeutung für die zugelassene Anwendung von XOFIGO zu ermitteln“. Und den Pharma-Riesen zwangen die Aufsichtsbehörden, die MedizinerInnen in zwei Rote-Hand-Briefen davor zu waren, das Präparat weiter zusammen mit Abirateronacetat und Prednison zu verordnen.
ASPIRIN mit Warnhinweisen
Das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-Produkte“ (BfArM) tritt bereits seit Langem dafür ein, ASPIRIN und andere Schmerzmittel in den Apotheken nur noch dann ohne Rezept auszugeben, wenn die Anwendungsdauer auf vier Tage beschränkt ist. Die Präparate haben nämlich beträchtliche Nebenwirkungen. So kann BAYERs „Tausendsassa“ etwa Magenbluten verursachen. Mit seinem Anliegen konnte sich das BfArM zwar nicht durchsetzen, immerhin aber müssen der Leverkusener Multi und die anderen Hersteller von Schmerzmitteln auf den Schachteln künftig den Warnhinweis anbringen: „Bei Schmerzen und Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden, als in der Packungsbeilage vorgegeben!“ Leider nur ermangelt es dem Satz an Eindeutigkeit, zudem haben die Pharma-Riesen noch zwei Jahre Zeit, um die Anordnung umzusetzen.
FDA schränkt ESSURE-Vertrieb ein
Bei ESSURE, BAYERs ohne Hormone auskommendes Sterilisationsmittel, handelt es sich um eine kleine Spirale, deren Kunststoff-Fasern für ein so großes Wachstum des Bindegewebes sorgen sollen, dass sich die Eileiter verschließen. Allzu oft jedoch bleibt das Medizin-Produkt nicht an dem vorgesehenen Ort, sondern wandert im Körper umher und verursacht Risse an den Wänden von Organen, was zu lebensgefährlichen inneren Blutungen führen kann. Auch Hautausschläge, Kopfschmerzen, Übelkeit und Allergien zählen zu den Nebenwirkungen. Das hat die US-amerikanische Gesundheitsbehörde „Food and Drug Admininstration“ (FDA) jetzt zu Maßnahmen veranlasst. „Jede Frau, die dieses Produkt erhält, sollte die damit verbundenen Risiken kennen“, so Scott Gottlieb von der FDA. Deshalb beschränkte die Institution den ESSURE-Vertrieb auf solche ÄrztInnen und Medizin-Einrichtungen, welche die Frauen anhand einer langen Check-Liste eingehend beraten. Zudem drohte die Behörde dem Leverkusener Multi für den Fall, dass er die potentiellen ESSURE-Interessentinnen nicht ausreichend über die Nebenwirkungen der Spirale informiert, rechtliche Schritte an.
BAYER schränkt ESSURE-Vertrieb ein
BAYER stellt den Vertrieb der Sterilisationsspirale ESSURE außerhalb der USA ein. Mit Sicherheits- oder Qualitätsbedenken (s. o.) habe das aber nichts zu tun, betont der Konzern.
EMA prüft CIPROBAY
Antibiotika aus der Gruppe der Fluorchinolone wie BAYERs CIPROBAY (Wirkstoff: Ciprofloxacin) haben viele schwerwiegende Nebenwirkungen (siehe auch SWB 3/18). Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA listet von 2002 bis 2017 allein zu Ciprofloxacin 1.116 Todesfälle und 20.353 Meldungen über unerwünschte pharmakologische Effekte auf. Besonders häufig kommen Lädierungen von Muskeln und Sehnen vor. Überdies hemmen die Fluorchinolone Enzyme, welche die Verstoffwechselung von Arzneien im Körper steuern. Dadurch verbleiben unter Umständen hohe Konzentrationen von Arznei-Stoffen im Organismus, was die Gefahr von unkontrollierbaren Wechselwirkungen heraufbeschwört. Bereits mehrmals haben die Aufsichtsbehörden der verschiedenen Länder deshalb den Anwendungsbereich der Mittel beschränkt und die Hersteller gezwungen, ihre Packungsbeilagen um Warnungen vor bestimmten Gesundheitsschäden zu ergänzen. Und im Februar 2017 stieß das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) bei der EMA ein europäisches Risiko-Bewertungsverfahren für Fluorchinolone an. „Ziel ist eine umfassende Bewertung von schwerwiegenden und persistierenden (dauerhaften, Anm. Ticker) Nebenwirkungen, die überwiegend den Bereich des Bewegungsapparates und des Nervensystems betreffen“, teilt das Institut mit. Mitte Juni findet dazu eine öffentliche Anhörung statt. Einen Monat später will die Arzneimittel-Agentur dann das Ergebnis der Überprüfung verkünden.
BfArM überprüfte YASMIN & Co.
BAYERs Verhütungsmittel wie die Pille YASMIN oder die Hormon-Spirale MIRENA haben zahlreiche Nebenwirkungen. Zum Brustkrebs- und zum Selbstmord-Risiko wertete das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) jetzt neue Studien aus. Danach gab die Behörde Entwarnung. Die Befunde gaben ihrer Ansicht nach keinen Anlass dazu, Maßnahmen zu ergreifen.
Grenzwert-Bestimmung in der Kritik
Die Pharma-Konzerne arbeiten permanent an der Vergrößerung der Zielgruppe für ihre Medikamente. Ein probates Mittel dazu ist es, die Grenzen zwischen Gesundheit und Krankheit zu verschieben. So befindet sich etwa der Wert, ab dem der Blutdruck nicht mehr als normal, sondern als zu hoch und damit behandlungswürdig gilt, seit Jahren im Sinkflug (Ticker 1/18). Ähnlich erging es demjenigen zur Diabetes-Bestimmung. Lange Zeit zeigte ein Blutzucker-Spiegel von über 140 mg/dl die Notwendigkeit von medizinischen Maßnahmen an, bereits seit 1997 reichen jedoch 126 mg/dl. Und ganz im grünen Bereich ist mensch auch unterhalb dieses Limits nicht. Das Reich der „Prä-Diabetes“ beginnt nämlich schon ab 100 mg/dl, was den Absatz von BAYERs Zuckerkrankheitspräparat GLUCOBAY nicht unerheblich steigert. Das ExpertInnen-Gremium der „American Diabetes Association“ (ADA) hatte für die neuen Festlegungen plädiert – allerdings nicht aus hehren wissenschaftlichen Motiven. Ökonomische gaben vielmehr den Ausschlag. Kommissonschef James R. Gavin beispielsweise verfügte über lukrative BeraterInnen-Verträge mit BAYER und anderen Pharma-Riesen. Der Kölner Mediziner Prof. Dr. Stefan Wilm hält rein quantitative Angaben, etwa über die Höhe des Blutzucker-Spiegels, generell für keine hinreichenden Kriterien zur Definition einer Gesundheitsstörung und kritisiert die Ausweitung der Krankheitszonen durch die Zahlenspiele vehement. „Je niedriger wir die Grenzwerte ansetzen, (...) umso mehr Medikamente werden verordnet. Aber der Patient hat davon keinen Nutzen“, so der Arzt.
Deal mit LOXO ONCOLOGY
BAYER setzt immer weniger auf eigene Forschungsanstrengungen und kauft stattdessen Innovationen von außen zu. So hat der Konzern mit LOXO ONCOLOGY ein Geschäft abgeschlossen, das ihm die Vertriebsrechte an zwei neu entwickelten Krebs-Wirkstoffen sichert. Dabei handelt es sich um Loxo-195 und Larotrectinib, für den LOXO in den USA gerade einen Zulassungsantrag gestellt hat. Je nach Erfolg der beiden Stoffe hat der Pillen-Riese sich zu Zahlungen von bis zu 1,15 Milliarden Dollar verpflichtet. „Das ist ein strategisch sehr wichtiger Deal für zwei hochinnovative Substanzen“, konstatiert Arznei-Chef Dieter Weinand: „Damit sollte endlich auch die Frage beantwortet sein, ob BAYER angesichts der MONSANTO-Übernahme nicht die Pharma-Sparte vernachlässige.“
„Consumer Health“ schwächelt
Der Leverkusener Multi hat das Geschäft mit den rezeptfreien Arzneien in der letzten Zeit stark ausgebaut und ist in diesem Bereich zur Nr. 2 auf der Welt aufgestiegen. Aber nicht nur die 2014 zugekaufte MERCK-Sparte erfüllte ihre Erwartungen bisher nicht, auch der Absatz der restlichen Produkte schwächelt bereits seit Langem. Im Geschäftsjahr 2017 ging der Umsatz um 1,7 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro zurück, und der Gewinn schrumpfte sogar um 13 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Im November 2017 kostete das Sparten-Chefin Erica Mann ihren Job.
AGRO & CHEMIE
Aus für GAUCHO, PONCHO & Co.
Im Jahr 2014 hatte die Europäische Union die Pestizid-Wirkstoffe Imidacloprid und Clothianidin von BAYER sowie die SYNGENTA-Substanz Thiamethoxam wegen ihrer Bienengefährlichkeit vorläufig aus dem Verkehr gezogen. Ende April 2018 verkündete die EU-Kommission ein dauerhaftes Verbot der Mittel aus der Gruppe der Neonikotinoide. Zum Leidwesen des Leverkusener Multis, der die Entscheidung mit den Worten „ein trauriger Tag für die Landwirte und ein schlechter Deal für Europa“ kommentierte, dürfen PONCHO, GAUCHO & Co. jetzt nicht mehr auf Äckern, sondern nur noch in Gewächshäusern ihr Unwesen treiben. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) betreibt bereits seit 1999 eine Kampagne gegen diese Insektizide und kann nun endlich den Erfolg ihrer Bemühungen verzeichnen. Deshalb begrüßte sie die Entscheidung Brüssels, verlangte allerdings zugleich weitere Maßnahmen: „Dieser Schritt war überfällig. Jetzt gilt es aber auch, konsequent zu sein und die übrigen Stoffe dieser Substanz-Klasse aus dem Verkehr zu ziehen.“ Darüber hinaus forderte die CBG Brüssel auf, diejenigen Pestizide genauer unter Beobachtung nehmen, welche die Industrie als Ersatz für die Mittel vorgesehen hat. Der Leverkusener Multi zum Beispiel bemüht sich in der Bundesrepublik gerade um eine Zulassung von SIVANTO, dessen Inhaltsstoff Flupyradifuron einige WissenschaftlerInnen ebenfalls als schädlich für Bienen einstufen. So hält etwa Michele Colopy von der Organisation POLLINATOR STEWARDSHIP COUNCIL fest: „Die Forschungsergebnisse weisen vielleicht auf keine akute toxische Wirkung bei der ersten Anwendung hin, aber Zweit- und Drittanwendung zeigen eindeutige Effekte auf die Bienensterblichkeit, das Verhalten, die Brut-Entwicklung sowie Pollen und Nektar.“ Und zu ähnlichen Ergebnissen kam jüngst die Universität Würzburg.
EuGH bestätigt GAUCHO-Aus
Nach dem von der Europäischen Kommission verkündeten Aus für GAUCHO und PONCHO (s. o.) setzte BAYER noch Hoffnung auf die Justiz. Der Konzern hatte nämlich 2013 in Tateinheit mit SYNGENTA schon gegen das vorläufige Verbot der Europäischen Union geklagt und erwartete nun eine Entscheidung in seinem Sinne. Aber diese Rechtshilfe blieb aus; der Europäische Gerichtshof stellte sich auf die Seite der EU-Kommission. „Was die im Jahr 2013 beschränkten oder verbotenen Verwendungen betrifft, entscheidet das Gericht, dass die Kommission darlegen konnte, dass in Anbetracht der erheblichen Verschärfung der Anforderungen daran, dass keine unannehmbaren Auswirkungen der Wirkstoffe auf die Bienen vorhanden seien, die von der EFSA (Europäische Lebensmittelbehörde, Anm. Ticker) festgestellten Gefahren den Schluss zuließen, dass die drei fraglichen Wirkstoffe nicht mehr den Zulassungskriterien entsprächen“, lautete das Votum aus Luxemburg. Da musste der Global Player schmollen: „BAYER ist enttäuscht.“
Neue Ackergifte
2018 bringt BAYER zwei neue Agro-Chemikalien auf den Markt, wobei „neu“ relativ ist. In Ermangelung wirklicher Innovationen kombiniert der Leverkusener Multi nämlich nur altbekannte Wirkstoffe und hofft – wie bei den mit Mehrfach-Resistenzen ausgestatteten Gen-Pflanzen –, dass es die Menge macht. So besteht das Fungizid ASCRA Xpro aus den drei Substanzen Bixafen, Prothioconazol und Fluopyram. Das Herbizid LIBERATOR PRO, von dem die LandwirtInnen laut BAYER-Empfehlung ein Liter pro Hektar ausbringen sollen, wartet hingegen mit den Inhaltsstoffen Flufenacet, Diflufenicat und Metribuzin auf. Und ganz ohne sind die nicht: Metribuzin beispielsweise findet sich in der Liste der hochgefährlichen Pestizide, welche das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK (PAN) im März 2018 veröffentlicht hat.
Verkauf von Bromacil-Pestiziden
Die mit der Übernahme von MONSANTO verbundenen Auflagen zwangen BAYER, einige Pestizide abzustoßen. Aber auch aus freien Stücken trennt sich der Konzern von Zeit zu Zeit von Agro-Chemikalien. So verkaufte der Global Player im Juni 2018 sein USA- und Kanada-Geschäft mit bromacil-haltigen Herbiziden. Neuer Besitzer der Ackergifte, die der Leverkusener Multi unter den Namen HYVAR und KROVAR vermarktet hatte, ist das US-amerikanische Unternehmen AMVAC.
Die „MONSANTO Papers“
Im Zuge der Klagen von US-amerikanischen Glyphosat-Geschädigten (siehe auch RECHT & BILLIG) kamen die Firmen-Unterlagen MONSANTOs zu dem Ackergift ans Licht der Öffentlichkeit. In diesen „MONSANTO Papers“ offenbaren die Konzern-WissenschaftlerInnen selber massive Zweifel an der medizinischen Unbedenklichkeit des unter dem Namen ROUNDUP vermarkteten Pestizides. „Man kann nicht sagen, dass ROUNDUP nicht krebserregend ist“, hält etwa die MONSANTO-Toxikologin Donna Farmer fest: „Wir haben nicht die nötigen Tests mit der Formulierung durchgeführt, um diese Aussage treffen zu können.“ Die Formulierung, also die mit Hilfe von Wirkungsverstärkern und anderen Substanzen erfolgte Weiterverarbeitung des Basis-Stoffes Glyphosat zum fertigen ROUNDUP, bereitete ihrem Kollegen William Heydens’ ebenfalls große Sorgen: „Glyphosat ist OK, aber das formulierte Produkt verursacht den Schaden.“ So hat es beispielsweise negative Effekte auf das Erbgut. Als eine Auftragstudie in dieser Hinsicht nicht genug Entlastungsmaterial liefern konnte, sondern den Befund sogar noch zu bestätigen drohte, schlug Heydens einfach vor, sich willigere WissenschaftlerInnen zu suchen. Wie die MONSANTO-Papers darüber hinaus belegen, griffen die Konzern-ForscherInnen zur Not auch selbst zur Feder, um ihrem Millionen-Seller einen Persilschein auszustellen, und kauften sich anschließend bekannte ExpertInnen ein, die für viel Geld ihren Namen unter den Text setzten. Zudem nutzte das Unternehmen all seinen Einfluss, um die Umweltbehörde EPA daran zu hindern, eine Untersuchung zu Glyphosat zu veranlassen.
BAYER vertreibt Bio-Stimulanzien
Der Leverkusener Multi vertreibt künftig die Bio-Stimulanzien BAYFOLAN, BAYFOLAN ACTIVATOR und COBRE des italienischen Unternehmens SICIT 2000. Eine entsprechende Vereinbarung zu den Produkten auf der Basis von Aminosäuren und Peptiden, die das Wachstum von Pflanzen anregen und ihre Widerstandskraft stärken, schlossen die beiden Unternehmen Ende 2017. Der Konzern baut damit sein Sortiment an Biologicals weiter aus. So hat er bereits die Bio-Pestizide REQUIEM, BIBACT und CONTANS sowie Saatgutbehandlungsmittel auf biologischer Basis im Angebot. Der Leverkusener Multi will wegen BAYFOLAN & Co. jedoch seinen Agrogift-Schrank nicht gleich entsorgen; „best of both worlds“ lautet die Devise. „Wir setzen auf integrierte Angebote für Nutzpflanzen. Also auf die Auswahl des passenden Saatguts und die beste Kombination aus chemischen und biologischen Produkten“, bekundet der Agro-Riese.
GENE & KLONE
Krebsgefahr durch „Gentechnik 2.0“?
BAYER setzt sowohl im Pharma- als auch im Agro-Bereich stark auf die „Gentechnik 2.0“, also zum Beispiel auf Gen-Scheren, die das Erbgut angeblich präzise an einer vorgegebenen Stelle auftrennen und dort neue, im Labor hergestellte DNA-Stränge einfügen können. So hat der Leverkusener Multi 2015 ein Kooperationsabkommen mit CELLECTIS PLANT SCIENCE in Sachen „Genome Editing“ geschlossen und gründete im selben Jahr ein Joint Venture mit dem US-Unternehmen CRISPR THERAPEUTICS. 2016 schließlich traf der Konzern eine Lizenz-Vereinbarung mit der irischen Firma ERS GENOMICS. Diese sichert dem Pharma-Riesen den Zugriff auf mehrere Patente, die ERS auf die Anwendung der Schnippel-Technik CRISPR/Cas9 hält. Und genau diese Methode steht jetzt in Verdacht, Krebs-Erkrankungen zu befördern. Gleich zwei Studien warnen vor dieser „Nebenwirkung“. Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht das Protein p53. Dieses flickt gebrochene DNA-Stränge und hemmt gleichzeitig das unkontrollierte, und deshalb Krebs befördernde Zell-Wachstum. Gen-Scheren meiden nach Möglichkeit Zellen mit dem p53-Protein, weil dieses sich unverzüglich daran macht, die Schnitte wieder zuzunähen, und halten lieber nach solchen ohne diesen Eiweiß-Stoff Ausschau. „Indem wir Zellen nehmen, die das beschädigte Gen erfolgreich repariert haben, nehmen wir vielleicht unbeabsichtigt immer gerade solche ohne funktionierendes p53“, erläutert die Wissenschaftlerin Dr. Emma Haapaniemi vom schwedischen Karolinska-Institut. Deshalb warnt sie: „Wenn diese Zellen einem Patienten transplantiert werden, beispielsweise zur Behandlung einer Erb-Krankheit, könnten sie die Krebsgefahr erhöhen, was Fragen zur Sicherheit der CRISPR/Cas9-Therapien aufwirft.“
BAYER will Gentech-Bakterien
Im Frühjahr 2018 hat der BAYER-Konzern seinen zahlreichen Kooperationen auf dem Gebiet der Gentechnik 2.0, dem so genannten Genome Editing (s. o.), eine neue hinzugefügt. Er gründete mit GINKGO BIOWORKS ein Joint Venture. Mit zusätzlichem Geld vom Hedgefonds VIKING GLOBAL versehen, wollen die beiden Unternehmen mit Hilfe der neuen Methoden Bakterien entwickeln, die der Landwirtschaft als Dünger dienen können.
Saatgut per Gentechnik 2.0
Zur Mitgift von MONSANTO gehörte auch eine Kooperation mit dem Startup-Unternehmen PAIRWISE PLANTS. Die Firma will mit Hilfe neuer gentechnischer Methoden, die das Erbgut angeblich präzise an einer vorgegebenen Stelle auftrennen und dort neue, im Labor hergestellte DNA-Stränge einfügen können, Saatgut entwickeln. Auf der Wunschliste stehen unter anderem Soja, Mais, Weizen, Baumwolle, Raps, Kartoffeln und diverse Obst-Sorten.
USA: Kommt die Kennzeichnungspflicht?
Die USA wollen ab 2020 eine Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel einführen. Während VerbraucherschützerInnen die wenig eindeutigen Text-Vorschläge, die der Gesetzes-Entwurf enthält, kritisieren, betreiben BAYER & Co. schon einmal Extrem-Lobbying gegen die Pläne (siehe auch POLITIK & EINFLUSS).
KOGENATE unter Beobachtung
Im Jahr 2014 machten gleich zwei Studien auf eine bisher unbekannte Nebenwirkung von BAYERs Blutgerinnungspräparat KOGENATE und dem ebenfalls vom Leverkusener Multi entwickelten, jetzt aber von BEHRING vertriebenem Mittel HEXILATE NEXGEN aufmerksam. Neue, vorher nicht behandelte Bluter-Patienten reagieren auf diese beiden Gentech-Mittel der zweiten Generation öfter allergisch als auf Blutprodukte der dritten Generation, so der Befund. Für den Bluter-Weltverband „World Federation of Hemophilia“ legte dieses Ergebnis nahe, die Pharmazeutika Menschen mit frisch diagnostizierter Hämophilie lieber nicht zu verschreiben. Auch die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA reagierte. Sie wies BAYER und BEHRING an, in den Packungsbeilagen auf das erhöhte Risiko von Immun-Reaktionen hinzuweisen. Das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) beschäftigte sich im Februar 2018 mit KOGENATE & Co. Es sah einstweilen zwar keinen Handlungsbedarf, will die Mittel aber unter Beobachtung halten.
WASSER, BODEN & LUFT
Verwirr-Spiel um CO2-Emissionen
Der Leverkusener Multi treibt ein Verwirr-Spiel um seine klima-schädigende Kohlendioxid-Emissionen. Er berechnet die Menge auf zwei unterschiedliche Weisen, mit der standort-orientierten und mit der markt-orientierten Methode. Zudem gibt er diese einmal unter Einbezug des Chemie„park“-Betreibers CURRENTA an, an dem er eine 60-prozentige Beteiligung hält, und einmal nur für den Konzern selbst . Damit nicht genug, nennt das Unternehmen in seinem neuesten Geschäftsbericht für 2016 mit 4,64 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß auch andere Zahlen als im letzten Jahr, wo es noch 9,87 Millionen Tonnen waren. So ist dem für BAYER-Verhältnisse relativ niedrigen Wert für 2017 von 3,63 Millionen Tonnen kaum zu trauen.
Keine Strommix-Angaben
Wie bei den Angaben zu den Kohlendioxid-Emissionen rechnet der Leverkusener Multi auch bei den Angaben zum Energie-Einsatz seine 60-prozentige Tochter CURRENTA heraus und verschweigt darüber hinaus, in welchem Verhältnis bei dieser die relativ sauberen Strom-Quellen wie Erdgas zu schmutzigen wie Kohle stehen.
BAYER schädigt Ozonschicht
Seit Jahren schon sorgt hauptsächlich ein einziges Werk des Leverkusener Multis für den ganzen Ausstoß an ozon-abbauenden und deshalb ebenso wie Kohlendioxid klima-schädigenden Substanzen, den „Ozone Depleting Substances“ (ODS): die Niederlassung der Agro-Sparte im indischen Vapi. Und seit Jahren schon schraubt der Konzern auch ein bisschen an der Fertigungsstätte rum, so dass die Werte immer ein bisschen sinken. Aber 2017 summierten sie sich trotzdem noch auf 8.6 Tonnen (2016: 8,8).
870 Tonnen flüchtige Substanzen
Auch BAYERs flüchtige organische Substanzen entstammen hauptsächlich dem Werk im indischen Vapi. Den dortigen Sanierungsmaßnahmen sowie dem Verkauf eines Werkes in Frankreich geschuldet, ging der Ausstoß dieser gesundheitsschädlichen Gase 2017 etwas zurück. Von 920 auf 870 Tonnen sank der Wert.
Kaum weniger Stickstoff & Co.
Der Ausstoß von Stickstoffoxiden, Schwefeldioxiden, Staub und Kohlenmonoxid hat sich bei BAYER 2017 gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Die Emissionen von Stickstoffoxiden stiegen von 1.500 Tonnen auf 1.520 Tonnen, während diejenigen von Schwefeldioxiden von 960 auf 920 Tonnen fielen. Bei Kohlenmonoxid reduzierten sich die Werte von 660 auf 610 Tonnen, und Staub wirbelte der Konzern genauso viel wie 2016 auf: 60 Tonnen.
BAYERs Abwasser-Frachten
Im Jahr 2017 sank BAYERs Phosphor-Eintrag in die Gewässer von 50 auf 40 Tonnen und der von organischem Kohlenstoff von 540 auf 390 Tonnen. Auch der Wert für Schwermetalle verminderte sich etwas. Er reduzierte sich von 2,1 auf 1,9 Tonnen. Dagegen legten die Einleitungen von Stickstoff und Anorganischen Salzen zu. Sie stiegen von 300 auf 400 Tonnen bzw. von 184.000 auf 188.000 Tonnen.
BAYER produziert mehr Müll
Im Jahr 2017 produzierte BAYER mehr Müll als 2016. Von 770.000 auf 846.000 Tonnen erhöhte sich die Gesamtmenge. Darunter befanden sich 485.000 Tonnen gefährlicher Abfall. Um 57.000 Tonnen stieg dessen Aufkommen.
UNFÄLLE & KATASTROPHEN
Chemikalien-Austritt in Berlin
Auf dem Gelände von BAYERs Berliner Pharma-Standort im Stadtteil Wedding kam es am 30.05.2018 zu einem Unfall. Es trat eine gefährliche Substanz aus, dessen Dämpfe zwei Personen verletzten. Der Leverkusener Multi erklärte, der Stoff hätte sich auf der Ladefläche eines LKWs befunden, der den Konzern belieferte, wäre aber nicht für ihn, sondern für einen anderen Kunden bestimmt gewesen.
IMPERIUM & WELTMACHT
Fragwürdige EU-Genehmigung
Die Europäische Union genehmigte die vom Leverkusener Multi geplante MONSANTO-Übernahme zunächst nur unter Vorbehalt. Hatte sie dem Konzern schon während des Verfahrens zur Auflage gemacht, sich von bestimmten Unternehmensteilen zu trennen, so wollte sie sich vor der endgültigen Zustimmung auch erst noch mal die potentiellen Käufer genauer anschauen. Diesen Prozess schloss Brüssel am 30. April ab. Die Generaldirektion Wettbewerb akzeptierte die BASF als neue Besitzerin von Cropscience-Produkten. Sie sieht in dem Ludwigshafener Unternehmen den geeigneten Kandidaten, um „den von BAYER ausgeübten Wettbewerbsdruck auf diesen Märkten zu ersetzen“. Der Erwerb der Geschäfte mit Gemüse-Samen, konventionellem und gentechnisch manipuliertem Saatgut, dem Pestizid Glufosinat, Saatgutbehandlungsmitteln wie PONCHO sowie mit Entwicklungen der digitalen Landwirtschaft durch die BASF reicht nach Ansicht der Kommission aus, BAYSANTO einzuhegen und für eine ausreichende Konkurrenz auf dem Agrar-Sektor zu sorgen. Dabei war am Tag der Brüsseler Entscheidung das Haltbarkeitsdatum des Veräußerungspakets schon überschritten – wofür die EU selber gesorgt hatte. Sie zog Glufosinat wegen seiner erbgut-schädigenden Wirkung und PONCHO wegen seiner Bienengefährlichkeit nämlich unlängst aus dem Verkehr. Damit fallen sie auf dem Gebiet der Europäischen Union – im Rest der Welt dürfen die Substanzen vorerst weiter ihr Unwesen treiben – als Gegengewichte zur BAYER-Dominanz aus. Eine Erklärung dazu hat die EU-Kommission der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN nicht gegeben. Eine entsprechende Anfrage ließ sie unbeantwortet.
Der Grund für Dekkers’ Abgang
Im Jahr 2014 gab der BAYER-Konzern die Trennung von seiner Kunststoff-Sparte bekannt. Für die beiden verbliebenen Bereiche „Pharma“ und „Agrar“ hatte der damalige Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers eine Vision. Er plante, die beiden Abteilungen unter dem Label „Life-Science“ enger miteinander zu verknüpfen. „In allen Lebewesen, so unterschiedlich sie uns erscheinen mögen, folgen die molekularen Mechanismen gemeinsamen Regeln. Diese Gemeinsamkeiten wollen wir unter einem Dach zu unserem Vorteil nutzen“, erklärte der Holländer. Allerdings teilten viele verantwortliche ManagerInnen seine Vision nicht. Nicht einmal ein gemeinsamer Vorstandsworkshop konnte den Konflikt auflösen. Und diese Auseinandersetzung bewog Dekkers nach Informationen des manager magazins schlussendlich dazu, das Unternehmen vorzeitig zu verlassen.
Der Grund für Dietsch’ Abgang
Viele Investment-Gesellschaften beurteilten BAYERs Plan, MONSANTO übernehmen zu wollen, zunächst skeptisch. Den Fonds-ManagerInnen machte die damit verbundene hohe Schulden-Aufnahme Sorgen. Sie befürchteten eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit des Konzerns durch die Rating-Agenturen. Die Finanzmarkt-AkteurInnen von der Profitabilität des Coups zu überzeugen, war für den Leverkusener Multi deshalb kein leichtes Unterfangen (siehe auch KAPITAL & ARBEIT). Und den Finanz-Chef Johannes Dietsch kostete das nach Informationen des manager magazins sogar seinen Job. Weil Dietsch als Überzeugungstäter vor den GroßanlegerInnen nach Meinung des Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann keine gute Figur machte, wurde er durch Wolfgang Nickl ersetzt.
ÖKONOMIE & PROFIT
EU will Derivat-Markt beleben
Derivate – eine Art Wette auf Preissteigerungen oder -senkungen von Rohstoffen, Aktien, Währungen, Schulden, Zinsen oder aber von Derivaten selber – hatten 2007 wesentlich mit zum Ausbruch der Finanzkrise beigetragen. Darum regulierte die EU diesen Markt im Jahr 2013 stärker. Sie schrieb für die Verbriefungs-deals eine Absicherung mit Eigenkapital und eine Registrierung vor. Der Leverkusener Multi, der Derivate laut Eigenauskunft „fast ausschließlich zur Absicherung von gebuchten und geplanten Transaktionen“ nutzt, protestierte in Tateinheit mit anderen Konzernen scharf gegen die Maßnahmen. Und 2017 ruderte die Europäische Union tatsächlich wieder zurück und machte sich ans Deregulieren. Sie verkündete eine neue Verbriefungsverordnung, welche den Zweck hatte, „den EU-Verbriefungsmarkt zu beleben, um die Finanzierung der EU-Wirtschaft zu verbessern“. Im Zuge dieser Wiederbelebungsmaßnahme hat Brüssel beispielsweise für bestimmte Derivate das Unbedenklichkeitslabel STS (simple, transparent, standardised) eingeführt und für den Handel mit diesen Papieren die Eigenkapital-Anforderungen gesenkt. Der Vorschlag der Grünen-Fraktion im Europa-Parlament ging genau in die gegenteilige Richtung. Die PolitikerInnen hatten für die Geschäfte mit den Derivaten eine Kapital-Unterlegung von 25 Prozent der Transaktionssumme gefordert. Zudem wollten sie Weiterverbriefungen unterbinden und es nicht mehr den Banken selber überlassen, die Risiken ihrer eigenen Finanzprodukte zu berechnen. Entsprechend vehement kritisierte Sven Giegold, der wirtschafts- und finanzpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Europa-Parlament, den Europäischen Rat sowie die konservativen, liberalen und euroskeptischen EU-ParlamentarierInnen für die Unterstützung der Regelung. „Sie sind dabei, die Lehren aus der letzten Finanzkrise zu vergessen“, so Giegold.
BAYER verkauft COVESTRO-Aktien
Im Jahr 2015 gab der Leverkusener Multi die Trennung von seinem Kunststoff-Geschäft bekannt. Unter dem Namen COVESTRO brachte er es an die Börse. Seither verringert der Konzern seinen Aktien-Anteil an der ehemaligen Unternehmenssparte peu à peu. Der letzte Verkauf fand im Mai 2018 statt. Das Unternehmen veräußerte in diesem Monat rund 29 Millionen Papiere für 2,2 Milliarden Euro. Damit reduzierte sich die BAYER-Beteiligung an COVESTRO auf rund sieben Prozent. Der Global Player kappt die Verbindung so schnell, weil er Geld braucht, um die für die MONSANTO-Übernahme gemachten Schulden abzubauen.
RECHT & UNBILLIG
Erster Glyphosat-Prozess in den USA
Kaum hatte der Leverkusener Multi die letzten amtlichen Bestätigungen für die Genehmigung der MONSANTO-Übernahme erhalten, da musste er sich auch schon den mit diesem Deal verbundenen juristischen Risiken stellen. Mitte Juni 2018 begann in den USA das erste Schadensersatz-Verfahren in Sachen „Glyphosat“. Der 46-jährige DeWayne Johnson hatte die Klage eingereicht. Der Familien-Vater leidet am Non-Hodgkin-Lymphom (NHL), einer bestimmten Form des Lymphdrüsen-Krebses, und macht das Herbizid dafür verantwortlich, das er in seinem früheren Beruf als Platzwart häufig einsetzen musste. Mit dieser rechtlichen Auseinandersetzung startet in den Vereinigten Staaten eine wahre Prozess-Lawine. Losgetreten hatte diese die Krebsforschungsagentur IARC der Weltgesundheitsorganisation mit ihrer Einstufung von Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend“. Daraufhin zogen in den Vereinigten Staaten über 4.000 NHL-PatientInnen, die als LandwirtInnen, LandschaftspflegerInnen oder als Hobby-GärtnerInnen in Kontakt mit der Agro-Chemikalie gekommen waren, vor Gericht. Obwohl der „San Francisco County Superior Court“ die im Zuge anderer Verfahren ans Licht der Öffentlichkeit geratenen Firmen-Unterlagen zu dem Ackergift, die berühmt-berüchtigten MONSANTO-Papers, zur Beweisaufnahme zugelassen hat (siehe auch AGRO & CHEMIE), setzt BAYER auf Sieg. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zeigte sich „BAYER CROPSCIENCE“-Chef Liam Condon zuversichtlich, „das die Gerichte zu dem Schluss kommen werden, dass Glyphosat keine Gefährdung für die Gesundheit darstellt, wenn es vorschriftsmäßig eingesetzt wird“.
Glyphosat-Prozess in Frankreich
Französische ImkerInnen haben den BAYER-Konzern verklagt, weil ihr Honig Rückstände von dessen Pestizid Glyphosat enthielt und sie ihre Ware darum teilweise nicht mehr verkaufen konnten.
Glyphosat-Prozess in den USA
Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA folgte der Einschätzung der Krebs-Agentur der Weltgesundheitsorganisation und nahm das jetzige BAYER- und frühere MONSANTO-Pestizid Glyphosat in seine Liste der wahrscheinlich krebserregenden Substanzen auf. In der Folge verfügte die „Food and Drug Administration“ das Anbringen von Warnhinweisen auf den Produkten und stellte das Einleiten von Glyphosat-Rückständen in Gewässer unter Strafe. MONSANTO klagte gegen die FDA-Entscheidung, konnte sich vor Gericht allerdings nicht durchsetzen.
Bt-Prozess in Indien
Das Oberste Gericht der indischen Hauptstadt New Dehli hat MONSANTO, dessen Rechtsnachfolger BAYER seit dem 7. Juni 2018 ist, das Recht abgesprochen, auf seine gentechnisch veränderte Bt-Baumwolle Patent-Ansprüche zu erheben. Die RichterInnen verwiesen dabei auf das indische Gesetz, das es nicht erlaubt, Saaten, Pflanzen oder Tiere zum geistigen Eigentum von Personen oder Unternehmens zu erklären. Der US-Konzern, der seine Labor-Frucht mit Genen des Bacillus thuringiensis (Bt) bestückt hatte, damit diese die Pflanze vor Schadinsekten schützen, reklamierte in dem Land deshalb in weiser Voraussicht nur für den Bacillus Schutzrechte. Das reichte nach Ansicht der JuristInnen aber nicht aus, um von Saatgut-Firmen Lizenz-Gebühren für die ganze Bt-Baumwolle verlangen können. Deshalb gaben sie der Klage des Unternehmens Nuziveedu statt. Die indische Aktivistin Vandana Shiva (siehe auch AKTION & KRITIK) begrüßte das Urteil als „Sieg für die Saatgut-Freiheit“. Rechtskräftig ist es allerdings noch nicht, da noch eine Berufungsverhandlung ansteht.
GroKo will Umwelt-Klagen einschränken
Mit der Aarhus-Konvention von 1998 fand der Umweltschutz Eingang in das internationale Recht. Seither können Umwelt-Organisationen vor Gericht ziehen, wenn etwa große Infrastruktur-Projekte der Natur zu schaden drohen. Der Gesetzgeber hat die Möglichkeiten dafür in den zurückliegenden Jahren sogar noch erweitert. So müssen die Verbände seit 2011 nicht mehr im Namen der Interessen Einzelner klagen, sondern sind berechtigt, dies auch im Namen der Interessen der Allgemeinheit zu tun und sich damit beispielsweise zu AnwältInnen des Artenschutzes zu machen. Nun aber kündigt die Bundesregierung an, das Rad zurückzudrehen. Prozesse, wie es sie etwa gegen die Öffnung von BAYERs Dhünnaue-Deponie im Zuge der Erweiterung der Autobahn A1 oder gegen die Kohlenmonoxid-Pipeline des Leverkusener Multis gab, verzögern die Bau-Vorhaben nach Ansicht der Großen Koalition zu sehr. Die Devise von CDU und SPD lautet stattdessen „Planungsbeschleunigung“, weshalb die Parteien „das Verbandsklage-Recht in seiner Reichweite überprüfen“ wollen, wie es im Koalitionsvertrag heißt.
2.900 MIRENA-Klagen
BAYERs Hormon-Spirale MIRENA hat Nebenwirkungen wie nächtliche Schweißausbrüche, Herzrasen, Unruhe, Schlaflosigkeit, permanente Bauchkrämpfe und Oberbauchschmerzen. Allein die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA erhielt bereits 45.000 Meldungen über unerwünschte MIRENA-Effekte. Darum reichten in den Vereinigten Staaten 2.900 Frauen Klagen gegen den Leverkusener Multi ein (Stand: 30.01. 2018).
22.000 XARELTO-Klagen
BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO mit dem Wirkstoff Rivaroxaban hat gefährliche Nebenwirkungen. Allein bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA gingen bis zum 1.03.2018 mehr als 85.000 Meldungen über unerwünschte Arznei-Effekte ein. In den USA ziehen deshalb immer mehr Geschädigte bzw. deren Hinterbliebene vor Gericht. Mit 22.000 Klagen müssen sich die RichterInnen mittlerweile beschäftigen (Stand: 30.01. 2018).
16.000 ESSURE-Klagen
ESSURE, BAYERs ohne Hormone auskommende Sterilisationsmittel, beschäftigt in den USA zunehmend die Gerichte. Die kleine Spirale, deren Kunststoff-Fasern für ein so großes Wachstum des Bindegewebes sorgen sollen, dass sich die Eileiter verschließen, hat nämlich zahlreiche Nebenwirkungen. Allzu oft bleibt das Medizin-Produkt nicht an dem vorgesehenen Ort, sondern wandert im Körper umher und verursacht Risse an den Wänden von Organe, was zu lebensgefährlichen inneren Blutungen führen kann. Auch Hautausschläge, Kopfschmerzen, Übelkeit und Allergien zählen zu den Gesundheitsschädigungen, über die Frauen berichten. Darum nimmt die Zahl der Klagen immer mehr zu und liegt mittlerweile bei 16.000 (Stand: 30.01. 2018).
Sammelklage gegen BAYER wg. GAUCHO?
BAYERs Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide wie GAUCHO und PONCHO haben mit für ein massives Bienensterben gesorgt. Kanadische ImkerInnen wollen den Leverkusener Multi deshalb juristisch zur Verantwortung ziehen. In Quebec und Ontario haben sie sich deshalb vor Gericht um die Zulassung von Sammelklagen bemüht.
Asbest-Klagen
Nur in der Bau-Branche kam mehr Asbest zum Einsatz als in der Chemie-Industrie. Der hierzulande seit 1993 verbotene Stoff fand sich in Zement, Abdichtungen und Wärme-Isolierungen wieder. Desweiteren umhüllte die Substanz säure- und laugen-führende Leitungen. Filter, Lacke, Beiz-Wannen, Lager-Behälter und Reaktionsbehältnisse enthielten diese ebenfalls. Der Leverkusener Multi wusste um die Risiken und Nebenwirkungen des Silikat-Minerals, setzte seine Beschäftigten aber trotzdem weiter der Gefahr von Asbest-Vergiftungen aus. „Expositionen gegen Asbest“ zählten deshalb lange Zeit zu den häufigsten Berufskrankheiten bei dem Konzern. Darüber hinaus hat in den USA eine Beteiligungsgesellschaft von BAYER die Rechtsnachfolge von Firmen angetreten, die bis 1976 Asbest-Produkte verkauften. Deshalb sieht das Unternehmen sich dort mit mehreren Klagen konfrontiert. Allerdings mahlen Justitias Mühlen langsam. Bereits seit Jahren führt der Global Player diese gerichtlichen Auseinandersetzungen in seinen Geschäftsberichten unter der Rubrik „rechtliche Risiken“ auf.
Hawaii verbietet Sonnencremes
Durch badende StrandurlauberInnen gelangen große Mengen von Sonnencreme in die Meere. Bestimmte Mittel können dabei Korallen und anderen aquatischen Lebewesen schaden. Darum hat der US-amerikanische Bundesstaat Hawaii Produkte mit den Beistoffen Oxybenzon und Octinoxat, wie etwa BAYER sie unter dem COPPERTONE-Label vertreibt, verboten. Der Leverkusener Multi protestierte umgehend: „Die Verwendungen von Sonnencreme-Ingredienzien zu verbieten, welche die ‚Food and Drug Administration’ (die US-amerikanische Gesundheitsbehörde, Anm. Ticker) als effizient und sicher ansieht, schränkt nicht nur die Wahlfreiheit der Konsumenten ein, sondern unterminiert auch die Hautkrebs-Vorsorge.“