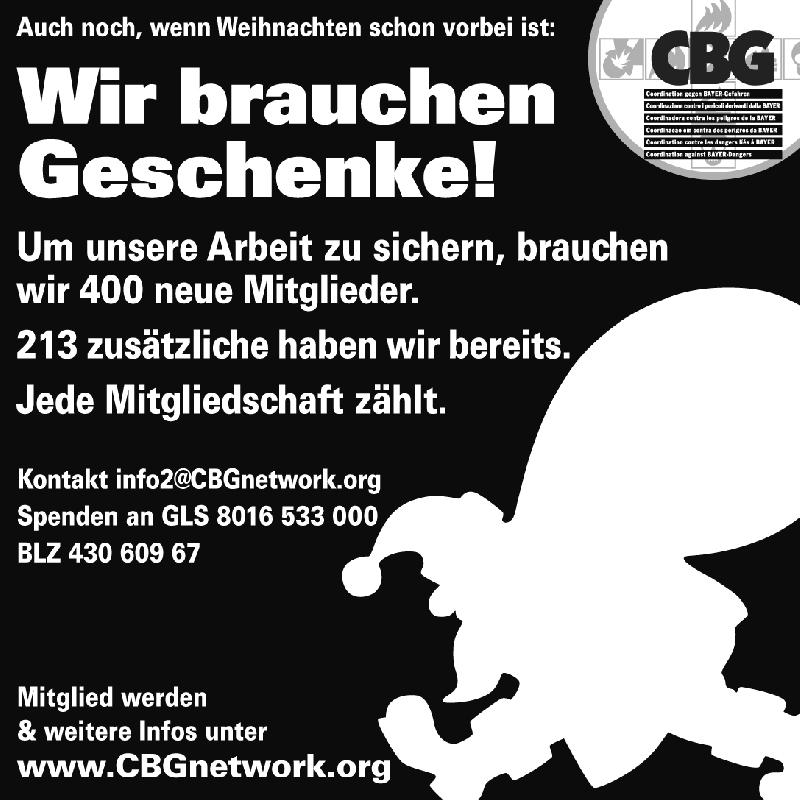Presse Information vom 10. November 2011
Coordination gegen BAYER-Gefahren e.V.
Xarelto: Bedenken nicht ausgeräumt
Trotz interner Warnungen hat die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) eine Zulassung des Gerinnungshemmers Xarelto zur Schlaganfall-Prävention erteilt. Nach Auffassung der Coordination gegen BAYER-Gefahren wurden die Bedenken bezüglich der Sicherheit des Medikaments jedoch nicht ausgeräumt. Bei Studien mit dem BAYER-Präparat war es mehrfach zu Todesfällen gekommen.
Erst im September kamen Berater der amerikanische Food and Drug Administration (FDA) zu dem Ergebnis, dass Xarelto keine Vorteile gegenüber dem seit langem etablierten Gerinnungshemmer Warfarin (in Deutschland: Marcumar) bietet. Die von BAYER eingereichten Studien warfen ihrer Meinung nach Fragen zu Herzinfarkt- und Blutungsrisiken auf. Nach Aussage der Experten zeigte die von BAYER eingereichte Studie (Rocket-AF) nur deshalb eine vergleichbare Wirksamkeit von Warfarin und Xarelto, da die mit Warfarin behandelten Patienten nicht die optimale Dosis erhalten hatten. Außerdem waren mehrere Probanden nach dem Absetzen von Xarelto gestorben.
Jan Pehrke von der Coordination gegen BAYER-Gefahren: „Die zahlreichen Meldungen über Gefäß-Verschlüsse, Blutungen, Herz/Kreislaufstörungen und Leberschäden lassen die Genehmigung von Xarelto zur Schlaganfall-Prophylaxe nicht ratsam erscheinen. Wir fordern grundsätzlich, dass Präparate, die gegenüber älteren Mitteln keinen Vorteil bieten, nicht zugelassen werden. Xarelto ist hierfür ein Paradebeispiel.“
Die US-Initiative Public Citizen kritisiert überdies, dass bei den BAYER-Studien vor allem Versuchsteilnehmer in Entwicklungsländern nicht richtig mit Warfarin eingestellt wurden. So bekamen nur 36 Prozent der indischen Probanden eine angemessene Warfarin-Therapie und setzten sich so einem erhöhten Schlaganfall-Risiko aus. Darüber hinaus rügt die Gruppe die Darreichungsform. Die Proband/innen mussten die ganze Dosis auf einmal einnehmen, was mit höheren Gefahren verbunden ist als eine Verteilung über den Tag. Einzig marketing-technische Erwägungen vermutet Public Citizen hinter dieser Wahl und riet der FDA wegen solcher Verstöße gegen medizinische und ethische Standards von einer Zulassung ab.
In Indien waren mindestens vier Proband/innen bei Xarelto-Studien ums Leben gekommen. Das Präparat soll daher in den USA mit einem Warnhinweis versehen werden, wonach Patienten das Medikament nicht ohne ärztliche Rücksprache absetzen sollen, da sonst das Risiko von Schlaganfällen steigt. BAYER hatte den Hinterbliebenen der in Indien Verstorbenen jeweils bloß 5.250 Dollar Entschädigung gezahlt.
In Europa ist Xarelto bislang nur zur Thrombose-Prophylaxe nach schweren orthopädischen Operationen zugelassen. Der Zulassungsprozess gestaltete sich wegen der vielen Nebenwirkungen und der ungeklärten Langzeitwirkung von Beginn an schwierig. Um den Umsatz zu steigern, hatte Bayer zusätzlich einen Zulassungsantrag für die weitaus lukrativere Schlaganfall-Prophylaxe bei Patienten mit Vorhofflimmern gestellt. Vorhofflimmern ist eine der häufigsten Herzrhythmusstörungen, allein in Europa sind davon mehr als 6 Millionen Menschen betroffen.
Auch als allgemeines Therapeutikum gegen Venen-Thrombosen möchte BAYER das Präparat einsetzen. Gegenüber bislang verwendeten Medikamenten konnte jedoch auch für diese Anwendung kein Vorteil gezeigt werden. Die sogenannte Magellan-Studie war laut BAYER lediglich darauf ausgelegt, bei mehr als 3.400 teilnehmenden Patienten nachzuweisen, dass Xarelto der Vergleichsmedikation „nicht unterlegen ist“. Selbst nach Aussage von BAYER wies das Präparat jedoch „kein konsistent positives Nutzen-Risiko-Profil“ auf.
weitere Informationen:
=> Public Citizen: Xarelto approval for stroke prevention rejected
=> Xarelto: Todesfälle in Indien
Wirtschaftswoche, 7. September 2011
FDA zweifelt an neuem Medikament
Schwarzer Tag für Bayer
Die US-Zulassungsbehörde FDA hat Zweifel an einem neuen Bayer-Medikament. Die Aktie des Leverkusener Pharma- und Chemiekonzerns verlor zeitweise um zwölf Prozent.
Eine Verzögerung – oder gar eine spätere Ablehnung – würde für Bayer und den neuen Konzernchef Marijn Dekkers ein ziemliches Desaster bedeuten. Entwickelt wurde Xarelto im wesentlichen am Forschungs- und Entwicklungsstandort Wuppertal. Für ihre Arbeit wurden die Forscher sogar vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet. Erst kürzlich besuchte Nachfolger Christian Wulff das Team in Wuppertal.
Bayer-Chef Dekkers hatte sich vor einigen Wochen im WirtschaftsWoche-Interview optimistisch über Xarelto geäußert: „Wir sind sehr zuversichtlich und rechnen unverändert mit einer Markteinführung im dritten oder vierten Quartal 2011 – schließlich haben wir das Präparat an 65 000 bis 70 000 Patienten getestet.“
Nun könnte alles anders kommen. Die FDA verlangt bessere Informationen zu Xarelto. Die Experten argwöhnen auch, dass Bayer einen Vergleichstest mit dem Standardmedikament Warfarin nicht fair und adäquat durchgeführt haben könnte, um Xarelto einen Vorteil zu verschaffen.
Das Leverkusener Unternehmen geht dagegen weiterhin von einem positiven Nutzen-Risiko-Verhältnis von Xarelto im Vergleich zu Warfarin aus. Zudem verursache Xarelto weniger Blutungen.
„Wir freuen uns auf eine offene und produktive Diskussion mit den FDA-Beratern und vertrauen auf die Ergebnissse der Rocket-AF.Studie“, sagt Bayer-Entwicklungschef Kemal Malik. Ob ihm die Diskussion am Ende auch noch Freude macht, wird sich zeigen.
Doch auch, wenn Xarelto noch zeitig den Markt erreicht, wird das Geschäft für Bayer nicht einfach werden: Ein Konkurrenzpräparat von Boehringer Ingelheim ist bereits auf dem Markt. Und ein vielversprechendes Mittel der US-Konzerne Pfizer und Bristol Myers Squibb zur Schlaganfall-Prophylaxe befindet sich gleichfalls in der Entwicklung.
Einen solchen Rückschlag hat die Bayer-Aktie seit drei Jahren nicht mehr erlebt. Am Dienstagnachmittag war an den Börsen durchgedrungen, dass Experten der US-Zulassungsbehörde FDA Zweifel an Bayers geplantem Spitzenmedikament Xarelto hegen. Für Bayer ist Xarelto, das gegen Schlaganfälle vorbeugen soll, das wichtigste Medikament seit Jahren. Die Bayer-Manager haben jährliche Spitzenumsätze von zwei Milliarden Euro schon ziemlich fest einkalkuliert. Nach den bisherigen Planungen soll das Mittel gegen Ende des Jahres auf den Markt kommen.
Am Donnerstag tagt nun bei der FDA in Silver Spring im US-Bundesstaat Maryland ein mit hochrangigen Medizinern besetztes Beratergremium. Dann fällt eine Vorentscheidung darüber, ob sich die Einführung des Bayer-Medikaments verzögert. Endgültig wird die FDA Anfang November entscheiden. Die FDA ist allerdings nicht an die Empfehlungen des Beratergremiums gebunden; tatsächlich folgt sie diesen jedoch häufig. Von der europäischen Zulassungsbehörde EMEA, wo Bayer Xarelto gleichfalls zur Zulassung eingereicht hat, ist noch keine entsprechende Reaktion überliefert. von Jürgen Salz (Düsseldorf)
DIE ZEIT, 04. November 2011
Warnung mit der Roten Hand
Neue Blutverdünner waren die Hoffnung für Bayer und Boehringer. Nun könnten sie sich als großer Reinfall erweisen.
Lieselotte Bettermann (Name geändert) ist eine rüstige Rentnerin. Eine, die auch mit 84 Jahren noch gerne verreist und sich ihr Alter ebenso wenig anmerken lässt wie die beiden Schlaganfälle, die sie erlitten hat. Nun gut – ein paar Zugeständnisse macht sie inzwischen doch: Sie ist in eine Seniorenwohnanlage im Hamburger Süden gezogen, und jeden Montag kommt eine Putzfrau und hilft ihr, ihren kleinen Haushalt in Schuss zu halten. Und wegen ihrer Herzrhythmusstörungen schluckt sie Arzneien, die verhindern, dass sich in ihrem Herzen erneut Blutgerinnsel bilden und ins Gehirn wandern. Jeder weitere Schlag, das weiß sie, könnte sie zum Pflegefall machen.
Allein hierzulande gibt es laut Deutscher Schlaganfall-Gesellschaft knapp eine Million Patienten wie Lieselotte Bettermann. Insgesamt sollen in der alternden industrialisierten Welt neun Millionen Menschen unter dem sogenannten Vorhofflimmern leiden und einer Schlaganfall-Prophylaxebedürfen. Bis zu zehn Milliarden Euro pro Jahr, so schätzen Analysten, ließen sich auf diesem Markt verdienen, weshalb sich gleich mehrere Pharmariesen – darunter auch Bayer aus Leverkusen und Boehringer Ingelheim – auf die Suche nach neuen Pillen machten. So viel Aufbruchstimmung gab es seit der Entdeckung der Statine als Cholesterinsenker vor zwanzig Jahren nicht.
Und tatsächlich schafften es die zuletzt wenig erfolgverwöhnten deutschen Arzneihersteller, den anderen zuvorzukommen: Boehringer konnte seine Pille namens Pradaxa bereits einführen. Und das Bayer-Produkt Xarelto ist ebenfalls marktreif: Die US-Gesundheitsbehörde etwa will am kommenden Freitag über ihre Zulassung entscheiden. »Schön, dass in diesem wichtigen Therapiegebiet zwei Unternehmen aus Deutschland die Nase vorn haben«, triumphierte Boehringer-Chef Andreas Barner noch im April in der Wirtschaftswoche.
Doch seither haben sich die Aussichten deutlich eingetrübt. So kam es in Asien – wo Boehringer das Mittel schon im Frühjahr einführte – bald zu unerfreulichen Nebenwirkungen. In Japan, wo bis August 14 Todesfälle registriert wurden, schlug die Gesundheitsbehörde zuerst Alarm, Australien folgte im Oktober. In Europa verschickte Boehringer vergangenen Donnerstag auf Betreiben der Europäischen Arzneimittelagentur ebenfalls sogenannte Rote-Hand-Briefe zur Warnung an die Ärzteschaft. Der Hersteller bestätigte, dass auch in Deutschland und anderswo in Europa Todesfälle gemeldet wurden. Wie viele, wollte Boehringer-Sprecher Reinhard Malin unter Verweis auf die laufende »Einzelfallprüfung« nicht sagen. Die Zahl von 50 Todesfällen weltweit sei, so Malin, aber »vermutlich die richtige Größenordnung«.
Und bei Bayer läuft die Sache auch nicht ganz rund. So entspann sich unter den Beratern der US-Gesundheitsbehörde Anfang September eine Debatte über die Wirksamkeit von Xarelto. Die Zulassungsempfehlung gab es mit Gegenstimmen.
»Das alles mindert die Chancen von Bayer und Boehringer«, urteilt Pharmaanalyst Karl-Heinz Scheunemann von der Landesbank Baden-Württemberg. »Die Idee, dass die Deutschen den Markt unter sich aufteilen, dürfte sich als Illusion erweisen.« Auch Ulrich Huwald von der Privatbank Warburg meint: »Der Durchmarsch wird wohl nicht stattfinden.«
Das Problem: Die deutschen Hersteller sind dringend auf Erfolge angewiesen. Seit Bayer vor zehn Jahren den Cholesterinsenker Lipobay wegen Nebenwirkungen vom Markt nahm, hat der Konzern keine Bestseller hervorgebracht, und selbst die Übernahme des Wettbewerbers Schering 2006 kann die Lücke wohl nicht dauerhaft füllen. Beim Familienkonzern Boehringer, wo gerade mehrere Pillen Billigkonkurrenz bekamen, hängt die Zukunft erst recht an dem neuen Produkt.
Noch dramatischer sind die jüngsten Entwicklungen allerdings für die Patienten. In wenigen Feldern der Medizin würden Innovationen »sehnlicher erwartet« als bei den Gerinnungshemmern, sagt Joachim Röther. Er ist Chefarzt an der Asklepios Klinik im Hamburg-Altona. Die Notaufnahme unten im Erdgeschoss des Krankenhauses ist eine der am stärksten frequentierten Ambulanzen in Deutschland, auch an diesem Abend ist der Computertomograf noch in Betrieb.
Rund tausend Schlaganfälle werden hier jedes Jahr behandelt. Viele davon wären durch Vorbeugung zu vermeiden, sagt Röther, im Nebenamt Präsident der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft. Doch die bisher gängige Pille Marcumar, die vor vielen Jahrzehnten vom Schweizer Pharmakonzern Roche entwickelt wurde, ist bei den Patienten unbeliebt. Es hat sich herumgesprochen, dass die Substanz zunächst als Rattengift patentiert worden war und dass sie – falsch dosiert – auch Menschen töten kann. Und weil die Arznei auf bestimmte Lebensmittel mit Wirkungsschwankungen reagiert, ist es nicht leicht, sie richtig zu dosieren. Rund die Hälfte derer, die die Pille eigentlich brauchten, verzichten deshalb darauf.
Lieselotte Bettermann ist eine davon. »Mit Marcumar hätte ich mit Salat und grünem Gemüse aufpassen und mir ständig Blut abnehmen lassen müssen«, sagt sie, und dass sie als Diabetikerin schon genug Aufwand dieser Art betreibe. Sie entschied: »Ich schlucke lieber ASS.« Tatsächlich kann Acetylsalicylsäure – besser bekannt unter dem Namen Aspirin – nicht nur Schmerzen lindern, sondern auch die Verklumpung der Blutplättchen bremsen – die Wirkung ist jedoch schwächer.
Möglicherweise lag es daran, dass Frau Bettermann im Mai dieses Jahres mit einem zweiten, glücklicherweise leichten, Schlaganfall in Röthers Notaufnahme landete. »Behandlung mit Marcumar wurde ausdrücklich nicht gewünscht« steht in ihrer Patientenakte. Auch die neue Pille Pradaxa – seit September in deutschen Apotheken zu haben – lehnt sie ab.
Möglicherweise eine weise Entscheidung: Denn die Patienten, die in Asien nach der Einnahme von Pradaxa starben, waren Menschen, deren Nieren – aufgrund hohen Alters oder einer Erkrankung wie Diabetes – nicht gut funktionierten. So sammelte sich der Gerinnungshemmer in ihrem Körper an, sie starben an inneren Blutungen.
In dem Warnbrief, den der Hersteller nun im Auftrag der Gesundheitsbehörden verschickte, werden die Ärzte deshalb aufgefordert, bei Patienten über 75 Jahren regelmäßig die Nieren zu testen – und gegebenenfalls auf eine Verordnung zu verzichten. Weil das Schlaganfallrisiko ab diesem Alter steigt, trifft das die Kernzielgruppe.
Lutz Hein, Pharmakologe von der Uni Freiburg, fordert deshalb: »Hier müssen zunächst einmal mehr Erfahrungen gesammelt werden, um die Blutungen auch zu beherrschen.« Zwar bergen alle Gerinnungshemmer ein gewisses Blutungsrisiko – und zumindest bei der leichteren Pradaxa-Dosis ist dieses sogar »um etwa 20 Prozent niedriger« als bei der gängigen Arznei, wie Boehringer-Chef Andreas Barner zur Verteidigung der Pille anführt. Doch anders als bei Marcumar gibt es für die neuen Pillen eben noch kein Gegenmittel.
Bei Boehringer schlägt man vor, die Patienten an die Dialyse zu legen, um den Blutverdünner auszuwaschen. Bei akuten Blutungen oder auch Notfall-Operationen dürfte dieses Verfahren aber zu langsam sein. Bei Bayer hingegen scheint man zumindest eine heiße Spur zu verfolgen: Das Medikament aus Leverkusen blockiert einen anderen Blutgerinnungsfaktor und lässt sich durch Gabe bestimmter menschlicher Enzyme offenbar wieder ausschalten.
Diese Nachricht dürfte auch die amerikanischen Wettbewerber Pfizer und Bristol-Myers Squibb erfreuen. Sie arbeiten nämlich gemeinsam an einem fast baugleichen Gerinnungshemmer wie Bayer. Zwar war das Projekt von so viel Rückschlägen begleitet, dass es in der Fachwelt zwischendurch fast nicht mehr ernst genommen wurde. Dann allerdings landete das Duo einen Paukenschlag: Auf einem Kongress Ende August in Paris präsentierten die Amerikaner eine Studie, die nahelegt, dass ihre Pille sowohl in der Wirksamkeit als auch bei der Sicherheit allen anderen überlegen ist. Sie soll allerdings frühestens im nächsten Jahr in die Apotheken kommen.
Auch vom anderen Ende der Welt droht Konkurrenz. Der japanische Arzneihersteller Daiichi Sankyo arbeitet ebenfalls an einem Gerinnungshemmer. Dass das Mittel den Markt noch später erreicht, scheint Europa-Geschäftsführer Reinhard Bauer wenig anzufechten. »Wir haben uns bewusst Zeit gelassen«, sagt der Deutsche, der vorher lange bei Bayer gearbeitet hat. »Am Ende kommt es auf die Qualität an«, sagt er selbstsicher.
Die Zeit, als sich Deutschland Apotheke der Welt nannte, scheint endgültig vorüber. Doch so ärgerlich die Konkurrenz für Bayer und Boehringer ist, so sehr profitieren Patienten wie Lieselotte Bettermann, wenn sie zu besseren Pillen führt.
Natürlich nur, wenn sie sie auch einnehmen. Von Jutta Hoffritz