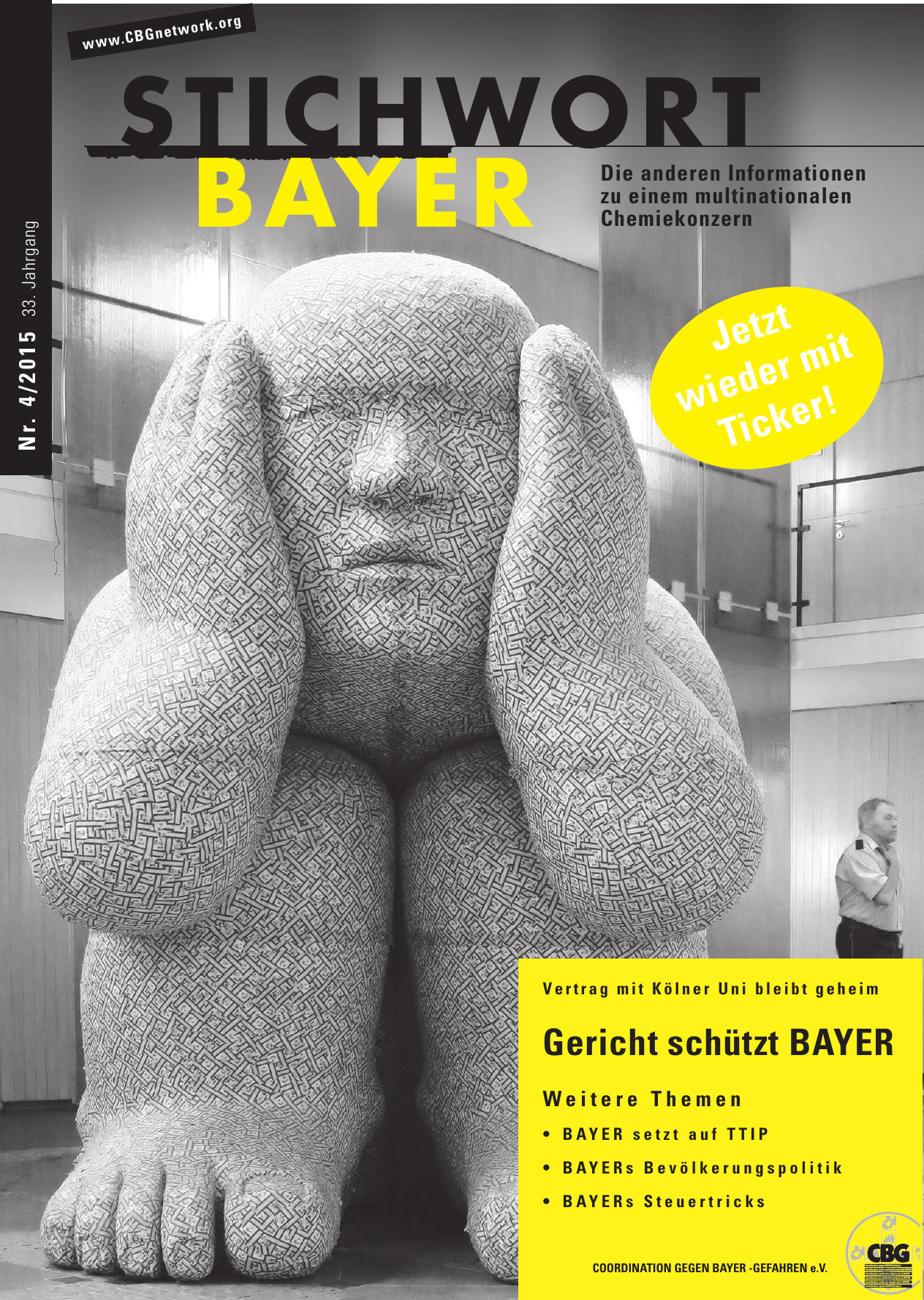Kontrazeptiva als „Entwicklungshilfe“
BAYERs Bevölkerungspolitik
„Weniger Arme statt weniger Armut“ – so lautet seit einiger Zeit die Devise der Entwicklungszusammenarbeit. Die Projekte versuchen vermehrt, die Menschen der „Dritten Welt“ dazu zu bewegen, weniger Kinder in die Welt zu setzen. Als Mittel der Wahl gelten den BevölkerungspolitikerInnen dabei besondere in der „Ersten Welt“ oft gar nicht erhältliche Kontrazeptiva. Ausgesprochen gern greifen sie auf das Implantat JADELLE von BAYER zurück. Den Leverkusener Multi erfreut diese „Entwicklungshilfe“ deshalb immens: Sie verhilft ihm zu Millionen-Gewinnen.
Von Dr. Susanne Schultz und Dr. Daniel Bendix
Bevölkerungspolitik ist offiziell zurück auf der Agenda. Nicht nur als verstecktes Beiwerk unter dem Obertitel „sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte“, sondern als eigenständiges Handlungsfeld der Entwicklungszusammenarbeit (EZ). Bevölkerungsentwicklungen sollen als ursächlicher Faktor für fast alle Problemlagen herhalten, als Erklärung für ökonomische Krisen oder als Bedingung für wirtschaftliche „Chancen“. Reagiert wird vor allem mit „Familienplanung“ und der Verbreitung von „modernen“ Verhütungsmitteln. 2012 hatten sich internationale Organisationen, Regierungen, Privatwirtschaft und Nichtregierungsorganisationen (NRO) in London zu einem „Familienplanungsgipfel“ getroffen. Das daraus entstandene Gremium FP2020 (Family Planning 2020) stellt diese Politik-Ausrichtung folgendermaßen dar: „Familienplanung ist essentiell für Gesundheit, Freiheit und Wohlstand. Wir wissen, dass Familienplanung Frauen empowert und Gesundheit verbessert, aber wir wissen auch, dass es unzählige Auswirkungen quer durch die Gesellschaft hat. Familienplanung spielt eine zentrale Rolle für Armutsreduzierung, nachhaltige Entwicklung, Wirtschaftswachstum, Geschlechter-Gleichheit, soziale Inklusion und Umweltschutz.“
Ziel von FP2020 ist es, innerhalb von acht Jahren zusätzliche 120 Millionen Menschen im Globalen Süden Zugang zu Verhütungsmitteln zu verschaffen. In der Öffentlichkeit wurde vor allem das „JADELLE Access Program“ als großer Erfolg des Treffens präsentiert – eine Initiative der Bill & Melinda Gates Stiftung, des deutschen Pharmaunternehmens BAYER HEALTHCARE (Teilkonzern der BAYER AG) in Koordination mit der internationalen EZ. 27 Millionen Stück des von BAYER vertriebenen Verhütungsimplantats JADELLE (siehe Kasten) sollen über sechs Jahre hinweg für einen von 18 auf 8,50 US$ reduzierten Preis pro Implantat über die EZ-Programme verbreitet werden. Das „Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (BMZ) sieht sich beim Thema „Bevölkerungsdynamik“ als „europäischer Vorreiter“. Ganz explizit geht es bei „Bevölkerungsdynamik“ nicht mehr nur um die Größe nationaler Bevölkerungen, sondern auch um deren Zusammensetzung. Der Fokus liegt auf Altersproportionen und einer offenen Ökonomisierung von Bevölkerungsfragen.
Die feinen Unterschiede
Differenziert wird in den aktuellen Bevölkerungsprogrammen zwischen unterschiedlichen Kategorien von Ländern: Erstens gibt es die Länder, insbesondere in Afrika, bei denen die Geburtenrate immer noch als zu hoch definiert wird, weil sie der Norm einer „replacement fertility“ von 2,1 Kindern pro Frau entgegenstehe. Weiterhin gibt es die Übergangsländer. Sie verzeichnen einen Rückgang der Fertilitätsraten, lassen aber aufgrund großer Jugend-Populationen immer noch hohe Bevölkerungszuwächse erwarten, wobei ihre betagten Bevölkerungen noch nicht als Problem gelten. Man spricht von einem „demographischen Bonus“, weil der Anteil der Erwerbsfähigen hoch ist und deswegen ein „günstiges Abhängigkeitsverhältnis“ bestehe. Schließlich gibt es die „alternden“ Gesellschaften, wo die Zahl der Menschen im Rentenalter steigt, die der Erwerbsfähigen sinkt.
Prinzipiell gilt somit ein universaler Maßstab: Die nationale Altersproportion entscheidet darüber, ob eine antinatalistische oder pronatalistische Regierungspolitik angesagt ist, d. h. an welchen Schrauben Regierungsstrategien drehen sollen, um die Geburten-Raten zu steigern oder zu senken. Je nach den jeweiligen demografischen Zielen werden Konzepte von Rechten, Wünschen und Selbstbestimmung von Frauen (denn selbstverständlich propagieren die Programme nicht staatliche Repression, sondern weiterhin die Freiheit des Individuums), die Regierungen wahrnehmen, fördern und stärken sollen, völlig unterschiedlich gefasst. Und es werden unterschiedliche reproduktive Technologien in den Fokus gerückt und bereitgestellt, um „Einstellungs- und Verhaltensänderungen“ zu erreichen. Ob Frauen vor „ungewollter Kinderlosigkeit“ oder vor „ungewollten Schwangerschaften“ bzw. einem „ungedeckten Bedarf“ an Verhütungsmitteln geschützt werden sollen, ob reproduktive Rechte als Zugang zu Reproduktionsmedizin oder zu Verhütungsmitteln diskutiert werden, erscheint somit nicht als eine Frage von Rassismus, sondern als „bevölkerungsdynamische“ Feinabstimmung. Staatliche demografische Ziele einerseits und individuelle Selbstbestimmungsrechte andererseits werden dabei nicht als Gegensatz oder zumindest als spannungsreich präsentiert, angeblich verträgt sich beides vielmehr bestens und schafft eine win-win-Situation.
Verhütung um jeden Preis
Der Fokus auf die Bevölkerungsdynamik hat Auswirkungen auf die programmatische Ausrichtung des BMZ. Neben klassischen Schwerpunkten sollen nun auch Investitionen in den Aufbau von Melderegistern, Bevölkerungsstatistik und Datenerfassung an Bedeutung gewinnen. Außerdem ist ein starker Trend in Richtung „Familienplanung“ deutlich sichtbar. Die Entwicklungshilfe-Statistiken der OECD verzeichnen mit 14,2 Millionen € in 2013 für Familienplanung gegenüber 7,8 Millionen € im Jahr 2011 eine deutliche Zunahme von exklusiv auf Verhütungsprogramme abzielenden Maßnahmen.
Was die direkten Käufe von Verhütungsmitteln angeht, schwanken die deutschen Ausgaben, erreichten aber 2013 einen neuen Höchststand von 29 Mio. US$. Ungleichgewichte werden auch deutlich, wenn die gesamten Basisgesundheitsinvestitionen der deutschen EZ mit Bevölkerungsprogrammen verglichen werden. So standen etwa im Jahr 2012 den Ausgaben für Bevölkerungsprogramme in Höhe von 169 Millionen € lediglich 147 Mio. € für Basisgesundheitsversorgung gegenüber, wobei die Hälfte der Investitionen mit 83 Mio. € in afrikanische Länder ging.
Noch deutlicher als in Deutschland zeichnen sich die Trends auf internationaler Ebene ab. Der Weltbevölkerungsfonds UNFPA (von Deutschland mit jährlich über 20 Millionen US$ finanziert) und die US-Entwicklungsbehörde USAID verdoppelten ihre Ausgaben für Verhütungsmittel zwischen 2006 und 2012 jeweils fast – UNFPA von 74 auf 128 Millionen und USAID von 63 auf 105 Millionen US$. Laut UNFPA spiegelt sich dieser Trend auch in den Programmen der Empfängerländer wider: „Familienplanung ist zunehmend wieder eine Priorität auf der höchsten Ebene nationaler Politik, nationaler Pläne und Programme geworden. Immer mehr Regierungen von Entwicklungsländern investieren ihre eigenen Ressourcen in Verhütungsmittel“. Trotz aller Bekenntnisse zu integrierten gesundheitspolitischen Ansätzen scheint sich dabei die Schieflage zwischen Basisgesundheitsversorgung und den spezifischen Diensten der Familienplanung zu verstärken.
Erklärtes Ziel ist eine hohe „Contraceptive Prevalance Rate“ (CPR), also eine möglichst hohe Rate von Nutzerinnen moderner Verhütungsmethoden. Die CPR erscheint als selbsterklärende Messlatte für bevölkerungspolitische Erfolge. Dass es dabei nicht um die Anerkennung von Rechten geht, sondern um die Durchsetzung von Verhaltensänderungen, wurde erst jüngst in einer Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) deutlich. Die AutorInnen stellten fest, dass nicht ein ungedeckter Bedarf an Verhütungsmitteln, sondern ein zu hoher Kinderwunsch quer durch alle sozialen Schichten in vielen afrikanischen Ländern das Problem sei.
Lobby-Einfluss
Das Spektakel rund um das Erreichen der „Sieben-Milliarden-Marke“ im Jahr 2011 hatte erheblichen Anteil daran, dass der Schwerpunkt „Bevölkerungsdynamik“ dermaßen in den Vordergrund geriet. BMZ und Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) organisierten eine Kampagne anlässlich des von UNFPA ausgerufenen Weltbevölkerungstags – und zwar gemeinsam mit der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW). Die DSW wurde ebenso wie das eher als Think Tank fungierende Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung von Industriellen gegründet und wird von der Industrie (u.a. BAYER HealthCare) finanziert. Einem/r BMZ-VertreterIn zufolge haben beide Organisationen wesentlichen Anteil daran, wie das Paradigma der demografischen Dividende in die BMZ-Programmatik aufgenommen wurde und welche Studien und Daten rezipiert werden. GIZ und BMZ geben die DSW fast immer ausschließlich oder an erster Stelle an, wenn es um die Förderung oder Kooperation mit der Zivilgesellschaft geht. Die DSW ist sogar auf der höchsten Ebene internationaler Politik eingebunden. Ihre Vorsitzende Renate Bähr vertritt Deutschland in der „High Level Task Force“ der Vereinten Nationen für den Revisionsprozess 20 Jahre nach der UN-Weltbevölkerungskonferenz von Kairo.
Türöffner für neue Märkte
Der Markt für Verhütungsmittel belief sich 2009 auf 11,2 Milliarden US$, und soll bis 2016 auf 14,5 Milliarden US$ steigen. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von ca. vier Prozent. Marktführer sind BAYER (Jahresumsatz 3 Milliarden. US$), TEVAT (1,2 Milliarden US$) und MERCK & CO. (1 Milliarde US$). Auch der Markt in so genannten „Entwicklungsländern“ ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen, was Aufmerksamkeit und Investitionen angeht. 2014 konstatierte die „Reproductive Health Supplies Coalition“, die sich für Bereitstellung von Verhütungsmitteln engagiert, dass in den zurückliegenden fünf Jahren die EZ-Mittel für Kontrazeptiva um 50 Prozent auf 275 Millionen US$ gestiegen waren. Dies wurde vor allem durch erhöhte Investitionen in Implantate erreicht (ihr Anteil am Zuwachs betrug 68 Prozent). In Bezug auf das „Hilfsgeschäft“ mit Verhütungsmitteln sind UNFPA und USAID die größten Käufer. Sie decken ca. drei Viertel des Marktes ab.
Zwei deutsche Firmen – BAYER und HELM MEDICAL – gehören zu den großen Belieferern von UNFPA. Wenn die Geschäfte von BAYER OY (Sitz in Finnland, produziert JADELLE), BAYER HEALTHCARE (Sitz in Berlin, vermarktet JADELLE) und BAYER S. A. (Ecuador) zusammengerechnet werden, war der Leverkusener Multi 2012 und 2013 bei weitem das Unternehmen mit dem monetär größten Liefervolumen. , 2013 konnte der Konzern den UNFPA-Marktanteil nochmal deutlich steigern und liegt nun bei ca. 59 Millionen US$ oder 16 Prozent der gesamten UNFPA-Einkäufe. Vor allem der entwicklungspolitische Markt für Implantate ist in den letzten Jahren geradezu explodiert: Wurden im sogenannten Hilfsgeschäft der acht größten „Geber“ 2006 lediglich knapp über sieben Millionen US$ für Implantate ausgegeben, waren es 2012 mehr als zehnmal so viel. Zum Vergleich: Die Gesamtausgaben der EZ für Familienplanung sind in diesem Zeitraum um etwas mehr als 50 Prozent gestiegen.
BMZ setzt auf BAYER
Lange bevor BAYER, USAID und andere das „JADELLE Access Program“ etablierten und eine Abnahmegarantie zum vergünstigten Preis aushandelten , um 27 Millionen Frauen in den ärmsten Ländern der Welt damit zu beglücken, setzte das BMZ bereits einseitig auf das BAYER-Implantat: In Äthiopien finanzierte die „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ (KfW) zwischen 2003 und 2007 den Ankauf von 45.000 JADELLE-Implantaten für das Gesundheitsministerium. Und in Kenia stellte die KfW Geld für die „testweise“ Verbreitung von „Familienplanungs“-Gutscheinen zur Verfügung, die ausschließlich gegen ein JADELLE-Implantat, Spirale oder Sterilisationen eingelöst werden konnten (ausgegeben wurden über 25.000 Gutscheine). Auch in einem Handbuch für Jugendaufklärung in Simbabwe nennt die GIZ nur JADELLE als Beispiel für Implantate.
Neben Implantaten und oralen Kontrazeptiva ist BAYER im „Hilfsgeschäft“ noch mit Einmonatsspritzen (NORIGYNON), der „Minipille“ (MICROLUT) und der in vielen Ländern weit verbreiteten Dreimonatsspritze (NORISTERAT) vertreten. Bei Verhütungsspritzen dominiert allerdings DEPO-PROVERA von PFIZER deutlich den Markt. BAYER setzt nur ca. ein Zehntel der Menge von PFIZER ab, kommt aber im Rahmen von Familienplanungsprogrammen im Globalen Süden trotzdem noch auf 9,2 Millionen für seine Injektionen25.
Einen geben – zwei nehmen
Die zunehmende Fokussierung auf technologische Lösungen zur Verringerung des Bevölkerungswachstums ist keine konzertierte Aktion von EZ und Pharma-Business. Sie bereitet aber für die Pharma-Unternehmen ein extrem günstiges Geschäftsklima und lässt die Geldquellen sprudeln, mit denen sie Kontrazeptiva-Märkte dort ausweiten können, wo sie bisher als unrentabel galten. Denn die Budgets der Bevölkerungsprogramme fließen sowohl in den – per Vertrag über Jahre garantierten – Kauf der Mittel selber als auch in die Subventionierung des Marketings oder in Schulungen.
Ausgebaut und verfeinert werden diese Kooperationen im Rahmen verschiedener Modelle öffentlich-privater Partnerschaften, die auf einer zunehmend engeren Kooperation zwischen Privatsponsoren bzw. „philanthropischen“ Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen, Firmen und staatlichen EZ-Institutionen beruhen – frei nach dem Motto des Ex-BMZ-Ministers Dirk Niebel (2013): „Mit jedem Euro Entwicklungszusammenarbeit fließen langfristig zwei Euro zurück zu uns“.
Besonders besorgniserregend erscheint das derzeitige Stillschweigen – ganz im Unterschied zu den 1980er und 1990er Jahren, wo sich international vernetzte Frauengesundheits- und Menschenrechtsbewegungen mit der Beobachtung antinatalistischer Programme befassten und auch die Verhütungsmittelforschung und -verbreitung in den Blick nahmen. Heute gibt es keinen internationalen Austausch über den Boom der Implantate. Wie die Implantat-Märkte konkret erobert werden und was die Nutzerinnen dabei erleben, dazu gibt es keine Öffentlichkeit. Ebenso fehlt eine Diskussion und kritische Forschung dazu, welche Ungleichgewichte sich in der EZ zwischen Investitionen in Familienplanung und Basisgesundheitsversorgung entwickeln und wie sich die Etats zu reproduktiver Gesundheit ausgestalten.
Angst vor den Risiken
Wenn in den operationellen Expertisen der internationalen EZ doch die Skepsis oder der Widerstand derjenigen aufscheint, die die Nutzerinnen oder Käuferinnen der neuen Pharma-Produkte sein sollen, dann ist oft von den „demand side barriers“ die Rede, d. h. von den Gründen für eine als zu gering erachtete Nachfrage. Besonders aufschlussreich ist das Ergebnis einer Studie des Guttmacher Institute zur Frage, warum verheiratete Frauen mit einem „ungedeckten Bedarf“ an Verhütungsmitteln denn keine Verhütungsmittel nutzten. Die Antwort liest sich simpel: „Bedenken über Nebenwirkungen und gesundheitliche Auswirkungen der Methoden waren mit Abstand der meist genannte Grund“.
JADELLE
JADELLE, auch bekannt unter dem klinischen Namen NORPLANT II, ist eine Entwicklung des US-amerikanischen Think Tanks „Population Council“, der sich der Bevölkerungspolitik widmet. Das Präparat ermöglicht einen Empfängnisverhütungsschutz von bis zu fünf Jahren. Der Wirkstoff, das Hormon Levonorgestrel, entspricht dem des Vorgänger-Produkts NORPLANT I, das bereits in den 1980er Jahren getestet und in der Folge über die EZ verbreitet wurde (Bock von Wülfingen 2001). Der einzige Unterschied: Die MedizinerInnen führen bei dem JADELLE-Eingriff nur zwei statt sechs mit dem Hormon gefüllte Silikonröhrchen in den Oberarm ein. Deshalb gilt das Kontrazeptivum als
einfacher zu implantieren und zu entfernen, ohne gegenüber NORPLANT I an Effektivität einzubüßen. Allerdings führt das „Population Council“ selbst an, dass es bei 7,5 Prozent der Nutzerinnen zu Problemen bei der Entfernung kam, da sich das Gewebe um die Silikonstäbchen vernarbt hatte oder die Röhrchen im Körper umherwandern. Auch ist die Abbruchquote hoch, was mit den beträchtlichen Nebenwirkungen zu tun hat: Nach hauseigenen Studien des „Population Council“ (2013) lassen sich innerhalb von drei Jahren knapp 30 Prozent der Nutzerinnen das Implantat wegen Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Depressionen, Gewichtszunahme oder Haarausfall entfernen.29 Während eine international gut vernetzte Frauengesundheitsbewegung NORPLANT I unter Beobachtung stellte und es weltweit zu Protestkampagnen kam, die das Präparat als Inbegriff eines technischen Machbarkeitswahns bevölkerungspolitischer Strategien ablehnten, verläuft die Durchsetzung der neuen Methode heute im Stillen. Vergessen scheint auch zu sein, dass Ende der 1990er Jahre etwa 36.000 Klägerinnen in den USA von der damaligen Lizenzinhaberin von NORPLANT, dem Pharmaunternehmen WYETH AYERST, über 50 Millionen US$ als Kompensation für Gesundsschädigungen erhielten.
Zu den AutorInnen:
Dr. Susanne Schultz ist Mitarbeiterin des GEN-ETHISCHEN NETZWERKS in Berlin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Goethe-Universität Frankfurt.
Dr. Daniel Bendix ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet „Entwicklungspolitik und Postkoloniale Studien“ der Universität Kassel. Außerdem gehört er zum Team des Vereins glokal e. V. in Berlin.
Eine andere Version dieses Artikels ist bereits im Pharma-Brief Nr. 4-5, Mai/Juni 2015 erschienen.